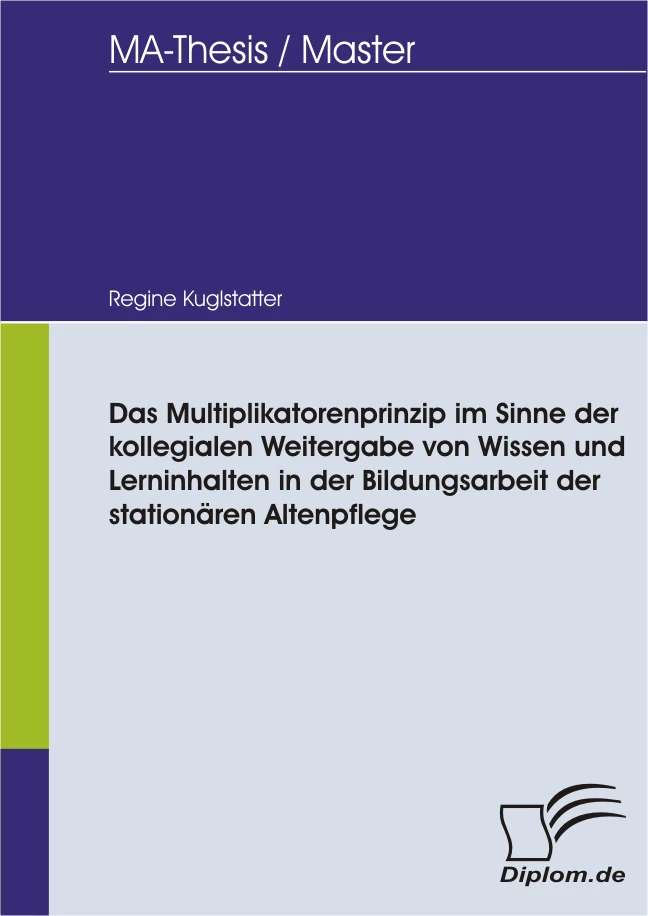Das Multiplikatorenprinzip im Sinne der kollegialen Weitergabe von Wissen und Lerninhalten in der Bildungsarbeit der stationären Altenpflege
Zusammenfassung
Technisierung, Globalisierung, Wettbewerb, Marktpositionierung - all dies sind populäre Schlagworte, welche regelmäßig durch die Medien geistern. In letzter Zeit treten sie vermehrt auf in Kombination mit ebenso eingängigen Begriffen wie lebenslanges Lernen, Informationsgesellschaft und abnehmende Halbwertzeit von Wissen. Dadurch verschiebt sich der Fokus von umfassend technisierten Arbeitsabläufen zugunsten maximaler Effizienz, Effektivität und Wirtschaftlichkeit auf den Personalbereich mit entsprechenden Qualifikationsanforderungen. Auf den Punkt gebracht geht es darum, dass Unternehmen möglichst wirksam, strategisch und kostengünstig in die berufliche Eignung ihrer Mitarbeiter investieren müssen, wenn sie dauerhaft am Markt bestehen wollen. Betriebliche Bildung wird also zunehmend als Wertschöpfungsfaktor betrachtet. In diesem Zusammenhang taucht immer wieder der Begriff Multiplikator auf. Bildungsinstitutionen werben entsprechend für ihre Angebote, z.B. VDAB-Multiplikatorenschulung - Die Knotenlösung für Ihre Pflegedokumentation, Multiplikator PR Unser Name ist unsere Mission oder Programm für lebenslanges Lernen Leonardo da Vinci Multiplikator für Oberbayern.
Es stellt sich die Frage, was in diesem Zusammenhang denn nun konkret unter einem Multiplikator zu verstehen ist, dessen ursprüngliche Bedeutung aus der Mathematik stammt als eine Zahl, mit der eine vorgegebene Zahl multipliziert wird. In einer weiteren Definition nach Duden bezieht sich der Begriff in der Bildungssprache auf eine Person, Einrichtung, die Wissen oder Information weitergibt und zu deren Verbreitung, Vervielfältigung beiträgt. In dieser Bedeutung findet der Terminus zumeist Verwendung in der Werbung, aber auch in sozialen und politischen Projekten. Dort spielen Multiplikatoren häufig eine zentrale Rolle zur Erreichung der gesteckten Ziele, welche gemeinhin darin bestehen, möglichst flächendeckend gesellschaftlich unerwünschte Strömungen zu unterbinden - z.B. Rassismus - oder bestimmte Verhaltensweisen zu fördern - z.B. die Verwendung von Kondomen zur HIV-Prävention. Geeignet für eine Tätigkeit als Multiplikator scheinen Personenkreise zu sein, welche über ausgeprägte Beziehungen zu den jeweiligen Zielgruppen verfügen. Dafür kommen im Regelfall entweder Personen mit pädagogischem oder sozialpädagogischem Hintergrund in Frage, welche mit der jeweiligen Zielgruppe regelmäßig in Interaktion treten, oder aber Zugehörige der […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Betriebliche Bildung und Ökonomie
2.1 Organisations- und Arbeitsstrukturen
2.2 Betriebliche Bildung
2.2.1 Aufgaben betrieblicher Bildung
2.2.2 Ziele der betrieblichen Bildung
2.2.3 Arten der betrieblichen Bildung
2.2.4 Transferproblematik
2.2.5 Einflussfaktoren für Transfererfolg
2.3 Informelles Lernen am Arbeitsplatz
2.4 Arbeitsplatznahes Lernen
2.5 Organisationales Lernen
2.5.1 Die erste Evolutionsstufe: Organisationsentwicklung
2.5.2 Die zweite Evolutionsstufe: Die lernende Organisation
2.5.3 Die dritte Evolutionsstufe: Wissensmanagement
2.5.4 Implizites Wissen
3 Multiplikatorenkonzepte als Option für die betriebliche Bildungsarbeit
3.1 Hierarchieorientierte Hauptströmungen
3.1.1 Exkurs Peer Learning
3.2 Implementierung des Multiplikatorenansatzes
3.2.1 Auswahl von Multiplikatoren
3.2.2 Betriebspädagogen
3.2.3 Direkte Vorgesetzte
3.2.4 Erfahrene Mitarbeiter
3.3 Externe Dozenten versus Multiplikatoren
4 Erwachsenenpädagogische Grundsätze
4.1 Grundsätze für Lehrende
4.2 Grundsätze für den Betrieb
5 Die stationäre Altenpflege
5.1 Ökonomische und finanzielle Rahmenbedingungen
5.2 Besonderheiten sozialer Dienstleistungen
5.3 Anforderungen an Pflegeheime als Arbeitgeber
5.4 Der Beruf der Altenpflege
5.4.1 Aufgaben der Altenpflege
5.4.2 Belastungen in der Altenpflege
5.4.3 Teamarbeit als Organisationsprinzip
5.4.4 Auswirkungen von Teamarbeit auf Entwicklungspotenziale
5.4.5 Lernen als Teamprozess
5.5 Weiterbildungsinhalte in der Altenpflege
5.6 Betriebliche Weiterbildung in Pflegeheimen
5.7 Der Multiplikatorenansatz in der Altenpflege
5.7.1 Potenzielle Inhalte für den Multiplikatorenansatz
5.7.1.1 Weitergabe von Fachinformationen
5.7.1.2 Weitergabe von Wissen
5.7.1.3 Weitergabe von Fortbildungsinhalten
5.8 Qualifizierung betrieblicher Multiplikatoren
5.8.1 Rollen und Rahmenbedingungen
5.9 Potenzielle Multiplikatoren in der Altenpflege
5.9.1 Pflegefachkräfte als Multiplikatoren
5.9.2 Praxisanleiter als Multiplikatoren
5.9.3 Vorgesetze als Multiplikatoren
5.9.4 Bewertung des Multiplikatorenansatzes
6 Schlusswort
7 Literaturverzeichnis
8 Eidesstattliche Erklärung
1 Einleitung
Technisierung, Globalisierung, Wettbewerb, Marktpositionierung – all dies sind populäre Schlagworte, welche regelmäßig durch die Medien geistern. In letzter Zeit treten sie vermehrt auf in Kombination mit ebenso eingängigen Begriffen wie „lebenslanges Lernen“, „Informationsgesellschaft“ und „abnehmende Halbwertzeit von Wissen“. Dadurch verschiebt sich der Fokus von umfassend technisierten Arbeitsabläufen zugunsten maximaler Effizienz, Effektivität und Wirtschaftlichkeit auf den Personalbereich mit entsprechenden Qualifikationsanforderungen. Auf den Punkt gebracht geht es darum, dass Unternehmen möglichst wirksam, strategisch und kostengünstig in die berufliche Eignung ihrer Mitarbeiter investieren müssen, wenn sie dauerhaft am Markt bestehen wollen. Betriebliche Bildung wird also zunehmend als Wertschöpfungsfaktor betrachtet. In diesem Zusammenhang taucht immer wieder der Begriff „Multiplikator“ auf. Bildungsinstitutionen werben entsprechend für ihre Angebote, z.B. „VDAB-Multiplikatorenschulung – Die Knotenlösung für Ihre Pflegedokumentation“, „Multiplikator PR – Unser Name ist unsere Mission“ oder „Programm für lebenslanges Lernen – Leonardo da Vinci Multiplikator für Oberbayern“.
Es stellt sich die Frage, was in diesem Zusammenhang denn nun konkret unter einem Multiplikator zu verstehen ist, dessen ursprüngliche Bedeutung aus der Mathematik stammt als „eine Zahl, mit der eine vorgegebene Zahl multipliziert wird“. In einer weiteren Definition nach Duden bezieht sich der Begriff in der Bildungssprache auf eine „Person, Einrichtung, die Wissen oder Information weitergibt und zu deren Verbreitung, Vervielfältigung beiträgt“. In dieser Bedeutung findet der Terminus zumeist Verwendung in der Werbung, aber auch in sozialen und politischen Projekten. Dort spielen Multiplikatoren häufig eine zentrale Rolle zur Erreichung der gesteckten Ziele, welche gemeinhin darin bestehen, möglichst flächendeckend gesellschaftlich unerwünschte Strömungen zu unterbinden – z.B. Rassismus – oder bestimmte Verhaltensweisen zu fördern – z.B. die Verwendung von Kondomen zur HIV-Prävention. Geeignet für eine Tätigkeit als Multiplikator scheinen Personenkreise zu sein, welche über ausgeprägte Beziehungen zu den jeweiligen Zielgruppen verfügen. Dafür kommen im Regelfall entweder Personen mit pädagogischem oder sozialpädagogischem Hintergrund in Frage, welche mit der jeweiligen Zielgruppe regelmäßig in Interaktion treten, oder aber Zugehörige der jeweiligen Zielgruppe selbst. In der betrieblichen Bildungsarbeit scheint sich der Einsatz von Multiplikatoren auf professionelle Dozenten zu konzentrieren, welche aufgrund ihrer kontaktintensiven Tätigkeit und ihres pädagogischen Hintergrunds in der Lage sind, bestimmte Informationen, Wissensbestände und Einstellungen sowohl bei ihren Schülern als auch bei ihren Kollegen zu verbreiten. Auf der anderen Seite versprechen betriebliche Multiplikatorenausbildungen unterschiedlichster Couleur eine kostengünstige, hausinterne und arbeitsplatznahe Verbreitung von branchenrelevanten Kompetenzen durch entsprechend geschulte Mitarbeiter.
Die inflationäre Verwendung des Begriffs Multiplikator in Bildungszusammenhängen transportiert dabei das Versprechen einer raschen, flächendeckenden und wirksamen Verbreitung von Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Trotz vieler durchdachter und einleuchtender Einzelkonzeptionen entsteht der Eindruck, dass der Einsatz von Multiplikatoren gerne dazu gebraucht wird, unter primär ökonomischen Prämissen inhaltsreduzierte Qualifizierungslösungen auf Kosten umfassender Weiterbildungen einzuführen. Eine derartige Herangehensweise erneuert den herkömmlichen Antagonismus zwischen der allgemeinen Erwachsenenbildung als Möglichkeit zur Persönlichkeitsentwicklung und der beruflichen Bildung als zweckmäßiger Dressur von menschlichem Material zur Erfüllung von Arbeitsanforderungen. Dieser Umstand hat mich dazu veranlasst, der Frage nachzugehen, wo und wie Multiplikatoren auf sinnvolle Art und Weise in der betrieblichen Weiterbildung eingesetzt werden können. Der Schwerpunkt dieser Arbeit wird auf die kollegiale Weitergabe von Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten innerhalb einer Organisation gelegt, die Rolle außerbetrieblicher professioneller Dozenten als Bildungsmultiplikatoren wird hierbei bewusst ausgeklammert. Gemäß der Definition des Dudens sind Kollegen – ungeachtet ihres jeweiligen Ranges – als beim selben Arbeitgeber beschäftigte, berufstätige Menschen zu verstehen, so dass eine kollegiale Wissensmultiplikation aus unterschiedlichen Positionen heraus erfolgen kann und nicht an eine bestimmte Hierarchie gebunden ist. Grundvoraussetzung dafür ist die Annahme, dass ein Unternehmen Interesse an der Weiterentwicklung und Lernfähigkeit seiner Mitarbeiter hat.
Aus diesem Grund wird in der vorliegenden Arbeit zunächst die betriebliche Bildungsarbeit in ihren Grundsätzen, Zielen und Umsetzungsformen erläutert und welche Rahmenbedingungen und Organisationsstrukturen sich mehr oder weniger lernförderlich auf einzelne Mitarbeiter sowie einen gesamten Betrieb auswirken. Es werden Managementansätze zu Führungsstilen und Arbeitsgestaltung, Maßnahmen zur Entwicklung einer lernförderlichen Umgebung sowie erwachsenenpädagogische Erwägungen zur praxistauglichen Gestaltung von beruflichen Lernmöglichkeiten vorgestellt. Anschließend werden in Ermangelung eindeutiger Konzepte die Hauptströmungen des Multiplikatorenansatzes erörtert und welche Mitarbeitergruppen sich generell für eine Multiplikatorentätigkeit eignen. Um ihren konkreten Nutzen für die betriebliche Weiterbildung untersuchen zu können, werden sie am Beispiel der stationären Altenpflege mit ihren Besonderheiten als soziale Dienstleistung, berufsspezifischen Fort- und Weiterbildungsschwerpunkten, Arbeitsorganisation und ökonomischen Rahmenbedingungen überprüft. Daraus soll abgeleitet werden, auf welchen Ebenen Multiplikatorenkonzepte in einer Organisation sinnvoll Anwendung finden können, für welche Lerninhalte der Einsatz von Multiplikatoren überhaupt angebracht ist, bis zu welchem Grad dadurch herkömmliche Fortbildungen möglicherweise ersetzt oder ergänzt werden können und welche Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Implementierung notwendig sind.
Herangezogene Bezugswissenschaften sind neben Erwachsenenbildung und Berufspädagogik Arbeitswissenschaft, Arbeitspsychologie, Organisationspsychologie, Soziologie, Pflegewissenschaften und Betriebswirtschaft. Hierbei ist anzumerken, dass gerade Arbeitswissenschaft, Arbeitspsychologie und Organisationspsychologie sich vornehmlich mit industriellen und gewerblich-technischen Berufen befassen und die Sicht auf Dienstleistungsberufe sich weitgehend auf kaufmännisch-verwaltende Arbeitsfelder beschränkt. Die Soziologie wiederum beschäftigt sich hauptsächlich mit Pflegeberufen im Zusammenhang mit Krankenhäusern, weil die dort herrschenden hierarchischen und interprofessionellen Strukturen von besonderem soziologischem Interesse sind. Insofern lassen sich die Erkenntnisse dieser Wissenschaftsdisziplinen nur mit kritischem Blick auf die besondere Situation in stationären Altenpflegeeinrichtungen übertragen. Dennoch erscheint ihre Heranziehung sinnvoll, da sie sich mit dem berufstätigen Menschen in Auseinandersetzung mit seiner Arbeitswelt befassen.
Von einer Differenzierung zwischen den Termini „Fortbildung“ und „Weiterbildung“ wird in dieser Arbeit abgesehen, sie werden synonym als Bezeichnung für organisierte betriebliche Bildungsmaßnahmen verwendet. Berufsqualifizierende Ausbildung und Umschulung werden dabei ausgeschlossen. Ebenso wird der besseren Lesbarkeit halber auf eine genderspezifische Sprache verzichtet, männliche Wortformen beziehen das weibliche Geschlecht selbstverständlich mit ein.
Übersetzungen englischer Quellen ins Deutsche wurden von der Verfasserin selbst vorgenommen.
2 Betriebliche Bildung und Ökonomie
Jeder Betrieb und jedes Wirtschaftsunternehmen ist eine Organisation und somit ein
„…soziales Gebilde, das bestimmte Ziele verfolgt und formale Regelungen aufweist, mit deren Hilfe die unter die Mitgliedschaftsbedingungen fallenden Aktivitäten der Mitglieder auf diese Ziele ausgerichtet werden sollen.“ (Scholl S. 409)
Primäre Absicht aller Wirtschaftsunternehmen ist die Sicherung der eigenen Existenz und das Erzielen von Gewinnen. Neben diesen rein betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten erfüllen sie jedoch auch eine volkswirtschaftliche und gesellschaftliche Funktion: Sie bieten Menschen Arbeitsplätze (vgl. Severing 2005 S. 3f). Arbeit wiederum besteht in der Regel darin, Produkte oder Dienstleistungen für den Konsum anderer herzustellen, und unterliegt dem Ökonomieprinzip. Dieses versucht das Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag zu optimieren, und entsprechende Maßnahmen – so auch die betriebliche Bildungsarbeit – werden als Rationalisierung bezeichnet. Damit diese Optimierungsmaßnahmen nicht in Inhumanität abgleiten, besteht das Anliegen der Arbeitswissenschaft darin, sowohl Arbeit effektiv und effizient zu gestalten als auch den Bedürfnissen der beschäftigten Menschen gerecht zu werden (vgl. Schlick / Bruder / Luczak S. 6f). Rationalisierung und Humanisierung von Arbeit sind folglich die zwei elementaren Zielsetzungen der Arbeitswissenschaft.
2.1 Organisations- und Arbeitsstrukturen
Diesem Ansatz liegt das Verständnis zugrunde, dass menschenwürdige Arbeitsbedingungen zu mehr Effizienz und Effektivität führen (vgl. Schlick / Bruder / Luczak S. 6f). Unter humanen Bedingungen verstehen sich Strukturen und Abläufe, welche einerseits die Gesundheit nicht schädigen, das Wohlbefinden nicht dauerhaft beeinträchtigen, den Bedürfnissen und Qualifikationen der Arbeitnehmer entsprechen, eine Einflussnahme auf die Arbeitsbedingungen zulassen und zur Persönlichkeitsentwicklung hinsichtlich der Potentialentfaltung und Kompetenzerweiterung beitragen (vgl. Schüpbach S. 170).
Möchte man Arbeitsprozesse gleichzeitig human und lernförderlich gestalten, so empfiehlt sich nach Bergmann die Abschaffung tayloristischer Strukturen, welche sich durch extreme Zerstückelung von Handlungsabläufen, Monotonie und der Trennung von Hand- und Kopfarbeit auszeichnen (vgl. Greif S. 38). Sie sollen abgelöst werden durch die Einführung ganzheitlicher Arbeitsaufgaben mit entsprechender Anforderungsvielfalt, Interaktionsmöglichkeiten und ausreichenden Tätigkeitsspielräumen sowie Partizipation und Mitarbeiterbeteiligung auf unterschiedlichen Ebenen (vgl. Bartels S. 112ff). In der Theorie hat sich dieses Organisationsprinzip als anerkannte Managementstrategie durchgesetzt, kommt freilich noch lange nicht in allen Berufszweigen und Arbeitsbereichen zum praktischen Einsatz (vgl. ebd. S. 35). Das Beharren auf alten Denkstrukturen steht im krassen Gegensatz zu der Entwicklung, dass in weiten Teilen unserer heutigen Arbeitswelt Personal nicht mehr beliebig ersetzbar ist und als wichtigster strategischer Erfolgsfaktor gepflegt und bewirtschaftet werden muss (vgl. Klaus S. 141): Man spricht von Investitionen in Humankapital (vgl. Weiß / Falk / Dziobaka-Spitzhorn S. 54).
"Wenn daher auch oder gerade lernende Organisationen ihren Mitarbeitern Gutes tun, so tun sie es, weil es nach ökonomischen Prinzipien für den Erfolg funktiona l (kursiv im Original, d. Verf.) ist..." (Warhanek S. 82)
2.2 Betriebliche Bildung
Der Optimierungsbedarf für Unternehmen hat in den letzten Jahrzehnten erheblich zugenommen, da sich aufgrund wachsender Globalisierung und rasanter Fortschritte in Technik und Wissen der Wettbewerb verschärft. Zeitgleich verbreiten sich sogenannte schlankere Betriebsorganisationen in immer mehr Branchen, wodurch die anfallenden Aufgaben auf immer weniger Personal verteilt werden und deswegen in vielen Arbeitsbereichen für die einzelnen Mitarbeiter Aufgabenspektrum und -intensität massiv zugenommen haben. Folglich steigen die Anforderungen an individuelle Lernanstrengungen (vgl. Bartels S. 91), und der Erwerb umfassender neuer Fähigkeiten und Kenntnisse lässt sich nicht mehr en passant erledigen (vgl. Severing 1994 S. 15ff).
„Der dynamische technologische und gesellschaftliche Wandel übt einen verstärkten Anpassungsdruck auf Unternehmen und einen Bildungs- wie Qualifizierungsdruck auf deren Mitarbeiter aus.“ (Fredersdorf / Glasmacher S. 222)
Im Gegensatz zu früher führt der Besuch von Weiterbildungen heutzutage nicht mehr quasi automatisch zu einem Karriereschritt oder einer Gehaltserhöhung. Berufliche Weiterqualifizierung ist mittlerweile unabdingbar für die Beschäftigungsfähigkeit von Menschen – ihre sogenannte Employability – und damit ihre individuelle Zukunft. Umgekehrt hängt jedoch auch die Überlebensfähigkeit von Organisationen von den Bildungsaktivitäten ihrer Mitarbeiter ab (vgl. Karg S. 7). Der Deutsche Bildungsrat definiert berufliche Weiterbildung im Rahmen institutionalisierter Lernprozesse als
„Fortsetzung oder Wiederaufnahme organisierten Lernens nach Abschluss einer unterschiedlich ausgedehnten ersten Ausbildungsphase.“ (zit. n. Deutscher Bildungsrat 1970 in Karg S. 15)
In welchem Ausmaß ein Unternehmen in die Bildungsarbeit und Kompetenzentwicklung seiner Mitarbeiter investieren kann, will und muss, ist neben Branchenzugehörigkeit und ökonomischer Weitsichtigkeit abhängig von der wirtschaftlichen Lage (vgl. Lutz S. 7). Tatsächlich hat es sich erwiesen, dass ein fest verankertes Weiterbildungssystem sowohl die Teilnahme an formalen Bildungsangeboten als auch die Motivation für informelle berufliche Bildungsprozesse erhöht. Eine umfassende Implementierung und Systematisierung von Weiterbildung wird vor allem in Großbetrieben mit 1000 oder mehr Mitarbeitern realisiert. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass in vielen kleinen und mittelständischen Betrieben keine strategische Bildungsarbeit stattfindet (vgl. Fredersdorf / Glasmacher S. 225).
2.2.1 Aufgaben betrieblicher Bildung
Üblicherweise konzentriert sich die betriebliche Bildungsarbeit auf Planung, Durchführung und Bewertung des Transfererfolgs von Bildungsmaßnahmen (vgl. Weiß / Falk / Dziobaka-Spitzhorn S. 4ff). Sie versteht sich als Instrument der strategieorientierten Personalentwicklung, welches auf die bedarfsorientierte und effektive Formung und Optimierung personaler Ressourcen abzielt (vgl. Fredersdorf / Glasmacher S. 221f). Die Differenz zwischen Ist-Qualifikationen und Soll-Anforderungen ist das Segment, aus dem sich der konkrete Personalentwicklungsbedarf ableiten lässt. Bei der Bildungsplanung dominiert dabei oft eine technikgläubige Defizitorientierung – kann ein Mitarbeiter Arbeitsanforderungen nicht ausreichend erfüllen, muss er „nachgebessert“ werden (vgl. Geißler S. 205). Gelingt dies nicht, muss unter ökonomischen Gesichtspunkten
“…berufliche Bildung, ‚die nicht in produktive Tätigkeit umgesetzt werden kann’, als ‚Fehlinvestition’ bewertet (werden)...“ (zit. n. Meyer-Dohm 1990 in Heid S. 40)
Die klassische betriebliche Bildungsarbeit wurde in den letzten Jahren durch das sogenannte Bildungsmanagement erweitert, welches die herkömmlichen Kernaufgaben um die Dimensionen Bedarfsermittlung, Kostenermittlung und pädagogische Evaluation ergänzt (vgl. Weiß / Falk / Dziobaka-Spitzhorn S. 4ff). In diesem Konzept müssen bei der Bedarfsanalyse und Planung neben den Umwelt- und Marktbedingungen sowie den finanziellen und personalen Ressourcen auch die Bildungsphilosophie der Organisation und die Ziele der Mitarbeiter berücksichtigt werden (vgl. Fredersdorf / Glasmacher S. 221f).
2.2.2 Ziele der betrieblichen Bildung
Betriebliche Weiterbildung zielt darauf ab, die Mitarbeiter so zu qualifizieren, dass sie den Arbeitsanforderungen gewachsen sind. Dabei geht es in erster Linie um Aufrechterhaltung und Marktpositionierung des Betriebes. Wie Maschinen gewartet und aufgerüstet werden müssen, um dem neuesten Stand der Technik und der Produktionsverfahren zu entsprechen, so müssen Mitarbeiter qualifiziert werden, wenn Marktumstände oder Betriebsverfahren es erfordern. Darüber hinaus sind auch personalpolitische Ziele zu verfolgen: Neben der Qualifikation der Mitarbeiter werden im Sinne ökonomischer Wertschöpfungsbestrebungen Kompetenzförderung, Steigerung der Leistungsfähigkeit und Produktivität sowie die Förderung von Arbeitsmotivation und Arbeitszufriedenheit angestrebt (vgl. Lenske / Werner S. 3f). Es hat sich gezeigt, dass
„…persönlichkeitsförderliche Arbeitsgestaltung untrennbar verbunden ist mit Massnahmen (Orthographie im Original, d. Verf.) vorauslaufender oder begleitender Qualifizierung.“ (Ulich 1994 S. 337)
Weiterhin muss betriebliche Bildungsarbeit immer mehr organisatorische Veränderungen und betriebliche Restrukturierungsprozesse begleiten (vgl. Kühnlein S. 21). Eine Verschlankung der Führungsebene beispielsweise stellt vollkommen neue Anforderungen an die Beschäftigten und erfordert neben rein fachlichen Qualifikationen zunehmend mehr Autonomie und entsprechende Schlüsselkompetenzen (vgl. Karg S. 22). Solch grundlegende Umwälzungen stellen altbekannte Sichtweisen und Verhaltensmuster auf den Kopf und müssen systematisch unterstützt werden. Deswegen benötigt die betriebliche Bildungspraxis eine Ergänzung ihrer primär ökonomischen Orientierung durch eine betriebspädagogische Perspektive. Ganz im Sinne humaner Arbeitsbedingungen kann sie somit den Anspruch erheben, nicht nur zur funktionalen Qualifizierung von Mitarbeitern, sondern auch zur Entwicklung und Entfaltung ihrer Persönlichkeit beitragen zu können (vgl. Severing 1994 S. 21).
„Entwicklung bedeutet dabei nicht nur, was seit jeher von Weiterbildung erwartet wird, nämlich … vertikale Entwicklung, Aufstieg und Karriere, sondern Entwicklung hat auch … eine horizontale Dimension, und Entwicklung hat über die betriebliche Position einer Person hinaus die Dimension der allgemeinen Persönlichkeitsbildung.“ (Bartels S. 109)
Anzustrebende Lernziele können sich folglich nicht mehr auf kognitive Kenntnisse oder sensumotorische Fertigkeiten beschränken, sondern müssen affektive Ziele mit einbeziehen – der emotionale Bereich eines Menschen ist maßgeblich verantwortlich für die Veränderung von Einstellungen und Werten (vgl. Karg S. 11).
2.2.3 Arten der betrieblichen Bildung
Die jeweiligen Ziele betrieblicher Bildungsarbeit wirken sich konsequenterweise auf die Fortbildungsarten aus. Die klassische betriebliche Weiterbildung konzentriert sich in erster Linie auf organisierte Lernformen, welche – entweder hausextern oder hausintern organisiert – im Regelfall als Seminare, Lehrgänge, Trainings oder Vorträge stattfinden. Sie lassen sich in vier Zieldimensionen einteilen:
- Erhaltungsweiterbildung zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit des Personals unter tendenziell gleichbleibenden Arbeitsbedingungen.
- Ergänzungsweiterbildung zum Erwerb zusätzlicher Kenntnisse und Fertigkeiten, welche für die Erledigung der täglichen Arbeitsanforderungen nicht unbedingt notwendig sind.
- Anpassungsweiterbildung zur Entwicklung von Kenntnissen und Fertigkeiten wegen stattgefundener Veränderungen und/oder neuen Anforderungen am Arbeitsplatz.
- Aufstiegsweiterbildung zur Karriereförderung (vgl. Severing 2005 S. 7).
Die Inhalte betrieblicher Weiterbildung wiederum können analog berufsbildender Kompetenzkonzepte in Fach-, Methoden-, Sozial- und personale Kompetenz aufgegliedert werden. Dabei lässt sich eine Schwerpunktverlagerung von der ehemals weitgehend ausschließlichen Konzentration auf Fachkompetenzen feststellen h in zu einer zunehmenden Bedeutung der „weicheren“ Kompetenzformen (vgl. Dick et al. S. 5). Unterschiedliche Weiterbildungstypen streben Lernprozesse entweder für Einzelpersonen, für ganze Teams bzw. Abteilungen oder für bestimmte Funktionsgruppen an (vgl. Warhanek S. 74ff).
2.2.4 Transferproblematik
Aus ökonomischer Sicht bedingt der Erfolg von Bildungsmaßnahmen die Existenzberechtigung betrieblicher Bildungsarbeit. Aber auch aus pädagogischer Sicht besteht das zentrale Anliegen der Weiterbildung darin, dass Gelerntes fruchtbringend in die Arbeitspraxis einfließt. Dieser sogenannte Lerntransfer ist der
„…psychosoziale … Prozeß der Übertragung, Verallgemeinerung oder Anwendung von Gelerntem aus einer Lernsituation in eine Arbeitssituation.“ (Faulstich S. 193)
Optimalerweise sind Mitarbeiter durch den Besuch von Veranstaltungen in der Lage, Arbeitsanforderungen besser, kompetenter und professioneller zu bewältigen. Eine Weiterbildung gilt dann als erfolgreich, wenn die dort stattgefundenen Veränderungen in Wissen und Verhalten sich auch im Arbeitsfeld auswirken, die Investition sich also gelohnt hat (vgl. ebd. S. 194). In der Realität stellt sich oftmals heraus, dass die Lerninhalte im Arbeitsprozess nicht angewendet werden. Das
„…Transferproblem ist also eine Grundfrage organisierten Lehrens und Lernens.“ (Faulstich S. 193)
Man spricht generell von vier verschiedenen Transfereffekten: Horizontaler Transfer bedeutet den Einsatz neu erlernter Kompetenzen am Arbeitsplatz, vertikaler Transfer ist die Optimierung individueller Kompetenzen durch eine Weiterbildung, beim Null-Transfer kommen neue Kompetenzen bei Aufrechterhaltung alter Verhaltensweisen überhaupt nicht zum Zug, und ein negativer Transfer tritt dann auf, wenn neue Kompetenzen eingesetzt werden, sich aber im Arbeitsfeld wegen falscher Anwendung oder Nicht-Einsetzbarkeit als unpassend erweisen (vgl. ebd. S. 195).
Bevor jedoch die Transferfrage gestellt werden kann, muss der Lernerfolg hinterfragt werden, denn ohne ihn kann auch kein Praxistransfer stattfinden. Doch bereits hier stößt die Evaluationsforschung an ihre Grenzen: Sobald es sich beim Lernziel nicht mehr um leicht abprüfbares Faktenwissen handelt – welches auch nicht zwangsläufig in die Praxis umgesetzt werden muss – sondern beispielsweise um Verhaltensänderungen, wird eine aussagekräftige und finanzierbare Lernerfolgskontrolle schwierig (vgl. Weiß / Falk / Dziobaka-Spitzhorn S. 74).
„Ein zentrales Problem für die betriebliche Weiterbildung stellt der Umstand dar, dass Lernen und die praktische Anwendung des Gelernten nicht automatisch zusammenfallen (Transferproblematik). Vor allem Standardseminare sind von dieser Problematik betroffen, wenn sie undifferenziert als Allheilmittel für aufgetretene Schwierigkeiten aufgefasst werden.“ (Severing 2005 S. 33)
Eine weitere Problematik systematischer Bildungsarbeit besteht darin, dass eindeutige Kosten-Nutzen-Rechnungen kaum plausibel herstellbar sind (vgl. Fredersdorf / Glasmacher S. 254). Dies kann zu Problemen bei der Rechenschaftslegung über Bildungsausgaben führen, wenn für das Management nur kurzfristige Return-on-Investment-Gleichungen relevant sind. Im schlechtesten Falle werden unrentable Weiterbildungsangebote einfach gestrichen.
Gleichwohl würde es zu kurz greifen, die Verantwortung für das Gelingen von Lerntransfer ausschließlich an der Qualität eines Seminars hinsichtlich seiner Inhalte, der Methoden und des Lehrenden festzumachen (vgl. Karg S. 11ff). Es gibt mindestens drei weitere Einflussfaktoren für Transfererfolg: den Betrieb als soziale Organisation mit seiner jeweiligen Unterstützung durch Kollegen und Vorgesetzte, transferförderliche oder transferhinderliche Rahmenbedingungen sowie das Individuum mit seinen Anlagen, Interessen und Motivationen (vgl. Karg S. 74ff).
2.2.5 Einflussfaktoren für Transfererfolg
Menschen arbeiten immer in einem sozialen System, welches bestimmte Verhaltensweisen unterstützt oder blockiert. Arbeitspsychologische Untersuchungen haben ergeben, dass ein Arbeitsergebnis nicht nur von den ausführenden Einzelpersonen abhängt, sondern von den in der Gruppe vorherrschenden sozialen Normen mitbestimmt ist (vgl. Ulich 1994 S. 37). Ein gutes Organisationsklima hat folglich nicht nur positiven Einfluss auf Arbeitsergebnisse, sondern auch auf den Transfer von Lerninhalten. Unterstützendes Verhalten von Seiten der Vorgesetzten ist dabei essentiell (vgl. Holling / Liepmann S. 308): Desinteresse oder aktives Ausbremsen aus Angst vor Kompetenzverlust wird die meisten noch so motivierten Mitarbeiter daran hindern, neu Gelerntes in der Praxis anzuwenden (vgl. Faulstich S. 199).
Eine zentrale Führungsaufgabe besteht folglich darin, zunächst die Potenziale der Mitarbeiter zu erkennen und zu unterstützen. Die Mitwirkung von direkten Vorgesetzten bei der Bedarfsanalyse als Grundlage der Bildungsplanung ist unabdingbar (vgl. Fredersdorf / Glasmacher S. 228), um das althergebrachte Gießkannenprinzip der betrieblichen Weiterbildung durch passgenaue Maßnahmen zu ersetzen (vgl. Weiß / Falk / Dziobaka-Spitzhorn S. 4ff). Nach Besuch einer Fortbildung sollte mit dem Mitarbeiter konkret besprochen werden, inwieweit sie sich gelohnt hat und welche Anteile in den Arbeitsalltag transferiert werden können (vgl. ebd. S. 27). Soweit es der Führungskraft möglich ist, müssen Rahmenbedingungen möglichst transferförderlich gestaltet werden. Erweiterte Zeitkorridore für das Üben und Umsetzen von Neuem sowie der Austausch über Erfolge und Misserfolge sind unerlässlich für die Implementierung neuer Arbeitspraktiken. Zu guter Letzt darf es auch kein Tabu sein, soziale Konstellationen zu hinterfragen und gegebenenfalls zu verändern (vgl. Faulstich S. 198f). Über dieses soziale Element hinaus kann nicht im Vornherein fehlerfrei bestimmt werden, was genau der einzelne Mitarbeiter aus einer Fortbildung mitnehmen wird. Man kann,
„…wenn man nicht auf den Lehrlernkurzschluß zurückfallen will, nicht unterstellen, daß das, was nach Maßgabe der Organisation gelernt werden soll, und das, was die Individuen tatsächlich lernen, übereinstimmt.“ (Faulstich S. 129)
Um gar ein widerwilliges Lernen zu verhindern, sollten Lehrziele der Organisation mit den Lernzielen der Mitarbeiter in Einklang gebracht werden. Auch wenn es selbstverständlich legitim ist, dass ein Unternehmen seine strategische Ausrichtung als Grundlage für die Bildungsplanung heranzieht, ist den Mitarbeitern durch adäquate Kommunikationsformen und Arbeitsbedingungen die Möglichkeit zu bieten, eigene Bildungsbedarfe einzubringen (vgl. ebd. S. 123). Wünschenswert für betriebliche Bildung wäre also eine
„…’Annäherung des ökonomisch Möglichen an das pädagogisch Nötige’…“ (zit. n. Arnold / Lipsmeier 1995 in Geißler S. 210)
Es ist folglich bis zu einem gewissen Grad durchaus möglich, den Transfererfolg von Lernprozessen positiv zu beeinflussen. Betriebliches Lernen findet indes nicht nur in organisierten Fortbildungen statt, sondern ein Großteil ergibt sich aus den unterschiedlichen Formen des informellen und häufig unbewussten und unbeabsichtigten Lernens.
2.3 Informelles Lernen am Arbeitsplatz
Viele Berufspraktiker haben den Eindruck, dass sie ihre Qualifikation in erster Linie während ihrer Berufstätigkeit erworben haben (vgl. Kloas S. 334f). Dabei spielt unter anderem das Phänomen eine Rolle, dass j eder arbeitstätige Mensch eine entsprechende berufliche Sozialisation erfährt. Diese lässt sich verstehen als
„…’Prozeß des Aneignens von Fähigkeiten, Kenntnissen, Motiven, Orientierungen und Deutungsmustern, die in der Arbeitstätigkeit eingesetzt werden können’…“ (zit. n. Heinz 1980 in Semmer / Udris S. 155)
Im Rahmen dieser Berufssozialisation werden viele Qualifikationen durch learning by doing transportiert und verinnerlicht. Über Modelllernen werden durch Nachahmen Verhaltensweisen eingeübt und verfestigt, und Handlungen erfahrener Kollegen werden in gemeinsamen Arbeitsprozessen häufig unbewusst kopiert (vgl. Holling / Liepmann S. 293ff). In den letzten Jahren haben diese informellen Lernprozesse immer mehr Beachtung gefunden und werden verstanden als
„…Lernen in und über Erfahrungen …, wobei die Erfahrungen in Reflexionen und bewusste Lernfortschritte einmünden oder auch als sinnliche Wahrnehmungen implizit und unbewusst zu Lernprozessen führen.“ (zit. n. Dehnbostel in Gollian S. 2)
Informelles Lernen am Arbeitsplatz ist somit eine nicht zu unterschätzende Komponente der beruflichen Bildung, welche unerlässlich ist, sich aber aufgrund ihrer Beiläufigkeit der gezielten Einflussnahme weitgehend entzieht (vgl. Baethge-Kinsky S. 33). Als Konzept ist es durchaus plausibel und nachvollziehbar, doch in jüngster Zeit hat sich rund um diesen Begriff eine beachtliche Zahl von Fachtermini angesammelt, welche zu einiger Verwirrung führen: „Selbstorganisiertes Lernen“, „Selbstverantwortliches Lernen“ und „Selbstgesteuertes Lernen“ werden ohne klare Definition unter „Lernen am Arbeitsplatz“ subsummiert (vgl. Leber S. 16f). Vielfach werden darunter EDV-gestützte Lernprogramme verstanden, die trotz eindeutiger Beschränkungen in ihren Einsatzmöglichkeiten durchaus ihre Berechtigung haben und berufsqualifizierende Möglichkeiten mithilfe moderner Technologien erweitern (vgl. Kühnlein S. 52f). In etlichen Unternehmen zeichnet sich jedoch die Tendenz ab, diese Ansätze dahingehend zu interpretieren, dass vermehrte persönliche und private Weiterbildungsbereitschaft der Mitarbeiter als Ersatz für betrieblich organisiertes Lernen gefordert werden kann. Unter dem Deckmantel pädagogischer Konzepte wird die Verantwortung für berufliche Weiterqualifizierung dem Personal selbst zugeschoben (vgl. Lenske / Werner S. 16). Dreh- und Angelpunkt dieser Entwicklung ist der Umstand, dass hohe Einsparungen auf dem Sektor der betrieblichen Mitarbeiterqualifikation erhofft werden.
„Die Vermutung liegt nahe, dass Kostenargumente bei der Favorisierung arbeitsnaher Lernformen eine weitaus größere Rolle spielen, als nach außen hin demonstriert.“ (zit. n. Schiersmann / Remmele2002 in Schilcher S. 227)
2.4 Arbeitsplatznahes Lernen
Die Renaissance des Lernens am Arbeitsplatz ist jedoch nicht nur Sparmaßnahmen geschuldet, denn als pädagogischer Ansatz bietet es durchaus eine Reihe von Vorteilen: Es besteht ein direkter Praxisbezug und es herrschen reale Rahmenbedingungen vor; die Freistellung für Seminare entfällt und es müssen weniger organisatorische Probleme gelöst werden. Man vermutet auch größere Transfersicherheit, Lernen findet kontinuierlich statt und überdies werden Schlüsselqualifikationen anhand von Selbstlernkompetenzen gefördert (vgl. Severing 2005 S. 39 und S. 87). Gerade An- und Ungelernte haben häufig aufgrund negativer schulischer Erfahrungen erhebliche Berührungsängste mit Weiterbildungen in klassischer Seminarform. Arbeitsplatznahes Lernen kann dabei helfen, diese Hemmschwellen abzubauen (vgl. Severing 1994 S. 63). Verglichen mit herkömmlichen Seminaren verspricht die arbeitsplatznahe Qualifizierung mehr
„…Aktualität und Flexibilität, einen stärkeren Anwendungsbezug, raschere Verwertbarkeit und somit eine enge Verzahnung von Arbeits- und Lernprozessen.“ (Kühnlein S. 20)
Gleichwohl ist nicht geklärt, ob pädagogisch wertvolles Lernen am Arbeitsplatz womöglich aufwendiger ist als Lernen in einem zentralen Setting. Unterschiedliche Modellversuche haben gezeigt, dass meist nur dann positive Resultate erzielt werden konnten, wenn die Mitarbeiter zusätzliche Unterstützung durch professionelle Trainer erhielten (vgl. Kühnlein S. 47). Auch diese Lernprozesse müssen pädagogisch begleitet werden, sie stellen sich nicht einfach von selbst ein (vgl. Severing 1994 S. 61ff), zumal keineswegs Klarheit darüber besteht, mit welchen Methoden welche Qualifikationen zustande kommen (vgl. Severing 1996 S. 7). Weiterhin sind angemessene Rahmenbedingungen vonnöten, damit Lernen am Arbeitsplatz erfolgreich sein kann. Neben einer entsprechenden Ausstattung mit geeigneten Lernmitteln sowie ausgewiesenen Lernzeiten ohne Unterbrechungen bedarf es einer betrieblichen Lernkultur (vgl. Karg S. 32), in der Lernen und die Anwendung des Gelernten ausdrücklich erwünscht ist und unterstützt wird. Die Frage, wie also Prozesse und Strukturen umgestaltet werden müssen, bleibt von Betrieben gerne unbeantwortet (vgl. Bartels S. 91). Wird aber die Implementierung notwendiger Rahmenbedingungen missachtet, kann arbeitsplatznahe Weiterbildung
„…die schnelle Vermittlung von Handlangerqualifikationen umschreiben. Methodisch reduzierte Anpassungsqualifikationen stehen in Gegensatz zu pädagogisch-didaktischen Konzepten der Verbindung von Arbeiten und Lernen.“ (Severing 1996 S. 7)
Die klassischen Arten arbeitsplatznahen Lernens sind neben dem Modelllernen das Ausprobieren sowie die Unterweisung durch Kollegen, Vorgesetzte oder außerbetriebliche Personen, z.B. im Rahmen der Beistelllehre oder der 4-Stufen-Methode (vgl. Severing 2005 S. 62ff). Neben diesen aus dem Handwerk stammenden traditionellen Lernformen existieren weitere Ansätze arbeitsplatznahen Lernens, welche über den reinen Kenntniserwerb hinaus auf Flexibilisierung, Wissensaustausch oder Partizipation abzielen (vgl. Bungard / Herbert Antoni S. 383ff). Sie lassen sich nur schwer in eindeutige Kategorien einteilen und voneinander abgrenzen (vgl. Karg S. 15) und umfassen handlungsorientierte Weiterbildungskonzepte wie Projektlernen, gruppenorientierte Maßnahmen wie Qualitätszirkel, Lerninseln oder Job-Rotation sowie unterschiedliche Formen der Selbstqualifikation am Arbeitsplatz (vgl. Severing 2005 S. 62).
Ihnen liegt die Idee zugrunde, dass d as Wesen einer Organisation nicht nur durch die individuellen Interaktionen ihrer einzelnen Mitarbeiter gekennzeichnet ist, sondern in erheblichem Maße aus spezifischen strukturellen Erfordernissen und Einflüssen besteht (vgl. Holling / Müller S. 54).
2.5 Organisationales Lernen
Lernen innerhalb von Betrieben findet in diesem Sinne nicht nur personenbezogen, sondern auch innerhalb von Teams sowie auf der Ebene gesamter Organisationen statt und erstreckt sich auf die Dimensionen kognitives, kulturbezogenes oder verhaltensorientiertes Lernen (vgl. Geithner / Krüger / Pawlowsky S. 404f). Wenn umfassende Lern- und Veränderungsprozesse in einem Unternehmen angestoßen werden sollen, erscheint es ratsam, alle drei Ebenen mit einzubeziehen. Unterschiedliche Organisationstheorien beschäftigen sich deswegen mit organisationalem Lernen als Wettbewerbsfaktor und Überlebensstrategie (vgl. Holling / Müller S. 67). In der einschlägigen Managementliteratur ist eine mehrstufige Evolution zu beobachten – zuerst war Organisationsentwicklung en vogue, dann war die Lernende Organisation der letzte Schrei, und der aktuellen Weisheit letzter Schluss scheint derzeit das Wissensmanagement zu sein.
Allen drei Ansätzen ist gemeinsam, dass sie keine einheitlichen Definitionen vorweisen und es mit ihrer Hilfe gelingen soll, Organisationen nicht nur am Leben zu halten, sondern zu Höchstleistungen zu beflügeln. Aufgrund fehlender empirischer Fundierung (vgl. Holling / Müller S. 67) und konzeptioneller Oberflächlichkeiten können diese Heilsversprechen jedoch nicht so ohne weiteres eingelöst werden. Im schlechtesten Sinne sind sie nichts anderes als leere Worthülsen die vorgaukeln, dass ein gesamtes Unternehmen mit wenigen strategischen Knopfdrucken transformiert werden kann. Trotzdem sind sie aufgrund ihres Zweifachanspruchs an Produktivität und Humanisierung für die betriebliche Weiterbildung von Interesse, da sie die Grundlage für eine geeignete Bildungsstrategie bieten können (vgl. Geißler S. 208).
2.5.1 Die erste Evolutionsstufe: Organisationsentwicklung
Organisationsentwicklung bezieht sich auf Veränderungen im gesamten Betrieb. Klassischerweise verfolgt sie sowohl die Steigerung der Produktivität als auch die Humanisierung der Arbeit durch Personalentwicklung im Rahmen ideeller Ansprüche wie beispielsweise der Entfaltung des Einzelnen (vgl. Geißler S. 205). Personalentwicklung umfasst dabei jede systematische Intervention zur Ausbildung und Erhaltung bzw. Ausweitung der Berufsqualifikation, welche neben den für die Bewältigung der Arbeitsanforderungen notwendigen Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten auch Motivation, Interessen und Einstellungen umfasst. Sie setzt im Regelfall am Individuum an (vgl. Holling / Liepmann S. 286), und betriebliche Bildung ist eine ihrer klassischen Maßnahmen. Organisations- und Personalentwicklung sind eng miteinander verflochten und können nicht klar getrennt werden.
Über individuelle Rationalisierungsmaßnahmen hinaus will Organisationsentwicklung durch angemessene Arbeits-, Führungs- und Kooperationsformen die Effizienz und Hingabe, das sogenannte Commitment, der Mitarbeiter steigern. Zusätzlich wird eine umfassende Flexibilität, Lern- und Erneuerungsbereitschaft der gesamten Organisation angestrebt (vgl. Gebert S. 481). Ein typisches Beispiel für Organisationsentwicklung ist die Umstellung eines Unternehmens von Fließbandarbeit auf autonome Gruppenfertigung. Dieser Prozessumstellung liegt der Gedanke zugrunde, dass das Arbeitsprinzip Teamarbeit von der Arbeitswissenschaft als diejenige Form der Organisation beschrieben wird, welche den menschlichen Bedürfnissen an Arbeitsabläufe am meisten entgegenkommt und deswegen die besten Ergebnisse bringt. Eine derartige Umwälzung herkömmlicher Organisationsstrukturen bedarf umfassender materieller Maßnahmen bezüglich der technischen und räumlichen Ausstattung sowie der fachlichen Qualifikation der einzelnen Mitarbeiter. Darüber hinaus ist ein komplettes Umdenken von Mitarbeitern und Vorgesetzten vonnöten, da sie einen neuen Führungsstil erfordert: Anstelle von Befehl und Kontrolle besteht nun die Hauptaufgabe von Vorgesetzten in der Anregung, Unterstützung und Förderung ihrer Mitarbeiter – die Führungskraft wird zum Coach des Personals (vgl. Ulich 1994 S. 49ff). Dieser Umschwung stellt althergebrachte Denkstrukturen auf den Kopf und setzt ein neues Menschenbild voraus, nach dem Mitarbeiter nicht nur nach den monetären Ergebnissen der Arbeit trachten, sondern auch nach Verantwortung, Autonomie und Selbstverwirklichung (vgl. Holling / Müller S. 57). Sicherlich ist zunächst nicht jeder Vorgesetzte für diese Kehrtwende bereit und bedarf gezielter Entwicklungsunterstützung, denn gerade die mittlere Führungsebene hat erheblichen Einfluss darauf, wie Prozesse vor Ort umstrukturiert werden können, inwieweit Mitarbeiter tatsächlich an Entscheidungen partizipieren können und wie Teamarbeit geregelt wird (vgl. Kühnlein S. 26f).
Zusammenfassend bezieht sich Organisationsentwicklung auf die Veränderung von Mensch, Aufgaben, Struktur und Technologie (vgl. Gebert S. 481).
2.5.2 Die zweite Evolutionsstufe: Die lernende Organisation
Das der Organisationsentwicklung nachfolgende Modell der Lernenden Organisation versteht ein Unternehmen als Organismus, welcher sich durch eine Art ihm innewohnender Intelligenz und Lernfähigkeit gegen zukünftige Herausforderungen wappnen kann. Im besten Sinne meint dieser Begriff ein Unternehmen mit einer hierarchieübergreifenden Lern- und Fehlerkultur: Alle Mitarbeiter gehen im Interesse des Betriebes konstruktiv mit neuen Herausforderungen um, zusätzlich wird nicht davor zurückgescheut, erforderliche Umstrukturierungen vorzunehmen (vgl. Kühnlein S. 24). Diese Unternehmen sind dann
„…Organisationen, die die Lernprozesse ihrer Mitglieder unterstützen und permanente Veränderungsprozesse durchlaufen. Lernenden Organisationen liegt eine Kultur zu Grunde, die die Individuen dazu ermutigt zu lernen und ihr Potenzial zu entfalten.“ (Mandl / Winkler S. 89)
Folgende Stufen des Lernerfolges werden dabei differenziert: Das Single-loop-learning (oder Anpassungslernen) als Lerndimension fachlichen Wissens und Könnens im Rahmen der gegebenen Arbeitsbedingungen, das Double-loop-learning (oder Veränderungslernen) als Lerndimension der Methoden- und Sozialkompetenz, bei dem eingefahrene Handlungsweisen hinterfragt und verändert werden, und das Deutero-learning (oder Lernen lernen) als Lerndimension der emotionalen bzw. Selbstkompetenz, welches die organisationalen Rahmenbedingungen hinsichtlich ihrer Lernförderlichkeit kritisch beurteilt (vgl. Geißler S. 214 und vgl. Geithner / Krüger / Pawlowsky S. 406). Flächendeckendes Deutero-learning ist der Inbegriff der lernenden Organisation, da alle Mitarbeiter gemeinsam bestrebt sind, Arbeitsstrukturen nicht nur hinsichtlich der Erfüllung von Arbeitsanforderungen zu optimieren, sondern auch bezüglich der ihnen innewohnenden Innovations- und Lernmöglichkeiten.
Das Prinzip der Lernenden Organisation setzt ein Umdenken in der betrieblichen Bildungsarbeit voraus, damit kollektive Lernprozesse ermöglicht und unterstützt werden. So wie eine Gruppe nicht nur aus der Summe ihrer individuellen Mitglieder besteht, beschränkt sich die Problemlösefähigkeit eines Betriebes nicht auf Einzelpersonen mit ihrem Einzelwissen (vgl. Probst / Raub / Romhardt S. 21). Der Fokus betrieblicher Bildungsmaßnahmen liegt jedoch nach wie vor auf Angeboten des Single-loop-learning, also der Anpassung des Einzelnen an die Rahmenbedingungen der Organisation (vgl. Geithner / Krüger / Pawlowsky S. 407). Von Organisationsentwicklung oder gar lernender Organisation kann unter diesen Voraussetzungen jedoch kaum die Rede sein. Eine Organisation kann man sicherlich erst dann als lernend bezeichnen, wenn die darin beschäftigten Individuen nicht nur für sich lernen, sondern sich auch über Wissen und Lerninhalte austauschen.
2.5.3 Die dritte Evolutionsstufe: Wissensmanagement
Das sogenannte Wissensmanagement als vorläufig letzte Stufe organisationalen Lernens nimmt jüngst an Bedeutung für Unternehmen zu. Als Erweiterung zum Konzept der Lernenden Organisation besteht das Anliegen darin, im Unternehmen vorhandene individuelle und kollektive Wissensbestände transparent und möglichst vielen Mitarbeitern zugänglich zu machen. Dies soll verhindern, dass durch Personalfluktuation Wissen im Sinne sogenannter immaterieller Vermögenswerte für die Organisation verloren geht (vgl. Probst / Raub / Romhardt S. 18f). Durch den Erhalt betriebsinternen Wissens verspricht man sich einen Wettbewerbsvorteil am Markt, eine Erleichterung des Schnittstellenmanagements zwischen einzelnen Betriebsbereichen sowie die Förderung betriebsinterner Innovationsbereitschaft (vgl. Karg S. 23ff). Wissensmanagement bedeutet also
„…den bewussten, verantwortungsvollen und systematischen Umgang mit der Ressource Wissen und den zielgerichteten Einsatz von Wissen in Organisationen … (nicht als) Selbstzweck, sondern … als Grundlage zur Optimierung bereits bestehender Geschäftsprozesse.“ (vgl. Mandl / Winkler S. 3)
Im Rahmen der Wissensmanagementdiskussion wird generell unterschieden zwischen Daten, Informationen und Wissen. Daten sind zunächst dokumentierte Zeichen in Sprache oder Zahlen ohne eigene Bedeutung. Erst wenn sie in einem bestimmten Kontext relevant sind, werden sie zu Informationen. Informationen wiederum sind aber zunächst nur eine Aussage über einen Sachverhalt und müssen erst vernetzt und in einen zusätzlichen Zusammenhang gebracht werden, damit daraus Wissen erwachsen kann (vgl. Schilcher S. 22f). Information ist folglich nicht gleichzusetzen mit Wissen, und die unreflektierte Übernahme von Informationen birgt die Gefahr einer neuen
„…Dummheit auf hohem Niveau…“ (Schilcher S. 72)
Wissen hingegen ist bedingt durch die Fähigkeit, neue Informationen zu nutzen und in Entscheidungsprozesse und Handlungsweisen zu integrieren (vgl. Probst / Raub / Romhardt S. 17). Hier liegt ein zentrales Problem der Ansätze zum Wissensmanagement: Es sind vor allem EDV-gestützte Medien, welche als Wissensverteiler genutzt werden. Dadurch wird zentral gespeichertes Wissen zwar möglichst vielen Mitarbeitern eröffnet, die tatsächliche Verarbeitung und Anwendung bleibt jedoch dem Einzelnen überlassen (vgl. Karg S. 28ff). Wenn nach Mandl Wissen das Vermögen zur effektiven Handlung bedeutet (vgl. Mandl / Winkler S. 1), entzieht sich der entscheidende Vorgang der Reflexion und Vernetzung vollständig dem Einfluss des Unternehmens, und die Generierung von echtem Wissen muss in Frage gestellt werden.
Eine weitere Grundschwierigkeit in der Wissensmanagementdebatte ist die Unterscheidung zwischen explizitem und implizitem Wissen (vgl. Schilcher S. 19). Explizit ist dasjenige Wissen, welches sich formal ausdrücken lässt und
„…’problemlos von einem Menschen zum anderen weitergegeben werden’ kann…“ (zit. n. Nonaka / Takeuchi 1997 in Schilcher S. 19)
2.5.4 Implizites Wissen
Implizites Wissen dahingegen lässt sich schwer in formale Begriffe fassen und ist gekoppelt an individuelle Erfahrungen, Emotionen und Einstellungen. Es wird auch häufig als Erfahrungswissen oder „tacit skills“ bezeichnet (vgl. Schilcher S. 19). Zusammen mit fundiertem Fachwissen als objektive Größe sind es die subjektiven Erfahrungswerte und das daraus erwachsende situative Gespür, welche zu hervorragenden Leistungen führen (vgl. ebd. S. 74). Gerade die impliziten Wissensbestände machen also das Expertentum eines Mitarbeiters aus und sind deswegen für die Organisation von besonderem Interesse (vgl. Mandl / Winkler S. 2). Ebenso haben sie einen hohen Stellenwert für die Kooperation innerhalb von Arbeitsteams (vgl. Meifert S. 274). Die Schwierigkeit besteht jedoch in der Explikation impliziten Wissens (vgl. Schilcher S. 119), da es oft unbewusst und deswegen schwer kommunizierbar ist, so
„…’dass wir mehr wissen, als wir zu sagen wissen’ oder ’dass wir von Dingen wissen, und zwar von wichtigen Dingen wissen, ohne dass wir dieses Wissen in Worte fassen können’.“ (zit. n. Polanyi 1985 in Meifert S. 273)
Möchte man implizites Wissen verbreiten, muss sich der Wissensträger zunächst überhaupt darüber bewusst werden. Sollte dieser Schritt gelingen, bedarf es zusätzlich der Fähigkeit, eigenes Wissen anderen zugänglich zu machen (vgl. Kühnlein S. 50). Wissen ist demzufolge keine Ware, die umstandslos wie ein Paket von Mensch zu Mensch weitergegeben werden kann (vgl. Mandl / Winkler S. 1). Die möglichst flächendeckende Verbreitung und Erhaltung von Wissensbeständen indessen ist Dreh- und Angelpunkt des Wissensmanagements.
[...]
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2012
- ISBN (eBook)
- 9783842830462
- DOI
- 10.3239/9783842830462
- Dateigröße
- 562 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau – Zentrum für Fernstudien, Studiengang Erwachsenenbildung
- Erscheinungsdatum
- 2012 (April)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- multiplikatorenprinzip betriebliche bildung stationäre altenpflege organisationales lernen wissensmultiplikation
- Produktsicherheit
- Diplom.de