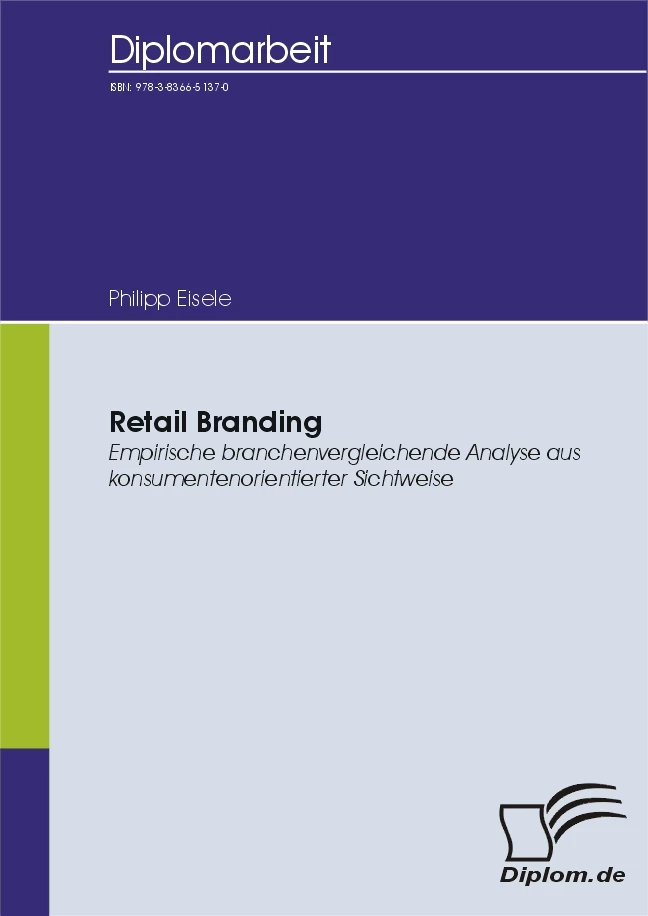Retail Branding
Empirische branchenvergleichende Analyse aus konsumentenorientierter Sichtweise
©2006
Diplomarbeit
86 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Die aktuelle Marktsituation des Handels in Deutschland ist durch stagnierende Umsätze, zunehmende Marktsättigung und einen drastischen Verdrängungswettbewerb charakterisiert. Aus diesen Entwicklungen resultieren Konzentrationstendenzen sowie eine wachsenden Bedeutung der Internationalisierung der Absatzmärkte. Als Paradebeispiel ist der Lebensmitteleinzelhandel zu nennen.
So stieg der Marktanteil der zehn größten Unternehmen in Deutschland von 45% im Jahre 1990 auf 84% Ende 2002. Tengelmann, Rewe, Aldi und Lidl konnten zudem Auslandsumsatzanteile von über 30% verzeichnen. Die geschilderten Entwicklungen fordern und fördern ein eigenständiges operatives und strategisches Handelsmarketing. Einerseits wird die Differenzierung von der Konkurrenz zur Voraussetzung, um im Wettbewerb zu bestehen, denn der herrschende Preiswettbewerb sowie austauschbare Leistungsangebote führen zu einem Profilierungsdefizit. Andererseits ermöglichen die finanziellen, technischen und personellen Ressourcen der Marktführer den Einsatz aller notwendigen Marketinginstrumente.
Die Markenpolitik hat in diesem Zusammenhang eine wesentliche Erweiterung erfahren. Als Marken werden nicht länger nur die Produkte der Hersteller verstanden, sondern darüber hinaus auch die Verkaufsstellen des Handels. Retail Branding ist eine Strategie, welche das Markenkonzept auf den Handel überträgt und somit die Markenpolitik eines Einzelhandelsunternehmens auf der Ebene seiner Verkaufsstellen.
In Folge dessen gewinnt der Handel auch in seiner Beziehung zur Industrie an Macht und emanzipiert sich vom Herstellermarketing. Ein Ziel des Handels ist hierbei die Schaffung einer prägnanten Markenpersönlichkeit und daraus resultierend eine Identifikation des Konsumenten mit der Verkaufsstelle. Damit schließt sich der Kreis zur Ursprungsform der Marke auf Verkaufsstellenebene, dem sog. Tante Emma-Laden, denn Tante Emma war einmalig und folglich unterschied sich ihr Laden, geprägt durch ihre Persönlichkeit, von allen anderen. Natürlich kann der Tante Emma-Laden nur als eine stark vereinfachende Metapher für das Markenphänomen im Handel dienen. Diese verdeutlicht jedoch, dass der Konsument und dessen Haltung zum Handelsunternehmen auch heute im Mittelpunkt der Überlegungen stehen muss, um eine leistungsfähige Retail Brand aufzubauen, d.h. die Verkaufsstelle als Marke zu profilieren.
Basierend auf der Erkenntnis, dass Retail Branding der Schlüssel zum Konsumenten sein […]
Die aktuelle Marktsituation des Handels in Deutschland ist durch stagnierende Umsätze, zunehmende Marktsättigung und einen drastischen Verdrängungswettbewerb charakterisiert. Aus diesen Entwicklungen resultieren Konzentrationstendenzen sowie eine wachsenden Bedeutung der Internationalisierung der Absatzmärkte. Als Paradebeispiel ist der Lebensmitteleinzelhandel zu nennen.
So stieg der Marktanteil der zehn größten Unternehmen in Deutschland von 45% im Jahre 1990 auf 84% Ende 2002. Tengelmann, Rewe, Aldi und Lidl konnten zudem Auslandsumsatzanteile von über 30% verzeichnen. Die geschilderten Entwicklungen fordern und fördern ein eigenständiges operatives und strategisches Handelsmarketing. Einerseits wird die Differenzierung von der Konkurrenz zur Voraussetzung, um im Wettbewerb zu bestehen, denn der herrschende Preiswettbewerb sowie austauschbare Leistungsangebote führen zu einem Profilierungsdefizit. Andererseits ermöglichen die finanziellen, technischen und personellen Ressourcen der Marktführer den Einsatz aller notwendigen Marketinginstrumente.
Die Markenpolitik hat in diesem Zusammenhang eine wesentliche Erweiterung erfahren. Als Marken werden nicht länger nur die Produkte der Hersteller verstanden, sondern darüber hinaus auch die Verkaufsstellen des Handels. Retail Branding ist eine Strategie, welche das Markenkonzept auf den Handel überträgt und somit die Markenpolitik eines Einzelhandelsunternehmens auf der Ebene seiner Verkaufsstellen.
In Folge dessen gewinnt der Handel auch in seiner Beziehung zur Industrie an Macht und emanzipiert sich vom Herstellermarketing. Ein Ziel des Handels ist hierbei die Schaffung einer prägnanten Markenpersönlichkeit und daraus resultierend eine Identifikation des Konsumenten mit der Verkaufsstelle. Damit schließt sich der Kreis zur Ursprungsform der Marke auf Verkaufsstellenebene, dem sog. Tante Emma-Laden, denn Tante Emma war einmalig und folglich unterschied sich ihr Laden, geprägt durch ihre Persönlichkeit, von allen anderen. Natürlich kann der Tante Emma-Laden nur als eine stark vereinfachende Metapher für das Markenphänomen im Handel dienen. Diese verdeutlicht jedoch, dass der Konsument und dessen Haltung zum Handelsunternehmen auch heute im Mittelpunkt der Überlegungen stehen muss, um eine leistungsfähige Retail Brand aufzubauen, d.h. die Verkaufsstelle als Marke zu profilieren.
Basierend auf der Erkenntnis, dass Retail Branding der Schlüssel zum Konsumenten sein […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Philipp Eisele
Retail Branding
Empirische branchenvergleichende Analyse aus konsumentenorientierter Sichtweise
ISBN: 978-3-8366-0137-5
Druck Diplomica® GmbH, Hamburg, 2007
Zugl. Universität Trier, Trier, Deutschland, Diplomarbeit, 2006
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2007
Printed in Germany
I
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis ...I
Abkürzungsverzeichnis...III
Tabellenverzeichnis ...V
Abbildungsverzeichnis ... VII
1. Einleitung ... 1
1.1 Der Handel als Marke... 1
1.2 Zielsetzung und Gang der Untersuchung ... 2
2. Grundlagen ... 3
2.1 Definitorische Grundlagen und Abgrenzungen... 3
2.1.1 Begriff der Marke ... 3
2.1.2 Begriff der Retail Brand ... 6
2.2 Konzeptionelle Grundlagen... 9
2.2.1 Funktionen der Marke als Ansatzpunkte der Markenpolitik... 9
2.2.2 Markenwert und Markenbewertung ... 14
3. Theorie... 19
3.1 Bezugsrahmen des Retail Branding... 19
3.2 Bedeutung ausgewählter Marketinginstrumente für das Retail Branding... 20
3.2.1 Sortimentspolitik ... 20
3.2.2 Kommunikationspolitik... 22
3.2.3 Preispolitik... 22
3.2.4 Servicepolitik... 24
3.2.5 Conveniencepolitik... 25
3.2.6 Ladengestaltung... 25
3.3 Einkaufsmotive... 26
3.4 Wahrnehmung der Marketinginstrumente... 27
3.5 Markenwert der Retail Brand ... 28
3.6 Erfolg der Retail Brand... 31
II
4. Empirie...31
4.1 Konzeption der empirischen Untersuchung...31
4.1.1 Untersuchungshypothesen ...31
4.1.2 Untersuchungs- und Fragebogendesign...32
4.2 Ergebnisse der empirischen Untersuchung ...33
4.2.1 Einkaufsmotive ...33
4.2.2 Wahrnehmung der Marketinginstrumente ...38
4.2.2.1 Vorbemerkung ...38
4.2.2.2 Beurteilungsdimensionen der Handelsleistung...39
4.2.2.3 Fit der Marketinginstrumente...52
4.2.3 Markenwert ...54
4.2.3.1 Vorbemerkung ...54
4.2.3.2 Operationalisierung des Markenwerts ...54
4.2.3.3 Wahrnehmung der Marketinginstrumente und Markenwert...59
4.2.4 Erfolg ...63
5. Reflexion und Ausblick...65
Literaturverzeichnis...69
III
Abkürzungsverzeichnis
Abb. Abbildung
Abs. Absatz
ACR
Academy of Consumer Research
AMS
Academy of Marketing Science
allg.
allgemein, -e, -er, -es
Aufl. Auflage
Bd. Band
Bew. Bewertung
bspw. beispielsweise
bzw. beziehungsweise
ca. circa
d.h. das
heißt
dtv
Deutscher Taschenbuch Verlag
DUV
Deutscher Universitäts-Verlag GmbH
EDLP-Politik Every-Day-Low-Price-Politik
EHI EuroHandelsinstitut
ERD
European Retail Digest
FGM
Verlag der Fördergesellschaft Marketing e.V. an der
Ludwig-Maximilians-Universität München
GJ GeoJournal
HBR
Harvard Business Review
HILO-Politik High-Low-Promotional-Pricing-Politik
Hrsg. Herausgeber
H&M
Hennes und Mauritz
IJRDM
International Journal of Retail & Distribution Management
IMU
Institut für Marktorientierte Unternehmensführung
Universität Mannheim
IMR
International Marketing Review
i.S. im
Sinne
JCM
Journal of Consumer Marketing
JM
Journal of Marketing
JMR
Journal of Marketing Research
JMRS
Journal of the Market Research Society
JPBM
Journal of Product & Brand Management
JPSP
Journal of Personality and Social Psychology
JR
Journal of Retailing
Kap. Kapitel
IV
KPMG
Klynveld, Peat, Marwick und Goerdeler; Deutsche Treuhand-
Gesellschaft, Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
LEH Lebensmitteleinzelhandel
MarkenG Markengesetz
Marketing-ZfP
Marketing-Zeitschrift für Forschung und Praxis
MSA-Wert
Measure for Sampling Adequacy-Wert
n Anzahl
Nr. Nummer
o.Jg. ohne
Jahrgang
o.S. ohne
Seite
PoS Point-of-Sale
QJE
Quarterly Journal of Economics
S. Seite
s. siehe
s Standardabweichung
SB-Warenhäuser Selbstbedienungswarenhäuser
Sign. Signifikanz
s.o. siehe
oben
sog.
sogenannte, -n, -r, -s
SOR-Modell Stimulus-Organismus-Response-Modell
stand. standardisiert
Tab. Tabelle
TNS
Taylor Nelson Sofres Aktiengesellschaft
TU Technische
Universität
u.a. unter
anderem
UdK Berlin
Universität der Künste Berlin
v.a. vor
allem
vgl. vergleiche
vs. versus
W&V
Werben und Verkaufen, Europa-Fachpresse-Verlag GmbH
x arithmetisches
Mittel
Y&R
Young & Rubicam GmbH & Co. KG
z.B. zum
Beispiel
z.T. zum
Teil
V
Tabellenverzeichnis
Tab. 1: Operationalisierung der wirkungsbezogenen Markendefinition...6
Tab. 2: Retail Brand vs. Betriebstypenmarke...8
Tab. 3: Funktionen der Marke ...9
Tab. 4: Die stärksten Marken in Deutschland nach dem Y&R BrandAssetTM Valuator...14
Tab. 5: Darstellung der Untersuchungshypothesen...32
Tab. 6: Stichprobenbeschreibung nach Alter und Geschlecht...32
Tab. 7: Rang und Bewertung der individuellen Einkaufsmotive ...34
Tab. 8: Faktorenanalyse Beurteilungsdimensionen: alle Branchen...40
Tab. 9: Korrelationsanalyse der Beurteilungsdimensionen: alle Branchen...41
Tab. 10: Regressionsanalyse Pauschalbeurteilung: Beurteilungsdimensionen alle Branchen.41
Tab. 11: Faktorenanalyse Beurteilungsdimensionen: Bekleidung ...42
Tab. 12: Korrelationsanalyse der Beurteilungsdimensionen: Bekleidung ...43
Tab. 13: Regressionsanalyse Pauschalbeurteilung: Beurteilungsdimensionen Bekleidung...43
Tab. 14: Faktorenanalyse Beurteilungsdimensionen: Lebensmittel...44
Tab. 15: Korrelationsanalyse der Beurteilungsdimensionen: Lebensmittel...45
Tab. 16: Regressionsanalyse Pauschalbeurteilung: Beurteilungsdimensionen Lebensmittel ..45
Tab. 17: Faktorenanalyse Beurteilungsdimensionen: Möbel ...46
Tab. 18: Korrelationsanalyse der Beurteilungsdimensionen: Möbel ...46
Tab. 19: Regressionsanalyse Pauschalbeurteilung: Beurteilungsdimensionen Möbel...47
Tab. 20: Faktorenanalyse Beurteilungsdimensionen: Heimwerken...48
Tab. 21: Korrelationsanalyse der Beurteilungsdimensionen: Heimwerken ...48
Tab. 22: Regressionsanalyse Pauschalbeurteilung: Beurteilungsdimensionen Heimwerken ..49
Tab. 23: Regressionsanalyse Differenzierungskraft: Einkaufsempfinden Heimwerken...49
Tab. 24: Faktorenanalyse Beurteilungsdimensionen: Elektrowaren ...50
Tab. 25: Korrelationsanalyse der Beurteilungsdimensionen: Elektrowaren ...50
VI
Tab. 26: Regressionsanalyse Pauschalbeurteilung: Beurteilungsdimensionen Elektrowaren . 51
Tab. 27: Faktorenanalyse Fit-Faktor... 52
Tab. 28: Regressionsanalyse Pauschalbeurteilung: Fit-Faktor ... 53
Tab. 29: Faktorenanalyse: Dimensionen des Markenwerts ... 55
Tab. 30: Mittelwerte Indikatoren der Markenwertschätzung... 57
Tab. 31: Benefit-to-Store-Assoziationen ... 58
Tab. 32: Regressionsanalyse Markenwert: Beurteilungsdimensionen alle Branchen ... 60
Tab. 33: Regressionsanalyse Markenwert: Beurteilungsdimensionen Bekleidung... 60
Tab. 34: Regressionsanalyse Markenwert: Beurteilungsdimensionen Lebensmittel... 61
Tab. 35: Regressionsanalyse Markenwert: Beurteilungsdimensionen Heimwerken... 61
Tab. 36: Regressionsanalyse Markenwert: Beurteilungsdimensionen Elektrowaren... 62
Tab. 37: Regressionsanalyse Markenwert: Fit-Faktor ... 62
Tab. 38: Zusammenfassende Darstellung der Untersuchungsergebnisse ... 65
VII
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Fiktives semantisches Netzwerk für IKEA ...11
Abb. 2: Operationalisierung des Markenwerts nach Keller ...17
Abb. 3: Komponenten des Markeneisbergs nach Andresen...18
Abb. 4: Bezugsrahmen des Retail Branding aus konsumentenorientierter Sichtweise...19
Abb. 5: Indikatoren des Markenwerts der Retail Brand...30
Abb. 6: Soll/Ist-Radar: Bekleidung ...35
Abb. 7: Soll/Ist-Radar: Lebensmittel...36
Abb. 8: Soll/Ist-Radar: Möbel ...36
Abb. 9: Soll/Ist-Radar: Heimwerken...37
Abb. 10: Soll/Ist-Radar: Elektrowaren ...37
Abb. 11: Markenwertschätzung und -bekanntheit ausgewählter Retail Brands...56
1
1. Einleitung
1.1 Der Handel als Marke
Die aktuelle Marktsituation des Handels in Deutschland ist durch stagnierende Umsätze, zu-
nehmende Marktsättigung und einen drastischen Verdrängungswettbewerb charakterisiert.
1
Aus diesen Entwicklungen resultieren Konzentrationstendenzen sowie eine wachsenden Be-
deutung der Internationalisierung der Absatzmärkte.
2
Als Paradebeispiel ist der Lebensmittel-
einzelhandel zu nennen. So stieg der Marktanteil der zehn größten Unternehmen in Deutsch-
land von 45% im Jahre 1990 auf 84% Ende 2002. Tengelmann, Rewe, Aldi und Lidl konnten
zudem Auslandsumsatzanteile von über 30% verzeichnen.
3
Die geschilderten Entwicklungen
fordern und fördern ein eigenständiges operatives und strategisches Handelsmarketing. Einer-
seits wird die Differenzierung von der Konkurrenz zur Voraussetzung, um im Wettbewerb zu
bestehen, denn der herrschende Preiswettbewerb sowie austauschbare Leistungsangebote füh-
ren zu einem Profilierungsdefizit.
4
Andererseits ermöglichen die finanziellen, technischen und
personellen Ressourcen der Marktführer den Einsatz aller notwendigen Marketinginstrumen-
te.
5
Die Markenpolitik hat in diesem Zusammenhang eine wesentliche Erweiterung erfahren. Als
Marken werden nicht länger nur die Produkte der Hersteller verstanden, sondern darüber hin-
aus auch die Verkaufsstellen des Handels.
6
Retail Branding ist eine Strategie, welche das
Markenkonzept auf den Handel überträgt und somit ,,die Markenpolitik eines Einzelhandels-
unternehmens auf der Ebene seiner Verkaufsstellen".
7
In Folge dessen gewinnt der Handel
auch in seiner Beziehung zur Industrie an Macht und emanzipiert sich vom Herstellermarke-
ting.
8
Ein Ziel des Handels ist hierbei die Schaffung einer prägnanten Markenpersönlichkeit
und daraus resultierend eine Identifikation des Konsumenten mit der Verkaufsstelle. Damit
schließt sich der Kreis zur Ursprungsform der Marke auf Verkaufsstellenebene, dem sog.
,,Tante Emma"-Laden, denn ,,Tante Emma" war einmalig und folglich unterschied sich ihr
1
Vgl. Zentes, Joachim; Morschett, Dirk: Retail Branding als strategische Markenpolitik des Handels, in: Esch,
Franz-Rudolf: Moderne Markenführung: Grundlagen, innovative Ansätze, praktische Umsetzungen, 4. Aufl.,
(Gabler) Wiesbaden 2005, S. 1139-1155, S. 1141-1142.
2
Vgl. Morschett, Dirk: Retail Branding und integriertes Handelsmarketing: Eine verhaltenswissenschaftliche
und wettbewerbsstrategische Analyse, Gabler Edition Wissenschaft, (DUV) Wiesbaden 2002, S. 79-83.
3
Vgl. KPMG; EHI: Status quo und Perspektiven im deutschen Lebensmitteleinzelhandel 2004: Eine Markt-
analyse von KPMG und EHI, http://www.kpmg.de/about/press_office/8144.htm, 6.Juli 2006, S. 23-24.
4
Vgl. Davies, Gary: The two ways in which retailers can be brands, in: IJRDM, Vol. 20, 1992, Nr. 2, S. 24-34,
S. 24.
5
Vgl. Theis, Hans-Joachim: Handels-Marketing, (Deutscher Fachverlag) Frankfurt am Main 1999, S. 33.
6
Vgl. Zentes, Joachim; Swoboda Bernhard: Hersteller-Handels-Beziehungen aus markenpolitischer Sicht
Strategische Optionen der Markenartikelindustrie, in: Esch, Franz-Rudolf: Moderne Markenführung: Grund-
lagen, innovative Ansätze, praktische Umsetzungen, 4. Aufl., (Gabler) Wiesbaden 2005, S. 1063-1086, S.
1066.
7
Vgl. Zentes, Joachim; Morschett, Dirk: Retail Branding als strategische Markenpolitik des Handels, in: Esch,
Franz-Rudolf: Moderne Markenführung: Grundlagen, innovative Ansätze, praktische Umsetzungen, 4. Aufl.,
(Gabler) Wiesbaden 2005, S. 1139-1155, S. 1143.
8
Vgl. Zentes, Joachim; Morschett, Dirk: Retail Branding als strategische Markenpolitik des Handels, in: Esch,
Franz-Rudolf: Moderne Markenführung: Grundlagen, innovative Ansätze, praktische Umsetzungen, 4. Aufl.,
(Gabler) Wiesbaden 2005, S. 1139-1155, S. 1141-1142.
2
Laden, geprägt durch ihre Persönlichkeit, von allen anderen.
9
Natürlich kann der ,,Tante Em-
ma"-Laden nur als eine stark vereinfachende Metapher für das Markenphänomen im Handel
dienen. Diese verdeutlicht jedoch, dass der Konsument und dessen Haltung zum Handelsun-
ternehmen auch heute im Mittelpunkt der Überlegungen stehen muss, um eine leistungsfähige
Retail Brand aufzubauen, d.h. die Verkaufsstelle als Marke zu profilieren.
Basierend auf der Erkenntnis, dass Retail Branding der Schlüssel zum Konsumenten sein und
damit einen direkten Einfluss auf den Unternehmenserfolg haben kann, hat diese Strategie
einen massiven Bedeutungszuwachs erfahren.
10
Der Aufbau und die Führung der Verkaufs-
stelle als Marke ist eine der wichtigsten strategischen Aufgaben von Handelsunternehmen.
11
Der Handel kann in diesem Zusammenhang als Wiederentdecker von Macht und Leistungs-
stärke der Marke bezeichnet werden.
12
1.2 Zielsetzung und Gang der Untersuchung
Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, Retail Branding aus einer konsumentenorientierten
Sichtweise auf Grundlage empirischer Daten zu analysieren. Hierbei wird eine vergleichende
Perspektive eingenommen, um Unterschiede zwischen verschiedenen Handelsbranchen und
darüber hinaus zwischen verschiedenen Verkaufsstellen (Retail Brands) zu identifizieren.
Basis der empirischen Analyse sind die in den Kapiteln 2 und 3 dargestellten theoretischen
Inhalte.
Kapitel 2 befasst sich mit definitorischen Grundlagen und Abgrenzungen der zentralen Beg-
riffe Marke und Retail Brand. Darüber hinaus werden die generellen Konzepte erläutert, wel-
che den Markenfunktionen als Ansatzpunkte der Markenpolitik sowie dem Themenkomplex
Markenwert und Markenbewertung zu Grunde liegen.
Kapitel 3 bildet den Bezugsrahmen als theoretisches Gerüst der empirischen Analyse des Re-
tail Branding ab. Nach einer Darstellung der grundsätzlichen Bedeutung der Marketingin-
strumente für den Aufbau einer Retail Brand folgt eine Untersuchung der Einkaufsmotive,
bevor schließlich die einzelnen Komponenten des Bezugsrahmens im Mittelpunkt der Be-
trachtung stehen.
Im Rahmen von Kapitel 4 werden die Ergebnisse einer Konsumentenbefragung, die vom Ver-
fasser sowie zwei weiteren Diplomanden der Universität Trier durchgeführt wurde, vorge-
stellt. Neben der deskriptiven Datenanalyse erfolgt eine Untersuchung der aufbauend auf Ka-
pitel 3 gebildeten Hypothesen.
9
Vgl. Meyer, Anton: Der Handel als Marke Ein Spaziergang durch die Welt der Branded Retailer, in: Tomc-
zak, Torsten (Hrsg.): Store Branding Der Handel als Marke?, Ergebnisse 10. Bestfoods TrendForum,
(TrendForum) Wiesbaden 2000, S. 13-38, S. 13.
10
Vgl. Ailawadi, Kusum L.; Keller, Kevin, Lane: Understanding retail branding: conceptual insights and re-
search priorities, in: JR, Vol. 80, 2004, S. 331-342, S. 331.
11
Vgl. Blackett, Tom: The nature of Brands, in: Murphy, John (Hrsg.): Brand Valuation, (Hutchinson) London
1989, S. 1-11, S. 4.
12
Vgl. Winters, Arthur A.; Fincher Winters, Peggy u.a.: The Power of Retail Branding: Innovative Marketing
Strategies for Achieving BrandPower, (Visual Reference Publications) New York 2005, S. 8.
3
Zentrale Forschungsfragen, die auf diesem Wege beantwortet werden sollen, sind:
· Stimmt die wahrgenommene Positionierung der Retail Brand mit der Idealvorstellung der
Konsumenten überein?
· Wie werden die Marketinginstrumente wahrgenommen und welchen Einfluss haben sie?
· Welche Indikatoren eignen sich zur Messung des Markenwerts der Retail Brand?
· Besteht ein Wirkungszusammenhang zwischen der Wahrnehmung der Marketinginstru-
mente und dem Markenwert der Retail Brand?
Die Untersuchung schließt in Kapitel 5 mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse und der
Identifikation weiterführender Fragestellungen.
2. Grundlagen
2.1 Definitorische Grundlagen und Abgrenzungen
2.1.1 Begriff der Marke
Im Folgenden werden Entstehung, Bedeutungsinhalte und Definitionen des Wortes Marke
dargestellt, um eine im Rahmen der vorliegenden Untersuchung zweckmäßige Abgrenzung
vorzunehmen. Der Begriff Marke wird hierbei als Synonym zum englischen Begriff Brand
verwendet.
Dem etymologischen Ursprung nach bedeutet Marke, im germanischen Wortschatz ,,marka",
Zeichen bzw. Grenzzeichen.
13
Im 19. Jahrhundert begannen insbesondere die Hersteller quali-
tativ hochwertiger Güter ihre Produkte zu markieren, um sie von denen der Konkurrenz abzu-
heben, häufig zur Durchsetzung höherer Preise.
14
Im Rahmen dieser Entwicklung war neben
einem Anstieg der Werbeaufwendungen auch ein immer stärkerer Fokus auf die Gewährleis-
tung einer konstanten Qualität der betreffenden Produkte zu verzeichnen. Aus den markierten
Produkten wurden Fabrikmarken bzw. Markenartikel.
15
Das Wort Marke erhielt auf diese
Weise seine neuzeitliche Dimension.
16
Auch das Produkt selbst wurde zur Marke, nicht nur
das zur Kennzeichnung verwendete Zeichen. Eine Studie unter 132 deutschen Unternehmen
verifiziert diese Dichotomie: 51,9% der Befragten verstehen unter Marke neben der Kenn-
zeichnung auch das Produkt selbst.
17
Man kann daher abstrahierend von einem zeichen- und
einem objektbezogenen Markenbegriff sprechen, die einander in der üblichen Sprachregelung
gegenüberstehen.
18
13
Vgl. Roeb, Thomas: Markenwert: Begriff, Berechnung, Bestimmungsfaktoren, (Mainz) Aachen 1994, S. 10.
14
Vgl. Blackett, Tom: The nature of Brands, in: Murphy, John (Hrsg.): Brand Valuation, (Hutchinson) London
1989, S. 1-11, S. 2.
15
Vgl. Berekhoven, Ludwig: Von der Markierung zur Marke, in: Dichtl, Erwin; Eggers, Walter (Hrsg.): Marke
und Markenartikel als Instrument des Wettbewerbs, (dtv) München 1992, S. 25-45, S. 34-35.
16
Vgl. Bekmeier-Feuerhahn, Sigrid: Marktorientierte Markenbewertung: Eine konsumenten- und unterneh-
mensbezogene Betrachtung, (DUV) Wiesbaden 1998, S. 10.
17
Vgl. Günther, Thomas; Kriegbaum, Catharina: Markenmanagement State of the Art Auswertungsbericht,
Dresdner Beiträge zur Betriebswirtschaftslehre Nr. 33/99, TU Dresden 1999, S. 6.
18
Vgl. Morschett, Dirk: Retail Branding und integriertes Handelsmarketing: Eine verhaltenswissenschaftliche
und wettbewerbsstrategische Analyse, Gabler Edition Wissenschaft, (DUV) Wiesbaden 2002, S. 14-16; vgl.
Roeb, Thomas: Markenwert: Begriff, Berechnung, Bestimmungsfaktoren, (Mainz) Aachen 1994, S. 12.
4
Dieses formale Verständnis der Marke bestimmt auch den juristischen Markenbegriff.
19
Die
analytische Trennung wird aufrechterhalten, denn im rechtlichen Sinne steht in Bezug auf die
Marke die sog. Herkunftsfunktion im Vordergrund. Es muss sichergestellt werden, dass ein
markiertes Objekt dem richtigen Unternehmen zugeschrieben wird und somit keine Ver-
wechslungen über dessen Herkunft auftreten.
20
Als Marken im Rahmen des Markengesetzes
können ,,alle Zeichen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen,
Buchstaben, Zahlen, Hörzeichen, dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form ei-
ner Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstiger Aufmachung einschließlich Farben und
Farbzusammenstellungen geschützt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen
von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden."
21
Auch die American Marketing Associa-
tion teilt dieses Begriffsverständnis.
22
Bei einer empirischen Erforschung der Marke lässt sich eine analytische Trennung jedoch
nicht aufrechterhalten, da zeichen- bzw. objektbezogene Wirkung der Marke bei Konsumen-
tenbefragungen nicht voneinander isoliert betrachtet werden können. Der Begriff Marke bein-
haltet daher nachfolgend sowohl das Markenzeichen als auch die Verkaufsstelle als markier-
tes Objekt.
23
Doch was macht das Phänomen Marke im Rahmen dieser Untersuchung aus? Zur Beantwor-
tung dieser Frage ist es notwendig, verschiedene inhaltliche Definitionsansätze der Marke im
betriebswirtschaftlichen Kontext zu betrachten. Sie lassen sich in drei zentrale Kategorien
einordnen, welche nachfolgend kurz umrissen werden: merkmalsorientierte, wirkungsbezoge-
ne und absatzsystemorientierte Sichtweisen.
24
Merkmalsorientierte Markendefinitionen beziehen sich auf klar definierte Merkmalskataloge,
die zu erfüllen sind, damit ein Produkt als Marke gilt.
25
Als Beispiel für eine solche Definition
soll Mellerowicz herangezogen werden: ,,Markenartikel sind für den privaten Bedarf geschaf-
fene Fertigwaren, die in einem größeren Absatzraum unter einem besonderen, die Herkunft
kennzeichnenden Merkmal (Marke) in einheitlicher Aufmachung, gleicher Menge sowie in
gleichbleibender oder verbesserter Güte erhältlich sind und sich dadurch sowie durch die für
sie betriebene Werbung die Anerkennung der beteiligten Wirtschaftskreise (Verbraucher,
19
Vgl. Homburg, Christian; Richter, Markus: Branding Excellence Wegweiser für professionelles Markenma-
nagement, Reihe: Management Know-how, Nr. M 75, (IMU) Mannheim 2003, S. 2.
20
Vgl. Freitag, Andreas: Markenrecht und Markenstrategie, in: Gaiser, Brigitte; Linxweiler, Richard; Brucker,
Vincent (Hrsg.): Praxisorientierte Markenführung: Neue Strategien, innovative Instrumente und aktuelle Fall-
studien, (Gabler) Wiesbaden 2005, S. 27-39, S. 29.
21
§3 Abs. 1 MarkenG.
22
Vgl. American Marketing Association: Dictionary of Marketing Terms: Brand, http://www.marketingpower.
com/mg-dictionary.php?SearchFor=Brand&Searched=1, 8. Juli 2006.
23
Vgl. Morschett, Dirk: Retail Branding und integriertes Handelsmarketing: Eine verhaltenswissenschaftliche
und wettbewerbsstrategische Analyse, Gabler Edition Wissenschaft, (DUV) Wiesbaden 2002, S. 15-16.
24
Vgl. Brauer, Wolfgang: Die Betriebsform im stationären Einzelhandel als Marke, (FGM) München 1997, S.
16.
25
Vgl. Homburg, Christian; Richter, Markus: Branding Excellence Wegweiser für professionelles Markenma-
nagement, Reihe: Management Know-how, Nr. M 75, (IMU) Mannheim 2003, S. 2.
5
Händler und Hersteller) erworben haben (Verkehrsgeltung)."
26
Diese angebotsorientierte
Sichtweise bringt verschiedene Nachteile mit sich. Bei ausschließlicher Bezugnahme auf
Markenartikel erweist sich die Definition als untauglich zur Abgrenzung, da bspw. die Varia-
tion der Packungsgröße eines Produkts die Marke selbst nicht verändert.
27
Zudem sind Defini-
tionen auf Basis von Merkmalskatalogen oftmals nicht flexibel genug. Industriegüter, Dienst-
leistungen oder, wie im vorliegenden Fall, der Handel könnten nach Mellerowicz keinen
Markenstatus realisieren.
28
Damit erweist sich die merkmalsorientierte Sichtweise in diesem
Kontext als unzweckmäßig.
Wirkungsbezogene Definitionen rücken die Meinungen der Konsumenten bzw. Nachfrager
ins Zentrum der Überlegungen. Im Unterschied zu Mellerowicz, der die Verkehrsgeltung als
Teilaspekt beschreibt, entscheiden alleine Wahrnehmung und Anerkennung über die Diffe-
renzierung in Marke und Nicht-Marke.
29
Dieser Perspektivenwechsel ist speziell aus Marke-
tingsicht zweckmäßig, da der Erfolg einer Marke letztlich basierend auf den Reaktionen der
Zielgruppe beurteilt werden muss.
30
Als Beispiel kann hier die Definition von Thurmann die-
nen, welche die Anerkennung des Verbrauchers zum ,,artbestimmenden Merkmal" der wirt-
schaftlichen Wirksamkeit der Marke erhebt.
31
Das Kernproblem der wirkungsbezogenen Per-
spektive wird jedoch beim Versuch der quantitativen Operationalisierung augenscheinlich.
32
Es ist zwar durchaus möglich, Funktionen zu definieren, die eine Marke in der Psyche des
Konsumenten erfüllen muss, sowie Indikatoren zu identifizieren, um diese zu messen. Ein
Beispiel für ein solches Messkonzept wird in Tabelle 1 dargestellt.
33
Das Festlegen allge-
meingültiger Grenzwerte, um auf diese Weise einen Rückschluss auf die Klassifizierung als
Marke ziehen zu können, ist aufgrund der Heterogenität von Branchen-, Produkt- und Ziel-
gruppen allerdings nicht möglich.
34
Dieser Kritikpunkt kann jedoch wiederum relativiert wer-
den, wenn man den Markenbegriff kontinuierlich auffasst und Marken in Bezug auf Konkur-
renzmarken beurteilt.
35
26
Mellerowicz, Konrad: Markenartikel Die ökonomischen Gesetze ihrer Preisbildung und Preisbindung, 2.
Aufl., (Beck) München 1963, S. 69, zitiert nach: Morschett, Dirk: Retail Branding und integriertes Handels-
marketing: Eine verhaltenswissenschaftliche und wettbewerbsstrategische Analyse, Gabler Edition Wissen-
schaft, (DUV) Wiesbaden 2002, S. 17.
27
Vgl. Brauer, Wolfgang: Die Betriebsform im stationären Einzelhandel als Marke, (FGM) München 1997, S.
17.
28
Vgl. Homburg, Christian; Richter, Markus: Branding Excellence Wegweiser für professionelles Markenma-
nagement, Reihe: Management Know-how, Nr. M 75, (IMU) Mannheim 2003, S. 2.
29
Vgl. Brauer, Wolfgang: Die Betriebsform im stationären Einzelhandel als Marke, (FGM) München 1997, S.
18.
30
Vgl. Kelz, Andreas: Die Weltmarke, (Schulz-Kirchner) Idstein 1989, S. 18.
31
Vgl. Thurmann, Peter: Grundformen des Markenartikels. Versuch einer Typologie., (Duncker & Humblot)
Berlin 1961, S. 16-17.
32
Vgl. Brauer, Wolfgang: Die Betriebsform im stationären Einzelhandel als Marke, (FGM) München 1997, S.
19.
33
Vgl. Hätty, Holger: Der Markentransfer, (Physica) Heidelberg 1989, S. 18-19.
34
Vgl. Burkhardt, Achim: Die Betriebstypenmarke im stationären Einzelhandel, Diss., Erlangen-Nürnberg
1997, S. 39; vgl. Bekmeier-Feuerhahn, Sigrid: Marktorientierte Markenbewertung: Eine konsumenten- und
unternehmensbezogene Betrachtung, (DUV) Wiesbaden 1998, S. 19.
35
Vgl. Morschett, Dirk: Retail Branding und integriertes Handelsmarketing: Eine verhaltenswissenschaftliche
und wettbewerbsstrategische Analyse, Gabler Edition Wissenschaft, (DUV) Wiesbaden 2002, S. 22.
6
Tab. 1: Operationalisierung der wirkungsbezogenen Markendefinition
Funktionen
Indikatoren
Identifikations- bzw. Individualisierungsfunktion
-
aktiver Bekanntheitsgrad
-
passiver Bekanntheitsgrad
Vertrauens- und Sicherheitsfunktion
-
Marktsicherheit
-
Wahrgenommenes Kaufrisiko
Nutzenfunktion
-
Einstellung
Quelle: Bekmeier-Feuerhahn, Sigrid: Marktorientierte Markenbewertung: Eine konsumenten- und unterneh-
mensbezogene Betrachtung, (DUV) Wiesbaden 1998, S. 19.
Absatzsystemorientierte Definitionsansätze der Marke stellen eine Kombination der beiden
oben geschilderten Sichtweisen dar. Hinter der Festlegung konstitutiver Merkmale der Mar-
kenplanung und -führung steht das Ziel, dauerhaftes Vertrauen der Nachfrager zu realisie-
ren.
36
Diese integrative Perspektive hebt die Notwendigkeit einer aktiven Markenführung
durch das Marketing hervor. Allerdings muss die Gestaltung des Marketingmix als kontext-
abhängiger Einflussfaktor auf die Marke verstanden werden.
37
Demzufolge erscheint die De-
finition starrer Kriterien, welche zwingend zu erfüllen sind, insbesondere bei der Analyse von
Handelsunternehmen, als nicht geeignet.
Wesensmerkmal der Marke im Rahmen der vorliegenden Arbeit ist ausschließlich ihre Wir-
kung beim Nachfrager. Da letztlich jede Objektmarkierung eine Wirkung auslöst, wird somit
jedes markierte Objekt auch zur Marke. Auf Grenzwerte zur Differenzierung in Marke und
Nicht-Marke kann daher verzichtet werden. Aussagen über die Markenstärke können bspw.
unter Bezugnahme auf die Erfüllung der Markenfunktionen getroffen werden.
38
2.1.2 Begriff der Retail Brand
Nach der Charakterisierung der Marke im Allgemeinen soll nun der Begriff Retail Brand,
bzw. dessen deutsche Entsprechung Händlermarke spezifiziert werden. Denn obwohl die
Übertragung des Markenkonzepts auf den Handel wissenschaftlich gesehen vergleichsweise
jung ist, werden zahlreiche Begrifflichkeiten verwendet, um den Gegenstand der Markierung
zu bezeichnen.
39
Es stellt sich somit die Frage nach Definition und Abgrenzung der Retail
Brand gegenüber anderen Betrachtungsweisen. Darüber hinaus soll geklärt werden, welche
Vorteile der Begriff mit sich bringt. Vorab wird die Verwendung der zur Systematisierung
und Charakterisierung von Handelsunternehmen zentralen Begriffe Betriebsform und Be-
triebstyp erläutert, da auch in diesem Bereich konkurrierende Definitionsansätze existieren.
40
36
Vgl. Brauer, Wolfgang: Die Betriebsform im stationären Einzelhandel als Marke, (FGM) München 1997,
S.19.
37
Vgl. Morschett, Dirk: Retail Branding und integriertes Handelsmarketing: Eine verhaltenswissenschaftliche
und wettbewerbsstrategische Analyse, Gabler Edition Wissenschaft, (DUV) Wiesbaden 2002, S. 23-24.
38
Vgl. Morschett, Dirk: Retail Branding und integriertes Handelsmarketing: Eine verhaltenswissenschaftliche
und wettbewerbsstrategische Analyse, Gabler Edition Wissenschaft, (DUV) Wiesbaden 2002, S. 24.
39
Vgl. Ahlert, Dieter; Kenning, Peter: Das Handelsunternehmen als Marke, in: Esch, Franz-Rudolf: Moderne
Markenführung: Grundlagen, innovative Ansätze, praktische Umsetzungen, 4. Aufl., (Gabler) Wiesbaden
2005, S. 1187-1208, S. 1192.
40
Vgl. Müller-Hagedorn, Lothar: Handelsmarketing, 4. Aufl., (Kohlhammer) Stuttgart 2005, S. 80-84.
7
Betriebsform und Betriebstyp werden häufig synonym verwendet oder nur unscharf vonein-
ander abgegrenzt.
41
In Übereinstimmung mit Barth bezeichnet der Terminus Betriebsform
nachfolgend die Stellung des Handelsunternehmens in der Distributionskette zwischen Urer-
zeuger und Konsument. Unterschieden wird demzufolge zwischen Groß-, Außen- und Einzel-
handelsbetrieben. Auf dieser Basis knüpft der Begriff Betriebstyp an die Vielfalt möglicher
Leistungspolitiken bzw. Strukturmerkmale innerhalb einer bestimmten Betriebsform an.
42
Als
Betriebstypen im Einzelhandel können somit Fachgeschäft, Spezialgeschäft, Boutique, Fach-
markt, Warenhaus, Selbstbedienungswarenhaus, Gemeinschaftswarenhaus, Kaufhaus, Dis-
counter, Gemischtwarengeschäft, Convenience-Store, Supermarkt und Verbrauchermarkt un-
terschieden werden.
43
Der Begriff der Retail Brand, wie er dieser Untersuchung zugrunde liegt, steht in direktem
Bezug zum in Kapitel 2.1.1. spezifizierten Begriffsverständnis der Marke. Er korrespondiert
sowohl mit der ganzheitlichen Betrachtungsweise (Markenzeichen und markiertes Objekt) als
auch mit der wirkungsbezogenen Markendefinition:
,,Eine Händlermarke (Retail Brand) bezeichnet eine Verkaufsstelle eines Handelsunterneh-
mens, die mit einem Markenzeichen versehen ist, oder eine Gruppe von Verkaufsstellen eines
Handelsunternehmens, die mit einem einheitlichen Markenzeichen versehen sind. Ein we-
sensmäßiger Bestandteil ist im Erfolg im Sinne der Anerkennung durch den Konsumenten
zu sehen."
44
Im Vergleich zu den anderen in der Literatur auftretenden Begrifflichkeiten sind zwei essen-
zielle Vorteile der Retail Band bzw. Händlermarke i.S. der Definition von Morschett anzufüh-
ren. Sie gewährleistet die in Bezug auf den Untersuchungsgegenstand notwendige Flexibilität
und schafft darüber hinaus die in der Vergangenheit vermisste Begriffsklarheit.
Die besondere Flexibilität der Bezeichnung Retail Brand liegt in der definitorischen Bezug-
nahme auf die Verkaufsstelle bzw. eine Gruppe von Verkaufsstellen als Markierungsobjekte
begründet. Im Vergleich mit dem konkurrierenden Begriff der ,,Betriebstypenmarke"
45
wird
die Zweckmäßigkeit dieser Betrachtungsweise deutlich.
41
Vgl. Müller-Hagedorn, Lothar; Toporowski, Waldemar: Handelsbetriebe, Arbeitspapier Nr. 19, Köln 2006,
http://www.wiso.uni-koeln.de/handel/Arbeitspapiere/AP_Handelsbetriebe.pdf, 11. Juli 2006, S. 7.
42
Vgl. Barth, Klaus; Hartmann, Michaela; Schröder, Hendrik: Betriebswirtschaftslehre des Handels, 5. Aufl.,
(Gabler) Wiesbaden 2002, S. 44-45.
43
Vgl. Ausschuss für Definitionen zu Handel und Distribution (Hrsg.): Katalog E, Definitionen zu Handel und
Distribution Elektronische Fassung, 5. Ausgabe, Köln 2006, http://www.katalog-e.de/Download/Katalog_
E-Beispieldefinition_Betriebsform_im_Einzelhandel.pdf, 11. Juli 2006, S. 29.
44
Morschett, Dirk: Retail Branding as a Goal of Strategic Retail Marketing, in: Cliquet, Gérard; Zentes,
Joachim (Hrsg.): Retailing and Distribution in Europe, Proceedings to the third AFM French-German Confer-
ence, 29./30. Juni 2000, St. Malo, http://www.hima.unisaarland.de/material/Morschett%20_Paper_St_Malo.
pdf, 16. Mai 2006, S. 13.
45
Vgl. Burkhardt, Achim: Die Betriebstypenmarke im stationären Einzelhandel, Diss., Erlangen-Nürnberg
1997, S. 39; vgl. Bekmeier-Feuerhahn, Sigrid: Marktorientierte Markenbewertung: Eine konsumenten- und
unternehmensbezogene Betrachtung, (DUV) Wiesbaden 1998; vgl. Große-Bölting, Kristin: Management der
Betriebstypenmarkentreue: Konzeptualisierung, Operationalisierung und Gestaltungsempfehlungen für den
Bekleidungseinzelhandel, (DUV) Wiesbaden 2005, S. 11-15.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2006
- ISBN (eBook)
- 9783836601375
- DOI
- 10.3239/9783836601375
- Dateigröße
- 1.1 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Trier – Betriebswirtschaftslehre
- Erscheinungsdatum
- 2007 (Februar)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- einzelhandel markenpolitik kundenorientierung handel marke brand discounter
- Produktsicherheit
- Diplom.de