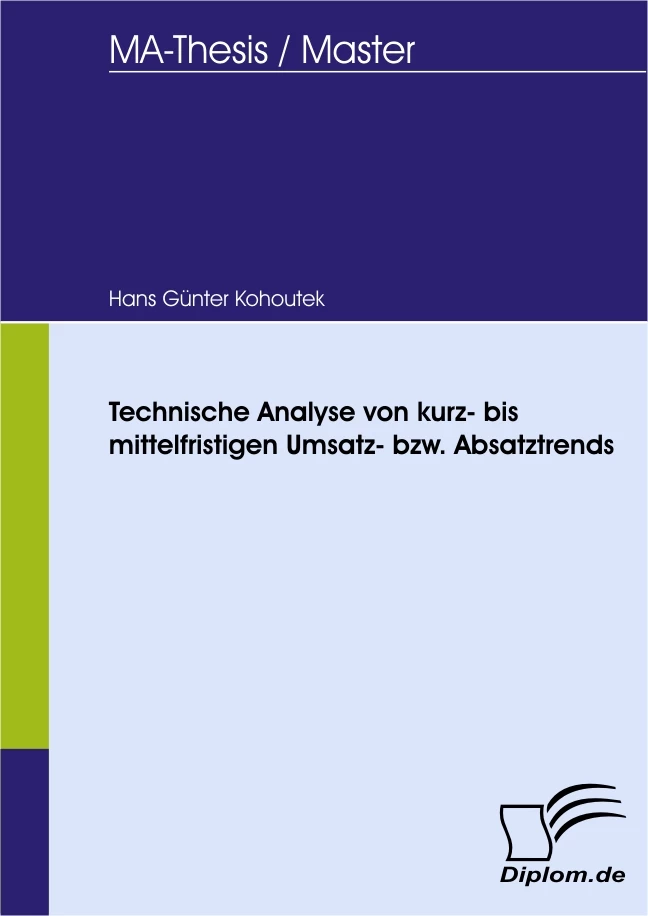Technische Analyse von kurz- bis mittelfristigen Umsatz- bzw. Absatztrends
Zusammenfassung
Als Folge der sich ab Mitte 2007 auch in Europa abzeichnenden Finanzkrise (vgl. Spiegel Online, 2007, http://www.spiegel.de/wirtschaft) und der danach folgenden Wirtschaftskrise in 2008 erklärten sich Anfang April 2009 nur acht der im deutschen Aktienindex (DAX) vertretenen umsatz- und kapitalstärksten Unternehmen zur öffentliche Bekanntgabe ihrer Planzahlen für das Jahr 2009 bereit. Von den übrigen 22 börsennotierten Konzernen gaben nur 18 Unternehmen vage Stellungnahmen ab. Vier Konzerne, darunter die Allianz Versicherungen und BMW, verweigerten jede Auskunft über die mögliche Entwicklung für das Wirtschaftsjahr 2009. Bis zum heutigen Tag ist nicht bekannt, weshalb es den angesprochenen 22 Konzernen nicht möglich war konkrete Informationen bereit zu stellen. Spekuliert wird, dass diese Unternehmen aus aktien- bzw. haftungsrechtlichen Gründen eine diesbezügliche Veröffentlichung scheuten. Aus welchen Gründen auch immer die Mehrzahl dieser Großunternehmen diese Vorgangsweise wählte, eines dürfte feststehen: Die Globalisierung der Wirtschaft und deren Konsequenzen in Bezug auf die geforderte Flexibilität bezüglich der Befriedigung von individuellen Bedürfnisse und damit verbundenen immer kürzeren Planungszyklen stellt die Wirtschaft vor eine weitere Herausforderung. Viele Bemühungen zu Effizienzsteigerungen bei den erfolgsrelevanten Unternehmensprozessen, auf globaler wie auch auf regionaler Ebene, werden durch Nachfrageeinbrüche vernichtet. Daher entsteht die Forderung, durch einen qualitativen Sprung weitere Flexibilisierungsmaßnahmen durchzuführen.
Matthias Horx, Trend- und Zukunftsforscher, erläuterte anlässlich seines Vortrages Das Zukunftsprinzip vom 10. März 2009 in Wien, dass sich die globalisierte Wirtschaft in Bezug auf die Prognosemöglichkeiten hart an der Grenze zu Rekursiv-Hyperkomplexen Systemen befindet. Diese Systeme zeichnen sich durch eine hohe Komplexität, unterschiedliche Subsysteme, starke Diversifizierung und schwere Simulierbarkeit aus und sind kaum voraussagbar. Demgemäß gewährleisten zusätzliche Informationen zur Erstellung wirtschafts-orientierter Prognosen keine höhere Treffersicherheit dieser Modelle, denn an der Interpretation der Daten und Annahmen scheiden sich die Geister.
André Malraux, französischer Schriftsteller und Politiker, postulierte im letzen Jahr-hundert den Gedanken Wer in der Zukunft lesen will, muss in der Vergangenheit blättern. Das Wissen über vergangene Entwicklungen […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Problemstellung
1.2 Zielsetzung dieser Master-Thesis
2 Methodik, Prämisse und Begriffsbestimmungen
2.1 Technische versus Fundamentale Analyse
2.2 Information versus Exformation
2.3 Begriffsbestimmungen
2.3.1 Definition des Zeitraumes der Kurz- und Mittelfristigkeit
2.3.2 Bildung eines Referenzindex
2.3.3 Exkurs I: Die Sigmoidkurve
3 Einführung in die Technische Analyse
3.1 Die Geschichte der Technischen Analyse der Finanzmärkte
3.2 Die Dow-Theorie
3.3 Betriebswirtschaftliche Interpretation der Dow-Theorie
4 Technische Analyseinstrumente
4.1 Von Langfrist- zu Kurzfristanalysen
4.2 Inflationsbereinigung langfristiger Beobachtungszeiträume
4.3 Indikatoren- und Charttechniken
4.4 Simple Moving Average
4.5 Trendkanaltechnik
4.6 Dreieckstechniken
4.7 Dreiecksarten
5 Zentrale Fallstudie und Fallbeispiele
5.1 Fallstudie „Maschinenhandel – Umsatz“
5.1.1 Umsatzentwicklung & Technische Analyse – Abschnitt A
5.1.2 Umsatzentwicklung & Technische Analyse – Abschnitt A-B
5.1.3 Umsatzentwicklung & Technische Analyse – Abschnitt A-C
5.1.4 Umsatzentwicklung & Technische Analyse – Abschnitt A-D
5.1.5 Umsatzentwicklung & Technische Analyse – Abschnitt A-E
5.1.6 Zusammenfassung der Ergebnisse der Technischen Analyse
5.1.7 Exkurs II: Technische Analyse & Planung
5.1.8 Unternehmensentwicklung & Situation zum 30. Juni 2009
5.2 Fallbeispiel „Gesundheit & Wellness – Besucherentwicklung“
5.3 Fallbeispiel „General Motors – PKW Verkauf in den USA“
5.4 Zusammenfassung der Ergebnisse der Fallstudie/-beispiele
6 Kritische Würdigung
7 Schlussfolgerung
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Anhang
1 Einleitung
Als Folge der sich ab Mitte 2007 auch in Europa abzeichnenden Finanzkrise (vgl. Spiegel Online, 2007, http://www.spiegel.de/wirtschaft) und der danach folgenden Wirtschaftskrise in 2008 erklärten sich Anfang April 2009 nur acht der im deutschen Aktienindex (DAX) vertretenen umsatz- und kapitalstärksten Unternehmen zur öffentliche Bekanntgabe ihrer Planzahlen für das Jahr 2009 bereit. Von den übrigen 22 börsennotierten Konzernen gaben nur 18 Unternehmen vage Stellungnahmen ab. Vier Konzerne, darunter die Allianz Versicherungen und BMW, verweigerten jede Auskunft über die mögliche Entwicklung für das Wirtschaftsjahr 2009. (vgl. The Associated Press, 2009, in: Yahoo!, http://de.news.yahoo.com) Bis zum heutigen Tag ist nicht bekannt, weshalb es den angesprochenen 22 Konzernen nicht möglich war konkrete Informationen bereit zu stellen. Spekuliert wird, dass diese Unternehmen aus aktien- bzw. haftungsrechtlichen Gründen eine diesbezügliche Veröffentlichung scheuten. Aus welchen Gründen auch immer die Mehrzahl dieser Großunternehmen diese Vorgangsweise wählte, eines dürfte feststehen: Die Globalisierung der Wirtschaft und deren Konsequenzen in Bezug auf die geforderte Flexibilität bezüglich der Befriedigung von individuellen Bedürfnisse und damit verbundenen immer kürzeren Planungszyklen stellt die Wirtschaft vor eine weitere Herausforderung. Viele Bemühungen zu Effizienzsteigerungen bei den erfolgsrelevanten Unternehmensprozessen, auf globaler wie auch auf regionaler Ebene, werden durch Nachfrageeinbrüche vernichtet. Daher entsteht die Forderung, durch einen qualitativen Sprung weitere Flexibilisierungsmaßnahmen durchzuführen. (vgl. Ramge, 2009, in: brand eins 06/2009, S. 28)
Matthias Horx, Trend- und Zukunftsforscher, erläuterte anlässlich seines Vortrages „Das Zukunftsprinzip“ vom 10. März 2009 in Wien, dass sich die globalisierte Wirtschaft in Bezug auf die Prognosemöglichkeiten hart an der Grenze zu Rekursiv-Hyperkomplexen Systemen befindet. Diese Systeme zeichnen sich durch eine hohe Komplexität, unterschiedliche Subsysteme, starke Diversifizierung und schwere Simulierbarkeit aus und sind kaum voraussagbar. (vgl. Horx, 2009, S. 11) Demgemäß gewährleisten zusätzliche Informationen zur Erstellung wirtschafts-orientierter Prognosen keine höhere Treffersicherheit dieser Modelle, denn an der Interpretation der Daten und Annahmen scheiden sich die Geister. (vgl. Grötker, 2008, in: brand eins 11/2008, S. 44)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Horx, M. (in Ruelle, D./Barrow. J., D.), 2009
André Malraux, französischer Schriftsteller und Politiker, postulierte im letzen Jahr-hundert den Gedanken „Wer in der Zukunft lesen will, muss in der Vergangenheit blättern.“ (Malraux, o. J., http://zitate.net) Das Wissen über vergangene Ent-wicklungen stellt somit eine Grundvoraussetzungen für das Verstehen der Zukunft dar. Dies berücksichtigt jedoch nicht den Ideenreichtum des Menschen, zukünftige Entwicklungen positiv wie negativ beeinflussen zu können.
Je nach Unternehmensgröße werden unterschiedliche Trend- und Prognosewerk-zeuge eingesetzt. Großunternehmen setzen auf quantitatives Datamining, verbunden mit dem Einsatz komplexer Software wie beispielsweise COGNOS mit ca. 23.000 Großkunden weltweit (vgl. IBM, 2009, http://www-01.ibm.com/software/data/ cognos/). Um diese Softwaretools auch nutzen zu können, ist eine entsprechende Anzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern intensiv einzuschulen. Bei kleinen und mittleren Unternehmen können einerseits die finanziellen Mittel beschränkt sein, andererseits werden diese Firmen noch in vielen Fällen von den Unternehmensgründern geführt, die sich eher auf ihre langjährige Erfahrung und Intuition als auf Zahlen, Daten und Fakten verlassen. In nicht wenigen Fällen werden ausschließlich die aktuellen Ergebnisse mit den Vorjahresresultaten, ungeachtet der aktuellen Wirtschaftslage, verglichen und die notwendig erscheinenden, korrigierenden Maßnahmen abgeleitet oder auch nicht. Beiden „Modellen“ ist die qualitative Auslegung des vorhandenen Zahlenmaterials gemeinsam. Diese Interpretationen können auf Branchen- und Berufserfahrungen, Intuitionen, Diskussionen sowie Einzel- und Gruppeninteressen, die einen solchen Interpretationsprozess durchaus dominieren können, und vielem mehr basieren. Vielfach fehlt auf der operativen Ebene ein pragmatischer wie analytischer Zugang zu dieser für den Erfolg eines Unternehmens so existentiellen Thematik.
Besonders in Kombination mit laufenden Marktanalysen können rollierende Umsatz- und Absatzprognosen eine sinnvolle Methode sein, die zukünftige Unternehmens- entwicklung abzuschätzen. Im Zeitalter der bereits erwähnten Globalisierung und zunehmender Individualisierung ist jedoch einmal mehr erlaubt zu hinterfragen, ob es operativ prioritär ist, das jeweilige Marktsegment und seine voraussichtliche Entwicklung, soweit dies überhaupt quantitativ erfassbar ist, zu berücksichtigen und nicht zu viele Informationen eher zur Verwirrung als zur Klärung eines Sachverhaltes beitragen.
1.1 Problemstellung
In der globalisierten und informationsbeschleunigten Welt von heute können Unternehmen, gleich welcher Größenordnung, alle auf sich bezogenen Faktoren kaum (er)kennen bzw. diese nur beschränkt steuern oder beeinflussen. Als diesbezügliche Beispiele seien die Konzerne Volvo Truck, Schweden, und ENGEL Austria, Weltmarktführer bei integrierten Systemlösungen im Bereich der Spritzgießtechnik, angeführt. Der Absatzeinbruch von Volvo Lastkraftwagen im vierten Quartal 2008 betrug 82 Prozent (vgl. Köhler, 2009, S. 212), der Absatzrückgang bei ENGEL im ersten Quartal 2009 summierte sich auf rund 60 Prozent. (vgl. Die Presse, 2009, http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist) Die Fragen, die sich in diesem Zusammenhang nun stellen, sind folgende: Waren diese Unternehmen tatsächlich von diesen Entwicklungen überrascht? Wurden Trendumkehrsignale nicht zeitgerecht erkannt oder wurde diese nicht gehört? Oder ermöglichen die eingesetzten Prognosewerkzeuge, meist basierend auf verschiedenen Regressionsanalyse-Modellen (vgl. Wikimedia, 2009, http://de.wikipedia.org/wiki/ Regressionsanalyse) aufgrund des vorhandenen Zahlenmaterials keine plausible Trendvorausschau?
1.2 Zielsetzung dieser Master-Thesis
Die grundsätzliche Idee zur Verfassung dieser Arbeit besteht darin zu untersuchen, ob die Anwendung der finanzmarktorientierten Technischen Analyse auf Unternehmensebene in der Praxis möglich und sinnvoll ist. Daher lautet die zu beantwortende Forschungsfrage wie folgt:
Bestehen Möglichkeiten zur Prognose, unter Einbeziehung des Prinzips der Exformation, künftiger Umsatz- bzw. Absatzentwicklungen durch die Anwendung finanzmarktanalytischer Indikatoren- und Charttechniken auf Unternehmensebene?
Um die Beantwortung der Forschungsfrage zu ermöglichen, werden folgende Arbeitshypothesen zugrunde gelegt:
Hypothese 1: Aufgrund der Anwendung von technischen Analysewerkzeugen werden unternehmenskritische Trendwendepunkte identifiziert.
Hypothese 2: Der übergeordnete, mittelfristige Trend erlaubt eine Aussage über die Umsatz- bzw. Absatzentwicklung eines Unternehmens.
Hypothese 3: Durch die Anwendung der entsprechenden Charttechniken kann eine kurzfristige Prognose rasch und effizient erstellt und mit den Planzahlen verglichen werden.
Da es sich bei der Fallstudie und dem ersten Fallbeispiel um firmeninternes Zahlenmaterial handelt, wollen diese Unternehmen nicht namentlich genannt werden. Das zweite Fallbeispiel Autoindustrie bezieht sich auf den amerikanischen Konzern General Motors. Dieses börsennotierte Unternehmen bietet die zur Erstellung der Trendanalyse und Prognose notwendigen Informationen über das Internet öffentlich an. Interessant im Zusammenhang mit dieser Arbeit ist die Tatsache, dass General Motors mit 1. Juni 2009 die Insolvenz nach Chapter 11, Reorganisation des Unternehmens, beantragte. (vgl. manager magazin, 2009, http://www.manager-magazin.de/unternehmen)
Für jedes Unternehmen gleich welcher Größenordnung sollte die Durchführung der Technischen Analyse der angesprochenen Unternehmensdaten in der Praxis einfach, rasch und effizient möglich sein. Aus diesem Grunde werden keine statistischen oder mathematischen Kenntnisse zur Durchführung dieser Techniken vorausgesetzt. Die Rahmenbedingungen sind jedoch einerseits die korrekte Verfahrensanwendung der Technischen Analyse, andererseits sollte der Analyst einiges Erfahrungswissen besitzen. Die für diese Master-Thesis als Grundlage dienenden empirischen Auswertungen und Grafiken wurden mithilfe von Microsoft Excel 2003 erstellt.
2 Methodik, Prämisse und Begriffsbestimmungen
Aufbauend auf den zur Verfügung stehenden umsatz- bzw. absatzorientierten Unternehmensdaten und der Anwendung finanzmarktanalytischer Methoden, Technische Analyse genannt, werden an Hand einer zentralen Fallstudie und zweier Fallbeispiele, unter Berücksichtigung nachstehender Prämisse, die Forschungsfrage vorläufig beantwortet und die Schlussfolgerungen für die betriebliche Anwendung gezogen. Die zentrale Fallstudie behandelt detailliert das Prognoseverfahren und als Exkurs, ein mögliches Planungswerkzeug. Die Fallbeispiele dienen ausschließlich der Plausibilitätsüberprüfung der aus der zentralen Fallstudie gewonnen Erkenntnisse über die Prognosemöglichkeiten, als auch zur ergänzenden Evaluierung und Verifizierung der formulierten Arbeitshypothesen.
Die Technische Analyse passt sich jedem Handelsgegenstand und jeder Zeitdimension an und dies ist ihre größte Stärke. (vgl. Murphy, 2003, S. 26) Demzufolge kann beispielsweise der Umsatz, ein Produkt aus abgesetzten physischen oder abstrakten Waren und Dienstleistungen, multipliziert mit dem Marktpreis, unter dem Begriff „Handelsgegenstand“ subsummiert und daher seine Entwicklung technisch analysiert werden. Weiters sei festgestellt, dass alle bekannten Prognosemethoden auf der Sammlung und Aufbereitung vergangener Daten basieren. Die Technische Analyse differenziert sich daher grundsätzlich nicht von anderen Prognosewerkzeugen, sie stellt nur eine andere Form der Zeitreihenanalyse dar. (vgl. Murphy, 2003, S. 36)
Die Akzeptanz folgender Prämisse ist für das Verständnis dieser Arbeit eine Voraussetzung. Grundsätzlich gilt, dass sowohl der realisierte als auch der geplante Umsatz die Summe aller größtmöglichen Bemühungen eines Unternehmens, in seinem Markt(segment) zu reüssieren, darstellen. Selbiges gilt selbstredend für den Absatz. Über die Unternehmensdaten (z.B. Umsatz- und/oder Absatzzahlen) hinausgehende Informationen, wie beispielsweise Marktgröße, Mitbewerb, Marktanteile, sind hinsichtlich der Kurz- und Mittelfristigkeit der Technischen Analyse, für die daraus zu folgernden Interpretationen und gegebenenfalls abzuleitenden Maßnahmen, irrelevant bzw. sind diese Teil der Exformation eines Unternehmens und müssen zur Erstellung einer Trendanalyse und Prognose nicht separat kommuniziert werden. Werden hingegen die Trend- und Prognoseresultate beispielsweise in einem Managementteam diskutiert, so können und sollten auch Exformationen besprochen werden. Eventuell können dadurch fundamental neue strategische Unternehmensansätze gefunden werden.
2.1 Technische versus Fundamentale Analyse
Die Unterscheidung zwischen Technischer und Fundamentaler Analyse ist grundsätzlicher Natur. Der technische Analyst konzentriert sich hauptsächlich auf das Studium der effektiven Marktbewegungen, um durch den Einsatz von verschiedenen Charttechniken den zukünftigen Trend vorherzusagen. Die drei Grundannahmen, auf denen der Ansatz der Technischen Analyse basiert, sind a) die Marktbewegung diskontiert alles, b) Kurse bewegen sich in Trends und c) Geschichte wiederholt sich. Der Technische Analyst geht davon aus, dass sich alle fundamentalen, psychologischen und politischen Komponenten, die eine Kursentwicklung beeinflussen können, im Marktpreis – im Sinne von Angebot und Nachfrage – positiv oder negativ widerspiegeln. Folgerichtig bedeutet dies, dass der Markt erzählt, wohin die Entwicklung geht und daher nur das Studium des Marktpreises notwendig ist. Per Definition sind daher alle Fundamentaldaten berücksichtigt. Es ist unnötig, sich mit Einzelinformationen zu beschäftigen, die zu dieser Entwicklung geführt haben mögen. Kurse bewegen sich in Trends, auch dies ist als eine Voraussetzung zum Verständnis für die Technische Analyse zu akzeptieren. Die Aufgabe der Darstellung eines Marktes durch Charttechnik dient dazu, Trends möglichst früh zu identifizieren, um diese Richtung möglichst schnell aufzunehmen. Einem Trend ist solange zu folgen, bis er deutliche Trendumkehrsignale zeigt. Muster der Vergangenheit können sich wiederholen und auch zukünftig funktionieren. Die menschliche Psyche tendiert dazu sich nicht zu ändern. Deshalb gilt der Grundsatz, dass sich das Verständnis für die Zukunft aus dem Studium der Vergangenheit ableitet. (vgl. Murphy, 2003, S. 21 – S. 25) Jede Prognosemethode setzt auf historische Datenbestände auf und unterscheidet zwischen deskriptiver, d.h. beschreibender und induktiver Statistik. Die grafische Darstellung von Daten bezieht sich auf die deskriptive Statistik, die Datenanalyse mittels Charttechniken fällt in den Bereich der induktiven Statistik. (vgl. Murphy, 2003, S. 36)
Im Falle eines Unternehmens kann dessen Marktkurs von den umsatz- und absatzorientierten Ergebnissen, als unverrückbare Fakten des Marktes, abstrakt abgeleitet werden. Auch eine Organisation verhält sich grundsätzlich ablehnend gegenüber Veränderungen. In vielen Fällen bedarf eines externen Anstoßes, um eine strategische Neupositionierung einzuleiten.
In der Kritik steht die Technische Analyse, da ihr unterstellt wird sich selbsterfüllend zu prophezeien. Vielfach wird jedoch von den Kritikern vergessen, dass Trendentwicklungen eindeutig das Resultat von Angebot und Nachfrage sind und beispielsweise Trendfolgesysteme ausschließlich die vergangene Entwicklung nachzeichnen. Eine Chartformation ist hingegen selten sehr klar und deren richtige oder falsche Interpretation hängt von der Erfahrung des Analysten ab. Da nicht alle Chartisten die gleichen Charttechniken anwenden und einen unterschiedlichen Erfahrungsschatz besitzen, ist nicht davon auszugehen, dass in Folge die selben Ergebnisse gleich interpretiert werden. (vgl. Murphy, 2003 S. 34 – S. 36)
Fundamentale Analysten untersuchen die Ursachen von Marktbewegungen, der erzielte Marktpreis steht kaum im Mittelpunkt. Um die Kausalität möglicher Marktbewegungen zu verstehen, werden viel Zeit sowie umfangreiche Informationen benötigt. (vgl. Murphy, 2003, S. 24) Wie bereits angeführt steht der Faktor Zeit in der globalisierten und zunehmend flexibleren Welt nicht unbegrenzt zur Verfügung. Wenn ein Unternehmen aufgrund seiner hohen Spezialisierung das eigene Marktsegment und die Positionierung zum Mitbewerb kaum mehr quantitativ erfassen kann, daher auf Vermutungen und Schätzungen zurückgreift, ist wohl die Frage „Ist weniger Information mehr?“ zulässig.
Sowohl die Technische wie auch die Fundamentale Analyse haben in einem Unternehmensumfeld ihre Daseinsberechtigung. Für die Kontrolle der operativen, d.h. der kurz- bis mittelfristigen Entwicklung, könnte hauptsächlich die Technische Analyse bevorzugt angewandt werden. Hingegen ist eine fundamentale Vorgehensweise bezüglich der strategischen Unternehmenspositionierung eine mögliche Voraussetzung für den künftigen Unternehmenserfolg.
2.2 Information versus Exformation
Welche Informationen benötigt der Technische Analyst zur Erstellung einer umsatz- und absatzorientierten Trendanalyse und Prognose? Es sind ausschließlich die relevanten Zahlen. Auf Informationen, die sich auf das Wie und Warum des Zustandekommens eines Ergebnisses beziehen, kann verzichtet werden zw. sind diese Teil der in einem Unternehmen vorhandenen, sich aus beispielsweise der täglichen Arbeit ergebenden Informationen und sind daher als Exformationen zu betrachten.
Grundsätzlich ist Information im jeweiligen Kontext zu verstehen bzw. zu interpretieren, eine allgemein gültige Definition für Information existiert nicht. Beispielsweise kann Information zusätzliches Wissen über eine spezifische Situation darstellen, aber auch im Zusammenhang mit „sich informieren“ eine Beseitigung oder Verkleinerung von Ungewissheit durch Auskunft, Aufklärung, Mitteilung und Benachrichtigung bedeuten. In diesem Zusammenhang sei auch das Informationsparadoxon (Wissenserwerb, der erst später bewertet werden kann) und die asymmetrische Information erwähnt. (vgl. Wikimedia, 2009, http://de.wikipedia. org/ wiki/ Information) Um bei einem Informationsempfänger verbesserte Entscheidungen auf Basis qualitativ hochwertiger Informationen zu ermöglichen, sind diesbezüglich acht Qualitätskriterien zu erfüllen. (vgl. Gräfe, 2005, S. 7)
Der Begriff „Exformation“ wurde vom dänischen Physiker Tor Nørretranders in den 1990er Jahren geprägt. Sinngemäß ist Exformation jene Information welche, in einem Bezugsrahmen, nicht dezidiert kommuniziert werden muss, die jedoch bekannt ist und somit ein gemeinsames Grundverständnis darstellt. (vgl. Wikimedia, 2009, http://de.wikipedia. org/ wiki/ Exformation)
Im betrieblichen Umfeld könnte dies bedeuten, dass dem Management die Gründe für die aktuelle Unternehmensentwicklung, beispielsweise das Auftreten eines neuen Mitbewerbers und ein damit ausgelöster Preiskrieg, bekannt sind und im Tagesgeschäft diese Problemstellung nicht (mehr) näher diskutiert werden muss.
2.3 Begriffsbestimmungen
2.3.1 Definition des Zeitraumes der Kurz- und Mittelfristigkeit
Fristigkeiten werden je nach Disziplin für unterschiedlich lange Zeiträume definiert, die Grenzen sind unscharf. In der Betriebswirtschaft werden allgemein die Zeitspanne für Kurzfristigkeit mit einem Jahr, die Mittelfristigkeit mit einer Zeitspanne von drei bis fünf Jahren und darüber hinausgehende Zeiträume als langfristig angenommen. Diese Zeiträume erscheinen in Anbetracht der Globalisierung und zunehmender Flexibilisierung von Unternehmen und Gesellschaften für die operativen Aktivitäten eines Unternehmens als antiquiert. Die Entwicklungen antizipierend und berücksichtigend, dass es sich bei der Technischen Analyse um ein finanzmarktorientiertes Instrument handelt, referenziert diese Master-Thesis als kurzfristig mit ein bis sechs Monate und mittelfristig mit sechs bis zwölf Monate. Alle über ein Jahr hinausgehenden Zeiträume sind somit als langfristig definiert.
2.3.2 Bildung eines Referenzindex
Voraussetzung für die Durchführung einer Technischen Analyse ist die Existenz einer vom Markt gebildeten Referenz. Im Falle der Analyse einer Unternehmensent-wicklung ist dies, wie bereits erwähnt, als Ergebnis von Angebot und Nachfrage der Umsatz bzw. der Absatz. Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass in jedem Unternehmen, gleich welcher Größenordnung, die Umsatzdaten auf monatlicher Basis zur Verfügung stehen und so zumindest ein Referenzindex für die Durchführung der Technischen Analyse gebildet werden kann.
Der Ist-Referenzindex für historische Daten auf Basis rollierender Geschäftsjahresergebnisse wird in Folge Moving Annual Total (MAT) genannt. Das planungsorientierte Äquivalent definiert sich als Moving Annual Planning (MAP) und bildet den Soll-Referenzindex ab. Per Definition sind das Moving Annual Total und das Moving Annual Planning Zahlen die finanzielle oder quantitative Werte einer Variablen auf einer Zwölfmonatsbasis, d.h. einem Wirtschaftsjahr, ausdrückt. Jedes Monat wird diese Zahl mit der aktuellen Variablen ergänzt und um die Variable des ersten Monats reduziert. (vgl. Yahoo, 2009, http:// answers.yahoo.com) Es erfolgt automatisch eine Glättung der unternehmensspezifische Saisonalitätskurve innerhalb der letzten zwölf Monate.
Die mathematischen Auslegungen des Moving Annual Total wie des Moving Annual Planning folgen den gleichen Prinzipien. Nachstehend werden die entsprechenden Gleichungen wie auch je ein Beispiel zur praktischen Verständnisdarstellung dargelegt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 5: Beispielsberechnung des MAP – Jahr 1-März, 2009
Wie aus der vorherigen Abbildung ersichtlich, betrug das Moving Average Total Ergebnis auf Basis des Jahres 1-März die Zahl 345 und lag damit in einer tolerablen Bandbreite von 2,3 Prozent unter der Planung (Moving Average Planning von 353). Eine solche geringe Differenz erfordert üblicherweise noch keine Korrekturmaßnahmen, es könnte sich auch nur um eine saisonale Verschiebung handeln. Stellt man jedoch das realisierte, erste Quartalsergebnis des aktuellen Jahres von 95 gegenüber der Planung von 103, so ergäbe sich bereits ein Minus von signifikanten rund acht Prozent und dies könnte zu voreiligen, möglicherweise falschen, Rückschlüssen hinsichtlich der weiteren Geschäftsentwicklung führen.
Werden die Moving Average Total Zahlen wie auch Moving Average Planning Daten in einem Diagramm als Referenzindizes dargestellt, können die aufgrund der Technischen Analyse erstellten Prognosen mit diesen Daten abgeglichen werden und bei signifikanten Abweichungen die mögliche Notwendigkeit von Korrekturmaßnahmen zeitnah anzeigen.
2.3.3 Exkurs I: Die Sigmoidkurve
Eine Sigmoidfunktion oder S-Funktion, eine mathematische Funktion, wird als S-förmiger Graph dargestellt (vgl. Wikimedia, 2009, http://de.wikipedia.org/wiki/ Sigmoidfunktion) Die Sigmoidkurve fasst nach Charles Handy die Geschichte von Lebenszyklen zusammen. Fast alle Entwicklungen, gleich welcher Art, beginnen zögernd, Rückschritte sind einzukalkulieren, konsolidieren sich und wachsen (vgl. Handy, Die Fortschrittsfalle, S. 66 – S. 82). Da nun jedes Wachstum beschränkt ist und letztendlich mit dem Tod endet, ist es die Kunst eines Unternehmensführers, zeitgerecht einen neuen Zyklus der Sigmoidkurve zu initiieren, um den Weiterbestand des Unternehmens sicherzustellen.
Charles Handy erkannte bereits 1994, dass die Beschleunigung aller Veränderungen (Stichwort Globalisierung) jede Sigmoidkurve schrumpfen lässt und der zur Verfügung stehende Zeitraum, um Anpassungen durchzuführen, sich auf nur mehr wenige Jahre wenn nicht Monate reduziert. (vgl. Handy, Die Fortschrittsfalle, S. 67) Die Herausforderung für eine Unternehmensführung besteht unter anderem darin, den richtigen Zeitpunkt für den Beginn eines neuen Sigmoidzyklus zu bestimmen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 6: Sigmoidkurve, 2009
Sind genügend historische Daten über einen längeren Zeitraum vorhanden, so kann der damit empirisch erfasste Unternehmensverlauf durch den Referenzindex visuell dargestellt werden. Der unternehmenskritische Trendwendepunkt, in diesem Falle der Initialzeitpunkt einer neuen Sigmoidkurve, kann möglicherweise durch ähnliche Entwicklungsmuster des Referenzindexes in der Vergangenheit des Unternehmens erkannt werden.
3 Einführung in die Technische Analyse
3.1 Die Geschichte der Technischen Analyse der Finanzmärkte
Charles Henry Dow wurde am 6. November 1851 geboren und startete seine Berufslaufbahn als Journalist. 1880 begann er bei Kiernan News Agency, New York, Börsennachrichten zusammenzustellen und gründete 1882, gemeinsam mit Edward David Jones und Charles Milford Bergstresser, die Dow Jones & Company, eine Agentur für Finanznachrichten, die den ersten Börsenbrief, den Customer Afternoon Letter, herausgab. 1884 veröffentlichte Dow den ersten Aktienindex, den Dow Jones Stock Average (heute unter dem Begriff Dow Jones Transportation Average bekannt), der sich zu Beginn aus den Schlusskursen von 11 Aktien, ein Jahr später aus 14 Aktientiteln zusammensetzte. 1889 beschäftigte das Unternehmen Dow
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
[...]
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2009
- ISBN (eBook)
- 9783842800298
- DOI
- 10.3239/9783842800298
- Dateigröße
- 792 KB
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2010 (August)
- Note
- 1
- Schlagworte
- betriebswirtschaft technische analyse trend planung umsatz
- Produktsicherheit
- Diplom.de