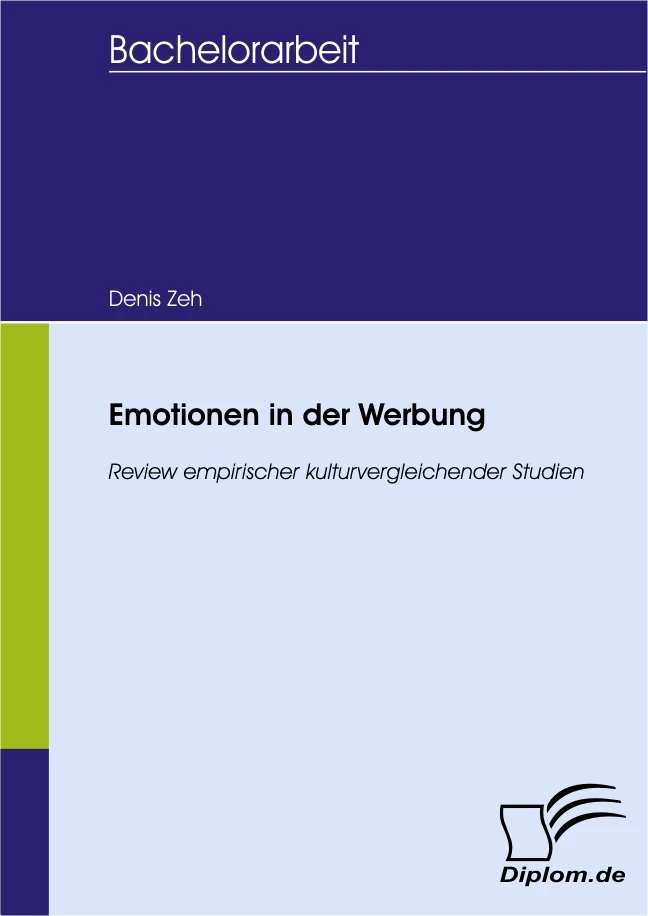Emotionen in der Werbung
Review empirischer kulturvergleichender Studien
©2009
Bachelorarbeit
50 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Die Informationsüberlastung in der Gesellschaft und Wirtschaft stellt ein zentrales Phänomen dar. In gesättigten Märkten sind die Produkte der Anbieter ausgereift und unterscheiden sich kaum voneinander. Die Produkte werden somit austauschbar. Nun bietet sich die Chance Konsumenten durch emotionale Kommunikation anzusprechen und ein unique selling feeling (USF) zu vermitteln, um eine unique selling proposition (USP) zu schaffen.
No advertising researcher, be it a practitioner or an academic, doubts that emotions are an important factor in the advertising process.
Die Forschung bezüglich Emotionen im Marketing erhielt in den 80er Jahren einen erheblichen Aufschwung und wichtige Erkenntnisse über die Wirkung von Emotionen in der Werbung konnten gemacht werden. Doch trotz Globalisierung befasst sich die Forschung kaum mit der Rolle von Emotionen bei Konsumentscheidungen in globalen Märkten.
Diese Arbeit widmet sich Emotionen in der Werbung und stellt ein Review empirischer kulturvergleichender Studien zu diesem Thema zusammen. Die Studien werden strukturiert, kritisch hinterfragt und ihre Ergebnisse vorgestellt. Da Werbung als Form der sozialen Kommunikation betrachtet werden kann und somit ein Spiegelbild der Kultur ist, wird folgender Frage nachgegangen.
Inwieweit unterscheiden sich Emotionen in der Werbung verschiedener Nationen oder Kulturen.
Da unterschiedliche Präferenzen und unterschiedliches Verhalten von Konsumenten im Zuge der Standardisierung des internationalen Marketing wenig untersucht werden, sind Erkenntnisse auf diesem Gebiet von hoher Relevanz.
Zu Beginn der Arbeit werden theoretische Grundlagen zu Emotionen dargelegt, indem der Emotionsbegriff abgegrenzt wird und verschiedene Emotionstheorien und modelle vorgestellt werden. Im Anschluss erfolgt die Auseinandersetzung mit emotionaler und transformationaler Werbung, um danach auf diverse emotionale Reize einzugehen, die in der Werbung verwendet werden. Daraufhin werden emotionale Reaktionen der Konsumenten auf die Werbung diskutiert.
Im nächsten Schritt werden theoretischen Grundlagen zu Kultur aufgezeigt. Hierfür wird Kultur definiert, um anschließend auf die Möglichkeiten der Operationalisierung von Kultur einzugehen. Im Folgenden werden die Themen Emotionen und Kultur zusammengeführt und ein Review empirischer kulturvergleichender Studien präsentiert. Auf die in den Studien untersuchten Aspekte wird eingegangen und die von den Studien […]
Die Informationsüberlastung in der Gesellschaft und Wirtschaft stellt ein zentrales Phänomen dar. In gesättigten Märkten sind die Produkte der Anbieter ausgereift und unterscheiden sich kaum voneinander. Die Produkte werden somit austauschbar. Nun bietet sich die Chance Konsumenten durch emotionale Kommunikation anzusprechen und ein unique selling feeling (USF) zu vermitteln, um eine unique selling proposition (USP) zu schaffen.
No advertising researcher, be it a practitioner or an academic, doubts that emotions are an important factor in the advertising process.
Die Forschung bezüglich Emotionen im Marketing erhielt in den 80er Jahren einen erheblichen Aufschwung und wichtige Erkenntnisse über die Wirkung von Emotionen in der Werbung konnten gemacht werden. Doch trotz Globalisierung befasst sich die Forschung kaum mit der Rolle von Emotionen bei Konsumentscheidungen in globalen Märkten.
Diese Arbeit widmet sich Emotionen in der Werbung und stellt ein Review empirischer kulturvergleichender Studien zu diesem Thema zusammen. Die Studien werden strukturiert, kritisch hinterfragt und ihre Ergebnisse vorgestellt. Da Werbung als Form der sozialen Kommunikation betrachtet werden kann und somit ein Spiegelbild der Kultur ist, wird folgender Frage nachgegangen.
Inwieweit unterscheiden sich Emotionen in der Werbung verschiedener Nationen oder Kulturen.
Da unterschiedliche Präferenzen und unterschiedliches Verhalten von Konsumenten im Zuge der Standardisierung des internationalen Marketing wenig untersucht werden, sind Erkenntnisse auf diesem Gebiet von hoher Relevanz.
Zu Beginn der Arbeit werden theoretische Grundlagen zu Emotionen dargelegt, indem der Emotionsbegriff abgegrenzt wird und verschiedene Emotionstheorien und modelle vorgestellt werden. Im Anschluss erfolgt die Auseinandersetzung mit emotionaler und transformationaler Werbung, um danach auf diverse emotionale Reize einzugehen, die in der Werbung verwendet werden. Daraufhin werden emotionale Reaktionen der Konsumenten auf die Werbung diskutiert.
Im nächsten Schritt werden theoretischen Grundlagen zu Kultur aufgezeigt. Hierfür wird Kultur definiert, um anschließend auf die Möglichkeiten der Operationalisierung von Kultur einzugehen. Im Folgenden werden die Themen Emotionen und Kultur zusammengeführt und ein Review empirischer kulturvergleichender Studien präsentiert. Auf die in den Studien untersuchten Aspekte wird eingegangen und die von den Studien […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Denis Zeh
Emotionen in der Werbung
Review empirischer kulturvergleichender Studien
ISBN: 978-3-8366-4568-3
Herstellung: Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2010
Zugl. Ludwig-Maximilian-Universität München, München, Deutschland, Bachelorarbeit,
2009
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und der Verlag, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplomica.de, Hamburg 2010
1
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis ... 2
Anhangsverzeichnis ... 3
Abkürzungsverzeichnis ... 4
1
Einleitung ... 5
2
Emotionen ... 7
2.1
Theoretische Grundlagen zu Emotionen ... 7
2.1.1
Abgrenzung des Emotionsbegriffs ... 7
2.1.2
Emotionstheorien und -modelle ... 8
2.2
Emotionen in der Werbung ... 11
2.2.1
Emotionale und transformationale Werbung ... 11
2.2.2
Emotionale Reize in der Werbung ... 14
2.2.3
Emotionale Reaktionen auf die Werbung ... 17
3
Kulturvergleichende Forschung zu Emotionen in der Werbung ... 19
3.1
Theoretische Grundlagen zu Kultur ... 19
3.1.1
Kulturbegriff und kulturvergleichende Forschung ... 20
3.1.2
Operationalisierung von Kultur ... 21
3.2
Review empirischer kulturvergleichender Studien ... 22
3.2.1
Untersuchte Nationen und Kulturauswahl ... 24
3.2.2
Untersuchte Emotionen, emotionale Reize und Medien ... 26
3.2.3
Methodik der Studien ... 27
4
Kulturelle Unterschiede bei Emotionen in der Werbung ... 32
4.1
Ergebnisse der Studien ... 33
4.2
Standardisierung internationaler Werbung ... 36
5
Forschungsausblick und Limitationen ... 37
Anhang ... 38
Literaturverzeichnis ... 41
2
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Eine schematische Gliederung der Bachelorarbeit ... 6
Abb. 2: Acht Basisemotionen nach Plutchik ... 10
Abb. 3: Rossiter-Percy Grid in vereinfachter Darstellung ... 13
Abb. 4: Modell emotionaler Reaktionen nach Edell/Burke in modifizierter
Darstellung ... 18
Abb. 5: Review empirischer kulturvergleichender Studien - Übersicht ... 23
Abb. 6: Review empirischer kulturvergleichender Studien - Methodik ... 28
3
Anhangsverzeichnis
Suchbegriffe für die Recherche in den Datenbanken
S. 38
Übersicht der im Review enthaltenen Akademischen Journals
S. 39
In den Studien behandelte emotionale Reize und Emotionen
S. 40
4
Abkürzungsverzeichnis
A
ad
attitude toward the ad
A
b
attitude toward the brand
UK
United Kingdom
5
1 Einleitung
Die Informationsüberlastung in der Gesellschaft und Wirtschaft stellt ein zentra-
les Phänomen dar. In gesättigten Märkten sind die Produkte der Anbieter aus-
gereift und unterscheiden sich kaum voneinander. Die Produkte werden somit
austauschbar.
1
Nun bietet sich die Chance Konsumenten durch emotionale
Kommunikation anzusprechen und ein ,,unique selling feeling" (USF) zu vermit-
teln, um eine ,,unique selling proposition" (USP) zu schaffen.
2
"No advertising researcher, be it a practitioner or an academic, doubts
that emotions are an important factor in the advertising process."
3
Die Forschung bezüglich Emotionen im Marketing erhielt in den 80er Jahren ei-
nen erheblichen Aufschwung und wichtige Erkenntnisse über die Wirkung von
Emotionen in der Werbung konnten gemacht werden.
4
Doch trotz Globalisie-
rung befasst sich die Forschung kaum mit der Rolle von Emotionen bei Kon-
sumentscheidungen in globalen Märkten.
5
Diese Arbeit widmet sich Emotionen in der Werbung und stellt ein Review empi-
rischer kulturvergleichender Studien zu diesem Thema zusammen. Die Studien
werden strukturiert, kritisch hinterfragt und ihre Ergebnisse vorgestellt. Da Wer-
bung als Form der sozialen Kommunikation betrachtet werden kann und somit
ein Spiegelbild der Kultur ist, wird folgender Frage nachgegangen.
6
Inwieweit unterscheiden sich Emotionen in der Werbung verschiedener
Nationen oder Kulturen.
Da unterschiedliche Präferenzen und unterschiedliches Verhalten von Konsu-
menten im Zuge der Standardisierung des internationalen Marketing wenig un-
tersucht werden, sind Erkenntnisse auf diesem Gebiet von hoher Relevanz.
7
1
Vgl. Kroeber-Riel (Konsumentenverhalten 2009), S. 149.
2
Vgl. Holbrook/O´Shaughnessy (Emotion in Advertising 1984), S. 47.
3
Poels/DeWitte (Measurement 2006), S. 18.
4
Vgl. Erevelles (Affect 1998), S. 211; Holbrook/O´Shaughnessy (Emotion in Advertising 1984),
S. 45 f.; Poels/DeWitte (Measurement 2006), S. 33 f.
5
Vgl. Erevelles (Affect 1998), S. 208.
6
Vgl. Hong et al. (Japanese and U.S. 1987), S. 55.
7
Vgl. Theodosiou/Leonidou (Standardization versus Adaption 2003), S. 154.
6
Zu Beginn der Arbeit werden theoretische Grundlagen zu Emotionen dargelegt,
indem der Emotionsbegriff abgegrenzt wird und verschiedene Emotionstheorien
und modelle vorgestellt werden. Im Anschluss erfolgt die Auseinandersetzung
mit emotionaler und transformationaler Werbung, um danach auf diverse emoti-
onale Reize einzugehen, die in der Werbung verwendet werden. Daraufhin
werden emotionale Reaktionen der Konsumenten auf die Werbung diskutiert.
Im nächsten Schritt werden theoretischen Grundlagen zu Kultur aufgezeigt.
Hierfür wird Kultur definiert, um anschließend auf die Möglichkeiten der Opera-
tionalisierung von Kultur einzugehen. Im Folgenden werden die Themen Emoti-
onen und Kultur zusammengeführt und ein Review empirischer kulturverglei-
chender Studien präsentiert. Auf die in den Studien untersuchten Aspekte wird
eingegangen und die von den Studien verwendete Methodik kritisch diskutiert.
Im Anschluss werden die Ergebnisse der in das Review aufgenommenen Studi-
en dargelegt und in Bezug auf die Standardisierung der internationalen Wer-
bung besprochen.
Die Arbeit schließt mit einem Ausblick auf die Forschung und dem Eingehen auf
Limitationen, wie der folgenden Abbildung entnommen werden kann.
Abb. 1: Eine schematische Gliederung der Bachelorarbeit
8
8
Eigene Darstellung
1
Einleitung
2
Emotionen
2.1
Theoretische Grundlagen zu
Emotionen
3
Kulturvergleichende Forschung zu
Emotionen in der Werbung
3.1
Theoretische Grundlagen zu
Kultur
2.2
Emotionen in der Werbung
3.2
Review empirischer kulturvergleichender Studien
3.2.1
Untersuchte Nationen und Kulturauswahl
3.2.2
Untersuchte Emotionen, emotionale Reize und Medien
3.2.3
Methodik der Studien
4
Kulturelle Unterschiede bei Emotionen in der Werbung
4.1
Ergebnisse der Studien
4.2
Standardisierung internationaler Werbung
5
F
o
rs
c
h
u
n
g
s
a
u
s
b
lic
k
u
n
d
L
im
it
a
ti
o
n
e
n
7
2 Emotionen
In folgendem Kapitel werden zunächst theoretische Grundlagen zu Emotionen
dargelegt und anschließend die Rolle von Emotionen in der Werbung diskutiert.
2.1 Theoretische Grundlagen zu Emotionen
Zunächst werden Definitionen von Emotionen aufgezeigt und Emotionen von
ähnlichen Begriffen abgegrenzt. Anschließend findet eine Auseinandersetzung
mit verschiedenen Emotionstheorien und -modellen statt.
2.1.1 Abgrenzung des Emotionsbegriffs
Emotionen sind im Leben der Menschen und folglich auch der Konsumenten
allgegenwärtig, doch in der Wissenschaft hat sich bisher keine allgemeingültige
Definition von Emotionen durchsetzen können.
9
Verschiedenste wissenschaftli-
che Disziplinen, wie die Psychologie, Neurologie, Soziologie, aber auch die
Ökonomie beschäftigen sich mit Emotionen und stellen Definitionen auf.
10
Aus
Marketingperspektive beschreiben Bagozzi et al. Emotionen als Zustand einer
mentalen Bereitschaft, der durch kognitive Bewertungen von Ereignissen oder
Gedanken hervorgerufen wird.
11
Emotionen entstehen demnach nicht ohne ei-
nen spezifischen Auslöser bzw. Stimulus und sind außerdem von Mensch zu
Mensch verschieden. Sie werden oft körperlich ausgedrückt, u.a. in Form von
Gestik und Mimik und können zu spezifischen Handlungen führen, wie Flucht
oder Angriff.
12
Nach dem Konsum- und Verhaltensforscher Kroeber-Riel ist vie-
len Emotionsdefinitionen gemeinsam, dass ,,eine Emotion ein subjektives Er-
eignis darstellt, also eine innere Erregung ist, die mehr oder weniger bewusst
als angenehm oder unangenehm erlebt wird und mit neurophysiologischen Vor-
gängen sowie häufig mit beobachtbarem Ausdrucksverhalten (...) einhergeht."
13
Dieses Verständnis von Emotionen wird der folgenden Arbeit zu Grunde gelegt.
Im Folgenden werden verwandte Begriffe wie z.B. Affekte, Gefühle, Stimmun-
gen und Einstellungen von Emotionen abgegrenzt. Diese werden mangels Kon-
9
Vgl. Bosch et al. (Emotionen im Marketing 2006), S. 25; Küpers/Weibler (Emotionen in Orga-
nisationen 2005), S. 49; Plassmann (Einfluss von Emotionen 2006), S. 43.
10
Vgl. Plassmann (Einfluss von Emotionen 2006), S. 27.
11
Vgl. Bagozzi et al. (Emotions in Marketing 1999), S. 184.
12
Vgl. Bagozzi et al. (Emotions in Marketing 1999), S. 184 f.; Bosch et al. (Emotionen im Mar-
keting 2006), S. 27; Holbrook/O´Shaughnessy (Emotion in Advertising 1984), S. 49.
13
Kroeber-Riel (Konsumentenverhalten 2009), S. 100.
8
sens in der Wissenschaft oft uneinheitlich oder synonym gebraucht.
14
Der Be-
griff ,,affect" wurde im angloamerikanischen Raum in der Vergangenheit breit
gefasst und dient als Oberbegriff für spezifische Bezeichnungen wie Emotionen,
Stimmungen und Einstellungen. Nicht zu verwechseln ist dies mit dem geläufi-
gen Ausdruck Affekt, der als kognitiv wenig kontrollierte Emotion angesehen
wird und eine kurze und intensive Kurzschlussreaktion darstellt.
15
Gefühle ihrer-
seits werden heute nicht mehr synonym mit Emotionen verwendet. Vielmehr
stellen Gefühle die erlebnisbetonte Seite einer Emotion dar.
16
Stimmungen wie
Niedergeschlagenheit oder Sorglosigkeit sind im Vergleich zu Emotionen von
längerer Dauer und niedrigerer Intensität und benötigen nicht zwingend einen
auslösenden Stimulus.
17
Einstellungen wiederum sind verglichen zu Emotionen
beständiger im Zeitverlauf und im engeren Sinne als wertende Urteile zu ver-
stehen. Sie sind zudem von niedrigerer Intensität als Emotionen.
18
2.1.2 Emotionstheorien und -modelle
Die Menge an Definitionen von Emotion spiegelt sich auch in der Vielzahl an
Emotionstheorien wider, jedoch wird keine einzige von diesen universal akzep-
tiert.
19
Verschiedene Erklärungsansätze liefern jeweils unterschiedliche Emoti-
onstheorien, wie beispielsweise Behavioristische Theorien, Kognitionstheorien,
Neurowissenschaftliche Theorien oder Evolutionstheorien.
Behavioristische Theorien betrachten Stimuli, die zu Reaktionen bzw. Verhalten
führen. Die dazwischenliegenden Vorgänge finden in einer sogenannten Black
Box statt und sind nicht beobachtbar. Emotionen gehen mit dem Verhalten ein-
her und sind als Ergebnis wiederum beobachtbar. Kognitionstheorien entwi-
ckeln diesen Gedanken weiter und ersetzen die Black Box durch kognitive Vor-
gänge, was zur Erklärung der Beziehung zwischen Stimulus und Reaktion bei-
14
Vgl. Bagozzi et al. (Emotions in Marketing 1999), S. 185; Holbrook/O´Shaughnessy (Emotion
in Advertising 1984), S. 48; Kroeber-Riel (Konsumentenverhalten 2009), S. 100.
15
Vgl. Bagozzi et al. (Emotions in Marketing 1999), S. 184; Batra/Ray (Affective Responses
1986), S. 235; Erevelles (Affect 1998), S. 199; Kroeber-Riel (Konsumentenverhalten 2009), S.
101; Plassmann (Einfluss von Emotionen 2006), S. 44 f.
16
Vgl. Kroeber-Riel (Konsumentenverhalten 2009), S. 102.
17
Vgl. Bagozzi et al. (Emotions in Marketing 1999), S. 184; Erevelles (Affect 1998), S. 199;
Kroeber-Riel (Konsumentenverhalten 2009), S. 100.
18
Vgl. Bagozzi et al. (Emotions in Marketing 1999), S. 185; Holbrook/O´Shaughnessy (Emotion
in Advertising 1984), S. 49.
19
Vgl. Bosch et al. (Emotionen im Marketing 2006), S. 25; Zeitlin/Westwood (Emotional Res-
ponse 1986), S. 36.
9
trägt.
20
Verhalten und folglich auch Emotionen werden laut Kognitionstheorien
durch kognitive Prozesse erst ermöglicht. Diese etablierte Sichtweise wurde je-
doch hinterfragt und die Möglichkeit der Unabhängigkeit von Emotionen in Be-
tracht gezogen. Zumindest manche Emotionen könnten demnach auch ohne
vorhergehende Registrierung oder Bewertung eines Stimulus, also automatisch
auftreten. Diese Auffassung wird in der Wissenschaft kontrovers diskutiert, trägt
aber zur Abgrenzung zwischen Emotionen und Kognitionen bei.
21
Neurowis-
senschaftliche Theorien betrachten Gehirnstrukturen wie das limbische System
und dort vorhandene Prozesse, die für das Entstehen von Emotionen verant-
wortlich sind. Erkenntnisse deuten darauf hin, dass Emotionen und Kognitionen
in verschiedenen Regionen des Gehirns entstehen, aber miteinander in Wech-
selwirkung stehen.
22
Evolutionstheorien erscheinen für das Marketing besonders relevant zu sein.
Die Grundannahme der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse ist auch im
Marketing von Bedeutung, betrachtet man Konsumenten die sich in der Kon-
sumwelt zurechtfinden müssen. Der Ansatz von Robert Plutchik wird im Fol-
genden herausgegriffen, da er ein umfassendes Erklärungsmodell für sämtliche
Arten von Emotionen bietet und für das Marketing eine überschaubare und
handhabbare Zahl an Emotionen liefert.
23
Emotionen sind laut Plutchik elementar für das Überleben eines Menschen. So-
bald ein Stimulus auftritt, wird er kognitiv bewertet und verursacht daraufhin ei-
ne subjektive Reaktion in Form einer Emotion. Diese Emotion führt zu einem
bestimmten Verhalten, welches für das Individuum und auch der gesamten
Spezies eine Funktion erfüllt. Ein Beispiel dafür ist das Erscheinen eines gefähr-
lichen Tieres (Stimulus), was als Gefahr bewertet wird (kognitive Bewertung)
und Furcht auslöst (subjektive Reaktion). Daraufhin flüchtet das Individuum
(Verhalten) und stellt damit seinen Schutz sicher (Funktion).
24
Plutchik identifi-
ziert acht relevante Funktionen der Evolution und verbindet sie mit acht Basis-
emotionen, die bei allen Lebewesen gleichermaßen auftreten. Durch Kombina-
tion jener Basisemotionen wird die Ableitung sämtlicher anderer Emotionen er-
20
Vgl. Bosch et al. (Emotionen im Marketing 2006), S. 29 ff.; Küpers/Weibler (Emotionen in Or-
ganisationen 2005), S. 50 ff.
21
Vgl. Bagozzi et al. (Emotions in Marketing 1999), S. 193; LeDoux (Gefühle 2006), S. 58 f.;
Zajonc (Primacy of Affect 1984), S. 117.
22
Vgl. Bosch et al. (Emotionen im Marketing 2006), S. 33 f.; LeDoux (Gefühle 2006), S. 75 f.
23
Vgl. Bosch et al. (Emotionen im Marketing 2006), S. 35 ff.; Zeitlin/Westwood (Emotional Res-
ponse 1986), S. 36.
24
Vgl. Plutchik (Emotion 1980), S. 155.
10
Freude
Akzeptanz
Furcht
Ärger
Überraschung
Traurigkeit
Erwartung
Ekel
möglicht.
25
In der Wissenschaft befassen sich mehrere Forscher mit der Idee
einer begrenzten Zahl von Basisemotionen, kommen jedoch zu unterschiedli-
chen Ergebnissen bezüglich Anzahl und Benennung der Basisemotionen. Im
Folgenden wird auf das Circumplex Modell von Plutchik verwiesen, das eine
Übersicht der von ihm identifizierten acht Basisemotionen liefert und sie oben-
drein in eine logische Beziehung setzt.
26
Abb. 2: Acht Basisemotionen nach Plutchik
27
Die Basisemotionen lauten Akzeptanz, Furcht, Überraschung, Traurigkeit, Ekel,
Ärger, Erwartung sowie Freude und wurden in Plutchiks Modell seit Veröffentli-
chung im Jahr 1980 nur leicht modifiziert. Man findet Basisemotionen bei allen
Menschen und in allen Kulturen, sie können jedoch durch individuelle und kultu-
relle Einflüsse variieren.
28
Basisemotionen bzw. Primäremotionen können wie
Farben gemischt werden und ergeben so komplexere Emotionen. Je näher sich
Basisemotionen im Circumplex Modell sind, desto ähnlicher sind sie sich. Ge-
genüberliegende Basisemotionen sind von gegensätzlicher Natur, wie z.B.
Freude und Traurigkeit.
29
Mischungen aus Basisemotionen werden Sekundär-
emotionen genannt und sind beispielsweise folgende: Freude und Akzeptanz
ergeben Liebe, Freude und Ärger führen zu Stolz und Freude und Überra-
schung resultieren in Vergnügen. Je verschiedener bzw. weiter entfernt die Ba-
sisemotionen im Modell sind, desto geringer ist die Chance ihrer Mischung,
doch bei erfolgreicher Mischung können innere Konflikte entstehen.
30
25
Vgl. Plutchik (Emotion 1980), S. 152.
26
Vgl. Bosch et al. (Emotionen im Marketing 2006), S. 47 f.; Plutchik (Emotion 1980), S. 160.
27
Eigene Darstellung in Anlehnung an Plutchik (Emotion 1980), S. 160.
28
Vgl. Kroeber-Riel (Konsumentenverhalten 2009), S. 111 f.; Ortony/Turner (Basic Emotions
1990), S. 317.
29
Vgl. Plutchik (Emotion 1980), S. 135 f.; Plutchik (Emotion 1980), S. 160 f.
30
Vgl. Plutchik (Emotion 1980), S. 162 f.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2009
- ISBN (eBook)
- 9783836645683
- Dateigröße
- 534 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Ludwig-Maximilians-Universität München – Betriebswirtschaft, Betriebswirtschaft
- Erscheinungsdatum
- 2014 (April)
- Note
- 1,7
- Schlagworte
- emotion werbung kultur review reiz
- Produktsicherheit
- Diplom.de