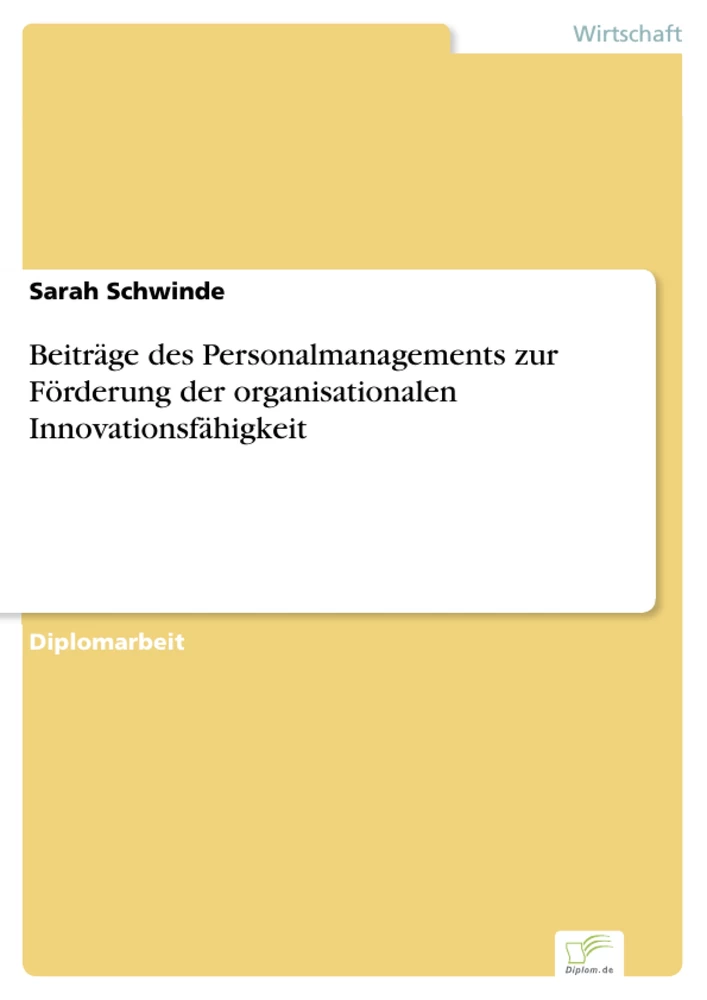Beiträge des Personalmanagements zur Förderung der organisationalen Innovationsfähigkeit
Zusammenfassung
Für den ökonomischen Erfolg von Unternehmen haben Innovationen eine zentrale Bedeutung. Diese These erfreut sich allgemeiner Zustimmung von Vertretern aus Wirtschaft und Politik, und dies sogar über Parteigrenzen hinweg. Unterstrichen wird die Relevanz von Innovationen durch die Entwicklung der ökonomischen, technologischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der vergangenen Jahre. Hohe, sich schnell ändernde Kundenanforderungen, gepaart mit scharfen Wettbewerbsbedingungen, verleihen der Forderung nach organisationaler Innovationsfähigkeit großen Nachdruck. Auch politische Aktivitäten auf Bundes- und Europaebene können als Evidenz für ein übergeordnetes Interesse an Innovationen herangezogen werden. Stellvertretend für viele weitere Maßnahmen sei hier exemplarisch auf die vom Europäischen Rat im Rahmen der Lissabon-Strategie formulierten Innovationsziele und auf den jährlich vom Bundesministerium für Bildung und Forschung verfassten Bericht Forschung und Innovation in Deutschland verwiesen.
Seit den richtungweisenden Ausführungen von Burns und Stalker in ihrem Werk The Management of Innovation erfreut sich das Innovationsphänomen in der Literatur wachsender Beliebtheit. In der Wissenschaft spiegelt sich somit in gewisser Weise die im Laufe der Zeit mehr und mehr erkannte praktische Relevanz von Innovationen wider. Bei der Analyse neuerer empirischer Studien zur Innovationsförderung wird schnell deutlich, dass der Faktor Mensch in diesem Zusammenhang eine zentrale Rolle einnimmt. Dies im Hinterkopf, fällt der Brückenschlag zum Thema der vorliegenden Arbeit nicht schwer, denn schließlich steht das Titelwort Personalmanagement für den Umgang mit eben diesem entscheidenden Faktor - dem Menschen. Ziel der Arbeit ist es, personalwirtschaftliche Beiträge entlang des - bildlich gesprochen - oft steinigen und schlecht ausgeschilderten Weges zu einer innovativen Unternehmung aufzuzeigen.
Um letztendlich Aussagen über die verschieden Angriffspunkte des Personalmanagements zur Förderung der organisationalen Innovationsfähigkeit ableiten zu können, sind zunächst die relevanten theoretischen Grundlagen zu erörtern. Die dabei zu Beginn dargebotene Klärung des Begriffs Innovation, die Enthüllung spezifischer Merkmale und die Charakterisierung von Innovationen als Prozess lassen erste Rückschlüsse auf die Anforderungen an innovative Organisationen zu. Sodann rücken die Mitarbeiter ins Zentrum der Betrachtung. Neben […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
INHALTSVERZEICHNIS
II. ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
III. ABBILDUNGSVERZEICHNIS
1. Einleitung
2. Grundlegendes zur Innovationsfähigkeit
2.1 Zum Innovationsbegriff
2.2 Persönlichkeitsmerkmale und Fähigkeiten innovativer Mitarbeiter
2.3 Widerstände gegen Innovationen
2.3 Bedeutung und Ausprägungen von Innovationskulturen
3. Bereitstellung innovativer Humanressourcen
3.2 Gezielte Personalauswahl zur Steigerung des organisationalen Innovationspotentials
3.2.1 Eignungsdiagnostische Verfahren zur Bestimmung von Innovativität
3.2.2 Gestaltungsmöglichkeiten von Auswahlverfahren
3.3 Förderung innovativer Handlungskompetenz durch Personalentwicklung
3.3.1 Entwicklung innovationsbezogener Fachkompetenz
3.3.2 Entwicklung innovationsbezogener Methodenkompetenz
4. Aktivierung innovativer Humanressourcen
4.1 Begleitung des Innovationsprozesses durch den Vorgesetzten
4.1.1 Phase der Ideengenerierung
4.1.2 Phase der Ideenauswahl
4.1.3 Phase der Ideenrealisierung
4.2 Beeinflussung des Innovationsverhaltens durch ausgewählte Anreizsysteme
4.2.1 Das betriebliche Vorschlagswesen
4.2.2 Qualitätszirkel
5. Schlussbetrachtung
6. LITERATURVERZEICHNI
II. ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
III. ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Abbildung 1: Aufbau der Arbeit
Abbildung 2: Regressionsgleichung für Kreativität
Abbildung 3: Vier-Felder-Matrix zur Personalentwicklung
Abbildung 4: Psychologie der Innovationsgenerierung
Abbildung 5: Führungsstile
1. Einleitung
Für den ökonomischen Erfolg von Unternehmen haben Innovationen eine zentrale Bedeutung.[1] Diese These erfreut sich allgemeiner Zustimmung von Vertretern aus Wirtschaft und Politik, und dies sogar über Parteigrenzen hinweg.[2] Unterstrichen wird die Relevanz von Innovationen durch die Entwicklung der ökonomischen, technologischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der vergangenen Jahre. Hohe, sich schnell ändernde Kundenanforderungen, gepaart mit scharfen Wettbewerbsbedingungen, verleihen der Forderung nach organisationaler Innovationsfähigkeit großen Nachdruck.[3] Auch politische Aktivitäten auf Bundes- und Europaebene können als Evidenz für ein übergeordnetes Interesse an Innovationen herangezogen werden. Stellvertretend für viele weitere Maßnahmen sei hier exemplarisch auf die vom Europäischen Rat im Rahmen der Lissabon-Strategie formulierten Innovationsziele[4] und auf den jährlich vom Bundesministerium für Bildung und Forschung verfassten Bericht „Forschung und Innovation in Deutschland“[5] verwiesen.
Seit den richtungweisenden Ausführungen von Burns und Stalker in ihrem Werk „The Management of Innovation“ erfreut sich das Innovationsphänomen in der Literatur wachsender Beliebtheit.[6] In der Wissenschaft spiegelt sich somit in gewisser Weise die im Laufe der Zeit mehr und mehr erkannte praktische Relevanz von Innovationen wider. Bei der Analyse neuerer empirischer Studien zur Innovationsförderung wird schnell deutlich, dass der Faktor Mensch in diesem Zusammenhang eine zentrale Rolle einnimmt.[7] Dies im Hinterkopf, fällt der Brückenschlag zum Thema der vorliegenden Arbeit nicht schwer, denn schließlich steht das Titelwort Personalmanagement für den Umgang mit eben diesem entscheidenden Faktor – dem Menschen. Ziel der Arbeit ist es, personalwirtschaftliche Beiträge entlang des – bildlich gesprochen – oft steinigen und schlecht ausgeschilderten Weges zu einer innovativen Unternehmung aufzuzeigen.
Um letztendlich Aussagen über die verschieden Angriffspunkte des Personalmanagements zur Förderung der organisationalen Innovationsfähigkeit ableiten zu können, sind zunächst die relevanten theoretischen Grundlagen zu erörtern. Die dabei zu Beginn dargebotene Klärung des Begriffs Innovation, die Enthüllung spezifischer Merkmale und die Charakterisierung von Innovationen als Prozess lassen erste Rückschlüsse auf die Anforderungen an innovative Organisationen zu. Sodann rücken die Mitarbeiter ins Zentrum der Betrachtung. Neben innovationsrelevanten Fähigkeiten und Persönlichkeitsmerkmalen wird auch den damit eng verbunden Widerständen gegen Innovationen Rechnung getragen. Den Abschluss des Grundlagenkapitels bilden Ausführungen zur Unternehmenskultur, die – wie bereits aus nachfolgender Graphik deutlich wird – in einer interessanten Wechselbeziehung zu den Mitarbeitern der Unternehmung steht. Die Unternehmenskultur wird einerseits durch die Mitarbeiter geprägt; andererseits beeinflusst sie rückwirkend deren Verhalten.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Aufbau der Arbeit (eigene Darstellung)
Wie ebenfalls dem visuell dargestellten Aufbau dieser Arbeit zu entnehmen, sind zur näheren Betrachtung lediglich die Handlungsfelder Personalauswahl, Personalentwicklung, Personalführung und Anreizgestaltung vorgesehen.
2. Grundlegendes zur Innovationsfähigkeit
Aus personalwirtschaftlichem Blickwinkel lassen sich drei grundlegende Faktoren der organisationalen Innovationsfähigkeit identifizieren. Kurz und bündig formuliert geht es um mitarbeiterbezogenes Können, Wollen und Dürfen.[8] Die grundlegende Bedeutung dieser Faktoren kommt implizit im Rahmen der Thematisierung innovationsrelevanter Fähigkeiten (Können), innovationsrelevanter Persönlichkeitsmerkmale sowie innovationsbezogener Widerstände (Wollen) und innovationsförderlicher Unternehmenskulturen (Wollen und Dürfen) zum Ausdruck. Bevor diese Aspekte in den Mittelpunkt der Betrachtung rücken, ist jedoch erst einmal mit dem Tatbestand der Innovation selbst vorliebzunehmen.
2.1 Zum Innovationsbegriff
Eine Definition im weitesten Sinne
Auf Grund des bereits herausgestellten, übergeordneten Interesses an Innovationen wundert die Vielfalt wissenschaftlicher Disziplinen, die sich mit Innovationen auseinandersetzen, nicht.[9] Denkt man nur an die unterschiedlichen Forschungsinteressen zweier dieser Disziplinen – der Psychologie und der Wirtschaftswissenschaft –, so ist die Entstehung uneinheitlicher Definitionen[10] leicht nachzuvollziehen. Als erster Wirtschaftswissenschaftler mit prägendem Einfluss auf den Innovationsbegriff wird Schumpeter gehandelt,[11] auch wenn dieser das Wort Innovation selbst noch nicht verwendet hat.[12]
Eine sehr weit gefasste und daher viele Ansichten in sich vereinende Definition beschreibt Innovationen als „die Entwicklung, Einführung und Anwendung neuer Ideen, Prozesse, Produkte oder Vorgehensweisen, von denen Einzelne, Gruppen oder ganze Organisationen profitieren“.[13] Auf Grund ihres umfassenden Verständnisses von Innovation wird diese Definition – allerdings unter Berücksichtigung der folgenden Anmerkungen – als Basis der vorliegenden Arbeit gewählt. Kritisch zu würdigen ist nämlich das in der Definition verwendete Verb profitieren, da die hiermit vorausgesetzte Vorteilhaftigkeit von Innovationen einer subjektiven Nutzeneinschätzung unterliegt und darüber hinaus in der Regel erst einige Zeit nach ihrer Umsetzung abschließend beurteilt werden kann.[14] Die obige Definition vernachlässigt also zu betonen, dass es sich oft lediglich um erwartete Verbesserung‚ gemessen an den Wertvorstellungen der Innovierenden, handelt.
Im Hinblick auf die späteren Ausführungen bedarf es allerdings einer über diese erste Definition hinausgehenden Präzision des Innovationsbegriffs. Im Folgenden wird daher vertiefend auf die Merkmale von Innovationen und die Phasen, in denen sie sich vollziehen, eingegangen.
Merkmale von Innovationen
Nach seiner umfassenden Literaturanalyse identifizierte Thom den Neuigkeitsgrad, die Unsicherheit, die Komplexität und den Konfliktgehalt als die vier allgemein anerkannten Merkmale von Innovationen.[15] Auch bei der Sichtung neuerer Literatur bestätigt sich dieses bereits von Thom beschriebene Bild.[16]
Die etymologische Wurzel des Wortes Innovation – das lateinische innovatio – steht für Erneuerung und macht den Neuigkeitsgrad somit zum konstitutiven Merkmal von Innovationen.[17] Besondere Aufmerksamkeit verdient der subjektive Charakter dieses Merkmals:[18] In der engsten Sichtweise kann zum Beispiel eine Idee, ein Prozess, ein Produkt oder eine Vorgehensweise nur für ein einzelnes Individuum neuartig sein, während andere diesen Tatbestand bereits zu einem früheren Zeitpunkt erkannt haben. Weiter gefasste Perspektiven wären beispielsweise die Neuartigkeit innerhalb einer bestimmten Branche, die Neuartigkeit für eine bestimmte Nation oder gar für die gesamte Menschheit.[19] Als Bezugspunkt für die Entscheidung über den Grad der Neuartigkeit scheint für betriebswirtschaftliche Fragestellungen im Allgemeinen und für diese Arbeit im Besonderen das sozio-technische System Organisation besonders geeignet.[20] Im Folgenden beziehen sich Innovationen also auf die erstmalige Einführung einer Idee, eines Prozesses, eines Produkts oder einer Vorgehensweise in einem Unternehmen.
Unmittelbar verbunden mit dem Grad der Neuartigkeit ist das Merkmal Unsicherheit: Je neuer eine Innovation für die jeweilige Organisation ist, desto größer sind die mit ihr einhergehenden Unsicherheiten. Dies lässt sich besonders auf fehlendes Erfahrungswissen zurückführen.[21] Häufig sind die vorliegenden Informationen unvollständig und weisen durch ihren Zukunftsbezug hohe Unsicherheiten auf.[22] Diese Unsicherheiten beziehen sich nicht nur auf die Verwertbarkeit des Innovationsergebnisses; es ist zum Beispiel auch an die benötigte Zeit oder die zunächst einmal verursachten Kosten zu denken.[23]
Innovationsprozesse verlaufen in der Regel nicht linear, werden häufig stark von der Dynamik der Unternehmensumwelt beeinflusst und sind regelmäßig durch eine große Zahl beteiligter Personen gekennzeichnet. All diese Komponenten weisen – natürlich in Abhängigkeit vom Innovationsgegenstand selbst – auf die Komplexität als drittes Merkmal von Innovation hin.[24] Hinsichtlich des Innovationsgegenstands sei darauf hingewiesen, dass vor allem in der neueren Literatur von dem Standpunkt Abstand genommen wird, Innovationen seien lediglich radikale Änderungen. Diese Sichtweise wird vielmehr durch ein gemäßigtes Verständnis ersetzt, das in Anlehnung an japanische Managementansätze wie Kaizen auch inkrementale Veränderungen berücksichtigt.[25] Naturgemäß fällt die Komplexität solch kleinschrittiger Innovation im Gegensatz zu grundlegenden Neuerungen deutlich geringer aus.
Das letzte zu beleuchtende Merkmal, der Konfliktgehalt, ist natürlich nicht unabhängig von den bereits vorgestellten Merkmalen. Die Notwendigkeit, mit Unsicherheiten umzugehen, trägt ebenso zum Konfliktpotential bei wie die aus der Komplexität resultierende Anzahl eingebundener Mitarbeiter.[26] Neben Konflikten, die auf verschiedenen Interessen und Wertvorstellungen von Mitarbeitern basieren, ist natürlich auch an Divergenzen zwischen organisationalen und individuellen Zielen zu denken.[27]
Innovation als Prozess
Um trotz der analytischen Schwierigkeiten eine exakte und zudem allgemeingültige Abgrenzung einzelner Phasen des Innovationsprozesses vornehmen zu können[28], ist eine grobe Gliederung für die späteren Ausführungen unerlässlich. Nur so können die im Innovationsprozess sehr verschiedenen Anforderungen an die Förderung der organisationalen Innovationsfähigkeit durch das Personalmanagement erkannt und entsprechend berücksichtigt werden. Da Innovationsprozesse in der Praxis sehr unterschiedlich geartet sind, ist bewusst von einer zu speziellen und zu detaillierten Phasierung abzusehen. Aufgrund des sich ergebenden, relativ abstrakten Niveaus wird in dieser Arbeit einer häufig vorzufindenden Dreiteilung des Innovationsprozesses gefolgt.[29] Die hier unterschiedenen Phasen Ideengenerierung, Ideenauswahl und Ideenrealisierung werden im Folgenden näher betrachtet.
Bezüglich der Phase der Ideengenerierung ist zunächst festzuhalten, dass Innovationen in den allermeisten Fällen nicht das Resultat zufälliger genialer Einfälle sind, sondern auf bewussten und zielgerichteten Überlegungen basieren.[30] Auf diese erste Phase entfallen die Wahrnehmung und Konkretisierung des Innovationsbedarfs, die eigentliche Ideenfindung und eine erste Formulierung bzw. Ausarbeitung der generierten Ideen. Nachdem bei diesen ersten Schritten die Quantität strategisch relevanter Ideen im Vordergrund steht, gewinnt in der folgenden Phase die Qualität an Bedeutung. In der Phase der Ideenauswahl geht es nämlich um die Prüfung und die Entscheidung für oder gegen bestimmte Lösungsvarianten. In der letzten Phase – der Ideenrealisierung – steht schließlich die konkrete Umsetzung der zuvor ausgewählten Variante im Mittelpunkt der Betrachtung.[31]
Die Ideenrealisierung ist, natürlich in Abhängigkeit vom Innovationsgegenstand selbst, ein mehr oder weniger langwieriger Prozess. Es ist daher zweckmäßig, nicht nur binär zwischen erfolgreicher und fehlgeschlagener Umsetzung von Innovationen zu unterscheiden, sondern den Grad der Implementierung zur weiteren Differenzierung heranzuziehen. Dieser kann durch zwei Dimensionen näher klassifiziert werden. Die erste, die Tiefendimension, gibt dabei an, inwieweit es durch das innovationsbedingte neue Vorgehen im Arbeitsalltag zu einer tatsächlichen Ausschöpfung des vollen Verbesserungspotentials der Innovation kommt. Die zweite Dimension, die Breitendimension, bringt hingegen zum Ausdruck, inwieweit sich die Innovation an den verschiedenen betroffenen Stellen im Unternehmen in vorgesehener Weise durchgesetzt hat.[32]
Auch wenn die Thematisierung der Merkmale von Innovationen im vorherigen Kapitel schon ein impliziter Hinweis darauf war, dass Innovationen keine Routineprozesse sind, sei hier noch einmal explizit erwähnt, dass die vorgestellten Phasen lediglich eine gedankliche Struktur darstellen. Der Prozessablauf folgt keiner streng sequenziellen Reihenfolge; vielmehr ist von Wiederholungsschleifen und Überlagerungen der einzelnen Phasen auszugehen.[33]
2.2 Persönlichkeitsmerkmale und Fähigkeiten innovativer Mitarbeiter
Zu den in der Literatur im Zusammenhang mit individueller Innovationsfähigkeit meistgenannten Eigenschaften gehört zweifelsfrei die Kreativität.[34] Die Frage nach den Eigenschaften kreativer Individuen hat seit der Forderung Guildfords nach entsprechenden Studien eine der längsten Traditionen in der Kreativitätsforschung.[35] Der Großteil der zahlreichen, im Laufe der Zeit angestellten Untersuchungen ist entweder persönlichkeitstheoretischer oder denkpsychologischer Art.
Bei den damit angesprochenen kognitiven Prozessen sind die Disharmonien der in der Literatur vertretenen Ansichten nicht zu übersehen. Mit relativ großer Einigkeit wird allerdings die Bedeutung des divergenten Denkens herausgestellt. Im Unterschied zum konvergenten Denken, bei dem das Finden einer einzigen richtigen Lösung zu vorgegebenen Aufgaben im Vordergrund steht, geht es hier darum, möglichst viele verschiedenartige, originelle Lösungsansätze zu erkennen.[36] In die gleiche Richtung gehen die häufig zur näheren Beschreibung kreativer Denkprozesse herangezogenen Begriffe Flüssigkeit, Flexibilität und Originalität.[37] Die im Alltagsgebrauch doch recht unkonventionelle Bezeichnung von Gedanken als flüssig und flexibel steht für einen schnellen und leichten Ideenfluss, der sich notwendigen Richtungswechseln nicht verschließt.[38]
Neben den bereits angesprochenen Differenzen bezüglich der kognitiven Prozesse laufen auch die in der Literatur vertretenen Ansichten über die Relevanz vorhandener Wissensstrukturen für kreative Leistungen auseinander. Einige Autoren erachten ein möglichst breites Wissen als besonders kreativitätsförderlich[39], andere betonen eher die Bedeutung von domänenspezifischem Fachwissen[40] ; wieder andere berichten, dass vorhandene Wissensstrukturen den kreativen Prozess sogar negativ beeinträchtigen können.[41] Eine vermittelnde und schlüssig erscheinende Position in dieser Kontroverse geht davon aus, dass Wissen prinzipiell einen förderlichen Charakter hat, solange es flexibel ist.[42] Gründe für die weiteren Unstimmigkeiten darüber, ob nun ein breites oder ein spezielles Wissen bedeutsamer ist, können in den unterschiedlichen Anforderungen entlang des kreativen Prozesses gesehen werden. Maier et al. gehen davon aus, dass ein breiteres Wissen bei der Ideengenerierung von besonderem Nutzen sei, während bei der Spezifizierung Detailwissen an Bedeutung gewinne.[43] Abschließend sei das ebenfalls umstrittene Verhältnis von Kreativität und allgemeiner Intelligenz erwähnt. Auch wenn auf Grund der gebotenen Kürze nicht auf die Vielzahl einzelner Ansätze und Forschungsergebnisse eingegangen werden kann, ist doch festzuhalten, dass die Annahme einer positiven Korrelation zwischen allgemeiner Intelligenz und Kreativität in der Literatur überwiegt.[44]
Neben diesen rein kognitiven Merkmalen werden kreativen Persönlichkeiten natürlich auch weitere, nicht oder nicht direkt mit kognitiven Prozessen und Strukturen in Verbindung stehende Eigenschaften zugeschrieben. Auf Grund der Fülle einschlägiger Literatur sind besonders in neueren Werken Übersichten zu den genannten Persönlichkeitsmerkmalen zu finden, die teilweise auch Systematisierungsversuche umfassen.[45] Kreativität begünstigende Wirkung wird vor allem einem hohen Selbstvertrauen, großer Offenheit und der Nonkonformität zugeschrieben. Unter Letzterer zu subsumierende Merkmale wie Autonomiestreben, Unkonventionalität oder Individualismus sind jedoch oft mit einer negativen Wertschätzung belegt.[46] Das unter Offenheit gefasste Merkmalsbündel enthält ferner Neugierde, breite Interessen, Flexibilität, eine offene Haltung gegenüber Neuem, Akzeptanz von Risiken und Ambiguitätstoleranz. Letztere meint die Fähigkeit, mit Widersprüchen, Mehrdeutigkeiten und Ungewissheiten umgehen zu können.[47] Das erwähnte Selbstvertrauen begünstigt die Öffnung von Individuen und stützt den Mut, der zur Nonkonformität notwendig ist.[48]
Die bis hierher thematisierte Kreativität ist eine notwendige, aber keine hinreichende Voraussetzung der Innovationsfähigkeit.[49] Besonders in den späten Phasen des Innovationsprozesses gewinnen weitere, teilweise völlig anders geartete Kompetenzen und Eigenschaften der Mitarbeiter an Bedeutung.[50] Speziell in der Phase der Ideenauswahl sind analytische Fähigkeiten und strategisches Geschick unerlässlich.[51] Bei der Ideenrealisierung treten weiterhin Überzeugungsvermögen auf der einen und Anpassungsfähigkeit bzw. -bereitschaft auf der anderen Seite hinzu.[52] Die damit angesprochenen motivationstheoretischen Überlegungen sind natürlich nicht nur auf die Bereitschaft zur Anpassung zu beziehen; Motivation ist vielmehr über den gesamten Innovationsprozess eine äußerst bedeutsame Komponente.[53] Gleiches gilt für die breite Palette sozialer Kompetenzen, da der gesamte Prozess, wie bereits festgestellt, durch vielfältige Interaktionsbeziehungen gekennzeichnet ist. Empirisch nachgewiesen ist dieser Zusammenhang insbesondere für die in den Innovationsprozess involvierten Führungskräfte.[54]
2.3 Widerstände gegen Innovationen
Eng verbunden mit dem Vorhandensein der soeben erwähnten Fähigkeiten und der Bereitschaft der Mitarbeiter ist die Entstehung von Widerstand gegen Innovationen. Neben rein rationalen Argumenten, die auf technologischen, ökologischen und ökonomischen Überlegungen basieren,[55] existieren nämlich weitere Innovationsbarrieren.
Zwei bereits sehr früh erkannte Innovationshindernisse sind die so genannten Barrieren des Nichtwissens bzw. Nichtkönnens und die des Nichtwollens.[56] Die Existenz Ersterer folgt unmittelbar aus dem Wesen der Innovation, speziell aus dem Merkmal der Neuartigkeit.[57] So müssen sich die mit der Innovation bzw. mit dem Innovationsbedarf konfrontierten Mitarbeiter beispielsweise mit bisher unbekannten Ursachen-Wirkungs-Ketten, neuen Vorgehensweisen und ungewohnten Begrifflichkeiten auseinandersetzen. Nehmen sie die Anforderungen aus subjektiver Perspektive als Überforderung wahr, so droht Widerstand auf Grund von Fähigkeitsbarrieren.[58]
Die zweite Barriere – die des Nichtwollens – kann trotz angenommener oder tatsächlich vorhandener Befähigungen auftreten. Der dabei zustande kommende innere Widerstand, Neues zu fördern bzw. zu akzeptieren, wurzelt nicht unbedingt im Unbewussten, sondern ist häufig durchaus reflektierter Art. Ursächlich für diesen Widerstand können zum Beispiel weltanschauliche, sachliche oder persönliche Gründe sein.[59] Zu Letzteren zählen u. a. die Angst vor dem Wegbrechen lieb gewonnener Gewohnheiten und antizipierte negative Auswirkungen auf die eigene Bedürfnisbefriedigung.[60] Besonders im Innovationskontext wird in diesem Zusammenhang regelmäßig von so genannten Risikobarrieren gesprochen. Gemeint sind damit wahrgenommene Risiken, einen materiellen oder immateriellen Nachteil zu erleiden.[61]
Eine weitere Barriere ist die des Nichtdürfens. Einen guten Nährboden für Widerstände dieser Art bieten mechanische Strukturen. In idealtypischer Ausprägung sind sie u. a. durch genau abgegrenzte Verantwortungsbereiche und strikte organisatorische Regelungen gekennzeichnet.[62] Mitarbeiter fühlen sich unter diesen Voraussetzungen tendenziell eher nicht zuständig, da die mit einer Innovation einhergehenden Aufgaben und Anforderungen auf Grund ihrer Neuartigkeit in den jeweiligen Stellenausschreibungen nicht aufgeführt sind. Spezielle und ungewöhnliche Fälle – zu denen problematische Situationen, aus denen Innovationen regelmäßig hervorgehen, in der Regel gehören – sind an Vorgesetzte weiterzuleiten. Damit entfernt sich die Handhabung von den direkt Betroffenen, die über das notwendige Fachwissen verfügen.[63]
Ein in Theorie und Praxis allgemein anerkannter Ansatz zur Überwindung der oben genannten Barrieren ist der Einsatz so genannter Promotoren;[64] dies sind hochmotivierte Mitarbeiter, die den Innovationsprozess aktiv und intensiv vorantreiben.[65] Befähigt durch hierarchisches Potential, wirken Machtpromotoren vorhandenen Willensbarrieren durch gezieltes Setzen positiver und negativer Anreize entgegen.[66] Der Fachpromotor verfügt – wie die Bezeichnung schon vermuten lässt – über ein ausgeprägtes Fachwissen. Dieses befähigt ihn, die Innovation durch fundierte Argumente gegen Widerstände zu schützen. Weiterhin trägt der Fachpromotor durch Weitergabe seines Wissens zum Abbau von Fähigkeitsbarrieren bei.[67] Zu den Aufgaben des Prozesspromotors gehört die Vermittlung zwischen Fach- und Machtpromotor oder zwischen Vorgesetzten und hierarchisch untergeordneten Mitarbeitern, die in der Regel über mehr Spezialwissen verfügen.[68]
[...]
[1] Vgl. Meiren 2005, S. 127, siehe auch Meffert 1976, S. 77, siehe auch Delhees 1998, S.17, siehe weiter Ruf 1996, S. 26.
[2] Vgl. Hildmann 1997, S. 7f, siehe auch Schirmer 2000, S. 340.
[3] Vgl. Haller 2003, S. 22ff, siehe auch Thom 1980, S. 7.
[4] Vgl. Schneider & Spelten 2005, S.1.
[5] Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung 2006, S. 7ff.
[6] Vgl. Bonn 2002, S. 66.
[7] Vgl. Haller 2003, S. 107ff.
[8] Vgl. Behrends 2001, S. 95f, siehe auch Gebert 2002, S. 195, siehe weiter Knoche 2005,
S. 19.
[9] Vgl. Guldin 2001, S. 290, siehe auch Wissel 2001, S. 18.
[10] Vgl. Hauschildt 1993, S. 4f, siehe auch Bonn 2002, S. 68.
[11] Vgl. Wissel 2001, S. 18, siehe auch Bonn 2002, S. 95.
[12] Vgl. Schumpeter 1931, S. 100ff.
[13] Maier et al. 2007, S. 810.
[14] Vgl. Thom 1980, S. 25, siehe auch Kern 1976, S. 277, siehe weiter Guldin 2001, S. 291.
[15] Vgl. Thom 1980, S. 23.
[16] Vgl. Wissel 2001, S. 26, siehe auch Haller 2003, S. 66ff.
[17] Vgl. Thom 1980, S. 23, siehe auch Bonn 2002, S. 66.
[18] Vgl. Hauschildt 1993, S. 13, siehe auch Gemünden & Salomo 2004, S. 506.
[19] Vgl. Haller 2003, S. 67.
[20] Vgl. Thom 1980, S. 24.
[21] Vgl. Thom 1980, S.27.
[22] Vgl. Scholl 2004, S. 5ff.
[23] Vgl. Wissel 2001, S. 25.
[24] Vgl. Thom 1980, S. 29, siehe auch Wissel 2001, S. 25, siehe weiter Haller 2003, S. 67.
[25] Vgl. Gebert 2007, S. 783, siehe auch Haller 2003, S. 75.
[26] Vgl. Haller 2003, S. 67, siehe auch Thom 1980, S. 29f.
[27] Vgl. Schanz 2000, S. 18.
[28] Vgl. Thom 1980, S. 45, siehe auch Meißner 1989, S.19f.
[29] Vgl. Krieger 2005, S. 24, siehe auch Thom 1980, S. 52f, siehe weiter Haller 2003, S. 85.
[30] Vgl. Maier et al. 2007, S. 817, siehe auch Schuler & Görlich 2007, S. 28.
[31] Vgl. Thom 1980, S. 53, siehe auch Haller 2003, S. 87ff.
[32] Vgl. Lewis & Seibold 1993, S. 323.
[33] Vgl. Piechottka 1991, S. 26f, siehe auch Thom 1980, S. 45, siehe weiter Haller 2003, S.85.
[34] Vgl. Thom 1980, S. 57.
[35] Vgl. Guildford 1950, S. 454.
[36] Vgl. Schuler & Görlich 2007, S. 20f, siehe auch Maier et al. 2007, S. 822f, siehe weiter Nütten & Sauermann 1988, S. 134.
[37] Vgl. Delhees 1998, S. 19, siehe auch Oerter 1971, S. 314ff.
[38] Vgl. Nütten & Sauermann 1988, S. 137, siehe auch Delhees 1998, S. 18f.
[39] Vgl. Bonn 2002, S. 221, siehe auch Guildford 1950, S. 30ff, siehe weiter Talke & Salomo 2005, S. 260.
[40] Vgl. Hauschildt 1993, S. 121, siehe auch Amabile 1983, S. 69ff.
[41] Vgl. Finke, Ward & Smith 1992, zitiert nach Maier et al. 2007, S. 824.
[42] Vgl. Maier et al. 2007, S. 824.
[43] Vgl. Maier et al. 2007, S. 824.
[44] Vgl. Amabile 1996, S. 100, siehe auch Schuler & Görlich 2007, S. 20ff, siehe weiter Krüger 1984, S. 238.
[45] Vgl. Schuler & Görlich 2007, S. 12ff, siehe auch Nütten & Sauermann 1988, S. 91ff, siehe auch Haller 2003, S. 145, siehe auch Bonn 2002, S. 116ff, siehe weiter Guldin 2001, S. 295.
[46] Vgl. Schuler & Görlich 2007, S.15.
[47] Vgl. Bonn 2002, S. 36, siehe auch Schuler & Görlich 2007, S. 14.
[48] Vgl. Haller 2003, S. 147f.
[49] Vgl. Amabile 1988, S. 147, zitiert nach Bonn 2002, S. 96.
[50] Vgl. Schuler & Görlich 2007, S.19, siehe auch Maier et al. 2007, S. 836.
[51] Vgl. Haller 2003, S. 99f, siehe auch Talke & Salomo 2005, S. 258.
[52] Vgl. Schuler & Görlich 2007, S. 19f.
[53] Vgl. Beitz 1995, S. 77, siehe auch Bonn 2002, S. 116, siehe weiter Schuler & Görlich 2007.
[54] Vgl. Bonn 2002, S. 217.
[55] Vgl. Hauschildt 1993, S. 91.
[56] Vgl. Witte 1973, S. 5ff.
[57] Vgl. Witte 1973, S. 8.
[58] Vgl. Hauschildt 1993, S.95f, siehe auch Schirmer 2000, S. 341.
[59] Vgl. Hauschildt 1993, S.96f.
[60] Vgl. Schanz 1994, S. 388f, siehe auch Maier et al. 2007, S. 843, siehe weiter Witte 1973, S. 6ff.
[61] Vgl. Thom 1980, S. 365.
[62] Vgl. Burns & Stalker 1961, S. 120.
[63] Vgl. Hauschildt 1993, S. 80 u. 97.
[64] Vgl. Bonn 2002, S. 84f.
[65] Vgl. Witte 1973, S. 15f.
[66] Vgl. Witte 1973, S. 17.
[67] Vgl. Witte 1973, S. 19.
[68] Vgl. Hauschildt 1993, S. 124.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2008
- ISBN (eBook)
- 9783836621205
- DOI
- 10.3239/9783836621205
- Dateigröße
- 429 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Georg-August-Universität Göttingen – Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
- Erscheinungsdatum
- 2008 (Oktober)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- personalauswahl personalentwicklung personalführung kreativität anreizsystem
- Produktsicherheit
- Diplom.de