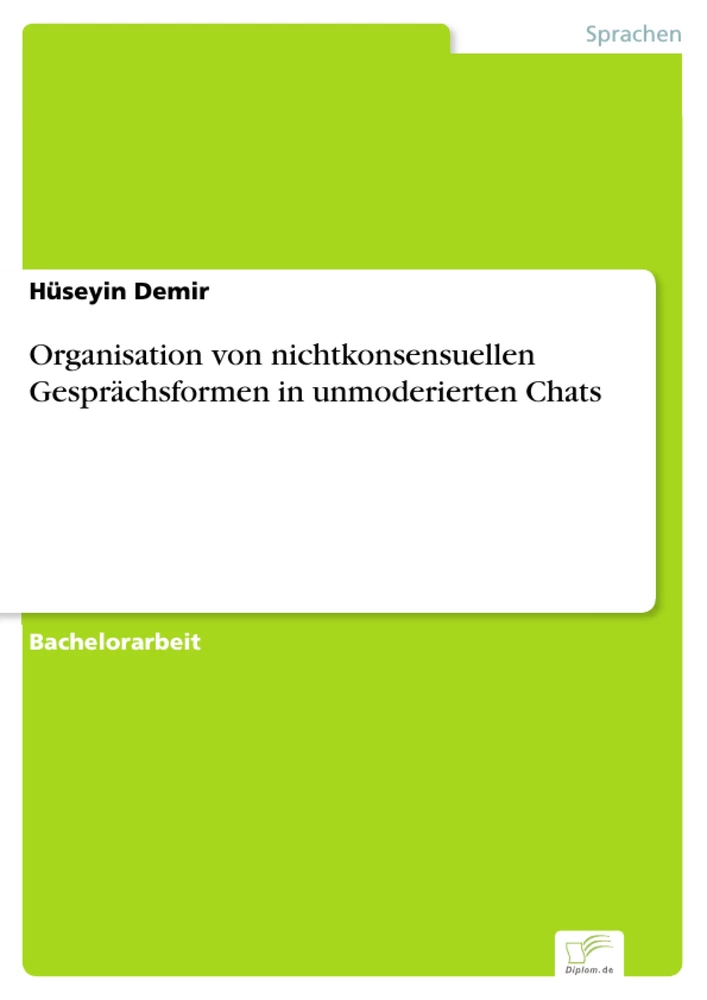Organisation von nichtkonsensuellen Gesprächsformen in unmoderierten Chats
©2007
Bachelorarbeit
276 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Nach Geers wird durch die computervermittelte Kommunikation "die gesamte Natur der menschlichen Kommunikation verändert [...]" und Androutsopulos/Ziegler meinen, dass sie "neue Kommunikationspraktiken und Muster des Sprachgebrauchs ermöglicht, die einen entscheidenden Einfluss auf Sprachwandel haben können." Insgesamt kann demnach angenommen werden, dass die CvK der gegenwärtigen Tendenz entsprechend weiter an Bedeutung gewinnen wird.
Eine der beliebtesten Formen CvK ist der Chat. Aus dieser Formulierung sollte aber nicht geschlossen werden, dass es "den Chat" als solchen gibt.
Runkeh meint hierzu:
"Es zeigt sich [ ], daß es sehr unterschiedliche Chats gibt und das Pauschalaussagen über das Chatten, wie man sie allzu häufig findet, problematisch sind".
Technisch gesehen bestehen drei Chat-Möglichkeiten, die in Kapitel 2 dargestellt werden sollen.
In der linguistischen Forschung, besonders in der Konversationsanalyse, sind mittlerweile einige Arbeiten zu finden, die sich aber zumeist nur mit sprachlichen Phänomenen im Chat beschäftigen. Es wird dabei jedoch vernachlässigt, dass der Chat eine Kommunikationstechnologie darstellt, die in zahlreichen verschiedenen Bereichen Anwendung findet. (Siehe 2.1) Die untersuchten Chats liegen zumeist ausschließlich im informellen Bereich und können als Plauderchats bezeichnet werden.
In Rahmen dieser Arbeit wird untersucht, wie Kommunikationsteilnehmer unter den medialen bzw. technischen Bedingungen unmoderierter Chats die kommunikative Handlung Dissens bewältigen.
Aufgrund des begrenzten Rahmens dieser Arbeit beschränke ich mich auf die Untersuchung unmoderierter Chats, wobei die Ergebnisse zum Teil auch auf moderierte Chats übertragbar sind.
Die Frage ist gesprächsanalytisch interessant, da essenzielle Merkmale von nichtkonsensuellen Gesprächsformen, wie sie z.B. durch Gruber erläutert werden, im Chat nicht realisierbar sind. Dazu zählen vor allem Phänomene des Sprecherwechsels, wie Unterbrechungen und Überlappungen, aber auch bestimmte Ausdrucksweisen auf para- und nonverbaler Ebene, durch die emotionale Elemente der Kommunikation, denen in nichtkonsensuellen Gesprächsformen eine besondere Bedeutung zukommt, vermittelt werden können. (Siehe 4.3) Außerdem soll herausgestellt werden, welche Konsequenzen das Fehlen von sprachlichen Mustern aus der Face-to-face Kommunikation auf die Chat-Sprache in nichtkonsensuellen Gesprächsformen hat und wie diese Probleme gelöst bzw. […]
Nach Geers wird durch die computervermittelte Kommunikation "die gesamte Natur der menschlichen Kommunikation verändert [...]" und Androutsopulos/Ziegler meinen, dass sie "neue Kommunikationspraktiken und Muster des Sprachgebrauchs ermöglicht, die einen entscheidenden Einfluss auf Sprachwandel haben können." Insgesamt kann demnach angenommen werden, dass die CvK der gegenwärtigen Tendenz entsprechend weiter an Bedeutung gewinnen wird.
Eine der beliebtesten Formen CvK ist der Chat. Aus dieser Formulierung sollte aber nicht geschlossen werden, dass es "den Chat" als solchen gibt.
Runkeh meint hierzu:
"Es zeigt sich [ ], daß es sehr unterschiedliche Chats gibt und das Pauschalaussagen über das Chatten, wie man sie allzu häufig findet, problematisch sind".
Technisch gesehen bestehen drei Chat-Möglichkeiten, die in Kapitel 2 dargestellt werden sollen.
In der linguistischen Forschung, besonders in der Konversationsanalyse, sind mittlerweile einige Arbeiten zu finden, die sich aber zumeist nur mit sprachlichen Phänomenen im Chat beschäftigen. Es wird dabei jedoch vernachlässigt, dass der Chat eine Kommunikationstechnologie darstellt, die in zahlreichen verschiedenen Bereichen Anwendung findet. (Siehe 2.1) Die untersuchten Chats liegen zumeist ausschließlich im informellen Bereich und können als Plauderchats bezeichnet werden.
In Rahmen dieser Arbeit wird untersucht, wie Kommunikationsteilnehmer unter den medialen bzw. technischen Bedingungen unmoderierter Chats die kommunikative Handlung Dissens bewältigen.
Aufgrund des begrenzten Rahmens dieser Arbeit beschränke ich mich auf die Untersuchung unmoderierter Chats, wobei die Ergebnisse zum Teil auch auf moderierte Chats übertragbar sind.
Die Frage ist gesprächsanalytisch interessant, da essenzielle Merkmale von nichtkonsensuellen Gesprächsformen, wie sie z.B. durch Gruber erläutert werden, im Chat nicht realisierbar sind. Dazu zählen vor allem Phänomene des Sprecherwechsels, wie Unterbrechungen und Überlappungen, aber auch bestimmte Ausdrucksweisen auf para- und nonverbaler Ebene, durch die emotionale Elemente der Kommunikation, denen in nichtkonsensuellen Gesprächsformen eine besondere Bedeutung zukommt, vermittelt werden können. (Siehe 4.3) Außerdem soll herausgestellt werden, welche Konsequenzen das Fehlen von sprachlichen Mustern aus der Face-to-face Kommunikation auf die Chat-Sprache in nichtkonsensuellen Gesprächsformen hat und wie diese Probleme gelöst bzw. […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Hüseyin Demir
Organisation von nichtkonsensuellen Gesprächsformen in unmoderierten Chats
ISBN: 978-3-8366-1184-8
Druck Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2008
Zugl. Universität Bielefeld, Bielefeld, Deutschland, Bachelorarbeit, 2007
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und der Verlag, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplomica.de, Hamburg 2008
Printed in Germany
-2 -
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung ...3
2. Chat-Kommunikation ...5
2.1 Technisches und kommunikatives Setting ...5
2.2 Charakteristika der Chat-Kommunikation ...7
2.2.1 Moderierte vs unmoderierte Chats ...7
2.2.2 Sprachliche Besonderheiten der Chat-Kommunikation ...8
3. Schriftlichkeit vs. Mündlichkeit ...10
3.1 Schriftlichkeit vs. Mündlichkeit in der Chat-Kommunikation ...10
4. Konfliktkommunikation ...13
4.1 Dissente Sequenzen und andere nichtkonsensuelle Gesprächsformen ...15
4.2 Inhaltliche Merkmale ...17
4.3 Formale Merkmale ...17
4.4 Zur Rolle von Emotionen in nichtkonsensuellen Gesprächsformen ...21
5. Übertragbarkeit der Organisationsstruktur nicht-konsensueller Gesprächsformen
auf die Chat-Kommunikation ...22
5.1 Exemplarische Untersuchung ...22
5.2 Inhaltliche Ebene ...27
5.3 Formale Ebene ...28
5.4 Kompensations- und Substitutionsmöglichkeiten ...31
6. Fazit ...32
Literatuverzeichnis
...36
Textkorpus 42
-3 -
1. Einleitung
Nach Geers (1999) wird durch die computervermittelte Kommunikation
1
,,
die gesamte Natur der mensch-
lichen Kommunikation verändert [...]
" (Geers 1999: 84) und Androutsopulos/Ziegler (2003) meinen, dass
sie ,,
neue Kommunikationspraktiken und Muster des Sprachgebrauchs ermöglicht, die einen entscheidenden Ein-
fluss auf Sprachwandel haben können.
" (Androutsopoulos/Ziegler 2003: 1) Insgesamt kann demnach an-
genommen werden, dass die CvK der gegenwärtigen Tendenz entsprechend weiter an Bedeutung ge-
winnen wird.
Eine der beliebtesten Formen CvK ist der Chat. (Vgl. Runkehl et al. 1998: 73) Aus dieser Formulie-
rung sollte aber nicht geschlossen werden, dass es ,,den Chat" als solchen gibt.
Runkehl et al. (1998) meint hierzu:
,,
Es zeigt sich [
...
], da
ß
es sehr unterschiedliche Chats gibt und das Pauschalaussagen
ü
ber das Chatten, wie man sie allzu h
ä
ufig findet, problematisch sind.
"
(Runkehl et al.
1998: 81)
Technisch gesehen bestehen drei Chat-Möglichkeiten, die in Kapitel 2 dargestellt werden sollen.
In der linguistischen Forschung, besonders in der Konversationsanalyse, sind mittlerweile einige Ar-
beiten zu finden, die sich aber zumeist nur mit sprachlichen Phänomenen im Chat beschäftigen. Nach
Beißwenger/Storrer (2005) wird dabei jedoch vernachlässigt, dass der Chat eine Kommunikations-
technologie darstellt, die in zahlreichen verschiedenen Bereichen Anwendung findet. (Siehe 2.1) Die
untersuchten Chats liegen zumeist ausschließlich im informellen Bereich und können als ,,Plauder-
chats" bezeichnet werden. (Vgl. Beißwenger/Storrer 2005: 12)
In Rahmen dieser Arbeit wird untersucht, wie Kommunikationsteilnehmer unter den medialen bzw.
technischen Bedingungen unmoderierter Chats die kommunikative Handlung Dissens bewältigen.
Aufgrund des begrenzten Rahmens dieser Arbeit beschränke ich mich auf die Untersuchung unmode-
rierter Chats, wobei die Ergebnisse zum Teil auch auf moderierte Chats übertragbar sind.
Die Frage ist gesprächsanalytisch interessant, da essenzielle Merkmale von nichtkonsensuellen Ge-
sprächsformen, wie sie z.B. durch Gruber (1996) erläutert werden, im Chat nicht realisierbar sind.
Dazu zählen vor allem Phänomene des Sprecherwechsels, wie Unterbrechungen und Überlappungen,
aber auch bestimmte Ausdrucksweisen auf para- und nonverbaler Ebene, durch die emotionale Ele-
mente der Kommunikation, denen in nichtkonsensuellen Gesprächsformen eine besondere Bedeutung
zukommt, vermittelt werden können. (Siehe 4.3) Außerdem soll herausgestellt werden, welche Kon-
sequenzen das Fehlen von sprachlichen Mustern aus der Face-to-face Kommunikation auf die Chat-
1
Als computervermittelte Kommunikation gelten ,,Äußerungen über Werkzeuge und durch Rechner, die in einem Netz
-4 -
Sprache in nichtkonsensuellen Gesprächsformen hat und wie diese Probleme gelöst bzw. kompensiert
werden. Daneben werden Aussagen darüber getroffen, in welchen Chats, wie häufig und und über
welche inhaltlichen oder formalen Aspekte Dissens auftritt.
Es soll aber darauf hingewiesen, dass in dieser Arbeit keine repräsentativen Aussagen zu diesen Fra-
gen gemacht werden können, was vor allem auf der Vielseitigkeit der Chat-Kommunikaton beruht.
Sie kann aber durchaus interessante und an Chat-Protokollen von unmoderierten Chats (IRC vs.
Proprietäre Chats) belegte Ergebnisse und Annahmen liefern. Einige dieser Chat-Protokolle wurden
vom Dortmunder Chat Korpus, das von dem Institut für Deutsche Sprache und Literatur an der Uni-
versität Dortmund angelegt wurde, zur Verfügung gestellt, während die restlichen Chat-Protokolle
(Logfiles) selbst aufgezeichnet wurden.
2
In Kapitel 2. erfolgt die Beschreibung und Definition des Untersuchungsgegenstands Chat-Kommu-
nikation, Hinweise zu ihren technischen Grundlagen und wie diese sich auf die Kommunikation aus-
wirken. (2.1). Daneben wird eine für die Untersuchung wichtige Unterscheidung zwischen moderier-
ten und unmoderierten Chats getroffen (2.2.1) und die sprachlichen Besonderheiten der Chat-Kom-
munikation dargestellt (2.2.2), wobei sich die Chat-Formen, je nach ihrer technischen Grundlage auch
in ihren sprachlichen und nichtsprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten unterscheiden.
Im folgenden Kapitel wird in Anlehnung an das Modell von Koch/Oesterreicher (1990) versucht, den
Chat zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit einzuordnen (3.1) und zu diskutieren, ob diese Form
der CvK als Gesprächsform eingestuft werden kann, damit eine Vergleichbarkeit mit der Face-to-face
Kommunikation gewährleistet ist.
In Kapitel 4 folgt die Darstellung von nichtkonsensuellen Gesprächsformen, wobei der Fokus auf der
dissenten Sequenz (DS) liegt. (Siehe 4.1). In den Unterkapiteln 4.2 und 4.3 werden typische inhaltli-
che und formale Merkmale nichtkonsensueller Gesprächsformen dargestellt. Hier geht es vor allem
um das System des Sprecherwechsels.
Im 5. Kapitel wird versucht, die herausgearbeiteten charakteristischen Merkmale nichtkonsensueller
Gesprächsformen auf die entsprechenden Sequenzen in der Chat-Kommunikation anzuwenden und
zwischen verschiedenen Chat-Formen zu differenzieren. Im Anschluss an die exemplarische Unter-
suchung des Protokolls eines proprietären Chats und Aussagen darüber, wie Chat-Teilnehmer die
kommunikative Aufgabe Dissens bewältigen, wird dargestellt, wie Kommunikationsteilnehmer die
mangelnden Wahrnehmungskanäle in der Chat-Kommunikation durch verbale und semiotische Mit-
verbunden sind." (Lemnitzer/Naumann 2001: 470)
2
Der Untersuchungskorpus besteht aus 16 Logfiles zu moderierten Chats und ebenfalls 16 Logfiles zu unmoderierten
Logfiles, wobei 8 der Protokolle unmoderierter Chats aus dem proprietären Chat ICQ stammen. Dabei bestand das
Problem, dass es schwierig ist, an Transkripte privater Chat-Kommunikation zu gelangen, die wichtig für die Unter-
suchung der proprietären Chats sind. Hier wurden Dritte darum gebeten, ihre Transkripte zur Verfügung zu stellen.
-5 -
tel kompensieren bzw. substituieren (5.3).
Zwecks besserer Lesbarkeit wird bei der Bezeichnung von Personengruppen ausschließlich die männ-
liche Form gewählt. Selbstverständlich sind aber sowohl männliche als auch weibliche Mitglieder in
diesen Gruppen enthalten.
2. Chat-Kommunikation
Der Begriff Chat hat seinen Ursprung in dem englischen Verb to chat und lässt sich mit plaudern
oder sich unterhalten übersetzen. Damit wird die elektronische Kommunikation zwischen mindes-
tens zwei Personen in Echtzeit bezeichnet, die über das Internet geführt wird. (Vgl. Mediensprache)
Da die Interaktionspartner weder Sichtkontakt, noch einen geteilten Anschauungsraum haben, auf
den sie sich beziehen oder auf den sie verweisen können, ist der Chat als Diskurstechnologie (Beiß-
wenger 2003: 202) bzw. Kommunikationstechnologie
3
durchaus mit Telefon und CB-Funk ver-
gleichbar.
Viele Internetnutzer setzen das Internet mit dem Word Wide Web (WWW) gleich. Dabei bildet die-
ses nur einen kleinen Teil des Internet-Komplexes. Zu diesem gehören neben vernetzten multimedi-
alen Hypertext Dokumenten (WWW), auch ein weltweit zugängliches elektronisches Postsystem
(eMail), der Austausch von Nachrichten und Artikeln in öffentlich zugänglichen und privaten Benut-
zergruppen bzw. Newsgroups (Usenet) und die Möglichkeit mit anderen Nutzern über ein beliebiges
Thema in virtuellen Räumen (IRC-Channels) zu diskutieren.
2.1 Technisches und kommunikatives Setting
Wie aus dieser kurzen Einführung hervorgeht, dient ein Teil der Internetdienste der Kommunikation.
Im Internet können Menschen, trotz zeitlicher und räumlicher Trennung, ohne Informationsverlust
miteinander kommunizieren. Hierbei wird zwischen synchronen und asynchronen Formen der com-
putervermittelten Kommunikation (CvK) unterschieden. (Vgl. Goldmann et al. 1995: 253)
Die synchrone Kommunikation überbrückt räumliche Distanzen. Dabei kommt es kaum zu zeitlichen
Verzögerungen, abgesehen von Interferenzen, welche eine fehlerfreie Dekodierung
4
seitens des Emp-
3
Nach Beißwenger (2003: 200) ist der Begriff Kommunikationstechnologie definiert ,,[...] als ein geregeltes Zusam-
menspiel von Prozeduren, welche die Produktion, den Austausch und die Rezeption von Zeichen zwischen Kommuni-
kanten ermöglichen soll und die zugleich die Medien (d.h.: die technischen Mittel) festlegen, die für die Produktion,
Kodierung, Enkodierung und Rezeption der ausgetauschten Zeichen jeweils benötigt werden".
4
Dekodierung bezeichnet die Entschlüsselung sprachlicher Zeichen durch den Rezipienten und verhält sich damit kom-
plementär zur Kodierung. (Vgl. Bußmann 2002: 151)
-6 -
fängers verhindern. Vorteilhaft an der synchronen Kommunikation ist gegenüber asynchronen For-
men die zeitgleiche Anwesenheit von Sender und Empfänger, wodurch die Partner sich der beider-
seitigen Aufmerksamkeit sicher sein können. (Vgl. NetWiki)
Bei der asynchronen Kommunikation wird Raum und Zeit überwunden. Somit ist keine zeitgleiche
Anwesenheit von Sender und Empfänger notwendig, wobei dies den Nachteil mit sich bringt, dass
Teilnehmer sich der gegenseitigen Aufmerksamkeit nicht sicher sein können. (Vgl. ebd.)
Es gibt unzählbar viele Chats, die sich nach Runkehl et al. (1998: 84) aber technisch in drei verschie-
dene schriftbasierte Chat-Formen einordnen lassen: 1. Internet Relay Chat (IRC), der als eigenständi-
ger Internet-Dienst mit einer Client-Software betrieben wird und damit auf dem Client-Server-Prinzip
basiert. 2. Web-Chats, die mit Hilfe gängiger Browser (wie Microsoft Internet Explorer oder Mozilla
Firefox) genutzt werden können und 3. Instant Messenger (Proprietäre Chats), die von Providern mit
einer speziellen Software betrieben werden.
Darauf aufbauend wird die Chat-Kommunikation durch einzelne Chat-Elemente (Chat-Werkzeuge
oder -Tools), die die Basis zur Etablierung einer Chat-Umgebung bilden, bereichert. (Vgl. Beißwen-
ger 2003: 202) Diese stellen den potentiellen Kommunikationspartnern diejenigen technischen Hilfs-
mittel zur Verfügung, die sie zur erfolgreichen Überbrückung der räumlichen Distanz benötigen.
(Vgl. Beißwenger 2005a: 65-68) Der IRC ist durch eine starke Anonymität der Nutzer geprägt, wäh-
rend sich die Nutzer von proprietären Chats zumeist persönlich kennen. Hier verlaufen die Gespräche
auch ausschließlich im privaten Rahmen einer 1zu1 Kommunikationssituation, während der IRC öf-
fentlich ist. Im IRC kann prinzipiell eine uneingeschränkte Menge an Teilnehmern zu jeder Zeit si-
multan Beiträge produzieren, die vom jeweiligen Server nach dem Mühlenprinzip was zuerst an-
kommt, wird zuerst angezeigt untereinander aufgelistet werden.
6
2.2 Charakteristika der Chat-Kommunikation
2.2.1 Moderierte vs. unmoderierte Chats
Es können zwei Hauptarten von Chats unterschieden werden: moderierte und unmoderierte Chats.
(Vgl. Storrer 2001: 439-465) Die Kommunikation in unmoderierten Chats ist allein durch die techni-
schen Rahmenbedingungen beschränkt. Dagegen gibt es in moderierten Chats einen Moderator, der
den Gesprächsverlauf bestimmt. Moderierte Chats sind zumeist themenzentriert, wobei bekannte Per-
sönlichkeiten aus Politik, Sport oder Kultur eingeladen werden, mit denen diskutiert werden kann.
Die Diskussion verläuft dabei auf einer sachlichen Ebene und einer one-to-many-(1-n) Kommunika-
tionssituation. Die Gesprächsorganisation in moderierten Chats kann als eher konventionell beschrie-
6
In moderierten Chats können Nutzer zwar darauf hingewiesen werden, gewisse Äußerungen zu unterlassen, doch sie
können daran nicht gehindert werden. (Vgl. Beißwenger 2005: 65-68)
-7 -
ben werden, d.h. sie basiert auf dem Interviewschema von Frage-Antwort. Trotz der Synchronität tre-
ten Frage-Antwort-Sequenzen geordnet untereinander auf, was darauf zurückgeführt werden kann,
dass Fragen der Teilnehmer zunächst vom Moderator gesammelt und weitergeleitet werden. Die
Sprache lässt sich als schriftsprachlich bezeichnen, wobei dies bedeutet, dass grammatische und or-
thographische Regeln befolgt und Sätze zumeist ausgeführt werden. Dem entsprechend sind die Bei-
träge in den untersuchten moderierten Chats durchschnittlich 13,41 Wortformen lang, während der
Wert in den unmoderierten Chats bei 3,88 liegt. Rechtschreibfehler treten in beiden Chat-Formen da-
gegen etwa gleich häufig auf, wobei dies mit der Schnelligkeit der Sprachproduktion (bzw. dem zeit-
lichen Druck) und dem Bedürfnis der Nutzer zusammenhängt, die Schriftproduktion weitgehend der
Äußerungsproduktion anzugleichen, weshalb Äußerungen nicht korrekturgelesen werden.
Charakteristische sprachliche Besonderheiten von unmoderierten Chats sind nach Glenewinkel
(2003: 11) Kurzsprache, Ellipsen, umgangssprachliche Merkmale, Kleinschreibung und der Wegfall
von Interpunktionszeichen.
Im Gegensatz zu der geordneten Abfolge von Paarsequenzen in moderierten Chats, verläuft diese in
unmoderierten Chats chaotischer, wodurch die Zuordnung erschwert wird. (Vgl. Storrer 2001a: 3-24)
Für Außenstehende ist im IRC deshalb kaum zu erkennen, welche Personen miteinander Chatten, wie
viele Teilnehmer sich an einem Gesprächsstrang beteiligen oder wer worauf antwortet. Durch die Pa-
rallelität mehrerer Gesprächsstränge, ist ein zusammenhängender Kommunikationsverlauf sehr er-
schwert, wobei Glenewinkel (2003: 11) daraus schließt dass die ,,Kommunikation in unmoderierten
Chats (ist) stark situations- und kontextabhängig [ist]."
2.2.2 Sprachliche Besonderheiten in der Chat-Kommunikation
Sprachliche Besonderheiten in der Chat-Kommunikation lassen sich auf vier Ebenen beobachten.
Dazu zählen Kurzformen (Akronyme und Abkürzungen), Emoticons (Smileys, Graphische Elemen-
te), Vereinfachungen bzw. Tilgungen und syntaktische Merkmale (vereinfachter Satzbau, Ellipsen).
Hieraus geht hervor, dass das der Face-to-face-Kommunikation zugrundeliegende Ökonomieprinzip
(Vgl. Grice 1975; Linke et al. 2004: 172), auch auf die Chat-Kommunikation anwendbar ist. Dabei
versuchen die Chatter, unter Gewährleistung der Verständlichkeit, innerhalb eines Gesprächsbeitrags
(in möglichst kurzer Zeit) möglichst viel mitzuteilen. (Vgl. Bader 2002: 02)
Akronyme entstehen, durch die Bildung einer Abkürzung aus den Anfangsbuchstaben oder -silben ei-
-8 -
nes Kompositums oder einer Wortgruppe (Vgl. Glück 2000: 23) und werden in Chats häufig in As-
teriske gesetzt. (Vgl. Runkehl et al. 1998: 105) Das häufigste Akronym ist nach einer Erhebung von
Pettersson (2001: 33f) das *g*, wobei dies für ,,grin" (dt. grinsen) steht. Zudem sind Steigerungsfor-
men davon, wie *bg* (für *biggrin*), *sfg* (*sehr freches Grinsen*) oder *gggg* (*gringrin*) zu
beobachten. Nach Runkehl et al. (1998: 106) können sie durch Reduplikation oder angehängte Smi-
leys ,,:-)" intensiviert werden. Diese Kurzformen, werden dazu verwendet, das Lachen als Reaktion
auf eine witzige Bemerkung des Chat-Partners zu vermitteln, da dieses nonverbale Verhalten, im
Chat nicht übermittelt werden kann.
Dagegen dienen Emoticons
7
bzw. Smileys, die Beißwenger als ,,
ikonographische Rekonstruktionen typi-
sierter Gesichtsausdrücke
" bezeichnet, durch ihre Funktion der Vermittlung parasprachlicher Informa-
tion und Anzeigen der Stimmung des Senders, dem Zweck, das Gespräch in eine ironisierende Ge-
sprächsmodalität zu verlagern bzw. den informellen Charakter der Kommunikation zu charakterisie-
ren.
8
(Vgl. Döring: 1999: 42) Daneben können Emoticons ganzen Sätzen einen zusätzlichen Informa-
tionsgehalt geben. Ein zwinkerndes Emoticon ;-) wird dazu genutzt Ironie anzuzeigen, wogegen ei-
nes, bei dem die Mundwinkel nach unten gerichtet sind, eine Drohung oder Trauer impliziert. (Vgl.
Glenewinkel 2003: 12f) Trotz der Tatsache, dass der Begriff Smiley dies impliziert, vermitteln also
nicht alle Emoticons positive Gefühlsregungen. (Vgl. Döring 1999: 42)
Vereinfachungen und Tilgungen weisen auf die enge Orientierung an der mündlichen Kommunika-
tion und deren phonetischen Merkmalen hin. Die Schriftsprache wird durch Tilgungen, Wortver-
schmelzungen (meinste? ICQ 3: 10) und Assimilationen stark vereinfacht. So werden Schwa-Laute
am Ende oft getilgt, wie z.B. komme wird zu komm oder ich überlege mal wird zu ich überleg ma
(ICQ 4: 32).
Auf syntaktischer Ebene ist ein wichtiges chatsprachliches Merkmal der isolierte Gebrauch ellipti-
scher bzw. unvollständiger Nebensätze, wobei Reparatursequenzen eingesetzt werden, sobald die
Verständlichkeit unter der Ökonomisierung leidet. (Vgl. Glenewinkel 2003: 13)
Obwohl syntaktisch vollständige Konstruktionen aufgrund der kommunikativen Distanz sinnvoll wä-
ren, kann beobachtet werden, dass die häufig stark elliptischen Sätze und Worte durch para- und non-
verbale Zeichen kompensiert werden können. (Vgl. Kap. 5.3 und Glenewinkel 2003:13) Wie ange-
deutet, werden in Situationen in denen weniger Emoticons verwendet werden
9
, also in moderierten
7
Der Begriff Emoticon gilt als Zusammensetzung aus den Wörtern Emotion und Icon (Zeichen).
8
So tauchen Emoticons, die aus höchstens vier Zeichen bestehen, in moderierten Chats sehr selten auf und lassen sich als
typisch nähesprachliches Phänomen in der Chat-Kommunikation charakterisieren. (Siehe Kap. 3)
9
In den untersuchten moderierten Chats ergeben sich 0,02 Emoticons pro Beitrag, während der Wert in den untersuch-ten
unmoderierten Chats bei 0,998 liegt.
-9 -
Chats, die Sätze syntaktisch komplexer formuliert, wobei sich dies auch in hypotaktischen Konstruk-
tionen äußert. (Vgl. Dittman 2006: 15)
3. Mündlichkeit vs. Schriftlichkeit
Grundsätzlich kann eine Äußerung auf zwei Arten realisiert werden: Mündlich oder schriftlich. Ihre
Konzeption ist dagegen nicht derart beschränkt, sondern kann innerhalb eines Kontinuums variieren,
in dem zahlreiche Zwischenformen möglich sind.
10
(Vgl. Koch/Oesterreicher 1990: 10)
Nach Koch/Oesterreicher (1990: 8f.) kann jede sprachliche Äußerungsform zwischen den Extrempo-
len von konzeptioneller Mündlichkeit und Schriftlichkeit eingeordnet werden. Dies geschieht durch
Parameter, die sich auf bestimmte Kommunikationssituationen anwenden lassen. Dazu gehört der Öf-
fentlichkeitscharakter der Kommunikationssituation, der Vertrautheitsgrad der Kommunikationspart-
ner, die Emotionalität, Dialog/Monolog, Spontaneität und Form des Sprecherwechsels. (Vgl. Koch/
Oesterreicher 1990: 12; Bader 2003: 26f)
Dabei entsprechen diesen Kommunikationsbedingungen gewisse Versprachlichungsstrategien, die
nach Koch/Oesterreicher (1990) auf die kommunikative Distanz bzw. Nähe zwischen den Beteiligten
zurückgeführt werden können, wobei sich die Begriffe auf räumliche, zeitliche und emotionale Nähe
bzw. Distanz beziehen. Es gilt die Regel, dass die Kommunikation umso mehr von Distanz geprägt
ist, je mehr die kommunikativen Bedingungen zu Öffentlichkeit und Formalität tendieren. Dem ent-
gegengesetzt könnnen von Spontaneität und Emotionalität dominierte Gesprächsformen als Nähe-
Kommunikation bezeichnet werden. Koch/Oesterreicher (1990: 9ff) weisen die Schriftsprache dem
Pol maximaler kommunikativer Distanz zu, während sie die gesprochene Sprache dem Pol maximaler
kommunikativer Nähe zuordnen. Wie angedeutet treten aber häufig Mischformen auf.
11
3.1 Chat zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit
Die Notwendigkeit der Einordnung von Chat-Kommunikation innerhalb dieses Kontinuums ergibt
1
0In der konversationsanalytischen Forschung herrscht Konsens darüber, dass das Mündlichkeits- bzw. Schriftlichkeits-
modell von Koch/Oesterreicher (1985, 1994) einen hilfreichen Ansatz zur Klassifizierung von Äußerungsformen dar-
stellt. (Vgl. Bader 2003: 110f; Wilde 2002: 9) Da dieses Modell aber im Jahr 1990 entstanden ist und die CvK zu die-
ser Zeit noch nicht verbreitet war, fehlen Email- und Chat-Kommunikation in dem Modell. Deshalb scheinen neue
Abstufungen für computerspezifische Aspekte sinnvoll.
1
1So kann der Nachrichtenvortrag obwohl er gesprochen wird, eher dem konzeptionell schriftlichen Pol zugerechnet
werden, da er vorformuliert wird.
-10 -
sich daraus, dass Face-to-face- und Chat-Kommunikation auf formaler Ebene nur dann verglichen
werden können, wenn sich sprechsprachliche Strukturen auch auf diese spezielle Form von CvK
anwenden lassen.
Bei einer Orientierung an den Kriterien der Nähe und Distanz von Koch/Oesterreicher (1990) fällt
auf, dass der Chat zunächst eher zum Pol der Distanz tendiert, da die Teilnehmer keinen Sichtkontakt
haben, räumlich getrennt sind und sich nicht kennen (im IRC). Dem entspricht auch die mediale
Schriftlichkeit der Chat-Kommunikation, da zur Realisierung eines Beitrags, wobei die Schrift ja ge-
nuin als die Sprache der Distanz gilt, die Tastatur genutzt werden muss. Sie ist medial also eindeutig
dem schriftlichen Pol zuzuordnen. (Vgl. Glenewinkel 2003: 6f)
Die räumliche Distanz ein wichtiges Merkmal schriftlicher Äußerungsformen wird in der Chat-
Kommunikation durch die Bildung virtueller Räume, sowie sprachliche und graphische Innovationen
überbrückt, wobei dies wiederum Nähe produziert. (Vgl. Bader 2003: 110f) Zudem ist zu beobach-
ten, dass sich in der Chat-Kommunikation Konventionen (Ignorieren von Orthographie und Zeichen-
setzung) und sprachliche Phänomene (Akronyme, ugspr. Lexik, sprechsprachliche Syntax, Partikeln)
etablieren, wie
12
13
Beispiel ICQ 8: 1 J1: hey... wir war paris. <3 ????
2 J2: hi
3 J2: super-bon
5 J2: war richtig cool die stadt mal wieder zu sehen
7 J1: oh cool.. ich hab in germany gegammelt..=( xD
10 J2: was haste denn gemacht am we?
Die wichtigste Funktion der Anfangsphase besteht, sofern sich Gesprächspartner bereits kennen, in
der Konstitution bzw. Rückversicherung sozialer Beziehungen (Vgl. Wilde 2002: 28f), wozu die The-
matisierung geteilten Wissens, des letzten Treffens oder Gesprächs, wie in der Frage ,,
wie war paris
"
(Z. 1) oder ,,
eyal: hey babak, how's it going.. still waiting on u know what ;)" (Maoxian)
dienen, wobei das
Emoticon am Ende des Beitrags auf geteiltes Wissen hinweist, das über den Inhalt der Äußerung
hinausgeht.
Der Übergang von der Anfangs- in die Haupthase erfolgt zumeist unbemerkt, wobei Merkmale auf
struktureller und inhaltlicher Ebene, wie Themenwechsel, Partikelhäufungen und Zäsursignale,
1
2Während die meisten Merkmale auf beide Formen zutreffen, sind Emotionalität, Spontaneität, Privatheit, Vertrautheit,
Informalität und Themenvarianz eher den unmoderierten Chats zu eigen, die sie als nähesprachliche Kommunika-
tionsform charakterisieren. In moderierten Chats tendieren die Teilnehmer dagegen zur Sprache der Distanz, die sich
u.a. durch die Merkmale der Anonymität, Themenfixiertheit, Öffentlichkeit und Objektivität auszeichnet. Daneben
treten bestimmte Strategien der Versprachlichung auf (Hypotaxe, Elaboriertheit, Planung). (Vgl. Wilde 2002: 9-12)
1
3Dies ist darauf zurückzuführen, dass bei nichtthemenfixierten Gespräch der Beziehungsaspekt im Vordergrund steht
und nicht die Themen, die situativen Zufällen entspringen. (Vgl. Henne/Rehbock 1995: 21)
-11 -
darauf hinweisen können, obwohl er auch metakommunikativ explizit erfolgen kann, wie ,,
gut, dann
kann es ja losgehen...
" (Beißwenger V: 24)
In der Endphase wird die aufgebaute Gesprächsbereitschaft von den Beteiligten gemeinsam aufge-
löst. An dieser Stelle im Gespräch ist wichtig, dass die Interaktionspartner verstehen, dass das Ende
eines Gesprächsbeitrags nicht als Turn-Übergabe Signal gemeint ist. (Vgl. Linke et al. 2004: 322f)
Die Parteien können das Gespräch auch einseitig beenden, indem sie den Gesprächsrahmen verlassen
bzw. (in der CvK) sich ausloggen. Dieser Kommunikationsbruch kann aber negative Auswirkungen
auf der Beziehungsebene nach sich ziehen. Die Verabschiedung ist durch obligatorische Sprechhand-
lungen charakterisiert, die als Beendigungsmechanismus bezeichnet werden und in der Face-to-face-
Kommunikation von nonverbalem Verhalten angekündigt, begleitet oder ganz ersetzt werden können.
(Vgl. Linke et al. 2004: 322f) Zu den die Verabschiedung begleitenden nonverbalen Elementen ist in
Chats zwar keine Entsprechung vorhanden, die obligatorischen Sprechhandlungen (Dankesbekun-
dungen, Austausch von guten Wünschen) sind dennoch übertragbar, wie in folgendem Beispiel zu
sehen ist. (Vgl. Schönfeldt 2001 25-53 und Linke et al. 2004: 323)
Beispiel Maoxian 371
james: great discussion tonight MAO - thanks
373
CMaoxian: you're welcome, james
374
sigi: I appreciate the discourse, education and the time you take to facilitate and initiate
the chat, CM !
375
Zoomie: thanks CM, awesome chat
376
CMaoxian: get some sleep, zoomie, you'll need it
Die Chat-Kommunikation bewegt sich, wie aus den
Darstellungen hervorgeht, in einem für die Sprachwissenschaft sehr interessanten Spannungsfeld
zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit. (Vgl. Bader 2003: 9)
4. Konfliktkommunikation
Da Konflikte sehr vielschichtig sind, sind in der Forschung auch zahlreiche verschiedene Definitio-
nen zu finden. Generell lassen sich in jedem Konflikt drei Komponenten unterscheiden. 1. Der Wi-
derspruch, also eine Unvereinbarkeit von Zielen, Interessen oder Bedürfnissen. 2. Verhalten, das den
Konflikt offenbart und häufig auch verschärft (wie Aggressivität, Wut, Hass) 3. Eine auf den Kon-
flikt bezogene und diesen bewusst oder unbewusst rechtfertigende Einstellung bzw. Haltung. (Vgl.
Galtung 1998: 136)
Der Friedens- und Konfliktforscher Johan Galtung (1998) veranschaulicht diese Komponenten im so
genannten Konfliktdreieck - einem wichtigen Werkzeug der Konfliktanalyse.
-12 -
Das Dreieck verbildlicht den kaum auflösbaren Zusammenhang zwischen den drei Komponenten je-
des Konflikts. Deutlich wird ebenfalls, dass ein objektiver Widerspruch allein nicht ausreicht, einen
Konflikt zu begründen. Die Grundlage eines manifestierten Konflikts ist, dass sich zumindest eine
Partei der konkreten Unvereinbarkeit der Bedürfnisse des Widerspruchs subjektiv bewusst ist und
durch ihr Verhalten auf eine Veränderung der für sie nicht hinnehmbaren Situation besteht. (Vgl. Ba-
ros 2004: 1f) Daneben wird durch die Unterscheidung zwischen manifester und latenter Ebene ver-
deutlicht, dass Außenstehende, aber auch die jeweiligen Konfliktparteien, von Konflikten nur ent-
sprechendes Verhalten verbale oder körperliche Gewalt wahrnehmen, während der zu Grunde lie-
gende Widerspruch, sowie Einstellungen und Annahmen zunächst verborgen bleiben. (Vgl. Baros
2004: 1-3) Zur Bearbeitung eines Konflikts stehen zwei Lösungswege offen, nämlich Kooperation
oder Konfrontation. (Vgl. Baros 2004: 8-18)
Trotz der negativen Konnotierung des Konfliktbegriffs im alltagssprachlichen Gebrauch sind sie eine
essenzielle Komponente menschlichen Miteinanders und begegnen in jedem sozialen Raum (Vgl. Lee
1964: 3) dies schließt virtuelle Räume, die einer immer verzweigteren Differenzierung unterworfen
sind, mit ein.
Für die konversationsanalytische Arbeit ist im Sinne von Spiegel (1995) wichtig, dass es zum Kon-
flikt durch die Entstehung von Diskrepanzen kommt. Diese gehen daraus hervor, dass mindestens
zwei ,,
Ideen [...], Personen oder Gruppen in Bezug auf Sachverhalte, Verhaltens- oder Wertvorstellungen aufeinan-
der prallen,[...]
" (Spiegel 1995: 16) Damit liegt jeder oppositionellen Austragungsform (ebd.) ein
Konflikt zugrunde.
Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt Gruber (1996: 53), der die ,,Nichtübereinstimmung" von Ge-
sprächsparteien als konstitutiv für die Konfliktkommunikation erachtet, wobei der Annahme, dass
konfliktäre Gesprächsformen Diskrepanzen voraussetzen, die wiederum als Erklärung für den verba-
len Verlauf des Gesprächs dienen können, auch Schwitalla (2001: 1374) zustimmt. Dem widerspricht
jedoch Nothdurft (1997: 6f.), der darauf besteht, dass Konflikte nicht sprachunabhängig existieren,
sondern interaktiv konstruiert werden und somit als Produkt gelten. Daraus ergibt sich die Frage,
durch welche sprachlichen Mittel und welche kommunikativen Prozesse ein Konflikt erzeugt wird,
die im Verlauf dieser Arbeit wieder aufgegriffen werden soll.
4.1 Dissente Sequenzen und andere nichtkonsensuelle Gesprächsformen
Nach Gruber (1996: 56) stellt die kommunikative Austragung eines Konfliktes nur eine seiner mög-
lichen Bearbeitungsformen dar. Doch auch bei dieser Form stehen verschiedene Möglichkeiten zu
-13 -
seiner Bearbeitung zur Verfügung, die an dieser Stelle erläutert werden sollen.
Die kommunikative Konfliktaustragung lässt sich in Anlehnung an Gruber (1996) unter dem Begriff
der dissenten Sequenz (im Folgenden abgekürzt als DS)
15
zusammenfassen.
Damit entgeht Gruber (1996) dem Problem, dass sich nichtkonsensuelle Gesprächsformen schwer
voneinander abgrenzen lassen. Er meint, dass DS sowohl die Gestalt einer Argumentation, als auch
die eines Streits annehmen können, wobei er Streit und Argumentation als entgegengesetzte Pole der
DS bezeichnet. (Vgl. Gruber 1996: 56) Hieraus geht hervor, dass die Einordnung der beiden Ge-
sprächsformen nicht dichotomisch ausgerichtet ist, sondern die DS als ein Kontinuum begriffen wer-
den soll, in welches sich nichtkonsensuelle Gesprächssequenzen einordnen lassen. Zwischen den
beiden Extremen sind aber vielfältige Mischformen möglich. (Vgl. ebd.)
Formal sind DS leicht mit Reparatursequenzen zu verwechseln, von denen sie aber deutlich unter-
schieden werden müssen.
16
Der wichtigste Unterschied zwischen beiden ist, dass man DS nicht nur
auf der inhaltlichen, sondern auch auf der strukturellen Ebene nachweisen kann, wobei Gruber (1996)
die spezifische inhaltliche und strukturelle Organisation von DS als Dissensorganisation von Gesprä-
chen (siehe 4.3) bezeichnet. (Vgl. Gruber 1996: 59f)
Zudem stehen DS auch mit Widerspruchs- und Vorwurfssequenzen in Zusammenhang. Charakteris-
tisch für Widerspruchssequenzen ist ebenfalls die Nichtübereinstimmung mit der Äußerung des Ge-
genübers, wobei der Widersprechende seinen eigenen Standpunkt aber nicht weiter ausführt. (Vgl.
Gruber 1996: 65; Grommes 2005: 25) Solche Gesprächsbestandteile können in DS eingebettet sein,
leiten sie aber zumeist ein. Strukturell lassen sich Widerspruchssequenzen von DS durch das
Vorherr-schen der Präferenzorganisation abgrenzen, die für ihre Einordnung als konsensuelle Ge-
sprächsform spricht. (Vgl. Gruber 1996: 65)
Neben der Funktion DS einzuleiten, können Vorwurfssequenzen dagegen sowohl innerhalb einer DS,
als auch alleinstehend auftreten. (Vgl. Gruber 1996: 66) Diese sind strukturell komplexer aufgebaut
als Widerspruchssequenzen, da demjenigen dem etwas vorgeworfen wird prinzipiell zwei Möglich-
keiten offenstehen Rechtfertigung oder Einlenken die wiederum vom Vorwurfs-Produzenten eine
Reaktion erfordern. (Vgl. Gruber 1996: 66f).
Vordergründig können inhaltliche und strukturelle DS unterschieden werden: Inhaltliche DS entste-
hen durch den Verstoß eines Teilnehmers gegen den Gesprächskonsens, während strukturelle DS
durch eine Meinungsverschiedenheit über die Turnvergaberegeln bzw. -reihenfolge (wie ,,
Entschuldi-
1
5Vgl. dazu den Begriff disagreement sequence bzw. dissent-turn-sequence bei Kotthoff 1993a; Goodwin 1983 und der
adversative episode bei Eisenberg/Garvey 1981)
1
6Auch in diesen kommt es zu einer Nichtübereinstimmung in Bezug auf inhaltliche Aspekte, die aber nicht auf der
prinzipiellen Unvereinbarkeit der Standpunkte, sondern auf einem kognitiven Irrtum oder einer missverständlichen
bzw. fehlerhaften Äußerung eines Beteiligten beruht.
-14 -
gung, darf ich auch mal reden oder wollen sie mich ständig unterbrechen.
" Elefantenrunde: 9-11) eingeleitet
werden können.
Als typische Verlaufsform inhaltlicher DS gilt nach Gruber (1996: 120) die Trias von Anlass, Formu-
lierung der gegnerischen Standpunkte und die Aushandlungsphase. Dabei ist jede dieser Phasen
durch spezifische Sprechhandlungen charakterisiert. Den Anlass bildet eine Konsensverletzung durch
A, worauf entweder die Thematisierung des Konsensverstoßes durch B oder ein Vorwurf folgt, auf
den A wiederum mit einer Zurückweisung reagiert, durch den er den Widerspruch manifestiert. In der
zweiten Phase werden die divergierenden Standpunkte dargestellt, wobei dies durch (rekursive)
Sequenzen von Vorwürfen und Gegenvorwürfen erfolgt, die mehr oder weniger emotional geprägt
sein können. Hier ist zu beachten, dass durch neue Anlässe, die in den Vorwürfen gegeben sind re-
kursiv neue Vorwurfs-Gegenvorwurfs-Sequenzen entstehen können. In die Aushandlungsphase und
damit zur Rückkehr zur Präferenzorganisation gelangen die Parteien zumeist durch einen Themen-
wechsel. (Vgl. Gruber 1996: 120f; Frankenberg 1979) ) Zum Ende des Dissens sei gesagt, dass
sprachlich ausgetragene Konflikte inhaltlich nicht gelöst werden müssen, um von einer Konfliktbeen-
digung sprechen zu könnnen. (Vgl. Gruber 1996: 64) Häufig verhindern Kontrahenten dies selbt, da
sie vor dem Ziel die eigene Position durchzusetzen, widersprechende Argumente ignorieren oder um-
deuten ein Phänomen, das Keim (1996: 230ff) als Perspektivenabschottung bezeichnet. Für die Lö-
sung des Dissens reicht es aus aus, wenn die Dissensorganisation nicht mehr die kommunikativen
Handlungen der Interaktionspartner bestimmt. (Vgl. Gruber 1996: 64f)
Nach Carmen Spiegel (1995: 17) ist Streit eine verbale, kontroverse und unkooperative Austragungs-
form von Konflikt, die durch Verletzung bzw. Missachtung des Partnerimages
17
und Unkooperativität
gekennzeichnet ist.
18
Ohne diese Merkmale ließe sich von eher von einer DS im Sinne von Gruber
(1996) sprechen.
Beim Streit steht der Beziehungsaspekt im Vordergrund, wobei er nicht nur negative Folgen auf der
Beziehungsebene nach sich zieht, sondern gravierende Folgen für den Verlierer bedeutet, weil im
Streit auch Identitäten ausgehandelt werden. Da bei einer Identitätsbedrohung im Streit die Emotio-
nen sehr intensive Ausmaße annehmen können, ist die Eskalation solcher Kommunikationsereignis-
se wahrscheinlicher als bei anderen Formen. Der jeweilige Standpunkt wird dann oft explizit und per-
1
7
,,
Der Terminus Image kann als der positive soziale Wert definiert werden, den man fuer sich durch die Verhaltens-
strategie erwirbt, von der die anderen annehmen, man verfolge sie in einer bestimmten Interaktion. Image ist ein in
Termini sozial anerkannter Eigenschaften umschriebenes Selbstbild - ein Bild, das die anderen uebernehmen können."
(Goffman 1996: 10)
1
8Das Kooperationsprinzip und damit zusammenhängend die Kommunikationsmaximen nach Grice gelten als Grund-lage
jeder Kommunikation. (vgl. Schank 1987) Bei der Untersuchung von Konfliktgesprächen können sie helfen, den Grad
der Rationalität der Konfliktaustragung zu bewerten, sagen aber nichts über die situative Angemessenheit von
Gesprächsbeiträgen aus. Daneben kann die Auffassung von Gesprächspartnern, was genau als Kooperativität gilt
durchaus unterschiedlich ausfallen, je nach kulturellem oder subkulturellem Hintergrund. (Vgl. Linke et al.: 219ff)
-15 -
sonenbezogen formuliert (z.B. Vorwurf, Kritik, Beleidigung), wobei weder die eigene Position, noch
die der anderen Partei weiter entfaltet werden kann. Daraus geht hervor, dass es, um eine DS als
Streit bezeichnen zu können, nicht ausreicht, dass die Teilnehmer unterschiedliche Meinungen vertre-
ten. Charakteristisch für den Streit ist die unkooperative, das Image des Gegners verletzende Art und
Weise in der dies geschieht. (Vgl. Rehbock 1987:177; Schwitalla 1987: 107f; Spiegel 1995:19;
Schwitalla 2001:1374) Darin liegt auch der Unterschied zur Argumentation, wobei bei dieser Kon-
fliktaustragunsform, aufgestellte Behauptungen begründet werden und die Kontrahenten ihre Positio-
nen ausführen. Zwischen den Teilnehmern herrscht auf formaler Ebene Kooperativität, weshalb die
Dissensorganisation in Argumentationen nicht zu beobachten ist. (Vgl. Gruber 1996: 56f)
Abgesehen von derartigen inhaltlichen Aspekten, kommt es beim Streit, wie bei der DS, zu einer spe-
zifischen Sequenzierung bzw. Organisation des Gesprächs der Dissensorganisation. (Siehe 4.3)
4.2 Inhaltliche Merkmale von DS
Inhalich sind DS durch die kommunikative Austragung interpersoneller Konflikte, also die Darstel-
lung von unterschiedlichen Standpunkten, in deren Folge mindestens zwei Positionen zu einem The-
ma explizit präsentiert werden, geprägt. (Vgl. Gruber 1996: 56)
Kommunikativ ausgetragene Konflikte, können an drei globalen Bereichen eskalieren. Dies sind das
Weltwissen, die Rollenbeziehungen
19
zwischen den Beteiligten und drittens die Regeln der Ge-
sprächsorganisation. (Vgl. Gruber 1996: 81) Dazu merkt Gruber (1996: 83ff) an, dass DS, die ihren
Ausgangspunkt auf verschiedenen Ebenen haben, auch verschiedene Strukturen aufweisen.
4.3 Formale Merkmale
Charakteristische formale Merkmale nichtkonsensueller Gesprächsformen lassen sich vor allem auf
der Ebene der Gesprächsorganisation benennen. Hierzu zählen verbale Kämpfe um das Wort, simul-
tane Sprechphasen, Unterbrechungen und Forderungen jemanden Aussprechen zu lassen, aber auch
auffällig lange Gesprächspausen. (Vgl. Fiehler 1993:161f; Schwitalla 2001:1379).
Das wichtigste Merkmal zur Kennzeichnung von DS ist der Wechsel in der Präferenzorganisation.
Das Verfahren der Präferenzorganisation wird von Interaktanten aktiv dazu benutzt die Kooperation
1
9Nach Balog (1989) sind Rollen dabei als ,,intentional realisierte, mehrstufige Handlungen" sowie ,,als eine Verbin-dung
einer sozialen Identität und Einzelhandlungen charakterisierbar." (Balog 1989: 111) Die Rollenpositionen von
Interaktionspartners erzeugen in dem jeweiligen Gegenüber Rollenerwartungen, die jemandem aufgrund seinem
sozialen oder beruflichen Status, aber auch wegen seiner Position zu einem Thema zukommen kann .
-16 -
zu maximieren und das Konfliktpotential zu minimieren. (Vgl. Heritage/Atkinson 1984: 55) Dabei
wird als Antwort auf den ersten Teil einer Paarsequenz vom Rezipienten diejenige mögliche Antwort
bevorzugt, die die geringste Imagebedrohung für den Produzenten bedeutet.
20
Diese ist also die präfe-
rierte Äußerung. Es treten zwar auch in konsensuellen Gesprächsformen nichtpräferierte Äußerungs-
teile auf, jedoch werden diese speziell markiert.
Die Kommunikation in DS ist hingegen nicht mehr durch die Ausrichtung auf Kooperation, sondern
bewusste Nichtübereinstimmung gekennzeichnet. Daneben scheinen noch weitere Merkmale aus-
schlaggebend für die Bewertung einer unkooperativen Gesprächsphase als DS zu sein.
Folgende Merkmale kennzeichnen nach Gruber (1996: 60) eine dissente Sequenz:
a) strukturelle Markierungen von Übereinstimmungsäußerungen, Nichtübereinstimmung wird
zum präferierten zweiten Teil in Gesprächssequenzen
b) Sprecherwechsel/Turn-taking finden nicht an transition relevant places (TRP's statt, sondern
an disagreement relevant places (DRPs)
c) Zwischen aufeinanderfolgenden Äußerungen ist ein erhöhtes Maß an formaler Kohäsion
21
1 zu
beobachten (inhaltliche Anschlüsse an die eigenen sowie an die Beiträge der anderen Partei
werden speziell markiert)
Durch die Kombination dieser drei Kriterien lassen sich DS nicht nur inhaltlich sondern auch struktu-
rell bestimmen. Gruber (1996) spicht von von Dissensorganisation, wenn mindestens zwei dieser
Merkmale in einem Gespräch auftreten. (Gruber 1996: 60)
Die Dissensorganisation betrifft vor allem Phänomene des Sprecherwechsels. Dieser auch als Ge-
sprächsschrittwechsel bezeichnete Vorgang ist regelgleitet und gelingt in konsensuellen Gesprächs-
formen zumeist, da die Gesprächspartner einem impliziten Kooperationsprinzip folgen. (Vgl. Zanner
2005: 5f) Der Sprecherwechsel kann grundsätzlich auf zwei Arten erfolgen:
22
t. (Vgl. Henne/Rehbock 1982: 201)
2
0Mögliche zweite Teile einer Paarsequenz sind also nicht gleichrangig. Als Antwort auf eine Bitte ist ihre Annahme
präferiert, während ihre Ablehnung nicht präferiert ist, und markiert wird. Formen der Markierung sind eine verzöger-
te Antwort, eine Einleitung, durch die der nicht-bevorzugte Status markiert wird oder eine Erklärung, weshalb nicht
der präferierte Teil ausgeführt werden kann.
2
1Mit dem Kohäsionsbegriff werden die sprachlichen Elemente bezeichnet, die Textteile mit anderen verbinden (z.B.
Wiederholungen, gramm. Referenzbeziehungen, Konjunktionen). (Vgl. Günthner 1993:125; Bußmann 1990:389f
2
2Die implizite Form wird durch nonverbale Mittel, wie leichte Körperzuwendung oder auch nur einen (auffordernden)
Blick eingeleitet.
-17 -
(Vgl. Gruber 1996: 60) Nach Gruber (ebd.) sind Unterbrechungen Redebeiträge, die keine Hörersig-
nale sind und durch einen Sprecher der gegenwärtig nicht das Rederecht besitzt an einer Stelle pla-
ziert werden, die keine transition relevant place (TRP) ist. Sie werden also nicht an Stellen im Ge-
spräch plaziert, wo eine ,,Beitragskonstruktionseinheit"
23
abgeschlossen oder ein baldiger Abschluss
abzusehen ist. (Vgl. Gruber 1996: 60f)
Offensichtlich kommt Unterbrechungen bzw. den Versuchen dazu in DS eine doppelte Funktion zu:
Sie stellen einerseits das Rederecht des Sprechers in Frage, wobei Macht- bzw. Dominanzverhältnis-
se eine Rolle spielen; andererseits markieren sie inhaltliche Bezugspunkte (DRPs) in der Argumen-
tation des Gegners, an denen der eigene Turn ansetzen soll.
24
(Vgl. Gruber 1996: 61)
Desweiteren erscheint die Differenzierung zwischen thematischer und struktureller Kohäsion auf der
Ebene der Gesprächsorganisation sinnvoll, obwohl die Annahme berechtigt ist, dass die strukturelle
Kohäsion immer auch die thematische Kohäsion voraussetzt, wie auch Sacks et al. (1974) erläutern:
,,Turns display gross organizational features that reflect their occurrence in a series. They regularly have a three
part structure: one which addresses the relation of a turn to a prior, one involved with what is occupying the
turn, and one which addresses the relation of the turn to a succeeding one."
(Sacks et al. 1974: 722)
Eben diese formale Charakteristik wird in nichtkonsensuellen Gesprächsformen oft verletzt. Hieraus
folgen zwei für diese Gesprächsform typische thematische Formen der Kohäsion. Dies ist zum einen
die selbstbezogene und zum anderen die partnerbezogene Kohäsion (vgl. Gruber 1996: 75). Als
selbstbezogene Turns werden nach Gruber (1996: 60) solche bezeichnet, in denen der Produzent auf
seinem vorherigen Beitrag insistiert bzw. die thematisch an den letzten selbstproduzierten Gesprächs-
beitrag anschließen. Gruber (1996: 64) spricht von thematischer Opponentenkohärenz, wenn ein In-
teraktant wesentliche Teile des Beitrags des Kontrahenten wiederholt, wobei er durch minimale Ver-
änderungen im Wortlaut einen Widerspruch hervorruft.
Jeder thematische Dissens zieht Folgen auf allen anderen Gesprächsebenen nach sich. Inhaltlich be-
trachtet weist ein Dissens darauf hin, dass mindestens ein Teilnehmer den thematischen Bezugsrah-
men nicht teilt. Die Beeinträchtigung der anderen Ebenen kann aus dem weiteren Verlauf der Interak-
tion abgeleitet werden, wobei die Charakteristika der Dissensorganisation es ermöglichen das Aus-
maß der DS einzuschätzen. Abhängig davon, wie stark die Ebene der sozialen Beziehung oder der
2
3Sacks/Schegloff/Jefferson (1974:704) bezeichen dies als ,,turn-constructional unit". Definition nach Deppermann
(2001:58): ,,Dies sind die kleinsten Einheiten, nach denen ein Sprecherwechsel möglich wäre [...]. Jede Beitrags-
konstruktionseinheit trägt zum Sinn des Gesamtbeitrags bei, bildet aber auch schon selbst eine Teilhandlung."
2
4Dies kann bspw. Durch einen einfachen Einwurf wie ,,ach, hör doch auf" oder einen Zisch-Laut (,,ts") geschehen,
wodurch noch während der Gegenspieler das Rederecht besitzt, Kritik angebracht werden kann.
-18 -
formalen Gesprächsorganisation behindert ist, kann diese Beeinträchtigung von den Gesprächspart-
nern thematisiert werden. Folglich ist dann von der kommunikativen Austragung eines Konflikts zu
sprechen, wenn die Anfangsphase durchlaufen und an die Stelle der Präferenzorganisation die Dis-
sensorganisation getreten ist.
Allerdings ist auch vorstellbar, dass eine objektive Konsensverletzung vom Rezipienten ignoriert
wird. Dagegen können nach objektiven Kriterien nicht-konsensverletzende, harmlose Äußerungen
vom Gesprächspartner thematisiert werden und zu einer DS führen,
25
was zu dem Schluss führt, dass
DS zwischen den Kontrahenten kooperativ-interaktiv hergestellt werden.
Von einem Kooperationsbruch ist die Rede, wenn ein Interatktionspartner gegen den Interaktionsmo-
dus verstößt bzw. den kommunikativen Modus nicht akzeptiert, wobei sich das im Verlassen des In-
teraktionsraumes äußern kann.
Häufig äußert sich mangelnde Kooperativität auch in einer gestörten Responsivität. (Vgl. Schank/
Schwitalla 1987: 35) Dies bedeutet, dass ein Interaktant auf einen Beitrag seines Partners nicht auf
angemessene bzw. erwartbare Art reagiert. In diesem Fall spricht Spiegel (1995: 186ff.) von einer so-
genannten Interaktionsblockade. Dabei können drei Formen unterschieden werden: Verweigerung
(Ablehnung einer erwartbaren Handlung), Angriff und Ausweichen (auf eine Ersatzaktivität, die im
Rahmen des Gesprächssituation noch als angemessen gelten kann). Typische Auswirkungen einer ge-
störten Responsivität sind auch auffällig lange Pausen.
Zusammenfassend lässt sich für die DS also ein Wechsel in der Präferenzorganisation nachweisen,
der dazu führt, dass Nichtübereinstimmung unmarkiert ist. Die Dissensorganisation ist auf der Bezie-
hungsebene darauf ausgerichtet, das eigene Image zu bewahren und zu pflegen, wogegen das des
Gegners bedroht wird. Dabei unterscheiden sich präferierte und nichtpräferierte Reaktionen nicht
bloß auf der inhaltlichen, sondern auch auf der strukturellen Ebene; Undzwar darin, dass nicht prä-
ferierte zweite Teile ,,
exhibit the following features: (1) the inclusion of delay devices prior to stated disagree-
ments like silences, hesitating prefaces, request for clarification, and/or (2) the inclusion of weakly stated disagree-
ment components, that is, partial agreements/partial disagreements."
(Pomerantz 1984: 75)
2
5Dies scheint sogar noch wahrscheinlicher, da demjenigen der den monierten Gesprächsbeitrag tätigt, die
Thematisierung willkürlich und unverständlich erscheinen muss. (Vgl. Baumeister/Stilwell/Wotman 1990)
-19 -
4.4 Zur Rolle von Emotionen in nichtkonsensuellen Gesprächsformen
Einige Wissenschaftler, die sich auf dem Gebiet der Konflikt- bzw. Streitgespräche betätigen, weisen
auf die wichtige Rolle der Emotionen bei diesem Gesprächstyp hin.
26
(z.B. Apeltauer 1977)
Dabei ist für die Konfliktkommunikation vor allem die Emotion Wut relevant. (Vgl. Gruber 1996: 78)
Fiehler führt (1992: 160) den Begriff der ,,emotionalen Positionskonfrontationen" ein, worunter For-
men des Emotionsausdrucks gefasst sind, die vielerseits als einzige mögliche Form des Ausdrucks
von Emotionen in Gesprächen gelten, die aus der Außenperspektive erkennbar sind.
27
Nach Thimm/Kruse (1993) sind hesitation markers, wozu Pausen, Räuspern und Strukturierungssig-
nale (wie ,,hmm" und ,,ah") gezählt werden, sowie Lachen, Selbstkorrektur und Reformulierung,
ebenfalls Phänomene, durch die im Gespräch Emotionen ausgedrückt werden können.
Der Psychologe Oatley (1992:66) begreift Emotionen als ,,Kontrollsignale" und tendiert zur Auffas-
sung, dass sie primär nicht verbal kommuniziert werden, sondern durch mimische, gestische und pa-
raverbale Mittel (vor allem Intonation). Da sich Emotionen also auf der para- und nonverbalen Ebene
manifestieren, scheint die Beobachtung von Mimik, Gestik und Intonation unumgänglich, um Annah-
men über die Intensität und Ausdrucksmodalität der auftretenden Emotionen, sowie insgesamt über
die emotionale Involviertheit der Teilnehmer tätigen zu können. (Vgl. Gruber 1996: 80f)
Die Relevanz der Ergebnisse Oatleys (1992) ergibt sich daraus, dass sie eine plausible Erklärung da-
für bereitstellen, weshalb im Verlauf von Konflikten bzw. nichtkonsensuellen Gesprächsformen
Emotionen auftreten müssen. Undzwar deshalb, weil die Gesprächspartner bei nichtkonsensuellen
Gesprächsformen (z.B. DS) auf der kognitiven Ebene konkurrierende bzw. sich widersprechende
Meinungen ausdrücken und damit oppositionelle Sprechhandlungen vollziehen, während auf der dis-
kursiven Ebene die Präferenz zur Nichtübereinstimmung (Dissensorganisation) überwiegt. Gruber
(1996: 80) postuliert deswegen, dass ,,
das Auftreten von Wut aufgrund der spezifischen Interaktionsbedingun-
gen, die in DS herrschen, vorhergesagt werden kann
." (Gruber 1996: 80)
2
6Eine Untersuchung über Charakteristika der Gesprächsorganisation und non- und paraverbaler Elemente, die Emotio-
nen ausdrücken können wäre für diese Arbeit sehr interessant, da sie wichtige Erkenntnisse zum Verlauf von
konfliktären Gesprächssequenenzen liefern könnten.
2
7Fiehler (1992) versteht darunter das inhaltliche Bestreiten einer Position, Gegenbehauptungen, bestreitende Formeln,
Verneinungen, den Gebrauch von adversativen Partikeln und Interjektionen, den Vorwurf des Lügens, Übertreibungs-
und Wiederholungserscheinungen und die Turn-Organisation (Vgl. Fiehler 1992: 160)
-20 -
5. Übertragbarkeit von Organisationsstrukturen mündlicher nichtkonsensueller
Gespräche auf Chat-Gespräche
Da DS durch eine spezifische Diskursorganisation gekennzeichnet sind, die vor allem die Bereiche
Sprecherwechsel und Präferenzorganisation betrifft, soll nun die Übertragbarkeit dieser formalen
Merkmale der Diskursorganisation auf die Chat-Kommunikation ausgeführt werden.
5.1 Exemplarische Untersuchung einer ICQ-Chat-Logfile (ICQ 7; unmoderiert, proprietär)
Die im Rahmen eines ICQ-Chats geführte Gesprächssequenz lässt sich aufgrund gewisser inhaltli-
cher und struktureller Merkmale als DS einordnen, die in ihrem Verlauf Merkmale einer Streitse-
quenz aufweist. Auf der Makroebene ist die Orientierung an den drei Gesprächsphasen Eröffnung
(Zeilen 1-16), Hauptphase (17-85) und Beendigung (86-146) zu erkennen.
In den Zeilen 1-16 werden Begrüßungsformeln (1-2) und Fragen nach dem Wohlbefinden (3-7) aus-
getauscht und es herrscht die Präferenzorganisation vor. Dies bedeutet, dass die konventionellen
Muster von Paarsequenzen befolgt werden und die Interaktanten in ihren Äußerungen kooperieren.
Beispiel ICQ 7
1 T1: hey ya
T2: hey
T1: wie geht's dir?
T2: gut gut
5 T2: und selbst?
Den Anlass für die DS stellt in diesem Gesprächsabschnitt die heftige emotionale Reaktion durch T2
(15), auf die insistierende Frage von T1 (12, 14) dar.
8 T1: und sonst?
T2: hm
10 T1: sonst nichts neues?
T2: ne nix besonderes
T1: wie geht's der runden schwester?
T2: gut denk ich
T1: aber du weißt es nicht?
15 T2: frag sie doch selbst
-21 -
Generell bildet den Anlass
28
für eine DS ein Verstoß gegen den Konsens über Ansichten der Welt,
der situational oder extrasituational erfolgen kann. (Vgl. Gruber 1996: 83). An dieser Stelle liegt der
Ver-stoß außerhalb der aktuellen Situation.
29
Dies wird daran ersichtlich, dass T1 die weder als
Wider-spruch, noch als Vorwurf bestimmbare Äußerung (15) als Anlass nimmt, diesen als
Konsensverstoß zu thematisieren (17), was T2 unverständlich erscheint, der zunächst mit Ignorieren
(18) und dann mit Zurückweisung der Thematisierung (19) reagiert, womit eine DS eingeleitet wird.
Das Vorliegen eines extrasituationalen Anlasses weist auf einen zugrundeliegenden latenten Konflikt
hin. (Vgl. ebd.) Obwohl vor der nicht erwartbaren, emotionalen Reaktion von T2 (15) scheinbar die
Präferenzorga-nisation vorherrscht, sind bereits in den Zeilen 7-11 Merkmale gestörter Responsivität
zu finden, die ebenfalls auf die Gegenwart eines latenten Konflikts zwischen den Parteien hindeuten.
Ein Turn kann im Allgemeinen als Teil einer Paarsequenz von Rede und Gegenrede betrachtet wer-
den. Bei dieser bedingt der erste Gesprächsbeitrag den zweiten, wobei Abweichungen vom erwarte-
ten Muster bemerkt und durch Wiederholung oder eingebettete Frage-Antwort-Sequenzen angezeigt
werden.
Im Beispiel reagiert T2 auf die sehr ambige Frage von T1 (8) zunächst mit der Verweigerung der
Antwort (9), während nach der Wiederholung der Frage durch T1, zwar eine Antwort erfolgt, die aber
als ausweichend bezeichnet werden kann (11). Die Wiederholung der Frage durch T1 lässt sich als
Hinweis für das Vorherrschen der Präferenzorganisation benennen, da T1 das durch T2 geäußerte
Partikel ,,hm" (9) nicht als Verweigerung, sondern als Zeichen dafür interpretiert, dass T2 die Frage
nicht verstanden hat. Er wählt also zunächst die am wenigsten imageverletzende Interpretation.
30
Wird das Ausbleiben bemerkt aber nicht angezeigt, stehen je nach Fall mehrere Interpretationswege
offen (ausbleibender Gegengruß > Abneigung), wodurch es zur Entstehung eines Konflikts bzw. zu
einer nichtkonsensuellen Gesprächssequenz kommen kann. (Vgl. Bußmann 2002: 491)
Auf die nächste Frage von T1 (12) reagiert T2 erneut mit einem ausweichenden Äußerungsturn (13),
worauf nach einem Nachhaken durch T1 (14) der beschriebene verbale Angriff (15) folgt.
Die Reaktion von T2 in Zeile 15 wurde als emotionale Zurückweisung bezeichnet, wobei sich die
Frage stellt, wie sich Emotionen im Chat manifestieren, da in dem Beispiel die Mittel zur Kompensa-
tion der fehlenden Wahrnehmungskanäle in der CvK durch graphische und semiotische Innovationen
nicht genutzt werden. Emotionen können aber nicht nur durch para- und nonverbale Mittel, sondern
auch durch die formale Struktur von Äußerungen ausgedrückt werden. Dies geschieht an dieser Stel-
2
8Es sollte darauf hingewiesen werden, dass der Anlass einer DS nur im Anschluss an die Reaktion von B auf eine Kon-
sensverletzung als solcher bestimmt werden kann, da unmöglich Merkmale angegeben werden können, die einen An-
lass a priori als solchen erkennen ließen. (Vgl. Gruber 1996: 83)
2
9Er kann jedoch auch innerhalb der Situation liegen, wie in dem Widerspruch (33-34) durch T2 zu erkennen ist.
3
0Derartig ambige Äußerungen sind ein Merkmal phatischer Kommunikation und besonders charakteristisch für nähe-
-22 -
le durch den Imperativ ,,
frag sie doch selbst
" (15), mit dem die direkte Ablehnung des Gesprächsver-
haltens der anderen Partei kommuniziert wird.
31
(Vgl. Gruber 1996: 232f). Auch durch andere forma-
le bzw. syntaktische Besonderheiten können Emotionen vermittelt werden. Dies kann, wie in den
Zei-len 34-35, 50 und 69, durch Übertreibungen (,,übelst oft", ,,immer", ,,nie") oder eine stark
umgangs-sprachliche Wortwahl mit negativ konnotierten Ausdrücken (Z. 52: ,,
wieso verdammt noch
mal egal?
", Z. 27: ,,[...]
, dass es dich nen scheiß interessiert
", Z. 30: ,,
hast du ja anscheinend drauf geschissen
")
geschehen.
Nach dieser Anlass- bzw. Eröffnungsphase entsteht eine längere Pause (32 sec.), die ebenfalls auf die
gestörte Responsivität auf Seiten von T2 hinweist, da an dieser Stelle rein strukturell ihm das Rede-
recht zukommt.
Daran schließt die Hauptphase an, die durch eine Frage von T1 eingeleitet wird, in der sie den Kon-
sensverstoß von T2 thematisiert (17). Darauf werden die divergierenden Ansichten dargestellt, wobei
durch den Vorwurf von T1 (21) eine DS eingeleitet wird, worauf mehrere verschachtelte Vorwurfs-
sequenzen auftreten. Daraus geht hervor, dass Vorwürfe DS sowohl einleiten als auch in ihrem Ver-
lauf auftreten können, wobei dies mit Themensprüngen zusammenhängt; deshalb sind sie nach Gru-
ber (1996: 196) initiierende Sprechhandlungen.
Innerhalb dieser DS ist ein Wechsel von der Präferenz- zur Dissensorganisation bzw. von der Koope-
ration zur bewussten Nichtübereinstimmung zu beobachten, der durch strukturelle Markierung von
Übereinstimmungsäußerungen (36, 66, 79), Präferierung von Nichtübereinstimmung als zweitem Teil
von Paarsequenzen (23, 33-34, 57, 59, 63-64) und ein erhöhtes Maß an formaler Kohäsion (42-43,
46-49, 57-59) gekennzeichnet ist. Damit sind zwei der nach Gruber (1996) erforderlichen Charakte-
ristika der Dissensorganisation erfüllt.
Im weiteren Verlauf sind Paarsequenzen von Vorwurf-Gegenvorwurf (21-23/24 und 35-37, 50-51) zu
beobachten, wobei aber auch Vorwurf-Rechtfertigungenssequenzen (43-44/49, 56-62, 73-75) auftre-
ten. Dies entspricht auch Grubers Ergebnissen zu Streitgesprächen, wonach Gegenvorwürfe die häu-
figste Reaktion auf Vorwürfe darstellen. (Vgl. Gruber 1996: 205)
Generell bestehen Vorwürfe aus einem darstellenden und einem wertenden Teil (Vgl. Gruber 1996:
196). In dieser Sequenz fehlt bei den Vorwürfen jedoch der wertende Teil, was darauf zurückzufüh-
ren ist, dass das Gespräch im Rahmen eines privaten 1 zu 1 Chats stattfindet und sich die Teilnehmer
persönlich kennen, weshalb ihnen die Vorwürfe auch ohne Vollständigkeit bzw. Realisierung des
wertenden Teils als solche erkennbar sind.
sprachliche Kommunikation und konsensuelle Gesprächsphasen.
3
1In konfliktären Gesprächsformen können Emotionen bereits durch die Art der Thematisierung des Positionsgegen-
satzes ausgedrückt werden. (Vgl. Gruber 1996: 91)
-23 -
Auffällig ist, dass nur extrasituationale Vorwürfe auftreten. Dies beruht auf den technischen Bedin-
gungen der Chat-Kommunikation, wodurch DS bezüglich der Gesprächsorganisation (Sprecherwech-
sel) nahezu ausgeschlossen sind.
32
(Vgl. Gruber 1996: 197)
Nach Scott/Lyman (1968/1976) stehen dem Hörer nach einem Vorwurf zwei Reaktionsmöglichkei-
ten offen, nämlich Rechtfertigungen (aber auch Schuldabweisung, Ausreden), die den Streit verschär-
fen, oder Entschuldigungen (auch Erklärungen und Selbstkritik), die deeskalierend wirken. (Vgl.
Rehbein 1972: 295). In dem Beispiel führt jedoch eine Erklärung von T1 (41-42) zu einer zweiten
DS, was der Annahme Rehbeins widerspricht. In die Aushandlungsphase gelangen die Interaktions-
partner aber im Einklang mit Rehbeins (1972) Ausführungen nach Rechtfertigungen (56-83) und ei-
ner anschließenden Entschuldigung (84-85).
Daneben wird ein Konsens bezüglich der Beziehungskonstellation der von T1 vorgebracht wird (28
und 31) von T2 durch einen Vorwurf (30) und einen Widerspruch (33-34) verletzt bzw. in Frage ge-
stellt, während T1 dieser Reaktion wiederum widerspricht (32 und 36). T2 besteht jedoch auf der Ab-
lehnung des Konsens' (31-33). Hier ist auch die für DS charakteristische erhöhte formale Kohäsion zu
erkennen. In den Zeilen 42-43 lässt sich die partnerbezogene Kohäsion nachweisen, da T2 die Äuße-
rung (42: ,,
es sind einfach schon 6 jahre
" ) aufgreift und daraus durch geringfügige Umformulierung ei-
nen Vorwurf herstellt (43). Ebenfalls partnerbezogen ist die formale Kohäsion zwischen den Äuße-
rungen ,,
da gabs echt nichts mehr zu erklären
" (57) und ,,
doch, gab es...
.[...]" Diese Form kann in Anleh-
nung an Gruber (1996: 64) als thematische Opponentenkohärenz bezeichnet werden. Merkmale
selbstbezogener Kohäsion sind ebenfalls zu finden, wobei diese sich auf situative (86) oder extrasi-
tuative Äußerungen (53) beziehen kann.
In Zeile 37 geht T2 auf den Vorschlag eines Face-to-face-Treffens (25-27) von T1 ein, indem er
durch die Äußerung ,,
so per chat versteht man sich ja gerne mal falsch
" (39), die Chat-Kommunikation als
für den verfolgten Gesprächszweck inadäquat charakterisiert. Diese Äußerung kann als Deeskala-
tionsversuch bezeichnet werden, durch den ein Übergang zur Aushandlungsphase geschaffen werden
soll, wobei danach eine kurzzeitige Rückkehr zur Präferenzorganisation erfolgt (39-42). Allerdings
hält diese nur kurz an, da die DS in Zeile 43 erneut eskaliert.
Ab dieser erneuten Eskalation und dem Beginn einer zweiten Vorwurfssequenz stellen beide Seiten
ihre Positionen auf eine emotionale, imageverletzende Art dar (43-49), woran eine weitere mit meh-
reren Themensprüngen verbundene Vorwurfssequenz anschließt, (50-83), in der beide Interaktanten
auf die Vorwürfe mit Gegenvorwürfen und Rechtfertigungen (53, 56, 66, 73-75, 83) reagieren. Zu be-
obachten ist außerdem, dass direkt nach Rechtfertigungen Gegenvorwürfe angebracht werden (53-54,
3
2In der Face-to-face Kommunikation beziehen sich situationale Vorwürfe auf Normverstöße, die innerhalb der aktuel-len
Kommunikationssituation getätigt werden.
-24 -
56, 58-60).
Der misslingende Versuch durch einlenkende Gesprächsbeiträge und Angebote in die Aushandlungs-
phase überzugehen (36-42) ist ein charakteristisches Merkmal von Streitsequenzen. Während T1 ein-
lenkt (40-43) beharrt T2 auf Themensprüngen, indem er einen emotional gefärbten Vorwurf realisiert
(43), auf den T1 wiederum reagieren muss. Darauf folgen gegenseitige Vorwürfe, Gegenvorwürfe,
Rechtfertigungen und Erklärungen bis sich T1 entschuldigt (84-85) und T2 darauf eingeht, indem er
seinen Vorschlag sich zu treffen erneuert (86) und nochmals auf sein Missfallen an der Chat-Kom-
munikation zur Lösung interpersoneller Konflikte hinweist (87).
Aus dieser DS geht hervor, dass beide Teilnehmer ihre Positionen nicht weiter entfalten, wobei es zu
einer Reihe emotionaler Reaktionen und Gegenreaktionen kommt. An dieser Stelle droht die Kom-
munikation abzubrechen, was an den kohäsiven Gesprächsbeiträgen (Perspektivenabschottung), dem
Übergang zur Dissensorganisation auf inhaltlicher Ebene und den langen Pausen zu erkennen ist. Ein
wichtiger Grund, weshalb die Kommunikation dennoch nicht abbricht, liegt vermutlich darin, dass
die Dissensorganisation nicht auch auf die strukturelle Ebene übergreift, da kein Dissens über die Ge-
sprächsorganisation auftaucht. Also kann angenommen werden, dass die DS in diesem Beispiel auf-
gelöst werden kann, weil die Dissensorganisation nur auf der inhaltlichen Ebene zu finden ist und die
Tatsache, dass Emotionen im Chat nicht adäquat vermittelt werden können, könnte begünstigende
Auswirkungen für einen erfolgreichen Übergang zur Aushandlungsphase haben, da die Dissensorga-
nisation laut Gruber (1996) einen schwächeren Einfluss auf den Gesprächsverlauf ausübt, wenn Emo-
tionen schwächer sind. Die Aushandlungsphase wird also durch weniger emotionale vorherige Pha-
sen gefördert. (Vgl. Gruber 1996: 98f.)
Die Darstellung der eigenen Position innerhalb einer DS kann mehr oder weniger emotional verlau-
fen. (Vgl. Gruber 1996: 90) Dabei gilt die Faustregel, dass der Verlauf sich umso emotionaler gestal-
tet, je weniger sich die Kontrahenten als Sprecher akzeptieren. (Vgl. ebd.) Diese Regel trifft auf das
Beispiel jedoch nicht zu, da die wechselseitige Akzeptanz der Sprecherrollen nicht erkennbar gefähr-
det ist, die Darstellungsphase aber dennoch von einer emotionalen Ausdrucksweise geprägt wird. Da-
mit hängen die für Streitsequenzen typischen formalen Kooperationsverletzungen (gestörte Responsi-
vität, Dissensorganisation) zusammen. Bemerkenswert ist auch, dass die chattypischen Überkreuz-
Strukturen, die Teil des Systems des Sprecherwels sind, in Sequenzen erhöhter Emotionalität bzw.
Vorwurfs-Gegenvorwurfssequenzen gehäuft auftreten, während die Paarsequenzen im restlichen Ge-
sprächsverlauf paarig geordnet sind. Diese Beiträge, die jeweils zu den Überkreuzstrukturen (24-27,
66-71) führen, können als Unterbrechungen bezeichnet werden.
Die gestörte Responsivität von T2 ist nicht nur auf die Anfangsphase des Gesprächs beschränkt, son-
dern lässt sich im gesamten Gesprächsverlauf nachweisen und kann als Hinweis für die mangelnde
-25 -
Kooperativität von T2 interpretiert werden. (Vgl. Schank/Schwitalla 1987: 35) T1 realisiert nicht nur
eine höhere Anzahl an Beiträgen (77 gegenüber 69), auch die Durchschnittsäußerungslänge unter-
scheidet sich signifikant.
33
Diese Beobachtung liegt auch im Einklang damit, dass T2 den latenten
Konflikt manifestiert (15) und das T1 derjenige ist, der einlenkende, rechtfertigende und zuletzt ent-
schuldigende Gesprächsbeiträge äußert. Es scheint also, als liege der kommunikative Handlungs-
druck auf der Seite von T1.
Durch das Einlenken, die Entschuldigung von T1 (84-85) und das darauf folgende Angebot zu einem
erneuten Treffen erfolgt die schrittweise Rückkehr zur Präferenzorganisation, womit der Rest des Ge-
sprächs als Aushandlungsphase bezeichnet werden kann, in dem ein Termin vereinbart wird (89-128),
Handlungsabsprachen getroffen werden (129-140) und die Verabschiedung (141-146) erfolgt. Der
Konflikt wird also nicht beigelegt, sondern verschoben.
5.2 Inhaltiche Ebene
In dem Beispiel treten inhaltliche DS auf, die einen die durch einen extrasituationalen Anlass einge-
leitet werden, wobei dies auf das Vorliegen eines latenten Konflikts hinweist. Das Auftreten von
extrasituationalen Anlässen in proprietären Chats kann darauf zurückgeführt werden, dass die Chat-
Partner in dieser Chat-Form sich zumeist persönlich kennen. Konflikte hinsichtlich der Rollenbezie-
hungen konnten nicht beobeachtet werden. Auch DS bezüglich der Regeln zur Gesprächsorganisation
sind aufgrund der technischen Bedingungen der Chat-Kommunikation in den untersuchten Protokol-
len nicht zu finden. Dies beruht darauf, dass DS, die sich am Sprecherwechsel, Nicht-Zuhören oder
Verlassen des Gesprächsrahmens entzünden, aufgrund der chronologischen Sequenzierung der Bei-
träge und der Unsichtbarkeit der Textproduktion ausgeschlossen sind. Das Verlassen des Chat-Rau-
mes, was die virtuelle Entsprechung zum Verlassen des Gesprächsrahmens wäre, führte in den unter-
suchen Chat-Protokollen zu keiner DS bzw. zu Vorwürfen. Dies beruht vermutlich darauf, dass den
Nutzern die technische Bedingtheit der Chat-Kommunikation bewusst ist und sie daher zunächst eine
nicht-imageverletzende Interpretation des Kommunikationsabbruchs präferieren, wie z.B., dass ihr
Interaktionspartner den Raum nicht intentionell verlassen hat.
3
3T1 realisiert pro Beitrag durchschnittlich 8,6 Wörter, während dieser Wert bei T2 bei 5,5 liegt, die Äußerungen sind im
Schnitt also 3 Wortformen kürzer.
-26 -
5.3 Formale Ebene
Zum Verlauf der DS im Untersuchungsbeispiel sei gesagt, dass er dem von Gruber für DS in der
mündlichen Kommunikation aufgestellten Modell entspricht. Im Beispiel bildet den Anlass eine Kon-
sensverletzung durch T2, den T1 thematisiert, woraufhin T2 der Thematisierung wiederspricht bzw.
sie zurückweist. Im Anschluss formulieren beide Parteien ihre Standpunkte in Form von Vorwürfen
und Gegenvorwürfen, wobei der Grad der Emotionalität der Äußerungen variiert. Auffällig ist auch,
dass die Vorwurf-Gegenvorwurfssequenzen rekursiv auftreten, d.h. dass durch neue Anlässe neue DS
entstehen, die dann wiederum bearbeitet werden müssen, um in die Aushandlungsphase übergehen zu
können. In diese gelangen die Kontrahenten wie angedeutet durch den Vorschlag von T2 das Ge-
spräch auf eine Face-to-face Situation zu verschieben, auf den T1 eingeht.
Besonders in DS, aber auch in nichtkonsensuellen Gespr
ä
chsformen im allgemeinen, kommt Ph
ä
no-
menen des Sprecherwechsels, wie
Ü
berlappungen, Unterbrechungen, gest
ö
rter Responsivit
ä
t und un-
kooperativen Themenwechseln, eine ma
ß
gebliche Rolle zu. (Vgl. Luginb
ü
hl 2003: 70) Das System
des Sprecherwechsels basiert auf der simplen Regel, ,,
dass von Überschneidungen an den
Übergangspunkten abgesehen nur ein Gesprächsteilnehmer redet, während die anderen schweigen und einen ge-
eigneten Moment für die Ergreifung des Rederechts
34
abwarten
" (Storrer 2001: 12).
38
1 Jan Karl. Danke. Also, wenn der Spiegel-Artikel stimmt und davon gehe ich aus, dann kann doch
wohl niemand mehr ernsthaft mit Office 97 arbeiten wollen. Wird MS wg. Geschäftsschädi-
gung gegen Scriba vorgehen?
4 CHochstaedter Mit Office97 kann jeder problemlos arbeiten...
5 Wolf wir koennen jhier nicht an MS Network teilnehemn weil wir hier in Uruguay nicht auf der
Liste sind. Warum
6 CHochstaedter Das einfachste ist, während der Arbeit nicht mit dem Internet connected zu sein...
7 RMacholz Was hat das mit dem Artikel zu tun? Punkt ist es gibt keine Lücke im IE. Fertig.
8 CHochstaedter Aber auch wenn die Connection hergestellt ist,... müssen Internet Verbindungen...
10 Steve Ich dachte hier wird ueber die Gefaehrlichkeit von Active X gechattet ???
11 CHochstaedter zwischen Office97 Produkten und dem Internet explizit aufgebaut werden...
12 Steve wo sind nun die Fakten ??? ;-(
13 CHochstaedter z.B. beim Laden und Speichern von Office Dateien auf FTP Servern
(Quelle: Focus-Chat)
In dem Beispiel ist ein Experte der Firma Microsoft, Christoph Hochstädter, zu einem Expertenchat
eingeladen worden, wo er ca. eine Stunde lange von zahlreichen Teilnehmern intensiv zu technischen
Einzelheiten befragt wird. Aus dieser kurzen Sequenz geht hervor, dass dieser (Chochstaedter) durch
3
4Der Begriff Rederecht bezeichnet ,,das Recht eines Sprechers [verstanden], eine Äußerung den aktuellen kommunika-
tiven Bedingungen entsprechend bis zum geplanten Abschluß zu realisieren" (Zifonun et al. 1997: 469)
3
8Sofern eine Gesprächssequenz zwischen Personen über einen längeren Zeitraum läuft oder die Auswahl des Ge-
sprächspartners gefallen ist, kann Fremdwahl auch ohne Adressierung auftreten, ohne dass dies zu Missverständnissen
führt.
-27 -
die vier Beiträge in den Zeilen 6, 8, 11 und 13 versucht, einen kommunikativen Zug
35
zu realisieren.
Dabei zeigt er durch die drei turnfinalen Punkte, die an seine ersten drei Beiträge angehängt sind und
als Pausenzeichen bezeichnet werden können, dass er zum einen seinen Turn noch nicht beendet hat
und zum anderen auch, dass er weiterhin das Rederecht beansprucht. (Vgl. Storrer 2001: 3-24) Er teilt
also seinen kommunikativen Zug in mehrere Beiträge auf, damit die Teilnehmer wissen, dass er einen
Beitrag produziert, da sie dies ja weder hören noch sehen können. Dies lässt sich als Anpassung des
Rederechts an die technischen Bedingungen der Chat-Kommunikation interpretieren. Das Ende sei-
nes kommunikativen Zugs signalisiert er schließlich dadurch, dass der Satz syntaktisch beendet ist
und an den letzten Beitrag keine Punkte angehängt werden. Allerdings wird er bei diesem Versuch
durch die anderen Nutzer mehrfach unterbrochen. Da nach Gruber (1996: 60) Äußerungen als Unter-
brechungen eingeordnet werden, ,,
[...] wenn ein Sprecher, der nicht am Wort ist, an einer Stelle, die keine
Transition Relevance Place ist, versucht einen Redebeitrag zu plazieren, der kein Hörersignal ist"
, können die
Beiträge der Laien als Unterbrechungen bzw. Unterbrechungsversuche gedeutet werden.
Die Tatsache, dass er nach den Einzelbeiträgen unterbrochen wird, verweist darauf, dass diese in An-
lehnung an Gruber (1996) als disagreement relevant places (DRP) bezeichnet werden können, also
als Punkte an denen Teilnehmer mit widersprechender Meinung mit ihrer Kritik ansetzen können.
Dies könnte zwar als versuchter Sprecherwechsel bewertet werden, allerdings können diese im Chat
schwer als erfolgreich oder nicht erfolgreich eingestuft werden. Neben dem ungefährdeten Rederecht
ist auch der theoretisch unbegrenzte Zeitraum, der den Interaktanten in unmoderierten Chats zur Ver-
fügung steht, ein wichtiger Grund, weshalb
36
5.4 Kompensations- und Substitutionsmöglichkeiten
In der Face-to-face-Kommunikation stehen den Interaktionspartnern mehrere Wahrnehmungskanäle
zur Verfügung, über die sie bewusst oder unbewusst kommunizieren können. In der Chat-Kommuni-
kation kann dagegen nur ein Wahrnehmungskanal genutzt werden, durch den Nutzer versuchen, die
fehlenden Kanäle zu kompensieren. Jedoch tun sie dies nicht, indem sie die nicht vermittelbaren non-
und paraverbalen Elemente verbalisieren (Vgl. Beißwenger 2000: 95), da dies der geforderten ökono-
mischen Verschriftlichung im Chat widersprechen und die Kommunikation erschweren würde. (Vgl.
Beißwenger 2000: 96) Vielmehr führt die Aufgabe der Kompensation und Substitution sprechsprach-
3
5Nach Beißwenger (2003: 212) bezeichne ich mit dem Begriff Beitrag eine ,,formale Einheit", also eine Äußerungen
eines Interaktionspartners, ,,die im Display aufgrund eines vorangehenden und eines nachfolgenden Absatzreturns als
Einheit isolierbar" ist. Dagegen sind kommunikative Züge, sprachliche Einheiten, die ,,von ihrem Produzenten als
pragmatische Einheit konzipiert wurden". (ebd.)
3
6In moderierten Chats ist dieser Zeitraum häufig beschränkt, da Experten eingeladen werden, die nur für eine begrenzte
Zeit zur Verfügung stehen. Die Zeit ist in diesem Fall das knappe Gut, um das Konflikte entstehen können. Deshalb
-28 -
licher Kommunikationselemente zu semiotischen, lexikalischen und morphologischen Innovationen.
(Siehe Kap. 2.2.2) Diese sind kurz und bieten eine ,,
weitestmögliche Angleichung der Geschwindigkeit der
Schriftproduktion an die aus der Vis-á-Vis-Kommunikation gewohnte Geschwindigkeit der Lautproduktion zu er-
reichen
" (Beißwenger 2000, 95).
Storrer (2000: 170) weist jedoch auf eine wichtige Unterscheidung hin:
,,Während Mimik und Gestik im
Face-to-face-Gespräch nicht ausgeblendet werden können, ist der Einsatz von Emotikons optional. Es handelt sich
also um intentional gesetzte Zeichen."
Bei den untersuchten Chat-Protokollen fällt auf, dass Emoticons,
aber auch andere Kurzformen, in nichtkonsensuellen Gesprächsformen im Vergleich zu restlichen
Chat-Gesprächen unterrepräsentiert sind.
39
In nichtkonsensuellen Chat-Gesprächen sind sie nur im
Rahmen einer gemischten oder humoristischen Interaktionsmodalität zu finden. Auch im Untersu-
chungsbeispiel tritt ein einziges Emoticon auf (Z. 78), das der Verdeutlichung einer sarkastischen
Äußerung dient.
40
Dies scheint ein Hinweis darauf zu sein, dass die Nutzer, die Tatsache Emotionen
bei DS im Chat ausblenden zu können als vorteilhaft betrachten, da diese im Zusammenhang mit ei-
ner Identitätsbedrohung zur Eskalation eines Gesprächs führen können. (Vgl. Rehbock 1987: 177)
Da sich das Auftreten von Emotionen in DS nach Gruber (1996: 81)
,,zwangsläufig daraus (ergibt), daß in
ihnen gegensätzlichen Handlungen und Ziele verfolgt werden",
kann das Ausbleiben von emotionsanzeigen-
den Elementen in nichtkonsensuellen Chat-Gesprächen der ernsten Interaktionsmodalität dem Zweck
dienen, die eigene emotionale Involviertheit zu verbergen (z.B. um keine entsprechende emotionale
Reaktion zu erhalten). In Anlehnung an Wilkens (2005), die annimmt, dass durch die Verwendung
von Emoticons fehlende Nähe kompensiert wird, kann also angenommen werden, dass durch ihre
Vermeidung (emotionale) Distanz hergestellt wird, die für die Lösung eines Konflikts vorteilhaft sein
kann.
In den im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Chats und Chat-Protokollen fällt auf, dass DS allge-
mein sehr selten auftreten. Allerdings lassen sich hinsichtlich ihres Auftretenskontexts Unterschiede
feststellen. In moderierten Chats treten DS auf, die als Argumentation bezeichnet werden können,
wobei kaum emotionale Äußerungen auftreten, Behauptungen begründet werden und die Kontrahen-
ten auf der formalen Ebene kooperieren.
41
In den untersuchten 16 moderierten Chats und unmoderierten IRCs traten keine Streitsequenzen auf,
übernehmen Moderatoren die Aufgabe der Gesprächsorganisation.
3
9Im Bsp. ICQ 7 tritt nur ein Emoticon auf, während der Durchschnitt bei den untersuchten konsensuellen Gesprächen im
Chat bei 24,83 Smileys pro Einzelgespräch liegt.
4
0Nach Gruber (1996) ist Sarkasmus (neben Ironie) eine wichtige Möglichkeit des Emotionsausdrucks in DS.
4
1Die Tatsache, dass in den untersuchten moderierten Chats keine Streitsequenzen auftreten kann darauf zurückgeführt
werden, dass die emotionale Involviertheit der Teilnehmer durch die rein textbasierte Kommunikation und die formel-
le Kommunikationsmodalität geringer ist, wobei die Anonymität in moderierten Chats ebenfalls eine Rolle spielt, da
-29 -
wobei aber darauf hingewiesen werden muss, dass beide Formen der öffentlichen Chat-Kommunika-
tion sind. Streitsequenzen sind dagegen eher in Privatchats zu erwarten, wie auch Luginbühl (2003:
72) annimmt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass in IRC keine Äußerungen vorhanden sind, die einen
Streitanlass darstellen können. Vielmehr wird auf diese, entweder weil sie indirekte Angriffe darstel-
len und sich die Teilnehmer aufgrund der Anonymität nicht angesprochen fühlen oder weil die
Produzenten durch angehängte Emoticons die Ernsthaftigkeit eines möglichen Streitanlasses selbst
relati-vieren, nicht eingegangen.Einen Grund für das Fehlen von nichtkonsensuellen Sequenzen im
IRC liefert Gebhardt (2001), der meint, dass für die meisten Nutzer von unmoderierten Chats die
zwanglose, unverbindliche Small Talk-Kommunikation mit Unbekannten und die Pflege von ,,Chat-
Bekanntschaften" im Vordergrund steht. (Vgl. Gebhardt 2001: 5) In einer derartig anonymen und
unverbindlichen Kommunikationsform sind DS und Streitsequenzen kaum erwartbar.
Dementsprechend sind Streitsequenzen eher in proprietären Chats (ICQ oder MSN-Messenger) zu
beobachten, wobei dies zu der Annahme führt, dass dies auf den zahlreichen Möglichkeiten beruht,
die diese zur Darstellung para- und nonverbaler Elemente der Sprache bieten, wodurch die Herstel-
lung emotionaler Nähe gefördert wird. Auffällig ist, dass in nichtkonsensuellen Gesprächssequenzen
keine Emoticons genutzt werden, obwohl durchaus vorgefertigte Formen bereitstehen, durch die z.B.
Verärgerung und Wut ausgedrückt werden können.
42
fahr zum summerjam !!!!!!!!!!!!!!!;
)" ICQ 8: 36)
oder Buchstaben (,,
hätte nicht sooooooooooo lust mit der den abend zu verbringen
" ICQ 6: 43).
43
Zum Verlauf von DS sei gesagt, dass sie auch in Chats durch persönliche Angriffe, Beleidigungen,
Widerspruchs- oder Vorwurfssequenzen eingeleitet werden. Dabei ist zu beobachten, das schnell die
Beziehungsebene in den Vordergrund rückt und Beiträge realisiert werden, die den Partner negativ
bewerten. Die dreigliedrige Struktur von Anlass Formulierung der gegnerischen Standpunkte
Aushandlungsphase konnte auch auf das Untersuchungsbeispiel übertragen werden. Daraus geht her-
vor, dass kontextuelle Faktoren, wie die technische Beschränktheit der Chat-Kommunikation, zwar
einen hemmenden oder fördernden Einfluss auf die kommunikative Austragung von DS ausüben
können, die grundsätzliche Struktur von DS bleibt jedoch gleich, wie auch Gruber (1996: 320f) für
ver-schiedene mediale Kontexte belegen konnte. Allerdings unterscheiden sich die Kontexte je nach
ihrem Einfluss auf die Konfliktlösung. (Vgl. ebd.) Da Streitsequenzen im Chat nicht gelöst werden,
scheint in ihnen nicht die Lösung eines Konflikts im Vordergrund zu stehen, sondern seine
Bearbeitung. Die Hemmschwelle sich aus dem Raum zu ent-fernen ist im IRC aufgrund der
Anonymität sehr niedrig. In proprietären Chats, wo sich die Nutzer häufig persönlich kennen, war das
Streitsequenzen eher zwischen Personen entstehen, die sich persönlich kennen. (Vgl. Luginbühl 2008: 78)
4
2Dies kann daran liegen, dass Emoticons, egal welche Emotion sie ausdrücken sollen, von vielen Nutzern mit einer hu-
morisierenden Interaktionsmodalität assoziiert werden, weshalb sie in Streitsequenzen unangemessen sind.
-30 -
Verlassen des Raums ohne eine Aushandlung der DS in den unter-suchten Protokollen nicht zu
beobachten.
44
emotio-nale Involviertheit mit sich, die durch die virtuelle Privatheit der 1zu1
Kommunikationssituation in proprietären Chats noch intensiviert wird.
Generell konnte beobachtet werden, dass der IRC verglichen mit der Face-to-face-Kommunikation
große Unterschiede im Hinblick auf die Organisation von Gesprächen aufweist. In unmoderierten
Chats eskalieren nichtkonsensuelle Gesprächssequenzen sehr schnell, wobei Emoticons nur selten
und gezielt eingesetzt werden. Dagegen bestehen zwischen Face-to-face-Situationen und proprietären
Chats auf formaler Ebene mehr Ähnlichkeiten. (Siehe Kap. 4.1) Während im Beispiel (ICQ 7) eine
Aushandlungsphase herbeigeführt werden konnte, fehlt diese im IRC völlig.
Daneben konnte festgestellt werden, dass sich Streitsequenzen im Chat nicht nur hinsichtlich der for-
malen Merkmale (schnelle Eskalation, fehlende Beendigungs-/Aushandlungspahse) von den entspre-
chenden Face-to-face-Kommunikationsformen unterscheiden, sondern auch hinsichtlich der Funk-
tion. Obwohl Streitsequenzen in proprietären Chats eine diesen sehr ähnliche formale Organisation
aufweisen, scheint ihre Funktion nicht in der Lösung, sondern in der Aushandlung von Konflikten zu
bestehen, wobei im unmoderierten Chat generell die phatische Funktion der Kommunikation im Vor-
dergrund steht. Durch die Austragung von Streitsequenzen im Chat können die Grundpositionen zu
einem Konflikt ausgehandelt werden, ohne dass die Emotionen der Beteiligten zur Eskalation bzw.
zum Abbruch der Kommunikation führen können. Zur Minderung des Eskalationspotentials einer DS
im Chat trägt vermutlich auch bei, dass die Teilnehmer reflektierter handeln können, da sie sich für
eine Reaktion auf einen Vorwurf, einen Angriff oder eine Entschuldigung mehr Zeit nehmen können,
als in der mündlichen Kommunikation, ohne dass dies negative Folgen auf der Beziehungsebene
nach sich zieht. Daneben kann die schriftliche Fixiertheit der Beiträge und damit die Möglichkeit
diese wiederholt zu rezipieren, inhaltliche Missverständnisse reduzieren. Im IRC liegt die Funktion
von nichtkonsensuellen Gesprächsformen hauptsächlich nicht in der Lö-sung von Konflikten,
sondern in der Provokation anderer Nutzer und der Profilierung der eigenen Rolle.
45
(Vgl. Luginbühl
2003: 85f) Provokationen funktionieren im Chat-Medium auch deshalb, weil durch die technischen
und kommunikativen Rahmenbedingungen und die starke Orientierung an der Mündlichkeit
(Spontaneität der Äußerungen/ Emotionalität) Nähe vermittelt wird. (Kap. 3; Vgl. Stor-rer 2001a)
4
3
4
4Im Untersuchungsbeispiel, wird der Dissens nicht beendet, sondern die Beteiligten einigen sich, dass dieser nicht auf
dem Weg der Chat-Kommunikation gelöst werden kann und vereinbaren ein Face-to-face-Treffen. Interessant ist die
Begründung ,,so per chat versteht man sich ja gerne mal falsch" (39) für die Vertagung des Dissens, da sie zeigt, dass
sich die Interaktanten der Mängel chatsprachlicher Kommunikation im Hinblick auf die Vermittlung para- und non-
verbaler Ausdrucksformen bewusst sind und daher den Wechsel des Gesprächsrahmens bevorzugen.
4
5Die Konzentration auf die eigenen Bedürfnisse und Vernachlässi-gung des Partnerimages kann auf die Anonymität
zurückgeführt werden, die ein verbal ungehemmte-res Verhalten fördert, durch das Nutzer ihren Aggressionen und
ihrer Neugier auf die Reaktion des Gegenübers Ausdruck verleihen. (Vgl. Döring 2001: 112)
-31 -
Das besondere Merkmal der Chat-Kommunikation ist eben diese Kombination anonymer
Kommunikation bei simultaner Suggerierung von Nähe. (Vgl. Thimm 2001: 260)
Der unterschiedliche Verlauf DS im Chat kann als Indiz für die Vielfältigkeit des Mediums bewertet
werden, welches den Nutzern, neben den verschiedenen technischen Bedingungen, nahezu keine Be-
schränkungen in Bezug auf die Gesprächsorganisation auferlegt. Da diese Arbeit sich aber nur auf DS
in unmoderierten Chats konzentrierte, muss offen bleiben wie die kommunikative Aufgabe der DS in
anderen Chat-Umgebungen gelöst wird. Zu erwarten ist jedoch, dass sich chatsprachliche Konventio-
nen entwickeln, die die Gesprächsorganisation erleichtern bzw.verändern. Die Regeln der Chat-Kom-
munikation müssen also immer wieder den Umständen und den Bedürfnissen der Nutzer angeglichen
werden.
-32 -
Literaturverzeichnis
Androutsopoulos, Jannis K./ Ziegler, Evelyn (2003): Sprachvariation und Internet: Regionalismen
in einer Chat-Gemeinschaft. Mannheim/ Freiburg i. Brsg.
Apeltauer, Ernst (1987): Element und Verlaufsformen von Streitgesprächen. Universität Münster:
phil. Diss.
Bader, Jennifer (2002): Schriftlichkeit und Mündlichkeit in der Chat-Kommunikation. In: Networx
29.
URL (10.10.2007): http://www.mediensprache.net/networx/networx-29.pdf
Baros, Wassilios (2004): Konfliktbegriff, Konfliktkomponenten und Konfliktstrategien In: Fuchs,
A./Sommer, G. (Hg.). Frieden und Krieg. Lehrbuch Friedenspsychologie Beltz Verlag
URL (08.10.2007):
http://www.empirische-migrationsforschung.de/Baros-
Konflikt.pdf
Beißwenger, Michael (2000): Kommunikation in virtuellen Welten: Sprache Text und Wirklichkeit.
Eine Untersuchung zur Konzeptionalität von Kommunikationsvollzügen und zur
textuellen Konstruktion von Welt in synchroner Internet-Kommunikation,
exemplifiziert am Beispiel eines Webchats. Stuttgart: ibidem.
Beißwenger, Michael (2003): Sprachhandlungskoordination im Chat. In: Zeitschrift für
germanistische Linguistik 31, S. 198-231.
Beißwenger, Michael / Storrer, Angelika (2005): Chat-Szenarien für Beruf, Bildung und Medien.
In: Beißwenger, Michael / Storrer, Angelika (Hrsg.) (2005): Chat-Kommunikation in
Beruf, Bildung und Medien: Konzepte Werkzeuge Anwendungsfelder. Stuttgart:
ibidem, S. 10-25
Beißwenger, Michael (2005a): Interaktionsmanagement in Chat und Diskurs. Technologiebedingte
Besonderheiten bei der Aushandlung und Realisierung kommunikativer Züge in Chat-
Umgebungen. In: Beißwenger, Michael / Storrer, Angelika (Hrsg.) (2005): Chat-
Kommunikation in Beruf, Bildung und Medien: Konzepte Werkzeuge
Anwendungsfelder. Stuttgart: ibidem, S. 63-87
Beißwenger, Michal (in press): Getippte ,,Gespräche" und ihre trägermediale Bedingtheit. Zum
Einfluss technischer und prozeduraler Faktoren auf die kommunikative Grundhaltung
beim Chatten. In: MODERNE ORALITÄT. Hrsg. v. Ingo W. Schröder und Stéphane
Voell. Marburg, Curupira.
Bittner, Johannes (2003): Digitalität, Sprache, Kommunikation. Eine Untersuchung zur Medialität
von digitalen Kommunikationsformen und Textsorten und deren varietätenlinguisti-
scher Modellierung. Berlin: Schmidt
Brinker, Klaus/ Sager, Sven F. (1996): Linguistische Gesprächsanalyse. Eine Einführung. 2.,
durchgesehene und ergänzte Auflage. Berlin: Erich Schmidt 1996 (= Grundlagen der
Germanistik 30)
-33 -
Bußmann, Hadumod (Hrsg.) (2002): Lexikon der Sprachwissenschaft. Dritte, aktualisierte und
erweiterte Auflage.Stuttgart: Alfred Kröner Verlag
Chi, Tobias (2005): Der Chat Diskurs, Text, kommunikative Gattung?. Hausarbeit Deutsche
Sprachwissenschaft. Zürich: Universität Zürich
Davitz, Joel R. (Hrsg) (1976): The Communication of Emotional Meaning. Westport, Connecticut:
Greenwood Press
Dittmann, Jürgen (2006): Konzeptionelle Mündlichkeit in E-Mail und SMS. In: Interkultureller
Fremdsprachenunterricht: Grundlagen und Perspektiven. Hg. Ulrike Reeg. Bari:
Pagina, 79-97.
Döring, Nicola (1999): Sozialpsychologie des Internet. Die Bedeutung des Internet für
Kommunikationsprozesse, Identitäten, soziale Beziehungen und Gruppen. Göttingen,
Bern, Toronto, Seattle, Hogrefe: Verlag für Psychologie
Döring, Nicola (2001): Belohnungen und Bestrafungen im Netz: Verhaltenskontrolle in Chat-
Foren. In: Gruppendynamik und Organisationsberatung 32/2. S. 109-143.
Fiehler, Reinhard (1992): Grenzfälle des Argumentierens. ,,Emotionalität statt Argumentation" oder
,,emotionales Argumentieren"?. In: Sandig, B./ Püschel, U. (Hrsg.) (1992): Stilistik III:
Argumentationsstile. (=Germanistische Linguistik 112-113), S. 149-175.
French, Peter/ Local, John (1983): Turn competitive incomings. Journal of Pragmatics, 1990/14,
383-395.
Galtung, Johan (1998): Frieden mit friedlichen Mitteln, Friede und Konflikt, Entwicklung und
Kultur. Opladen
Gebhardt, Julian (2001): Inszenierung und Verortung von Identität in der computervermittelten
Kommunikation. Rahmenanalytische Überlegungen am Beispiel des ,,Online-Chat".
Erfurt: Universität Erfurt.
URL (08.10.2007): http://www.soz.uni-frankfurt.de/K.G/B7_2001_Gebhardt.pdf
Geers, Rainer (1999): Der Faktor Sprache im unendlichen Daten(t)raum. Eine linguistische
Betrachtung von Dialogen im Internet Relay Chat. In: Naumann, Bernd (Hrsg.):
Dialouge analysis and the mass media. Tübingen: Niemeyer, S. 83-100
Glenewinkel, Johanna (2003): Charakteristika der Chat-Kommunikation. Am Beispiel der
unmoderierten und moderierten Chats. Hauptseminararbeit an der Pädagogischen
Hochschule Freiburg im Hauptseminar Sprachwissenschaft zum Thema ,,Text- und
Gesprächsstile". Freiburg
Glück, Helmut (Hg.) (2000): Metzler Lexikon Sprache. Zweite, überarbeitete und erweiterte
Auflage. Stuttgart/Weimar: Verlag J.B. Metzler
Goffman, Erving (1996): Interaktionsrituale. Ueber Verhalten in direkter Kommunikation.
Frankfurt a. M. 1996, S. 10.
-34 -
Goldmann, Martin/ Herwig, Claus/ Hooffacker, Gabriele (1995): Internet: Per Anhalter durch das
globale Datennetz. München: Systhema Verlag
Grommes, Patrick (2005): Prinzipien kohärenter Kommunikation. Dissertation zur Erlangung des
akademischen Grades doctor philosophiae. Eingereicht an der Philophischen Fakultät
II. Berlin, Humboldt Universität
Gruber, Helmut (1996): Streitgespräche. Zur Pragmatik einer Diskursform. Opladen: Westdeutscher
Verlag
Günthner, Susanne (1993): Diskursstrategien in der interkulturellen Kommunikation. Analysen
deutsch-chinesischer Gespräche. Tübingen.
Harris, Sandra (1989): Defendant resistance to power and control in court. In: Coleman, Hywel
(Hrsg.): Working with language. A multidisciplinary consideration of language use in
work contexts. Berlin: de Gruyter, S. 131-165
Henne, Helmut/ Rehbock, Helmut (1982): Einführung in die Gesprächsanalyse. Zweite, verbesserte
und erweiterte Auflage. Berlin, New York: de Gruyter (= Sammlung Göschen 2212)
Keim, Inken (1996): »Verfahren der Perspektivenabschottung und ihre Auswirkung auf die
Dynamik des Argumentierens.« In: Kallmeyer, Werner (Hg.): Gesprächsrhetorik.
Rhetorische Verfahren im Gesprächsprozess. Tübingen (= Studien zur deutschen
Sprache, Bd. 4), S. 191277.
Koch, Peter/ Oesterreicher, Wulf (1985): Sprache der Nähe Sprache der Distanz. Mündlichkeit
und Schriftlichkeit im Spannungsfeld von Sprachtheorie und Sprachgeschichte. In:
Romanistisches Jahrbuch 36, S. 15-43.
Koch, Peter/ Oesterreicher, Wulf (1990): Gesprochene Sprache in der Romania: Französisch,
Italienisch, Spanisch. Tübingen: Max Niemeyer Verlag (= Romanistische Arbeitshef-te
31)
Koch, Peter/ Oesterreicher, Wulf (1994): Schriftlichkeit und Sprache. In: Günter, Hartmut / Otto,
Ludwig (Hrsg.): Schrift und Schriftlichkeit. Writing and ist use. Ein interdisziplinäres
Handbuch internationaler Forschung. 1. Halbband. Berlin / New York: de Gruyter.
(=Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 12.1), S. 587-604
Lee Robert (1964): Religion and Social Conflict: An Introduction, in: Lee, Robert/Marty, Martin E.
(Hrsg.): Religion and Social Conflict. New York
Lemnitzer, Lothar / Naumann, Karin (2001): ,,Auf Wiederlesen!" das schriftlich verfaßte
Unterrichtsgespr
ä
ch in der computervermittelten Kommunikation. Bericht von einem
virtuellen Seminar. In: Beißwenger, Michael (Hrsg.) (2001), S. 470-491.
Lenke, Nils/ Schmitz, Peter (1995): Geschwätz im ,Globalen Dorf' Kommunikation im Internet.
In: Neue Medien. OBST 50 (Osnabrücker Beiträge zur Sprachtheorie). Hrsg. von
Schmitz, Ulrich, S. 117-141.
Linke, Angelika/ Nussbaumer, Markus/ Portmann, Paul R. (2004): Studienbuch Linguistik. Ergänzt
-35 -
um ein Kapitel ,,Phonetik/Phonologie" von Urs Willi. 5., erweiterte Auflage. Tübingen:
Max Niemeyer Verlag (= Reihe Germanistische Linguistik)
Luginbühl, Martin (2003): Streiten im Chat. In: Chat-Forschung. Chat Analysis. Hrsg. Von Elke
Hentschel (= Reihe Linguistik Online 15, 3/03), S. 69-81
Oatley, Keith (1992): Best laid schemes. The psychology of emotions. Cambridge: Cambridge
University Press
Pettersson, Helena (2001): Zur Darstellung des nonverbalen Sprachverhaltens im Chat am
Beispiel eines IRC-Korpus. Göteborg. (= D-uppsats. Institutionen för tyska och
nederländska. Göteborgs universitet).
Pomerantz, Anita (1984): Agreeing and disagreeing with assessments: some features of
preferred/dispreferred turn shapes. In: Atkinson, M.J./ Heritage, J. (Hrsg), S. 57-102
Rehbock, Helmut. 1987. Konfliktaustragung in Wort und Spiel: Analyse eines Streitgesprächs von
Grundschulkindern. Konflikte in Gesprächen, ed. by G. Schank; and J. Schwitalla, 176-
239. Tübingen: Narr.
Ropers, Norbert (2002): Friedensentwicklung, Krisenprävention und Konfliktbearbeitung
Technische Zusammenarbeit im Kontext von Krisen, Konflikten und Katastrophen,
Gesellschaft für technische Zusammenarbeit (GTZ), Eschborn 2002,
URL (10.10.2007): http://www2.gtz.de/dokumente/bib/02-5163.pdf
Runkehl, Jens/Schlobinski, Peter/Siever, Torsten (1998): Sprache und Kommunikation im Internet.
Überblick und Analysen. Opladen/Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.
Sacks, Harvey/ Schegloff, Emanuel/ Jefferson, Gail (1974): A simpliest systematics for the
organization of Turn-Taking in conversation. In: Language, 1974/50, 697-735
Schank, Gerd/ Schwitalla, Johannes (Hrsg.) (1987): Konflikte in Gesprächen. Tübingen (= Tübinger
Beiträge zur Linguistik 296) : Narr.
Scherer, Klaus (1985): Vocal Affect Signalling: A Comparative Approach. In J. Rosenblatt, C.
Beer, M.-C. Busnel, & P.J.B. Slater (Hg), Advances in the study of behavior, Vol. 15.
(pp. 189-244). New York: Academic Press, S. 189-238
Schmidt, Gurly (2000): Chat-Kommunikation im Internet eine kommunikative Gattung? In:
Thimm, Caja (Hrsg.): Soziales im Netz. Sprache, Beziehungen und
Kommunikationskulturen im Internet. Opladen / Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, S.
109-130.
Schönfeldt, Juliane (2001): Die Gesprächsorganisation in der Chat- Kommunikation. In:
Beißwenger, Michael (Hrsg.) (2001): Chat-Kommunikation. Sprache, Interaktion,
Sozialität & Identität in synchroner computervermittelter Kommunikation.
Perspektiven auf ein interdisziplinäres Forschungsfeld. Stuttgart: ibidem. S. 25-53
Schwitalla, Johannes (1997): Gesprochenes Deutsch. Eine Einführung. Berlin: Erich Schmidt
Verlag (= Grundlagen der Germanistik 33)
-36 -
Spiegel, Carmen (1995): Streit. Eine linguistische Untersuchung verbaler Interaktionen in
alltäglichen Zusammenhängen. Tübingen. (= Forschungsberichte des Instituts für
deutsche Sprache 75) verfügen
Storrer, Angelika (2000): Schriftverkehr auf der Datenautobahn: Besonderheiten der schriftlichen
Kommunikation im Internet. In: Boehnke, Klaus / Holly, Werner / Voß, G. Günter
(Hrsg.): Neue Medien im Alltag. Begriffsbestimmungen eines interdisziplinären
Forschungsfeldes. Opladen: Leske + Buderich, S.151-175.
Storrer, Angelika (2001): Getippte Gespräche oder dialogische Texte? Zur kommunikationstheore-
tischen Einordnung der Chat-Kommunikation. In: Lehr, Andrea/Kammerer, Matthias
et al. (Hrsg.): Sprache im Alltag. Beiträge zu neuen Perspektiven der Linguistik.
Herbert Ernst Wiegand zum 65. Geburtstag gewidmet. Berlin/New York: de Gruyter,
S. 439-465.
Storrer, Angelika (2001a): Sprachliche Besonderheiten getippter Gespräche:
Sprecherwechsel und sprachliches zeigen in der Chat-Kommunikation. In: Beißwenger,
Michael (Hrsg.): Chat-Kommunikation. Sprache, Interaktion, Sozialität & Identität in
synchroner computervermittelter Kommunikation. Perspektiven auf ein
interdisziplinäres Forschungsfeld. Stuttgart: ibidem 2001, Seite 3-24
Talbot, Mary (1992): ,,I wish you'd stop interrupting me!": Interruptions and asymmetries of
speaker-rights in equal encounters. Journal of Pragmatics, 1992/18, 451-466
Thimm, Caja/ Kruse, Lenelis (1993): The Power-Emotion Relationship in Discourse. Spontaneous
Expression of Emotions in Asymmetric Dialogue. Journal of Language and Social
Psychology (Special Issue on ,,Emotional Communication, Culture and Power, ed. By
Cynthia Gallois), 1993/12, 1/2, S. 81-103
Thimm, Caja (2001) Funktionale Stilistik in elektronischer Schriftlichkeit: Der Chat als
Beratungsforum. In: Beißwenger, Michael (Hg.) Chat-Kommunikation Sprache,
Interaktion, Sozialität & Identität in synchroner computervermittelter Kommunikation.
Perspektiven auf ein interdisziplinäres Forschungsfeld. Stuttgart: ibidem S. 255-278
Watts, Richard J. (1991): Power in Family Discourse. Berlin (=Contributions to the Sociology of
Language [CSL] 63): Mouton de Gruyter
Werry, Christopher C. (1996): Linguistic and Interactional Features of Internet Relay Chat. In:
Computer-Mediated Communication. Linguistic, Social and Cross-Cultural
Perspectives. Hg. Von Susan C. Herring. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins
Publishing Company (= Pragmatics and beyond 39), S. 47-63
Wilkens, Nicole (2005): Sprachliche Besonderheiten der Chat-Kommunikation in verschiedenen
Zweckbereichen. Dortmund: Universität Dortmund
Wirth, Uwe (2002): Schwatzhafter Schriftverkehr. Chatten in den Zeiten des Modemfiebers. In:
Münker, Stefan / Roesler, Alexander (Hrsg.): Praxis Internet. Kulturtechniken der
vernetzten Welt. Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 208-231.
Zanner, Wibke (2004/2005): Gesprächsorganisation im Chat. Dortmund: Universität Dortmund
-37 -
Zifonun, Gisela / Hoffmann, Ludger et al. (1997): Grammatik der deutschen Sprache. Berlin / New
York: de Gruyter.
Internet-Quellen:
Bluewin: URL (08.10.2007):
http://de.bluewin.ch/services/index.php/chat/
BPB: URL (10.10.2007):
http://www.bpb.de/themen/V24LGM,0,0,Was_ist_ein_Konflikt.html
Heise: URL (08.10.2007):
http://heise.forenwiki.de/index.php?title=Troll
Maoxian: URL (10.10.2007):
http://maoxian.com/archive/category/chat-transcripts/
Mediensprache: URL (12.10.2007):
http://www.mediensprache.net/de/websprache/chat/index.asp
NetWiki:
URL (10.10.2007):
http://www.net-wiki.de/index.php?title=Computervermittelte_Kommunikation
Abbildungsnachweis:
Abbildung I Konfliktdreieck nach Johan Galtung:
URL (08.10.2007)
http://www.bpb.de/themen/V24LGM,0,Was_ist_ein_Konflikt.htm
-38 -
Textkorpus
Elefantenrunde, Aufgezeichnet am 18.09.2005
Bsp. 1:
A: meine meine/ mei/ meine fra/ meine FRAge an sie ist sie wollten stärkste Partei werden +das
S: ja . Bitte . Bitte
+ ja
A: werden sie/ die frage werden sie beantworten /
+jawoll sie haben das nicht
S: sehr knapp * wahrscheinlich nicht
A: erreicht * sie haben das drittschlechteste ergebnis einer sozialdemokratischen Partei/ in dieser
S:
NE
A: republik erreicht * DESwegen frage ich sie * ist es nicht erlaubt zu fragen ob sie auch
S: aber herr brender das is/ Das ist doch das, was sie fortsetzen
A: verloren haben +ja also bitte
S: +Natürlich ist das erlaubt +verglichen mit dem letzten Wahlergebnis haben wir
S: verlo:ren . ist doch gar keine FRAge * aber verglichen mit DEM * was in dieser
S: republik * geschRIEben und gesendet worden ist * gibt es einen EINdeutigen verlierer und DASS
S: ist nun wirklich frau MERkel * und das sollten sie: auch mal zur kenntnis nehmen * das
B: herr schrö:der vielleicht haben sie nicht/ vielleicht haben sie
S: ist ja doch so: * und deswegen sage ich entschuldigung
B: nicht zugehört * der kollege hat SIE hat frau merkel gerade darauf hinge/ hingewie:sen
S:
entschuldigung darf ich auch mal red/
A: * dass sie verloren hat
S: +darf ich auch mal reden oder wolln sie mich ständich unterbrechen
A: +(seufzt)
S: * wir haben verlo:rn ist doch gar keine Fra:ge und das schmerzt mich aber
S: verglichen mit DEM von wo wir ka: men herr brender ähm von 24 prozent nämlich
S: * verglichen mit dem was wir erleben mussten * in den letzten wochen und monaten
S: bin ich wirklich stolz'' * auf meine partei . auf die menschen . die mich unterstützt
S: ha:ben die uns gewählt ha:ben und die ähm/ uns ein Ergebis beschert haben . Das
S: EINdeutig ist * jedenfalls eindeutig * dass ''niemand außer mir'' in der la:ge ist . eine
S: stabile regierung zu stellen
-39 -
Unmoderierte Chats
ICQ 1, Aufgezeichnet am 19.10.2007
1. V1: yo bro was geht was machst du
2. V1: meld dich ma bidde das wär cool
3. V1: mir gehts bissl scheisse
4. V2: yo bro
5. V2: was geht ab war grad im keller
6. V2: noch da
7. V1: jau digga
8. V1: wieder
9. V2: was geht bro
10. V1: alter ich hab mich grad mit hanna getroffen
11. V1: das war das letzte was ich noch gebraucht habe
12. V2: shit man
13. V2: digga kann ich dich callen?
14. V1: ja klar mann digga
ICQ 2, Aufgezeichnet am 23.07.2007
1. S1: bonjour
2. S1: was gehtn?
3. S1: wie war arbeit?
4. S2: bonjour
5. S2: krass geil und konret fett
6. S2: und üüüüüüüüüüüübelst anstrengend
7. S1: aha aha
8. S2: ne ging eigentlich klar
9. S1: so anstrengend, dass du sofort eingepennt bist, als du zu hause warst?;-)
10. S2: hä?
11. S2: bin grad nach hause gekommen
12. S1: aso...dachte, du wärst eben online gewesen
13. S2: ne hatte ja erst um zwei schluss
14. S2: war eben üBELST müde
15. S2: aber jetzt gehts
16. S1: hat mich auch gewundert, du warst bei mir mit ,,unsichtbar" zu sehen
17. S1: mein vater hat sich gemeldet
18. S2: oh mein gott
19. S2: vielleicht war meine seele wandern
20. S2: musste auf arbeit ja auch nicht denken
21. S2: :-D:-D
22. S1: hihi
23. S1: war voll fertig vorhin
24. S2: wieso dn
25. S1: krasse mail
-40 -
26. S2: von deinem mac daddy
27. S2: ??
28. S1: jupp
29. S2: was hat er denn geschrieben?
30. S1: ich kann sie dir weiterleiten, wenn du nen roman lesen willst
31. S2: weiß nicht
32. S2: wenn du möchtest
33. S1: ist ziemlich krass
34. S1: war so krass wie ich mich dabei gefühlt habe
35. S1: ich war entsetzt, war am heulen und so aggressiv gleichzeitig
36. S2: krass
37. S2: dann hat er sich wohl nicht entschuldigt
38. S1: nein, eher im gegenteil
39. S1: so noch mal richtig einen draufhauen...
40. S2: kraaaaaaaaaaaaaaaaas
41. S2: der dreht ja voll am rad
42. S2: wie nen hamster auf crack
43. S1: :-)
44. S2: dann schick mal
45. S1: hab ich gerade schon
46. S2: hätte voll bock heute fußball zu zocken
47. S1: dann mach das doch
48. S2: ups... die war nicht an dich
49. S2: :-D
50. S1: tsts
51. S1: an wen denn dann????
52. S2: an meine top-model-fußball-spielende-freunding
53. S2: :-D
54. S1: so nen ding, ey
55. S2: und was machste heute noch
56. S1: arbeiten
57. S1: und du?
58. S2: weiß nicht
59. S2: auf jeden fall mal pennen
60. S1: hihi
61. S1: das werd ich auch noch
62. S2: und duschen
63. S1: da komm ich gerad her;-)
64. S2: oh öhchen
65. S2: und lohnts sich da reinzugehen
66. S2: oder kannst dus nicht empfehlen?
67. S1: doch, ist schon der hammer
68. S2: boah die mail ist echt krass
69. S2: ich dachte schon krasser als die erste geht's nicht mehr
70. S2: also falls du mit jemandem drüber reden möchtest
71. S2: es gibt da jemanden der hätte morgen nachmittag zeit
72. S2: ;-)
73. S1: wuerd michfreuen
74. S2: cool
75. S2: dann geh ich mal duschen
-41 -
76. S1: dann bis morgen
77. S2: jausen
ICQ 3, Aufgezeichnet am 20.10.2007
1. R1: schubi
2. R1: geh jetzt schlafen...
3. R1: dacht nur, ich wünsch dir noch ne schöne nacht
4. R2: oh das ja nett
5. R2: danke
6. R1: also... baideldibai und süße träume
7. R2: wünsch ich dir auch
8. R1: dankeschööööööööööööööööööööööööööön
9. R1: und wir müssen morgen unbedingt dancen
10. R2: meinste?
11. R2: *THUMBS UP *
12. R1: aber jetzt muss ich schlafen... bin todmüde
13. R1: schlabbaschmatz
ICQ 4 Aufgezeichnet am 20.10.2007
1. V1: selam cano
2. V1: was machste schönes
3. V2: selam caney...hab gegessen,chille jetzt und gehe gleich duschen...
4. V2: und duuuuuuuuu????
5. V2: :-)
6. V1: cooooool
7. V1: ich bin auch am chillen und aufräumen
8. V1: überlege wann ich nach bi fahre
9. V1: was gabs denn zu essen?
10. V2: gute frage
11. V2: essen: nudel-spinat -sahne
12. V2: grinssss
13. V1: hihi
14. V1: lecker
15. V2: was hältst du von um 11uhr hiersein?
16. V1: oh
17. V2: oder früher?
18. V1: wieso denn:-)
19. V2: also bis halb elf sind wir startklar
20. V2: komm dann zu uns
21. V1: ach ja
22. V2: damit wir dich knuddeln können
23. V1: wollt ihr denn auch zu jörg
24. V1: oder nur auf die schlosshofparty
25. V2: schlosshof und dann kamp
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2007
- ISBN (eBook)
- 9783836611848
- Dateigröße
- 1.1 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Bielefeld – Linguistik und Literaturwissenschaft
- Erscheinungsdatum
- 2014 (April)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- chat streitgespräche konflikt dissente sequenz gesprächsform
- Produktsicherheit
- Diplom.de