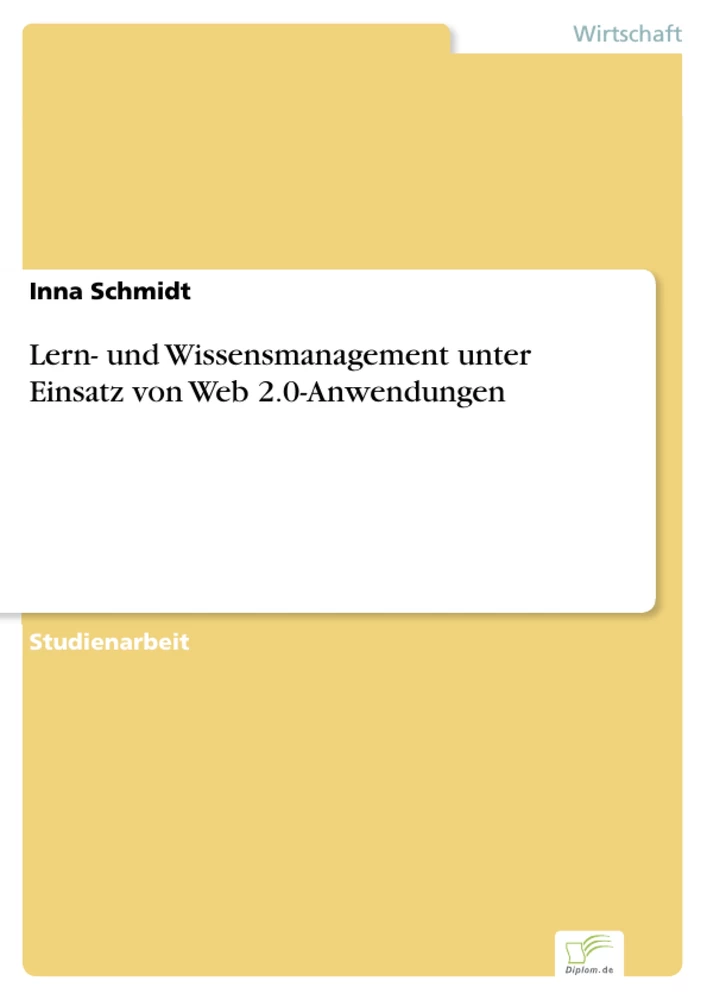Lern- und Wissensmanagement unter Einsatz von Web 2.0-Anwendungen
©2007
Studienarbeit
74 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Die Bildungsstrukturen der Unternehmen werden durch zwei wesentliche Entwicklungen geprägt: Die Notwendigkeit des kontinuierlichen Lernens, um den wachsenden Anforderungen in der Wissensgesellschaft gerecht zu werden und die Fortschritte in den Informations- und Kommunikationstechnologien, die neue Lernformen ermöglichen. Daher stellt sich für Unternehmen die Frage, wie die neuen Technologien zur effektiven Weiterbildung und zum Wissensmanagement beitragen können.
Fokus dieser Arbeit sind die Trends in der Weiterbildungslandschaft, die immer stärker informelles, selbst gesteuertes und Web-basiertes Training forcieren. Die Entwicklung des computergestützten Lernens lässt sich unter dem Oberbegriff E-Learning 2.0 als Fortsetzung von E-Learning 1.0 erfassen. E-Learning 2.0 folgt der Konzeption von Web 2.0 und beinhaltet demnach Elemente der Social Software wie zum Beispiel Online Communities, RSS, Podcasting, Web-Blogs, Wikis. Mit diesen Tools wird ein Wandel des informellen Lernens eingeleitet, der ein E-Learning von unten erlaubt, das von den Lernern gelebt und nicht von oben verordnet wird.
Im Verlauf der Arbeit werden die Elemente des neuen Lernens aufgezeigt sowie in ihrem Nutzwert hinsichtlich der Effizienz und Effektivität aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Weiterhin werden die für den Lernerfolg erforderlichen Rahmenbedingungen untersucht. Insgesamt ist das Ziel der Arbeit, eine Übersicht über die gegenwärtigen Lerntrends zu schaffen, ihre Chancen (Nutzenpotentiale) und Risiken hervorzuheben sowie fundierte Empfehlungen zur Vermeidung von Risiken herauszuarbeiten. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
1.Einleitung1
2.Weiterbildungssituation heute2
2.1Berufliche Weiterbildung2
2.2Entwicklungen in der betrieblichen Weiterbildung4
2.2.1Gesonderte Stellung des E-Learnings5
2.2.2Bedeutung des E-Learnings für die betriebliche Weiterbildung7
2.2.2.1Potentiale von E-Learning10
2.2.2.2Schwächen von E-Learning14
2.2.3Gegenwärtiger E-Learning-Einsatz in deutschen Unternehmen16
3.Entwicklungen des computergestützen Lernens18
3.1Learning goes online18
3.2Zukunft des Lernens im Internet20
3.2.1Web 2.022
3.2.1.1Wikis23
3.2.1.2Weblogs27
3.2.1.3Podcasts29
3.2.1.4Communities of Practice30
3.2.2E-Learning 2.032
3.2.3Herausforderungen von E-Learning 2.034
3.2.4Empfehlungen zur Gestaltung des Lernprozesses 36
3.2.4.1Lebenslanges Lernen?37
3.2.4.2E-Portfolio […]
Die Bildungsstrukturen der Unternehmen werden durch zwei wesentliche Entwicklungen geprägt: Die Notwendigkeit des kontinuierlichen Lernens, um den wachsenden Anforderungen in der Wissensgesellschaft gerecht zu werden und die Fortschritte in den Informations- und Kommunikationstechnologien, die neue Lernformen ermöglichen. Daher stellt sich für Unternehmen die Frage, wie die neuen Technologien zur effektiven Weiterbildung und zum Wissensmanagement beitragen können.
Fokus dieser Arbeit sind die Trends in der Weiterbildungslandschaft, die immer stärker informelles, selbst gesteuertes und Web-basiertes Training forcieren. Die Entwicklung des computergestützten Lernens lässt sich unter dem Oberbegriff E-Learning 2.0 als Fortsetzung von E-Learning 1.0 erfassen. E-Learning 2.0 folgt der Konzeption von Web 2.0 und beinhaltet demnach Elemente der Social Software wie zum Beispiel Online Communities, RSS, Podcasting, Web-Blogs, Wikis. Mit diesen Tools wird ein Wandel des informellen Lernens eingeleitet, der ein E-Learning von unten erlaubt, das von den Lernern gelebt und nicht von oben verordnet wird.
Im Verlauf der Arbeit werden die Elemente des neuen Lernens aufgezeigt sowie in ihrem Nutzwert hinsichtlich der Effizienz und Effektivität aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Weiterhin werden die für den Lernerfolg erforderlichen Rahmenbedingungen untersucht. Insgesamt ist das Ziel der Arbeit, eine Übersicht über die gegenwärtigen Lerntrends zu schaffen, ihre Chancen (Nutzenpotentiale) und Risiken hervorzuheben sowie fundierte Empfehlungen zur Vermeidung von Risiken herauszuarbeiten. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
1.Einleitung1
2.Weiterbildungssituation heute2
2.1Berufliche Weiterbildung2
2.2Entwicklungen in der betrieblichen Weiterbildung4
2.2.1Gesonderte Stellung des E-Learnings5
2.2.2Bedeutung des E-Learnings für die betriebliche Weiterbildung7
2.2.2.1Potentiale von E-Learning10
2.2.2.2Schwächen von E-Learning14
2.2.3Gegenwärtiger E-Learning-Einsatz in deutschen Unternehmen16
3.Entwicklungen des computergestützen Lernens18
3.1Learning goes online18
3.2Zukunft des Lernens im Internet20
3.2.1Web 2.022
3.2.1.1Wikis23
3.2.1.2Weblogs27
3.2.1.3Podcasts29
3.2.1.4Communities of Practice30
3.2.2E-Learning 2.032
3.2.3Herausforderungen von E-Learning 2.034
3.2.4Empfehlungen zur Gestaltung des Lernprozesses 36
3.2.4.1Lebenslanges Lernen?37
3.2.4.2E-Portfolio […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inna Schmidt
Lern- und Wissensmanagement unter Einsatz von Web 2.0-Anwendungen
ISBN: 978-3-8366-0666-0
Druck Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2008
Zugl. Diplomica Verlag GmbH, Hamburg, Deutschland, Studienarbeit, 2007
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2008
Printed in Germany
II
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1
2 Weiterbildungssituation heute
2
2.1 Berufliche Weiterbildung
2
2.2 Entwicklungen in der betrieblichen Weiterbildung
4
2.2.1 Gesonderte Stellung des E-Learnings
5
2.2.2 Bedeutung des E-Learnings für die betriebliche Weiterbildung
7
2.2.2.1 Potentiale von E-Learning
10
2.2.2.2 Schwächen von E-Learning
14
2.2.3 Gegenwärtiger E-Learning-Einsatz in deutschen Unternehmen
16
3 Entwicklungen des computergestützen Lernens
18
3.1 Learning goes online
18
3.2 Zukunft des Lernens im Internet
20
3.2.1 Web 2.0
22
3.2.1.1 Wikis
23
3.2.1.2 Weblogs
27
3.2.1.3 Podcasts
29
3.2.1.4 Communities of Practice
30
3.2.2 E-Learning 2.0
32
3.2.3 Herausforderungen von E-Learning 2.0
34
3.2.4 Empfehlungen zur Gestaltung des Lernprozesses
36
3.2.4.1 Lebenslanges Lernen?
37
3.2.4.2 E-Portfolio
40
3.2.4.3 Unternehmensorganisation 2.0
41
III
4 Bildungscontrolling
45
4.1 Wie lässt sich der Erfolg von Weiterbildung messen?
45
4.1.1 Unternehmenswert
46
4.1.2 Wert des Lernens
48
4.1.3 Ganzheitliche Betrachtung mit der Learning Scorecard
51
4.1.4 Controlling-Probleme
53
4.2 Bildungscontrolling im E-Learning 2.0
55
4.2.1 Neues Lernverständnis
56
4.2.2 Informelles Lernen
58
4.2.3 Mehrwert durch E-Learning 2.0
59
5. Fazit
62
Literaturverzeichnis
IV
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Verzahnung von Arbeits- und Lernprozessen
Abb. 2: Gegenüberstellung von CBTs und WBTs
Abb. 3: Potentiale und Gefahren von E-Learning
Abb. 4: Blended Learning Prozess
Abb. 5: Kreis des selbstständigen, handlungsorientierten Lernens
Abb. 6: Ursache-Wirkungshypothesen für ein Verkaufsgespräch
Abb. 7: Strategische und situationsbezogene Lernziele
Abb. 8: Brainstorming Web 2.0
Abb. 9: Screenshot Wikipedia
Abb. 10: Screenshot WikiMatrix
Abb. 11: Ermittlung von Wissenslücken
Abb. 12: Gegenüberstellung des sozialen Systems von Unternehmen 1.0 und
Unternehmen 2.0
Abb. 13: Gegenüberstellung des technischen Systems von Unternehmen 1.0 und
Unternehmen 2.0
Abb. 14: Zusammenhang von Führungsqualität und Unternehmenserfolg
Abb. 15: Learning Scorecard
Abb. 16: Schaffung von Wettbewerbsvorteilen durch Wissensmanagement
1
1 Einleitung
Die Bildungsstrukturen der Unternehmen werden durch zwei wesentliche Entwick-
lungen geprägt: Die Notwendigkeit des kontinuierlichen Lernens, um den wachsen-
den Anforderungen in der Wissensgesellschaft gerecht zu werden und die Fortschrit-
te in den Informations- und Kommunikationstechnologien, die neue Lernformen er-
möglichen. Daher stellt sich für Unternehmen die Frage, wie die neuen Technologien
zur effektiven Weiterbildung und zum Wissensmanagement beitragen können.
1
Ziel dieser Arbeit besteht darin, einen Beitrag zur Beantwortung dieser Frage
zu leisten. Im Fokus stehen der Wandel vom Web 1.0 zum Web 2.0 und somit die
neuen Möglichkeiten des informellen Lernens, bezeichnend durch E-Learning 2.0. In
der Arbeit setzt sich die Autorin mit folgenden Leitfragen auseinander:
Vor welchen Herausforderungen stehen Unternehmen in der Wissensgesell-
schaft?
Was verbirgt sich hinter E-Learning 2.0?
Welches Nutzenpotential beinhaltet E-Learning 2.0 für die Weiterbildung der
Zukunft?
Was ist bei der Nutzung von E-Learning 2.0-Angeboten zu beachten?
Welche
Weiterbildungsformen
ergeben aufgrund neuer Lernmedien?
Was bedeutet Blended Learning 2.0?
Wie kann der Erfolg der Weiterbildung gemessen werden?
Brauchen wir ein neues Lernverständnis?
1
Vgl. Riekhof/Schüle 2002, S. 115
2
2 Weiterbildungssituation heute
2.1 Berufliche Weiterbildung
Das Thema ,,Weiterbildung" spielt in mehreren Bereichen eine große Rolle. Zu unter-
scheiden sind insbesondere folgende Bereiche:
Hochschulbereich
Berufliche Aus- und Weiterbildung
Private
Weiterbildung
Politische
Bildung
Fokus dieses Buches ist die berufliche Weiterbildung. Die berufliche Weiterbil-
dung gewinnt aufgrund der steigenden Bedeutung der Ressource ,,Wissen" für das
wirtschaftliche Wachstum auf der einen Seite und dem rasanten Wissensverfall auf
der anderen Seite zunehmend an Bedeutung.
Innovation bildet die Grundlage des künftigen Wohlstandes: Die zunehmende
Globalisierung führt zum wachsenden internationalen Wettbewerb. Gleichzeitig wan-
deln sich die Kundenansprüche wie nie zuvor. Somit stehen Unternehmen vor der
Herausforderung, sich nicht nur im internationalen Wettbewerb zu behaupten, son-
dern auch die wandelnden Kundenansprüche befriedigen zu können. Demnach kön-
nen sich Unternehmen in Zukunft nur mit Hilfe von Innovationen behaupten. Innova-
tion setzt jedoch Wissen voraus. Folglich kann zukünftiges Wirtschaftswachstum
nicht durch mehr Beschäftigung - gemeint ist ein höherer Einsatz von Arbeitskräften
oder eine höhere Verbrauchernachfrage - erreicht werden. Der künftige Wohlstand
kann nur durch die Produktivitätssteigerung der Ressource ,,Wissen" gewährleistet
werden. Nur bei Wissensarbeit kann der Wettbewerbsvorsprung erzielt werden.
2
Bereits heute sieht die Beschäftigtenstruktur folgendermaßen zusammen:
3
- 20 Prozent der Beschäftigten sind hoch professionelle und hoch kompe-
tente Wissensmitarbeiter. Sie zeichnen sich aus durch sehr gute Ausbil-
2
Vgl. Drucker 2005, S. 36
3
Vgl. Auer 2007, S. 11
3
dung, globale Mobilität und Unabhängigkeit von spezifischen staatlichen
Rahmenbedingungen aus.
- 60 Prozent der Beschäftigten sind als professionalisiert zu bezeichnen.
Diese Gruppe ist ebenfalls qualifiziert und in der Lage, neue Arbeitsaufga-
ben anzunehmen. Sie ist ebenfalls mobil und bindet sich nicht für lange
Zeit an ein Unternehmen.
- Die restlichen 20 Prozent der Beschäftigten werden von den Anforderun-
gen der modernen Gesellschaft überfordert. Diese Gruppe ist wenig quali-
fikationsfähig und qualifikationswillig.
Der hohe Anteil der Wissensmitarbeiter in Unternehmen verdeutlicht, dass
Wissen sich zu dem wertvollsten Unternehmensgut entwickelt hat. In diesem Zu-
sammenhang reicht es nicht aus, Wissen zu besitzen. Viel mehr muss das in einem
Unternehmen vorhandene Wissen immer wieder auf Aktualität und Nutzbarkeit im
Hinblick auf die marktwirtschaftlichen und soziokulturellen Entwicklungen untersucht
werden. Entstehender Wissensbedarf muss frühzeitig erkannt werden. Gleichzeitig
gilt es neue Wege für die Wissensgenerierung und Wissensvermittlung zu finden.
In der betrieblichen Weiterbildung spielt der Kostenfaktor eine große Rolle.
Aufgrund der beschriebenen Notwendigkeit, Wissensarbeiter unaufhörlich zu qualifi-
zieren, verlieren traditionelle Lernmethoden, bestehend zum Beispiel vorwiegend aus
Präsenzschulungen, an Bedeutung. Sie sind nicht nur kostenintensiv, sondern zeich-
nen sich oft durch die Zielsetzung der Wissenshortung aus: In bestimmten Zeitab-
ständen werden die Mitarbeiter ,,auf Vorrat" geschult. Fraglich bleibt, ob das vermit-
telte Wissen anschließend effektiv in die Arbeitsprozesse einfließen kann. Oftmals
stimmen die Schulungsinhalte mit den Arbeitsinhalten des Einzelnen nicht überein
oder die Zeitabstände zwischen Schulung und Anwendung sind zu groß. Das führt
wiederum zu Wissensverlust und Wissensmangel und drückt sich im sinkenden Un-
ternehmenswert aus. Notwendig sind demnach preiswerte, flexibel einsetzbare und
gleichzeitig effektive Lernmethoden. Nicht zuletzt muss die Motivation der Mitarbeiter
zur Weiterbildung gefördert werden.
4
4
Vgl. Volkmer 2003, S.19
4
2.2 Entwicklungen in der betrieblichen Weiterbildung
An Stelle von bedingt brauchbarer Wissensanhäufung gilt es, handlungsorientiertes
Lernen anzustreben. Der Lernprozess muss an den Erfahrungen der Lernenden an-
knüpfen, am Arbeitsprozess ausgerichtet sein und eine Verzahnung zum Arbeitspro-
zess aufweisen. Ziel ist dabei sowohl Kompetenzzuwachs bei dem Mitarbeiter als
auch die gleichzeitige Steigerung der Ergebnisqualität seiner Arbeit. Wie in der nach-
stehenden Abbildung verdeutlicht erfolgt die Verknüpfung von Arbeits- und Lernpro-
zessen mittels der Einbindung formeller und informeller Lernsequenzen in den Ar-
beitsablauf. Formelle Schulungen decken oft nur einen Teil der benötigten Wissens-
vermittlung ab. Weiterhin bestehende Wissenslücken können zum Beispiel durch die
Interaktion mit Projektbeteiligten (Social Networks) oder mit Hilfe von innovativen
Lernmedien, wie die Nutzung von Webblogs, Communities oder Content Sharing
weitgehend behoben werden. Die Verknüpfung von Arbeitsschritten mit informellen
Lernsequenzen führt entsprechend der Anforderung an das Lernen zur Steigerung
der Ergebnisqualität und gleichzeitig zum Kompetenzzuwachs bei dem Mitarbeiter.
Abb. 1: Verzahnung von Arbeits- und Lernprozessen
Kompetenzen unterscheiden sich von Wissen dadurch, dass sie nicht vermit-
telt werden können, sondern im Laufe der Arbeitstätigkeit erworben werden. Die Ver-
bindung von Wissen mit Erfahrung qualifiziert den Mitarbeiter entsprechend dem An-
forderungsprofil und stiftet erst in diesem Zusammenhang Unternehmenswert. Der
Arbeitsprozess
Informeller Lernprozess
Zugriff auf informelle Lernsequenzen
Wissenseinsatz aus formellen Schulungen im Arbeitsprozess
Arbeits-
ergebnis
Kompetenz-
zuwachs
Formelle Lernsequenz
5
Übergang von Wissen zur Kompetenz erfordert Handlungsfähigkeit, Handlungsbe-
reitschaft und Handlungsorientierung bei der Bewältigung von Arbeitsstellungen.
5
Handlungsfähigkeit bedeutet zum Beispiel die Arbeitsplatzgestaltung. Der Mit-
arbeiter soll die Möglichkeit haben, jederzeit vom Arbeits- in den Lernprozess zu
wechseln. Das bedeutet, dass ihm beispielsweise innovative Medien, zunächst er-
möglich durch einen Onlinezugang und die Erlaubnis zur Internetnutzung bei Lern-
bedarf, zur Verfügung stehen. Weithin ist die Akzeptanz innerhalb des Unterneh-
mens zur Nutzung informeller Lernwege entscheidend. Der Wert des kontinuierlichen
Lernens muss erkannt, in der Unternehmenskultur verankert werden und somit die
Mitarbeiter befähigen, entsprechend den Unternehmenswerten zu handeln.
Handlungsbereitschaft und Handlungsorientierung setzen neben der Motivati-
on der Mitarbeiter ihre Fähigkeit zur Entwicklung von eigenen Suchstrategien (die
selbstständige Auswahl, Organisation und Aneignung von Lerninhalten) voraus. Die
Mitarbeiter müssen lernen vom ,,Push-Prinzip" der Informationszustellung zum ,,Pull-
Prinzip" zu wechseln, indem sie aktiv um die eigene Informationsbeschaffung bemüht
sind.
6
Die Trends in der beruflichen Weiterbildung stellen die Mitarbeiter vor neue
Herausforderungen. Sie sind stärker gefordert, die Verantwortung für die eigene
Qualifikation zu übernehmen. Weg von ihrer Rolle als Konsumenten müssen sie sich
immer mehr um die Gestaltung der eignen Lernwege kümmern. Auch das Personal-
wesen muss andere Aufgaben wahrnehmen: Es reicht nicht mehr, bestimmte Lern-
angebote Zielgruppen zur Verfügung zu stellen. Weiterbildung muss individualisiert
werden. Personalverantwortliche sind gefordert, dem Mitarbeiter Hilfestellung bei der
Aufdeckung der eigenen Wissenslücken zu bieten und individualisierte Lernwege für
einzelne Mitarbeiter weitgehend zu ermöglichen.
2.2.1 Gesonderte Stellung des E-Learnings
Immer mehr Unternehmen gehen dazu über, ihre Mitarbeiter mit Hilfe von E-Learning
zu schulen. E-Learning bedeutet selbstgesteuertes Lernen unter Einsatz von elektro-
nischen Medien. Hinter der Methode ,,E-Learning" verbergen sich sowohl Lernpro-
gramme auf CD-ROM (=Computer Based Trainings) als auch webbasierte Kurse
5
Vgl. Kirschhofer 2005
6
Vgl. Thorne 2003, p. 15f
6
(=Web Based Trainings), Lern- und Wissensportale mit unterschiedlichen Inhalten
und Plattformen sowie ganzheitliche Systeme, die aufgrund von Kompetenzprofilen
individualisierte Kursangebote ermöglichen (=Lern Management Systeme).
7
Compu-
ter Based Trainings (=CBTs) sind Lernsysteme, deren Inhalte auf Datenträgern ver-
trieben werden. Mit der wachsenden Verbreitung des Internets werden CBTs zu-
nehmend durch Web Based Trainings (=WBTs) ersetzt. Der wesentliche Unterschied
zu CBTs liegt in der Bereitstellung der Lerninhalte über das Internet bzw. Intranet.
WBTs erleichtern zudem die Integration von Kommunikationskanälen (E-Mail, Black-
boards und so weiter).
8
Insbesondere das virtuelle Klassenzimmer, in dem Dozenten
und Teilnehmer zusammengeschaltet werden können, gewinnt in diesem Zusam-
menhang an Bedeutung. Vorzüge des virtuellen Klassenzimmers ergeben sich durch
die synchrone (=zeitgleiche) Interaktivitätsmöglichkeit bei räumlicher Dezentralisie-
rung der Lernenden.
9
Die folgende Abbildung verdeutlicht in der Gegenüberstellung
von CBTs und WBTs die wesentlichen Unterschiede dieser E-Learning-Formen.
Abb. 2: Gegenüberstellung von CBTs und WBTs
10
E-Learning nimmt eine besondere Stellung als Lernmethode in der beruflichen
Weiterbildung ein. Der Einsatz von computergestützen Lernformen ist bezeichnend
für die Abkehr von konventionellen Schulungen (Präsenzschulungen) hin zu indivi-
7
Vgl. Back/Bender/Stoller-Schai 2001, S. 36
8
Vgl. Seufert/Mayr 2002, S. 25f; Schüle 2002, S. 174f
9
Vgl. Mandl/Winkler 2003, S. 4; Fuhrman/Klas 2002, S. 160
10
In Anlehnung an Seufert/Mayr (2002, S. 26)
Computer Based Trainings
Web Based Trainings
·
Verbreitung auf Datenträgern
(CD-ROM, DVD)
Problem:
Schwierige Aktualisierung und
Systematisierung der Lernin-
halte
·
Verbreitung über das Internet
bzw. Intranet
·
Vereinfachte Integration von
Kommunikationskanälen
·
Vereinfachte Aktualisierung
und Individualisierung der Lern-
inhalte
Problem:
Eingeschränkte
Übertragungs-
raten verhindern umfassenden
Einsatz von multimedialen E-
lementen.
Weiterentwicklung
7
dualisierten Schulungen. Zwar bedeutet E-Learning nicht zwangsläufig die Ausrich-
tung des Lernprozesses an den Bedürfnissen des Mitarbeiters. Diese Lernmethode
stellt jedoch die Basis dar: Mit Hilfe der neuen Medien ist es dem Mitarbeiter erst
möglich, sich schnell und bedarfsgerecht mit dem aktuell benötigten Wissen zu ver-
sorgen. E-Learning, und insbesondere E-Learning 2.0, stellen die notwendigen Mittel
zur Verwirklichung der Lernvision, nämlich gezieltes und situationsbezogenes Ler-
nen, bereit. Ergänzt um die Handlungsfähigkeit, Handlungsbereitschaft und Hand-
lungsorientierung bei dem Mitarbeiter kann das Lernen der Zukunft Gegenwart wer-
den!
2.2.2 Bedeutung des E-Learnings für die betriebliche Weiterbildung
E-Learning birgt großes Potential hinsichtlich der Optimierung der betrieblichen Wei-
terbildung. Übergreifende Zielsetzungen dieser Lernmethode liegen in der Steige-
rung sowohl der Effektivität als auch der Effizienz betrieblicher Bildungsmaßnahmen.
Vorteile ergeben sich aufgrund der Wissensvermittlung unabhängig von dem Ort, der
Zeit und dem Bildungsstand der Lernenden. Demnach kann der Lernprozess flexibel
gestaltet werden. Entstehende Zeit- und Kosteneinsparungspotentiale gelten als we-
sentliche Vorteile dieser Lernform.
11
Die Berücksichtigung unterschiedlicher Wis-
sensstände und Lerngeschwindigkeiten der Lernenden trägt zudem erheblich zur
Individualisierung des Lernens bei.
Die E-Learning-Methode in ihrer ursprünglichen Form weist nicht nur Vorteile,
sondern auch Schwächen auf: Es bestehen hohe Ansprüchen an die Lernenden,
denn sie müssen sich in Eigeninitiative und Disziplin beweisen. Weiterhin entsteht
die Gefahr von Motivationsmangel, wenn Lernende über lange Lernstrecken hinweg
persönliche Betreuung und Interaktivität mit anderen Kursteilnehmern entbehren
müssen.
12
Nicht zuletzt fehlt bei vorgefertigten E-Learning-Programmen häufig der
unmittelbare Arbeitsbezug. Außerdem bleiben die Lernenden dabei oft in einer kon-
sumierenden Haltung verhaftet. Die folgende Abbildung verdeutlicht die wesentlichen
Vor- und Nachteile des E-Learnings in Reinform.
11
Vgl. Janson 2003, S. 51; Kaltenbaek 2003, S. 43
12
Vgl. Kaltenbaek 2003, S. 15, Seufert/Mayr 2002, S. 23
8
Potentiale von E-Learning
Gefahren von E-Learning
-
Flexibilität von Zeit und Ort
- ,,Just-in-time"-Lernen
- Selbstständiges
Lernen
-
Erhöhung der Lerneffektivität
-
Erhöhung der Lerneffizienz (Einsparung
von direkten Kosten und Opportunitäts-
kosten)
-
Erleichterter Zugang zu Lerninhalten
(Erreichbarkeit des Lernortes)
-
Erhöhte Verfügbarkeit der Lerninhalte
-
Erweiterung des Nutzerkreises von
betrieblichen Weiterbildungsangeboten
-
...
- Fehlende
Betreuung
- Fehlende
Handlungsorientierung
-
Motivationsmangel bei den Lernenden
-
Teuere Erstellung von E-Learning-
Inhalten
-
Häufige Aktualisierung der Inhalte not-
wendig
- Unzureichende
Themenauswahl
-
Konsumierende Haltung der Lernenden
bei vorgefertigten Lerninhalten
-
Überforderung der Lernenden mit techno-
logischen und didaktischen Herausforde-
rungen
-
Fehlende Vermarktung der Lernmethode
im Unternehmen
-
Fehlende Lernkontrolle bei CBTs
-
...
Abb. 3: Potentiale und Gefahren von E-Learning
13
Mit der Zielsetzung, die Schwächen von E-Learning zu beheben wurde die E-
Learning-Methode zu der Blended Learning-Methode weiterentwickelt. Der Grund-
gedanke von Blended Learning besteht in der Kombination des E-Learnings mit
klassischen Lernmethoden (Präsenzlernveranstaltungen). Auf diese Weise soll ein
ganzheitliches Konzept des Lernens geschaffen werden, bei dem durch die Ver-
schmelzung verschiedener Lernmethoden die Nachteile einzelner Lernformen ge-
zielt kompensiert werden sollen.
14
Nach Janson verbindet ,,Blended Learning (...)
die Effektivität und Flexibilität der elektronisch unterstützten Qualifizierung mit den
sozialen Aspekten des gemeinsamen Lernens".
15
Der Blended Learning Prozess gliedert sich grundsätzlich in drei Phasen: Vor-
bereitungs-, Präsenzlern- und Nachbereitungs- bzw. Transferphasen. Diese Pha-
sen finden abwechselnd statt und können sich mehrfach wiederholen. Die Vorberei-
tungsphasen stellen das gemeinsame Kernelement von E-Learning und Blended
14
Vgl. Volkmer 2003, S. 19; Schlüter 2004, S. 34f; Seufert/Mayr 2002, S. 22f
15
Janson 2003, S. 53
9
Learning dar: Es handelt sich um Selbstlernphasen der Lernenden mithilfe elektro-
nischer Medien, die vordergründlich dem Wissenserwerb und der Vorbereitung auf
die Präsenzlernphase dienen. Auf diese Weise soll theoretisches Wissen vermittelt
und die Wissensstände der Teilnehmer angeglichen werden. In Präsenzlernphasen
(zum Bespiel Seminare und Workshops) können Fragen geklärt, elektronisch
schwer darstellbares Wissen vermittelt und Erfahrungen ausgetauscht werden. Ne-
ben der Vertiefung des Verständnisses dienen die Präsenzlernphasen der Förde-
rung der Handlungskompetenz durch den Einsatz von praktischen Trainingseinhei-
ten, der Motivation und der Lenkung der Lernenden. Zu den Nachbereitungsphasen
gehört die Reflektion des Erlernten mit dem Dozenten und den anderen Teilneh-
mern. Die Reflektion trägt zur Sicherung und zum Transfer des Lernstoffes bei.
16
Darüber hinaus können ,,themenbezogene Wissenscommunities"
17
zur gezielten
Wissensversorgung gebildet werden, die sowohl Feedback für alle Beteiligten er-
möglichen, als auch neue Impulse bieten.
18
Die Integration von im Web zugängli-
chen Wissenscommunities ist bezeichnend für den Wandel von E-Learning 1.0 zu
E-Learning 2.0.
Wichtig ist weiterhin die Zusammenführung von Lernen und Wissensmana-
gement. Unter Wissensmanagement versteht die Verfasserin in Anlehnung an
Pawlowsky et al. die Identifikation, den Transfer, die Verteilung und die Entwicklung
des erfolgsrelevanten Wissens.
19
In einem solchen Prozess wird erworbenes Wis-
sen nicht nur angesammelt, sondern angewandt und weitergegeben. Zu Vertei-
lungs- und Erfassungszwecken kann unternehmensrelevantes Wissen in einem of-
fenen, für alle Mitarbeiter zugänglichen Wissenspool gesammelt und bearbeitet
werden.
20
16
Vgl. Volkmer 2004, S. 24f; Baumbach 2004, S. 137; Back 2004, S. 101f
17
Volkmer 2004, S. 25
18
Vgl. Volkmer 2004, S. 25
19
Vgl. Pawlowsky/Bäumer 1996, S. 187; Back/Bendel/Stoller-Schai 2001, S. 55f
20
Vgl. Sauter/Sauter/ Bender 2004, S. 134
10
Abb. 4: Blended Learning Prozess
21
Durch die Einbindung von Präsenzlernphasen in E-Learning-Schulungen kann
möglichen Schwächen wie zum Bespiel ,,fehlender praktischer Übungsanteil", ,,Moti-
vationsmangel der Lernenden aufgrund fehlender sozialer Interaktion", ,,fehlende
Betreuung" entgegengewirkt werden. Um jedoch den durchgängigen Handlungsbe-
zug und die Aktualität der Lerninhalte zu forcieren sowie die Selbständigkeit der Ler-
nenden zu fördern ist die Ausprägung (Inhalt, Form und Zugang) der E-Learning-
Inhalte ausschlaggebend. In diesem Zusammenhang zeigen sich, wie am Beispiel
der Wissenscommunities beschrieben, die Chancen von E-Learning 2.0.
2.2.2.1 Potentiale von E-Learning
Im Folgenden geht die Autorin vertiefend auf diejenigen Potentiale von E-Learning
1.0 ein, die den Weg für den erfolgsträchtigen Einsatz von E-Learning 2.0 mit dem
Ziel der Steigerung der Lerneffektivität bereiten:
21
Wissensmanagement
Wissens-
Pool
Erfahrungs-
austausch
Wissens-
Pool
Vorbereitung
Angleichen des Wissens-
tandes und erste Inhalts-
vermittlung mit Hilfe z. B.
von WBTs
Begleitend:
E-Coaching im virtuellen
Klassenraum
Präsenzlernen
Klassisches Seminar
mit Inhaltsvermittlung
und Anwendung der
Themen durch Praxis-
beispiele
Nachbereitung
Praxistransfer- und Lernsi-
cherung, Abdeckung von
tangierten Themen als
Ergänzung zum Seminar
mit Hilfe z. B. von WBTs
Begleitend:
E-Coaching, ,,Wissens-
communities
"
Blended Learning Prozess
11
Mitarbeiter entwickeln sich von passiven Seminarkonsumenten zu aktiven
Wissenserwerbern:
E-Learning zielt auf selbstgesteuertes und selbstbestimmtes Lernen ab: Der
Lernende entscheidet, wann und wie er lernt. Die Grundidee ,,Lernen on de-
mand" beziehungsweise ,,just-in-time-Lernen" bedeutet die Ausrichtung des
Lernens am akuten Bedarf und soll den Mitarbeiter dazu animieren, sich ent-
sprechend den gegenwärtigen Herausforderungen Wissensbausteine selbst-
ständig zu beschaffen.
22
Dies wird dadurch erleichtert, dass der Mitarbeiter
nicht erst auf ein Seminarangebot warten muss, um seinen Lernbedarf zu stil-
len. Ziel des E-Learnings ist es, dem Mitarbeiter die Möglichkeit zu bieten,
zeitnah und gezielt vom eigenen Arbeitsplatz aus ein entsprechendes Lernan-
gebot erhalten zu können.
23
Trainer haben die Funktionen der Lernbegleiter und Berater:
Begleitung hat einen kontinuierlichen Charakter, ist längerfristig angelegt und
somit prozessorientiert. Im Zuge der Begleitung nehmen die Trainer eine stra-
tegische Funktion wahr, indem sie mit den Lernenden eine langfristige Qualifi-
zierungsplanung erarbeiten.
Beratung ist punktuell und zeitlich eingeschränkt. Anstelle von Prozess-
orientierung tritt die Zielorientierung ein. Beratung orientiert sich an einer kon-
kreten Problemstellung.
24
Trainer begleiten und beraten die Lernenden beim E-Learning insofern,
als dass sie sie immer stärker dazu befähigen sollen, die eigene Lernstrategie
und ziele aktiv zu erarbeiten und zu verfolgen: Die Mitarbeiter sollen den auf-
gezeigten Kreislauf des selbstständigen und handlungsorientierten Lernens
weitgehend beherrschen, da E-Learning eine hohe Selbstständigkeit und
Selbststeuerung bei dem Lernenden voraussetzt.
22
Vgl. Sailer-Burckhardt et. al, 2002, S. 24ff
23
Vgl. Da Rin 2005, S. 56
24
Vgl. Dehnbostel 2007, S. 24
12
Abb. 5: Kreis des selbstständigen, handlungsorientierten Lernens
25
Führungskräfte übernehmen die Funktion von Mentoren:
Mangelndes Interesse der Vorgesetzten am Lernfortschritt kann die Weiterbil-
dung behindern. Mitarbeiter empfinden dann Weiterbildung am Arbeitsplatz
(E-Learning) häufig als Luxus und nicht als strategische Investition in den Un-
ternehmenswert. Wichtig ist, dass Vorgesetzte ,,Weiterbildung" als Unterneh-
menswert vorleben. Nicht zuletzt gehört dazu die Abkehr von einer ergebnis-
orientierten Planung der Prozesse im Unternehmen (Planung von Zielen, Res-
sourcen, Handlungsprogrammen) hin zu einer lernorientierten Unternehmens-
planung. Demnach müssen ,,weiche" Faktoren wie Trends und immaterielle
Werte ihre Berechtigung in unternehmerischen Zielsetzungen erhalten. Das
führt von einer eindimensionalen Sichtweise, bezeichnend durch das Bestre-
ben nach ,,hartem" Output, zum Denken in Alternativen. Diese Vorgehenswei-
se kann zwar zu inhaltlichen Widersprüchen und Zielkonflikten führen, wirkt
jedoch stimulierend auf das strategische Lernen.
Eine ganzheitliche Unternehmensplanung kann zum Beispiel mit Hilfe
der Szenariotechnik erfolgen. Das bedeutet die Entwicklung unterschiedlicher
Zukunftsszenarien, die aber auf logisch schlüssigen Annahmen aufbauen.
Diese alternativen Szenarien erlauben die Beurteilung der Qualität und der Art
des Wissens, welches zur Bewältigung der entstehenden Herausforderungen
25
Vgl. Hoepfner 2007, S. 21
Lernprozessbegleitung und Beratung durch den Trainer
1. Zielsetzung
2. Planung der
Vorgehensweise
3. Entscheidung mit
Blick auf Alternativen
4. Durchführung
und Überwachung
5. Auswertung der Hand-
lung und ihrer Ergebnisse
Strategischer
Qualifizierungsplan
Informations-
sammlung
Informations-
sammlung
Informations-
sammlung
Informations-
sammlung
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2007
- ISBN (Paperback)
- 9783836606660
- ISBN (eBook)
- 9783956363061
- Dateigröße
- 740 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- internet personalentwicklung weiterbildung wikipedia informelles lernen
- Produktsicherheit
- Diplom.de