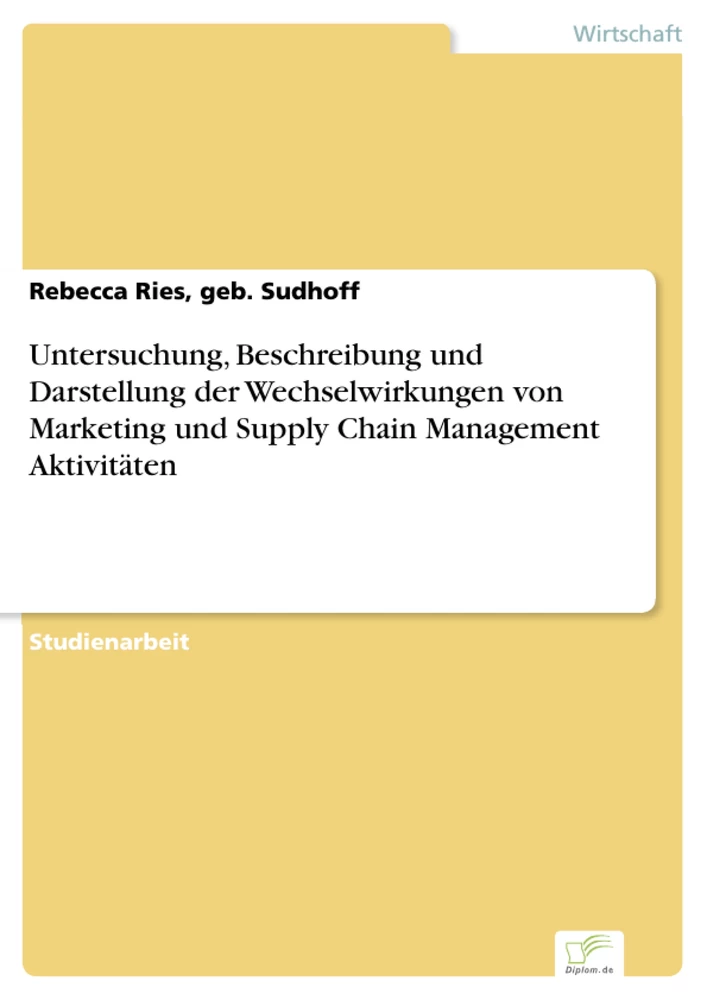Untersuchung, Beschreibung und Darstellung der Wechselwirkungen von Marketing und Supply Chain Management Aktivitäten
©2004
Studienarbeit
138 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Vor dem Hintergrund, dass Supply Chain Management (SCM) und Marketing sich in verschiedenen Formen mit dem Kunden auseinandersetzen, liegt es auf der Hand, die Gemeinsamkeiten und Differenzen beider Begriffe zu klären. SCM wird allgemein als funktions- und unternehmensübergreifendes, prozessorientiertes Gestalten, Planen, Beobachten, Kontrollieren, Analysieren und Steuern der Material-, Dienstleistungs-, Informations- und Finanzmittelflüsse logistischer Wertschöpfungsketten und Wertschöpfungsnetzwerke im Sinne der Unternehmensphilosophie verstanden. Somit sind darunter ebenfalls Aktivitäten des Marketing enthalten. Marketing kann z.B. als Analyse, Organisation, Planung und Kontrolle kundenbezogener Ressourcen, Verhaltensweisen und Aktivitäten beschrieben werden. Bisher sind die gegenseitigen Interdependenzen zwischen Marketing und SCM noch nicht eindeutig beschrieben worden. Die Ergebnisse der Arbeit sollen die Erkenntnisse im SCM ergänzen.
Ziel der Arbeit ist die Darstellung der Zusammenhänge zwischen SCM und Marketing, insbesondere werden die Auswirkungen von Marketingmaßnahmen auf das Unternehmen im Rahmen der SCM Strategie untersucht. Diese Studienarbeit ist im Zusammenhang mit der Erstellung einer Schulung der BBS-LOGSCM Training entstanden. Zunächst wird dem Leser die Entstehung und Entwicklung des Marketing und des SCM dargestellt. Anschließend werden diese beiden Begriffe abgegrenzt und für deren Bedeutung für den Verlauf der Arbeit festgelegt.
In Kapitel 4 werden die Aufgaben des Marketing beschrieben, auf denen die folgenden Kapitel aufbauen. Gleichzeitig werden in diesem Kapitel die Einflüsse der Marketing-Aufgaben auf die SC, aufgezeigt. Nach der Aufgabenstellung ist eine Definition der Ziele nötig um daraus eine Strategie festzulegen. Daher werden in Kapitel 5 auf die Ziele des Marketing und des SCM und ihre Verknüpfungen, Beziehungen und Gemeinsamkeiten herausgestellt. Nachdem die Aufgaben und Ziele erläutert wurden, kann daraus eine Strategie hergeleitet werden.
In Kapitel 6 werden die Strategien des Marketing, die des SCM und die gegenseitigen Einflüsse erläutert. Anhand der bis dahin erlangten Erkenntnisse werden dann in Kapitel 7 die Wechselwirkungen von Marketing und SCM Aktivitäten zusammengefasst und dargestellt.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
1.Einleitung5
1.1Aufgabenstellung und Zielsetzung der Studienarbeit5
1.2Aufbau der Studienarbeit5
2.Entwicklung des Marketing und des Supply […]
Vor dem Hintergrund, dass Supply Chain Management (SCM) und Marketing sich in verschiedenen Formen mit dem Kunden auseinandersetzen, liegt es auf der Hand, die Gemeinsamkeiten und Differenzen beider Begriffe zu klären. SCM wird allgemein als funktions- und unternehmensübergreifendes, prozessorientiertes Gestalten, Planen, Beobachten, Kontrollieren, Analysieren und Steuern der Material-, Dienstleistungs-, Informations- und Finanzmittelflüsse logistischer Wertschöpfungsketten und Wertschöpfungsnetzwerke im Sinne der Unternehmensphilosophie verstanden. Somit sind darunter ebenfalls Aktivitäten des Marketing enthalten. Marketing kann z.B. als Analyse, Organisation, Planung und Kontrolle kundenbezogener Ressourcen, Verhaltensweisen und Aktivitäten beschrieben werden. Bisher sind die gegenseitigen Interdependenzen zwischen Marketing und SCM noch nicht eindeutig beschrieben worden. Die Ergebnisse der Arbeit sollen die Erkenntnisse im SCM ergänzen.
Ziel der Arbeit ist die Darstellung der Zusammenhänge zwischen SCM und Marketing, insbesondere werden die Auswirkungen von Marketingmaßnahmen auf das Unternehmen im Rahmen der SCM Strategie untersucht. Diese Studienarbeit ist im Zusammenhang mit der Erstellung einer Schulung der BBS-LOGSCM Training entstanden. Zunächst wird dem Leser die Entstehung und Entwicklung des Marketing und des SCM dargestellt. Anschließend werden diese beiden Begriffe abgegrenzt und für deren Bedeutung für den Verlauf der Arbeit festgelegt.
In Kapitel 4 werden die Aufgaben des Marketing beschrieben, auf denen die folgenden Kapitel aufbauen. Gleichzeitig werden in diesem Kapitel die Einflüsse der Marketing-Aufgaben auf die SC, aufgezeigt. Nach der Aufgabenstellung ist eine Definition der Ziele nötig um daraus eine Strategie festzulegen. Daher werden in Kapitel 5 auf die Ziele des Marketing und des SCM und ihre Verknüpfungen, Beziehungen und Gemeinsamkeiten herausgestellt. Nachdem die Aufgaben und Ziele erläutert wurden, kann daraus eine Strategie hergeleitet werden.
In Kapitel 6 werden die Strategien des Marketing, die des SCM und die gegenseitigen Einflüsse erläutert. Anhand der bis dahin erlangten Erkenntnisse werden dann in Kapitel 7 die Wechselwirkungen von Marketing und SCM Aktivitäten zusammengefasst und dargestellt.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
1.Einleitung5
1.1Aufgabenstellung und Zielsetzung der Studienarbeit5
1.2Aufbau der Studienarbeit5
2.Entwicklung des Marketing und des Supply […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 7895
Sudhoff, Rebecca: Untersuchung, Beschreibung und Darstellung der Wechselwirkungen
von Marketing und Supply Chain Management Aktivitäten
Hamburg: Diplomica GmbH, 2004
Zugl.: Universität Dortmund, Universität, Studienarbeit, 2004
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2004
Printed in Germany
Einleitung
Studienarbeit von Rebecca Sudhoff
Universität Dortmund
Seite 2
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung ... 4
1.1
Aufgabenstellung und Zielsetzung der Studienarbeit ...4
1.2
Aufbau der Studienarbeit...4
2 Entwicklung des Marketing und des Supply Chain Managements ... 5
2.1
Entwicklung des Marketing...5
2.2
Entwicklung des Supply Chain Management ...8
3 Begriffsabgrenzungen... 11
3.1
Marketing...11
3.2
Supply Chain Management ...14
4 Aufgaben des Marketing und ihre Einbindungen in die Supply Chain ... 18
4.1
Aufgaben des Marketingmanagements...20
4.2
Marketingaufgaben und ihre Einbindungen in die Supply Chain...22
4.2.1
Marktforschung... 23
4.2.2
Produktmix... 26
4.2.3
Preismix... 32
4.2.4
Distributionsmix ... 34
4.2.5
Kommunikationsmix ... 38
5 Ziele ... 42
5.1
Marketingziele ...45
5.2
Ziele des Supply Chain Managements...49
5.3
Beziehungen zwischen Marketing- und SCM-Zielen...52
6 Strategien des Marketing und des Supply Chain Managements und ihre
Auswirkungen aufeinander ... 54
6.1
Marketingstrategien ...54
6.1.1
Marktfeldstrategien... 55
6.1.2
Marktstimulierungsstrategien ... 59
6.1.3
Marktwahlstrategien ... 60
6.1.4
Marktarealstrategie... 64
6.1.5
Push- und Pull-Strategie im Marketing... 65
Einleitung
Studienarbeit von Rebecca Sudhoff
Universität Dortmund
Seite 3
6.2
Strategien des Supply Chain Managements ...67
6.2.1
Autonomiestrategie ... 67
6.2.2
Kooperationsstrategie ... 68
6.2.3
Strategien der Versorgung ... 73
6.2.4
Strategien der Entsorgung und des Recyclings ... 77
7 Darstellung der Wechselwirkungen von Marketing und
Supply Chain Management ... 81
8 Ausblick... 93
Literaturverzeichnis ... 94
Abbildungsverzeichnis ... 104
Tabellenverzeichnis ... 105
Abkürzungsverzeichnis ... 106
Anhang ... 107
Einleitung
Studienarbeit von Rebecca Sudhoff
Universität Dortmund
Seite 4
1 Einleitung
1.1 Aufgabenstellung und Zielsetzung der Studienarbeit
Vor dem Hintergrund, dass Supply Chain Management (SCM) und Marketing sich in ver-
schiedenen Formen mit dem Kunden auseinandersetzen, liegt es auf der Hand, die Gemein-
samkeiten und Differenzen beider Begriffe zu klären. SCM wird allgemein als funktions- und
unternehmensübergreifendes, prozessorientiertes Gestalten, Planen, Beobachten, Kontrol-
lieren, Analysieren und Steuern der Material-, Dienstleistungs-, Informations- und Finanzmit-
telflüsse logistischer Wertschöpfungsketten und Wertschöpfungsnetzwerke im Sinne der
Unternehmensphilosophie verstanden. Somit sind darunter ebenfalls Aktivitäten des Marke-
ting enthalten. Marketing kann z.B. als Analyse, Organisation, Planung und Kontrolle kun-
denbezogener Ressourcen, Verhaltensweisen und Aktivitäten beschrieben werden. Bisher
sind die gegenseitigen Interdependenzen zwischen Marketing und SCM noch nicht eindeutig
beschrieben worden. Die Ergebnisse der Arbeit sollen die Erkenntnisse im SCM ergänzen.
Ziel der Arbeit ist die Darstellung der Zusammenhänge zwischen SCM und Marketing, insbe-
sondere werden die Auswirkungen von Marketingmaßnahmen auf das Unternehmen im
Rahmen der SCM Strategie untersucht.
1.2 Aufbau der Studienarbeit
Diese Studienarbeit ist im Zusammenhang mit der Erstellung einer Schulung der BBS-LOG-
SCM Training entstanden. Zunächst wird dem Leser die Entstehung und Entwicklung des
Marketing und des SCM dargestellt. Anschließend werden diese beiden Begriffe abgegrenzt
und für deren Bedeutung für den Verlauf der Arbeit festgelegt.
In Kapitel 4 werden die Aufgaben des Marketing beschrieben, auf denen die folgenden Kapi-
tel aufbauen. Gleichzeitig werden in diesem Kapitel die Einflüsse der Marketing-Aufgaben
auf die SC, aufgezeigt. Nach der Aufgabenstellung ist eine Definition der Ziele nötig um dar-
aus eine Strategie festzulegen. Daher werden in Kapitel 5 auf die Ziele des Marketing und
des SCM und ihre Verknüpfungen, Beziehungen und Gemeinsamkeiten herausgestellt.
Nachdem die Aufgaben und Ziele erläutert wurden, kann daraus eine Strategie hergeleitet
werden. In Kapitel 6 werden die Strategien des Marketing, die des SCM und die gegenseiti-
gen Einflüsse erläutert. Anhand der bis dahin erlangten Erkenntnisse werden dann in Kapi-
tel 7 die Wechselwirkungen von Marketing und SCM Aktivitäten zusammengefasst
und dargestellt.
Entwicklung des Marketing und des Supply Chain Management
Studienarbeit von Rebecca Sudhoff
Universität Dortmund
Seite 5
2 Entwicklung des Marketing und des Supply Chain
Managements
2.1 Entwicklung des Marketing
Der Marketinggedanke hat sich in den vergangenen Jahrzehnten wie folgt entwickelt: von
der anfänglichen Produktionsorientierung, bei der die Produktion im Mittelpunkt der Unter-
nehmensaktivitäten steht, bis zur Verkaufsorientierung, der Ausrichtung der Produktion an
der Nachfrage. [Gün97; S.34]
Diese Entwicklung muss vor dem Hintergrund des strukturellen Wandels des Marktes, vom
Verkäufer- zum Käufermarkt gesehen werden (Bild 2.1). Ursprünglich mussten die Abneh-
mer um das knappe Angebot kämpfen, wohingegen das heutige Markthandeln durch das
Bemühen der Verkäufer um den Käufer gekennzeichnet ist. [Bec02; S.1]
Verkäufermarkt
Käufermarkt
Angebot
Nach-
frage
Nachfrage-
überhang
Nachfrage
Angebot
Angebots-
überhang
Produktorientiertes Verhalten
- Kapazitätsbeschaffung
- Aufbau von Produktionsmitteln
- Verteilungsfunktion
Marktorientiertes Verhalten
- Marktanforderung (Bedürfnisse, Probleme, Wünsche)
- Marktorientierte Gestaltungsinstrumente
- Leistungserstellungsprozess / Verteilungsfunktion
- Problemlösung / Kundennutzen
Bild 2.1: Wandel Verkäufer- zu Käufermarkt [Gün97; S.36]
Typisch für den Verkäufermarkt ist ein Nachfrageüberschuss, das heißt, das Angebot ist
knapp und wenn Ware vorhanden ist, besteht die einzige Aufgabe aus der Verteilung der
Waren. Der Verkäufer bestimmt somit den Markt und kann die Preise willkürlich festlegen.
Alles was zur Zeit des Verkäufermarktes produziert wurde, wurde auch verkauft, weshalb der
Markt nicht wichtig und die Unternehmen nach innen orientiert waren. [Gün97; S.36]
International gesehen gibt es hier jedoch Unterschiede, die internationalen Märkte befinden
sich, je nach Entwicklungsstand des Landes, in unterschiedlichen Stadien, welche zwischen
der Produktions- und der Verkaufsorientierung liegen. [Gün97; S.34] In Westeuropa beginnt
die Entwicklung des Marketing in der Nachkriegszeit.
Die Ausprägung zum Verkäufermarkt zeichnete sich in den 50er Jahren ab. Zum ersten Mal
wurde Ware als Markenartikel mit Hilfe von Produkt- und Markenimages verkauft. Somit
Entwicklung des Marketing und des Supply Chain Management
Studienarbeit von Rebecca Sudhoff
Universität Dortmund
Seite 6
konnte ein Massengut zum Produkt mit eigener und interessanter Identität werden. [Pep96;
S.572] Es entstand die Philosophie der marktorientierten Unternehmensführung, welche die
primär inputorientierte Sichtweise sukzessive ablöste. [Pep96; S.573]
In den 60er Jahren erweiterte sich das Angebot und ließ den Nachfrageüberschuss deutlich
geringer werden. Es reichte jedoch eine genaue Planung und Steuerung des Vertriebes aus,
um die Fertigung effizient auszulasten. [Gün97; S.35]
GUTENBERG entwickelte aus dem 4 P-Ansatz (McCarthy: Product, Price, Place, Promotion)
die Instrumente
1
, die auch heute noch Grundlage der Analyse des Marktes sind. Auch kam
es zu der Anwendung von psychologischen und soziologischen Erkenntnissen über das
menschliche Verhalten bezogen auf die Vermarktung von Gütern und Dienstleistungen. So
wurden psychologische Konsumentenverhaltenstheorien (z.B. Motivationsmodell von MAS-
LOW [Tho98, S.625f] oder Lernmodell von PAWLOW [Mühl]) und soziologische Konsumen-
tenverhaltenstheorien (z.B. Meinungsführermodell von KATZ/LAZARSFELD [Int03e]) einge-
bunden. [Pep96; S.573]
KOTLER beschrieb das Marketing 1967 als eine Analyse, Organisation, Planung und Kon-
trolle kundenbezogener Ressourcen, Verhaltensweisen und Aktivitäten einer Firma, was das
Ziel der gewinnbringenden Befriedigung der Wünsche und Bedürfnisse ausgewählter Kun-
dengruppen beinhaltet [Pep96; S.579].
Der Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage schritt in den 70er Jahren voran und es
bedurfte schon eines größeren planerischen Aufwands, wie beispielsweise Marktbeobach-
tungen und Produktionsplanung, um Nachfrage und eigene Produktion aufeinander abzu-
stimmen. Aufgrund des schwindenden Nachfrageüberschusses konnte der Kunde mehr und
mehr den Markt bestimmen. Somit mussten die Unternehmen die nach innen gerichtete Ori-
entierung aufgeben und eine zum Markt und Kunden gerichtete Orientierung entwickeln (O-
rientierung nach). [Gün97; S.35f]
Als wichtiges Merkmal der 70er Jahre lässt sich die Entwicklung verschiedener Marketingar-
ten hervorheben. Die Marketingerkenntnisse wurden auf unterschiedliche Aspekte der Ge-
sellschaft projeziert:
- humane Aspekte (Human Marketing), bei der das Gewinnstreben durch die Berücksichti-
gung sozialer, gesellschaftlicher und ökologischer Ansprüche begrenzt wird [Int03g],
- soziale Aspekte (Social Marketing), die die Planung, Organisation, Durchführung und
Kontrolle von Marketingstrategien und -aktivitäten nichtkommerzieller gemeinnütziger
Organisationen [Int03h], beinhalten, und
1
auf die 4`Ps und ihre Instrumente wird in den nachfolgenden Kapiteln eingegangen
Entwicklung des Marketing und des Supply Chain Management
Studienarbeit von Rebecca Sudhoff
Universität Dortmund
Seite 7
- generische Aspekte (Generic Marketing), also die Ausdehnung auf den Austausch nicht-
materieller Ressourcen [Int03i].
In diesem Zusammenhang sah KOTLER [Kot82; S.24/27] das Ziel des Marketing aufgrund
zunehmender Ressourcenausbeutung nicht mehr singulär in der einseitigen Marktauswei-
tung und Konsumintensivierung, sondern in einem gezielten Reduktionsmarketing (Demarke-
ting). Dies bedeutet, dass nicht alles verkauft werden darf, was verkauft werden kann, son-
dern nur das, was vertretbar erscheint. Das zunehmende Angebot führte zu einer klaren Ab-
grenzung des eigenen Angebots gegenüber den anderen Wettbewerbsteilnehmern, zu einer
besseren Analyse der Nachfrageseite und zu einer immer größer werdenden Konkurrenz.
Durch die stetige Ausweitung des Gültigkeitsbereiches von Marketingaussagen und durch
verstärkte Wirtschaftsverflechtungen zwischen den Branchen einer Volkswirtschaft entstand
das Makromarketing, welches die Übertragung marketingtypischen Denkens und Handelns
auf die allgemeine Wirtschaftspolitik bezeichnet. [Pep96; S.574/575]
Die durch die wachsende Konkurrenz entstehenden intensiven Wettbewerbsbeziehungen
zeigten sich auf den Märkten erstmals in den 80er Jahren. Ein verstärktes Marketingziel war
die (beabsichtigte) Konkurrenzvernichtung. Es wurde von Frontal- und Flankenangriffen,
Überraschungs- und Einschleichtaktiken gesprochen. Diese Bezeichnungen stammen aus
der Militärstrategie, aus der einige Erkenntnisse in das Marketing einflossen. Die Folge dar-
aus war eine Zunahme des Absatzanteils der Unternehmen auf ausländischen Märkten. Wei-
terhin fand eine Erweiterung auf internationales Marketing statt. Das heißt, Unternehmen
erwerben in einem anderen Land Immobilien oder errichten Tochterunternehmen. Dabei
handelt es sich um Fragen der Marktwahl, des Marktzugangs und der Marktbearbeitung auf
globalen Märkten.
Weitere Arten des Marketing entstanden in diesem Jahrzehnt (80er). LEVITT brachte in die-
sem Zusammenhang den Begriff des Global Marketing zur Diskussion. Entsprechend seiner
Hypothese, dass die hochentwickelten Industrienationen konvergente Sozialstrukturen auf-
weisen, sich in ihren Vermarktungsbedingungen also immer ähnlicher werden und grenz-
überschreitende Kommunikation nicht zu verhindern war, trat er für gleiche oder übertragba-
re Marketingkampagnen auf verschiedenen nationalen Absatzmärkten international tätiger
Unternehmen ein. [Pep96; S.575]
Gleichzeitig wurde das Direktmarketing, also die direkte Ansprache von Zielpersonen bei-
spielsweise durch Mailings, Response-Werbemittel und Haushaltsverteilungen und das Akti-
onsmarketing (Promotions) immer bedeutsamer. Da die normalen Kommunikationswege
durch Informationsüberflutung und selektive Wahrnehmung der Verbraucher immer weniger
geeignet waren, schienen erst außergewöhnliche Ereignisse des Aktionsmarketing dazu in
Entwicklung des Marketing und des Supply Chain Management
Studienarbeit von Rebecca Sudhoff
Universität Dortmund
Seite 8
der Lage zu sein, Botschaften ans Ziel zu transportieren.
KOTLER [Kot82, S.33ff] ergänzte in den 80er Jahren den 4P-Ansatz um die Öffentlichkeits-
arbeit (Publicity), was alle Maßnahmen, die das Ansehen des Unternehmens (z.B. Wirt-
schaftsverbände, Behörden, Regierungsstellen) in der Öffentlichkeit fördern sollen, beinhal-
tet. Auch als Public Relations (PR) fand sie durch Placement, Sponsoring und Networking
als verdeckte Werbung in verstärktem Maße statt. [Pep96, S.576] Allgemein werden jedoch
die ursprünglichen 4 P`s als die zentrale Aufgaben angesehen, wobei Publicity als Teilmenge
der Promotion betrachtet wird.
In den 90ern wurde das Marketing individualisiert (Customized Marketing). Das bedeutet,
dass auf jeden Kunden einzeln eingegangen wird. Daraus folgt die Rückkehr zur Einzelferti-
gung, was durch computergestützte Fertigungsanlagen, Outsourcing und Modultechnik mög-
lich gemacht wird. Aufgrund von Unternehmenskonzentrationen stieg die Bedeutung von
Marketingallianzen (Marketing Networks), die Konzerne zur Wahrung gegenseitiger Interes-
senssphären in verschiedenen Märkten schlossen. Auch mit der Entstehung reiner Marke-
tingfirmen, bei denen sich eine rechtliche und/oder wirtschaftliche Trennung von Produktion
und Absatz vollzieht, wurde gerechnet. [Pep96; S.576]
Ein weiterer neuer Begriff tauchte auf: Das Turbomanagement, das ebenfalls von KOTLER
geprägt wurde und einen technologiebedingten besseren Informationsstand im Marketing
und Vorkehrungen für ein schnelleres Feedback auf Marktreaktionen beinhaltet
[Kot82; S.72].
Auch die Standort- und Ansiedlungsentscheidung von Unternehmen gewann an Relevanz.
Diese Entscheidungen werden durch marketingadäquates Verhalten der Staaten und Regio-
nen durch Steuererleichterungen und Subventionen beeinflusst, was als Space-Management
bezeichnet wird.
Neben diesen Aspekten gewann auch der Bereich der kaufbegleitenden technischen und
kaufmännischen Services an Bedeutung (Service Marketing). [Pep96; S.577]
2.2 Entwicklung des Supply Chain Management
Veränderungen in den Märkten und im Unternehmensumfeld haben dazu beigetragen, dass
Unternehmen ihre Strukturen und Organisationskriterien komplett neu gestalten müssen.
Eine höhere Dynamik auf den Absatzmärkten, stärkerer Preiskampf durch die Öffnung des
globalen Wettbewerbs sowie die rasante Entwicklung des E-Commerce sind nur einige Cha-
rakteristika, die den Unternehmen eine veränderte Sichtweise auf die Wertschöpfungskette
abverlangen. Die Unternehmen sehen sich gezwungen, sich den stetig steigenden Lieferser-
viceanforderungen der Kunden hinsichtlicht Kosten, Zeit und Qualität anzupassen.
Entwicklung des Marketing und des Supply Chain Management
Studienarbeit von Rebecca Sudhoff
Universität Dortmund
Seite 9
Stand früher vor allem das eigene Unternehmen im Blickpunkt der Unternehmensführung, so
zeichnen sich gegenwärtig erfolgreiche Unternehmen dadurch aus, dass sie ihre Ziele an
den Prämissen und Erfolgsfaktoren aller in der logistischen Kette involvierten Partner anpas-
sen. Statt den Fokus auf die Funktionen und Aufgaben einzelner Teilbereiche zu richten,
müssen Unternehmen den ganzheitlichen Prozess der logistischen Kette vom Lieferanten bis
zum Kunden betrachten. Sämtliche separate Funktionen der Beschaffungs-, der Produkti-
ons- und der Distributionslogistik müssen zu einem einheitlichen Prozess vernetzt werden.
[Lin78;S.10]
Dies zu realisieren ist Aufgabe des SCM. Es umfasst somit die ,,integrierte Planung, Steue-
rung und Kontrolle aller in einer Lieferkette auftretenden logistischen Aktivitäten". [Kämp03]
Dabei müssen alle Prozesse entlang der Lieferkette möglichst effektiv und effizient bewältigt
und koordiniert werden. Dies setzt das Errichten von bereichsübergreifenden Organisations-
und Informationseinheiten voraus.
Das SCM orientiert sich dabei stets an folgenden Leitlinien:
· Prozessbezogenes Denken ersetzt die funktions- und organisationsbezogene Be-
trachtung.
· Prozesse werden nicht am Produkt, sondern an Kundenanforderungen ausgerichtet.
· Die ganzheitliche Optimierung des Informations- und Materialflusses steht jederzeit
im Vordergrund.
· Die Erfüllung der Kundenanforderungen ist auf gleicher Ebene zu verfolgen wie die
Verbesserung der Rendite. [Wan02; S.331]
Zukünftig wird der Wettbewerb weniger zwischen einzelnen Unternehmen sondern zwischen
den Supply Chains (SC) gestaltet. Ausschlaggebend für den Erfolg von Unternehmen wird
deren Kooperationsbereitschaft mit anderen in der Lieferkette eingebundenen Unternehmen
sein. Das kompetitive Verhalten im Wettbewerb wird folglich von der Unternehmensebene in
Richtung der SC-Ebene verschoben. [Wil00;S.13]
Historisch betrachtet stammt der ca. 40 Jahre alte Begriff aus den USA und wurde zu Beginn
durch Consultinggesellschaften geprägt. Ende der 80er Jahre wurde das Thema von der
Wissenschaft aufgegriffen. In Deutschland wurde das SCM erst Mitte der 90er Jahre von
Wissenschaft und Praxis bearbeitet. Als Basis für das Thema wird die Value Chain (Wert-
schöpfungskette) nach Porter genannt [Wer00; S.4]. Grundlegende Arbeiten zur Etablierung
des Begriffs in den Vereinigten Staaten wurden unter anderem von Cooper, Christopher,
Ellram, Bowersox und Davis angefertigt.
Entwicklung des Marketing und des Supply Chain Management
Studienarbeit von Rebecca Sudhoff
Universität Dortmund
Seite 10
Es gibt demnach in der Literatur viele Ansätze und Definitionen dieses Begriffs. [Kot00; S.24]
Die Vielfalt der Denkansätze zum SCM stellt KOTZAB [Kot00; S24] zusammen. Er be-
schreibt besonders die verschiedenen Definitionen aus dem amerikanischen Raum. Chrono-
logisch betrachtet können sie wie in Bild 2.2 dargestellt aufgeführt werden.
Materialfluss vom
Lieferanten
bis zum Endkunden;
ein Objekt
anstelle
aufgeteilter
Verantwortlichkeiten
und Zuständigkeiten
Materialfluss vom
Lieferanten
zum Kunden
1985
Jones/Riley
1987
Houlighan
Materialfluss vom
Lieferanten
über die
Produktion
und Distribution
bis
zum Endkunden
1994
Christopher
Gegenseitige
Informations-
bereitstellung
und
gemeinschaftliche
Planung
vom Rohstoff-
lieferanten
bis zum Endkunden
Kooperatives
Verhalten
als Basis,
Funktionen und
deren Aufgaben
werden
unternehmens-
übergreifend
verbunden
1996
Bowersox/Closs
1997
Bowersox
Integration von
Geschäftsprozessen
vom Endbenutzer
bis zu Lieferanten,
welche Produkte,
Dienstleistungen,
Informationen
bereitstellen,
die beim Kunden zu
einem Mehrwert
führen
1998
The Global
Supply Chain
Forum
Entwicklung des SCM
SCM wird verstanden als:
Bild 2.2: Entwicklung des SCM
Begriffsabgrenzungen
Studienarbeit von Rebecca Sudhoff
Universität Dortmund
Seite 11
3 Begriffsabgrenzungen
3.1 Marketing
Marketing ist heute ein geläufiger Begriff, mit dem jedoch immer noch sehr Vielfältiges ver-
bunden wird. Es handelt sich um einen inhaltsvollen Begriff, der sich in viele Bereiche ver-
zweigt hat, da heutzutage nicht nur Unternehmen, sondern zunehmend auch Institutionen
wie Kommunen, Bund und Länder Marketingaktivitäten durchführen. [Bec02; S.1]
In den letzten Jahren hat sich, wie in Kapitel 2 beschrieben, die Wandlung vom Verkäufer-
zum Käufermarkt vollzogen. Nicht mehr die Produktion, sondern der Markt bzw. Kunde mit
seinen Bedürfnissen und Wünschen steht im Vordergrund. Mit Hilfe des Marketing ist es
möglich, diesen Markt zu beeinflussen und zu gestalten. Es ist umso wichtiger, je gesättigter
der Markt ist, je austauschbarer die Produkte sind und je mehr an die Grenze der Verbesse-
rungsfähigkeit der Angebote gestoßen wird. [Blo89; S.9]
Grundsätzlich können dem Marketing zwei Bedeutungen zugeordnet werden. Zum einen
kann darunter eine Denkhaltung verstanden werden, die im betrieblichen Handeln dadurch
zum Ausdruck kommt, dass alle Mitarbeiter die Grundsätze des Marketing berücksichtigen
und die Wichtigkeit der Kunden- und Marktorientierung verinnerlicht haben. Zum anderen
kann Marketing als betriebswirtschaftliche Funktion abgegrenzt werden, die auf einer Ebene
wie z.B. die Produktion oder Finanzierung stehen kann. [Tho98; S.143]
Im Folgenden werden einige Definitionen aus der Literatur herausgestellt.
Marketing wird auf "marketing-marktplatz.de"[Int03d] allgemein als ein Prozess beschrieben,
durch den eine Organisation auf kreative, produktive und gewinnbringende Weise eine Be-
ziehung zum Markt herstellt.
Bei MEYER und DAVIDSON [Mey01] erhält neben der Beziehung zum Markt die Beteiligung
aller Mitarbeiter eine hohe Bedeutung. Ziel ist es, überdurchschnittliche Wertzuwächse für
das Unternehmen zu erzielen.
Als eine bewusst marktorientierte Unternehmensführung, die sich in Planung, Koordination
und Kontrolle aller auf die aktuellen und potentiellen Märkte ausgerichteten Unternehmens-
aktivitäten niederschlägt wird Marketing von MEFFERT [Gün97; S.15] gesehen.
SCHNEIDER betrachtet Unternehmensaktivitäten etwas detaillierter, er unterscheidet zwi-
schen Instrumenten für die Planung, Steuerung, Koordination und Kontrolle (formelle Seite)
und für die marketingpolitische (materiale) Seite Instrumente. Unter ihrem Einsatz befinden
sich alle Maßnahmen einer ziel- und wettbewerbsorientierten Ausrichtung der marktrelevan-
Begriffsabgrenzungen
Studienarbeit von Rebecca Sudhoff
Universität Dortmund
Seite 12
ten Aktivitäten der Unternehmung an ausgewählten Problemfeldern gegenwärtiger und zu-
künftiger Kundenpotentiale [Sch].
Die AMERICAN MARKETING ASSOCIATION (AMA) [Hüt99; S.10] nennt in ihrer Definition
bereits die Aufgaben des Marketing (4 P`s): Marketing ist ein Prozess der Planung und
Durchführung von Gestaltung, Preisfestlegung, Promotion und Distribution von Ideen, Sach-
gütern und Dienstleistungen zur Schaffung solcher Austauschbeziehungen, die die Ziele von
Individuen und Organisationen befriedigen. Die AMA unterscheidet hier als erste zwischen
Ideen, Sachgütern und Dienstleistungen als Produkt, welches auf den Markt gebracht wer-
den soll.
Die Bindung an den und die Orientierung am Kunden kommt besonders bei BLOOS
[Blo89; S.9f] zum Ausdruck: Er beschreibt Marketing als ein Prinzip, eine Konzeption, eine
Denkweise. Marketing ist die Einsicht, dass ein Unternehmen vom Markt lebt. Der Kunde ist
der zentrale Ansatzpunkt und letzten Endes die Existenzberechtigung der Unternehmung.
Weiter führt er zwei Definitionsmerkmale auf: die Ausrichtung der Unternehmenspolitik auf
die Zukunft und auf permanentes Wachstum. Ein Produkt kann zwar im Augenblick noch
marktgerecht sein, für die Unternehmung ist es jedoch von zentraler Bedeutung, ob es das
auch in Zukunft sein wird. Er bezeichnet Marketing als marktorientiertes, zukunftsorientiertes
und wachstumsorientiertes Denken, Handeln und Entscheiden der Unternehmensführung
sowie aller Mitarbeiter.
2
Nach MEFFERT [Hüt99; S10] (s.o.) ist Marketing eine marktorientierte Unternehmensfüh-
rung, was auf das Marketing Management hinweist, also die Steuerung und Koordination
der allgemeinen Marketing-Problemlösungsprozesse, insbesondere die Gestaltung und Um-
setzung des Marketingkonzeptes.
[Beck02; S.189f] Um verschiedene Probleme und Aufga-
ben zu lösen, welche das Marketing als unternehmerische Funktion neben anderen (z.B.
Produktion, Finanzierung, Personal) mit sich bringt, wird in der Unternehmensführung wie in
folgendem Problemlösungsprozess vorgegangen (Bild 3.1). Es handelt sich hierbei um ein
allgemeines Vorgehen zur Lösung eines Problems. Im Verlauf der Arbeit wird auf die einzel-
nen Schritte des Problemlösungsprozesses eingegangen.
2
vgl. auch ,,Lexikon des Marketing" von Peppels, J.Beckers ,,Das Marketingkonzept", Leihs, Dr. Helmuth (1989):
Marketing, Tips und Hinweise für den Praktiker, Thommen, J-P./Axchleitner, A-K. (1998): Allgemeine Betriebs-
wirtschaftslehre
Begriffsabgrenzungen
Studienarbeit von Rebecca Sudhoff
Universität Dortmund
Seite 13
Umwelt-
bedingungen
Bedürfnisse
Unternehmens-
ziele
Steuerungsfunktionen
5. Durchführung
6. Evaluierung der Resultate
Problemlösungsprozess
1. Analyse der Ausgangslage
2. Marketing-Ziele
3. Marketing-Instrumente
4. Marketing-Mix
Distribution
Konditi-
onen
Kom-
munikation
Ziele
Ziele
Ziele
Ziele
Maß-
nahmen
Maß-
nahmen
Maß-
nahmen
Maß-
nahmen
Mittel
Mittel
Mittel
Mittel
Produkt
Führung
Distribution
Konditi-
onen
Kom-
munikation
Ziele
Ziele
Ziele
Ziele
Maß-
nahmen
Maß-
nahmen
Maß-
nahmen
Maß-
nahmen
Mittel
Mittel
Mittel
Mittel
Produkt
Führung
Bild 3.1: Steuerung des Marketing-Problemlösungsprozesses [Tom98; S.145]
Abgrenzung des Marketingbegriffs für die weitere Arbeit
Für die Abgrenzung des Marketingbegriffes für die weitere Arbeit wird die schon oben aufge-
führte Definition von BLOOS [Blo89; S.9f] zugrunde gelegt.
Marketing ist eine Konzeption der Unternehmensführung bzw. eine Unternehmensphiloso-
phie, bei der im Interesse der Erreichung der Unternehmensziele (z.B. mehr Gewinn, Ver-
größerung der Marktanteile) alle betrieblichen Aktivitäten auf die gegenwärtigen und zukünf-
tigen Erfordernisse der Märkte ausgerichtet werden. Bei BLOOS ist ,,der Kunde die Exis-
tenzberechtigung der Unternehmung". Dies bedeutet eine grundlegende Veränderung der
unternehmerischen Einstellung, die den Markt und die Kundenwünsche in den Mittelpunkt
des unternehmerischen Denkens und Handelns stellt (,,Der Kunde ist König"), entgegen der
ursprünglichen, am Produktionsprozess orientieren Denkhaltung, die darauf hoffte, der Markt
werde die produzierten Güter schon aufnehmen. Der Blick in die Zukunft muss also aus Sicht
Begriffsabgrenzungen
Studienarbeit von Rebecca Sudhoff
Universität Dortmund
Seite 14
der Käufer erfolgen. Als Grundsatz gilt: ,,Finde Wünsche und erfülle sie" und nicht ,,Erfinde
Produkte und verkaufe sie".
Als marktorientierter und unternehmerischer Denkstil, der in der Erzeugung von Kundenzu-
friedenheit den Weg zur Erreichung der Unternehmensziele sieht, bedeutet Marketing, neben
der ,,Ausrichtung der Unternehmenspolitik auf die Zukunft und auf permanentes Wachstum"
[Blo89; S.9f] die systematische Marktbeeinflussung, d.h. gezielte Planung und Durchführung
von Maßnahmen zur Pflege und Erschließung von Märkten. Marketing als Mittel zur syste-
matischen Marktbeeinflussung und Marktgestaltung ist dadurch gekennzeichnet, nicht nur
auf Marktentwicklungen zu reagieren, sondern selbst aktiv auf allen Ebenen des Marktge-
schehens zu handeln. [Sch01]
3.2 Supply Chain Management
Der Begriff ,,SCM" wird häufig verwendet, jedoch ist die Auffassung über Aufgaben, Inhalte
und Ziele im SCM nicht eindeutig und führt so zu Missverständnissen
3
. Nachdem in der Ent-
wicklung des SCM vor allem auf Definitionen aus dem englischsprachigen Raum eingegan-
gen wurde, werden folgende Ansätze und Definition aus der deutschsprachigen Literatur
herausgestellt.
Bei SCHOLZ-REITER/JAKOBZA [Sch99; S.7ff] wird SCM mit der Koordination der Material-
und Informationsflüsse von den Rohstofflieferanten über die verschiedenen Produktionsstu-
fen bis zu den Endkunden gleichgesetzt. Die unternehmensübergreifende Abstimmung der
oben genannten Flüsse hat das Ziel, den Gesamtprozess zeit- und kostenoptimal zu gestal-
ten. Als Wesen des SCM wird besonders die Kooperation über die eigenen Unternehmens-
grenzen hinweg genannt, die sich von lokalen Optimierungen löst und zu einer Optimierung
in der gesamten Wertschöpfungskette führt. Durch SCM werden Bestellmengen, Lieferzei-
ten, Transporte, Bestände sowie Produktionsmengen und -programme entlang der Wert-
schöpfungskette verbessert bei gleichzeitiger Reduzierung der Bereitstellungszeiten beim
Kunden.
Neben den unternehmensübergreifenden SCM-Funktionen nennen SCHOLZ-
REITER/JAKOBZA auch intraorganisatorische Aspekte. Zu diesen zählen sie die Steuerung
der eigenen Produktion unter Verwendung verbesserter Prognosewerte, im Gegensatz zu
konventionellen Produktionsplanungs und -steuerungssystemen (PPS-Systeme) oder Enter-
prise Ressource Planing Systemen (ERP-Systeme), welche auf Vergangenheitsdaten basie-
ren und Zukunftsdaten nur schwach berücksichtigen. Zur Unterstützung der Ansätze wird die
3
Einen Grund für die Vielseitigkeit der Auffassungen ist, dass der Begriff nicht der betriebswirtschaftlichen Theo-
rie entstammt, sondern in der betrieblichen Praxis entwickelt wurde. Vgl. hierzu [Cors01; S. 95]
Begriffsabgrenzungen
Studienarbeit von Rebecca Sudhoff
Universität Dortmund
Seite 15
moderne Informationstechnologie (IT) genutzt, so dass Kunden vor allem über den Informa-
tionsfluss integriert werden. Die Effekte der Kundenanbindung sind verringerte Fehlerquoten
bei der Datenübermittlung und einer Datenverfügbarkeit ohne Zeitverzögerung
[Sch99; S.7ff].
WERNER [Wer00] fasst im Gegensatz zu Scholz-Reiter/Jakobza die Definition weiter und
bezieht neben der Versorgung auch alle Aktivitäten der Entsorgung und des Recyclings in
die Betrachtungen des SCM mit ein. Kennzeichnend bleiben Material- und Informationsflüs-
se, zusätzlich werden Finanzmittelflüsse betrachtet. Somit entsteht ein ,,Order to Payment"
Prozess. Er beginnt mit der Übermittlung eines Kundenauftrags an das Unternehmen und
endet mit der Begleichung der zugehörigen Rechnung. Grundsätzlich werden zwei Betrach-
tungsebenen unterschieden, einerseits die unternehmensinterne SC und andererseits die
unternehmensintegrierende SC, welche die Lieferanten und die Kunden einer Unternehmung
einbeziehen. Die Versorgung, Entsorgung und das Recycling sollen im SCM unter Berück-
sichtigung von Effektivität und Effizienz erfolgen. Als weiteres sind nach Werner die Erfolgs-
faktoren Zeit, Qualität, Flexibilität und Kosten gleichermaßen in den Ansatz einzubeziehen
[Wern00; S.4ff].
KUHN [Kuhn02] definiert SCM wie folgt: ,,Supply Chain Management ist die prozessorientier-
te Planung und Steuerung der Waren-, Informations- und Geldflüsse entlang der gesamten
Wertschöpfungskette vom Kunden bis zum Rohstofflieferanten..." [Kuh02; S.10]. Durch SCM
sollen sich folgende Effekte einstellen: Reduktion der Kapitalbindung, erhöhte Planungssi-
cherheit durch bessere Planungsdaten, gesteigerte Flexibilität auf sich verändernden Märk-
ten und effizientere Kapazitätsausnutzungen [Kuh02; S.15]. Als Grundlagen für erfolgreiches
SCM sieht KUHN prozessorientiertes Kooperationsmanagement, Reorganisation der Kern-
prozesse und die Nutzung moderner IT-Systeme [Kuh02; S.22f].
Der SUPPLY CHAIN COUNCIL
4
[Sup03b] sieht SCM wie folgt: Die SC umfasst alle Bestre-
bungen ein Produkt oder eine Dienstleistung herzustellen und zu liefern. Die Kette reicht von
den Vorlieferanten bis zu den Kunden der Kunden. Das SCM behandelt dabei sowohl die
Angebot- (engl.: supply) als auch die Nachfrageseite (engl.: demand). Zudem werden fol-
gende Aktivitäten dem SCM zugeschrieben: Beschaffung von Rohmaterialien und Zwischen-
produkten, Fertigung und Montage, Lagerhaltung und Bestandsverfolgung, Auftragsabwick-
lung, der Vertrieb über alle Kanäle sowie die Auslieferung zum Kunden (Bild 3.2). Aufgrund
4
Der Supply Chain Council ist eine Non-Profit Organisation mit knapp 1000 Mitgliedern weltweit. Die Mitglieder
sind Unternehmen aller Wirtschaftszweige und haben sich zum Ziel gesetzt, den aktuellen Stand bezüglich
Supply Chain Management voranzutreiben. Zu den Mitgliedern gehören z.B. Bayer, Compaq Computer, Procter &
Gamble, Lockheed Martin u.a..
Begriffsabgrenzungen
Studienarbeit von Rebecca Sudhoff
Universität Dortmund
Seite 16
der weitgefassten Definition muss sich SCM mit den komplexen Zusammenhängen zwischen
den Funktionen beschäftigen.
Materialstrom
Rohmaterial-
Verarbeiter 1
A
b
bau
un
d A
nb
au R
o
hm
a
ter
ia
l
Rohmaterial-
Verarbeiter 2
Rohmaterial-
Verarbeiter 3
Unternehmen
V
e
rb
ra
uc
he
r
Einzelhändler 1
Einzelhändler 2
Großhändler 1
Einzelhändler 3
Sub-Lieferant 1
Lieferant 1
Lieferant 3
Lieferant 4
Lieferant 5
Lieferant 6
Lieferant 2
Stufe 1
Stufe 2
Stufe 3
Stufe 6
Einkauf
Produktio n
Vertrie b
La ger
La ger
Einkauf
Produktio n
Vertrie b
La ger
La ger
Informationsstrom
Geldstrom
Stufe 4
Stufe 5
Sub-Lieferant 2
Materialstrom
Rohmaterial-
Verarbeiter 1
A
b
bau
un
d A
nb
au R
o
hm
a
ter
ia
l
Rohmaterial-
Verarbeiter 2
Rohmaterial-
Verarbeiter 3
Unternehmen
V
e
rb
ra
uc
he
r
Einzelhändler 1
Einzelhändler 2
Großhändler 1
Einzelhändler 3
Sub-Lieferant 1
Lieferant 1
Lieferant 3
Lieferant 4
Lieferant 5
Lieferant 6
Lieferant 2
Stufe 1
Stufe 2
Stufe 3
Stufe 6
Einkauf
Produktio n
Vertrie b
La ger
La ger
Einkauf
Produktio n
Vertrie b
La ger
La ger
Informationsstrom
Geldstrom
Stufe 4
Stufe 5
Sub-Lieferant 2
Bild 3.2: Exemplarische Supply Chain
Der SUPPLY CHAIN COUNCIL hat zur Darstellung der Prozesse in einer SC das SC Opera-
tions Reference Modell (SCOR-Modell
5
) entwickelt. Alle Aktivitäten, die der Wertschöpfung
im Sinne der Kundennachfrage dienen, werden in diesem Modell erfasst, zu diesen gehören:
Interaktionen mit den Kunden und den Märkten sowie physische Materialtransaktionen. Das
SCOR-Modell umfasst jedoch nicht alle Prozesse eines Unternehmens, z.B. werden Marke-
tingaktivitäten und Produktentwicklung nicht abgebildet. Das Modell beinhaltet einen hierar-
chischen Aufbau in drei Ebenen. Eine vierte Ebene ist bereits erkannt, wird im SCOR-Modell
jedoch noch nicht vollständig beschrieben. Die Erweiterung der vierten Ebene soll organisa-
tionsspezifische Prozesse, Systeme und Praktiken beinhalten [Sup03b].
Abgrenzung des Supply Chain Management Begriffs für die weitere Arbeit
Bei der vorliegenden Arbeit wird SCM wie folgt verstanden: SCM bedeutet das funktions-
und unternehmensübergreifende, prozessorientierte Gestalten, Planen, Beobachten, Kontrol-
lieren, Analysieren und Steuern der Material-, Dienstleistungs-, Informations- und Finanzmit-
telflüsse logistischer Wertschöpfungsketten und Wertschöpfungsnetzwerke im Sinne der
Unternehmensphilosophie und -strategie. SCM ist somit nicht nur die IT-gestützte Optimie-
5
Auf das SCOR-Modell wird in Kapitel 6 ausführlicher eingegangen
Begriffsabgrenzungen
Studienarbeit von Rebecca Sudhoff
Universität Dortmund
Seite 17
rung, Simulation und Steuerung vernetzter Wertschöpfungsketten auf Basis strategischer
Ausrichtung [Die]
6
.
Die SC besteht aus Lieferanten, Produzenten, Logistikdienstleistern und Kunden, die durch
die oben genannten Flüsse verbunden sind. Der Begriff Supply beinhaltet bei dem genutzten
Verständnis die Lieferung von bzw. die Versorgung mit Material, Dienstleistungen, Informati-
onen und Finanzmitteln. Als zentrale Elemente werden Wertschöpfungsprozesse angese-
hen. Wertschöpfung bedeutet die Erschaffung oder Herstellung von Kundennutzen zur Be-
friedigung seiner Bedarfe durch verwertbare Materialien oder Dienstleistungen. Die Kunden
sind interne und externe Abnehmer der Leistungen. Prozesse sind Folgen logisch zusam-
menhängender, reproduzierbarer Aktivitäten, die ein Objekt aus einem definierten Anfangs-
zustand in einen definierten Endzustand transformieren.
6
Nach Diebold (o. Jhg.) ist Supply Chain Management gerade nur die IT-gestützte Optimierung, Simulation und
Steuerung der Supply Chain S. 4
Aufgaben des Marketing und ihre Einbindungen in die Supply Chain
Studienarbeit von Rebecca Sudhoff
Universität Dortmund
Seite 18
4 Aufgaben des Marketing und ihre Einbindungen in die
Supply Chain
An dieser Stelle wird zunächst auf den Produktlebenszyklus eingegangen, um an seinem
Verlauf die Aufgaben und mögliche Maßnahmen sowie Instrumente des Marketing abzulei-
ten und erklären zu können. Der Produktlebenszyklus stellt als ein phasenorientiertes Markt-
reaktionsmodell die Absatz- bzw. Umsatzentwicklung eines Produktes über einen variablen
Zeitablauf dar. Durch den gezielten Einsatz von Marketingaktivitäten kann der Produktle-
benszyklus beeinflusst werden. Die Zielsetzung des Lebenszyklus ist somit die phasenge-
rechte Gestaltung des Einsatzes der Marketinginstrumente. Er kann als Frühwarnsystem
(Prognose-Modell) und als Orientierungshilfe für Marketingentscheidungen dienen, um bei-
spielsweise die Überalterung eines Produktprogramms zu verhindern. [Int03a]
Jeder Produktlebenszyklus ist in seinem Verlauf durch sieben charakteristische Phasen
(1. Produktfindung, 2. Produktrealisierung, 3. Markteinführung, 4. Wachstum, 5. Reifezeit,
6. Marktsättigung, 7. Degeneration) in einem Umsatz-Zeit-Schaubild darstellbar (Bild 4.1)
[MGH; S1.3].
1. Phase
2. Phase
3. Phase
4. Phase
5. Phase
6. Phase
7. Phase
Produkt-
findung
Produkt-
realisierung
Markt-
einführung
Wachstum
Reifezeit
Markt-
sättigung
Abstieg
0
[]
F&E-Kosten
Produktgewinn
Innovationszeit
Pay-Off-Periode
Verkäuflichkeitsspanne
Umsatz-
kurve
Gewinn-
kurve
Bild 4.1: Lebenszyklus eines Produktes [Mgh; S.1.4]
1. Produktfindung: Sie liefert die Produktidee und am Ende den Entwicklungsauftrag. Die-
ser beinhaltet den Anforderungskatalog sowie Termin- und Kostenziele.
Aufgaben des Marketing und ihre Einbindungen in die Supply Chain
Studienarbeit von Rebecca Sudhoff
Universität Dortmund
Seite 19
2. Produktrealisierung: Produktrealisierung beschreibt die Abfolge von Prozessen und
Unterprozessen, die benötigt werden, um das Produkt herzustellen. [Son00; S.96]
3. Markteinführung: Nach der Entwicklung folgt die Markteinführung. In der Phase der
Entwicklung fallen ausschließlich Kosten an, wohingegen sich nach Markteinführung ers-
te Umsätze einstellen. Diese steigen jedoch erst mit zunehmendem Bekanntheitsgrad.
Zu Beginn setzt sich der Umsatz vor allem aus Probe- und Neugierkäufen zusammen. In-
folge hoher Marketingkosten ( Auf- und Ausbau der Produktions- und Absatzorganisation,
Werbung) stellt sich zunächst noch kein Gewinn ein [Tho98; S.194f].
4. Wachstum: Wird das Produkt in vermehrtem Maße gekauft, so steigt der Umsatz in der
vierten Phase. Stark beeinflusst wird der Umsatz durch Wiederholungskäufe, Mund-zu-
Mund-Werbung und Artikel in Zeitschriften. Häufig treten in dieser Phase Konkurrenzpro-
dukte auf, die sich durch ihre Form, technische Ausführung, Qualität oder Preis unter-
scheiden. Dadurch werden neue Käuferschichten gewonnen, was eine Marktausweitung
zur Folge hat. Somit ist diese Phase durch ein überproportionales Umsatzwachstum ge-
kennzeichnet, das sich aber gegen Ende der Phase zu stabilisieren beginnt
[Tho98; S.194f].
5. Reifezeit: In dieser Phase nimmt das absolute Marktvolumen zwar noch zu, doch neh-
men die Umsatzzuwachsraten ab. In dieser Phase wird oft der höchste Gewinn erzielt
[Tho98; S.194f].
6. Marktsättigung: Hier kommt das Umsatzwachstum zum Stillstand. Der Konkurrenzmarkt
wird durch die Marktsättigung größer. Das einzelne Unternehmen kann eine Umsatzaus-
weitung nur durch Erhöhung seines Marktanteils erreichen. Um den Übergang in die letz-
te Phase des Produktlebenszyklus zu verhindern oder zumindest zu verzögern werden
verschiedene Marketingmaßnahmen ergriffen (z.B. Produktveränderung)
7
[Tho98; S.194f].
7. Abstieg: Wenn der Umsatzrückgang auch durch entsprechende Marketingmaßnahmen
nicht mehr aufgehalten werden kann, erreicht das Produkt seine letzte Lebensphase.
Grund für das Absinken des Umsatzes kann die Ablösung durch neue Produkte sein,
welche aufgrund ihres technischen Fortschrittes eine bessere Problemlösung darstellen.
Auch Modeerscheinung oder rechtliche Bestimmungen können zum Absinken führen
[Tho98; S.194f].
7
Auf diese Maßnahmen wird im Verlauf dieses Kapitels eingegangen.
Aufgaben des Marketing und ihre Einbindungen in die Supply Chain
Studienarbeit von Rebecca Sudhoff
Universität Dortmund
Seite 20
Die für ein Unternehmen wichtigsten Zusammenhänge lassen sich an drei zusammen-
fassenden Abschnitten beschreiben.
Über Produktfindung und -realisierung erstreckt sich die Innovationszeit. Die in dieser Zeit
eingesetzten Strategien, Ressourcen und Methoden haben entscheidenden Einfluss auf den
Produkterfolg. Hierbei wird es neben der durchgängigen Zielorientierung und einem ressour-
ceschonenden Entwicklungsprozess für den Produkterfolg zunehmend wichtiger, die kom-
munikative Vernetzung des Entwicklungsprozesses mit allen relevanten Funktionsbereichen
des Unternehmens herzustellen [Mgh; S.1.4]. Die Verkäuflichkeitsspanne umfasst den Zeit-
raum, in dem das Produkt am Markt eingeführt wird, sich am Markt behauptet und schließlich
seinen Fixkosten-Deckungsbeitrag leistet.
Der Verlauf der Markteinführung hängt im wesentlichen von zwei Faktoren ab. Zum einen
beeinflusst der individuelle Kundenwunsch und die Einzigartigkeit des Produktes maßgeblich
die Kaufentscheidung des Kunden. Zum anderen bestimmt die Dimensionierung und Gestal-
tung des in der Regel ebenfalls geänderten Produktionsprozesses die Produktqualität sowie
die sicherzustellende Produktionsflexibilität.
Die Zeit, welche verstreicht, bis das am Markt eingeführte Produkt die Entwicklungskosten
deckt, wird als Pay-Off Periode bezeichnet.
4.1 Aufgaben des Marketingmanagements
Das Marketing-Management umfasst die zielorientierte Gestaltung aller marktgerichteten
Unternehmensaktivitäten. Die Merkmale des Marketing als Führungskonzeption werden in
drei wichtigen Aufgabenkomplexen zusammengefasst: in die marktbezogenen, die unter-
nehmensbezogenen und die gesellschafts- und umweltorientierten Aufgaben, welche im fol-
genden genauer betrachtet werden.
Dabei hängen die einzelnen Aufgaben auch vom individuellen Unternehmenstyp ab. Ein
Markenartikelhersteller hat zum Beispiel bei der differenzierten Marktbearbeitung andere
Schwerpunkte zu setzen als ein Hersteller von Massengütern. Die konkreten Aufgaben und
der Inhalt und Umfang der Marketingaktivitäten ergeben sich aus der spezifischen Absatzsi-
tuation und den Zielen des jeweiligen Unternehmens.
[Mef00; S.11]
Marktbezogene Aufgaben
Die marktbezogenen Aufgaben befassen sich mit der Nachfragesteuerung. Ausgehend von
verschiedenen Nachfragekonstellationen lassen sich dabei als Beispiel folgende Aufgaben
herausstellen:
Aufgaben des Marketing und ihre Einbindungen in die Supply Chain
Studienarbeit von Rebecca Sudhoff
Universität Dortmund
Seite 21
Nachfrage
Bedarf
vorhanden
muss gedeckt werden
fehlt
muss geschaffen werden
schwankt
muss gleichmäßig verteilt werden
Diese Aufgaben werden mit verschiedenen Methoden und Instrumenten, auf die später ein-
gegangen wird, umgesetzt.
Somit beinhalten die marktbezogenen Aufgaben nicht nur die Befriedigung einer vorhanden
Nachfrage, sie sollen auch den Bedarf und das Verhalten der Nachfrager systematisch be-
einflussen.
Dies geschieht sowohl durch Durchdringung und Ausschöpfung der vorhandenen Märkte mit
vorhandenen Produkten (Intensivierung), als auch durch Entwicklung und Schaffung neuer
Märkte mit neuen oder bereits vorhandenen Produkten (Extensivierung).
Um die Nachfrage zu beeinflussen hat das Marketing-Management folgende Aufgaben zu
erfüllen:
- Identifikation und Definition von Märkten und Zielgruppen
- Steigerung der Kaufmotivation
- Produktpositionierung und -gestaltung
- Kommunikation
- Warenverteilung
- Initiierung von Kauftransaktionen (z.B. durch die Konditionengestaltung)
- Durchführung von Nachkauftransaktionen (z.B. Kundendienst)
Diese Funktionen sind wiederum in Abhängigkeit von dem angebotenen Produkt und der
jeweiligen Marktstruktur unterschiedlich zu gewichten. [Mef00; S.11f]
Unternehmensbezogene Aufgaben
Die unternehmensbezogenen Aufgaben befassen sich mit der Koordinierung der Aktivitäten
innerhalb eines Unternehmens. Zwischen den einzelnen Unternehmensbereichen sollten
beispielsweise Interessenskonflikte ausgeglichen und marktorientierte Prioritäten festgelegt
werden. Dabei sollen auch die Mitarbeiter in allen Bereichen von der Notwendigkeit einer
Marktorientierung überzeugt werden.
Aufgaben des Marketing und ihre Einbindungen in die Supply Chain
Studienarbeit von Rebecca Sudhoff
Universität Dortmund
Seite 22
Die Koordinationsaufgabe umfasst zum einem die Abstimmung der Marketingaktivitäten mit
den Forschungs- und Entwicklungsstrategien, den Produktions- und Lagerhaltungsstrategien
sowie den Einkaufs- und Finanzierungsmaßnahmen. Des Weiteren ist eine Koordination der
Marketinginstrumente innerhalb eines Unternehmens in sachlicher und zeitlicher Hinsicht
erforderlich. Beispielsweise kann der Verkauf von hochwertigen Markenartikeln in Discount-
geschäften zu Konflikten führen. [Mef00; S.12f]
Die Marketingkonzeption sollte organisatorisch von der Unternehmensspitze integriert wer-
den und der Marketingbereich gleichberechtigt gegenüber anderen betrieblichen Hauptfunk-
tionen bei der Formulierung der Unternehmenspolitik vertreten sein. [Meff00; S.12f]
Gesellschafts- und umweltbezogene Aufgaben
In diesem Aufgabenfeld wird die soziale Verantwortung des Marketing-Managements be-
rücksichtigt. Vor allem Kritiker des Marketing weisen auf eine Reihe dysfunktionaler Wirkun-
gen und ,,externe" Effekte unter gesamtwirtschaftlicher bzw. gesellschaftlicher Perspektive
hin. Damit sind zum Beispiel die künstliche Schaffung von Bedürfnissen, manipulative und
irreführende Werbung, unsichere Produkte und umweltschädliche Verpackungen gemeint.
1969 wurde das ,,Human-Concept of Marketing" (Dawson) vorgeschlagen, wobei die Ab-
nehmerorientierung zwar immer noch Basis der Gewinnerzielung sein soll, zahlreiche soziale
Veränderungen in der Umwelt des Unternehmens bewirken jedoch, dass das Gewinnstreben
durch Nebenbedingungen sozialer Art begrenzt wird bzw. werden soll.
Dieser Aspekt wird in den sozialen bzw. nicht-kommerziellen Marktbereichen auch als Vertie-
fung (Deepening) der marktorientierten Führung bezeichnet. Dies meint die Ergänzung rein
ökonomischer Entscheidungskriterien um ökologische, humanistische und ethische Maßstä-
be. [Mef00; S.13f]
4.2 Marketingaufgaben und ihre Einbindungen in die Supply Chain
Innerhalb des Marketing artikulieren, befriedigen und tauschen mehrere Personen ihre Be-
dürfnisse aus, indem sie Produkte und andere Dinge von Wert erzeugen und anbieten. Dar-
aus lassen sich folgende Aspekte ableiten:
Die Unternehmen und ihre Kunden drücken ihre jeweiligen Bedürfnisse oft nicht direkt aus,
das heißt sie müssen durch eine Markt- und Kundenanalyse genau ermittelt werden. Unter-
nehmen und Kunden tauschen Leistungen, Produkte und Geld aus, wenn es beiden zum
eigenen Vorteil ist. Dabei ist es wichtig, dass der Austausch für beide Seiten mit möglichst
wenig Aufwand verbunden ist, sie mit diesem Austausch zufrieden sind und die Bedürfnisse
Aufgaben des Marketing und ihre Einbindungen in die Supply Chain
Studienarbeit von Rebecca Sudhoff
Universität Dortmund
Seite 23
und Wünsche erfüllt werden. Ob der Kunde mit der Leistung zufrieden ist, zeigt sich nach
dem Kauf, da diese dann alleine durch den Kunden bewertet wird.
Die traditionelle Marketinglehre unterscheidet neben der Marktforschung vier zentrale Aufga-
ben
8
, die auch als die vier P's des Marketing bezeichnet werden (Bild 4.2)
9
: Product (Pro-
duktmix), Price (Preismix), Place (Distributionsmix), Promotion (Kommunikationsmix).
[Pep96; S.573]
Produktmix
- Produktgestaltung
- Programm / Sortiment
- Kundendienst
- Garantieleistung
Preismix
- Preis
- Rabatte
- Liefer- und Zahlungs-
bedingungen
- Kredite
Distributionsmix
- Vertriebssystem
- Verkaufsorgane
- Distributions-
logistiksysteme
Kommunikations-
mix
- Werbung
- persönlicher Verkauf
- Public Relations
- Verkaufsförderung
Bild 4.2: Die 4 P's des Marketing
Zur Analyse der Ausgangslage müssen notwendige Informationen über die gegenwärtige
und zukünftige Entwicklung gewonnen werden. Wichtig dabei sind die Unternehmensziele,
die allgemeinen Umweltbedingungen und die Beziehungen zwischen dem Unternehmen und
seiner Umwelt sowie die Bedürfnisse tatsächlicher oder potentieller Kunden, die mit Hilfe der
Marktforschung ermittelt werden können. [Tho98; S.165]
4.2.1 Marktforschung
Fast keine wichtige Marketing Entscheidung ist möglich, ohne vorher entsprechende Infor-
mationen zu eruieren. [Hüt99; S.47] Das heißt, allen Entscheidungen liegen Annahmen über
die Reaktionen der Käufer, Konkurrenten oder anderen Personengruppen zu Grunde. Um
geeignete Marketing-Maßnahmen ableiten zu können, ist es äußerst wichtig, das Verhalten
der verschiedenen Gruppen zu kennen. Die Erfassung dieser Informationen ist jedoch aus
folgenden Gründen schwierig: [Tho98; S.165]
8
Auf diese Aufgaben wird im Verlauf dieses Kapitels noch genauer eingegangen.
9
vgl. Kapitel 2: Entwicklung des Marketing
Aufgaben des Marketing und ihre Einbindungen in die Supply Chain
Studienarbeit von Rebecca Sudhoff
Universität Dortmund
Seite 24
Der Markt unterliegt einer großen Dynamik, das heißt, das Verhalten der Konsumenten kann
sich in Bezug auf Produkt, Kaufort, Kaufzeit und anderen Parametern schnell ändern. Wei-
terhin sind die Konsumenten selten eine homogene Gruppe, die durch ein gleichartiges
Kaufverhalten beschrieben werden könnte. Dem Unternehmen stehen Konkurrenten gegen-
über, die ebenfalls versuchen den Konsumenten für sich zu gewinnen. Dazu kommen noch
externe Einflüsse, die das Unternehmen wenig steuern kann, wie Einkommensentwicklungen
und saisonales Geschäft. [Tho98; S.165f] An dieser Stelle ist die Reaktionsschnelligkeit ei-
nes Unternehmens von hoher Bedeutung. Sie stellt die Fähigkeit von Unternehmen dar,
Marktänderungen auf verschiedenen Hierarchieebenen im Unternehmen wahrzunehmen und
in angemessener Zeit, die abhängig ist von Kundenerwartungen oder -verhalten, reagieren
zu können. [Las98; S.31f]
Deshalb ist eine systematische Informationsgewinnung wichtig. In Einzelfällen sind Ent-
scheidungen, die aus auf Erfahrung beruhenden Informationen getroffen werden, möglich.
Jedoch genügen sie nicht mehr den komplexen Systemen, die Märkte in der Regel darstel-
len. Erfahrungsbasierte Informationen sind meist unsystematisch erworben und durch sub-
jektive Erlebnisse und Zufälligkeiten geprägt. Um ein objektives Bild der vergangenen, ge-
genwärtigen und zukünftigen Marktsituation zu erhalten, ist eine systematische Sammlung
und Auswertung relevanter Informationen nötig. Die systematische Informationsgewinnung
kann und muss die Erfahrung und Intuition überprüfen, ergänzen und ggf. korrigieren.
[Tho98; S.165f]
Die Marktforschung kann somit als systematische, auf wissenschaftlichen Methoden beru-
hende Gewinnung und Auswertung von Informationen über die Elemente und Entwicklungen
des Marktes unter Berücksichtigung der Umweltbedingungen bezeichnet werden. Ziel ist das
Bereitstellen von objektiven Informationen und Analysen, die als Grundlage für die Planung,
Entscheidung, Aufgabenübertragung und Kontrolle von Marketing-Maßnahmen dienen.
[Tho98; S.166]
Die wichtigsten Funktionen der Marktforschung sind die Bereitstellung von Informationen, die
Objektivierung von Entscheidungen und das Markt-,,Controlling", welches als Frühwarnsys-
tem bei Marktveränderungen und als Navigationssystem (z.B. zum Auffinden neuer Ziel-
gruppen) dient. Anhand der Informationen der Marktforschung lässt sich der Verlauf des
Produktlebenszyklus näher beschreiben: es kann beispielsweise festgestellt werden, ob sich
die Marktsättigungsphase aufgrund von Marktveränderungen verkürzt. Auf die Methoden, die
dann ansetzen, um diese Phase erneut zu verlängern, wird im weiteren Verlauf eingegan-
gen. Die Marktforschung befasst sich mit den Absatzmärkten, auf denen Marktpotentiale und
Zielgruppen bestimmt, Marktanteile und Kaufmotive ermittelt, Kundenzufriedenheit analy-
Aufgaben des Marketing und ihre Einbindungen in die Supply Chain
Studienarbeit von Rebecca Sudhoff
Universität Dortmund
Seite 25
siert, Preisgrenzen ausgelotet und Wettbewerber erforscht werden. Neben dem Absatzmarkt
befasst sich die Markforschung auch mit dem Arbeits-, Kapital-, Rohstoffbeschaffungsmarkt
(Bild 4.3). [Zec01; S.60f]
Marktforschung
befasst sich mit
Absatzmärkten
Beschaffungsmärkten
Marktpotentiale bestimmen
Marktanteile ermitteln
Zielgrupeen bestimmen
Kaufmotive ermitteln
Kundenzufriedenheit analysieren
Preisgrenzen ausloten
Wettbewerber erforschen
Arbeitsmarkt
Kapitalmarkt
Rohstoffmarkt
Marktforschung
befasst sich mit
Absatzmärkten
Beschaffungsmärkten
Marktpotentiale bestimmen
Marktanteile ermitteln
Zielgrupeen bestimmen
Kaufmotive ermitteln
Kundenzufriedenheit analysieren
Preisgrenzen ausloten
Wettbewerber erforschen
Arbeitsmarkt
Kapitalmarkt
Rohstoffmarkt
Bild 4.3: Marktforschung für Absatz- und Beschaffungsmärkte [Zec01; S.60f]
Weiterhin wird bei der Marktforschung zwischen einer Marktforschung im engeren Sinne, die
sich nur auf den Markt und seine Elemente selbst bezieht, und einer Marktforschung im wei-
teren Sinne entschieden. Die Marktforschung im weiteren Sinne bezieht neben der Analyse
der für das Unternehmen relevanten Märkte auch Untersuchungen mit ein, welche die Eig-
nung verschiedener Marketing-Instrumente
10
zu erklären versuchen.
Ein weiteres Merkmal der Marktforschung ist der Zeitbezug: Die Marktanalyse ist eine stati-
sche Analyse, welche ein gegenwärtiges Bild über die Struktur und Größe des Marktes ab-
gibt, wohingegen die Marktbeobachtung die Veränderungen und Entwicklungen der Märkte
über mehrere Zeitperioden untersucht. Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung ver-
sucht die Marktprognose aus den vorhandenen und gesicherten Informationen herzuleiten.
[Tho98; S.167]
Zur Datengewinnung bedient sich die Marktforschung der Primär- und Sekundärforschung
11
.
Unter Primärforschung versteht man die Gewinnung originärer Daten. Im Gegensatz zur Se-
10
vgl. Kapitel 7
11
auf die Instrumente der Marktforschung wird im Anhang ausführlicher eingegangen
Aufgaben des Marketing und ihre Einbindungen in die Supply Chain
Studienarbeit von Rebecca Sudhoff
Universität Dortmund
Seite 26
kundärforschung wird hierbei nicht auf die Daten von Dritten zurückgegriffen, sondern die
Informationen werden durch Befragung oder Beobachtung gewonnen [Int03c].
Die Marktforschung sollte nicht nur das Verhalten der Konsumenten erfassen und erklären,
sondern auch Prognosen über zukünftige Entwicklungen, insbesondere Absatz und Preise.
machen [Tho98; S.182f]
Die Prognosen über zukünftige Entwicklungen des Marktes sind für die SC eine wichtige
Komponente. Nicht nur das Marketing, sondern die gesamte Wertschöpfungskette muss sich
auf die Trends und Entwicklungen der Zukunft einstellen. Die Produktpalette wird durch Ab-
nehmerbedürfnisse beeinflusst:
- Wird es neue Produkte, eine Veränderung an einem Produkt geben?
- Wie entwickelt sich der Preis, wenn beispielsweise die Bereitschaft der Kunden Geld
auszugeben gesunken ist?
- Welche Qualität wird vom Markt gefordert oder welche Serviceleistungen werden erwar-
tet?
Die Marktforschung hat somit Auswirkung auf die gesamte SC, angefangen bei der Roh-
stoffbeschaffung bis hin zum Verkauf an den Endkunden. Sie leistet einen großen Beitrag
dazu, wie sich die Kette auf die Zukunft einstellen und vorbereiten kann.
Im Folgenden werden die 4P`s des Marketing erläutert, die Instrumente zu den einzelnen
Aufgaben werden im Anhang erläutert.
4.2.2 Produktmix
Produkte und Leistungen sollen nach den Bedürfnissen des Kunden entwickelt und gestaltet
werden. [Dres03]
Aufgaben des Marketing und ihre Einbindungen in die Supply Chain
Studienarbeit von Rebecca Sudhoff
Universität Dortmund
Seite 27
Produktmix
- Produktgestaltung
- Programm / Sortiment
- Kundendienst
- Garantieleistung
Preismix
- Preis
- Rabatte
- Liefer- und Zahlungs-
bedingungen
- Kredite
Distributionsmix
- Vertriebssystem
- Verkaufsorgane
- Distributions-
logistiksysteme
Kommunikations-
mix
- Werbung
- persönlicher Verkauf
- Public Relations
- Verkaufsförderung
Bei der Gestaltung eines Produktes kann zwischen der physikalischen Gestaltung (der
Gestaltung des Produktkerns) und der sozial-psychologischen Dimension, dem Marketing-
Überbau unterschieden werden [Tho98; S.190].
Der Produktkern stellt das eigentlich Produkt, die physikalische Substanz, dar und zeichnet
sich durch seine funktionalen Eigenschaften aus. In ihm ist die technisch-ökonomische Di-
mension beinhaltet. Er bietet dem Käufer den Grundnutzen, den er aus dem Gebrauch des
Produktes ziehen kann und umfasst je nach Zweckbestimmung [Tho98; S.191]:
- Gebrauchs-, und Funktionstüchtigkeit
- Funktionssicherheit
- Betriebssicherheit
- Störanfälligkeit
- Haltbarkeit
- Wertbeständigkeit
Aufgabe des Marketing ist jedoch nur die, grobe Gestaltung des Produktkerns. Es kann bei-
spielsweise Aussagen über Größe, Optik und Material des Produktes (Kunststoff, Holz oder
Metall) machen. Zu den oben aufgeführten Eigenschaften kann es vorgeben, wie sicher und
haltbar ein Produkt sein sollte und wie wichtig die Wertbeständigkeit und die Störanfälligkeit
ist. Es erstellt somit ein ,,Lastenheft", aus dem die SC-Elemente Entwicklung, Konstruktion
und Fertigung ein Produkt erstellen, das diesen Vorgaben entspricht. Dabei entscheiden die
SC Elemente über die endgültigen Werkstoffe, die möglichen Größen und das Design. Zwi-
schen der Marketingabteilung und der SC sind bei diesem ,,Produktfindungsprozess" Aus-
Aufgaben des Marketing und ihre Einbindungen in die Supply Chain
Studienarbeit von Rebecca Sudhoff
Universität Dortmund
Seite 28
tauschprozesse notwendig, bei denen Kompromisse eingegangen werden müssen. Dies
könnte der Fall sein, wenn das Marketing verschiedene Eigenschaften verlangt, die ferti-
gungstechnisch nicht gleichzeitig umsetzbar sind. Somit sind hier eine enge Zusammenar-
beit und ein regelmäßiger und häufiger Datenaustausch notwendig, um das ,,perfekte" Pro-
dukt zu finden.
Der Marketing-Überbau setzt sich aus folgenden Elementen zusammen:
- Design: Hierunter fallen Mode und Prestige wie auch vielfach technisch-funktional o-
rientierte Elemente (z.B. Handlichkeit, Betriebssicherheit)
- Verpackung, der folgende Funktionen zuzuschreiben sind:
Information
Werbung
Identifikation
Schutz
Lagerung
Transport
Verwendung (Unterstützung des Gebrauchs)
Fertigung (Unterstützung des Fertigungsprozesses)
- Markierung: Kennzeichnung eines Produktes mit einem speziellen Produktnamen,
dem Firmennamen oder einem sonstigen Symbol als Erkennungszeichen
[Tho98; S.190f]
- Kundendienst
- Garantieleistungen
Ebenso wie beim Produktkern ist beim Marketing-Überbau ein Austauschprozess zwischen
Marketing und SC notwendig, wenn auch in kleinerem Maße. Dabei geht es beispielweise
um die Fragen, ob das verlangte Design umgesetzt werden kann, in welchem Maße Garan-
tieleistungen erbracht werden können und ob die Verpackung, so wie vom Marketing vorge-
geben, die Distributionsanforderungen erfüllt.
Die Gestaltung der Verpackung eines Produktes erfordert folglich ebenfalls einen Aus-
tauschprozess. Das Marketing bringt in die Gestaltung die Wünsche der Kunden ein. So wol-
len die Kunden in der Kaufphase beispielsweise ein geringes Gewicht und einen guten Pro-
Aufgaben des Marketing und ihre Einbindungen in die Supply Chain
Studienarbeit von Rebecca Sudhoff
Universität Dortmund
Seite 29
duktschutz beim Transport. In der Ge- und Verbrauchsphase fordern die Konsumenten bei-
spielsweise eine hohe Benutzerfreundlichkeit (leichtes Öffnen, Verschließen, Portionieren,
Standsicherheit, Verderblichkeitsschutz) sowie ausreichende und verständliche Produktin-
formationen unter anderem über Mindesthaltbarkeit, wichtige Inhaltsstoffe und Produkt-
gebrauch. Demgegenüber ist in der Entsorgungsphase unter anderem ein geringes Abfallvo-
lumen oder Wiederverwertbarkeit der Verpackung wichtig. Diese Informationen müssen in
der Konstruktion und Fertigung des Produktes berücksichtigt werden und beziehen somit die
Rohstoffbeschaffung sowie den kundennahen Teil, den Verkauf und die Distribution sowie
die Entsorgung, mit ein (Bild 4.4).
Hersteller
Marketing
(Erlöse
Produktion
(Kosten
Logistik
(Kosten)
Verpackung
Kauf-
phase
Entsorgungs
-phase
Ge- und
Verbrauchs-
phase
Konkurrenz
Konsumenten
Umwelt
Händler
Bild 4.4: Einflussfaktoren der Verpackungsgestaltung [Mef98; S.442]
Bereits in der Produktentwicklung werden Entscheidungen über den weitern Verlauf der SC
getroffen:
- Soll das Produkt selbst entwickelt werden, oder wird Know-How ,,eingekauft"?
- Wird es ein Marken- oder ein Massengut, was unter anderem über Werkstoffe, Quali-
tät der Verarbeitung und Verpackung und den Verkaufsweg entscheidet (ein Mas-
sengut kann nicht exklusiv über einen Fachhandel verkauft werden)?
- Wird jedes Teil selbst produziert oder wird ein Modullieferant beauftragt, so dass eine
Komponentenfertigung entsteht?
Zu den Aufgaben des Marketing gehört die Konzeption des Produktprogramms. Das be-
deutet, der Markt muss dahingehend beobachtet und analysiert werden, welche Produkte
gekauft werden könnten, ob eine Neuentwicklung eines Produktes möglich ist (Produktinno-
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2004
- ISBN (eBook)
- 9783832478957
- ISBN (Paperback)
- 9783838678955
- DOI
- 10.3239/9783832478957
- Dateigröße
- 1.2 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Technische Universität Dortmund – Maschinenbau
- Erscheinungsdatum
- 2004 (April)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- werbung marketingstrategie produktmix marktforschung
- Produktsicherheit
- Diplom.de