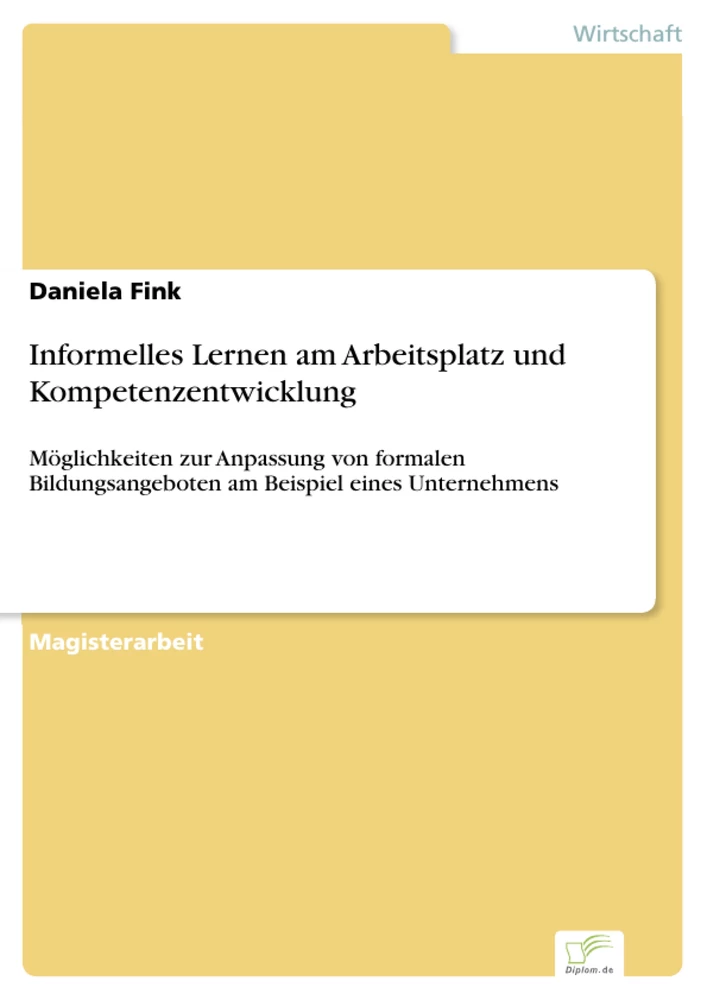Informelles Lernen am Arbeitsplatz und Kompetenzentwicklung
Möglichkeiten zur Anpassung von formalen Bildungsangeboten am Beispiel eines Unternehmens
©2003
Magisterarbeit
141 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Der Begriff lebenslanges Lernen taucht seit einigen Jahren als Dauerthema in Politik und Öffentlichkeit auf. Ein Wandel der Auffassung des Lernens durchzieht die Wissenschaft ebenso wie die Praxis. Das Lernen ist zu einer unerlässlichen Voraussetzung für das Bestehen in der heutigen Welt geworden. Vor allem auch in der Arbeitswelt kann auf ein kontinuierliches, lebensumfassendes Lernen nicht mehr verzichtet werden. Veränderungen des Marktes, Fortschritt und Innovation von Produkten und Arbeitsabläufen, Schlagwörter wie Globalisierung und Wissensmanagement erfordern Mitarbeiter und Führungskräfte, die weit über ihre konkreten Aufgaben hinaus (mit-)denken.
Die moderne Wirtschaft ist auf Arbeitskräfte angewiesen, die bestrebt sind, ihre Kompetenzen und Fähigkeiten selbst organisiert und selbständig weiterzuentwickeln und sich nicht auf den Grundlagen ihrer Erstausbildung ausruhen. Unternehmen erwarten von ihren Mitarbeitern einen fortwährenden Lernprozess, um ihre Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt gewährleisten zu können.
Deshalb ist es in einer Zeit, in der übergreifende Kompetenzen und Qualifikationen in fast jedem Bereich gefordert werden, nicht mehr ausreichend, Arbeit und Lernen getrennt voneinander zu betrachten. Es ist nur dann möglich, kontinuierlich und lebensumfassend zu lernen, wenn eine Beschränkung des Lernens auf formal organisierte Bildungsveranstaltungen aufgelöst und ein Lernen in allen Lebenslagen für den Einzelnen selbstverständlich wird.
Der Arbeitnehmer verbringt den größten Teil seines Tages am Arbeitsplatz und ist dort in alltägliche und komplexe Aufgaben eingebunden. Zeit für formal organisierte Weiterbildung ist bei den meisten Mitarbeitern rar und im Tagesgeschäft wird oft auf andere Lernaktivitäten zurückgegriffen. Der Arbeitsplatz sollte deshalb so ausgerichtet sein, dass ein Miteinander von Lernen und Arbeiten jedem Einzelnen erleichtert wird. Um den Arbeitsplatz zu einem Ort zu machen, an dem Lernprozesse dauerhaft stattfinden können, müsste das (Lern-)Engagement der Mitarbeiter seitens der Unternehmen gefördert und gefordert werden. Ein Lernen neben institutionalisierten Veranstaltungen und Weiterbildungsangeboten, also sogenanntes informelles Lernen, sollte durch die Rahmenbedingungen gewährleistet sowie die Anerkennung und Zertifizierung informell erworbener Kompetenzen möglich gemacht werden.
Das informelle Lernen ist in Deutschland noch wenig thematisiert und […]
Der Begriff lebenslanges Lernen taucht seit einigen Jahren als Dauerthema in Politik und Öffentlichkeit auf. Ein Wandel der Auffassung des Lernens durchzieht die Wissenschaft ebenso wie die Praxis. Das Lernen ist zu einer unerlässlichen Voraussetzung für das Bestehen in der heutigen Welt geworden. Vor allem auch in der Arbeitswelt kann auf ein kontinuierliches, lebensumfassendes Lernen nicht mehr verzichtet werden. Veränderungen des Marktes, Fortschritt und Innovation von Produkten und Arbeitsabläufen, Schlagwörter wie Globalisierung und Wissensmanagement erfordern Mitarbeiter und Führungskräfte, die weit über ihre konkreten Aufgaben hinaus (mit-)denken.
Die moderne Wirtschaft ist auf Arbeitskräfte angewiesen, die bestrebt sind, ihre Kompetenzen und Fähigkeiten selbst organisiert und selbständig weiterzuentwickeln und sich nicht auf den Grundlagen ihrer Erstausbildung ausruhen. Unternehmen erwarten von ihren Mitarbeitern einen fortwährenden Lernprozess, um ihre Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt gewährleisten zu können.
Deshalb ist es in einer Zeit, in der übergreifende Kompetenzen und Qualifikationen in fast jedem Bereich gefordert werden, nicht mehr ausreichend, Arbeit und Lernen getrennt voneinander zu betrachten. Es ist nur dann möglich, kontinuierlich und lebensumfassend zu lernen, wenn eine Beschränkung des Lernens auf formal organisierte Bildungsveranstaltungen aufgelöst und ein Lernen in allen Lebenslagen für den Einzelnen selbstverständlich wird.
Der Arbeitnehmer verbringt den größten Teil seines Tages am Arbeitsplatz und ist dort in alltägliche und komplexe Aufgaben eingebunden. Zeit für formal organisierte Weiterbildung ist bei den meisten Mitarbeitern rar und im Tagesgeschäft wird oft auf andere Lernaktivitäten zurückgegriffen. Der Arbeitsplatz sollte deshalb so ausgerichtet sein, dass ein Miteinander von Lernen und Arbeiten jedem Einzelnen erleichtert wird. Um den Arbeitsplatz zu einem Ort zu machen, an dem Lernprozesse dauerhaft stattfinden können, müsste das (Lern-)Engagement der Mitarbeiter seitens der Unternehmen gefördert und gefordert werden. Ein Lernen neben institutionalisierten Veranstaltungen und Weiterbildungsangeboten, also sogenanntes informelles Lernen, sollte durch die Rahmenbedingungen gewährleistet sowie die Anerkennung und Zertifizierung informell erworbener Kompetenzen möglich gemacht werden.
Das informelle Lernen ist in Deutschland noch wenig thematisiert und […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 7461
Fink, Daniela: Informelles Lernen am Arbeitsplatz und Kompetenzentwicklung -
Möglichkeiten zur Anpassung von formalen Bildungsangeboten am Beispiel eines
Unternehmens
Hamburg: Diplomica GmbH, 2003
Zugl.: Ludwig-Maximilians-Universität München, Universität, Magisterarbeit, 2003
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2003
Printed in Germany
_____________________________________________________________
3
I
I
I
n
n
n
h
h
h
a
a
a
l
l
l
t
t
t
s
s
s
v
v
v
e
e
e
r
r
r
z
z
z
e
e
e
i
i
i
c
c
c
h
h
h
n
n
n
i
i
i
s
s
s
Abbildungsverzeichnis
6
Tabellenverzeichnis
7
Einführung und Fragestellung
8
1
Ausgangslage
11
1.1 Wandel der Lernkulturen
11
1.2 Ausgangslage im internationalen Vergleich
14
2
Konzeptionen und Definitionen des informellen Lernens
16
2.1 Abgrenzung zu anderen Lernformen
16
2.2 Unterschiedliche Konzeptionen und Aspekte
20
2.2.1
Informelles Lernen bewusst und unbewusst
20
2.2.2
Informelles Lernen Lernen im Alltag
26
2.2.3
Informelles Lernen Lernen durch Erfahrung
28
3
Kompetenzen und Kompetenzentwicklung
32
3.1 Der Kompetenzbegriff
32
3.1.1
Unterschiedliche Ansätze des Kompetenzkonzepts
33
3.1.2
Qualifikation und Kompetenz
37
3.1.3
Schlüsselqualifikationen
38
3.2 Kompetenzentwicklung
39
4
Informelle Lernprozesse am Arbeitsplatz und Kompetenzentwicklung 43
4.1 Lernort Arbeitsplatz
43
4.2 Kompetenzentwicklung durch informelles Lernen am Arbeitsplatz
49
4.3 Förderung der Kompetenzentwicklung durch Förderung informellen Lernens 52
_____________________________________________________________
4
5
Datenerhebung zum informellen Lernen und der Kompetenzentwicklung
am Arbeitsplatz
58
5.1 Hypothesen
58
5.2 Das Unternehmen
59
5.3 Methodisches Vorgehen
60
5.3.1
Wahl der Methode
60
5.3.2
Der Fragebogen
62
5.3.3
Das Lerntagebuch
64
5.3.4
Die Datenerhebung
65
5.3.5
Die Datenanalyse
66
6
Darstellung und Diskussion der Ergebnisse
71
6.1 Die Ergebnisse des Fragebogens
71
6.1.1
Soziodemographische Beschreibung der Analysepopulation
71
6.1.2
Die Themengebiete informellen Lernens
72
6.1.3
Fähigkeiten und Kompetenzen aus der beruflichen Tätigkeit
73
6.1.4
Lern- und Informationsquellen
76
6.1.5
Der Zeitfaktor informellen Lernens
79
6.1.6
Nutzung von Weiterbildungsveranstaltungen
80
6.2 Die Ergebnisse des Lerntagebuchs
82
6.2.1
Soziodemographische Beschreibung der Analysepopulation
82
6.2.2
Die Themengebiete des aufgezeichneten Lernens
83
6.2.3
Lern- und Informationsquellen
86
6.2.4
Anlässe des aufgezeichneten Lernens
88
6.2.5
Offene Fragen bzw. Vertiefungswünsche der Befragten
91
6.3 Diskussion der Ergebnisse
93
_____________________________________________________________
5
7
Konsequenzen für die betriebliche Weiterbildung
102
7.1 Bedarf einer Anpassung organisierter Weiterbildung
102
7.2 Möglichkeiten zur Anpassung betrieblicher Weiterbildung an informelle
Lernprozesse
104
7.2.1
Lerninhalte und -ziele betrieblicher Weiterbildung
104
7.2.2
Thematisierung informellen Lernens
105
7.2.3
Zertifizierung informell erworbener Kompetenzen
106
7.2.4
Veränderung klassischer Strukturen betrieblicher Weiterbildung 107
7.2.5
Ein Beispiel aus der Praxis: Arbeitsprozessorientiertes Lernen
108
Fazit
111
Literaturverzeichnis
114
Anhang
124
Fragebogen zum Thema informelles Lernen
125
Das verwendete Lerntagebuch
130
Anforderungsprofil zur Führungskräfteauswahl
136
Exemplarische Darstellung des Kodierleitfadens nach Mayring
137
Exemplarische Darstellung der inhaltsanalytische n Auswertung nach Mayring 138
Selbständigkeitserklärung
140
_____________________________________________________________
6
A
A
A
b
b
b
b
b
b
i
i
i
l
l
l
d
d
d
u
u
u
n
n
n
g
g
g
s
s
s
v
v
v
e
e
e
r
r
r
z
z
z
e
e
e
i
i
i
c
c
c
h
h
h
n
n
n
i
i
i
s
s
s
Abb. 1: Entwicklungstendenzen des Lernens in der Informationsgesellschaft
12
Abb. 2: Compared Characteristics of Learning Experiences
18
Abb. 3: Handlung und Reflektion in Lernprozessen
22
Abb. 4: Weg ins Gedächtnis Die Wahrnehmungsart beeinflusst das Erinnern
29
Abb. 5: Unterschiedliche Ansätze des Kompetenzkonzeptes
33
Abb. 6: Aktivitäts- und Handlungskompetenz
36
Abb. 7: Berufsrelevantes informelles Lernen: subjektgesteuert subjektgebunden 45
Abb. 8: Informelle berufliche Weiterbildung 1994 und 1997 in % der Befragten 46
Abb. 9: Erfahrungslernen formalisiert und informell
48
Abb. 10: Komponenten beruflicher Handlungskompetenz
51
Abb. 11: Modelle zur Verbindung non-formalen und informellen Lernens
108
Abb. 12: Rollen- und Aufgabenverteilung im Arbeitsprozessorientierten Lernen 109
_____________________________________________________________
7
T
T
T
a
a
a
b
b
b
e
e
e
l
l
l
l
l
l
e
e
e
n
n
n
v
v
v
e
e
e
r
r
r
z
z
z
e
e
e
i
i
i
c
c
c
h
h
h
n
n
n
i
i
i
s
s
s
Tab. 1: Soziodemographische Beschreibung der Analysepopulation (Fragebogen) 72
Tab. 2: Themengebiete informellen Lernens
73
Tab. 3: In derzeitiger Tätigkeit eingesetzte Fähigkeiten und Kompetenzen
74
Tab. 4: In derzeitiger Tätigkeit eingesetzte Kompetenzen (in Kategorien)
75
Tab. 5: In bisherigen Tätigkeiten erworbene Kompetenzen (in Kategorien)
76
Tab. 6: Vergleich von (non-)formalen und informellen Lernangeboten
77
Tab. 7: Lern- und Informationsquellen für die Ausbildung von
Kompetenzen und Fähigkeiten
77
Tab. 8: Verwendete Quellen zur Klärung von Fragen am Arbeitsplatz
78
Tab. 9: Vergleich non-formaler und informeller Quellen zur Klärung
von Fragen am Arbeitsplatz
78
Tab. 10: Informelles Lernen in den letzten 12 Monaten
79
Tab. 11: Informelles Lernen in Stunden pro Woche
80
Tab. 12: Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen in Tagen
81
Tab. 13: Gründe für die Teilnahme an organisierter Weiterbildung
81
Tab. 14: Soziodemographische Beschreibung der
Analysepopulation (Lerntagebuch)
83
Tab. 15: Allgemeine Themen des aufgezeichneten Lernens
84
Tab. 16: Vergleich allgemeiner mit arbeitsplatzbezogenen Themen
84
Tab. 17: Arbeitsplatzbezogene Theme n des aufgezeichneten Lernens
85
Tab. 18: Lern- und Informationsquellen
86
Tab. 19: Quellen und Themenbereiche des aufgezeichneten Lernens
88
Tab. 20: Anlässe des aufgezeichneten Lernens
89
Tab. 21: Anlässe und Themenbereiche des aufgezeichneten Lernens
90
Tab. 22: Hätte gerne gewusst... / mehr dazu erfahren (in Kategorien)
92
Tab. 23: Hätte gerne gewusst... / mehr dazu erfahren (in Positionen)
93
_____________________________________________________________
8
E
E
E
i
i
i
n
n
n
f
f
f
ü
ü
ü
h
h
h
r
r
r
u
u
u
n
n
n
g
g
g
u
u
u
n
n
n
d
d
d
F
F
F
r
r
r
a
a
a
g
g
g
e
e
e
s
s
s
t
t
t
e
e
e
l
l
l
l
l
l
u
u
u
n
n
n
g
g
g
Der Begriff ,,lebenslanges Lernen" taucht seit einigen Jahren als Dauerthema in Poli-
tik und Öffentlichkeit auf. Ein Wandel der Auffassung des Lernens durchzieht die
Wissenschaft ebenso wie die Praxis. Das Lernen ist zu einer unerlässlichen Voraus-
setzung für das Bestehen in der heutigen Welt geworden. Vor allem auch in der Ar-
beitswelt kann auf ein kontinuierliches, ,,lebensumfassendes" Lernen nicht mehr ver-
zichtet werden. Veränderungen des Marktes, Fortschritt und Innovation von Produk-
ten und Arbeitsabläufen, Schlagwörter wie Globalisierung und Wissensmanagement
erfordern Mitarbeiter und Führungskräfte, die weit über ihre konkreten Aufgaben
hinaus (mit-)denken.
Die moderne Wirtschaft ist auf Arbeitskräfte angewiesen, die bestrebt sind, ihre
Kompetenzen und Fähigkeiten selbst organisiert und selbständig weiterzuentwickeln
und sich nicht auf den Grundlagen ihrer Erstausbildung ausruhen. Unternehmen er-
warten von ihren Mitarbeitern einen fortwährenden Lernprozess, um ihre Zukunfts-
und Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt gewährleisten zu können.
Deshalb ist es in einer Zeit, in der übergreifende Kompetenzen und Qualifikationen
in fast jedem Bereich gefordert werden, nicht mehr ausreichend, Arbeit und Lernen
getrennt voneinander zu betrachten. Es ist nur dann möglich, kontinuierlich und le-
bensumfassend zu lernen, wenn eine Beschränkung des Lernens auf formal organi-
sierte Bildungsveranstaltungen aufgelöst und ein Lernen ,,in allen Lebenslagen" für
den Einzelnen selbstverständlich wird.
Der Arbeitnehmer verbringt den größten Teil seines Tages am Arbeitsplatz und ist
dort in alltägliche und komplexe Aufgaben eingebunden. Zeit für formal organisierte
Weiterbildung ist bei den meisten Mitarbeitern rar und im Tagesgeschäft wird oft auf
andere Lernaktivitäten zurückgegriffen. Der Arbeitsplatz sollte deshalb so ausgerich-
tet sein, dass ein Miteinander von Lernen und Arbeiten jedem Einzelnen erleichtert
wird. Um den Arbeitsplatz zu einem Ort zu machen, an dem Lernprozesse dauerhaft
stattfinden können, müsste das (Lern-)Engagement der Mitarbeiter seitens der Unter-
nehmen gefördert und gefordert werden. Ein Lernen neben institutionalisierten Ver-
_____________________________________________________________
9
anstaltungen und Weiterbildungsangeboten, also sogenanntes informelles Lernen,
sollte durch die Rahmenbedingungen gewährleistet sowie die Anerkennung und Zer-
tifizierung informell erworbener Kompetenzen möglich gemacht werden.
Das informelle Lernen ist in Deutschland noch wenig thematisiert und erforscht. Erst
in den letzten Jahren wird der Ruf nach diesen informellen Lernprozessen auch in der
Diskussion um die Kompetenzentwicklung immer lauter. Für den fachübergreifenden
und umfassenden Kompetenzerwerb vor allem für das Berufsleben, kann informelles
Lernen einen wesentlichen Bestandteil darstellen. Es ist zu untersuchen, inwieweit
Arbeitnehmer sich informellen Lernaktivitäten zuwenden, um sich weiterzubilden
und welchen Stellenwert sie in der Kompetenzentwicklung des Einzelnen einneh-
men.
Die folgenden Ausführungen gehen näher auf den Wandel der Lernkulturen in der
heutigen Zeit ein. Zusätzlich wird ein Blick auf die internationale Ausgangslage ge-
worfen. Der theoretische Teil der vorliegenden Arbeit stellt vor allem informelles
Lernen im Unterschied zu non-formalen und formalen Lernprozessen dar. Was ist
informelles Lernen? Wo und wie findet es statt? Welche unterschiedlichen Aspekte
beinhaltet das informelle Lernen? Schließlich wird ein Ausschnitt der Diskussion um
den Kompetenzbegriff und die Kompetenzentwicklung eingehender betrachtet. Ein
weiteres Kapitel wendet sich speziell dem Arbeitsplatz als Schauplatz informellen
Lernens zu. Der Lernort Arbeitsplatz ist vor allem auch im Hinblick auf die dort ent-
stehenden und benötigten Kompetenzen interessant.
Der praktische Teil untersucht konkret die informellen Lernprozesse am Arbeitsplatz
und versucht, arbeitsplatzrelevante Kompetenzen zu erfassen. Die Studie bedient sich
eines qualitativen Forschungsdesigns in Form einer Voruntersuchung durch einen
Fragebogen und einer direkt anschließenden Hauptuntersuchung anhand eines Lern-
tagebuches. Auf Grundlage der Lerntagebücher, welche die Mitarbeiter der Firma X
1
über den Zeitraum von vier Tagen geführt haben, und der Befragung durch den Fra-
gebogen wird informelles Lernen im Alltag und vor allem am Arbeitsplatz beleuch-
tet. Dazu zählen zum Beispiel die Unterweisung oder das Anlernen am Arbeitsplatz
1
Nachträglich anonymisiert
_____________________________________________________________
10
durch Kollegen, Vorgesetzte oder außerbetriebliche Personen, das Selbstlernen durch
Beobachten und Ausprobieren, selbst gesteuertes Lernen mit Hilfe computerunter-
stützter Selbstlernprogramme, die Nutzung von Lernangeboten und ähnliches im
Internet / Intranet, Qualitätszirkel und vieles mehr.
Die Fragebögen und Lerntagebücher wurden von Personen verschiedenen Alters,
Geschlechts und beruflicher Position bearbeitet. Das Datenmaterial wurde im Hin-
blick auf informelle Lernprozesse und -inhalte analysiert und anhand eines Katego-
riensystems inhaltsanalytisch ausgewertet.
Zusätzlich zu einer Zusammenführung der theoretischen Grundlagen und der Ergeb-
nisse aus der Praxis, werden denkbare Anpassungen des non-formalen Bildungsan-
gebotes an die informellen Lernstrukturen der Mitarbeiter und die daraus erworbenen
Kompetenzen dargestellt.
Auf der Grundlage von theoretischen Ausführungen zu den Themen informelles Ler-
nen und Kompetenzentwicklung, ergaben sich folgende zentrale Fragestellungen:
·
Inwieweit nutzen Arbeitnehmer informelle Lernformen am Arbeitsplatz?
·
In welchen Themenbereichen wird hauptsächlich informell gelernt?
·
Welche Kompetenzen entstehen aus informellen Lernprozessen?
·
Zeigen Führungskräfte andere Muster informellen Lernens als Nicht-
Führungskräfte?
·
Wie kann man informelle Lernprozesse mit formalen Angeboten ver-
knüpfen?
·
Wie muss der Arbeitsplatz auf Grundlage dieser Ergebnisse gestaltet wer-
den?
·
Wie könnten Lernstrukturen der Teilnehmer und das bestehende Bil-
dungsangebot aufeinander bezogen werden?
In der vorliegenden Arbeit wurde auf eine Differenzierung von männlichen und
weiblichen Bezeichnungen verzichtet. Die Personenbezeichnungen sind einheitlich
in der maskulinen Form aufgeführt, außer sie betreffen eine bestimmte Person oder
Personengruppe.
_____________________________________________________________
11
1
1
1
A
A
A
u
u
u
s
s
s
g
g
g
a
a
a
n
n
n
g
g
g
s
s
s
l
l
l
a
a
a
g
g
g
e
e
e
"Education is no longer the privilege of an elite or the concomitant of a particular
age: to an increasing extent, it is reaching out to embrace the whole of society and
the entire lifespan of the individual."
(Faure, 1972, S. 160)
1.1 Wandel der Lernkulturen
Der Austritt aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit (Immanuel Kant) erfolgt
durch Aufklärung und Lernen. Dies wiederum geschieht in einer allgemeinen Erst-
ausbildung, einer anschließenden Berufsausbildung oder einem Studium und wird
später eventuell durch institutionell organisierte Weiterbildungsmaßnahmen ergänzt
(vgl. Kirchhhöfer, 2000, S. 31). Dieses traditionelle Lernmodell aus der Zeit der
Aufklärung ist in der heutigen Informationsgesellschaft nicht mehr tragbar.
Gesellschaft und Wirtschaft befinden sich in einem ständigen, sich beschleunigenden
Wandel, der alle Lebensbereiche mit einschließt. Schlagwörter wie Globalisierung,
offene Märkte und Wissensmanagement verlangen neue Formen des Lernens. Die
Betrachtungsweise von Lernprozessen verschiebt sich von einem klassischen, wis-
sensvermittelnden Lernmodell hin zu neu strukturierten, kontinuierlichen und lebens-
langen Lernaktivitäten. Angeregt wurde die genauere Erforschung dieser neuen
Lernformen durch das ,,Europäische Jahr des lebenslangen Lernens", das die Europä-
ische Union 1996 einleitete (vgl. Bulmahn, In: Arbeitsgemeinschaft Qualifikations-
Entwicklungs-Management, 1999, S. 5). Um im Arbeitsleben erfolgreich bestehen zu
können, ist es nicht mehr ausreichend, sich auf die institutionellen Bildungswege zu
beschränken. Der alleinige Verlass auf die in Erstausbildung, Berufsausbildung oder
im Studium erworbenen Kompetenzen reicht nicht mehr aus. Ebenso wenig kann
eine sporadische Ergänzung durch den einen oder anderen weiterbildenden Kurs den
Arbeitnehmer von heute charakterisieren.
Die Erwerbsarbeit mit ihrem hohen zeitlichen Anteil an der Lebensgestaltung und als
,,wichtigste Sozialisationsinstanz des Erwachsenen" (Trier, 1998, S. 217) sollte dem
_____________________________________________________________
12
Einzelnen die Möglichkeit bieten, sich selbst entfalten und bestätigen zu können.
Dies fordert mehr Entscheidungskompetenz und Mitgestaltung im Arbeitsprozess
(Laur-Ernst / Gutschmidt / Lietzau, 1992).
Diese neue Situation stellt für den Arbeitnehmer eine gesteigerte Kompetenzanforde-
rung dar und verlangt einen verstärkten (Lern-)Einsatz des Individuums. Das heißt:
der Einzelne muss lernen. Er muss lernen, mit den neuen Anforderungen umzugehen
und lernen, sich in seinem Berufsleben fachlich, methodisch und arbeitsplatzüber-
greifend durchzusetzen. Das Lernen kann nicht allein auf die Erstausbildung und
institutionalisierte Weiterbildung beschränkt werden. Das Schlagwort des ,,lebens-
langen Lernens" ist aktiv in der Praxis zu leben.
Die Vorstellung von Lernprozessen ist heute weit weniger auf ein geradliniges und
eingeschränkteres Lernen festgelegt. Lernen hat die unterschiedlichsten Formen an-
genommen und ist im Gegensatz zu den traditionell relativ starren Strukturen flexib-
ler und individualisierter geworden (vgl. Abbildung 1).
Abbildung 1: Entwicklungstendenzen des Lernens in der Informationsgesellschaft
(Quelle: Kirchhöfer, 2000, S. 31)
Der Einzelne muss sich kontinuierlich selbständig und selbst organisiert um seine
Weiterbildung kümmern, mit dem Ziel, berufliche Qualifikationen zu fördern, Kom-
_____________________________________________________________
13
petenzen zu erwerben und sich in einer multikulturellen Gesellschaft behaupten zu
können. Lernfeldgrenzen werden aufgelöst: neben institutionalisierter Weiterbildung
werden Lernprozesse im Alltag, im Arbeitsprozess, im sozialen Umfeld sowie auch
multimediales Lernen immer wichtiger (Bulmahn, In: Arbeitsgemeinschaft Qualifi-
kations-Entwicklungs-Management, 1999). "Every individual must be in a position
to keep learning throughout his life. The idea of lifelong education is the keystone of
the learning society." (Faure, 1972, S. 181)
Immer mehr Unternehmen gehen dazu über, ihre Mitarbeiter stärker zu fördern und
sich ihrer Weiterbildung anzunehmen, so dass daraus ein stetiges Wachstum dieses
,,menschlichen Kapitals" entsteht. Firmen wollen nunmehr nicht nur den Einsatz der
,,Hände ihrer Mitarbeiter", sondern zusätzlich den Einsatz ,,des Verstandes" (Wat-
kins / Marsick, 1992, S. 288). Zur Bewältigung der gestiegenen Kompetenzanforde-
rungen an die Arbeitnehmer ist Lernen im Arbeitsprozess nötig. Lernen außerhalb
institutionalisierter Bildung, sogenanntes informelles Lernen, gewinnt immer mehr
an Bedeutung. Es bedarf jedoch einer allgemeinen Anerkennung des lebenslangen
Lernens des kontinuierlichen Lernens im Alltag wie auch in der Erwerbstätigkeit
um Zielen wie zum Beispiel der persönlichen Entwicklung des Einzelnen, dem sozia-
len Zusammenhalt und wirtschaftlichem Wachstum näher zu kommen. Hierfür sind
gemeinsame Strategien der Arbeitgeber und Arbeitnehmer nötig. (vgl. OECD, 1996,
S. 87)
Neben formalen Bildungsangeboten müssen informelle Lernprozesse viel mehr ange-
regt und genutzt werden, damit der Einzelne die Flut der Anforderungen adäquat zu
bewältigen weiß und seine Kompetenzen kontinuierlich stärken und weiterentwi-
ckeln kann. Im internationalen Vergleich hinkt Deutschland in der Erforschung und
vor allem in der praxisnahen Anerkennung des informellen Lernens anderen Ländern
hinterher.
_____________________________________________________________
14
1.2 Ausgangslage im internationalen Vergleich
Das informelle Lernen wurde Anfangs hauptsächlich im Hinblick auf die Bildungs-
entwicklung der ,,Dritten Welt" diskutiert. In industrialisierten Ländern spielt vor
allem die formale Ausbildung in Schulen und Universitäten eine Rolle, wohingegen
in den weniger industrialisierten Ländern mehr auf informelle Lernzusammenhänge
zurückgegriffen werden muss, meist aufgrund fehlender oder nicht ausreichender
Ressourcen. (Overwien, 1999)
Doch auch in den industrialisierten Staaten nimmt die Bedeutung des informellen
Lernens in der Bildungsdiskussion zu. Hierzulande wurde informelles Lernen das
erste Mal im Zusammenhang um die Debatte des lebenslangen Lernens beachtet. Der
Unesco-Bericht (Faure, 1972) hielt fest, dass informelles Lernen ungefähr 70% allen
menschlichen Lernens umfasse. Gemeint sind Lernprozesse außerhalb organisierter
Zusammenhänge und in sehr unterschiedlichen Bereichen des Lebens
(Overwien, 1999).
Deutschland kann dem internationalen Vergleich jedoch kaum standhalten, wenn
Entwicklung und Erforschung des informellen Lernens in vergleichbaren europäi-
schen und außereuropäischen Ländern betrachtet werden (Dohmen, 2001).
In den USA wird das außerschulische Lernen schon länger in höherem Maße ernst
genommen. Vielleicht ist ein Grund hierfür die Berufsbildung, die sich noch stärker
am praktischen Lernen am Arbeitsplatz orientiert als zum Beispiel das duale System
in Deutschland. Mit Malcolm Knowles und seinen Arbeiten wurde das informelle
Lernen in den 50er Jahren ein wichtiger Faktor in der amerikanischen Wissenschaft.
(ebd.)
Fast jede Hochschule in den USA bietet ein ,,Prior Learning Assessment" (PLA) an.
Alternativ zum theoretischen Studium können hier über mehrere Jahre hinweg Punk-
te für bereits erworbene Erfahrungen gesammelt werden. So kann jeder einen allge-
mein gültigen Abschluss erwerben. (Klünsch, 2002)
Nicht nur die USA haben schon länger Methoden gefunden, das Lernen außerhalb
institutionalisierter Bildung zu bewerten und zu honorieren. Dies ist auch Ländern
_____________________________________________________________
15
wie zum Beispiel Frankreich, Großbritannien und Kanada gelungen, die schon er-
probte Zertifikate zur formalen Anerkennung informell erworbener Kompetenzen
entwickelt haben. Seit 1985 kann sich zum Beispiel jeder französische Bürger kos-
tenlos ein Kompetenzgutachten ausstellen lassen, das seine informell erworbenen
Kompetenzen auflistet und diese bewertet. (Klünsch, 2002)
In Kanada entstand 1998 eine wichtige landesweite Studie zu informellem Lernen.
Das Forschungsnetzwerk NALL ,,New Approaches to Lifelong Learning" (URL:
http://www.oise.utoronto.ca/depts/sese/csew/nall/) untersuchte unter der wissen-
schaftlichen Leitung von David Livingstone die Beteiligung und Anerkennung in-
formellen Lernens. Es wurden die vier Bereiche Beruf, ehrenamtliche Tätigkeiten in
der Gemeinde, Haushalt und andere Interessensgebiete in die Studie mit einbezogen.
(Livingstone, 2002)
Kanada versucht einen Umschwung von der Ausrichtung der Kompetenzen auf spe-
zifische betriebliche Anforderungen hin zu einer Anpassung betrieblicher Anforde-
rung auf vorhandene, vor allem auch informell erworbene Kompetenzen. Diese in-
formell erworbenen Kompetenzen liegen in der Erwerbsarbeit oft brach, werden vom
Arbeitgeber nicht anerkannt und vom Arbeitnehmer nicht genutzt. (Dohmen, 2001)
Das Erfassen, Bewerten und die Anerkennung von informell erworbenen Kompeten-
zen wird im Prozess des ,,Prior Learning Assessment and Recognition" (PLAR) vor-
genommen. Als Instrument zur Aufzeichnung und Dokumentation von Lernstilen
und -strategien Erwachsener wurde das Skills and Knowledge Profile (SKP) entwi-
ckelt. (Ontario Institute for Studies in Education/University of Toronto, 1998)
Auch in Großbritannien ist das Lernen außerhalb von Bildungsinstitutionen schon
länger ein Thema. Verschiedene Institute (zum Beispiel Department for Education
and Employment (DfEE), Economic & Social Research Council (ESRC), National
Institute of Adult Continuing Education (NIACE)) erforschen in unterschiedlichen
Projekten das informelle Lernen. Die Anerkennung außerschulisch erworbener
Kompetenzen ist auch hier beispielsweise mit dem ,,National Vocational Qualificati-
on"-System (NVQ) (zum Beispiel URL: http://www.dfes.gov.uk/nvq/) schon einen
Schritt weiter.
_____________________________________________________________
16
2
2
2
K
K
K
o
o
o
n
n
n
z
z
z
e
e
e
p
p
p
t
t
t
i
i
i
o
o
o
n
n
n
e
e
e
n
n
n
u
u
u
n
n
n
d
d
d
D
D
D
e
e
e
f
f
f
i
i
i
n
n
n
i
i
i
t
t
t
i
i
i
o
o
o
n
n
n
e
e
e
n
n
n
d
d
d
e
e
e
s
s
s
i
i
i
n
n
n
f
f
f
o
o
o
r
r
r
m
m
m
e
e
e
l
l
l
l
l
l
e
e
e
n
n
n
L
L
L
e
e
e
r
r
r
n
n
n
e
e
e
n
n
n
s
s
s
"The new educational ethos makes the individual the master and creator of his own
cultural progress. Self-learning, especially assisted self-learning, has irreplaceable
value in any educational system."
(Faure, 1972, S. 209)
Es ist nicht einfach, Lernen in bestimmte Kategorien einzuteilen. Für die weitere
Auseinandersetzung mit dem Thema, werden nun mögliche Definitionen informeller
Lernprozesse gegeben, deren Grenzen unter Umständen jedoch fließend sind.
2.1 Abgrenzung zu anderen Lernformen
Das informelle Lernen ist eine Lernform, die vom formalen Lernen und non-
formalen Lernen unterschieden wird. In der Literatur gibt es verschiedene Definiti-
onsansätze zu diesen Begriffen.
Einerseits wird das formale Lernen als das Lernen in der anerkannten Ausbildungs-
laufbahn, also in öffentlichen Bildungsinstitutionen gesehen. Davon unterscheidet
sich das non-formale Lernen als ein Lernen in organisierten Kursen oder Seminaren,
jedoch außerhalb des formalen Schulsystems. Gemeint sind hier meist kurzzeitige
und freiwillig gewählte Programme in Bildungseinrichtungen wie zum Beispiel der
Volkshochschule, in Betrieben oder sozialen Einrichtungen.
Das informelle Lernen ist davon abgegrenzt und beinhaltet jegliches Lernen, das au-
ßerhalb von Bildungseinrichtungen egal ob staatlich, privat oder sozial geschieht.
(Schugurensky, 2000)
Andererseits kann formales Lernen als gesellschaftlich anerkanntes und organisiertes
Lernen in Bildungsinstitutionen gesehen werden, sei es nun das Lernen innerhalb der
_____________________________________________________________
17
Schullaufbahn oder der Besuch eines Seminars zum Beispiel an der Volkshochschu-
le.
Im Gegensatz dazu ist der Begriff non-formales Lernen ein Überbegriff für alle Lern-
prozesse außerhalb geplanter Bildung, beinhaltet also auch informelles Lernen.
(Dohmen, 2001)
David Livingstone (2001) definiert diese einzelnen Lernformen über den Anteil der
direktiven Kontrolle im Lernprozess. Sobald ein Lehrer über die Autorität verfügt,
den Schüler vor dem Hintergrund eines vorgegebenen Lehrplans zu unterrichten und
entscheiden zu können, welches Wissen der Schüler aufzunehmen hat, spricht Li-
vingstone von formaler Bildung.
Sobald der Lerner von sich aus entscheidet, weiteres Wissen oder zusätzliche Fähig-
keiten zu erlangen und dies mit Hilfe eines Lehrers oder Trainers anhand eines orga-
nisierten Lehrplanes in die Tat umsetzt, handelt es sich um non-formale Bildung.
Informelle Bildung ist laut Livingstone ein eher spontanes, zufälliges Lernen ohne
organisierte Vorgaben, das zusammen mit einem Lehrer oder Mentor stattfindet. Ein
Anleiten zum Erwerb von berufsbezogenen Fähigkeiten oder ein Begleiten in Ent-
wicklungsprozessen der Gemeinde sind Beispiele dafür.
Im Unterschied zu informeller Bildung handelt es sich bei informellem Lernen um
jegliche Aktivität, die ein Verstehen oder das Aneignen von Wissen oder von Fähig-
keiten außerhalb fremd-organisierter Lehrpläne verfolgt und ohne direkten Lehrerbe-
zug abläuft. Der Lerner handelt in eigener Verantwortung und auf eigenen Antrieb.
(ebd.)
Eine zusammenfassende Tabelle (vgl. Abbildung 2, S. 18) von Ash / Klein (In:
ILER-Newsletter, 1998) führt unterschiedliche Charakteristika des informellen und
formalen Lernens auf. Es werden verschiedene Kategorien wie zum Beispiel der so-
ziale Kontext, die Interaktion, die Zeitkomponente und die Bewertung der Lerner-
gebnisse betrachtet.
_____________________________________________________________
18
Abbildung 2: Compared Characteristics of Learning Experiences
Informal
Formal
Affect / choice
fun, enjoyable, playful
voluntary
personal experience
repetitive
mandatory
group experience
Medium
visually oriented
real objects
authentic tasks
text oriented
models and manipulatives
tasks for teacher
Social context
social groups,
individuals learning together
cooperative activities
learner direct
multi-generational experiences
whole group instruction
individual student work
teacher direct
one age group
Interaction
highly interactive, learning by doing
multi-dimensional interactions
process oriented
didactic
variable levels
topic oriented
Motivation
self directed
intrinsic motivation
"flow" experience
other directed
extrinsic motivation
boredom and anxiety
Time
short term, self-paced
open-ended
life-long
long term, teacher sets pace
limited
isolated lesson or longer unit
Assessment
self assessment
based on feedback
formal assessment
Structure
non-structured
non-linear
bottom-up
highly structured
linear, sequential
top-down
Philosophy
practice to theory
theory to practice
Quelle: Ash, D. / Klein, C. (1998). Inquiry in informal learning environments. Manuscript in prepara-
tion. In: ILER-Newsletter, 1998
_____________________________________________________________
19
Informelles Lernen zeichnet sich demnach durch Freiwilligkeit und spielerische E-
lemente aus. Es beschäftigt sich mit realen Lernobjekten und authentischen Aufga-
ben, wohingegen formales Lernen aus Aufgaben besteht, die für den Lehrer zu erle-
digen sind und an Modellen und Texten geschieht.
Der soziale Kontext ist unter anderem aus mehreren Generationen zusammengesetzt
und die Kontrolle über das Lernen geht eindeutig vom Lerner selbst aus. In formalen
Lernsituationen gibt der Lehrer die Inhalte vor und richtet seine Instruktionen an eine
einheitliche Altersgruppe. (Ash / Klein, 1998)
Informelles Lernen entwickelt sich aus intrinsischer Motivation und kann bei Lerner-
folg und Bewältigung selbst gestellter Aufgaben eine Art ,,flow"-Erlebnis hervorru-
fen. Im Gegensatz zu formalem Lernen sind einzelne informelle Lernprozesse oft
von kurzer Dauer, das heißt, sie beschäftigen sich in kurzen Abschnitten mit einem
bestimmten Thema, das dann auch wieder fallen gelassen werden kann, und sie fol-
gen dem vom Individuum vorgegebenen Lerntempo. Sie sind jedoch auf lange Sicht
ohne ein vorgegebenes Ende und dauern ein Leben lang. Themen werden immer
wieder aufgegriffen und neue Bereiche angegangen. Diese Themen eignet sich der
Lerner durch interaktives Handeln und ,,learning by doing" an. Die Interaktion findet
in den unterschiedlichsten Dimensionen statt, ist stark prozessorientiert, nicht struk-
turiert und nicht linear. (vgl. Abbildung 2, S. 18)
Ute Laur-Ernst definiert formalisiertes und informelles Lernen über die Begriffe
,,Angebot" und ,,Nachfrage" (Laur-Ernst, 2000b, S. 58). Das Angebot (Weiterbil-
dungsveranstaltungen, VHS-Kurse, Bildungsangebote, etc.) wird von Institutionen
oder vom Staat vorgegeben das Lernen findet also in formalem Rahmen statt.
Im Gegensatz dazu wird aufgrund persönlicher und individueller Nachfrage das in-
formelle Lernen angeregt. Bedingt durch Wissenslücken oder mangelnde Fähigkei-
ten, vorhandenes Interesse an einem bestimmten Bereich oder fehlenden Kompeten-
zen, beschäftigt sich das Individuum bewusst mit einem oder mehreren Themen, um
diese Defizite auszugleichen und Informationen zu erhalten. In diesem Fall findet
bewusstes und daher meist geplantes und selbst organisiertes informelles Lernen
statt. (ebd.)
_____________________________________________________________
20
,,Informelles Lernen gehört zum Lernkontinuum. Es ist kein in sich geschlossenes
Paket und keine genau abzugrenzende Kategorie." (Livingstone, 1999, S. 71)
In den weiteren Ausführungen soll der Definitionsrahmen Schugurenskys (2000)
verwendet werden. Informelles Lernen wird demnach, im Gegensatz zu formalen
oder non-formalen Lernprozessen, als ein Lernen außerhalb jeglicher Bildungsein-
richtungen und ohne Kurs- oder Seminarorganisation aufgefasst.
Informelles Lernen selbst beinhaltet unterschiedliche Aspekte und muss aus ver-
schiedenen Perspektiven betrachtet werden. Es reicht von unbewussten, beiläufigen,
bis hin zu geplanten, selbst organisierten Lernprozessen. Livingstone (2002) ver-
gleicht informelles Lernen mit einem Eisberg: der größte Teil liegt unter Wasser ver-
borgen, in seiner Gesamtheit betrachtet, nimmt es jedoch enorme Ausmaße an.
Unterschiedliche Konzeptionen und Aspekte des informellen Lernens sollen nach-
folgend genauer beleuchtet werden.
2.2 Unterschiedliche Konzeptionen und Aspekte
2.2.1 Informelles Lernen bewusst und unbewusst
Jede Form von Lernen hat immer sowohl eine bewusste wie auch eine unbewusste
Komponente. In informellen Lernprozessen ist die unbewusste Komponente jedoch
stärker vertreten als in formalen Lernprozessen. Nachdem formales Lernen in Bil-
dungsinstitutionen stattfindet und Wissenszuwachs und Lernfortschritt zum Ziel hat,
ist das Lernen dort ein bewusstes Element. Im Rahmen des informellen Lernens kann
das Lernen bewusst vom Lerner gesteuert oder bewusst aufgenommen werden, es
kann jedoch auch unbewusst und beiläufig geschehen. Informationen werden in die-
sem Fall im Gedächtnis gespeichert, sind jedoch nicht sofort abrufbar und bewusst
und können so auch schwierig ausgedrückt werden. Dieses Wissen wird als träges
Wissen, tacit knowledge oder auch implizites Wissen bezeichnet (Livingstone, 2001;
Polany, In: Staudt / Kley, 2001).
_____________________________________________________________
21
Beiläufiges Lernen
Victoria Marsick und Karen Watkins, zwei amerikanische Professorinnen, stellten
1992 eine Theorie des informellen und ,,incidental learning" auf. ,,Incidental lear-
ning" wird im nachfolgenden Text als ,,beiläufiges Lernen" bezeichnet.
Sie definieren beide Lernformen als ein Lernen durch Erfahrung. Dabei zeigt sich als
wichtiger Faktor, dass die Erfahrung außerhalb gewohnter und organisierter Struktu-
ren stattfindet. In neuartigen Situationen wird eine Art Überraschungseffekt, wenn
nicht sogar eine Art des Unbehagens ausgelöst, aufgrund dessen ein Reflektieren
über die bereits gemachten Erfahrungen angeregt wird. Reflektion und die Erkennt-
nis, einer neuartigen Situation gegenüberzustehen führt wiederum zu Informations-
suche und einer Erweiterung bzw. Veränderung des eigenen Denkens und Verhal-
tens. Daraus entsteht laut Theoretikern wie Kolb, Jarvis und Dewey Lernen
(Watkins / Marsick, 1992).
Das informelle Lernen kann sowohl geplant als auch ungeplant, also zufällig, erfol-
gen, zeigt jedoch normalerweise im Gegensatz zu reinem beiläufigen Lernen immer
eine gewisse Art bewusster Beteiligung. Der Lernende weiß, dass in diesem Moment
Lernen geschieht. Das beiläufige Lernen ist dagegen ,,embedded in people's closely
held belief systems" (ebd., S. 288). Es ist ein Nebenprodukt anderer Handlungen und
ist dem Lernenden nicht bewusst. Beiläufiges Lernen ist als ungeplantes, meist unre-
flektiertes Lernen ohne Ziel zu charakterisieren. Die Ergebnisse des Lernens können
jedoch meist nur in Handlungen zum Ausdruck gebracht werden, da sie unreflektiert
bleiben. (ebd.)
,,Unintentional adult learning is a fact of life for everyone; it is a concomitant of liv-
ing" (Peterson, 1979, In: Collins, 1996). Sowohl das informelle wie auch dessen Un-
terkategorie, das beiläufige Lernen (Watkins / Marsick, 1992), sind Lernprozesse, die
in den alltäglichen Ablauf eingebettet sind.
Lernprozesse laufen in beiden Fällen ohne großartige Planung und Struktur ab. Sie
unterscheiden sich jedoch durch den Grad des Bewusstseins des Lernvorgangs
(ebd.).
_____________________________________________________________
22
Beiläufiges Lernen birgt immer die Gefahr, dass falsche Handlungsweisen oder In-
formationen aufgenommen werden, die sich durch ihren unbewussten Charakter fes-
tigen können, ohne berichtigt zu werden. Nicht jedes beiläufige Lernen ist effektiv
und zeigt Ergebnisse. Damit durch beiläufige Lernprozesse wirkliches Lernen ge-
schieht, muss die Aufmerksamkeit auf die meist in der Interaktion versteckten ,,er-
lernten" Informationen gelenkt werden. Dem Einzelnen müssen sie verdeutlicht und
von ihm eventuell berichtigt werden (Dohmen, 2001). Doch wie können unbewusste
Prozesse explizit bewusst gemacht werden, damit der Lerner diese reflektieren kann?
Zwei Punkte sind wichtig, um aus beiläufig gemachten Erfahrungen auch zu lernen
und nicht nur Erfahrungen zu sammeln. Das heißt, nicht nur unbemerkt und nebenbei
zu erfahren, sondern bewusst einen Lernprozess anzuregen. Es handelt sich hierbei
um die zwei Komponenten ,,Handlung" und ,,Reflektion". (Watkins / Marsick, 1992)
Folgende Grafik verdeutlicht den Stellenwert von Handlung und Reflektion in
formalen, informellen und beiläufigen Lernprozessen.
Abbildung 3: Handlung und Reflektion in Lernprozessen
Reflektion vorhanden
Reflektion nicht vorhanden
Handlung vorhanden
Informelles Lernen
Beiläufiges Lernen
Handlung nicht vorhanden
Formales Lernen
Kein Lernen
(vgl. Watkins / Marsick, 1992, S. 290)
Handlung stellt in diesem Fall die aktive Umsetzung der Erfahrungen dar. Sobald das
Individuum ob nun bewusst oder eher unbewusst die gemachten Erfahrungen,
Beobachtungen oder Erkenntnisse in der Praxis anwendet, findet Lernen statt. In
formalen Lernsituationen ist die Handlung zunächst abwesend, jedoch wird schon
während des Lernprozesses das Gelernte reflektiert, da es sich um ein rein geplantes
und organisiertes Lernen handelt.
_____________________________________________________________
23
Um das beiläufige Lernen als einen Subtyp des informellen Lernens deutlicher zu
machen, hier ein paar Beispiele für beiläufige Lernprozesse:
Lernen aus Fehlern, Austesten interpersoneller Beziehungen und das Internalisieren
der Bedeutung von Handlungen anderer Personen (vgl. ebd., S. 291).
Informelles Lernen weist neben den unbemerkten Komponenten, also dem erwähn-
ten beiläufigen Lernen, zusätzlich andere Elemente der Beiläufigkeit auf. Informelles
Lernen zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass es meist ohne großartige Pla-
nung abläuft. Der Lerner beschäftigt sich nebenbei also sozusagen beiläufig mit
bestimmten Inhalten. Diese Beiläufigkeit bedeutet in den meisten Fällen, dass keine
explizite Planung der Vorgehensweise und der genauen Themeninhalte durch den
Lerner vorliegt. Diese ergeben sich in der Praxis oft spontan und werden aufgrund
sich erschließender Informationen individuell erweitert und angepasst. Informelle
Lernprozesse können jedoch auch explizit vom Lerner geplant sein. Vielleicht könnte
man deshalb über informelles Lernen treffender sagen, dass es ohne großartige Pla-
nung von Seiten anderer stattfindet. Denn informelle Lernprozesse zeichnen sich in
erster Linie durch ihre Unabhängigkeit von durch andere organisierte Lernaktivitäten
aus.
Informelles Lernen ist ein Mittel zum Zweck. Es wird eingesetzt als Maßnahme, (au-
ßerschulische) Probleme zu lösen, Situationen zu bewältigen und Lebensanforderun-
gen zu begegnen. Der Zweck ist nicht das Lernen selbst, sondern ,,die bessere Lö-
sung" (Dohmen, 2001, S.19) der Aufgabe.
Implizites Lernen
Ebenfalls als nicht-bewusstes und nicht-intentionales Lernen wird das implizite Ler-
nen bezeichnet. Auch dieses Lernen findet außerhalb formalisierter Lernveranstal-
tungen statt und ist eher auf das Lösen von Problemen und auf erfolgreiche Hand-
lungsstrategien ausgerichtet, als auf die explizite Beschäftigung mit Theorien und
dem Lernen an sich. Deshalb wird informelles Lernen oft auch als implizites Lernen
bezeichnet. (ebd.)
_____________________________________________________________
24
Implizites Lernen ist ein nicht verbalisierbares Lernen. Gemeint sind damit Lernvor-
gänge, die zum einen vom Einzelnen nicht als Lernen erkannt werden und zum ande-
ren nicht so leicht greifbar gemacht werden können. Beispiele dafür sind das Erler-
nen von Essensgewohnheiten von Kindern (sie lernen in unserer Kultur zum Bei-
spiel, keine Insekten zu essen) oder der Erwerb von Geschicklichkeit in einem be-
stimmten Spiel, das über Jahre hinweg regelmäßig unter Freunden gespielt wird.
Dem Lerner ist in diesen Fällen nicht bekannt, dass etwas gelernt wurde, doch drü-
cken sich die Lernergebnisse im Verhalten aus. (Schugurensky, 2000)
Das Gelernte kommt in Handlungen zum Vorschein und wird auch als implizites
Wissen (vgl. Polany, 1985, In: Staudt / Kley, 2001, S. 235) bezeichnet. Implizites
Wissen ist ein Wissen, das sich vor allem im Kompetenzerwerb und in Erfahrungen
widerspiegelt, ganz anders als ein Wissen, das rein aus der Aufnahme von Fakten
und Regeln erworben wurde (Dohmen, 2001).
Ebenso wie das informelle Lernen ist das implizite Lernen in alltägliche und ganz-
heitliche Umwelterfahrungen integriert. Eine Förderung solcher Lernprozesse ist
deshalb am besten durch Übung, Nachahmen, Spielen und unterschiedliche Aufga-
ben zu erreichen (vgl. ebd., S. 34).
Das implizite Lernen kann nicht mit informellem Lernen gleichgesetzt werden, da
das informelle Lernen weit über das hinausreicht, was implizites Lernen ausmacht.
Durch den hohen Grad der Unbewusstheit bei impliziten Lernvorgängen ist es jedoch
dem unbewussteren Teil des informellen Lernens, also dem beiläufigen Lernen, ähn-
lich. Das beiläufige Lernen zeichnet sich jedoch gegenüber dem impliziten Lernen
durch einen relativ höheren Grad der Bewusstheit aus (ebd.).
Selbstgesteuertes Lernen
Für einen erfolgreichen Lerner ist es wichtig, den Weg von einem oft unbewussten
und zufälligen informellen Lernen hin zu einem zunehmend bewusster werdenden,
selbst gesteuerten Lernen zu gehen.
Selbstgesteuertes Lernen wird von Knowles als ,,aktives, selbstbestimmt-
nachfragendes Lernen im Austausch mit anderen auch mit Beratern, Helfern, ,faci-
litators', Informationsquellen etc." (In: Dohmen, 2001, S. 39) verstanden.
_____________________________________________________________
25
Selbstgesteuertes Lernen ist insofern verwandt mit informellen Lernprozessen, als
dass auch hier die Lernenden selbst über Ziele und Inhalte ihres Lernens bestimmen
und in diesem Rahmen auch entscheiden können, ob und in welchem Ausmaß sie auf
organisierte und institutionelle Lernangebote zurückgreifen möchten. Lernort, Zeit-
punkt, Ressourcen und Methoden sowie auch eventuelle Lernpartner werden vom
Lernenden selbst organisiert und gewählt. (Kraft, 1999)
Informelles Lernen und selbstgesteuertes Lernen berühren sich in ihren Eigenschaf-
ten als ein von ,,organisierter Fremdsteuerung unabhängiges Lernen" (Dohmen,
2001, S. 41). Der Lerner verfügt sowohl bei selbstgesteuerten wie auch bei informel-
len Lernprozessen über die Entscheidungsgewalt hinsichtlich Inhalt, Methode und
Ablauf. Selbstgesteuertes Lernen ist jedoch zu jeder Zeit bewusst, wohingegen in-
formelles Lernen neben den bewussten, selbst gesteuerten Komponenten einen deut-
lich höheren Anteil an Unbewusstheit aufweisen kann.
Voraussetzungen, die der Lernende für das selbstgesteuerte Lernen mitbringen muss,
betreffen sowohl den kognitiven Bereich, wie auch motivationale Komponenten.
Kognitive Voraussetzungen gehen über Inhalts-, Aufgaben- und Strategiewissen hin
zu Informationsverarbeitungsstrategien, Kontroll- und Ressourcenstrategien. Im mo-
tivationalen Bereich werden sowohl Bedürfnisse, Interessen, Ziele und Selbstwirk-
samkeit genannt wie auch selbstwerterhaltende Strategien und emotionale Prozesse.
(Friedrich / Mandl, 1995)
Diese Voraussetzungen für selbstgesteuertes Lernen können ebenso für informelle
Lernprozesse übernommen werden. Informelles Lernen ist in seiner Natur unabhän-
gig von formalen und institutionellen Bildungsangeboten und bedarf daher ebenfalls
eines hohen motivationalen Antriebs, sobald es vom Lerner bewusst ausgeübt und
auf ein Ziel hin verfolgt wird. Ebenso sind kognitive Voraussetzungen wie Strategie-
und Aufgabenwissen notwendig, um mit Lerninhalten erfolgreich umgehen zu kön-
nen, ohne den Rückhalt aus institutionellen Lehrveranstaltungen zu haben.
Aus den vorhergehenden Ausführungen ist zu erkennen, dass das informelle Lernen
sowohl bewusste wie auch unbewusste Komponenten besitzt und mit Lernformen
wie dem impliziten oder selbstgesteuerten Lernen verglichen werden kann. Das bei-
_____________________________________________________________
26
läufige Lernen kann als die unbewusste Form des informellen Lernens bezeichnet
werden.
2.2.2 Informelles Lernen Lernen im Alltag
Moll und Greenberg (ILER Newsletter, 1998) sehen jeden Haushalt als ,,in a very
real sense, an educational setting in which the major function is to transmit knowl-
edge that enhances the survival of its dependents."
Das informelle Lernen findet per definitionem außerhalb formaler und institutioneller
Bildungseinrichtungen statt, das heißt unter anderem auch in alltäglichen settings, sei
es nun der Beruf, der private und familiäre Bereich oder der alltägliche Lebensab-
lauf. Mit seinen Eigenschaften als selbstverständliches und praktisches Lernen ist das
informelle Lernen in gewisser Weise ein Alltagslernen. (Dohmen, 2001)
Vor allem im Zusammenhang mit dem "incidental learning" dem beiläufigen Ler-
nen wird gesagt, dass kein Tag vergehe, an dem wir nicht lernen würden: ,,It is
impossible to live a day without learning something." (Mealman, 1993).
Meist finden beiläufige Lernprozesse statt, während man in geplantes Lernen einbe-
zogen ist. Neben den beabsichtigten Lerninhalten nimmt man dort zusätzlich unge-
plante Informationen auf. Das beiläufige Lernen ist nichtsdestotrotz die alltäglichste
Form des informellen Lernens und findet im Prinzip in den unterschiedlichsten Kon-
texten statt. (Mealman, 1993)
Abzugrenzen von informellem Alltagslernen sind jedoch die allgemeinen Alltags-
wahrnehmungen. Das informelle Alltagslernen zeichnet sich gegenüber allgemeinen
Alltagswahrnehmungen durch einen relativ stärkeren bewussten Umgang mit dem
erworbenem Wissen aus. Informationen werden nicht nur wahrgenommen, sondern
so verarbeitet, dass Lernen stattfindet. (Livingstone, 1999)
Der Alltag wird immer mehr zu einem Umfeld, in dem komplexe Handlungsabläufe
ihren Platz haben. Im Umgang mit den alltäglichen Situationen entstehen aufgrund
der Anforderungen und Komplexität zunehmend auch arbeitsplatzrelevante Kompe-
tenzen. Informelles Lernen ergibt sich vor allem in Situationen, in denen bewährte
Strategien nicht greifen, in denen keine Handlungsmuster vorgegeben sind, techni-
_____________________________________________________________
27
sche, zwischenmenschliche oder andere Probleme auftreten oder neue Verhaltens-
weisen erforderlich sind (Kirchhöfer, 2000). Als informelle Lernfelder können be-
sonders Ehrenämter, Erziehungsarbeit, Hauswirtschaftsorganisation, Doppelbelas-
tungsmanagement, Budgetverwaltung, Umgang mit Medien und Haushaltstechniken,
Beschäftigung mit Rechts-, Steuer- und Finanzierungsfragen, Funktionen in Verei-
nen, Nachbarschaft, Urlaubsplanung, Sprachen lernen, Diskussion und Kooperation
etc. (vgl. Kirchhöfer, In: Dohmen, 2000, S. 130) hervorgehoben werden. Vor allem
in diesen Bereichen entstehen durch informelles Lernen Kompetenzen, die übergrei-
fend, also auch am Arbeitsplatz eingesetzt werden können.
Informelles Lernen als alltägliches Lernen hat jedoch auch seine Tücken. Die Gefahr,
die in beiläufigem und alltäglichem Lernen liegt, besteht darin, nebenbei Informatio-
nen, Ansichten und Wissen aufzuschnappen, ohne weiter zu hinterfragen oder ohne
sich dessen überhaupt aktiv bewusst zu sein. So können falsche Informationen, An-
sichten oder Wissensbausteine abgespeichert und schwieriger bewusst revidiert wer-
den. Richtige oder vielleicht noch unvollständige Informationen liegen als ,,tacit
knowledge" brach und werden nicht aktiv und praktisch genutzt. Wichtig ist der be-
wusste Umgang mit alltäglichem informellem Lernen und dessen bewusste Reflekti-
on. (Laur-Ernst, 2000b)
Informelles Lernen ist ,,prinzipiell nicht zu verhindern" (ebd., S. 59). Es geschieht
überall in den unterschiedlichsten Lebenszusammenhängen. Wie und wie gut der
Einzelne informell lernt, geht auf individuelle Dispositionen wie Motivation, Kogni-
tionsstruktur und Kompetenzstand zurück. (ebd.)
In der Bildungsdiskussion besteht ein Spannungsverhältnis zwischen den Anteilen
des ,,realitätsabgehobenen fachsystematischen Wissen" und dem eingeschränkten
Umgang mit alltäglichen ,,pragmatisch-problembezogenen" Alltagserfahrungen
(Dohmen, 2001, S. 38). Sowohl der Einzelne wie auch die Bildungsinstitutionen
müssen einen Weg finden, beide Seiten zu verbinden und Alltagserfahrungen und
theoretisch fundiertes Wissen in ein ausgewogenes Gleichgewicht zu bringen. (Nähe-
res hierzu in Kapitel 7)
_____________________________________________________________
28
2.2.3 Informelles Lernen Lernen durch Erfahrung
Wie bereits erwähnt, geschieht Lernen durch Erfahrung vor allem in fremden und
neuen Situationen. Aus der Handlungsforschung ist bekannt, dass man eher lernt,
wenn ein Überraschungseffekt vorhanden ist, man sich also nicht in gewohnter Ma-
nier verhalten kann. In unbekannten Situationen kann nicht auf bewährte Routinen
zurückgegriffen werden, sondern an die neuen Tatsachen muss mit gesteigerter Auf-
merksamkeit herangetreten werden. Der Bedarf nach kritischer Reflektion ist in die-
sen Situationen größer und kritische Reflektion ist ein guter Nährboden für Lernpro-
zesse. (Watkins / Marsick, 1992)
Auf der anderen Seite kann man Erfahrungen nur dann generalisieren und abstrahie-
ren, wenn man sie mit bereits vorhandenen Informationen verknüpfen kann.
Was bedeutet der Begriff Erfahrung? Erfahrung setzt sich aus ,,Wissensbestandteilen,
die verknüpft sind mit Wissenselementen, welche sich auf das emotional-moti-
vationale System der handelnden Person beziehen" zusammen (Franke, 2001, S.43).
Durch die Verbindung der Wissenselemente mit dem emotional-motivationalen Sys-
tem spielen Emotionen bei erfahrungsbasiertem Wissen eine Rolle. Da der Einzelne
ständig Informationen und Eindrücken ausgesetzt ist, erweitert er laufend sein Wis-
sen und seine Erfahrungen (Franke, 2001). Aber Erfahrungen müssen weiterverarbei-
tet werden, um daraus Wissen zu machen bzw. um daraus zu lernen. Durch zum Bei-
spiel Verknüpfung mit schon vorhandenen Wissensbausteinen oder Abstraktion wird
Erfahrung in das bestehende Begriffssystem des Einzelnen integriert. Um themen-
oder bereichsübergreifende Erfahrungen zu machen und neue Begründungs-
zusammenhänge zu schaffen, müssen erfahrungsbasierte Informationen über Analo-
gien generalisiert und verknüpft werden. (vgl. ebd., S. 43ff)
Erfahrungslernen geschieht nach Hoffmann (1992, In: Franke, 2001) aufgrund des
Vergleichs bisheriger ähnlicher Erfahrung auf dem Weg zum erwünschten Ziel und
erfahrungsgemäß notwendigen Eigenschaften mit den realen Konsequenzen. Stim-
men diese überein, kann das Individuum davon ausgehen, dass es in Situationen die-
ser Art immer wieder zu diesen Konsequenzen kommen wird, das heißt, dass Abs-
traktionen und allgemeine Regeln erstellt werden können. Bestehende Verknüpfun-
gen zwischen Erwartung und Eintreten der Konsequenzen werden in diesem Fall
verstärkt. Bei Nichtübereinstimmung der erfahrungsgemäß erwarteten Konsequenzen
_____________________________________________________________
29
mit den real eintretenden wird dem Einzelnen bewusst, dass es sich um eine neue
Situation handelt und er nicht auf bewährte erfahrungsbasierte Vorgehensweisen
zurückgreifen kann. Hier muss der Einzelne handeln und reflektieren, um auch die
neue und unbekannte Situation bewältigen zu können. Hoffmann setzt bei jeglichen
Lernprozessen grundsätzlich Handlung voraus (vgl. Abbildung 3, S. 22).
Es ist also wichtig, sowohl in neuen, wie auch bekannten Situationen Eindrücke und
Informationen zu reflektieren und daraus zu lernen.
Ebenso ist bekannt, dass die Art und Weise, in welcher der Einzelne Informationen
und Eindrücke aufnimmt, das Erinnern beeinflusst. Informelles Lernen ist gekenn-
zeichnet durch Prozessorientierung und ,,learning by doing" (vgl. Abbildung 2,
S. 18), das heißt, der Einzelne führt selbst aus, probiert und versucht sich an einer
Lösung des Problems oder der Aufgabe. Wie in Abbildung 4 gezeigt, erinnert sich
der Mensch an 90 % dessen, was er selbst ausführt, 70 % dessen, was er sieht und
hört, wohingegen er lediglich 10 % von dem behält, was er nur liest.
Abbildung 4: Weg ins Gedächtnis Die Wahrnehmungsart beeinflusst das Erinnern
(Quelle: FOCUS, 21. Oktober 2002, S. 72)
Informelles Lernen wird oft mit Erfahrungslernen gleichgesetzt. Beide Lernformen
haben vieles gemeinsam, aber gleichgesetzt werden können sie nicht. Das informelle
Lernen kann jedoch von bereits bestehenden Erkenntnissen über das Erfahrungsler-
nen insofern profitieren, da beide Lernarten sehr eng verwandt sind und informelles
Lernen im Gegensatz zum Erfahrungslernen noch wenig erforscht ist.
(Dohmen, 2001)
_____________________________________________________________
30
Die Komponenten der Unmittelbarkeit und der Nicht-Organisation des informellen
Lernens erlauben eine Verarbeitung von Reizstrukturen, Informationen und Sinnes-
eindrücken, die als ,,quasi natürliches Erfahrungslernen" (Dohmen, 2001, S. 27) be-
zeichnet werden können. Informelles Lernen baut auf die Erfahrungen außerhalb
organisierter Bildung. Der Einzelne macht Erfahrungen und mit jeder Erfahrung, die
er macht, lernt er etwas dazu, wenn diese Erfahrungen untereinander verglichen und
schließlich verallgemeinert werden können (Hoffmann, 1992, In: Franke, 2001).
Erfahrungen bilden den Ausgangspunkt für Lernen. In der neuen, informellen Lernsi-
tuation können zurückliegende Erfahrungen immer wieder aufgegriffen und genutzt
werden. (Dybowski, 1999)
Von diesem natürlichen und ,,informellen" Erfahrungslernen ist jedoch das formal
organisierte und unter pädagogischen Aspekten strukturierte Erfahrungslernen abzu-
grenzen. Denn gerade diese Art des Lernens wird in Betrieben im Rahmen der Be-
rufsausbildung und unter dem Standpunkt der arbeitsnahen und handlungsorientier-
ten Funktionen von Lernen geplant und eingesetzt (Laur-Ernst, 2000b). Außerhalb
formalisierter und organisierter Bildungsangebote kann sich das informelle Erfah-
rungslernen zum Beispiel im Prozess der Arbeit entwickeln.
Informelles Lernen muss jedoch ergänzt werden durch formal erworbenes Fachwis-
sen alleine auf Erfahrungen zu bauen, ist in der Entwicklung von Kompetenzen zu
wenig. Formal erworbenes Wissen dient als Hintergrund zur ,,Interpretation und
Deutung der sinnlichen Wahrnehmung" (Dybowski, 1999, S. 19) der realen Situati-
on.
Wichtig ist es, das informelle Lernen nicht auf sich alleine gestellt zu lassen. Eine
Verbindung mit formalem Lernen würde sich im Kompetenzerwerb als durchaus
fruchtbar erweisen, wenn formale Bildungsangebote sich ständig an der Praxis prü-
fen und ihre Inhalte laufend an dieser ausrichten würden (Schiersmann / Remmele,
2002) (Näheres auch in Kapitel 7).
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2003
- ISBN (eBook)
- 9783832474614
- ISBN (Paperback)
- 9783838674612
- DOI
- 10.3239/9783832474614
- Dateigröße
- 1.1 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Ludwig-Maximilians-Universität München – Psychologie und Pädagogik, Pädagogik
- Erscheinungsdatum
- 2003 (November)
- Note
- 1,5
- Schlagworte
- personalentwicklung weiterbildung lernen alltag schlüsselqualifikation erfahrungslernen
- Produktsicherheit
- Diplom.de