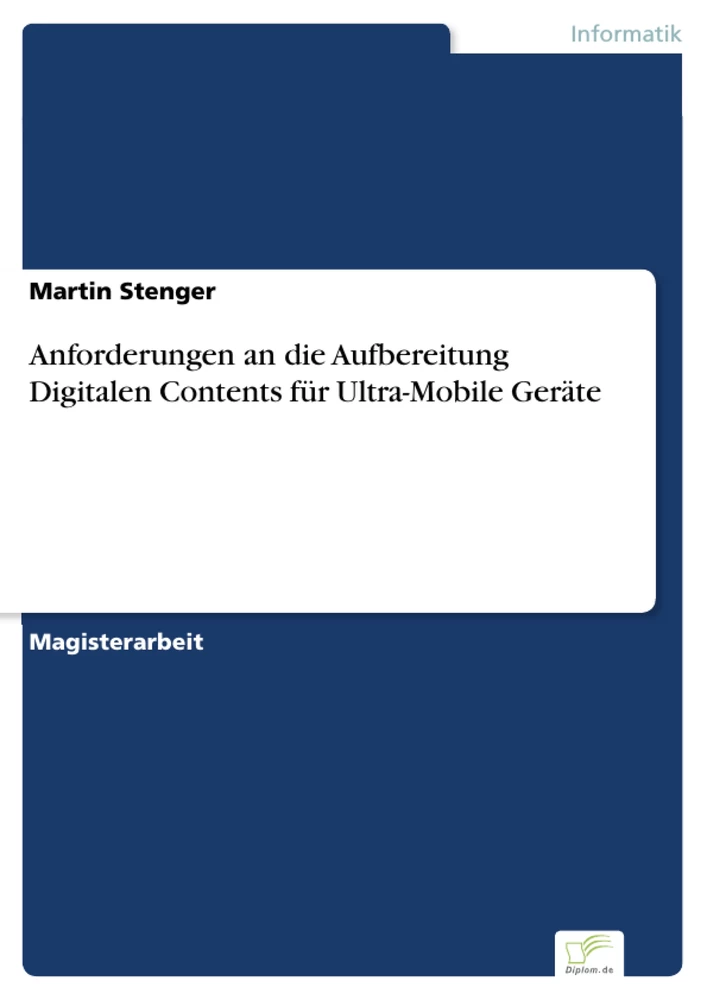Anforderungen an die Aufbereitung Digitalen Contents für Ultra-Mobile Geräte
©2003
Magisterarbeit
107 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Zusammenfassung:
Diese Untersuchung befasst sich mit einer vielschichtigen Darstellung der Möglichkeiten, Besonderheiten und technischen Grundlagen der Informationsrepräsentation auf mobilen Endgeräten. Eine Vielzahl von Standards und unterschiedlichen Protokollen, heterogene Umgebungen von Mobilgeräten mit variierender Darstellung und andersartiger Bedienelemente eröffnen vielfältige Möglichkeiten, Wissen durch einen Transformationsprozess dem Nutzer als elektronisch generierte Einheit zugänglich zu machen. In dieser Arbeit wird die uneinheitliche Landschaft der Möglichkeiten dargestellt und stückweise eine Systematik entwickelt, mit deren Hilfe generierte Dokumente auf diesen Endgeräten zu einem informationellen Mehrwert führen. Daneben werden Probleme betrachtet und Hinweise zur Lösung gegeben, um dem Nutzer die besten Darstellungsoptionen zu unterbreiten. Diese Grundlagen führen zu neuen Anforderungen an die Entwicklung von Inhalten für das Medium dem Mobile Content. Es müssen Richtlinien geschaffen, Eventualitäten herausgearbeitet und dargestellt werden, um eine möglichst valide Aussage darüber treffen zu können, wie aus Daten Wissen entsteht, welches in einem Prozess über eine zu spezifizierende Infrastruktur zum Nutzer gelangt und dort durch einen pragmatischen Charakter zu Wissen in Aktion, also zu Information wird.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
Abkürzungsverzeichnisi
Abbildungsverzeichnis, Verzeichnis der Tabellen, Anmerkungeniv
Vorwort1
1.Einleitung2
1.1Methodik und Gliederung2
1.2Abgrenzung und Terminologie5
1.3Zur Problematik der Begriffes des Elektronischen Publizierens10
2.Infrastrukturelle Betrachtungen12
2.1Übertragungstechnologien13
2.1.1Die Informations-Tankstelle14
2.1.2Wireless14
2.1.3Speicherkarten18
2.1.4Hybride19
2.1.5Konklusion der Protokolle und Übertragungsmedien20
3.Gestaltung und Usability23
3.1Problemfeld Display Anforderungen an die Gestaltung23
3.1.1Display-Technologien24
3.1.2Darstellungsproblematik der Daten26
3.1.2.1Graphik/Symbole26
3.1.2.2Farbe27
3.1.2.3Textstrukturen auf kleinen Anzeigen28
3.1.3Navigation im Zeitalter des virtuellen Seitenumblätterns30
3.1.4Hypertextuelle Strukturen auf kleinen Displays31
3.1.5Linguistisch bedingte Besonderheiten34
3.1.6Problematik der Escher-Effekte39
3.2Sensoren zur Bestimmung der world of action42
3.3Systeme und Techniken zur Usability-Verbesserung43
4.Produktion der Inhalte49
4.1Anwendungen und Protokolle […]
Diese Untersuchung befasst sich mit einer vielschichtigen Darstellung der Möglichkeiten, Besonderheiten und technischen Grundlagen der Informationsrepräsentation auf mobilen Endgeräten. Eine Vielzahl von Standards und unterschiedlichen Protokollen, heterogene Umgebungen von Mobilgeräten mit variierender Darstellung und andersartiger Bedienelemente eröffnen vielfältige Möglichkeiten, Wissen durch einen Transformationsprozess dem Nutzer als elektronisch generierte Einheit zugänglich zu machen. In dieser Arbeit wird die uneinheitliche Landschaft der Möglichkeiten dargestellt und stückweise eine Systematik entwickelt, mit deren Hilfe generierte Dokumente auf diesen Endgeräten zu einem informationellen Mehrwert führen. Daneben werden Probleme betrachtet und Hinweise zur Lösung gegeben, um dem Nutzer die besten Darstellungsoptionen zu unterbreiten. Diese Grundlagen führen zu neuen Anforderungen an die Entwicklung von Inhalten für das Medium dem Mobile Content. Es müssen Richtlinien geschaffen, Eventualitäten herausgearbeitet und dargestellt werden, um eine möglichst valide Aussage darüber treffen zu können, wie aus Daten Wissen entsteht, welches in einem Prozess über eine zu spezifizierende Infrastruktur zum Nutzer gelangt und dort durch einen pragmatischen Charakter zu Wissen in Aktion, also zu Information wird.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
Abkürzungsverzeichnisi
Abbildungsverzeichnis, Verzeichnis der Tabellen, Anmerkungeniv
Vorwort1
1.Einleitung2
1.1Methodik und Gliederung2
1.2Abgrenzung und Terminologie5
1.3Zur Problematik der Begriffes des Elektronischen Publizierens10
2.Infrastrukturelle Betrachtungen12
2.1Übertragungstechnologien13
2.1.1Die Informations-Tankstelle14
2.1.2Wireless14
2.1.3Speicherkarten18
2.1.4Hybride19
2.1.5Konklusion der Protokolle und Übertragungsmedien20
3.Gestaltung und Usability23
3.1Problemfeld Display Anforderungen an die Gestaltung23
3.1.1Display-Technologien24
3.1.2Darstellungsproblematik der Daten26
3.1.2.1Graphik/Symbole26
3.1.2.2Farbe27
3.1.2.3Textstrukturen auf kleinen Anzeigen28
3.1.3Navigation im Zeitalter des virtuellen Seitenumblätterns30
3.1.4Hypertextuelle Strukturen auf kleinen Displays31
3.1.5Linguistisch bedingte Besonderheiten34
3.1.6Problematik der Escher-Effekte39
3.2Sensoren zur Bestimmung der world of action42
3.3Systeme und Techniken zur Usability-Verbesserung43
4.Produktion der Inhalte49
4.1Anwendungen und Protokolle […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 6908
Stenger, Martin: Anforderungen an die Aufbereitung Digitalen Contents für Ultra-Mobile
Geräte
Hamburg: Diplomica GmbH, 2003
Zugl.: Universität, Magisterarbeit, 2003
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2003
Printed in Germany
,,We look back on print media the way we look
back on travel by horse or wind-powered ship ...
as relevant to our future as the carrier pigeon."
1
1
Aus einem Interview mit IBM Designer Bob Steinbugler in Wired 8.08 (August 2000): 146
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis... i
Abbildungsverzeichnis, Verzeichnis der Tabellen, Anmerkungen... iv
Vorwort...1
1. Einleitung...2
1.1 Methodik und Gliederung... 2
1.2 Abgrenzung und Terminologie ... 5
1.3 Zur Problematik der Begriffes des ,Elektronischen Publizierens' ... 10
2. Infrastrukturelle Betrachtungen...12
2.1 Übertragungstechnologien... 13
2.1.1 Die ,Informations-Tankstelle' ... 14
2.1.2 Wireless... 14
2.1.3 Speicherkarten ... 18
2.1.4 Hybride ... 19
2.1.5 Konklusion der Protokolle und Übertragungsmedien ... 20
3. Gestaltung und Usability...23
3.1 Problemfeld Display Anforderungen an die Gestaltung... 23
3.1.1 Display-Technologien... 24
3.1.2 Darstellungsproblematik der Daten... 26
3.1.2.1 Graphik/Symbole ... 26
3.1.2.2 Farbe ... 27
3.1.2.3 Textstrukturen auf kleinen Anzeigen... 28
3.1.3 Navigation im Zeitalter des virtuellen Seitenumblätterns ... 30
3.1.4 Hypertextuelle Strukturen auf kleinen Displays ... 31
3.1.5 Linguistisch bedingte Besonderheiten... 34
3.1.6 Problematik der Escher-Effekte... 39
Inhaltsverzeichnis
3.2 Sensoren zur Bestimmung der ,world of action'... 42
3.3 Systeme und Techniken zur ,Usability-Verbesserung' ... 43
4. Produktion der Inhalte...49
4.1 Anwendungen und Protokolle zur Verbreitung mobil verfügbarer Daten ... 49
4.3 Editoren und Tools zur Content-Generierung ... 60
5. Standardisierung der Daten...64
5.1 Mark-up Sprachen ... 64
5.1.2 SGML als Grundlage von Beschreibungssprachen... 65
5.1.3 Die Anwendung HTML als ,Volkssprache'... 65
5.1.4 XML als de facto Standard ... 66
5.1.5 Konklusion dieser Beschreibungssprachen ... 69
5.2 Programmiersprachen zur multimedialen Aufbereitung ... 70
5.3 Sonderstellung der E-Books ... 71
6. Abrechnungsverfahren Elektronischer Publikationen und elektronisch
generierter Dokumente ...74
6.1 Preisgebung... 75
6.2 Mehrwertproblematik und politische Anforderungen... 76
6.3 Auswahl der Abrechnungsmethoden... 76
6.4 Kosteneinsparungen im Vergleich zum traditionellen Printbereich... 77
6.5 Resümee zur Auswahl der Abrechnungsverfahren... 78
7. Neue Aufgaben der Verleger...80
8. Resümee und zukünftige Entwicklungen...83
Literaturverzeichnis...86
Verzeichnis der Abbildungen, Tabellen und Anmerkungen
i
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1
Marktgröße content-orientierter Datenanwendungen... 8
Abbildung 2
Aufgaben des Content Aggregators ...9
Abbildung 3
Users, Information und Tasks...30
Abbildung 4
Textbegrenzung...36
Abbildung 5
AvantGo...53
Abbildung 6
Komponenten eines Endgerätes...54
Abbildung 7
YAHOO...56
Abbildung 8
Beispiel eines WAP-Portals...58
Abbildung 9
Beispiel einer Nachrichtenauswahl...59
Abbildung 10
WAP-Angebot...61
Abbildung 11
Aufgaben des Verlegers...80
Verzeichnis der Tabellen
Tabelle 1
E-Book Software für mobile Geräte...72
Anmerkungen
Fremdsprachige Ausdrücke sind kursiv gekennzeichnet; Eigennamen und Begriffe,
wie z.B. Internet, nicht. Es ist aber hierbei zu beachten, dass viele englischsprachige
Ausdrücke bereits eingedeutscht sind.
Zitate sind auf Grund der Authentizität in der jeweilig gültigen Rechtschreibung
gehalten.
Seitenangaben können bei Webseiten nicht gemacht werden, daher sind sie in dieser
Arbeit mit WWW gekennzeichnet, z.B. Schmitz, Ulrich (1995): WWW.
Abkürzungsverzeichnis
ii
Abkürzungsverzeichnis
a.a.O.
am angegebenen Ort
ASCII
American Standard Code for Information Interexchange
bzgl.
bezüglich
bzw.
beziehungsweise
ca.
circa
CD-ROM
Compact Disc Read Only Memory
CF
Compact Flash
cHTML
Compact Hypertext Markup Language
CRT
Cathode Ray Tube
d.h.
das heißt
DBMS
Database Management System
DECT
Digital Enhanced Cordless Telecommunications
DFKI
Deutsches Forschungsinstitut für künstliche Intelligenz
DIN
Deutsche Industrienorm
DPA
Deutsche Presse Agentur
DRM
Digital Rights Management
DSL
Digital Subscriber Line
ebd.
ebenda
E-Book
Electronic Book
E-Commerce
Electronic Commerce
E-Content
Electronic Content
ELD
Electro Luminescent Display
E-Mail
Electronic Mail
Abkürzungsverzeichnis
iii
EMS
Enhanced Messaging Service
EN
Europäisches Institut für Normierung
evtl.
Eventuell
ggf.
gegebenenfalls
GHz
Gigahertz
GPRS
General Packet Radio Service
GPS
Global Positioning System
GSM
Global System for Mobile (Communications)
HSCD
High Speed Circuit Switched Data
HTML
Hypertext Markup Language
IBM
International Business Machines
IEEE
Institute of Electrical and Electronic Engineers
IrDA
Infrared Data Association
ISO
International Organization for Standardization
kBit/s
Kilobit pro Sekunde
LAN
Local Area Network
LBS
Location Based Services
LCD
Liquid Crystal Display
Mbit/s
Megabit pro Sekunde
M-Commerce
Mobile Commerce
M-Content
Mobile Content
MHz
Megahertz
MIM
Metal-Insulator-Metal
MMC
Multimedia Card
MMS
Multimedia Messaging Service
Abkürzungsverzeichnis
iv
MOCOS
Mobile Optimized Content Standard
MP3
Moving Pictures Expert Group (MPEG) Layer 3
Mrd.
Milliarde
MS
Memory Stick
n-TV
Nachrichten TV
PC
Personal Computer
PDA
Personal Digital Assistant
PDF
Portable Data Format
POI
Point of Information
RAM
Random Access Memory
ROM
Read Only Memory
SD
Secure Digital
SGML
Structured Generalized Markup Language
sic
sicnature
SMS
Short Message Service
TCP/IP
Transmission Control Protocol/Internet Protocol
TFT
Thin Film Transistor
u. a.
unter anderem/und andere
u. U.
unter Umständen
UMTS
Universal Mobile Telephone Service
URL
Uniform Resource Locator
URM
User Rights Management
usw.
und so weiter
vgl.
vergleiche
VHS
Video Home System
Abkürzungsverzeichnis
v
W(ISP)
Wireless Internet Service Provider
W3
World Wide Web
WAP
Wireless Application Protocol
WASP
Wireless Application Service Provider
WBMP
Mobile Internet Graphic Standard
WEP
Wireless Encryption Protocol
WIFI
Wireless Fidelity
W-LAN
Wireless Local Area Network
WML
Wireless Markup Language
WWW
World Wide Web
XML
Extensible Markup Language
z. B.
zum Beispiel
zit. n.
zitiert nach
Vorwort
1
Vorwort
Seit der Entstehung der Idee Vannevar Bushs, eines amerikanischen Elektro-
ingenieurs, zur Gestaltung eines fiktiven Gerätes, der Memex, um das Wissen der
Welt an einem Punkt zugänglich zu machen, ist versucht worden, diese Überlegung
durch verschiedene Systeme und Ansätze umzusetzen. Ein Ansatz, der eine
weltweite Vernetzung ermöglichte das Internet mit dem darauf basierenden World
Wide Web kann wohl am besten mit dieser gedanklichen Apparatur verglichen
werden, da es die von Bush in prophezeiender Manier aufgeführten Eigenschaften
besitzt. Jedoch ist diese Anforderung durch das Aufkommen neuer Technologien um
eine Dimension zu erweitern: das Wissen der Welt soll jetzt nicht nur an einem
Punkt, sondern überall zugänglich gemacht werden, was den pragmatischen Aspekt
der Information als Instrument zur Problemlösung hervorhebt. Hierzu fallen
Stichwörter wie WAP, UMTS, Mobile Internet usw. Diese Arbeit wird sich an diesen
Standards orientieren, doch ist zu bemerken, dass auf Grund der bestehenden
Dynamik und den immer schneller werdenden Innovationszyklen einige der hier
aufgeführten Systeme und Protokolle bereits obsolet, substituiert oder erweitert
worden sind. Ungeachtet dessen bleiben jedoch die darauf basierenden Grundlagen
anwendbar, sodass die aktuellen Gegebenheiten nur als Beispiele und Richtlinien zur
Handlungsanweisung, die bei der Schaffung von veredelten Inhalten (Content) zu
beachten ist, zu betrachten sind.
Kapitel 1 Methodik und Gliederung
2
1. Einleitung
1.1 Methodik und Gliederung
Die folgende Untersuchung befasst sich mit einer vielschichtigen Darstellung der
Möglichkeiten, Besonderheiten und technischen Grundlagen der Informations-
repräsentation auf mobilen Endgeräten. Eine Vielzahl von Standards und
unterschiedlichen Protokollen, heterogene Umgebungen von Mobilgeräten mit
variierender Darstellung und andersartiger Bedienelemente eröffnen vielfältige
Möglichkeiten, Wissen durch einen Transformationsprozess dem Nutzer als
elektronisch generierte Einheit zugänglich zu machen. In dieser Arbeit wird die
uneinheitliche Landschaft der Möglichkeiten dargestellt und stückweise eine
Systematik entwickelt, mit deren Hilfe generierte Dokumente auf diesen Endgeräten
zu einem informationellen Mehrwert
1
führen. Daneben werden Probleme betrachtet
und Hinweise zur Lösung gegeben, um dem Nutzer die besten Darstellungsoptionen
zu unterbreiten.
Diese Grundlagen führen zu neuen Anforderungen an die Entwicklung von
Inhalten für das Medium dem Mobile Content. Es müssen Richtlinien geschaffen,
Eventualitäten herausgearbeitet und dargestellt werden, um eine möglichst valide
Aussage darüber treffen zu können, wie aus Daten Wissen entsteht, welches in einem
Prozess über eine zu spezifizierende Infrastruktur zum Nutzer gelangt und dort durch
seinen pragmatischen Charakter zu ,,Wissen in Aktion"
2
, also zu Information wird.
Die Frage hierbei lautet, wie diese Inhalte aufbereitet werden können, damit ein
höchst möglicher Informationsgehalt zur Lösung eines Problems (aus Rezipienten-
sicht) entstehen kann. Der Prozess der Aufbereitung von bestehenden Daten konnte
bereits auf Basis des World Wide Webs beobachtet werden. Dort wurden Dokumente,
basierend auf dem Konzept des Hypertextes, mit Hilfe der Beschreibungssprache
HTML transformiert, um in dieser neuen Erscheinungsform (aufbereitet zu einem
logisch organisierten Hypertext) als Informationsmedium nutzbar zu sein
3
.
MCLUHAN, ein kanadischer Kommunikationsforscher, formulierte diese Proble-
matik der Transposition von Daten von einem in ein anderes, bereits bestehendes
1
Vgl. Kuhlen, Rainer (1995): 1ff. über die Theorie informationeller Mehrwerte.
2
Ebd.
3
Vgl. Lemay, Laura (1996): 4ff.
Kapitel 1 Methodik und Gliederung
3
Medium, in abstrakter Weise in seinem Buch Understanding Media, in welchem er
das Medium, den Informationsträger, als ein Element der zu übermittelnden
Botschaft betrachtet
4
, denn ohne das Wissen, wie Medien arbeiten, kann die
eigentliche Nachricht nicht verstanden werden. Er schreibt dem Medium der
Informationsübertragung eine höhere Relevanz zu, als den damit übertragenen Daten.
Dies resultiert aus der logischen Konsequenz, dass z.B. Daten nur mit dem Wissen
über ihre Organisationsstruktur gefunden werden können. Ohne die Anpassung an
ihre jeweilige Datenbank (bzw. deren Aufbau) wären die Daten mit der ,,Library of
Form"
5
des argentinischen Autors Jorge Luis Borges vergleichbar, welche be-
schriebene Bücher in allen Fassungen durch die Permutation aller Möglichkeiten von
Buchstabenkombinationen enthält. Angesichts des veranschaulichten Sachverhaltes
kann das Übertragungsmedium als ein wichtiger Bestandteil der zu übertragenden
Botschaft betrachtet werden.
Auf Grund dieser Begebenheiten müssen die Daten dem zu übertragenden
Medium angepasst werden, damit ein Mehrwert entsteht und somit einem Nutzer
eine Hilfe zur Problemlösung geben kann. Dieses führt, da keine direkte Übernahme
der Techniken des Publizierens im WWW angesichts der vorherig beschriebenen
Problematik möglich ist, nur zu unzureichenden Ergebnissen und stellt somit neue
Anforderungen an den Generierungsprozess: zum einen auf der Publikationsseite,
zum anderen auch auf der rechtlichen, betriebwirtschaftlichen und kognitions-
psychologischen Seite. Zur Lösung dieser Problematik ist es unabdingbar zu unter-
suchen, welche Probleme es schon bei den weit verbreiteten und genutzten Medien,
wie z.B. dem Internet, gibt.
In dem Kapitel 1.2 wird die Terminologie abgegrenzt und der Gegen-
standsbereich definiert. Es wird aufgezeigt, welches wirtschaftliche Gefüge in dieser
neu entstehenden ,Publikationskette' zu finden ist.
Kapitel 2 befasst sich mit der Grundstruktur der Kabel ungebundenen
Übertragung von Informationen. Dabei werden die aktuellen Standards heraus-
4
Vgl. McLuhan, Marshall (1992): 17ff.
5
Vgl. Kelly, Kevin (1994): 258ff.
Kapitel 1 Methodik und Gliederung
4
gearbeitet, damit darauf aufbauend abgeschätzt werden kann, wie der Publikations-
prozess vonstatten gehen kann, da dies diverse Anforderungen an die Systeme stellt.
Das Kapitel 3 behandelt die informationsrepräsentative Seite von Endgeräten.
Zur Gewährleistung der Mobilität dürfen diese eine bestimmte Grundgröße nicht
überschreiten, was auch in Hinblick auf die Leistung und Darstellung auf
verkleinerten Displays als ,Einschränkung' zu betrachten ist. Hierzu werden auch
einige Studien hinzugezogen, welche sich mit der Informationsrepräsentation auf
kleinen Displays befassen, anhand derer Richtlinien zur Gestaltung herausgearbeitet
werden. Neben der Darstellung existieren auch neue Dimensionen bzgl. Inter-
aktionen. Ausgehend von Teilaspekten bestehender Expertensysteme kann mit Hilfe
von Agenten und entlehnten Techniken dem Nutzer Arbeit abgenommen werden,
indem diese kontextuell reagieren und die Information in einer vorbestimmten Art
und Weise aufbereiten. Dieses Kapitel reflektiert somit die Möglichkeiten der
Nutzung von auf Expertensystemen beruhenden Techniken auf mobilen Geräten und
zeigt Möglichkeiten, wie z.B. LBS (Location Based Services). Hierbei steht der
Begriff der automatisierten Informationsarbeit als Grundlage zur Lösung der
Problematik.
Zur Erstellung von Publikationen werden neben den Daten, dem eigentlichen
Inhalt, auch Systeme gebraucht, mit denen dieser neu entstandene Content verwaltet
werten kann. Diese als Content-Management-Systeme bezeichneten Software-
Erzeugnisse tragen zu einer schnellen Produktion von Inhalten bei. In Kapitel 4 wird
auf die Ebene der Erzeugung mit Hilfe von Editoren eingegangen und aufgezeigt,
welche bereits bestehenden Systeme es gibt. Allerdings ist hierbei zu beachten, dass
auf Grund des Umfangs nicht auf alle existierenden Systeme eingegangen werden
kann, sondern Beispiele herausgegriffen werden, um diese Methode der Publikation
besser zu veranschaulichen.
Konventionen sind eine Grundvoraussetzung, um Daten austauschen und
dekodieren zu können, denn der Sender sowie der Rezipient müssen über die
gleichen Voraussetzungen hinsichtlich kommunikativer Aspekte verfügen. Daher
wird in Kapitel 5 auf die verschiedenen Formen des Datenaustauschs und der
Grundanforderung an die Festlegung von Standards eingegangen.
Kapitel 1 Abgrenzung und Terminologie
5
Kapitel 6 beschreibt die Problematik des M-Commerce, welche sich als eine
Form des E-Commerce abgespalten hat. Systeme müssen evaluiert werden, um die
Grundlage zur einer Berechnungsmöglichkeit zu schaffen. Diese sollen dem Nutzer
transparent sein und somit zu einer Erleichterung der Bedienung/Nutzung führen.
Neben der Darstellung der theoretischen Grundlagen und der Abrechnungs-
problematik wird in Kapitel 7 ein Überblick über neue Aufgaben der Verleger
gegeben, der die Landschaft des Mobile Content noch genauer verdeutlicht.
In Kapitel 8 wird das Resümee dieser Arbeit dargestellt, die erarbeiteten
Richtlinien, Grundlagen, zukünftige Entwicklungen und Methoden, aber auch die
Probleme, welche es im Zuge dieses neuen Prozesses der Aufbereitung zu lösen gilt.
1.2 Abgrenzung und Terminologie
Terminologien haben die Aufgabe, Sachverhalte und Objekte eindeutig zu be-
schreiben. Daher ist es von höchster Relevanz, solche Begrifflichkeiten vorher genau
zu definieren.
,Aufbereitung' umfasst viele Tätigkeitsbereiche in Bezug auf diese Arbeit.
Hierunter soll verstanden werden, durch welche vorstellbaren Möglichkeiten Daten
für den mobilen Einsatz verändert werden müssen, um eine bestmögliche
Präsentation respektive Repräsentation der Daten zu erwirken. Hierbei werden die
Termini ,Präsentation' und ,Repräsentation' in gleicher Weise gebraucht, da eine
Präsentation wie die ,,Mentale Repräsentation"
6
der Daten die gleiche Wirkung haben
soll: das Wissen des Nutzers durch neues Wissen zu erweitern. Beide Begriffe sind in
der gleichen Schnittstelle zugegen. Zwischen dem, was angezeigt wird, und dem, was
von einem Nutzer gesehen wird, ist somit durch diese Begriffe definiert, auf der
Darstellungs- wie auf der Wahrnehmungsseite.
6
Eimer, Martin (1990): 6
Kapitel 1 Abgrenzung und Terminologie
6
Zur Rezeption werden Endgeräte benötigt, welche die Dekodierung und
anschließende Darstellung von Daten erlauben. Diese werden im Rahmen der Arbeit
unter einen Sammelbegriff gestellt: Ultra-Mobile Geräte. Die Abgrenzung ist hin-
sichtlich der immer weiter schreitenden Miniaturisierung von Notebooks und
Rechnern ähnlichen Systemen vonnöten. Es werden hierunter die Geräte verstanden,
die sich nicht als ,vollwertige Rechner' beschreiben lassen, jedoch einige Aspekte
und Möglichkeiten von diesen besitzen. Die Merkmale hierfür liegen in der Größe der
Geräte, den längeren Laufzeiten (durch den niedrigeren Energieverbrauch bestimmt)
und den Möglichkeiten der Interaktion mittels neuer Technologien ohne
herkömmliche QUERTY oder QUERTZ Tastatur: ,,PDAs lack a keyboard, the pen is
used to write notes or to operate Programs"
7
. Unter diese Gruppe fallen aber auch
Mobiltelefone mit Merkmalen wie eingebautem Internet-Browser, WAP-Fähigkeit
und die so genannten PDAs, Personal Digital Assistants. In der Fachliteratur ist der
Begriff ,,,post'-PC devices"
8
für die hier dargestellten Geräte zu finden.
Die Schlüsselrolle in dieser Arbeit spielen neben den Endgeräten die Inhalte
und die aufzubereitenden Daten. Der Begriff Content wird in der Sozialpsychologie
als ,,[...] die Gesamtheit von Bedeutungen in Gestalt von Symbolen (verbal,
musikalisch, bildlich, plastisch, gestikulativ), die die Kommunikation ausmacht
[...]"
9
definiert. Nach der generellen Abgrenzung von Inhalten gilt es nun, diesen
weiter zu spezifizieren. Dieser Mobile Content beschreibt den Inhalt, also alle
nutzbaren Möglichkeiten der Darstellung von Daten auf den jeweiligen Endgeräten
hinsichtlich des in der Definition gegebenen Kommunikationsprozesses. Da in Bezug
auf diese Begriffsbildung keine Abgrenzung hinsichtlich der Art der Informationen
für den mobilen Gebrauch gemacht wird, wären auch akustische Informationen, wie
z.B. Musik in Form von Melodien, Klingeltönen oder aber auch in einer hoch
komprimierten Form, z.B. in dem MP3-Format, denkbar. Eine Definition zur
Beschreibung von Mobile Content kann mit Hilfe einer extensionalen Katego-
risierung gegeben werden. Hierbei werden die Kategorien auf Grund ihrer
Anwendung gebildet.
7
Gessler, Stefan/Kotulla, Andreas (1995): 54
8
Huang, Andrew C. et al. (2000): 619
9
Berelson, Bernard (1954): Content Analysis. In: Handbook of Social Psychology. Band 1. New
York: 488. Zit. n. Silbermann, Alphons/Krüger, Michael (1973): 50
Kapitel 1 Abgrenzung und Terminologie
7
Folgende Unterscheidung wurde in einem Bericht der Europäischen Union über
,Content for Global Mobile Services' getroffen
10
:
- Mobile Nachrichten
- Mobile Transportinformationen
- Mobile Finanzinformationsdienste
- Mobile Verzeichnisse
- Edutainment
- Mobile Spiele
- Mobile Musik
- Downloads von Klingeltönen und Logos
- Mobile Unterhaltung für Erwachsene
Diese extensionale Beschreibung bezieht sich nur auf mobile Telefone, sodass
eine Spezifizierung der Definition unabdingbar ist. Mobile Content wird ein Aspekt
der Mobilität zugeschrieben, der in die jeweiligen Applikationen eingebracht werden
muss. Der informationelle Blickwinkel darf hierbei nicht vernachlässigt werden.
Während sich Mobile Content mit Hilfe der Einteilung in die aufgezeigten
Kategorien beschreiben lässt, wird hier die Publikationsseite in informationeller
Hinsicht betrachtet. Hierbei stellt Edutainment den Grenzbegriff hinsichtlich des hier
behandelten Gegenstandes dar, denn die Betrachtung der oben aufgeführten Punkte,
wie Spiele, Musik, Klingeltöne und Unterhaltung für Erwachsene, enthalten keinen
informationellen Aspekt in Hinblick auf die Allgemeinheit und sind somit für diese
Arbeit nicht relevant.
Hauptsächlich werden die Erscheinungsformen der Nachrichten- und
Informationsdienste hinsichtlich der neuen Anforderungen angesichts verringerter
Bildschirmgröße und neuen Interaktionsmöglichkeiten untersucht. Sie benötigen
einen hohen Grad an Aufbereitung, um auf diesen Geräten nutzbar zu sein respektive
einen ,Sinn' für den Informationssuchenden ergeben.
10
Vgl. European Commission Directorate-General Information Society (2002): 3
Kapitel 1 Abgrenzung und Terminologie
8
Abbildung 1
11
: Marktgröße content-orientierter Datenanwendungen
In Abbildung 1 sind die Marktchancen (durch den Umsatz gekennzeichnet)
für Mobile Content dargestellt und somit der damit verbundenen Notwendigkeit an
Informationsarbeit. Daher entsteht auch ein erhöhter Bedarf an die Aufbereitung
bereits bestehender elektronischer Dokumente, z.B. des Milliarden Seiten
12
umfassenden World Wide Webs. Nachschlagewerke haben mit einem
Gesamtvolumen von 18,5 Mrd. Euro ein immenses Potential, wo hingegen
Finanzinformationen mit einem Volumen von 11 Mrd. Euro vertreten sind.
Nachrichten kommen auf ca. 3,9 Mrd. Euro. Angesichts dieser von Anderson
Consulting durchgeführten Marktanalyse ist der Bedarf von Inhalten zu ersehen,
welcher durch die Aufbereitung bestehender Daten geschaffen werden muss, um das
Informationsbedürfnis dieses Marktes befriedigen zu können.
Zur Erstellung des Contents wird eine organisierte Infrastruktur zur
Produktion und Distribution benötigt. Neben den Bereichen der Informations-
erstellung, der Generierung von Inhalten, ob manuell oder automatisiert, werden
auch Anforderungen an eine entsprechende Infrastruktur (Kanäle) zur Übertragung
von Informationen gestellt.
11
European Commission Directorate-General Information Society (2002): 4
12
Hierbei ist anzumerken, dass die Anzahl der im Internet befindlichen Dokumente am 02.12.2001
ca. 2 Milliarden Seiten umfasste: The Search Engine Report vom 18.12.2001.
Vgl. im Internet: http://searchenginewatch.com/reports/sizes.html. Stand 02.12.2002.
Kapitel 1 Abgrenzung und Terminologie
9
Der Content muss neu generiert oder aus bestehenden digitalen Formaten
konvertiert werden. Hierzu sind Anforderungen notwendig, welche einen
Tätigkeitsbereich in einem neuen Berufsbild definieren. Dieses wird durch einen
Content Provider realisiert. Er kann durch folgende Aufgabenfelder definiert
werden
13
:
- Content Generierung
- Content Provisionierung
- Content Management
- Content Adaption
Nun müssen diese ,Inhalte' verfügbar gemacht werden. Ob dies durch einfache
Vergabe von Metainformationen oder durch die Auswahl bestimmter Formate wie
z.B. HTML geschieht, hängt von dem jeweiligen Provider und den benutzen
Systemen ab. Daneben ist der Content zu organisieren, d.h. er muss durch eine
Kategorisierung in Themenbereiche oder durch Vorgaben bestimmt systematisch
eingeordnet werden, sodass eine Weiterverwertung der Daten ermöglicht wird. Die
Content Adaption kann als eine Möglichkeit beschrieben werden, Content von
anderen Anbietern oder Formaten zu übernehmen (adaptieren), um den selbst
produzierten Content zu erweitern, ergänzen oder aber auch aufzuwerten. Nach dem
Content Provider steht in der Generierungskette der Content Aggregator.
Content Aggregation
Content Packaging
Content Syndication
Abbildung 2
14
: Aufgaben des Content Aggregators
13
Vgl. Ottke, Mark (2002): 26
14
Vgl. ebd.
Kapitel 1 Zur Problematik der Begriffes des ,Elektronischen Publizierens'
10
Der Content Aggregator sammelt Inhalte in einer Datenbank, um diese später
wieder abrufen oder zur einer Weiterverwertung nutzen zu können, wie z.B. der
Realisierung von Portalen durch logische Aufbereitung. Er verpackt einzelne Daten
zu Datenpaketen, wie z.B. Newsletter oder kurze Nachrichteninformationen
(Nachrichtenticker). Die Syndikation beinhaltet das Zuordnen unterschiedlichster
Informationen an einen Zugangspunkt, um einen zentralisierten Zugriff zu
ermöglichen.
Durch die Festlegung der Aufgabenbereiche des Content Providers und des
Content Aggregators in der Publikationskette zeigt sich eine gewisse Interdependenz
vieler Aufgabengebiete. Daher werden im weiteren Verlauf dieser Arbeit die beiden
Begriffe Content Aggregator und Content Provider synonym verwendet, um Miss-
verständnisse auszuschließen.
1.3 Zur Problematik der Begriffes des ,Elektronischen Publizierens'
Beim ersten Betrachten kann der Eindruck entstehen, Mobile Content könnte mit
einer elektronisch publizierten Einheit gleichgesetzt werden. Hierbei zeigen sich
jedoch Probleme angesichts der definitorischen Abgrenzung. RIEHM et al.
beschreibt elektronisches Publizieren wie folgt:
,,Elektronisches Publizieren umfaßt öffentliche Formen der Kommunikation über
anerkannte Kanäle von derzeit vorwiegend textlichen und graphischen Informationen, zu
deren Nutzung technische Hilfsmittel (Hard- und Software) nötig und die für den
zeitpunktunabhängigen Gebrauch geeignet sind. Voraussetzung des Elektronischen
Publizierens ist die elektronische Dokumenterstellung und speicherung."
15
Angesichts der gegebenen Definition könnte von ,Elektronischem
Publizieren' gesprochen werden, jedoch gelten nicht alle Aspekte dieser Festlegung
für Mobile Content, denn RIEHM et al. spricht von einem ,,zeitpunktunabhängigen
Gebrauch", der bei elektronisch generierten Dokumenten nicht gegeben sein muss. So
ist z.B. eine generierte Dateneinheit nicht zeitpunktunabhängig nutzbar, da bei jedem
15
Riehm, Ulrich et al. (1992): 10
Kapitel 1 Zur Problematik der Begriffes des ,Elektronischen Publizierens'
11
neuen Zugriff durch veränderte Parameter und Konfigurationen ein anderes
Dokument generiert wird. Es kann somit nur eingeschränkt von Elektronischem
Publizieren gesprochen werden. Jedoch ist angesichts der gegebenen Begriffsschärfe
dieser Definition diese nicht wie bereits beschrieben nutzbar, sondern muss erweitert
werden, da die anderen Aspekte der gegebenen Definition zutreffen. So wird hier der
Begriff der ,elektronisch generierten Dokumentationseinheit' eingeführt und es wird
von ,elektronisch generierten Dokumenten' gesprochen. Dies ist notwendig, da zwar
Inhalte vorliegen, jedoch speziell für den einzelnen Einsatzort die entsprechenden
Dokumente neu generiert werden müssen, wobei im weiteren Verlauf noch auf die
Aufbereitung unter Zuhilfenahme zusätzlicher Mittel zur Zufriedenstellung des
Informationsbedürfnisses eingegangen wird. Von einem Dokument kann im
modernen Sinne jedoch gesprochen werden, da der Beweischarakter veraltet ist und
,,[...] es sich nicht um Unikate, sondern um die Vervielfältigung einer
Veröffentlichung oder Teile einer solchen handelt [...]"
16
, was bei der Generierung
aus bestehenden Dokumenten in Form von Daten durchaus gegeben ist. Es ist in
diesem Zusammenhang noch zu erwähnen, dass im Verlauf dieser Arbeit trotzdem
die Termini ,Publikationskette' und ,Publikationen' benutzt werden, da diese
definitorische Einschränkung sich nur auf den Ausdruck ,Elektronisches Publizieren'
bezieht. Die Erzeugung elektronischer Publikationseinheiten lässt sich auch mit dem
Prozess der Entstehung von Mobile Content vergleichen, denn dieser Ent-
stehungsprozess ist wie beim Elektronischen Publizieren ,,produktionsorientiert",
,,distributionsorientiert" und bezeichnet ,,neuartige, innovative, elektronische
Publikationsformen"
17
. Angesichts dieser Abgrenzung wird jedoch die Problematik
deutlich, die mit dieser neuen Art des ,Veröffentlichens' einher geht.
16
Oßwald, Achim (1992): 27
17
Riehm, Ulrich et al. (1992): 9
Kapitel 2 Übertragungstechnologien
12
2. Infrastrukturelle Betrachtungen
Eine Infrastruktur soll hierbei den Zugriff bzw. die Distribution der generierten
respektive zu generierenden Informationseinheiten vereinfachen oder aber generell
ermöglichen. Somit ist eine Vernetzung durch Datenleitungen eine Grundprämisse.
Ob diese Datenleitungen zur morgendlichen
18
Auffüllung eines Datenspeichers zur
Verfügung stehen (Synchronisation), oder physikalisch gänzlich ungebunden
(wireless) sind, wird von dem jeweiligen Einsatzbereich determiniert. Hierbei sind
im weiteren Verlauf dieser Arbeit die einzelnen Bereiche mit den entsprechenden
Übertragungsmethoden voneinander zu unterscheiden. Daten brauchen Handlungs-
anweisungen, wie sie übertragen werden. Diese Vorschriften werden als Protokolle
bezeichnet.
Weil Informationen über bestimmte Kanäle transportiert werden müssen, ist
eine Festlegung von Standards unabdingbar, denn es muss eine Infrastruktur
geschaffen werden, die es erlaubt, Daten auf einfache Weise auf Endgeräte zu
übertragen. Daher gilt es vorab eine Auswahl aus den bestehenden Methoden zu
treffen und die Probleme der einzelnen Anwendungsfelder darzustellen, um diese
Kanäle zur Distribution effektiv nutzen zu können.
Zur Erstellung einer grundlegenden Struktur zur Datenübertragung wurde das
OSI-Modell
19
entwickelt, welches ,,[...] alle Komponenten, die für die Kommu-
nikation von Rechnern erforderlich sind [...]"
20
beschreibt. Es ist ein sieben-
schichtiges Modell, das den Datenfluss von der untersten Ebene ausgehend, der
physikalischen Schicht, in eine immer abstraktere Schicht, bis zur Anwendung hin,
festlegt. Mit Hilfe dieses Modells kann der Informationskanal hinsichtlich seiner
physikalischen Beschaffenheit definiert werden, um so eine Standardisierung zur
Erreichung eines Massenpublikums zu erwirken:
18
Dieser Begriff verdeutlicht den Aspekt der einmaligen Nutzung in einem 24-stündigen Zeitrahmen;
er kann z.B. auch durch ,abendlichen' substituiert werden.
19
Hierbei steht OSI für Open System Interconnection.
20
Hennekeuser, Johannes/Peter, Gerhard (1994): 38
Kapitel 2 Übertragungstechnologien
13
,,Unter Massenkommunikation versteht MALETZKE jene Form der Kommunikation, bei
der Aussagen öffentlich durch technische Verbreitungsmittel indirekt und einseitig an ein
dispersives Publikum vermittelt werden."
21
Hierbei sind aber noch verschiedene Prinzipien der Datenübertragung zu
unterscheiden. Der Ausdruck ,Mobil' innerhalb des Terminus ,Mobile Kommuni-
kation' impliziert zwar eine drahtungebundene Kommunikation, kann aber auch eine
einseitige Kommunikation sein, welche ,,die Aussage nur in eine Richtung, vom
Kommunikator (Aussagenden) zum Rezipienten (Aufnehmenden), ohne ständigen
Rollentausch"
22
vermittelt.
,,Die indirekte Kommunikation ist durch eine zeitliche oder räumliche oder
raumzeitliche Distanz zwischen den Kommunikationspartnern gekennzeichnet"
23
,
daher ist diese auch als ein Teil mobiler Kommunikation anzuerkennen. Zur weiteren
Erläuterung ist eine Beschreibung dieser Technologie und den darauf basierenden
Techniken notwendig. Diese ermöglichen einerseits das Übertragen von
Informationen, andererseits aber auch das Abrufen oder verändern bereits
vorhandener Daten, die sich durch dieses ,Verändern' zu einer Information in einem
jeweiligen Kontext entwickeln können. Chavéz et al. beschreibt das Ziel wie folgt:
,,[...] to provide the right Information at the right time and place [...]"
24
. Hierzu
dienen Übertragungstechnologien sowie lokale Speichermedien, welche angesichts
in dieser Arbeit angesprochenen Kontexts des ubiquitären Zugangs zu Informationen
auch miteinander koexistent sein müssen.
2.1 Übertragungstechnologien
Technische Unzulänglichkeiten, gegeben durch die Realisierungsmöglichkeiten der
derzeit verwendeten Protokolle und Endgeräte, machen eine Nutzung
unterschiedlicher Systeme in verschiedenen Umgebungen notwendig. Somit können
21
Maletzke, Gerhard (1963): Psychologie der Massenkommunikation. Theorie und Systematik.
Hamburg: Verlag Hans Bredow-Institut: 32. Zit. n. Bleuel, Jens (1995): 22
22
Bleuel, Jens (1995): 23
23
Maletzke, Gerhard: a.a.O.: 23. Zit. n. Bleuel, Jens (1995): 23
24
Chavéz, Esteban/Ide, Rüdiger/Kirste, Thomas (2000): 903
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2003
- ISBN (eBook)
- 9783832469085
- ISBN (Paperback)
- 9783838669083
- DOI
- 10.3239/9783832469085
- Dateigröße
- 2 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität des Saarlandes – Informationswissenschaft
- Erscheinungsdatum
- 2003 (Juni)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- mobile content m-content aufbereitung handy
- Produktsicherheit
- Diplom.de