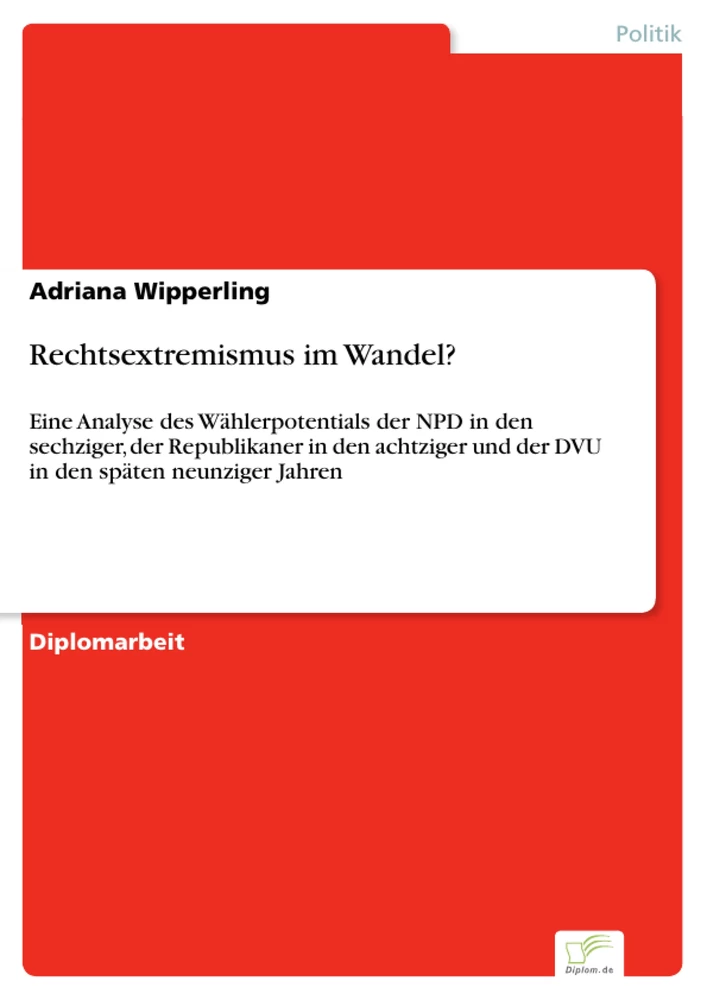Rechtsextremismus im Wandel?
Eine Analyse des Wählerpotentials der NPD in den sechziger, der Republikaner in den achtziger und der DVU in den späten neunziger Jahren
Zusammenfassung
Die Tatsache, daß rechtsextreme Parteien bei manchen Wahlen beängstigende Erfolge erzielen, bei anderen jedoch nicht einmal ein Prozent erreichen, gehört nach wie vor zu den Rätseln, denen die Wahlforschung auf den Grund zu gehen versucht. Erwiesen ist bisher nur folgendes: Damit ein größerer Teil der Bevölkerung rechts wählt, müssen vor allem drei Bedingungen gegeben sein: Eine oder mehrere attraktive rechtsextreme Parteien, ein latent vorhandenes rechtes Einstellungspotential und eine Krisen- bzw. Umbruchsituation.
Nachdem das geistige Erbe des Nationalsozialismus nach und nach abgebaut wurde, hat sich das rechtsextreme Einstellungspotential auf einen Wert von 13-15% Prozent eingepegelt. Doch es gab nur drei Phasen in der Geschichte der Bundesrepublik, in denen die Wahlergebnisse von Rechtsaußen-Parteien auch nur annäherungsweise an dieses Potential heranreichten.
Die Wahlerfolge der Sozialistischen Reichspartei (SRP) in der Nachkriegszeit können getrost als Nachwehen des Nationalsozialismus angesehen werden.
Die Erfolgsphase der NPD in der Sechzigern war gewissermaßen ein Aufbäumen nationalkonservativer Wähler gegen die APO, den beginnenden Wertewandel und die Große Koalition, aber auch ein Ausdruck das Schocks über das abrupte Ende des Wirtschaftswunders und die Rezession, die den neu gewonnenen Glauben daran, daß Demokratie funktioniert, recht heftig erschütterte.
Die Dritte Welle wird mit dem Einzug der Republikaner ins Berliner Abgeordnetenhaus 1989 angesetzt. Die Republikaner bildeten sich als Gegenpol zu den Grünen, als Opposition gegen den fortschreitenden Wertewandel und die von den Linken propagierte multikulturelle Gesellschaft. Sie gingen vornehmlich mit dem Thema Ausländer und Asyl hausieren und gewannen somit die Stimmen der Modernisierungsverlierer.
Doch die Dritte Welle des Rechtsextremismus scheint kein Ende zu nehmen. Nachdem die Republikaner kurz nach der Wiedervereinigung eine Wahlniederlage nach der anderen einstecken mußten, erlebten sie bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg ein überraschendes Comeback. Noch häufiger als den Republikanern gelang es in den Neunziger Jahren der Deutschen Volksunion (DVU), die Fünf-Prozent-Hürde zu überwinden.
Nun stellt sich die Frage, ob die Gesetzmäßigkeit vom Wellencharakter rechtsextremer Wahlerfolge für die neunziger Jahre überhaupt noch zutrifft. Zum ersten existieren anstelle einer einzigen erfolgreichen rechtsextremen Partei nun […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1. 1. Fragestellung und Schwerpunkt
Ein Konsens in der Literatur besteht darin, daß sich die Wahlerfolge rechtsextremer Parteien in der Bundesrepublik Deutschland in drei Wellen bzw. Boomphasen gliedern. Die erste Welle setzte demzufolge in der Nachkriegszeit ein, als die 1949 gegründete Sozialistischen Reichspartei (SRP) gezielt um die Stimmen ehemaliger NSDAP-Anhänger warb und bei der niedersächsischen Landtagswahl 1951 mit 11 % ihr bestes Ergebnis erzielte. Bis zu ihrem Verbot im Jahre 1952 gelang es ihr, in zwei Länderparlamente einzuziehen. Die zweite Welle kam mit einer überraschenden Serie von Wahlerfolgen der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands (NPD), die zwischen 1966 und 1969 sieben Landtagsmandate gewann. Die dritte Welle wird 1989 angesetzt, als die rechtsradikalen Republikaner die 5 %-Hürde bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus und kurz darauf bei den Europawahlen übersprangen (vgl. z.B. Roth/Schäfer 1994: 122f.; Stöss 1994: 39f.; Pfahl-Traughber 1999: 21ff.).
Diese „Wellentheorie“ geht von folgendem Schema aus: Einer bestimmten Partei gelingt es - im Gegensatz zu ihrer erfolglosen rechtsextremen Konkurrenz - unter bestimmten Umständen eine nennenswerte Menge an Wählern zu mobilisieren. Es kommt zu einer Serie von Wahlerfolgen, bei der die betreffende Partei mehrere Mandate auf Kommunal- und Landesebene gewinnt. Diese Erfolgssträhne findet jedoch nach weniger als vier Jahren ein abruptes Ende und der Partei gelingt es danach nie wieder, bei Landtags-, Europa oder gar Bundestagswahlen die 5%-Hürde zu überspringen.
Die SRP fällt aus diesem Schema gewissermaßen heraus, da man nicht weiß, wie erfolgreich die Partei noch hätte sein können, wenn sie nicht verboten worden wäre. Doch da es ihren rechten Konkurrenzparteien Deutsche Reichspartei (DRP) und Deutsche Gemeinschaft (DG) nicht gelang, die nationalistisch gesinnten Wähler aufzufangen (vgl. Fascher 1994: 33ff.), kann man davon ausgehen, daß die Bedingungen für rechtsextreme Parteien nach 1952 zunehmend schlechter wurden und auch die SRP irgendwann in der Bedeutungslosigkeit versunken wäre.
Für die NPD begann nach ihrem knappen Scheitern bei der Bundestagswahl 1969 ein tiefer Fall. In den siebziger Jahren sanken die Wahlergebnisse der Partei kontinuierlich, später erreichte sie meist weniger als ein Prozent.[1]
Den Republikanern wurde um 1990 ein ähnliches Schicksal prophezeit. In Berlin, wo sie ihren ersten durchschlagenden Wahlerfolg erzielt hatten, ging der Anteil der REP-Wähler stark zurück. Bei der ersten gesamtdeutschen Bundestagswahl und den Landtagswahlen in den fünf neuen Ländern blieb die extreme Rechte erfolglos.
Daß es sich bei den Stimmenverlusten der Republikaner in den Jahren 1990 und 1991 offenbar nur um einen vorübergehenden „Durchhänger“ handelte, zeigten die Landtagswahlen in Baden-Württemberg: 1992 erzielten die REP dort mit 10,9% ihr bisher bestes Ergebnis, 1996 zogen sie erneut in den Stuttgarter Landtag ein, diesmal mal mit 9,1%. Zudem gelang es nun auch der Deutschen Volksunion (DVU) bei einigen Landtagswahlen die Fünf-Prozent-Hürde zu überwinden. Das Wahlergebnis von Sachsen-Anhalt, wo die DVU 1998 12,9% der Zweitstimmen auf sich vereinigte, war das beste, was eine Rechtsaußen-Partei in der Bundesrepublik Deutschland bisher erreichen konnte.[2] Ein Ende der dritten Welle des Rechtsextremismus scheint also nicht in Sicht.
Nun stellt sich für mich die Frage, ob die Gesetzmäßigkeit vom Wellencharakter rechtsextremer Wahlerfolge für die neunziger Jahre überhaupt noch zutrifft. Meines Erachtens lassen sich hier entscheidende Unterschiede zur Erfolgsserie der NPD in den Sechzigern und zum Aufstieg der SRP in den frühen fünfziger Jahren feststellen. Zum ersten existieren anstelle einer einzigen erfolgreichen rechtsextremen Partei[3] nun zwei: Die Republikaner und die DVU. Zum zweiten scheinen sich diese Parteien auf unterschiedliche regionale Schwerpunkte zu konzentrieren: Während für die Republikaner Baden-Württemberg das einzige Bundesland bleibt, wo ihnen nach 1990 der Einzug ins Länderparlament gelang, scheint sich für die DVU nach Bremen und Schleswig-Holstein nun Ostdeutschland als neue Hochburg herauszubilden. Zum Dritten schwanken die Ergebnisse der Republikaner und der DVU sehr stark, so daß immer dann, wenn von der Wahlforschung bereits der Niedergang dieser Parteien vorausgesehen wurde, die extreme Rechte irgendwo wie aus dem Nichts emporschoß und - meist unterbesetzt und völlig unvorbereitet - ihren Platz im Parlament einnahm.
Die Tatsache, daß rechtsextreme Parteien bei manchen Wahlen beängstigende Erfolge erzielen, bei anderen jedoch nicht einmal ein Prozent erreichen, gehört nach wie vor zu den Rätseln, denen die Wahlforschung auf den Grund zu gehen versucht. Als erwiesen gilt bisher nur folgendes: Damit ein größerer Teil der Bevölkerung rechts wählt, müssen vor allem drei Bedingungen gegeben sein: Eine oder mehrere attraktive rechtsextreme Parteien, ein latent vorhandenes rechtes Einstellungspotential und eine Krisen- bzw. Umbruchsituation. Erst wenn alle drei Faktoren zusammentreffen, kommt es – zumindest in Deutschland – zu einer sogenannten rechtsextremen Welle.
Das folgende Kapitel skizziert daher die Entwicklung des rechtsextremen Parteienlagers und versucht - nach einer Definition der Begriffe Rechtsextremismus, Rechtsradikalismus, Rechtspopulismus sowie „alte“ und „neue“ Rechte - die drei wichtigsten deutschen Rechtsaußen-Parteien ideologisch und programmatisch einzuordnen. Kapitel drei beschäftigt sich mit dem rechtsextremen Einstellungspotential in der Bundesrepublik und geht der Frage nach, welche Elemente der rechtsextremen Weltanschauung seit der Nachkriegszeit an Bedeutung gewonnen bzw. verloren haben. Das vierte Kapitel zeichnet die Entwicklung der Wahlergebnisse rechter Parteien nach und konzentriert sich auf die Umstände, unter denen es diesen Parteien gelingt, das rechtsextreme Einstellungspotential zu mobilisieren und/oder Protestwähler anzusprechen. Kapitel fünf nimmt schließlich die Wähler selbst unter die Lupe. Hierbei soll untersucht werden, inwiefern die politischen, sozialen und ökonomischen Prozesse, die eine Boomphase rechtsextremer Wahlerfolge begleiten, einen Einfluß auf die Demographie, Soziographie oder Psychographie des rechten Wählerpotentials haben. Sprechen die Republikaner andere soziale Schichten, Berufs- oder Altersgruppen an als die NPD in den Sechzigern? Sind die Gründe, rechts zu wählen, in den neunziger Jahren andere als in den Achtzigern? Könnte es sein, daß die DVU sich in Zukunft auf eine andere Wählerklientel konzentrieren wird als die Republikaner? War das rechtsextreme Einstellungs- und Wählerpotential im Laufe der Jahrzehnte einem Wandel unterworfen? Stellt das Jahr 1990 tatsächlich eine entscheidende Zäsur bei der Entwicklung der Wahlergebnisse rechtsextremer Parteien dar? Hat die Wiedervereinigung Impulse geliefert, die bestimmte Veränderungen im Wählerverhalten hervorgerufen haben? Oder sind diese Veränderungen vielmehr das Ergebnis einer langfristigen Entwicklung?
Der Vergleich zwischen den einzelnen Boomphasen des parteipolitischen Rechtsextremismus ist das zentrale Element dieser Arbeit und zieht sich durch jedes einzelne Kapitel. Über das Wählerpotential der SRP ist sehr wenig bekannt, weshalb ich die erste Welle nur am Rande abhandeln werde. Auch zur DVU, die offenbar erst 1998 als demoskopisch relevant entdeckt wurde, liegt vergleichsweise wenig Datenmaterial vor. Ein ausführlicher Vergleich wird daher in erster Linie zwischen den Wählern der NPD in den sechziger Jahren und denen der Republikanern stattfinden. Zeitlich liegt der Schwerpunkt auf der sogenannten „dritten Welle“ des Rechtsextremismus, da meine Fragestellung darauf abzielt, was diese Welle von den ersten beiden unterscheidet.
1. 2. Bemerkungen zur Literatur
Unter den zahlreichen Monographien, Sammelbänden und Aufsätzen zum gegenwärtigen deutschen Rechtsextremismus nimmt die Literatur über das rechtsextreme Wählerverhalten einen vergleichsweise geringen Raum ein. Meistens wird dieses Thema lediglich in Aufsätzen abgehandelt. In vielen einschlägigen Monographien sind dem rechtsextremen Wählerpotential zwar separate Kapitel gewidmet (so z.B. in Kühnl u.a. 1969; Stöss 1990; Jaschke 1993; Pfahl-Traughber 1993; Fascher 1994; Neubacher 1996), aber Monographien, die sich ausschließlich mit Rechtswählern beschäftigen, sind bisher kaum erschienen. Bekannt sind mir - neben der Studie von Jürgen Falter (vgl. Falter 1994) - eine Untersuchung von Karl-Heinz Klär, Malte Ristau, Bernd Schoppe und Martin Stadlmaier aus dem Jahr 1989 sowie eine im Auftrag der Konrad-Adenauer-Stiftung durchgeführte Analyse der DVU-Wählerschaft in Sachsen-Anhalt. Falters Buch ist wohl die bisher umfangreichste und detaillierteste Arbeit zu diesem Thema. Leider beschränkt es sich auf eine Analyse der Wählerschaft von Republikanern, NPD und DVU in den achtziger und frühen neunziger Jahren - also während der sogenannten dritten Welle des Rechtsextremismus in der Bundesrepublik. Die Studie von Klär u.a. trifft zwar eine repräsentative Auswahl für das gesamte Bundesgebiet, bezieht sich aber ausschließlich auf die Wähler der Republikaner (vgl. Klär u.a. 1989). Noch enger gefaßt ist die Untersuchung von Viola Neu und Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, befaßt sie sich doch nur mit der 1998-er Landtagswahl in Sachsen-Anhalt (vgl. Neu/Wilamowitz-Moellendorff 1998).
Wenn es darum geht, Vergleiche zwischen den einzelnen Boomphasen des parteipolitisch organisierten Rechtsextremismus anzustellen, sind die entsprechenden Beträge in der wissenschaftlichen Literatur ausgesprochen dünn gesät. Auch hier gibt es wiederum einige Aufsätze (z.B. Winkler 1994). Unter den Monographien ist besonders die Studie von Eckhard Fascher hervorzuheben, die sich ausführlich mit der Entstehungsgeschichte und Entwicklung der NPD und der Republikaner beschäftigt (vgl. Fascher 1994). Darin findet sich auch eine vergleichende Analyse der Wählerstruktur beider Parteien.
Problematisch ist meines Erachtens außerdem, daß die meisten Publikationen über „die Rechtswähler“ kaum oder gar nicht zwischen die Wählern der einzelnen Parteien differenzieren. Falter stellt zumindest Vergleiche zwischen der Wählerstruktur in Schleswig-Holstein als Hochburg der DVU und Baden-Württemberg als wichtigster Bastion der Republikaner an (vgl. Falter 1994: 55ff.). Michael Minkenberg bemerkt in einem Aufsatz zur radikalen Rechten in Ostdeutschland, daß die DVU besonders in den neuen Ländern Fuß zu fassen scheint, während die REPs auch zehn Jahre nach der Einheit eine Westpartei bleiben (vgl. Minkenberg 2000). Man kann vermuten, daß sich die „typischen“ Wähler von REP und DVU bei genauerer Betrachtung nur unwesentlich unterscheiden, da es auch zwischen den Programminhalten beider Parteien kaum Unterschiede gibt. Aber da eine Besonderheit der „dritten Welle“ darin besteht, daß zwei (mehr oder weniger) erfolgreiche rechte Parteien miteinander konkurrieren, wäre es möglich, daß die Wählerklientel der DVU bereits heute beginnt, sich von den Anhängern der Republikaner abzuheben.
2. Rechtsextremismus - Begriff und Parteienlandschaft
2. 1. Rechtsextremismus und -radikalismus
Als Synonym für antidemokratische bzw. verfassungsfeindliche Bewegungen hat Extremismus den in den ersten zwei Nachkriegsjahrzehnten verwendeten Begriff Radikalismus abgelöst (vgl. Jesse 1997: 156). „Seit 1974 verwenden die Verfassungsschutzbehörden in ihren Jahresberichten den Begriff ‘Rechtsextremismus’, nachdem bis dahin stets von ‘Rechtsradikalismus’ die Rede gewesen war ... Etwa zur gleichen Zeit fand der Extremismus-Begriff Eingang in die Sozialwissenschaften“ (Jaschke 1994: 25 u. 27; vgl. auch Gessenharter 1998: 30).
Einigkeit herrscht darin, daß der Extremismusbegriff eine Abgrenzung zum modernen demokratischen Verfassungsstaat darstellt und der politische Extremismus darauf ausgerichtet ist, die freiheitlich demokratische Grundordnung zu beseitigen (vgl. Jesse 1997: 155; Jaschke 1994: 26). Extremismus zeichnet sich aus durch ein hohes Maß an ideologischem Dogmatismus, Fanatismus, Freund-Feind-Stereotype, den Glauben ein objektiv erkennbares und vorgegebenes Gemeinwohl, ein heftiges Missionsbewußtsein seiner Anhänger sowie ein antipluralistisches Politik- und Gesellschaftsverständnis, basierend auf der Auffassung von der Homogenität des Volkes (vgl. Backes 1989; Jesse 1997: 155; Pfahl-Traughber 1999: 12f.).
In seinen politischen Zielen und Mitteln zeigt sich der Extremismus äußerst vielfältig. Die Spannweite reicht bei den Ausdrucksformen von systematischer politischer Gewalt (Terroris-mus) bis hin zu einer formalen Einhaltung der gesellschaftlichen Spielregeln aus taktischen Gründen. Was die politischen Ziele betrifft, unterscheidet man in erster Linie zwischen Rechts- und Linksextremismus: Der Rechtsextremismus basiert im Gegensatz zum Linksextremismus auf einer Ideologie der Ungleichheit. (vgl. Pfahl-Traughber 1999: 13ff.; Jesse 1997: 156). Aus objektiv bestehenden Unterschieden zwischen den Individuen wird eine Ungleichwertigkeit der jeweiligen Menschen abgeleitet (vgl. Pfahl-Traughber 1999: 14). Diese „Hierarchisierung in hö-herwertige und minderwertige Menschengruppen“ (Pfahl-Traughber 1999: 14), die alle rechts-extremistischen Ideologien[4] verbindet, bringt Geisteshaltungen wie Nationalismus, Rassismus, Antisemitismus, Ethnozentrismus, Wohlstandschauvinismus oder Sexismus hervor. Selbst der ebenfalls allen rechtsextremistischen Strömungen eigene Autoritarismus und Führerkult hat im Grunde seinen Ursprung in dieser Ideologie der Ungleichheit: Der unerschütterliche Glaube an die alleinige Lösungskompetenz eines „Führers“, an die Hierarchie, an „Law and Order“, einen starken Staat usw. setzt die Akzeptanz einseitiger Dominanzverhältnisse voraus. Damit wird
meines Erachtens eine Minderwertigkeit der „Schwachen“ und Unterlegenen impliziert.
Hans-Gerd Jaschke führt diese ideologischen Besonderheiten des Rechtsextremismus auf eine Art sozialbiologistische Mystifizierung der Natur zurück. Dazu gehört der darwinistische Bezug auf das Gesetz vom Überleben des Stärkeren und die Vorstellung, daß das Führerprinzip einer natürlichen sozialen Auslese folgt (vgl. Jaschke 1994: 55). „Gegen die emanzipativen Bewegungen seit der Aufklärung, gegen die kantsche Idee der Befreiung des Menschen aus selbstverschuldeter Unmündigkeit setzt die extreme Rechte die Verwurzelung des Individuums in Familie, Volk, Nation und Tradition einerseits und seine genetische Determination andererseits“ (Jaschke 1994: 56).
Eckhard Fascher sieht den Rechtsextremismus in erster Linie als Produkt autoritärer Charakterstrukturen. Dabei bezieht er sich vor allem auf die Autoritarismus-Studien von Theodor Adorno und die These Max Horkheimers, „wonach eine autoritäre Erziehung zu einer Identifizierung mit den in der Gesellschaft dominierenden Kräften führen kann und die aufgestauten Aggressionen auf Minderheiten und Schwächere abgewälzt werden“ (Fascher 1994: 12; vgl. auch: Adorno 1973: 322ff.; Horkheimer 1968: 340ff.). Fascher kommt daher zu dem Schluß, daß der Rechtsextremismus nur die krasseste Form eines weit verbreiteten autoritären Bewußtsein darstellt. „So können die rechtsextremen Parteien in ihrer Ideologie an bereits in der Bevölkerung stark verbreitete Stimmungen und Meinungen anknüpfen, die nicht unbedingt mit dem eigentlichen Rechtsextremismus gleichzusetzen sind“ (Fascher 1994: 13).
Jaschke, der ein besonderes Augenmerk auf das Phänomen Fremdenfeindlichkeit legt, gelangt zu folgender Definition: „Unter Rechtsextremismus verstehen wir insbesondere Zielsetzungen, die den Individualismus aufheben wollen zugunsten einer völkischen, kollektivistischen, ethnisch homogenen Gemeinschaft in einem starken Nationalstaat und in Verbindung damit den Multikulturalismus ablehnen und entschieden bekämpfen.“ (Jaschke 1994: 31).
Viele Wissenschaftler definieren den Rechtsextremismus in erster Linie über seine einzelnen Ideologieelemente. Ulrich Druwe nennt da insbesondere: Ethnozentrismus, Xenophobie, Rigidität des Denkens, Autoritarismus, Sexismus, Rassismus, Nationalismus, Antisemitismus, Antipluralismus, Antiindividualismus und Militarismus (vgl. Druwe 1996). Eine neuere empirische Jugendstudie macht das Phänomen Rechtsextremismus an folgenden Einstellungskomponenten fest: Übersteigerter Nationalismus, Kollektivismus, Demokratiefeindlichkeit, Antipluralismus, autoritäres Gesellschaftsbild, Ausländerfeindlichkeit und Antisemitismus, Vorurteile und Stereotypen, Freund-Feind-Denken, verklärtes Geschichtsbild (vgl. Diesler 1997: 87).
Wilhelm Heitmeyer hat in seinen empirischen Untersuchungen Rechtsextremismus nur noch über zwei Dimensionen definiert, nämlich Gewaltbereitschaft und die Akzeptanz der Ideologie der Ungleichheit (vgl. Heitmeyer 1987). Dieser Ansatz erscheint mir besonders fragwürdig, da Gewalt in erster Linie von Jugendlichen - und da auch von linksradikalen Tätern - ausgeübt wird und Parteien wie die Republikaner trotz ihrer legalistischen Taktik als rechtsextrem anzusehen sind. Weiterhin ist die Ideologie der Ungleichheit zwar der Kern des rechtsextremistischen Gedankengutes, doch als Erklärungsansatz reicht das meines Erachtens nicht aus, um das Phänomen Rechtsextremismus in seiner ganzen Komplexität zu erfassen.
Richard Stöss bemängelt, daß die verschiedenen Autor(inn)en sich in der Regel eines sehr persönlichen Forschungsdesigns bedienen würden, „ohne andere zur Kenntnis zu nehmen oder gar zu berücksichtigen“ (Stöss 1994: 24.). Eine auch nur halbwegs anerkannte Definition läge daher seines Erachtens nicht vor. In diesem Sinne sei Rechtsextremismus „allenfalls ein diffuser Sammelbegriff für verschiedenartige gesellschaftliche Erscheinungsformen, die als rechtsgerichtet, undemokratisch und inhuman gelten“ (Stöss 1994: 25f.).
Daß Stöss und alle anderen Sozialwissenschaftler, die die Rechtsextremismusforschung karikierend als „one man = one approach“ (Neureiter 1996)[5] beschreiben, nicht ganz Unrecht haben, zeigt das hohe Maß an Unklarheit und Widersprüchlichkeit, das bei der Unterscheidung der Begriffe Rechtsextremismus und -radikalismus an den Tag gelegt wird. So geht der „Mainstream“ in der wissenschaftlichen Debatte, aber auch im öffentlichen Sprachgebrauch dahin, die Bezeichnung „rechtsradikal“ auf alle politischen Strömungen anzuwenden, die nicht eindeutig auf die Beseitigung zentraler Bestandteile der freiheitlich demokratischen Grundordnung gerichtet sind, sich jedoch am äußersten rechten Rand des Verfassungsrahmens bewegen. Rechtsradikalismus umfaßt demgemäß nationalistische, autoritäre und reaktionäre Positionen und richtet sich vor allem gegen Pluralismus, „Überfremdung“, Internationalismus, Individualismus und die Politik der etablierten Parteien. Als „rechtsextremistisch“ werden Parteien und Organisationen bezeichnet, deren Politik und Ideologie die Ablehnung der wesentlichen Prinzipien des demokratischen Verfassungsstaates - d.h. Menschen- und Bürgerrechte, Freiheit, Gleichheit, Demokratie, Gewaltenteilung und Pluralismus - beinhaltet. Hinzu kommen ein extremer Nationalismus, Rassismus und das Führerprinzip (vgl. Kowalsky/Schröder 1994; Lepszy/Veen 1993: 101f.). Nach diesem Verständnis wäre also Rechtsradikalismus eine „abgeschwächte und zugleich breiter angelegte Version des Begriffs Rechtsextremismus“ (Jaschke 1994: 28).
Daß es auch Ansätze gibt, die dieser Auffassung völlig zuwiderlaufen, zeigt beispielsweise die Definition von Hans-Uwe Otto und Roland Merten: „Rechtsradikal sollen demnach nur solche Einstellungen und Handlungen heißen, in denen zur Durchsetzung der rechtsextremen Zielsetzungen Gewalt als legitimes Mittel akzeptiert wird“ (Otto/Merten 1993: 19). Doch selbst wenn man so „denkwürdige Sumpfblüten“ (Jaschke 1994: 28) außer Acht läßt, macht es die geringe Trennschärfe der einzelnen Definitionen schwierig, eine bestimmte Partei oder Organisation eindeutig als „rechtsextrem“ einzustufen.
Das einzige, was als unumstritten gilt, sind die juristischen Kriterien für Verfassungswidrigkeit, obwohl die Verfassungsschutzpraxis zwischen dem Bund und den einzelnen Ländern z. T. stark divergiert und auch die Inhalte des Begriffes Rechtsextremismus von Verfassungsschutzbericht zu Verfassungsschutzbericht variieren (vgl. Gessenharter 1998: 28ff.). Vergleichsweise klar ist hier allerdings die Abgrenzung von Rechtsextremismus und Rechtsradikalismus. Im verfassungsrechtlichen Diskurs wird davon ausgegangen, „daß politische Aktivitäten oder Organisationen nicht schon deshalb verfassungsfeindlich sind, weil sie eine bestimmte ... ‘radikale’, d.h. an die Wurzel einer Fragestellung gehende Zielsetzung haben“ (Bundesministerium des Inneren 1993: 4). Extremistisch und damit verfassungsfeindlich sind Parteien bzw. Organisationen mit „radikalen“ Programminhalten demnach erst dann, „wenn erkennbar wird, daß die Absicht besteht, derartige Vorstellungen mit eindeutig politischer Zielrichtung ... in die Tat umzusetzen“ (Schelter 1997, Bd.1: 194) und sich somit gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung zu richten. Wegen der Uneinigkeit, die in der Wissenschaft bei der Begriffsbestimmung von Rechtsextremismus herrscht, wird sich in der öffentlichen Debatte meist auf die Sichtweise des Verfassungsschutzes bezogen. Wolfgang Gessenharter spricht von einer regelrechten „Definitionsmacht der Verfassungsschutzämter“ (Gessenharter 1998: 31). Thomas Assheuer und Hans Sarkowicz verwenden sogar ganz bewußt den Begriff Rechtsradikalismus, da Rechtsextremismus „von der Sozialwissenschaft und dem Verfassungsgericht definitorisch besetzt“ sei (Assheuer/Sarkowicz 1992: 10). Obwohl mir offen gestanden unklar ist, was genau Assheuer und Sarkowicz damit meinen, wird anhand der Begriffsdebatte um Rechtsextremismus und -radi-kalismus vor allem eines deutlich: Es ist heute ausnehmend schwierig, „zweifelsfrei Verstöße gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung festzustellen“ (Gessenharter 1998: 29), denn gerade die modernen Rechtsparteien verstehen es sehr geschickt, ihre wahren Ziele hinter einer „demokratischen Lackschicht“ zu verbergen.
2. 2. Rechtspopulismus
Populismus ist keine Ideologie, sondern eine Politikform, die sich auf bestimmte Verfahren zur Mobilisierung von Massen konzentriert. „Dieses Verständnis definiert Populismus ... als eine besondere Wechselbeziehung zwischen einem Akteur und seinem Publikum. Einer solchen Kommunikationsform können sich dann auch ganz unterschiedliche Träger bedienen: Linke wie Rechte, Demokraten wie Extremisten, Politiker wie soziale Bewegungen“ (Pfahl-Traughber 1994: 18). Populisten präsentieren sich als Anwalt der „kleinen Leute“, sie appellieren an „das Volk“, nicht an bestimmte Klassen, Schichten oder Interessengruppen (vgl. Jaschke 1994: 32). Die populistische Agitation bedient sich am „Stammtisch-Diskurs“, an diffusen Einstellungen, Emotionen und Vorurteilen, sie knüpft am „Alltagsverstand“ an, an den „Volkstraditionen und der Volksmoral“ (vgl. Pfahl-Traughber 1994: 19; Glotz 1989: 41).
Populistische Taktiken müssen sich nicht notwendigerweise gegen die Wertvorstellungen eines demokratischen Verfassungsstaates wenden, aber indem der Populismus das Volk als Einheit versteht, ist ihm ein „antipluralistischer und identitärer Zug eigen“ (Pfahl-Traughber 1994: 18). Zudem werden dabei politische und soziale Probleme stark vereinfacht dargestellt und in vielen Fällen auf eine einzige Ursache reduziert (vgl. Pfahl-Traughber 1994: 19). Die wahre Komplexität politischer Prozesse wird also durch den Populismus verschleiert.
Typisch für die rechtspopulistische Agitation ist das Schüren von Ressentiments und Vorurteilen gegen Migranten, „Scheinasylanten“ und „kriminelle Ausländer“, die in sozialen Krisensituationen gern zu Sündenböcken erklärt werden. Die Themen der rechtspopulistischen Parteien in (West-)Europa zielen im wesentlichen auf die „Verteidigung und Rückeroberung von Lebens- und Wohlstandsniveaus gegen die vorgebliche Bedrohung von Migranten aus dem Süden und die Bewahrung der völkischen und territorialen Identität“ (Jaschke 1994: 32). Der multikulturellen Gesellschaft wird von den Rechtspopulisten die Vision einer ethnisch homogenen Volksgemeinschaft entgegengesetzt, gegen die Unsicherheiten, die die Modernisierung mit sich bringt, werden traditionelle Werte als Orientierungsmaßstab angeboten (vgl. Jaschke 1994: 33). (Rechts-)populistische Parteien profitieren von jener „Entfremdung zwischen der Bevölkerung und den politischen Parteien und Institutionen, die in den neunziger Jahren zu einem bedrohlichen Krisenfaktor in der europäischen Politik geworden ist“ (Jaschke 1994: 33).
Armin Pfahl-Traughber differenziert außerdem zwischen Rechtspopulisten und rechtsextremen Populisten, da sich auch Vertreter des demokratischen Konservatismus gelegentlich rechtspopulistischer Agitationstaktiken bedienen. Rechtsextremer Populismus bedeutet also, daß die Inhalte, die durch populistische Agitation in die Öffentlichkeit transportiert werden, im Sinne der oben genannten Definitionsmerkmale als „rechtsextrem“ eingeschätzt werden können (vgl. Pfahl-Traughber 1994: 21). Doch wie bereits erwähnt, ist Rechtsextremismus selbst ein wenig trennscharfer Begriff, so daß auch die Unterschiede zwischen Rechtspopulismus und rechtsextremem Populismus in einer Grauzone verschwimmen. Wann immer hier also von „Rechtspopulismus“ die Rede ist, steht dieser Begriff im Zusammenhang mit dem öffentlichen Auftreten von Rechtsaußen-Parteien.
2. 3. Die „alte“ und die „neue“ Rechte
Wenn bereits Rechtsextremismus und Rechtspopulismus diffuse Begriffe sind, gilt das meines Erachtens erst recht für den Terminus „Neue Rechte“. In der öffentlichen Debatte kennzeichnet er die erfolgreichen Rechtsaußen-Parteien (Republikaner, DVU) genauso wie die jüngeren intellektuellen Rechten, etwa um die Zeitschrift „Junge Freiheit“ (vgl. Jaschke 1994: 43).
Jaschke reserviert daher die Bezeichnung „Neue Rechte“ für „jene kleinen intellektuellen Zirkel der Nachkriegsgeneration, die bemüht sind, die Ideen der Weimarer ‘konservativen Revolution’ aufzugreifen und daraus ein analytisches und programmatisches Konzept für die Gegenwart zu erstellen“ (Jaschke 1994: 43).
Edgar Julius Jung, einer der geistigen Väter der „konservativen Revolution“, hat diesen „antagonistisch wirkenden Begriff“ (Pfahl-Traughber 1999: 44) folgendermaßen definiert: „Konservative Revolution nennen wir die Wiederinachtsetzung aller jener elementaren Gesetze und Werte, ohne welche der Mensch den Zusammenhang mit der Natur und mit Gott verliert und keine wahre Ordnung aufbauen kann. An die Stelle der Gleichheit tritt die innere Wertigkeit, an die Stelle der mechanischen Wahl das organische Führerwachstum, an die Stelle bürokratischen Zwangs die innere Verantwortung echter Selbstverwaltung, an die Stelle des Massenglücks das Recht der Volksgemeinschaft“ (Jung 1932: 380).
Der Weimarer Staatsrechtsgelehrte Carl Schmitt, ebenfalls einer der führenden Köpfe dieser geistigen Strömung, sieht die Unterscheidung zwischen Freund und Feind als primäre Voraussetzung für die Politik schlechthin. Demzufolge war Schmitt ein erklärter Gegner des Pluralismus und Parlamentarismus, denn die Fähigkeit eines starken Staates, über den Ausnahmefall zu entscheiden und innere Feinde zu bekämpfen, wurde seiner Ansicht nach dadurch zugrunde gerichtet (vgl. Schmitt 1987). Von der parlamentarischen Demokratie mit ihrem allgemeinen und gleichen Wahlrecht hieß es in einer Schrift Ottmar Spanns, sie würde „das Niedere herrschend machen über das Höhere“ (Spann 1931: 101).
Doch was ist nun neu oder gar „revolutionär“ an einer Bewegung, die ihre Ideen „aus der Mottenkiste reaktionärer Literatur“ (Stöss 1994: 45) bezieht? „Tatsächlich unterscheidet sich das, was sich selbst als neu-rechts präsentiert oder dafür gehalten wird, in der Substanz kaum von der Weltanschauung der Alten Rechten“ bemerkt Stöss, zumal sich sowohl die Alte als auch die Neue Rechte auf die konservative Revolution beziehen, die somit als Abgrenzungsmerkmal untauglich ist (Stöss 1994: 39). Das einzige brauchbare Unterscheidungskriterium sei daher, ob eine Bewegung sich vorrangig an alten d.h. vor dem Zweiten Weltkrieg entwickelten Denkmustern orientiert oder ob sie sich um „zeitgemäße“ Konzepte und Erklärungsmuster bemüht. Somit begreift sich die Alte Rechte entweder in der Tradition des Deutschnationalismus oder des Nationalsozialismus, während sich die Neue Rechte vor allem durch eine andere Sicht von Nation und Rassismus abhebt. Dazu äußert sich Stöss: „Rassistische Vorurteile lassen sich nicht mehr dadurch mobilisieren, daß man den Deutschen erklärt, sie seien Arier, als solche besonders hochwertig und zu Herrenmenschen prädestiniert. Opas Rassismus ist tot. Angesagt ist Ethnopluralismus, die Lehre von der Bewahrung der Identität prinzipiell gleichwertiger aber verschiedenartiger Völker bzw. Rassen durch räumliche Separierung. Die Parole ‘Ausländer raus’ verdankt ihre Popularität nicht irgendwelchen ideologischen Traditionen, sondern der heutigen globalen Problemlage“ (Stöss 1994: 45). Der Begriff „Ethnopluralismus“ wurde von dem neurechten Vordenker Hennig Eichberg in die Diskussion gebracht. Um dem Unterschied zum Rassismus der Nationalsozialisten hervorzuheben, wird hier unterdrückten Völkern das Recht auf „Befreiungsnationalismus“ zugesprochen - einen regionalen Nationalismus von unten gegen den „System-Imperialismus“ von oben (vgl. Jaschke 1994: 49). Daß die Abschottung der einzelnen Ethnien und Völker Vorurteile provoziert und letztendlich die Abschiebung von Ausländern legitimiert, sollte dabei nicht vergessen werden.
Mit ihrem Bezug auf die konservative Weimarer Staatsrechtslehre, ergänzt durch ethnozentristische und kulturkämpferische Positionen, haben die modernen rechten Intellektuellenzirkel Brücken zwischen dem etablierten Konservativismus und rechtsextremen Positionen geschlagen (vgl. Assheuer/Sarkovicz 1992: 10; Jaschke 1994: 51; Pfahl-Traughber 1999: 46). Auch die neueren Rechtsaußen-Parteien, insbesondere die Republikaner, bedienen sich in ihren Programmatiken der Vorarbeiten dieser rechten Intellektuellenszene (vgl. Jaschke 1994: 49).
2. 4. Das rechtsextreme Parteienlager
Der diffuse Charakter der Begriffe Rechtsextremismus, Rechtsradikalismus, „Alte Rechte“ und „Neue Rechte“ macht es freilich nicht einfach, die drei wichtigsten deutschen Rechtsaußen-Parteien NPD, Republikaner und DVU dementsprechend einzuordnen.
Bei der Definition des Begriffs Rechtsextremismus scheinen sich die verschiedenen Autoren zumindest einig, daß der Rechtsextremismus eine Ideologie der Ungleichheit darstellt. Auch bezüglich seiner einzelnen Ideologieelemente scheinen kaum Differenzen zu bestehen. Uneinig ist man sich dagegen, welche dieser Ideologieelemente besonders charakteristisch für den Rechtsextremismus sind und was Rechtsextremismus von Rechtsradikalismus unterscheidet. Bei letzterem werde ich mich auf die Definition des Verfassungsschutzes beziehen, wonach „rechtsextrem“ gleichzusetzen ist mit eindeutig verfassungsfeindlich und „rechtsradikal“ eine Grauzone zwischen Rechtskonservativismus und Rechtsextremismus bezeichnet. Die Klassifizierung „Alte“ oder „neue“ Rechte bezieht sich hier auf den entstehungsgeschichtlichen Hintergrund einer Partei, ihre ideologischen Wurzeln sowie das Maß an NS-Apologetik und Vergangenheitsorientierung in ihren Programmen.
2. 4. 1. Die NPD - Partei der ewiggestrigen Altnazis?
In den sechziger Jahren hatte sich die NPD als Auffangbecken für die zerfallenden rechtsextremen Nachkriegsparteien angeboten, von denen sich einige - speziell die SRP - eindeutig am Vorbild des Nationalsozialismus orientiert hatten. Im Gegensatz zu ihren Vorläuferorganisationen vermied es die NPD allerdings, ideologische Verwandtschaft zur NSDAP zu bekunden und bekannte sich formal zu Demokratie und Rechtsstaatlichkeit (vgl. Pfahl-Traughber 1999: 25). Sie verstand sich nicht als Partei der „Ewiggestrigen“, sondern wollte mit den Erinnerungen an Hitlerdeutschland und der Verantwortung für die Folgen des Nationalsozialismus endgültig Schluß machen (vgl. Maier/Bott 1968: 41).
Zum öffentlichen Erscheinungsbild der NPD in den sechziger Jahren schreibt Bernd Neubacher: „Das Verständnis der NPD als legal taktierende Nachfolgeorganisation der NSDAP griff zu kurz. Diese eindeutige Qualifizierung ließ zum einen die innerparteiliche Zerrissenheit und Fraktionierung außer acht, zum anderen stammten zahlreiche Mitglieder nicht aus dem Nationalsozialismus, sondern aus dem Spektrum der zuvor Unionspolitischen oder von Strukturkrisen bedrohten Mittelständischen. Darüber hinaus verfolgte die NPD in den Parlamenten einen Legalismus, der nicht nur taktisch motiviert war, sondern sich durch eine konservative Interpretation des Rechtsstaats- und Parlamentarismusbegriffs am ehesten eine Abwehr gesellschaftlicher Demokratisierung versprach“ (Neubacher 1996: 32f; vgl. auch Dudek/Jaschke 1984, Bd.1: 350; Niethammer 1969: 162 u. 168).
Der pluralistischen Demokratie setzte die NPD ihre Ideologie des „völkischen Kollektivismus“ entgegen, für die Zersetzung des Staates und der traditionellen Werte machte sie eine Verschwörung aus APO, Kommunisten, Liberalen und Gewerkschaften verantwortlich, sie solidarisierte sich mit dem Portugal Salazars und der letzten „weißen Bastion“ Südafrika, erhob Anspruch auf Deutschland in den Grenzen von 1937, verharmloste die Verbrechen der NS-Diktatur und war nicht bereit, die deutsch(sprachig)en Juden als Teil des deutschen Volkes anzuerkennen. Weiterhin propagierte die NPD ein patriarchalisches Frauen- und Familienbild und wetterte gegen die Zersetzung der deutschen Kultur durch amerikanische Einflüsse (vgl. Fascher 1994: 150-180). Die schärfsten rechtsextremen Positionen fanden sich jedoch nicht in den Parteiprogrammen oder im Wahlkampfmaterial, sondern vor allem in der Parteipresse (z.B. „Deutsche Nachrichten“) den Reden der Funktionäre oder dem zwischen 1966 und 1971 herausgegebenen „Politischen Lexikon“ der NPD (vgl. Pfahl-Traughber 1999: 26).
Durch militante Erscheinungsformen an der Basis und Spaltungstendenzen verspielte die Partei allerhand Anerkennung, so daß sie bei der Bundestagswahl 1969 an der 5%-Hürde scheiterte. Mit ihrer anschließenden Radikalisierung drängte sie sich selbst ins politische Abseits (vgl. Dudek/Jaschke 1984, Bd.1: 301 u. 336). Ihrem eigenen Anspruch als neue, „salonfähige“ nationalkonservative Partei wurde die NPD also nicht gerecht.
In den achtziger Jahren versuchte sie ihrem Dasein als bedeutungslose Splitterpartei durch eine programmatische Erneuerung entgegenzuwirken. Ihre Versuche, mit Programmpunkten zur „Ausländerproblematik“, ökologischen Forderungen und dem Anknüpfen an Positionen der Friedensbewegung jüngere Wähler anzusprechen, waren jedoch von wenig Erfolg gekrönt (vgl. Fascher 1994: 125f.; Neubacher 1996: 34). Im Programm von 1987 wurden offen rechtsextremistische Äußerungen durch vage, inhaltsarme Formulierungen ersetzt, die den Eindruck einer gemäßigten Organisation erwecken sollten (vgl. Pfahl-Traughber 1993).
Dennoch gelang es der NPD auch in den neunziger Jahren nicht, sich von ihrem neonazistischen Image zu lösen. Progammatisch konzentrierte sie sich nun auf Statements zur Ausländerpolitik und geschichtsrevisionistische Themen (vgl. Wagner 1992). Die Inhaftierung ihres Parteivorsitzenden Günter Deckert wegen Unterstützung der Holocaust-Leugner (vgl. Pfahl-Traughber 1999: 35) trug nicht gerade dazu bei, das Ansehen der Partei zu steigern.
Unter ihrem neuen Vorsitzenden Udo Voigt begann eine „inhaltliche Neuorientierung, die insbesondere sozialpolitische Themen in rechtsextremistischer Deutung aufgriff und verstärkter sowohl nationalrevolutionäre als auch nationalsozialistische Ideologiefragmente propagandistisch nutzte. Insbesondere fällt dabei eine aggressive antikapitalistische Demagogie auf, die Ängste vor Arbeitslosigkeit und sozialen Krisen schürt und vor allem Jugendliche aus den unteren sozialen Schichten ansprechen will“ (Pfahl-Traughber 1999: 36). Zugleich öffnete sich die NPD gegenüber Neonazis, was zwar die Mitgliederzahlen steigen ließ, aber die Partei aus der Sicht vieler Wähler noch mehr stigmatisierte (vgl. Pfahl-Traughber 1999: 36).
Am rechtsextremistischen Charakter der NPD kann kein Zweifel bestehen. Die Tatsache, daß sie eindeutig verfassungsfeindliche Ziele vertritt und diese auch aggressiv-kämpferisch durchzusetzen versucht, brachte die Bundesregierung im Jahr 2000 dazu, einen Verbotsantrag gegen diese Partei zu stellen (vgl. Berliner Zeitung v.12.12.2000).
Obwohl die NPD weder in den sechziger Jahren noch später als neo-nationalsozialistisch eingeschätzt werden konnte und sich von Anfang an an der Traditionslinie des Deutsch-Nationalismus orientierte (vgl. Pfahl-Traughber 1993: 68f.) ist sie als Relikt der „Alten Rechten“ anzusehen. Indem sie nicht nur - wie andere rechtsextreme Parteien - die Verbrechen des Nationalsozialismus verharmlost und gegen die „Kollektivschuld“ der Deutschen am Zweiten Weltkrieg kämpft, sondern auch Bestandteile der nationalsozialistischen Ideologie in ihre Programme integriert, gilt sie als stark vergangenheitsorientiert. Die heutige Bedeutungslosigkeit der NPD bei Wahlen ist sowohl eine Folge dieser Vergangenheitsorientierung, als auch ihres selbstverschuldeten schlechten Rufes.
2. 4. 2. Die Republikaner - Eine moderne rechtspopulistische Partei?
Von ihrer Gründungsgeschichte her betrachtet sind die Republikaner keine Partei mit rechtsextremistischem Hintergrund. In ihrer Eigenschaft als Abspaltung unzufriedener Unionsanhänger hatte die 1983 gegründete Partei am Anfang noch kein klares politisches Konzept und war somit offen für die unterschiedlichsten politischen Strömungen rechts von der Mitte (vgl. Pfahl-Traughber 1994: 66).
Zur ursprünglichen Führungstroika gehörten zwei ehemalige CSU-Bundestagsabgeordnete: Franz Handlos und Eckhard Voigt. Der Dritte im Bundes war der Fernsehjournalist Franz Schönhuber, der 1981 vom Bayrischen Rundfunk entlassen worden war, nachdem sein autobiographisches Buch „Ich war dabei“ wegen apologetischer Äußerungen über die Waffen-SS massive öffentliche Proteste hervorgerufen hatte (vgl. Assheuer/Sarkowicz 1992: 42; Pfahl-Traugh-ber 1994: 65f.). Dieser unterschiedliche politische Hintergrund der drei Parteiaktivisten ließ die Debatte um das künftige politische Profil der Republikaner schließlich sehr kontrovers geraten. „Es bestand folgende Alternative: eine rechtskonservative Partei als Alternative zur CSU, aber ausgedehnt auf das gesamte Bundesgebiet, oder eine modernisierte rechtsextreme Partei mit populistischem Charakter im Sinne des französischen FN ... Handlos vertrat die erste, Schönhuber die zweite Variante.“ (Pfahl-Traughber 1994: 66). Letztendlich setzte sich Schönhuber durch, was vermutlich daran lag, daß er als einziger im „Triumvirat“ klare Zielvorstellungen hatte. „Auf lange Sicht wollte er am rechten Rand eine Partei etablieren, die in ihren Ansichten radikaler sein sollte als die CSU, sich aber trotzdem wirkungsvoll von NPD und DVU abgrenzen würde. Schönhuber hatte, vereinfacht ausgedrückt, alle Wähler im Auge, denen die CSU zu links und die NPD zu rechts oder zu wirkungslos war“ (Assheuer/Sarkowicz 1992: 42). Handlos warf Schönhuber vor, er wolle die Partei von rechts unterwandern - ein Vorwurf, der nicht unbegründet war, hatte doch Schönhuber im Laufe der Gründungsphase zahlreiche ehemalige NPD-Mitglieder für die Republikaner rekrutiert und zum Teil in hohe politische Ämter gebracht (vgl. Pfahl-Traughber 1994: 67).
In seinem Abgrenzungskurs gegenüber der CSU einerseits und der Extremen Rechten andererseits drängte Schönhuber jene Kräfte aus der Partei, die von der ihm vorschwebenden Parteilinie zu stark abwichen. Zu den ersten, die auf seiner „schwarzen Liste“ erschienen, gehörten seine beiden „Mitregenten“ Handlos und Voigt: Handlos, der von seiner konservativen, im Vergleich zu Schönhuber gemäßigten Position nicht abwich und Voigt, der als Rechtsaußen des Triumvirats galt. Beide verließen 1985 die REP (vgl. Assheuer/Sarkowicz 1992: 43).
Schönhuber, der jetzt geradezu unangefochten über seine Partei herrschte, praktizierte einen autoritären Führungsstil, der sich in willkürlichen Entscheidungen, mangelnder bis fehlender Basisdemokratie und einem regelrechten „Schönhuber-Personenkult“ manifestierte (vgl. Pfahl-Traughber 1993: 41 u. 43ff.). Doch nicht nur mit diesem innerparteilichen Führer-Gefolg-schafts-Prinzip bewiesen die Republikaner ihren Charakter als rechtsextreme Partei[6]. Auch programmatisch orientierten sich die REP immer weiter zur extremen Rechten hin. Während das „Siegburger Manifest“ vom Juni 1985 lediglich sehr allgemeine Forderungen enthielt, zeigte sich im Programm von 1987 bereits die nationalistische Grundorientierung der Partei: Einsetzen wollte man sich lediglich für das „Lebensrecht und die Menschenrechte aller Deutschen“, ohne die Exklusivität des „Deutschseins“ zu begründen. Man ging von der Existenz einer „Lebens-, Leistungs- und Wertegemeinschaft aller“ aus und verdrängte damit die real existierenden Differenzen zwischen Klassen und Interessengruppen. Individual- und Gruppeninteressen sollten sich bedingungslos dieser imaginären Gemeinschaft unterordnen, wobei dem Staat als Verkörperung des „Ganzen“ ein besonderes Maß an Souveränität zugemessen wurde (vgl. Programm der Republikaner 1987). In diesem Programm wird mehr als deutlich, daß „der autoritäre Ordnungs- und Nationalstaat und nicht die Republik, wie der Parteiname verheißt“ (Pfahl-Traughber 1993: 35), das wahre politische Ziel der Schönhuber-Partei ist. Weiterhin werden im Programm von 1987 eine biologistische Frauen- und Familienideologie vertreten, NS-Ver-brechen verharmlost und Ausländern Rechte auf verschiedenen Ebenen aberkannt. In den Programmen von 1990 und 1993 wurden diese Positionen zwar durch eine veränderte Wortwahl abgemildert, doch es handelte sich lediglich um eine verbale Revision, die nichts an den rechtsextremistischen Grundpositionen der Partei änderte (vgl. Pfahl-Traughber 1994: 67f.).
„Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, daß Schönhuber in der Phase sinkender Zustimmung bei Wahlen die Nähe zum DVU-Vorsitzenden Frey suchte, was starken innerparteilichen Unmut auslöste und 1994 zu seiner Ablösung durch den bislang als ‘Kronprinz’ geltenden Rolf Schlierer an der Parteispitze führte... Der langjährige Vorsitzende der REP trat zwischendurch aus der Partei aus und äußerte sich nun, taktischer Rücksichtnahmen ledig, sehr klar im rechtsextremistischen Sinne, teilweise mit deutlichen Sympathien gegenüber dem italienischen Faschismus oder dem ‘linken’ Flügel der NSDAP“ (Pfahl-Traughber 1999: 32). Schlierer führte unterdessen, besorgt um das Image seiner Partei, den strengen Abgrenzungskurs gegenüber DVU, NPD und Neonazi-Szene weiter fort. Als er von seinem Stellvertreter Christian Käs unter Druck gesetzt wurde, die Republikaner stärker nach rechts zu öffnen, kam es wieder einmal zu heftigen parteiinternen Auseinandersetzungen, was für die Glaubwürdigkeit der REP als Sammelbecken rechts von der Mitte nicht gerade förderlich war (vgl. „Nach dem Wahlschock die Zerreißprobe“, in: Der Tagesspiegel v. 21.11.1998).
Trotz ihrer inneren Zerrissenheit und ihrer außerhalb Bayerns eher schwach entwickelten Organisationsstruktur galten die Republikaner noch Anfang der neunziger Jahre als aussichtsreichste Rechtsaußen-Partei, der sogar längerfristige parlamentarische Erfolge zugetraut wurden (vgl. Jaschke 1999: 151). Das lag zum einen daran, daß ihrem Vorsitzenden Schönhuber (und später auch Schlierer) durchaus bewußt war, daß eine offen rechtsextreme Partei gegenwärtig kaum Akzeptanz bei den Wählern findet. Obwohl in der Öffentlichkeit vielfach als „rechtsradikal“ bzw. „rechtsextrem“ stigmatisiert, geben sich die Republikaner betont seriös und konservativ (vgl. z.B. Pfahl-Traughber 1993: 37). Zum anderen verdankte die Partei ihre Erfolge der geschickten populistischen Agitationsweise Schönhubers.
Der rechtspopulistische Charakter der Republikaner wird weniger in den Parteiprogrammen als im Wahlkampf und politischen Diskurs deutlich. „Nahezu alle gesellschaftlichen Problemfelder, von der Arbeitslosigkeit und Beschäftigungskrise über Kriminalität und Pflegenotstand bis hin zur Wirtschaftskrise und Wohnungsnot, werden mit der Anwesenheit von Ausländern in Deutschland in Verbindung gebracht. Bei ihrer öffentlichen Agitation geht es den REP nicht um die Präsentation sachpolitischer Alternativen und Konzepte zu bestehender Politik, sondern um oberflächliche Schuldzuweisungen und das Suggerieren einfacher Erklärungen für komplexe gesellschaftliche Probleme“ (Pfahl-Traughber 1994: 71). Äußerungen Schönhubers, wie „Die Errungenschaften unseres sozialen Netzes dürfen nicht länger dazu benutzt werden, daß sich Gastarbeiter darin ausruhen“ (zit. in: Pfahl-Traughber 1994: 72) oder „Man kann leicht für die multinationale Gesellschaft sein, wenn man irgendwo außerhalb der Stadt eine Villa hat und nicht in der Nähe eines Asylantenheims wohnt“[7] (zit. in: Bergsdorf 2000: 621), sind dafür geradezu exemplarisch: Dazu äußert sich Jaschke: „Schönhuber-Reden informieren nicht, sie beschwören, sie argumentieren nicht, sondern sie sollen aufwühlen und polarisieren. Sie sprechen das Gefühl an, nicht den Verstand. Schönhubers Rhetorik ist jenen faschistischen Agitatoren verwandt, die in den zwanziger und dreißiger Jahren in Deutschland und darüber hinaus die Krisenängste der Modernisierungsverlierer aufgriffen und für ihre Zwecke instrumentalisierten“ (Jaschke 1994: 37).
Von Parteien der „Alten Rechten“ wie der NPD unterscheiden sich die Republikaner - neben ihrem taktisch geschickteren öffentlichen Auftreten - vor allem durch ihre größere Distanz zum Nationalsozialismus. „So nahm die NPD in den sechziger Jahren durchaus positiv auf den Nationalsozialismus Bezug und distanzierte sich lediglich von dessen ‘Auswüchsen’. Die Republikaner dagegen vertreten eine Ideologie, die zwar nicht dem Nationalsozialismus widerspricht, sich aber nicht mehr von ihm ableitet.“ (Fascher 1994: 185). Schönhubers Partei vermeidet es ebenso, offenen Rassismus zu propagieren oder den Nationalsozialismus zu rechtfertigen. Allenfalls rechtfertigt sie die Gründe, die zu seiner Entstehung geführt hatten, sowie das Verhalten der Deutschen zur NS-Zeit (vgl. Fascher 1994: 219).
Vom Verfassungsschutz wurden die Republikaner lange Zeit nicht als rechtsextrem eingestuft. Erst im Dezember 1992 kam man dort zu der Auffassung, daß die meisten Ideologieelemente des Rechtsextremismus sich - wenn auch in entschärfter Form - in den Parteiprogrammen der REP wiederfinden würden (vgl. Pfahl-Traughber 1993: 53 u. 56). Eindeutig rechtsextremistische Positionen kamen vor allem in den Äußerungen einzelner Parteifunktionäre zum Ausdruck (vgl. Pfahl-Traughber 1999: 32). So werden die Republikaner aus extremismustheoretischer Sicht als „rechtsextrem im Sinne eines antidemokratischen Konservativismus mit (national-) populistischen Zügen“ (Pfahl-Traughber 1993: 56) eingeschätzt.
2. 4. 3. Die DVU - (k)eine ernst zu nehmende Rechtsaußen-Partei
Die Gründung der DVU im Jahre 1971 resultierte im Wesentlichen aus dem Niedergang der NPD: Während die Nationaldemokraten zunehmend Wählerstimmen und Mitglieder verloren, machte es sich der Münchner Verleger und Multimillionär Gerhard Frey zur Aufgabe, dem zerfallenden rechtsextremen Lager ein Auffangbecken anzubieten. Eine klare politische Linie wies diese Organisation nicht auf, vielmehr ging es Frey darum, die Leserschaft seiner Publikationen („Nationalzeitung“, „Deutsche Wochenzeitung“ u.a.) als Beitrag zahlende Mitglieder eines Ver-eins zu bündeln (vgl. Pfahl-Traughber 1993: 59f.; Assheuer/Sarkowicz 1992: 34f.).
Trotz ihrer hohen Mitgliederstärke blieb die DVU lange Zeit passiv, ihre politische Aktivität gipfelte darin, jährliche „Großkundgebungen“ in Passau abzuhalten. Das änderte sich 1986, als Frey in seinen Zeitungen erstmalig Wahlempfehlungen zugunsten der NPD aussprechen ließ. Im selben Zug kam es zu einer Annäherung beider Organisationen, wobei die politisch erfolglose NPD vor allem von der propagandistischen Schlagkraft des Frey’schen Presseimperiums zu profitieren hoffte. Das Aufkommen der Republikaner als starke, rechte Konkurrenz veranlaßte Frey im März 1987, seine Organisation unter dem Namen „DVU - Liste D“ als wählbare Partei eintragen zu lassen (vgl. Pfahl-Traughber 1993: 60f.). Zwischen der DVU und der NPD gab es Wahlabsprachen, wonach abwechselnd die NPD mit Unterstützung der DVU oder die DVU mit Unterstützung der NPD antreten sollte. Die DVU profitierte dabei von der gut entwickelten Organisationsstruktur der NPD sowie der politischen Erfahrung ihrer Kandidaten, während die NPD in erster Linie die finanziellen Mittel ihres Kooperationspartners nutzte und ihr Werbematerial über den Frey-Konzern bezog (vgl. Pfahl-Traughber 1993: 61).
Ihre Wahlerfolge erzielte die DVU - vor allem später, als das Bündnis mit der NPD bröckelte - praktisch ohne funktionierenden organisatorischen Unterbau und mit politisch meist völlig unbedarften Kandidaten. Im Gründungsjahr 1987 entstand lediglich ein Landesverband in Bremen, die Etablierung weiterer Landesverbände verlief äußerst schleppend. In einigen Bundesländern existieren noch nicht einmal Geschäftsstellen, öffentliche Wahlkampfveranstaltungen werden so gut wie gar nicht abgehalten (vgl. Pfahl-Traughber 1999: 29f.). In Sachsen-Anhalt, wo die Partei ihren bisher größten Wahlerfolg verbuchen konnte, gibt es nur rund 30 (!) DVU-Mitglieder (vgl. Obszerniks/Schmidt 1998). Den fehlenden organisatorischen Rückhalt kompensiert Frey durch die finanzielle Schlagkraft seines Unternehmens. Die Wahlkämpfe der DVU konzentrieren sich - neben dem Kleben von Plakaten - vor allem darauf, bestimmte Wählergruppen persönlich anzuschreiben. Manchmal wird auch versucht, die Wähler durch ebenso effektvolle wie kostenintensive Werbeaktionen zu beeindrucken - wie z.B. 1987 in Bremen, wo man zwei Flugzeuge mit dem Banner der DVU tagelang über der Stadt kreisen ließ (vgl. Pfahl-Traughber 1993: 65). Nicht selten investierte Frey mehr Geld in Wahlkämpfe als CDU/CSU und SPD zusammen (vgl. Pfahl-Traughber 1999: 30).
Die parlamentarische Arbeit dient der DVU in erster Linie zur Finanzierung aus öffentlicher Hand (vgl. Neubacher 1996: 45) - was nicht verwunderlich ist, wenn man bedenkt, welchen geringen Stellenwert Freys Organisation der Demokratie beimißt. „An innerparteilicher Demokratie mangelt es bei der DVU selbst auf rein formaler Ebene. So werden Kandidaten meist nicht durch Parteigremien nominiert, sondern nach Gutdünken eingesetzt“ (Pfahl-Traughber 1999: 29). In den Parlamenten legen die Abgeordneten der DVU - die zuweilen nicht einmal von ihrer Nominierung als Kandidaten wußten (vgl. Linke 1994: 39) - meist eine erschreckende Inkompetenz an den Tag. „Die DVU-Fraktionen zeigten in der Regel wenig Interesse an der Arbeit in den Fachausschüssen und glänzten durch Abwesenheit und Schweigsamkeit“ (Linke 1994: 42).
Die Tatsache, daß man in der DVU so wenig Wert auf die politischen Fähigkeiten der einzelnen Abgeordneten legt, verwundert nicht weiter, wenn man bedenkt, daß die Parteipolitik ausschließlich von Gerhard Frey konzipiert und gelenkt wird. Anträge für Parlamentsabgeordnete entwirft man in der Münchner Zentrale und schickt mit den entsprechenden Anweisungen per Fax an die Mandatsträger (vgl. Pfahl-Traughber 1993: 64; Linke 1994: 43).
Wegen dieser Besonderheiten - d.h. beachtlichen Wahlerfolgen trotz schwacher Organisationsstruktur und nahezu fehlender Basisverankerung, Wahlkämpfen, die in ihrem Wesen völlig unpersönliche „Materialschlachten“ sind und Abgeordneten, die als ferngesteuerte Marionetten Freys agieren - wird die DVU in der wissenschaftlichen Literatur gern als „Phantompartei“ oder „virtuelle Partei“ (Thränhardt 1998) bezeichnet.
Beim ersten Parteiprogramm der DVU-Liste D handelte es sich lediglich um ein beidseitig bedrucktes DIN A4-Blatt mit zwölf Programmpunkten. „Relativ allgemein gehalten und im Unterschied zu sonstigen Äußerungen aus der Frey-Presse zurückhaltend formuliert, findet man in dem Programm Forderungen folgender Art: ‘Deutschland soll deutsch bleiben’ und ‘Deutschland zuerst’, womit die ‘nationale Identität’ beschworen und eine verschärfte Politik gegen Ausländer gefordert wird, ‘Gleichberechtigung für Deutschland’, womit man sich gegen eine angeblich ‘einseitige Vergangenheitsbewältigung allein zu Lasten der Besiegten des Zweiten Weltkriegs mit Zuweisung von Kollektivschuld’ wendet, und eine Reihe sehr allgemeiner Forderungen zur Schaffung von Arbeitsplätzen, Sicherung der Renten, Schutz vor Kriminalität, Hilfe für den deutschen Mittelstand und die deutschen Bauern, zu verstärktem Tier- und Umweltschutz, sowie zu mehr ‘direkter Demokratie für deutsche Bürger’, wobei Volksbegehren und die Herabsetzung der Fünf-Prozent-Klausel angesprochen werden. Im Zentrum dieses Programmes stehen nicht die Menschen- und Bürgerrechte, sondern das ‘Deutschsein’ bzw. das ‘Deutsche’, was auch immer damit gemeint ist“ (Pfahl-Traughber 1993: 62; vgl. auch: Programm der deutschen Volksunion - Liste D 1987).
Ähnlich wie die Republikaner hatte die DVU einige Jahre später ihr Programm sprachlich modifiziert, um rechtsextremistische Positionen zu verschleiern und mehr Wähler außerhalb der von NS-Nostalgikern dominierten Leserschaft der Frey-Gazetten zu gewinnen (vgl. Linke 1994: 26f.). Offen rassistische Formulierungen versuchte die DVU im Parteiprogramm und in ihrer Wahlwerbung stets zu vermeiden. Mit Slogans wie „Timbuktu den Afrikanern, Istanbul den Türken - aber Hamburg soll deutsch bleiben“ (Fernsehwerbespot zur Hamburger Bürgerschafts-wahl 1993, zit. in: Linke 1994: 36) orientiert sie sich eher an der von der intellektuellen „Neuen Rechten“ konzipierten Ideologie des „Ethnopluralismus“. Auch der lupenrein populistische Stil ihrer Wahlwerbung läßt die DVU nach außen hin als Vertreterin des modernen Rechtspopulismus erscheinen. Aus ihrem Wahlprogramm zur Brandenburger Landtagswahl 1999 waren schließlich - bis auf eine einzelne Forderung zum Ehrenschutz für gefallene deutsche Soldaten - sämtliche NS-bezogenen Programmpunkte verschwunden (vgl. Wahlprogramm der DVU zur Brandenburger Landtagswahl 1999).
Einen augenfälligen Kontrast zu den Wahlprogrammen, wo Forderungen nach der Begrenzung des Ausländeranteils in erster Linie mit den sozialen Problemen in Deutschland begründet werden, stellt der revisionistische und fremdenfeindliche Duktus der Frey-Presse dar (vgl. Jaschke 1999: 149). Daß die DVU vom Verfassungsschutz als rechtsextrem und damit als verfassungsfeindlich eingestuft wird, ergibt sich weniger aus Programm und Satzung der Partei, sondern aus ihren Verbindungen zur NPD und zur Neonazi-Szene sowie aus den Inhalten parteinaher Publikationen und bestimmten Äußerungen höherer Parteifunktionäre (vgl. Linke 1994; Pfahl-Traughber 1993: 62). Von dieser Warte aus betrachtet, zeigt die DVU eine sehr eindeutig rechtsextremistische Orientierung, die sich in Nationalismus (basierend auf der rigorosen Abschottung gegenüber Ausländern), Militarismus (in Sinne einer Glorifizierung des Soldatentums und der deutschen Armeen), Geschichtsrevisionismus (Verharmlosung von NS-Verbrechen, Unterstützung der These von der „Auschwitz-Lüge“), Volksgemeinschafts-Ideologie, Forderungen nach der Wiederherrichtung Großdeutschlands in den Grenzen von 1937, antisemitischen Tendenzen und Sexismus (in dem Sinne, daß Männer und Frauen biologisch/genetisch auf ihre gesellschaftliche Rolle festgelegt seien) niederschlägt (vgl. Linke 1994: 62-66).
Somit ist die DVU eine Partei, die ideologisch und entstehungsgeschichtlich in der sogenannten „Alten Rechten“ verwurzelt ist, sich aber - mit weitaus geringerem Erfolg als die Republikaner - um ein zeitgemäßes, nationalkonservatives und soziales Image bemüht. Ihre populistischen Agitationstaktiken sind weniger subtil als die der Republikaner, vermögen jedoch von Zeit zu Zeit breitere Wählerschichten anzusprechen.
3. Das rechtsextreme Einstellungspotential
Der oben skizzierte Zustand des rechtsextremen Parteienlagers läßt vermuten, daß keine dieser Parteien sich in nächster Zeit zu einer wirklich attraktiven, schlagkräftigen Organisation am rechten Rand entwickeln wird. Zu sehr sind die vorhandene Rechtsaußen-Parteien von innerparteilichen Machtkämpfen zerrissen, durch ihre parlamentarische Inkompetenz oder ihre Verbindungen zur militanten Neonazi-Szene diskreditiert. Der Erfolg rechtsextremer Parteien wird daher in Deutschland vor allem durch zwei Faktoren bestimmt: Wirtschaftliche oder politische Krisenerscheinungen bzw. als bedrohlich empfundene soziale Wandlungsprozesse und ein latent vorhandenes rechtsextremes Einstellungspotential.
In diesem Kapitel gilt es, der Frage nachzugehen, inwiefern sich dieses rechte Einstellungspotential tatsächlich mit der Wählerschaft der entsprechenden Parteien deckt, ob es seit der Nachkriegszeit eher zu- oder abgenommen hat oder ob sich - wie bei den Progammatiken rechter Parteien - lediglich die ideologischen Schwerpunkte verschoben haben.
„Konsens besteht darin, daß es sich beim Rechtsextremismus um ein mehrdimensionales Einstellungsmuster handelt. Umstritten ist, welche Dimensionen dieses Muster einschließt. Genannt, bzw. berücksichtigt werden Anomie, Autoritarismus (ggf. differenziert nach Bereichen wie Politik, Erziehung usw.), Nationalismus (wobei zwischen Nationalbewußtsein, Nationalismus und Expansionismus unterschieden werden sollte), Ethnozentrismus (neuerdings aufgeteilt in Rassismus und Wohlstandschauvinismus), Antisemitismus und pronazistische Einstellungen“ (Stöss 1994: 28). Die erste Untersuchung, die sich bemüht hat, rechtsextreme Einstellungsmuster in dieser multidimensionalen Form zu erfassen und dabei eine repräsentative Auswahl für das gesamte Bundesgebiet zu treffen, war die SINUS-Studie von 1981. Frühere Erhebungen beziehen sich meist nur auf NS-Sympathie und Antisemitismus, die nach Stöss lediglich einzelne Dimensionen des Rechtsextremismus ausmachen. Weiterhin gab es Studien zum Autoritarismus und zum Demokratiebewußtsein der Deutschen.
3. 1. Untersuchungen in den fünfziger, sechziger und siebziger Jahren
In der Nachkriegszeit waren antisemitische Einstellungen und positive Erinnerungen an die NS-Zeit bei Mehrheiten der Bevölkerung verbreitet. Der Nationalsozialismus mochte zwar durch Krieg und Völkermord diskreditiert und öffentlich geächtet sein, doch sein Gedankengut sollte noch lange in den Köpfen der Deutschen fortbestehen (vgl. Fascher 1994: 30). Umfragen zufolge hielten im Jahre 1948 57% den Nationalsozialismus für eine gute Idee, die nur schlecht umgesetzt worden war, 1949 lehnten 70% und 1961 noch immer 54% Eheschließungen mit Juden ab, 70% betrachteten die Juden als „andere Rasse“ (vgl. Noelle/Neumann 1955 - 1983, Bd.1: 131, Bd.3: 215). 1951 teilten sich die Deutschen in NS- und Kaiserreichs-Nostalgiker, die Weimarer Republik betrachtete nur eine verschwindend geringe Minderheit als gute Ära für Deutschland, lediglich 2% fühlten sich in der Bundesrepublik am wohlsten (vgl. Noelle/Neumann 1955 - 1983, Bd.3: 230). 1955 waren laut einer Umfrage des Allensbacher Instituts für Demoskopie 48% der Meinung, daß Hitler ohne den Krieg und die Judenverfolgung einer der größten deutschen Staatsmänner gewesen wäre (vgl. Institut für Demoskopie 1979: 96). Auch das Verhältnis zu den deutschen Widerstandskämpfern war äußerst ambivalent: 1954 meinten 40 % der Befragten, daß Emigranten keine hohen Regierungsämter bekleiden sollten, noch 1960 lehnte eine Mehrheit ab, Schulen nach ihnen zu benennen (vgl. Noelle/Neumann 1955 - 1983, Bd1: 139, Bd.3: 235).
Später fanden diese Einstellungen weniger Akzeptanz. Die regelmäßig vom Institut für Demoskopie gestellte Frage, ob Hitler ohne den Krieg und die Judenverfolgung einer der größten deutschen Staatsmänner geworden wäre, bejahten 1960 34%, 1964 29%, 1967 32%, 1972 35%, 1975 38% und 1978 31% der Befragten (vgl. Institut für Demoskopie 1979: 96). Das Meinungsforschungsinstitut EMNID fragte in den fünfziger und sechziger Jahren: „Wenn es jetzt - wie 1933 - wieder eine Gelegenheit gäbe, in einer Wahl für oder gegen einen Mann wie Hitler zu stimmen, wie würden Sie sich dann entscheiden?“. Zugunsten Hitlers sprachen sich daraufhin 1954 15%, 1958 10%, 1965 4% und 1968 6% aus (vgl. EMNID-Informationen 8-9/1968: 1 u. 10). Allerdings befürwortete 1969 noch eine Zwei- Drittel-Mehrheit die Verjährung von NS-Verbrechen (vgl. Noelle/Neumann 1955 - 1983, Bd. 5: 232).
In den siebziger Jahren verzeichneten Meinungsforscher eine wachsende Akzeptanz demokratischer Prinzipien und Verhaltensweisen. So sank z.B. zwischen 1950 und 1972 der Anteil derjenigen, die für ein Einparteiensystem eintraten, von 24% auf 8% ab, 1982 meinten nur noch 6%, daß die meisten Probleme sich mit einer starken Regierung lösen ließen, gegenüber 17% im Jahr 1975, für die Todesstrafe traten 1980 28% ein, während es 1967 50% gewesen waren und für eine Verjährung von NS-Verbrechen plädierten 1979 weniger als 50% (vgl. Noelle/ Neumann 1955 - 1983, Bd.5: 222 u. 232, Bd.8: 223 u. 312f.).
Diese optimistisch stimmenden Zahlen sollten jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß Überreste nationalsozialistischen Gedankengutes sowie autoritäre und fremdenfeindliche Einstellungen auch später noch weit verbreitet waren. So sprachen sich 1972 laut einer „Spiegel“-Umfrage 71% für eine Verminderung der Gastarbeiter-Zahlen aus (vgl. Der Spiegel 44/1972: 60). Das Dritte Reich sei „gar nicht so schlecht“ gewesen, meinten Ende der siebziger Jahre 37% gegenüber 40%, die dies kategorisch ablehnten (vgl. Stöss 1989: 43). Nach einer Untersuchung von Werner Habermehl aus dem Jahr 1979 glaubten 40% der Befragten, daß bei der Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und Kriminalität, in Krisensituationen sowie für Entwicklungsländer eine Diktatur die bessere Staatsform sei (vgl. Habermehl 1979: 118).
3. 2. Die SINUS-Studie
Zu Beginn der achtziger Jahre untersuchte das Meinungsforschungsinstitut SINUS die Verbreitung von rechtsextremen und autoritären Einstellungsmustern an 7000 repräsentativ ausgewählten volljährigen Bundesbürgern. Nach der Auswertung rechtsextremer Literatur und Interviews mit Personen aus der rechten Szene wurden 23 Statements entwickelt und den Befragten vorgelegt. Diejenigen, die mindestens sieben dieser Aussagen entschieden bejahten (bzw. die mit „*“ gekennzeichneten entschieden verneinten) galten als rechtsextrem eingestellt. Die Ergebnisse sahen folgendermaßen aus (vgl. SINUS 1981):
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Nach Auswertung dieser Daten kam man bei SINUS zu dem Schluß, daß 13% der Deutschen über ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild verfügen. Über diese Einschätzung des rechtsextremen Einstellungspotentials hinaus lieferte die Studie auch Angaben zu den soziodemographischen Merkmalen der Befragten: Die rechtsautoritären Statements fanden bei der Altersgruppe der unter 40-jährigen weniger Akzeptanz als bei den Älteren. Geschlecht und Konfession spielten kaum eine Rolle, Frauen neigten teilweise sogar stärker zu reaktionären Ansichten. Deutlich überrepräsentiert beim rechtsextremen Einstellungspotential waren Personen ohne Berufsausbildung, Landwirte, Selbständige sowie Menschen, die die wirtschaftliche Lage pessimistisch einschätzten oder sich sozial benachteiligt fühlten. Gewerkschaftsmitglieder und Akademiker zeigten dagegen eine geringere Anfälligkeit gegenüber rechten Einstellungsmustern. Bemerkenswert ist, daß sich rund 80% der Bürger mit rechtsextremem Weltbild als Wähler der etablierten Parteien zu erkennen gegeben haben (vgl. SINUS 1981: 87ff.).
Die methodische Herangehensweise von SINUS ist zum Teil kritikwürdig. Zum einen empfinde ich es als problematisch, von einem „geschlossenen rechtsextremen Weltbild“ zu sprechen, wenn noch nicht einmal eine unumstrittene Definition des Begriffs Rechtsextremismus vorliegt. Zum anderen wird hier, anders als z.B. in einer späteren Untersuchung von Jürgen Falter, keine systematische Rechtsextremismus-Skala erstellt, wobei man - gemessen an der Anzahl der positiv beantworteten Fragen - nach mehr oder weniger festgefügten rechtsextremen Einstellungsmustern differenziert. Außerdem lassen einige der vorgelegten Statements, z.B. „Wenn es so weitergeht, steht unseren Volk schon bald eine ungeheure Katastrophe bevor“ oder „Das bei uns heute alles drunter und drüber geht, verdanken wir den Amerikanern“, meines Erachtens nicht eindeutig auf rechtsextreme Orientierungen schließen.
Indem sie das rechtsextreme Einstellungspotential in der Bundesrepublik mit 13% beziffert hat, kam die SINUS-Studie nichtsdestotrotz zu einem sehr ähnlichen Ergebnis wie diverse in den neunziger Jahren durchgeführte Untersuchungen.
3. 3. Ost-west-vergleichende Analysen:
Nach 1990 wurden verschiedene Erhebungen durchgeführt, die die Verbreitung autoritärer, reaktionärer und fremdenfeindlicher Einstellungsmuster erfassen sollten. Da meine Fragestellung darauf abzielt, was warum an der dritten Welle des Rechtsextremismus „anders“ ist und die Wiedervereinigung sich als Erklärungsfaktor geradezu aufdrängt, werde ich mich hier auf ausgewählte, ost-west-vergleichende Analysen beziehen.
[...]
[1] Quelle der Wahlergebnisse: Fischer 1990.
[2] Zu den Wahlergebnissen von 1990 - 1998 vgl. Falter 1994; Jaschke 1994; DER SPIEGEL Nr. 37/1998.
[3] Die Bezeichnung „erfolgreich“ bezieht sich hier lediglich darauf, ob die entsprechende Partei bei Wahlen auf Landes- oder Bundesebene mehr als einmal die 5%-Hürde überwunden hat.
[4] Ich spreche hier bewußt von Ideologien , da es zwischen den verschiedenen Denkrichtungen des Rechtsextre- mismus Differenzen gibt. Ein Teil der Rechtsextremisten befürwortet die freie Marktwirtschaft, andere favo- risieren einen sozialpolitischen Protektionismus, einige überhöhen die eigene Nation, während andere für eine - Nationen übergreifende - Stärkung der „weißen Rasse“ eintreten (vgl. Pfahl-Traughber 1999: 18f.).
[5] Zu dem Schluß, daß die Unübersichtlichkeit, die hier bei der Terminologie und Begriffsbestimmung herrscht, für die Forschung nicht eben förderlich ist, kommt auch Dieter Rucht (vgl. Rucht 1996: 267-270).
[6] Der autoritäre Führungsstil scheint ein generelles Merkmal rechtsextremer Parteien zu sein. Auch die NPD und die DVU weisen in Puncto innerparteiliche Demokratie erhebliche Defizite auf (vgl. z.B. Neubacher 1996: 26. u. 42.; Pfahl-Traughber 1993: 63f. u. 69).
[7] Dazu muß gesagt werden, daß Schönhuber selbst eine Villa am Tegernsee besitzt (vgl. Bergsdorf 2000: 621).
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2001
- ISBN (eBook)
- 9783832449834
- ISBN (Paperback)
- 9783838649832
- Dateigröße
- 1.2 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Potsdam – Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät
- Note
- 1,5
- Schlagworte
- wählerverhalten nationalsozialismus demokratie parteien
- Produktsicherheit
- Diplom.de