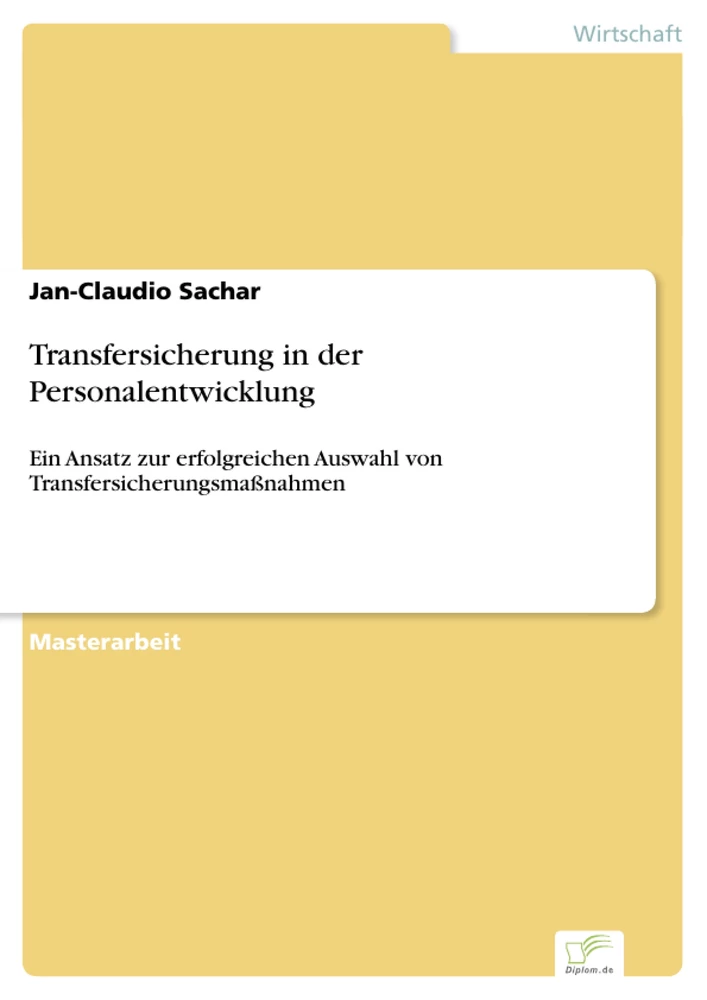Transfersicherung in der Personalentwicklung
Ein Ansatz zur erfolgreichen Auswahl von Transfersicherungsmaßnahmen
©2014
Masterarbeit
91 Seiten
Zusammenfassung
Dieses Fachbuch soll zu einer stärkeren Berücksichtigung des Transfers bzw. der Transferproblematik im Rahmen der Personalentwicklung beitragen. Dies betrifft vor allem den Bereich der Entscheidungsfindung. Denn im Gegensatz zu den zahlreichen Untersuchungen bezüglich der Einflussfaktoren des Transfers, scheint in der Fachliteratur im Hinblick auf Entscheidungsmodelle ein Defizit vorzuliegen. Dies gilt zumindest für Modelle, welche die komplexe Prognostizierbarkeit, die Messproblematik und neben den quantitativen vor allem auch die qualitativen Aspekte des Transfers berücksichtigen. Die vorliegende Arbeit soll zur Schließung dieser Lücke beisteuern, indem ein Ansatz zur Lösung des genannten Entscheidungsproblems bereitgestellt wird. Weiterhin soll es Impulse und Anregungen für weitere Untersuchungen und die Entwicklung weiterer Lösungsansätze in diesem Bereich geben.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Sachar, Jan-Claudio: Transfersicherung in der Personalentwicklung.
Ein Ansatz zur erfolgreichen Auswahl von Transfersicherungsmaßnahmen,
Hamburg, Diplomica Verlag GmbH 2014
PDF-eBook-ISBN978-3-95636-393-1
Herstellung: Diplomica Verlag GmbH, Hamburg, 2014
Zugl. Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Magdeburg, Masterarbeit, 2014
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung
außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages
unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen,
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Bearbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und die Diplomica Verlag GmbH, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Alle Rechte vorbehalten
© Diplom.de, Imprint der Diplomica Verlag GmbH
Hermannstal 119k, 22119 Hamburg
http://www.diplom.de, Hamburg 2014
Printed in Germany
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis ... I
Tabellenverzeichnis ... II
Abkürzungsverzeichnis ... III
1.
Einleitung ... 1
1.1
Problemstellung ... 1
1.2
Aufbau der Arbeit ... 2
2.
Begriffliche und terminologische Grundlagen ... 4
2.1
Personalentwicklung ... 4
2.1.1
Begriff und Definition ... 4
2.1.2
Arten der Personalentwicklung ... 7
2.2
Transfer ... 10
2.2.1
Begriff und Definition ... 11
2.2.2
Ein ausgewähltes Prozessmodell des Transfers ... 13
2.2.3
Verortung des Transfers in der Personalentwicklung ... 15
2.2.4
Bedeutung des Transfers in der Personalentwicklung ... 18
3.
Ö
konomische Legitimierung der Personalentwicklung ... 21
3.1
Systematisierung und Abgrenzung der Problemstellung ... 21
3.2
Grundprobleme der Personalwirtschaft ... 23
3.3
Personalentwicklung als personalwirtschaftliches Instrument ... 26
3.4
Effekte der Personalentwicklung ... 28
4.
Untersuchung ausgewählter Entscheidungsmodelle ... 33
4.1
Verdeutlichung des Entscheidungsproblems ... 33
4.2
Quantitativ orientierte Modelle bei Unsicherheit ... 33
4.2.1
Kapitalwert-Methode ... 34
4.2.2
Entscheidungsregeln bei Unsicherheit ... 38
4.2.3
Eignung der Modelle für das vorliegende Entscheidungsproblem ... 46
4.3
Der analytische Hierarchieprozess (AHP) ... 48
4.3.1
Grundlagen ... 48
4.3.2
Vorgehensweise des AHP ... 53
4.3.3
Begründung der Auswahl des AHP für das vorliegende Entscheidungsproblem ... 60
4.4
Der AHP für die Auswahl von Maßnahmen zur Transfersicherung ... 62
4.4.1
Entscheidungsraum ... 62
4.4.2
Ableitung möglicher Attribute ... 67
4.4.3
Eignung des AHPs für das vorliegende Entscheidungsproblem ... 71
5.
Zusammenfassung ... 74
Literaturverzeichnis ... V
Anhang ... IX
Symbolverzeichnis ... XIV
Abbildungsverzeichnis
I
Abbildungsverzeichnis
Abb. 2.1: Forschungs- und Gestaltungszugänge zur Personalentwicklung... 5
Abb. 2.2: Arten der Personalentwicklung ... 8
Abb. 2.3: Prozessmodell des Transfers ... 14
Abb. 2.4: Prozessmodell der Personalentwicklung ... 17
Abb. 3.1: Handlungsstrukturmodell ... 22
Abb. 3.2: Wirkungszusammenhänge Instrumente und Personalverhalten ... 28
Abb. 3.3: Wertkette einer Unternehmung ... 29
Abb. 4.1: Entscheidungsmodelle bei Unsicherheit ... 39
Abb. 4.2: Einfache Form einer Hierarchie ... 49
Abb. 4.3: Hierarchie für die optimale Auswahl eines Tablets ... 54
Abb. 4.4: 9-Punkte-Skala ... 55
Abb. 4.5: Gewichtete Hierarchie für die optimale Auswahl eines Tablets ... 60
Abb. 4.6: Bereichsinterner Vergleich von Alternativen ... 68
Abb. 4.7: Bereichsübergreifender Vergleich von Alternativen ... 70
Tabellenverzeichnis
II
Tabellenverzeichnis
Tabelle 4.1: Zahlungsströme der Investitionsmöglichkeiten (in GE) ... 38
Tabelle 4.2: Maßnahmen zur Transfersicherung (in GE) ... 40
Tabelle 4.3: Maßnahmen mit Eintrittswahrscheinlichkeiten (in GE) ... 43
Tabelle 4.4: Erwartungswerte und Standardabw. der Maßnahmen (in GE) ... 45
Tabelle 4.5: Beispielhafte Zufallskonsistenzen ... 52
Tabelle 4.6: Evaluationsmatrix bezüglich der Zielerreichung... 55
Tabelle 4.7: Evaluationsmatrix bezüglich des Hauptattributs Design ... 56
Tabelle 4.8: Evaluationsmatrix bezüglich des Hauptattributs Handhabung... 56
Tabelle 4.9: Approximative Gewichtsberechnung der Elemente ... 58
Tabelle 4.10: Ermittlung der Durchschnittsmatrix ... 59
Abkürzungsverzeichnis
III
Abkürzungsverzeichnis
AHP Analytical Hierarchy Process bzw. Analytischer Hierarchieprozess
ANP Analytical Network Process bzw. Analytischer Netzwerkprozess
CI Consistency Index bzw. Konsistenzindex
CR Consistency Ratio bzw. Konsistenzverhältnis
Einleitung
1
1. Einleitung
Um einen Einstieg in die Thematik der vorliegenden Arbeit zu ermöglichen,
gehen die folgenden Ausführungen auf die zugrunde liegende Problemstellung
sowie den Aufbau der Arbeit ein. Um die Motivation für die Themenwahl zu
verdeutlichen, wird ebenfalls die Zielstellung der Arbeit formuliert.
1.1 Problemstellung
Die Fachliteratur, die im Rahmen der vorliegenden Arbeit herangezogen
wurde, zeigt, dass der Transfer bereits vor Jahrzehnten als wesentlicher
Bestandteil der Personalentwicklung identifiziert wurde.
1
Trotz dieser
Erkenntnis weisen einschlägige Arbeiten jedoch auf eine Unterschätzung der
Bedeutung des Transfers hin. Eine vielfach zitierte Schätzung stammt von
Georgenson (1982), welcher konstatierte, dass in den vereinigten Staaten nicht
mehr als 10 Prozent der 100 Millarden US-Dollar, die jährlich in die
Personalentwicklung investiert werden, tatsächlich in einem Transfer münden.
2
Diese Schätzung kann jedoch, da nicht empirisch fundiert und nicht mehr
aktuell, allenfalls als erster Hinweis für das Ausmaß der Transferproblematik
gesehen werden. Eine aktuellere Untersuchung mit empirisch fundiertem
Hintergrund liefern hingegen Saks und Belcourt (2006). Die in Kanada
durchgeführte Studie kommt unter anderem zu dem Ergebnis, dass lediglich 62
Prozent der Befragten das in einer Personalentwicklungsmaßnahme vermittelte
Wissen unmittelbar in der Praxis anwenden. Weiterhin verringert sich die
Umsetzungsrate, so die Autoren, nach sechs Monaten bzw. einem Jahr auf
lediglich 44 bzw. 34 Prozent.
3
Diese Resultate können als erster Nachweis für
die Brisanz der Transferproblematik gesehen werden. Im Rahmen der für die
vorliegende Arbeit durchgeführten Literaturrecherche ist jedoch ein starkes
Defizit im Hinblick auf weitere Studien mit gleichem Untersuchungs-
gegenstand festzustellen. Dies kann als Indiz für die Messproblematik des
Transfers gesehen werden, die später in der Arbeit aufgegriffen werden soll.
1
Vgl. u.a. Baldwin & Ford 1988.
2
Vgl. Georgenson 1982, S. 75.
3
Vgl. Saks, Belcourt 2006, S. 642.
Einleitung
2
Zudem finden sich auch in der Fachliteratur zahlreiche Aussagen, die die hohe
Relevanz der Transferproblematik bestätigen. So betont zum Beispiel Jung
(2006) mit folgender Aussage, dass im Hinblick auf den Transfer
Handlungsbedarf besteht.
,,Das wohl größte Problem bei Personalentwicklungsmaßnahmen, die nicht am
Arbeitsplatz durchgeführt werden, ist darin zu sehen, dass der anschließend
notwendige Transfer des Erlernten von der Übungssituation auf die konkrete
Aufgabe am Arbeitsplatz nicht gelingt."
4
Die angeführten Beispiele verdeutlichen, dass der Transfer ein essentieller
Bestandteil von Personalentwicklungsmaßnahmen ist. Sollen derartige
Maßnahmen als Instrument zur Lösung personalwirtschaftlicher Probleme
eingesetzt werden, ist es demnach notwendig den Transfer, also die
Übertragung des erlernten Wissens in den Anwendungskontext, zu
gewährleisten. Dieser Sachverhalt mündet letztendlich in dem Entscheidungs-
problem der Auswahl einer optimalen Maßnahme zur Transfersicherung.
1.2 Aufbau der Arbeit
Aufgrund der notwendigen Subsumption des Transfers unter die
Personalentwicklung, ist der Transfer in gewissen Hinsichten auf diesem
nächsthöheren Abstraktionslevel zu betrachten. Dementsprechend vermittelt
das zweite Kapitel der vorliegenden Arbeit sowohl den begrifflichen und
terminologischen Hintergrund der Personalentwicklung als auch die nötigen
Grundlagen zum Transfer. Letzterer wird hierbei in den Prozess der
Personalentwicklung eingeordnet und auf seine Bedeutung hin untersucht.
Das dritte Kapitel der Arbeit schafft unter Rückgriff auf das
Handlungsstrukturmodell nach Kossbiel (2002) den Rahmen für eine
strukturierte, entscheidungsorientierte und ökonomisch fundierte Betrachtung
des Entscheidungsproblems.
5
Hierdurch wird insbesondere die ökonomische
Legitimierung der Personalentwicklung und des Transfers ermöglicht.
Kapitel 4 beschäftigt sich mit der Untersuchung von möglichen Entscheidungs-
modellen, die zur Lösung des vorliegenden Entscheidungsproblems geeignet
4
Jung 2006, S. 307.
5
Vgl. Kossbiel 2002, S. 476.
Einleitung
3
sein könnten. Hierbei werden sowohl quantitativ orientierte Modelle als auch
der analytische Hierarchieprozess (AHP) beleuchtet und auf ihre Eignung und
Zulänglichkeit hin untersucht. Nachdem der AHP mit seinen spezifischen
Eigenschaften als geeignetes Entscheidungsmodell validiert wurde, wird ein
Ansatz für die Anwendung des AHPs auf das Problem der Auswahl einer
optimalen Maßnahme zur Transfersicherung entwickelt.
Das fünfte und letzte Kapitel fasst die Erkenntnisse der Arbeit zusammen und
weist auf Aspekte hin, die Ansatzpunkte für weitere Untersuchungen darstellen
könnten.
Die folgende Ausarbeitung soll zu einer stärkeren Berücksichtigung des
Transfers bzw. der Transferproblematik im Rahmen der Personalentwicklung
beitragen. Dies betrifft vor allem den Bereich der Entscheidungsfindung. Denn
im Gegensatz zu den zahlreichen Untersuchungen bezüglich der
Einflussfaktoren des Transfers, scheint in der Fachliteratur im Hinblick auf
Entscheidungsmodelle ein Defizit vorzuliegen. Dies gilt zumindest für
Modelle, welche die komplexe Prognostizierbarkeit, die Messproblematik und
neben den quantitativen vor allem auch die qualitativen Aspekte des Transfers
berücksichtigen. Die vorliegende Arbeit soll zur Schließung dieser Lücke
beitragen, indem ein Ansatz zur Lösung des genannten Entscheidungsproblems
bereitgestellt wird. Weiterhin soll sie Impulse und Anregungen für weitere
Untersuchungen und die Entwicklung weiterer Lösungsansätze in diesem
Bereich geben.
Begriffliche und terminologische Grundlagen
4
2. Begriffliche und terminologische Grundlagen
Wie bereits im vorangehenden Abschnitt erwähnt, wird sich dieses Kapitel der
Arbeit mit der Beleuchtung der terminologischen und begrifflichen Grundlagen
beschäftigen. Neben der Vermittlung des nötigen Hintergrundwissens soll
hierdurch auch eine Verdeutlichung der Schwerpunkte der Arbeit erfolgen.
2.1 Personalentwicklung
Da der Transfer unter das personalwirtschaftliche Teilgebiet der
Personalentwicklung subsumiert werden muss, soll mit den Ausführungen zu
letzterem begonnen werden.
2.1.1 Begriff und Definition
Die bisher in diesem Bereich veröffentlichte Fachliteratur liefert zahlreiche
Definitionen, um den Begriff der Personalentwicklung zu beschreiben. Obwohl
Einigkeit darüber besteht, dass die Personalentwicklung durchaus als
strategischer Erfolgsfaktor eines Unternehmens gesehen werden kann, herrscht
bezüglich seiner Definition eine gewisse Heterogenität. Diese ist vor allem
durch die zahlreichen Fachgebiete begründet, aus denen der Zugang zum
Begriff und damit auch seine Definition erfolgen kann. Neben den
Wirtschaftswissenschaften seien hierbei zum Beispiel die Psychologie, die
Pädagogik oder auch die Soziologie genannt.
6
Eine bereichsübergreifende Definition des Begriffs zu liefern ist aus diesem
Grund kaum möglich und wenig zielführend. Vielmehr ist der Begriff je nach
Forschungs- und Gestaltungshintergrund zu definieren. Becker (2002) zeigt
insgesamt fünf begriffliche Zugänge für die Forschung und Gestaltung der
Personalentwicklung auf.
7
Abbildung 2.1 illustriert diese fünf Forschungs- und
Gestaltungszugänge und verdeutlicht deren Beziehungen zueinander. Um die
Betrachtungsperspektiven der Arbeit zu verdeutlichen, sollen die
verschiedenen Zugänge zur Personalentwicklung im Folgenden konzise
erläutert werden. Die kontextorientierte, die inhaltsorientierte sowie die
6
Vgl. Becker 2007, S. 9.
7
Vgl. Becker 2002, S. 2-3.
Begriffliche und terminologische Grundlagen
5
methodenorientierte Personalentwicklung seien hierbei nur der Vollständigkeit
wegen und nur sehr kurz aufgeführt, da die vorliegende Arbeit den
akteursorientierten und den zielorientierten Zugang nutzt, um sich mit dem
Thema Personalentwicklung und dem ihr zuzuordnenden Transfer
auseinanderzusetzen.
Abbildung 2.1: Forschungs- und Gestaltungszugänge zur Personalentwicklung
Quelle: Becker 2002
Der kontextorientierte Zugang beschäftigt sich mit den unternehmensexternen
und internen Rahmenbedingungen, welche Auswirkungen auf die
Personalentwicklung haben. Die internen Rahmenbedingungen werden durch
die Unternehmensentwicklung dargestellt, die typischerweise in drei
Entwicklungsphasen unterteilt wird. Aus kontextorientierter Sicht ist die
Personalentwicklung proaktiv an die entsprechende Entwicklungsstufe des
Unternehmens anzupassen, um diese positiv beeinflussen zu können. Die
externen Rahmenbedingungen hingegen werden durch Berufsbildungspolitik
sowie die tarifvertraglichen Vorstellungen der Gewerkschaften und
Arbeitgeber bestimmt.
8
Die inhaltsorientierte Personalentwicklung ist durch die drei Inhaltsbereiche
Bildung (Personalentwicklung im engen Sinne), Förderung (Personal-
entwicklung im erweiterten Sinne) und Organisationsentwicklung (Personal-
entwicklung im weiten Sinne) gekennzeichnet.
9
Eine inhaltsbezogene
vergleichsweise weite Definition des Begriffs gibt Becker (2005), nach dem
die Personalentwicklung ,,[...] alle Maßnahmen der Bildung, Förderung und
der Organisationsentwicklung, die zielgerichtet, systematisch und methodisch
8
Vgl. Becker 2007, S. 10-12.
9
Vgl. Becker 2007, S. 14.
Begriffliche und terminologische Grundlagen
6
geplant, realisiert und evaluiert werden"
10
umfasst.
Der zielorientierte Zugang definiert durch gesetzte Ziele das Anspruchsniveau
und die Reichweite der Personalentwicklung. Diese Ziele bzw. die
gewünschten Ergebnisse der Personalentwicklung variieren mit den
verschiedenen Akteuren. Während das Ziel der Mitarbeitenden eine Erhaltung
und Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit (Employability) ist, wünschen
sich Führungskräfte als Ergebnis der Personalentwicklung leistungsfähige und
motivierte Mitarbeiter/-innen. Wieder anders verhält es sich mit der
Unternehmensleitung, für die das Ziel entsprechender Personalentwicklungs-
maßnahmen in der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und der Steigerung des
Unternehmensgewinns liegt. Auf welche Art und Weise diese Effekte durch
derartige Maßnahmen erzielt werden können, wird vor allem im dritten Kapitel
der Arbeit verdeutlicht. Im Hinblick auf den zielorientierten Zugang zur
Personalentwicklung und dem Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit ist in
diesem Zusammenhang auch der Verwendungsaspekt der Personalentwicklung
im Sinne der Kompetenz- und Performanzverbesserung zu beleuchten. Laut
diesem ist es unter anderem Aufgabe der Personalentwicklung sowohl die
situativ-individuelle Handlungsfähigkeit (Können) und die Handlungs-
bereitschaft (Wollen) zu fördern, als auch die konkrete Zuständigkeit für
Aufgaben (Dürfen) zu definieren.
11
Auch Kossbiel (2002) geht auf diesen
Aspekt in ähnlicher Weise ein, indem er die Instruktion, die Qualifikation, die
Motivation und die Präparation als Voraussetzung für die Erfüllung von
Verhaltensansprüchen gegenüber dem Personal nennt.
12
Für den
zielorientierten Zugang kann eine Definition von Klages (1991) aufgegriffen
werden, nach der Personal-entwicklung als ,,[...] die Summe und das
Zusammenwirken aller derjenigen Maßnahmen [...], die sowohl zur
Qualifizierung wie auch zur beruflichen Förderung und zur Motivierung von
Beschäftigten geeignet sind"
13
verstanden werden kann.
Im Rahmen des akteursorientierten Zugangs werden die relevanten Akteure der
Personalentwicklung mit ihren spezifischen Interessen als Einflussfaktoren der
Ausgestaltung genannt. Dies sind neben den von der entsprechenden
10
Vgl. Becker 2005, S. 8.
11
Vgl. Becker 2007, S. 13-14.
12
Vgl. Kossbiel 2002, S. 470.
13
Vgl. Klages 1991, S. 1149.
Begriffliche und terminologische Grundlagen
7
Maßnahmen betroffenen Mitarbeiter/-innen und den zuständigen
Personalentwicklern, die sich vor allem mit der Konzeption und der
Durchführung der Personalentwicklungsmaßnahme beschäftigen, auch die
jeweiligen Entscheidungsträger. Zum anderen beschäftigt sich der
akteursorientierte Zugang mit der Untersuchung von biographie- und
kontextbestimmten Lernimpulsen und barrieren, die den Erfolg einer
Personalentwicklungsmaßnahme maßgeblich beeinflussen. Es wird davon
ausgegangen, dass die Bereitstellung von Entwicklungsmöglichkeiten und die
Schaffung eines lernfördernden Arbeitsklimas aus akteursorientierter
Perspektive notwendig sind, um den Erfolg der Personalentwicklung zu
gewährleisten.
14
Eine Definition, die dem akteursorientierten Zugang
zugeordnet werden kann, bietet Münch (1995). Denn dessen Auffassung nach
ist Personalentwicklung ,,[...] das Insgesamt derjenigen Maßnahmen, die
geeignet sind, die Handlungskompetenz der Mitarbeiter weiterzuentwickeln, zu
erhalten und ständig zu erneuern, und zwar mit dem Ziel, den
Unternehmenserfolg unter weitesgehender Berücksichtigung der
Mitarbeiterinteressen zu sichern."
15
Laut des methodenorientierten Zugangs ist eine methodische Absicherung für
die Erreichung und Überprüfung der Effektivität und Effizienz von
Personalentwicklungsmaßnahmen unerlässlich. Zudem geht dieser Forschungs-
und Gestaltungszugang davon aus, dass durch diese Absicherung eine
Legitimation der Maßnahme gegenüber den Entscheidungsträgern bzw. der
Unternehmensleitung erreicht wird, wodurch gleichzeitig auch die
notwendigen Ressourcen sichergestellt werden.
16
Der methodenorientierte
Zugang wird im Rahmen der Arbeit jedoch lediglich aufgegriffen, um den
Transfer im Prozess der Personalentwicklung zu verorten.
2.1.2 Arten der Personalentwicklung
Nachdem im vorangehenden Kapitel die Forschungs- und Gestaltungszugänge
der Personalentwicklung verdeutlicht wurden, sollen nun die verschiedenen
Arten dieses personalwirtschaftlichen Instruments beleuchtet werden. Im
14
Vgl. Becker 2007, S.13.
15
Münch 1995, S. 15.
16
Vgl. Becker 2007, S. 16.
Begriffliche und terminologische Grundlagen
8
Hinblick auf den thematischen Schwerpunkt dieser Arbeit ist eine
Differenzierung von Personalentwicklungsmaßnahmen anhand ihrer Nähe zum
tatsächlichen Aufgabenbereich bzw. der beruflichen Tätigkeit deshalb sinnvoll,
weil sie verdeutlicht, in welchen Bereichen eine Transfersicherung überhaupt
als relevant bzw. erstrebenswert erachtet werden kann.
17
Einen Überblick der
Personalentwicklungsarten wird zunächst durch die folgende Abbildung
gegeben.
Abbildung 2.2: Arten der Personalentwicklung
Quelle: Holtbrügge 2013
Eine der wichtigsten Arten ist die Personalentwicklung ,,into the job", da sie
letztendlich den Berufseinstieg ermöglicht. Zu dieser Personalentwicklungsart
gehören neben der Berufsausbildung zum Beispiel auch Anlernausbildungen
oder Trainiee-Programme. Durch die Personalentwicklung ,,into the job" soll
der Mitarbeitende Qualifikationen erhalten, die ihm die zukünftige Ausübung
einer beruflichen Tätigkeit erlauben.
18
Die Entwicklungsmaßnahmen werden
hierbei in zeitlicher, zum Teil auch räumlicher Entfernung zum Arbeitsplatz
durchgeführt; auch wenn eine inhaltliche Nähe zum Arbeitsplatz oft
gewährleistet ist, um den Einstieg in das Berufsumfeld zu erleichtern.
19
17
Vgl. Holtbrügge 2013, S. 135.
18
Vgl. Holtbrügge 2013, S. 135-136.
19
Vgl. Bröckermann, Müller-Vorbrüggen, S.192.
Begriffliche und terminologische Grundlagen
9
Eine andere Art ist die Personalentwicklung ,,on the job". Diese wird dann
angewendet, wenn Mitarbeitende bereits eine Berufsausbildung und
Berufserfahrung haben. Zu dieser Art der Personalentwicklung gehören zum
Beispiel systematische Unterweisungen oder qualifikationsfördernde
Aufgabengestaltung, wie beispielsweise Job Enrichment, Job Enlargement oder
Job Rotation. Auch sind bei der Personalentwicklung ,,on the job"
gruppenorientierte Ansätze wie Projektarbeit möglich.
20
Bei dieser
Personalentwicklungsart werden die Maßnahmen direkt am Arbeitsplatz
durchgeführt. Es erfolgt eine unmittelbare Verzahnung von Erlerntem und
dessen Anwendung in der Praxis.
21
Personalentwicklung ,,near the job" findet neben dem Job statt. Fokus ist
hierbei nicht die eigentliche Arbeitsaufgabe, sondern der Lernprozess und die
Bewältigung neuer, zeitlich befristeter Aufgaben. Im Rahmen der ,,near the
job" Personalentwicklung können zum Beispiel Lernstätte, Qualitätszirkel oder
Planspiele durchgeführt werden.
22
Diese Art der Personalentwicklung erfolgt
meistens in zeitlicher, räumlicher sowie inhaltlicher Nähe zur beruflichen
Tätigkeit.
23
Im Rahmen der ,,along the job" Personalentwicklung erfolgen Maßnahmen, die
den Mitarbeitenden schrittweise mehr Arbeitsaufgaben und Verantwort-
lichkeiten übertragen sowie die entsprechenden Kompetenzen vermitteln.
Hierdurch soll diesem temporär oder dauerhaft ermöglicht werden, eine neue,
hierarchisch höher angesiedelte Stelle zu besetzen. Die ,,along the job"
Personalentwicklung beinhaltet also Maßnahmen zur individuellen Karriere-,
Laufbahn- und Nachfolgeplanung.
24
Diese Personalentwicklungsart erfolgt in
sehr unterschiedlicher zeitlicher, räumlicher und inhaltlicher Nähe zur
beruflichen Tätigkeit.
25
Die traditionellste Art der Personalentwicklung sind ,,off the job" Maßnahmen.
Zu diesen gehören zum Beispiel Vorträge, Seminare und Workshops,
Fallstudien, Rollenspiele, E-Learning, oder auch Outdoor-Trainings. Diese
20
Vgl. Holtbrügge 2013, S. 136-137.
21
Vgl. Bröckermann, Müller-Vorbrüggen, S.192.
22
Vgl. Holtbrügge 2013, S. 137.
23
Vgl. Bröckermann, Müller-Vorbrüggen, S.192.
24
Vgl. Holtbrügge 2013, S. 137.
25
Vgl. Bröckermann, Müller-Vorbrüggen, S.192.
Begriffliche und terminologische Grundlagen
10
Maßnahmen ermöglichen eine Fortsetzung des Lernens nach der ersten
Berufsausbildung.
26
Die ,,off the job" Personalentwicklung findet meist in
zeitlicher, räumlicher und inhaltlicher Entfernung zum Job statt.
27
Zuletzt ist die Personalentwicklung ,,out of the job" zu erwähnen. Im Rahmen
dieser Personalentwicklungsart werden Maßnahmen wie das Outplacement
durchgeführt, das gekündigte Mitarbeitern/-innen bei dem Einstieg in eine
andere Arbeitsstelle unterstützt. Eine andere Maßnahme ist die
Ruhestandsvorbereitung, die ein schonendes Ausscheiden von kurz vor der
Pensionierung stehenden Mitarbeitenden ermöglicht.
28
Durch die vorgenommene Differenzierung wird deutlich, dass die
verschiedenen Arten der Personalentwicklung spezifische Entfernungen zur
eigentlichen beruflichen Tätigkeit aufweisen. Unter Anbetracht dieser
Erkenntnis, ist die Relevanz des Transfers für gewisse Arten der
Personalentwicklung somit höher als für andere. Grundsätzlich erhöht sich die
Bedeutung des Transfers mit steigender zeitlicher, räumlicher und inhaltlicher
Entfernung zur beruflichen Tätigkeit und den zugehörigen
Aufgabenbereichen.
29
Diese Aussage muss jedoch in der Weise relativiert
werden, als dass die Nähe zur Tätigkeit nur einer von mehreren
Einflussfaktoren des Transfers ist. Auf diese Einflussfaktoren soll jedoch im
nächsten Abschnitt ausführlich eingegangen werden. Festzuhalten ist jedoch,
dass sich die vorliegende Arbeit aufgrund der hohen Bedeutung des Transfers
im Bereich der ,,off the job" Maßnahmen, in erster Linie auf diese Art der
Personalentwicklung bezieht.
2.2 Transfer
Die folgenden Ausführungen sollen dazu dienen, den Begriff des Transfers
näher zu beschreiben und zu definieren. Anschließend soll eine
modelltheoretische Grundlage für die Herleitung von Maßnahmen zur
Transfersicherung geschaffen werden, um darauf aufbauend die Verortung des
Transfers in der Personalentwicklung vorzunehmen. In diesem Kontext kann
26
Vgl. Holtbrügge 2013, S. 137-138.
27
Vgl. Bröckermann, Müller-Vorbrüggen, S.192.
28
Vgl. Holtbrügge 2013, S. 141.
29
Vgl. Seidel 2012, S. 12.
Begriffliche und terminologische Grundlagen
11
dann dessen Bedeutung für die Personalentwicklung aufgezeigt werden.
2.2.1 Begriff und Definition
Die Fachliteratur bietet auch für den Transfer diverse Zugänge. Wie bei der
Personalentwicklung kommt es auch hier auf die Perspektive an, aus der der
Begriff beleuchtet wird.
Zunächst lässt sich Transfer im Kontext der Lernpsychologie betrachten, die
unter anderem auch den Begriff ,,Lerntransfer" nutzt. Aus lernpsychologischer
Sicht kommt dem Lernen, mit dem Ziel der Übertragung des Gelernten auf
andere Lerngebiete, eine besondere Bedeutung zu. Roth (1963) bezeichnet den
Lerntransfer sogar als zentrale Zielstellung pädagogischen Handelns.
30
Passend
zu diesen Ausführungen definiert Seel (2000) den Transfer als ,,[...] Einfluss
von Lernen in einer Situation auf das Lernen in einer anderen Situation."
31
Seidel (2012) umschreibt den Lerntransfer im Rahmen der der Lehr-Lern-
Forschung ähnlich. Laut der Autorin untersucht diese die ,,[...] Übertragung
des Gelernten von einer Aufgabe auf eine davon abweichende Aufgabe
innerhalb der Lernsituation [...]".
32
Da der Transfer in der vorliegenden Arbeit aber aus Sicht der betrieblichen
Weiterbildung betrachtet wird, sollen an dieser Stelle zwei betriebs-
wirtschaftlich orientierte Definitionen angeführt werden.
Mit Bezug auf die betriebliche Weiterbildungsforschung wird der Transfer laut
Seidel (2012) als ,,[...] Übertragung von erworbenem Wissen auf die
Anforderungen am Arbeitsplatz [...]"
33
verstanden.
Eine weitere Definition liefert Solga (2011), nach dem Transfer ,,[...] die
Übertragung gelernter Kenntnisse und Fertigkeiten auf Herausforderungen
(Aufgaben und Probleme) des Arbeitslebens, die Umsetzung und
Generalisierung erworbener Kompetenzen in den Arbeitsalltag"
34
darstellt.
Es wird deutlich, dass zwischen den beiden genannten Betrachtungsweisen vor
allem im Hinblick auf den Anwendungskontext des Gelernten Unterschiede
30
Vgl. Roth 1963.
31
Vgl. Seel 2000, S. 307.
32
Vgl. Seidel 2012, S. 13.
33
Vgl. Seidel 2012, S. 13.
34
Vgl. Solga 2011, S. 342.
Begriffliche und terminologische Grundlagen
12
bestehen. Weil sich die vorliegende Arbeit dem Thema aus
betriebswirtschaftlicher Sicht nähert, wird sie sich auf die Betrachtung des
Transfers im Rahmen der betrieblichen Weiterbildungsforschung
konzentrieren.
Weiterhin gilt es im Rahmen der Begriffsklärung die möglichen Dimensionen
und Formen von Transfer zu erläutern, um zu verdeutlichen, welche
Zielstellung verfolgt wird, wenn von der Transfersicherung gesprochen wird.
Ausgehend von der Definition Solga (2011) lassen sich Transferprozesse
zunächst durch verschiedene Dimensionen beschreiben. So ist der
Transferprozess zunächst durch den Grad der notwendigen Generalisierung
geprägt. Dieser beschreibt, inwieweit sich die Lernbedingungen von den
Anwendungsbedingungen unterscheiden. Weichen die Bedingungen stark
voneinander ab, muss das Gelernte in hohem Maße abstrahiert werden, bevor
es angewendet werden kann. Auf diese sogenannte Transferdistanz wurde
bereits im Rahmen der Personalentwicklungsarten (Abschnitt 2.1.2) und ihrer
Nähe zum tatsächlichen Anwendungsbereich, das heißt der beruflichen
Tätigkeit, eingegangen. Die zweite Dimension des Transferprozesses ist die
Aufrechterhaltung. Sie beschreibt, über welchen Zeitraum hinweg das Gelernte
tatsächlich wirksam und anwendbar bleibt.
35
Denkbar sind in diesem
Zusammenhang zum Beispiel Fälle, in denen Qualifikationen durchgeführt
werden, obwohl eine Anwendung erst in naher oder ferner Zukunft eintritt oder
zu erwarten ist.
Weiterhin kann der Transfer verschiedene Formen aufweisen. In Anbetracht
des ökonomischen Hintergrundes der Arbeit sollen an dieser Stelle lediglich
der positive und negative Transfer aufgegriffen werden. Im Idealfall stellt sich
ein positiver Transfer ein. Das bedeutet, dass die Personalentwicklungs-
maßnahme und der nachgelagerte Transferprozess die Ausübung der
beruflichen Tätigkeit erleichtern oder verbessern und so zu der durch die
qualitative Personalbedarfsplanung angestrebte Schließung der Deckungslücke
zwischen Soll- und Ist-Qualifizierung führen. Ein negativer Transfer hingegen
kann sich zum Beispiel dann einstellen, wenn vermittelte Lerninhalte von
Mitarbeitenden nicht richtig gelernt wurden oder diese nicht in ausreichendem
35
Vgl. Baldwin und Ford 1988, S. 95.
Begriffliche und terminologische Grundlagen
13
Maße auf den Verwendungskontext abgestimmt worden sind. In der
Konsequenz kann es zu Handlungsfehlern oder verzögerungen kommen.
36
2.2.2 Ein ausgewähltes Prozessmodell des Transfers
Nachdem der Transfer definiert und begrifflich eingeordnet wurde, wird nun
ein Prozessmodell des Transfers aufgegriffen. Durch die Beleuchtung des
Modells soll der Prozess des Transfers mit seinen Bestandteilen und dessen
Ausprägungen verdeutlicht werden. Dies ist nötig, um zu einem späteren
Zeitpunkt der Arbeit eine theoretisch fundierte Ableitung von Maßnahmen zur
Transfersicherung zu ermöglichen.
An dieser Stelle wurde das Prozessmodell nach Baldwin und Ford (1988)
gewählt, weil es in der Fachliteratur bereits vielfach, wenn auch zum Teil in
etwas abgewandelter Form, aufgegriffen wurde. So lassen sich zum Beispiel in
den Transfermodellen von Dubs (1994) sowie Rank und Wakenhut (1998)
durchaus Parallelen erkennen. Auch Bender (2009) greift in seiner Arbeit
einige Aspekte des Transfermodells von Baldwin und Ford auf. Bei allen drei
Autoren fällt vor allem eine Gemeinsamkeit auf. In ihren Ausführungen wird
der Transfer unter anderem durch drei spezifische Bereiche beeinflusst, die
ihrerseits eigene Einflussfaktoren aufweisen. Das Modell nach Baldwin und
Ford, das nun näher erläutert wird, wird durch Abbildung 2.3 illustriert.
Das Prozessmodell untergliedert sich in die drei Einflussbereiche
Trainingsinput, Trainingsoutput und Transferbedingungen. Die Inputs
umfassen hierbei die oben angesprochenen Einflussbereiche des Transfers mit
ihren Einflussfaktoren.
37
Der erste Einflussfaktor sind die teilnehmenden Personen mit ihren
Merkmalen. Zu den Kategorien der Merkmale gehören neben den Fähigkeiten
zum Beispiel auch die Persönlichkeit und die Motivation der Personen. Der
zweite Einflussbereich ist das Trainingsdesign, welches zum Beispiel die
Lernprinzipien, die zeitliche Struktur sowie die Relevanz der Inhalte für die
berufliche Tätigkeit umfasst. Der dritte und letzte Einflussbereich ist die
Arbeitsumgebung. Diese kann beispielsweise die Unterstützung durch
36
Vgl. Sonntag 2005, S.358.
37
Vgl. Baldwin und Ford 1988, S. 64-65.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2014
- ISBN (eBook)
- 9783956363931
- ISBN (Paperback)
- 9783956367373
- Dateigröße
- 1.5 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
- Erscheinungsdatum
- 2014 (November)
- Note
- 2,3
- Schlagworte
- Transfer Personalentwicklung Personalwirtschaft Kapitalwert-Methode
- Produktsicherheit
- Diplom.de