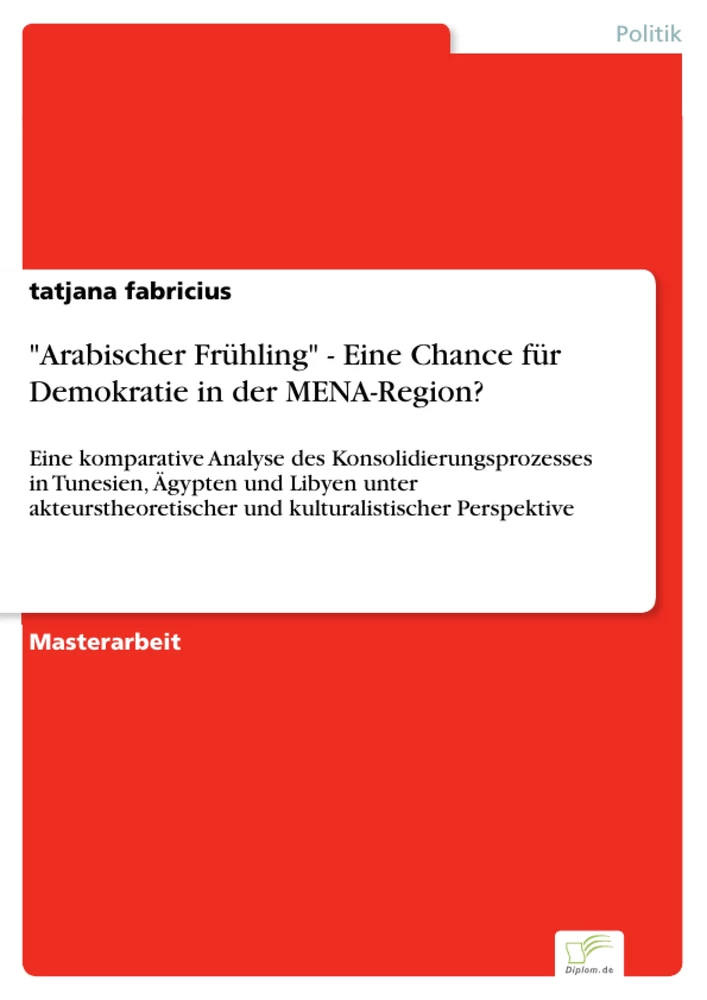"Arabischer Frühling" - Eine Chance für Demokratie in der MENA-Region?
Eine komparative Analyse des Konsolidierungsprozesses in Tunesien, Ägypten und Libyen unter akteurstheoretischer und kulturalistischer Perspektive
©2014
Masterarbeit
95 Seiten
Zusammenfassung
Anfang 2011 sollten die gesellschaftspolitischen Umbrüche in der MENA-Region1 für alle Unbeteiligten und Beteiligten überraschend kommen. Sie weckten deren Hoffnung auf Konsolidierung rechtsstaatlicher Demokratien in den arabischen Staaten (Rosiny 2011). Der Übergang von autoritären zu liberaldemokratischen politischen Systemen wird in der Transformationsforschung in die Phasen Liberalisierung, Demokratisierung und Konsolidierung unterteilt (O´Donnell et al. 1986). In Abgrenzung zur Liberalisierung, also der Auflösung des autokratischen Systems, und Demokratisierung, d. h. der Institutionalisierung der Demokratie, wird in der vorliegenden MA-Thesis die Phase der Konsolidierung in der MENA-Region untersucht.
Bis heute konnte sich kein Land in dieser Region demokratisch konsolidieren (BTI 2012a: 90), sodass aus politikwissenschaftlicher Sichtweise der Demokratisierungsprozess dort ins Stocken geraten ist. Ziel der vorliegenden qualitativen Untersuchung ist es, die Konsolidierungsprobleme in der MENA-Region zunächst mit Merkels „Mehrebenenmodell der demokratischen Konsolidierung“ zu untersuchen, um anschließend anhand der Fälle Tunesien, Ägypten und Libyen deren Gründe unter akteurs- und kulturtheoretischer Perspektive zu erklären. Das Zeitfenster der Untersuchung öffnet sich mit Beginn der Proteste Anfang 2011 und schließt mit dem Ende der Arbeit.
Bis heute konnte sich kein Land in dieser Region demokratisch konsolidieren (BTI 2012a: 90), sodass aus politikwissenschaftlicher Sichtweise der Demokratisierungsprozess dort ins Stocken geraten ist. Ziel der vorliegenden qualitativen Untersuchung ist es, die Konsolidierungsprobleme in der MENA-Region zunächst mit Merkels „Mehrebenenmodell der demokratischen Konsolidierung“ zu untersuchen, um anschließend anhand der Fälle Tunesien, Ägypten und Libyen deren Gründe unter akteurs- und kulturtheoretischer Perspektive zu erklären. Das Zeitfenster der Untersuchung öffnet sich mit Beginn der Proteste Anfang 2011 und schließt mit dem Ende der Arbeit.
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung 5
1.1 Thema 5
1.2 Fragestellung und Hypothese 5
1.3 Gesellschaftliche und wissenschaftliche Relevanz 6
1.4 Forschungsstand und Vorgehensweise 6
2 Zentrale Begriffe 8
2.1 Demokratie 9
2.1.1 Lauths Demokratieverständnis 10
2.1.2 Stoibers Demokratieverständnis 11
2.2 Transformation 13
2.2.1 Regimewandel und -wechsel 13
2.2.2 Systemwandel und -wechsel 14
2.2.3 Transition 15
3 Theorie I: ,,Mehrebenenmodell der demokratischen Kon-
solidierung" 17
3.1 Konsolidierung 17
3.2 Merkels ,,Vier-Ebenen-Modell" 18
3.2.1 Einfluss von Eliten und Staatsbürgern auf die Konsolidierung 19
3.2.2 Konstitutionelle Konsolidierung 21
3.2.3 Repräsentative Konsolidierung 22
3.2.4 Verhaltenskonsolidierung informeller politischer Akteure 23
3.2.5 Konsolidierung der Bürgergesellschaft 24
4 Theorie II: Akteurs- und Kulturtheoretischer Ansatz 24
4.1 Transformationstheoretische Diskussion 24
4.2 Akteurstheorien 27
4.3 Kulturtheorien 29
5 Konzeptualisierung 32
5.1 Vergleichende Methode 32
5.2 Most Similar Systems Design (MSSD) 34
5.3 Variablen 34
5.3.1 Abhängige Variable (AV) 34
5.3.2 Unabhängige Variablen (UVs) 35
5.4 Hypothesen 37
5.5 Fallauswahl 37
6 Empirie I: Konsolidierungsstand in der MENA-Region 40
6.1 Ausgangspunkte in Tunesien, Ägypten und Libyen 40
6.2 Konstitutionelle Konsolidierung 42
6.2.1 Formale Legitimation 42
6.2.2 Empirische Legitimation 45
6.3 Repräsentative Konsolidierung 47
6.3.1 Parteiensystem 47
6.3.2 Wahlsysteme 50
6.3.3 Interessenverbände und Gewerkschaften 51
6.4 Verhaltenskonsolidierung informeller politischer Akteure 53
6.4.1 Militär- und Sicherheitsapparat 53
6.4.2 Islamisten 55
6.4.3 Stämme 56
6.5 Konsolidierung der Bürgergesellschaft 58
6.5.1 NGOs 58
6.5.2 Autonomie der Individuen 59
6.5.3 Zugang zu einem umfassenden Kommunikationsnetz 59
6.5.4 ,,Überlappende" Mitgliedschaft in Organisationen 59
6.5.5 ,,Schulen der Demokratie" 60
6.5.6 ,,Emanzipatorischer" Zugang zum Agenda-Setting 60
6.6 Zwischenfazit 61
7 Empirie II: Erklärung der Konsolidierungsdefekte in der
MENA-Region 63
7.1 Verteilung der Machtkonzentration 63
7.1.1 Emanzipierte Arbeiterschaft 63
7.1.2 Moderne Mittelschicht 64
7.1.3 Moderate Bourgeoise 65
7.2 Elitenhandeln 66
7.2.1 Elitendispositionen 66
7.2.2 Elitenkalküle 67
7.2.3 Elitenpakte 70
7.3 Islamische Resurgenz 71
7.3.1 Stellenwert des Islams in der Gesellschaft 72
7.3.2 Politische Legitimation auf Religion 73
7.3.3 ,,Zufluchtsort" Islam? 75
7.4 Kulturelle Indigensierung 77
7.4.1 Akzeptanz westlicher Werte 77
7.4.2 Rechte der Frauen 78
7.4.3 Integration von Nichtmuslimen 80
8 Fazit 82
A. Literatur 84
B. Anhang 94
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1:
,,Mehrebenenmodell der demokratischen Konsolidierung"
20
Abbildung 2:
Die Staaten der Grundgesamtheit MENA-Region
38
Abbildung 3:
Konsolidierungsstand in Tunesien, Ägypten und Libyen
62
Abbildung 4: Konsolidierungshindernisse in Tunesien, Ägypten und Libyen
81
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1:
Formale Legitimation
45
Tabelle 2:
Empirische Legitimation
46
T
abelle 3:
Konstitutionelle Konsolidierung
47
Tabelle 4:
Repräsentative Konsolidierung
52
Tabelle 5:
Verhaltenskonsolidierung informeller politischer Akteure
57
Tabelle 6:
Konsolidierung der Bürgergesellschaft
61
,,Demokratie ist nicht, sondern wird ständig."
(Klaus von Beyme, 1994)
1 Einleitung
1.1 Thema
Anfang 2011 sollten die gesellschaftspolitischen Umbrüche in der MENA-Region
1
für
alle Unbeteiligten und Beteiligten überraschend kommen. Sie weckten deren Hoff-
nung auf Konsolidierung rechtsstaatlicher Demokratien in den arabischen Staaten
(Rosiny 2011).
Der Übergang von autoritären zu liberaldemokratischen politischen Systemen wird
in der Transformationsforschung in die Phasen Liberalisierung, Demokratisierung
und Konsolidierung unterteilt (O´Donnell et al. 1986). In Abgrenzung zur Liberalisie-
rung, also der Auflösung des autokratischen Systems, und Demokratisierung, d. h.
der Institutionalisierung der Demokratie, wird in der vorliegenden MA-Thesis die
Phase der Konsolidierung in der MENA-Region untersucht.
Bis heute konnte sich kein Land in dieser Region demokratisch konsolidieren (BTI
2012a: 90), sodass aus politikwissenschaftlicher Sichtweise der Demokratisierungs-
prozess dort ins Stocken geraten ist. Ziel der vorliegenden qualitativen Untersu-
chung ist es, die Konsolidierungsprobleme in der MENA-Region zunächst mit Mer-
kels ,,Mehrebenenmodell der demokratischen Konsolidierung" zu untersuchen, um
anschließend anhand der Fälle Tunesien, Ägypten und Libyen deren Gründe unter
akteurs- und kulturtheoretischer Perspektive zu erklären. Das Zeitfenster der Unter-
suchung öffnet sich mit Beginn der Proteste Anfang 2011 und schließt mit dem Ende
der Arbeit.
1.2 Fragestellung und Hypothese
Die Leitfrage meiner Untersuchung ist: Warum können die Staaten in der MENA-
Region sich noch nicht demokratisch konsolidieren?
Im Fokus der Analyse stehen das Handeln der Akteure und deren kulturell-traditio-
nelle Rahmenbedingungen. Daraus ergeben sich weitere Fragen: Welchen Einfluss
haben Eliten und kulturell-traditionelle Rahmenbedingungen auf den Konsolidie-
rungsprozess in der MENA-Region? Wer sind die politisch relevanten Akteure wäh-
rend des Konsolidierungsprozesses in der MENA-Region? Inwieweit beeinflussen
deren Interessen und Strategien den Konsolidierungsprozess? Inwiefern wirken kul-
5
1
Länder Nordafrikas und des Nahen Ostens.
turelle Traditionsbestände (islamische Kultur und vormoderne Tradition) auf den
Konsolidierungsprozess in der MENA-Region ein?
Meine Arbeits-Hypothese ist: je stärker alte Eliten intervenieren, neue Eliten
,,schwächeln", religiös-kulturelle Strukturen sowie vormoderne Traditionen vorherr-
schen, desto mehr schwindet die Chance auf demokratische Konsolidierung in der
MENA-Region.
1.3 Gesellschaftliche und wissenschaftliche Relevanz
Meine Fragestellung ist deshalb von gesellschaftlicher Relevanz, weil die MENA-
Region ,,von (einer) Welle politisch-gesellschaftlichen Drucks" (Perthes 2011: 137)
erfasst wurde, die bis dato aber noch nicht abgeebbt ist. Anfang 2011 wurden in
zahlreichen arabischen Ländern Massenbewegungen ausgelöst, die sich gegen die
brutale Repression und Menschenrechtsverletzungen der Staatsmacht erhoben. In
der Folge wurden Despoten gestürzt, langjährige verkrustete politische Strukturen
aufgebrochen und Demokratisierungsprozesse eingeleitet. Wohin die gesellschafts-
politischen Umbrüche die Staaten der MENA-Region führen, ist bis heute noch nicht
abzusehen.
Die wissenschaftliche Relevanz der Fragestellung resultiert aus dem Umstand, dass
erstens eine zunehmende Islamisierung im gesellschaftspolitischen Bereich, zwei-
tens eine schwache säkulare Bewegung und drittens immer noch die Dominanz der
alten Seilschaften der gestürzten autoritären Regime zu beobachten sind (Masoud
2011). Dabei wird in der Politikwissenschaft die Frage kontrovers diskutiert, ob nach
den ,,vier Demokratisierungswellen" des 20. Jahrhunderts (Merkel 2010: 128 ff.) mit
den Umbrüchen in der MENA-Region von einer ,,fünften Demokratisierungswelle" im
21. Jahrhundert gesprochen werden kann (Perthes 2011).
1.4 Forschungsstand und Vorgehensweise
Die politikwissenschaftliche Forschung zu den Transformationsprozessen in der
MENA-Region ist noch wenig elaboriert, weil die politischen und gesellschaftlichen
Umwälzungsprozesse dort noch von großer Dynamik geprägt sind. Doch mit der
,,Dritten Demokratisierungswelle" nach 1974 wurden in der Transformationsfor-
schung unzählige analytische Konzepte und Theorien in anderen Regionen
2
entwi-
ckelt. Die vorliegende theoriegeleitete Querschnittsanalyse knüpft an diesen bzw. an
der politikwissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Transformationsprozessen im
Allgemeinen und Konsolidierungsprobleme in der MENA-Region (Nordhausen/
Schmid 2011; Perthes 2011) im Speziellen an. Fraglich ist, ob und inwieweit die
Konzepte respektive die generalisierende sozialwissenschaftliche Aussagen, die für
6
2
Eine breit angelegte Studie zu Südeuropa, Lateinamerika, Ost- und Südostasien bietet
Merkel (2007b).
andere Regionen entwickelt wurden, reisen (travelling)
3
, sodass der Konsolidie-
rungsprozess in der MENA-Region mit diesen hinreichend untersucht werden kann.
Ich will den oben aufgeworfenen Fragen im Folgenden in drei Schritten nachgehen,
sodass im ersten Schritt mit Merkels Konzept ,,Mehrebenenmodell der demokrati-
schen Konsolidierung" (Merkel 2010) untersucht wird, wann und inwieweit von einer
erfolgreichen Konsolidierung gesprochen werden kann. In der Abgrenzung zu ande-
ren Konsolidierungskonzepten hat sich Merkels Modell in der Transformationsfor-
schung als robust erwiesen, da es neben der konstitutionellen Ebene und die der
Verhaltenskonsolidierung der informellen Akteure auch die Ebenen der intermediä-
ren Akteure und die der Staatsbürger betrachtet. In der Folge wird dann im zweiten
Schritt entlang der vier Ebenen von Merkels theoretischen Modell, die als Indikato-
ren dienen, eine systematische Untersuchung der Fälle vorgenommen bzw. deren
Stand der Konsolidierung und Defizite operationalisiert.
Im dritten Schritt werden die Ursachen und Ausprägungen der aufgefundenen Defi-
zite mit Theorien der Transformationsforschung untersucht. Diese analysieren mit
fünf Ansätze die Ursachen, Erfolge und Misserfolge demokratischer Systemwech-
sel. In Abgrenzung zur System- und Modernisierungstheorie erfolgt der theoretische
Zugang der vorliegenden Arbeit mit einem akteurstheoretischen Ansatz, der um ei-
nen kulturalistischen Ansatz ergänzt wird. Nicht langfristige Makrostrukturen bzw.
sozioökonomische Bedingungen stellen die Weichen für einen erfolgreichen Demo-
kratisierungsprozess, sondern das Handeln der relevanten Akteure in unsicheren
und schnell wechselnden Situationen (O´Donnell et al.1986: 4). Hierbei beeinflussen
insbesondere Eliten und deren Bereitschaft ein Minimalkonsens über demokratische
Spielregeln herzustellen den Konsolidierungsprozess nachhaltig (Higley/Gunther
1992). Die zunehmende Islamisierung im gesellschaftspolitischen Bereich in den
Ländern der MENA-Region macht die Ergänzung um einen kulturalistischen Ansatz
notwendig. Nach Huntington (2002: 28) entscheidet Religion bzw. die islamische
Kultur über die Demokratisierung eines Landes. Der strukturtheoretische Ansatz
hingegen fließt als Kontrollvariable mit in die vorliegende Untersuchung ein.
Das religiös-traditionell kanalisierte Handeln der Eliten in der MENA-Region kann
mit den Kernsätzen akteurstheoretischer und kulturalistischer Ansätze begründet
werden, wobei der erstgenannte Ansatz in der vorliegenden Arbeit eine Modifikation
erfährt, da hier nicht, wie bei O´Donnell und Schmitter, die Liberalisierungsphase im
Fokus steht, sondern die Konsolidierungsphase.
Ziel der vorliegenden deskriptiv-analytischen Arbeit ist es, mit der systematischen
Untersuchung der Indikatoren auf der unteren analytischen Ebene und dem an-
schließenden Ergebnistransfer auf die obere theoretische Ebene Aussagen über die
7
3
Siehe Peters (2004: 66 f.).
Kausalität zwischen unabhängiger und abhängiger Variable zu ermöglichen. Kurz:
es gibt einen Ursache-Wirkungs-Zusammenhang zwischen den UVs (erklärender
Faktor) und der AV (das Erklärte). Dementsprechend gestaltet sich die vorliegende
Arbeit methodisch wie folgt: in Abgrenzung zur statistischen Methode wird unter ge-
legentlicher Auswertung von Statistiken (quantitative Methode) vorwiegend mit der
qualitativen Methode Sekundärliteratur ausgewertet (Lijphart 1971: 682693). Die
Herleitung der AV und der UVs und die Generierung allgemeiner Hypothesen wer-
den durch die Forschungsfrage bzw. durch theoretische Überlegungen bestimmt
(Merkel et al. 2006: 10). Die Fälle werden sowohl durch die UVs als auch mit dem
Most Similar Systems Design bestimmt (Jahn 2011: 76 ff.). Deren anschließende
Untersuchung mit der ,,vergleichenden Methode" ermöglicht es, die Hypothesen
empirisch zu überprüfen um eine Generalisierbarkeit von Ergebnissen zu erreichen.
Die Grenzen der verwendeten Methoden sind in der nicht ausreichenden wissen-
schaftlichen Intersubjektivität zu finden, da die Wahl der Fälle, Variablen und Indika-
toren subjektiv gefärbt ist. Die Generalisierbarkeit bzw. Validität, d. h. Stabilität der
Analyse, wird mit der Kombination von qualitativer und quantitativer Datenauswer-
tung erhöht. Trotzdem ist die vorliegende Arbeit nicht von ,,blinden Stellen" in Bezug
auf die Verwendung von (anderen) theoretischen Modellen, Konzepten und Variab-
len (Indikatoren), ausgenommen.
Nach der Einleitung werden in Kapitel zwei die Begriffe Demokratie und Transforma-
tion geklärt. In Kapitel drei werden die Konsolidierung im Allgemeinen und Merkels
,,Mehrebenenmodell der demokratischen Konsolidierung" im Besonderen diskutiert.
Mein Akteur- und kulturtheoretischer Ansatz wird im vierten Kapitel vorgestellt und in
Abgrenzung zu den anderen Transformationstheorien begründet. In Kapitel fünf wird
das methodische Vorgehen der Arbeit erläutert. Im sechsten Kapitel der Arbeit wer-
den die Konsolidierungsdefizite der drei Fälle der vorliegenden Analyse herausge-
arbeitet, um im anschließenden Kapitel die Gründe für diese zu liefern. Damit kann
ich im achten Kapitel mein Fazit begründen, dass von Eigeninteressen geleitetes
Elitehandeln und radikal-religiöse Gruppierungen des Islams eine erfolgreiche de-
mokratische Konsolidierung in der MENA-Region verhindern.
2 Zentrale Begriffe
Ziel dieses Kapitels ist es, die Fragen nach dem, wer und wie des politischen Pro-
zesses zu beantworten. Wer wird beteiligt bzw. inwieweit kommt die Variable Kon-
trolle zur Anwendung, und zwar erstens auf einer abstrakten normativen Ebene und
zweitens vor dem Hintergrund der Konsolidierungsprobleme in der MENA-Region?
Mit der Diskussion anerkannter demokratischer Definitionen (Lauth 2004: 12) bzw.
der Diskussion von Lauths und Stoibers Demokratiekonzepten, werde ich meinen
Demokratiebegriff definieren. Anschließend werde ich kurz die äußere Abgrenzung
8
von Demokratie zur Autokratie mit Robert A. Dahls ,,Polyarchie" vornehmen. Der
zweite Teil dieses Kapitels nimmt die begriffliche Differenzierung des Terminus
Transformation vor, um einerseits die Begriffe trennscharf zu verwenden und ande-
rerseits den die jeweiligen ,,System-Übergangstypen" der Fälle zu bestimmen.
2.1 Demokratie
,,As a form of government, democracy has been defined in terms of sources of authori-
ty for government, purposes serves by government, and procedures for constituting
government" (Huntington 1991: 6).
Vor dem Hintergrund, dass kein Staat den Kriterien der Demokratie wirklich genügt
(Dahl 1998: 42), ist Robert A. Dahls rhetorische Frage ,,What is Democracy?" (e-
benda: 35 ff.) berechtigt. Es gibt weder eine allgemein gültige Demokratiedefinition
(Diamond/Morlino 2004: 1; Beichelt 2001: 23; Sandschneider 1995; 10 f.) noch die
,,ideale Demokratie" (Merkel 2010: 29). Es existieren unterschiedlich methodolo-
gisch und normativ ausgerichtete Ansätze, die z.T. inkompatible Aussagen beinhal-
ten. Die empirische Messung von Demokratie setzt zunächst einen weitgehenden
Konsens über diese und über deren Qualität zwingend voraus (Stoiber 2011: 20).
Zunächst muss aber Demokratisierung klar von Demokratie abgegrenzt werden.
Demokratisierung bezeichnet den ,,Prozess" eines Wandels hin zu einer vollständig
ausgeprägten Demokratie. Demokratie dagegen bezeichnet einen Status quo, der
sich an normativen Grundlagen festmachen lässt. Demokratie wird erstmalig vom
griechischen Philosophen Aristoteles erwähnt und ist eine Herrschaft der Vielen (vgl.
Nohlen 2002: 51), wenn eine klare Abgrenzung
4
zu anderen Staatsformen besteht
und die Herrschaft ausschließlich beim Volk liegt.
Alle Demokratiekonzepte, die von Rousseau über Locke bis Schumpeter und Ha-
bermas reichen, können hier aus Platz- und Zeitgründen nicht nachgezeichnet wer-
den
5
. Demokratie wurde von Aristoteles negativ konnotiert und mit der Herrschaft
des Mobs assoziiert. Im modernen Demokratieverständnis ist Demokratie ein wer-
tender Begriff. Demokratie basiert auf einer normativen Grundlage, deren Erlangung
für viele Länder ein erstrebenswertes Ziel ist. Alle Demokratiemodelle fußen auf
Gleichheit und Freiheit. Normative
6
wie empirische
7
Demokratiedefinitionen implizie-
ren Jean Jacques Rousseaus Idee der Volkssouveränität, Schutz der Bürger sowie
demokratische Partizipation durch allgemeine, freie und faire Wahlen.
9
4
Es wird zwischen ,,klassischer" und ,,moderner" Abgrenzung zur Demokratie differen-
ziert. Erstere umfasst die Monarchie, Aristokratie, Oligarchie, Theokratie, d. h. Herr-
schaft von religiösen Führern sowie der Diktatur. Letztere umfasst totalitäre und autori-
täre Regime sowie Gottesstaaten, also die Führung eines Staates unter dem ,,Banner"
einer Religion, die alle gesellschaftlichen und politischen Subsysteme erfasst.
5
Siehe hierzu ausführlich Held (1987).
6
Normative Theorien bewerten Ist- und Soll-Zustände der Demokratie.
7
Empirische Theorien beschreiben und erklären Ist-Zustände der Demokratie.
Insbesondere Wahlen werden als Synonym für die Souveränität eines Volkes gese-
hen (Schmidt 2008: 373) bzw. stellen nach Joseph Schumpeter die existentielle Vo-
raussetzung demokratischer Verfahren dar. Demokratie wird per se als eine Ver-
trauensübertragung von Bürgern an Persönlichkeiten im Zuge freier und fairer Wah-
len gesehen. Max Weber betrachtet Demokratie deshalb als ,,eine Form säkularisier-
ter legitimer Herrschaft kraft Befehlsgewalt und Gehorsamspflicht" (Schmidt 2010:
19). Die eindeutigen Indizien der Demokratie sind dabei die Möglichkeit der Abwahl
durch das Volk und die Pflicht der Regierenden, politische Entscheidungen darauf
zurückzuführen.
Bis heute ist aber strittig, wer in welcher Form und in welchem Umfang politisch be-
teiligt werden soll. Nach Nohlen (2002: 51) definiert der Begriff Demos das Volk poli-
tisch, aber nicht ethnisch. Der Frage, wer wie auf den politischen Prozess einwirkt,
werde ich im folgenden Kapitel mit Hilfe von Lauths dreidimensionalen Konzept der
Demokratie und Stoibers minimalistischer Demokratiedefinition nachgehen.
2.1.1 Lauths Demokratieverständnis
,,Demokratie ist eine rechtsstaatliche Herrschaftsform, die eine Selbstbestimmung für
alle Staatsbürgerinnen und Staatsbürger im Sinne der Volkssouveränität ermöglicht,
indem sie die maßgebliche Beteiligung von jenen an der Besetzung der politischen
Entscheidungspositionen (und/oder an den Entscheidungen selbst) in freier, kompeti-
tiven und fairen Verfahren (z.b. Wahlen) und die Chancen einer kontinuierlichen Ein-
flussnahme auf den politischen Prozess sichert und generell eine Kontrolle der politi-
schen Herrschaft garantiert" (Lauth 2004: 100).
Demnach sind die drei Dimensionen der Gleichheit, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit
konstitutive Merkmale von Demokratie (ebenda: 86).
Politische Gleichheit steht bei Lauth erstens für einen Input-Egalitarismus, d. h. je-
der hat gleiche Zugangsbedingungen. Zweitens steht sie für einen legalen Egalita-
rismus, also der Staat schafft einen Rahmen, in dem die Bürger eine faire Gleichbe-
handlung erfahren. Demgegenüber wird aber ein Output-Egalitarismus nicht thema-
tisiert, wonach der Staat für die Schaffung gleicher Ausgangspositionen verpflichtet
ist (ebenda: 32-54).
Politische Freiheit wird in der scientific community unter kontroversen Debatten in
negative und positive Freiheiten eingeteilt (Berlin 1958; Stoiber 2011: 58). Negative
Freiheit bestimmt die Art, wie man regiert wird. Im Fokus stehen die bürgerlichen
Freiheitsrechte wie Meinungs-, Gewissens-, Glaubens- und Religionsfreiheit, aber
auch die individuellen Rechte. Diese schützt der Staat gegenüber dem Zugriff von
Dritten und sichert dem Bürger gleichzeitig Abwehrrechte gegenüber dem Staat
selbst zu (Lauth 2004: 57).
10
Positive Freiheit indes hinterfragt, wer regiert und thematisiert die Mängel wie Armut
und Arbeitslosigkeit. Rechtsstaatliche und politische Kontrolle wird bei Lauth als In-
strument gesehen, dass politische und gesellschaftliche Akteure an rechtsstaatliche
Regeln binden soll, denen sie sich stellen. Der Verlust einer der drei genannten Di-
mensionen führt nach Lauth zur Gefährdung der Demokratie im Ganzen durch Be-
einflussung der Qualität, zumal die Dimensionen sich wechselseitig bedingen bzw.
die demokratische und rechtsstaatliche Kontrolle miteinander verzahnt ist. Bei
Bühlmann (et al. 2006) hingegen soll Kontrolle im Gegensatz dazu die optimale Ba-
lance zwischen Gleichheit und Freiheit herstellen.
2.1.2 Stoibers Demokratieverständnis
Stoiber setzt Lauths Kontrolldimension entgegen, dass Kontrolle kein Ziel, sondern
ein Mechanismus ist, der Gleichheit und Freiheit sichern soll (Stoiber 2011: 23). In
Anlehnung an Abromeits Demokratieverständnis
8
, wo Demokratie als individuelle
Selbstbestimmung von Individuen bei kollektiven Entscheidungen verstanden wird
(2004: 78), definiert Stoiber Demokratie wie folgt:
,,Demokratie strebt nach der Verwirklichung individueller Freiheit und Gleichheit.
Sie ist die Ausdehnung der individuellen Selbstbestimmung auf den Bereich kollektiver
Entscheidungen; sie vollzieht sich mittels einer effektiven Beteiligung der Individuen
an den Entscheidungen, von denen sie betroffen sind" (Stoiber 2011: 137).
Das universalistische Konzept von Stoiber intendiert möglichst viele empirische Fäl-
le zu erfassen und unter Umgehung des ,,Travelling-Problems"
9
einen cross-area
Vergleich zwischen heterogenen Kontexten zu ermöglichen. Die Maximierung der
Extension, also die Anzahl der möglichen Fälle, auf die das Konzept angewendet
werden kann, ist dabei die Voraussetzung, um die Intension, d. h. die Hinzunahme
zusätzlicher Definitionsattribute, zu minimieren.
Stoibers Demokratieverständnis basiert auf drei Schritten, wobei erstens die Ver-
wirklichung individueller Freiheit und Gleichheit als (normative) Zielfunktion identifi-
ziert wird. Diese wird zweitens ,,mit dem zentralen Mechanismus der Herrschafts-
ausübung, dem Treffen kollektiver Entscheidungen" (ebenda) verbunden. Und drit-
tens ist die Schaffung eines ,,prozeduralen" Rahmens, in dem die Individuen sich
effektiv einbringen (beteiligen) können, notwendig. Im Gegensatz zu Lauth (2004:
226), der Demokratie an dem normativen Wirken von Institutionen festmacht, steht
bei Stoiber das ,,Wie" der Verwirklichung der Ziele der Individuen im Zentrum. Es
müssen Rahmenbedingungen für die Einbindung dieser geschaffen werden, sodass
deren Interessen und Ziele in kollektive Entscheidungen überführt werden können.
11
8
... welches massiv von Fuchs kritisiert wurde. Ausführlich dazu Fuchs (2004: 94 ff.).
9
Wenn z. B. ein hochspezifiziertes Konzept aufgrund eines anderen Kontextes/Kultur-
kreises nicht mehr passt.
Konträr zu Lauth macht Stoiber (siehe Kap. 2.1.1) demokratische Qualität nicht an
der ,,Gleichzeitigkeit" von politischer Gleichheit, Freiheit und Kontrolle fest, sondern
an der effektiven Beteiligung von Individuen an politischen Entscheidungen (Input),
von denen sie betroffen sind.
10
Normativer Individualismus und Chancengleichheit
stellen dabei Stoibers Schlüsselindikatoren für effektive Beteiligung von Individuen
an politischen Entscheidungen dar.
Die analytische Trennschärfe zwischen Demokratie und Autokratie wird in der vor-
liegenden Arbeit mit Robert A. Dahls ,,Polyarchie" hergestellt. Diese hat sich im Zuge
der dritten und vierten ,,Demokratisierungswelle" (Huntington 1991) zum ,,wichtigsten
Referenzmodell der Transformationsforschung" (Merkel 2010: 30) etabliert.
Dahl, der ,,Urvater" der Demokratiemessung, legt mit Wettbewerb (negative Freiheit
und positive Gleichheit) und Partizipation (positive Freiheit und rechtliche Gleichheit)
zwei Dimensionen der realen Polyarchie fest. Notwendige aber nicht hinreichende
Bedingungen für Demokratie sind die Möglichkeit der Bürger, ihre Präferenzen ge-
genüber der Regierung und den Mitbürgern durch individuelles und kollektives Han-
deln zu formulieren.
Die Wahrung dieser Präferenzen muss von der Regierung durch acht institutionelle
und prozessuale Minima gesichert werden. Diese sind Organisations-, Meinungs-
und Informationsfreiheit, aktives und passives Wahlrecht, regelmäßige freie und fai-
re Wahlen, Wettbewerb um Wählerstimmen und institutionelle Regelungen, die Re-
gierungsentscheidungen von den Präferenzen der Bürger abhängig machen (eben-
da: 28). Demnach kann nur in Abgrenzung zur Autokratie von Demokratie gespro-
chen werden, wenn alle acht institutionellen Minimalkriterien der Polyarchie erfüllt
werden. Dieses Kriterium erreicht aber bis dato auch keiner der westlichen Demo-
kratien. Merkels theoretische Konzept embedded democracy (ebenda: 30 ff.) ver-
sucht dieses Dilemma aufzufangen, doch wird hier davon abgesehen, weiter darauf
einzugehen. Nicht der Status quo, sondern der Prozess der Konsolidierung (Kap. 3)
in der MENA-Region steht im Fokus der vorliegenden Arbeit.
Vor dem Hintergrund der hier geführten demokratietheoretischen Diskussion fußt
mein Demokratieverständnis auf Gleichheit, Freiheit und weiche Kontrolle
11
. Sowohl
Lauths institutionelle als auch Stoibers individuelle demokratietheoretische Kompo-
nente finden darin Anwendung, da ein ,,starker" staatlicher Handlungsrahmen be-
12
10
Siehe hierzu auch Bühlmann et al. (2008).
11
Als weiche Kontrolle definiere ich einerseits die institutionelle Schaffung eines norma-
tiven Rahmen, in dem die Akteure handeln. Andererseits die Anerkennung dieses
durch die in diesem handelnden und nicht-handelnden Akteuren.
rücksichtigt wird. Dieser hat alle Rechte
12
aller Beteiligten
13
und Kontrollmechanis-
men in Form eines institutionell abgesicherten gegenseitiges checks and balances
zu umfassen, um die Basis für die effektive Beteiligung von Individuen zu stellen.
Je höher die Akzeptanz der von Akteuren geschaffenen Institutionen, desto effekti-
ver können individuelle Interessen und Ziele eingebracht und in kollektive Entschei-
dungen überführt werden. In meinem Verständnis ist ein ,,flexibler Rahmen" für Indi-
viduen i.S.v. Stoibers Demokratieverständnis nur über eine weiche Kontrolle und ein
institutionelles checks and balances i.S.v. Lauth möglich. So kann die Einbringung
und Berücksichtigung der Interessen aller Individuen gewährleistet werden.
2.2 Transformation
Vor dem Hintergrund, dass
,,[d]ie Transformation autoritärer und ,,totalitärer" politischer Systeme in pluralistische
Demokratien [...] im ausgehenden zwanzigsten Jahrhundert zu einem der beherr-
schenden Probleme auf der politischen Agenda vieler Länder in Osteuropa, Latein-
amerika, Asien und Afrika avanciert[e]" (Merkel 1994: 7).
hat sich ein umfangreiches begriffliches Instrumentarium der Transformationsfor-
schung entwickelt. Eine klare analytische Abgrenzung zwischen den Begriffen selbst
und den Phasen der Transformationsforschung ist somit zwingend notwendig.
Transformation steht in der Politikwissenschaft als Oberbegriff für alle Formen, Zeit-
strukturen und Aspekte des Systemwandels, der die Unterbegriffe Regimewandel,
Regimewechsel, Systemwandel, Systemwechsel und Transition involviert. Demzu-
folge sprechen wir von zeitgleichen Auftreten mehrerer interdependenter Prozesse,
im Rahmen derer alle gesellschaftlichen Teilsysteme eine radikale und umfassende
Veränderung erfahren (Merkel 1998).
2.2.1 Regimewandel und -wechsel
Regime sind formelle und informelle Organisationen des politischen Herrschaftszen-
trums, die den Zugang zur politischen Herrschaft, das Verhältnis zwischen den
Machteliten sowie zwischen Regierenden und Regierten regeln. Deren Dauerhaftig-
keit wird über den Grad der Institutionalisierung
14
bestimmt (O´Donnnell et al. 1986:
73). Fehlt unterdessen einer der beiden Regimedimension Akzeptanz und/oder Le-
gitimierung, kommt es zur Destabilisierung bzw. zum ,,Kippen"
15
des Regimes (Mer-
kel 2010: 64).
13
12
Sowohl die negativen Freiheiten als auch die ,,Bekämpfung" der positiven Freiheiten
müssen berücksichtigt werden.
13
Die Inklusion von politisch und nicht-politisch Beteiligten setze ich voraus.
14
Also inwieweit die Machtbeziehungen untereinander und zwischen Regierenden und
Regierten akzeptiert, praktiziert und normenleitend angenommen werden.
15
Davor sind auch demokratische Regime nicht gefeit.
Ein Regime kann dauerhafter sein als ein politisches System (siehe Kap. 2.2.2),
allerdings niemals von längerer Dauer als ein Staat. Ein Staat ist eine dauerhafte
Herrschaftsstruktur, deren politische Organisationsstruktur von den Normen, Prinzi-
pien und Verfahrensweisen der Regime bedingt, aber de facto nicht verändert wird.
Weder staatliche Organisationsstrukturen noch staatliche Funktionsträger werden
durch einen Regimewechsel eliminiert. Vielmehr bleiben die alten autoritären Struk-
turen
16
und politischen Machteliten zementiert.
Von einem Regimewandel kann gesprochen werden, wenn grundlegende Funktio-
nen und Herrschaftsstrukturen sich langsam gradual-evolutionär verändern (Sand-
schneider 1995: 39 f.). Während der Regimewechsel (s. u.) bei einer von unten er-
zwungenen Transformation oder einem Regime-Kollaps radikal, rapide und revoluti-
onär verläuft, unterliegt der Wandel von einem autoritären zu einem demokratischen
System, analog zur ersten Demokratisierungswelle
17
, einem langjährigen Prozess.
Unterdessen bleibt aber offen, ob und inwieweit dem Regimewandel ein Regime-
wechsel folgt. In Ungarn z. B. wurde 1956 ein Regimewandel eingeleitet, der Re-
formprozess aber vorzeitig mit militärischer Gewalt beendet, sodass kein Regime-
wechsel folgen konnte. Wo Militär und zivile Eliten Demokratisierungsprozesse lang-
jährig aushandeln, wie z. B. während der dritten Demokratisierungswelle
18
(1974-
1995) kommt es zum erfolgreichen Regimewandel.
Regimewechsel sind Übergänge von einem zum anderen Regime (Merkel 2010:
66). Während beim Regimewandel der Ausgang offen ist, muss sich beim Regime-
wechsel ,,der Herrschaftszugang, die Herrschaftsstruktur, der Herrschaftsanspruch
und die Herrschaftsweise eines Regimes grundsätzlich verändert haben" (ebenda).
Bei der Nicht-Erfüllung einer der genannten Prämissen, kommt es zu einem ,,un-
vollständigen" Regimewechsel, der den Weg in ,,defekte Demokratien"
19
bereitet.
2.2.2 Systemwandel und -wechsel
Im Gegensatz zu den Transformationsprozessen in Südeuropa und Lateinamerika,
bei denen ausschließlich die politische Sphäre erfasst wurde, sollte in Osteuropa
gleichzeitig ein politischer, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Wandlungsprozess
vollzogen werden. Dementsprechend greift hier der in der Transformationsforschung
umfassendere Begriff System besser, zumal neben der Erfassung von Regierung,
14
16
Diese können auch den neu aufbauenden demokratischen Systemen dienlich sein.
17
Zwischen 1828-1922/26 bildete sich das Wahlrecht und andere Partizipationsrechte
gradual heraus.
18
,,A wave of democratization is a group of transitions from nondemocratic to democratic
regimes that occur within a specified period of time and that significantly outnumber
transitions in the opposite direction during that periode of time (Huntington 1991: 15).
19
Siehe hierzu auch Merkel (2010: 37 f.) und Merkel et al. (2006).
Staat und Regime und deren Subsysteme bzw. Defekte, auch die Hinterfragung der
politischen Ordnung auf Legitimität und Stabilität möglich ist.
20
Analog zum Regimewandel und -wechsel werden die Begriffe Systemwandel und
-wechsel in der Transformationsforschung für einen offenen bzw. vollzogenen Pro-
zess verwendet (Sandschneider 1995: 39-42).
2.2.3 Transition
Der Begriff ,,Transition[s]" wurde durch das 1977 etablierte Lateinamerika Projekt
des Woodrow Wilsons International Center for Scholar in Washington D.C. geprägt.
Transition ist nach O´Donnell/Schmitter (1986: 7) ,,the interval between one political
regime and another." Es wird ein Wechsel von einem ,,sicheren" autoritären Regime
zu einem unsicheren Etwas vollzogen (ebenda: 3).
Der ungewisse Ausgang (Etwas) einer Transition ist bei O´Donnell/Schmitter signifi-
kant, zumal neben der Etablierung demokratischer Regime auch eine Rückkehr
zum alten bzw. zu einer neuen Form des alten autoritären Regimes möglich ist. Bei
der Transition, also der Übergang zur Demokratie, wird ausschließlich die politische
Sphäre erfasst. Die Transition gilt mit den ersten abgehaltenen Wahlen als abge-
schlossen und begünstigt erstens eine emanzipierte und freiheitsorientierende Bür-
gerkultur, zweitens eine weitreichende Humanentwicklung mit sozioökonomischer
Entwicklung, Selbstentfaltungswerte und demokratischen Institutionen sowie drit-
tens gemäßigte Oppositionsgruppen, die mit den softlinern des gestürzten Regimes
eine Koalition anstreben
21
.
Transitionshemmende Faktoren hingegen werden in verschiedenen wirtschaftlichen
und sozialen Schwächen und Misserfolgen gesehen bzw. in einer schwachen Zivil-
gesellschaft und einer unterentwickelten Staatlichkeit. Weiter gelten Konfliktlinien,
kulturelle Faktoren wie auch Fundamentalismus, ein nicht-säkularisiertes Staatswe-
sen, Entwicklungsbarrieren und die Einflüsse der Machtblöcke des internationalen
Systems als Transitionshemmnisse.
Mit der Transitions-to-democracy-Studie von O´Donnell et al. (1986) wird Transition
in den Phasen Liberalisierung, Demokratisierung und Konsolidierung eingeteilt (Bei-
chelt 2001: 17; Merkel 2010: 93 f.). Die Transitionsphasen folgen idealerweise chro-
nologisch, verlaufen aber in der Regel nicht synchron. Die Transition, also der
Wechsel eines politischen Systems, wird vollzogen, wenn Ausgangs- und Endpunkt
klar bestimmbar sind auf eine klar definierte Phase der unmittelbaren Etablierung
eines demokratischen politischen Systems. Dabei bilden die drei Transitionsphasen
15
20
David Easton (1965) unterscheidet zwischen diffuser und spezifischer Unterstützung.
21
Diese dürfen weder vom Militär noch von den Schlüsselgruppen als bedrohlich ange-
sehen werden (Huntington 2002).
die Entwicklungsstufen des Überganges von einem gesellschaftlichen Systemtyp zu
einem anderen.
Liberalisierung wird nach O´Donnell et al. (1986: 7) als ,,[t]he process of redefining
and extending rights" bezeichnet. Die Phase der Liberalisierung manifestiert den
Beginn der Transition und stellt den Auflösungsprozess alter (vorwiegend) autoritä-
rer Strukturen dar. Mit dem Entzug staatlicher Legitimation wird der ,,stabile" politi-
sche Zustand eines Regimes in einen ,,schwammigen" politischen Zustand trans-
formiert. Dieser ist gekennzeichnet durch fehlende Normen- und Handlungs(an)lei-
tende Institutionen. Den politischen und gesellschaftlichen Akteuren öffnet sich ein
weiter Handlungsraum, der ihre Interessen unkanalisiert in den politischen Prozess
einfließen lässt.
In der Folge ist eine Fragmentierung politischer und gesellschaftlicher Interessen
sowie eine sich herausbildende gegensätzliche Interessenlage, in puncto der Aus-
richtung des politischen Systems, zu beobachten. Dahingegen kann die Balance
zwischen den Mächtigen (Eliten)
22
und dem Gemeinwesen (Legitimationsträger)
23
einerseits die Herausbildung von Vetospielern
24
minimieren und andererseits den
Weg in Richtung Demokratisierung ebnen, wo die Vereinbarungen der Akteure ver-
bindlich institutionalisiert werden. Die hardliner und softliner des alten autoritären
Regimes und die neuen politischen und gesellschaftlichen Akteure entscheiden de-
mentsprechend mit ihrem Handeln und Wirken, ob Demokratie eine Chance hat.
Demokratisierung steht für die Etablierung demokratischer Institutionen wie Parla-
ment, Judikative, Regierung, Parteien und Wahlen, die von allen anerkannt werden
müssen und sowohl für Regierende als auch Regierte gleichermaßen gelten. Das
Moment des freien Agierens und die unkanalisierte Interesseneinbringung alter und
neuer politischer und gesellschaftlicher Akteure wird mit der Etablierung einer Nor-
men vorgebenden Institutionenordnung wieder eingeengt (ebenda: 4).
Mit der Beendung des unkoordinierten Zustandes zwischen der Auflösung alter au-
toritärer Strukturen und der Etablierung neuer demokratischer Strukturen wird Politik
wieder berechenbar. Jedoch kann die Institutionalisierung der Demokratie noch
scheitern, wenn der Legitimitätszuspruch aus der Bevölkerung ausbleibt und/oder
Partikularinteressen über Allgemeininteressen stehen. Die Demokratisierungsphase
endet mit der Verabschiedung einer Verfassung (Merkel 2010) und mündet in die
Konsolidierungsphase, auf die ich im folgenden Kapitel eingehe.
16
22
Siehe Kapitel 7.2.1.
23
Siehe Kapitel 7.1.1-7.1.2.
24
Siehe hierzu die Vetospieler-Theorie von Tsebelis (1995).
3 Theorie I: ,,Mehrebenenmodell der demokratischen Konsolidie-
rung"
In der Politikwissenschaft steht demokratische Konsolidierung unstrittig für Stabilität,
Sicherheit und Festigung einer institutionell abgesicherten Herrschaftsordnung.
Zahlreiche Konsolidierungskonzepte fußen dabei auf die semantische Begrifflichkeit
von Herrschaft, Volk und Festigung bzw. auf Dankwart Rustows Schrift ,,Transitions
to Democracy" (Waldrauch 1996: 7 f.). Trotzdem herrscht in der Politikwissenschaft
ein Dissens über den Begriff ,,Konsolidierung" selbst, als auch über die Fragen,
wann Konsolidierung beginnt bzw. erfolgreich abgeschlossen ist, welche Akteure zur
Stabilisierung eines politischen Systems notwendig sind (Beichelt 2001: 23; Merkel:
2010: 546) und welches Zeitmaß angelegt bzw. Pfade am schnellsten zur Konsoli-
dierung führen. Dieses Kapitel hat zum Ziel, den aufgeworfenen Fragen nachzuge-
hen und mit Merkels theoretischem Konzept ,,Mehrebenenmodell der demokrati-
schen Konsolidierung" die Indikatoren für eine erfolgreiche demokratische Konsoli-
dierung zu bestimmen, um im empirischen Teil der vorliegenden Arbeit (Kap. 6) die
Fallbeispiele auf Konsolidierungsdefekte zu untersuchen.
3.1 Konsolidierung
Nach Beichelt (2001: 23) ,,bedeutet Konsolidierung zunächst Festigung oder Siche-
rung einer Herrschaftsordnung, die über bestimmte institutionelle Rahmensetzun-
gen eine Rückbindung der staatlichen Herrschaft an den demos [sic!] gewährleis-
tet." Konsolidierung bildet nach den Phasen der Liberalisierung und Demokratisie-
rung die letzte, schwierigste und langwierigste Phase eines Überganges von einem
autokratischen zu einem demokratischen System (Bos 1994: 86). Dabei folgt Kon-
solidierung idealerweise nach der Beendigung der Demokratisierung.
25
Auch Hun-
tington (1991: 35) hebt die Konsolidierung demokratischer Strukturen nach dem En-
de autoritärer Regime und der Etablierung demokratischer Strukturen als abschlie-
ßende Stufe des Demokratisierungsprozesses hervor.
Der Beginn demokratischer Konsolidierung wird in der Transformationsforschung
auf der einen Seite mit den Gründungswahlen (founding elections) (O`Donnell et al.
1986, Valenzuela 1992) angegeben und auf der anderen Seite mit der Etablierung
einer von einer verfassungsgebenden Versammlung ausgearbeiteten Verfassung
(Merkel 2010) festgelegt. Nach Merkel (ebenda: 110) gibt eine Verfassung und de-
ren gesetzte Normen die Richtung des politischen Weges eines Staates vor. Der
,,schwammige" Zustand des Transformationsprozesses wird in einen ,,stabilen" Zu-
stand überführt, indem die relevanten politischen Akteure benannt und die neu etab-
lierten Institutionen auf vereinbarte demokratische Normen festgelegt werden.
17
25
Bei Bos wird hier auch von einer ,,Übergangsdemokratie" gesprochen (1994: 86).
Dahingegen ist Normenstabilität respektive innere institutionelle Stabilität nur über
Akteure möglich, die ihr Verhalten und ihre Entscheidungen den institutionell abge-
sicherten demokratischen Normen unterwerfen bzw. sich dem ,,ungewissen Zu-
sammenspiel demokratischer Institutionen aus[...]setzen" (Bos 1994: 86). Nur so
wird ein Wechsel von einem Handeln ,,im Nichts" zu einem für alle Akteure bere-
chenbaren Handeln innerhalb eines stabilen Institutionssystems möglich (Beichelt
2001: 17). Im Ergebnis wird das Verhalten der relevanten politischen Akteure durch
das Normengerüst eines herausbildenden institutionalisierten Handlungsrahmen
determiniert, was per se zu einer dauerhaften Stabilisierung des innerinstitutionellen
Systems und damit zur demokratischen Konsolidierung führt (Prezeworski 1991:
26). Demnach kann von demokratischer Konsolidierung erst gesprochen werden,
wenn alle relevanten politischen Akteure demokratische Institutionen als ,,the only
game in town" akzeptieren (ebenda).
Derweilen betonen zahlreiche akteurszentrierte Forschungsansätze
26
insbesondere
die stabilisierend Wirkung der Staatsbürger auf den Konsolidierungsprozess. Nach
Diamond (2010) ist ein Zusammenbrechen der Demokratie um so unwahrscheinli-
cher, je tiefer und breiter die Legitimität der Demokratie bei den Bürgern verankert
ist.
Vor diesem Hintergrund wird in der Transformationsforschung zwischen minimalisti-
sche (Di Palma 1990: 138 f.; Prezeworski 1991: 26) und maximalistische Konsoli-
dierungskonzepte (Pridham 1995; Gunther et al. 1995; Merkel 1998) differenziert.
27
Erstere argumentieren sowohl handlungstheoretisch als auch elitenzentriert, sodass
nur von Konsolidierung gesprochen werden kann, ,,wenn kein relevanter politischer
oder sozialer Akteur außerhalb der demokratischen Institutionen seine Interessen
und Ziele verfolgt, weil zu diesem Zeitpunkt keine attraktive Systemalternative zur
Demokratie existiert." (Merkel 2010: 110) Letztere folgen hingegen systemtheoreti-
schen Prinzipien, indem neben der intermediären Ebene auch die der Staatsbürger
bzw. deren Einstellung zur Demokratie betrachtet werden (Beichelt 2001: 25). Nach
Merkel (2007: 416) müssen die Bürger das politische System einstweilen als legitim
und alternativlos anerkennen und mit einen über Jahre erworbenes ,,Einstellungs-,
Werte- und Verhaltensmuster" stabilisieren. In diesem Verständnis entwickelte Mer-
kel das ,,Mehrebenenmodell der demokratischen Konsolidierung", auf das ich im fol-
genden Abschnitt näher eingehen werde.
3.2 Merkels ,,Vier-Ebenen-Modell"
Merkels theoretische Konzept differenziert zwischen vier analytischen Ebenen der
Konsolidierung. Neben der institutionellen und der intermediär-repräsentativen Ebe-
18
26
Siehe hierzu ausführlich Easton (1965) und Almond/Verba (1963).
27
Analog zu Geoffrey Pridhams ,,negativer" und ,,positiver" Konsolidierung (1995: 168).
ne, werden zusätzlich die Ebenen der Verhaltenskonsolidierung informeller Akteure
und die der Staatsbürgerkultur betrachtet. Der äußere Rahmen (Umwelt) des Mo-
dells wird durch einen regionalen Kontext
28
, gesellschaftliche Konflikte
29
, internatio-
nale Unterstützung
30
und einen wirtschaftlichen Kontext
31
bestimmt (siehe Abbildung
1). Die dem Modell zu Grunde liegenden vier Ebenen folgen idealerweise in chrono-
logischer Reihenfolge, wobei die erste Ebene zuerst und die vierte Ebene zuletzt
demokratisch konsolidiert ist. Diese Trennschärfe ist aber in aller Regel nicht zu be-
obachten, vielmehr werden nachfolgende Ebenen früher bzw. gleichzeitig konsoli-
diert. Dessen ungeachtet ist die Legitimität und Stabilität eines politischen Systems
sowohl von der Dauer des Konsolidierungsprozesses bzw. wie viele Ebenen konso-
lidiert wurden, als auch vom Wirken der Eliten und den Staatsbürgern während der
vier Ebenen des Konsolidierungsprozesses abhängig.
3.2.1 Einfluss von Eliten und Staatsbürgern auf die Konsolidierung
Für Schubert/Klein (2011) stellt Eliten ein ,,(p)olitisch-soziologischer Begriff für einen
besonders hervorgehobenen Teil einer Bevölkerung, einer Organisation, eines sozi-
alen Systems" dar. In der vorliegenden Arbeit steht das Handeln und Wirken der
Machteliten im Fokus. Machteliten werden über ihr Durchsetzungsvermögen ge-
genüber anderen Mitglieder einer Gemeinschaft definiert und werden in der Folge in
der vorliegenden Analyse mit ,,Eliten" benannt.
Im Gegensatz zu den ersten drei Ebenen des Konsolidierungsprozesses, die explizit
vom Handeln der Eliten bestimmt werden (siehe Abbildung 1), stabilisieren die
Staatsbürger durch ihren Legitimitätszuspruch auf der vierten Ebene die demokrati-
sche Konsolidierung. Auf der ersten Ebene (Makroebene) etablieren Eliten hand-
lungseingrenzende und strukturierende Institutionen, die sich unmittelbar auf den
Konsolidierungserfolg der nachfolgenden Ebenen auswirken. Die Konstellationen
und Handlungen der Eliten auf der zweiten Ebene (Mesoebene), also im Rahmen
von herausbildenden Parteien und Interessenverbände, beeinflussen genauso die
Konsolidierungschancen der nachfolgenden Ebenen, wie rückwirkend die Konsoli-
dierungschancen der ersten Ebene.
Mit der Konsolidierung der ersten beiden Ebenen wird die Gefahr der Herausbildung
von Vetomächten minimiert, die zur Verfolgung von Eigeninteressen demokratische
Normen unterwandern. Die Konsolidierung der dritten Ebene, die der informellen
Akteure und deren Akzeptanz gegenüber staatlich verfasster Institutionen, entschei-
det gleichzeitig über die Erfolgschancen der ersten Ebene und in Verbindung mit der
zweiten Ebene, ob und inwieweit die vierte Ebene (Mikroebene), die der Staatsbür-
19
28
Einfluss der Nachbarstaaten.
29
Ethnisch-linguistisch, Ungleichheit, Armut und Gewaltpotenzial.
30
In politischer, wirtschaftlicher und militärischer Beziehung.
31
Aufbau einer internationalen und nationalen Wirtschaftsstruktur.
ger, eine stabile ,,Legitimationsbasis" für die erste im Besonderen und für die ande-
ren Ebenen im Allgemeinen aufbaut.
Abbildung 1: ,,Mehrebenenmodell der demokratischen Konsolidierung"
Quelle: Merkel (2010: 111)
Nach Merkel (2007a: 417) basiert eine erfolgreiche demokratische Konsolidierung
auf dem Legitimitätszuspruch der Bürger, der per se eine ,,immunisierende Wirkung"
gegenüber exogenen und endogenen Krisen ausübt. Die gut ausgebildete aber
chancenlose Jugend, ,,die Freiheit und Demokratie, ein Ende der Willkürherrschaft
20
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2014
- ISBN (eBook)
- 9783956363665
- ISBN (Paperback)
- 9783956367106
- Dateigröße
- 1.3 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- FernUniversität Hagen
- Erscheinungsdatum
- 2014 (Oktober)
- Note
- 1,6
- Schlagworte
- "Arabischer Frühling" Konsolidierungsstand in der MENA-Region Demokratie Transformation Konsolidierung Akteurs- und Kulturtheoretische Ansätze Vergleichende Politikwissenschaft Arabischer Frühling Revolution Macht des Volkes Protest
- Produktsicherheit
- Diplom.de