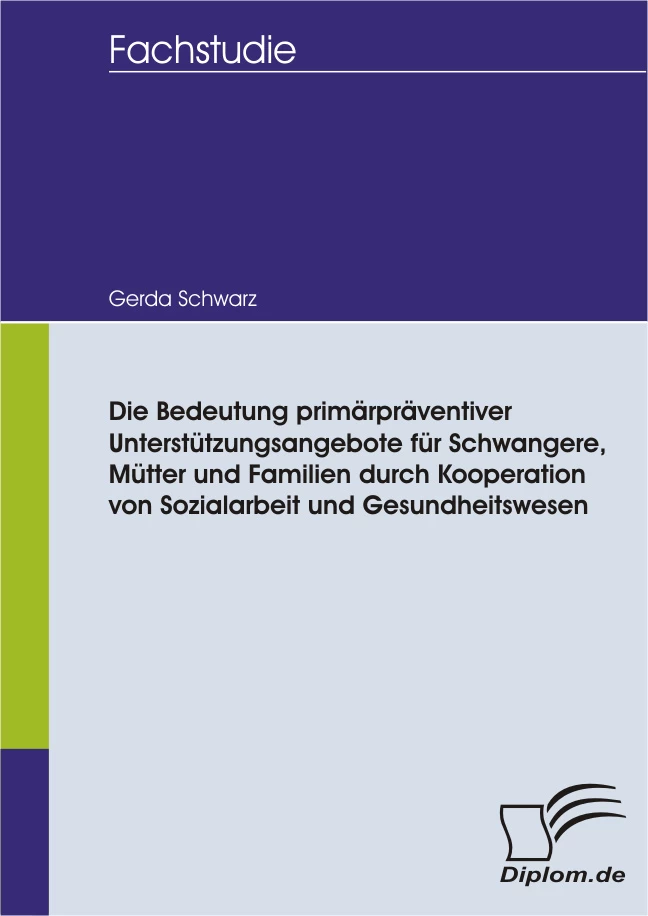Die Bedeutung primärpräventiver Unterstützungsangebote für Schwangere, Mütter und Familien durch Kooperation von Sozialarbeit und Gesundheitswesen
Zusammenfassung
Die Vernachlässigung von Kindern und das damit verbundene Interesse an einem verbesserten Kinderschutz sind in den letzten Jahren vermehrt in das öffentliche Bewusstsein gerückt. Die in den Medien aufgegriffenen tragischen Verwahrlosungs- und Todesfälle, die durch reißerische Aufbereitung für Schlagzeilen sorgen, stellen allerdings nur die Spitze des Eisbergs dar und lassen aufgrund einer vermuteten hohen Dunkelziffer die Tragweite dieses gesellschaftlichen Problems erkennen. (vgl. Tarneden 2003, S. 1) Besonderes Interesse gilt der Verbesserung des Schutzes von Säuglingen und Kleinkindern, da diese aufgrund ihrer Bedürftigkeit und Hilflosigkeit besonders für Vernachlässigung und Misshandlung gefährdet sind. Kinder unter drei Jahren stellen für die Jugendwohlfahrt einen blinden Fleck dar, weil sie meist ausschließlich innerfamiliär betreut werden und dadurch weniger mit anderen Erwachsenen oder Organisationen in Kontakt kommen. Deshalb scheinen die meisten Fälle von Vernachlässigung oder Misshandlung erst dann auf, wenn Kinder in Einrichtungen wie Kindergärten oder Schulen regelmäßig außerhalb ihrer Familie beaufsichtigt werden. (vgl. Hensen/Rietmann 2008, S. 36)
Präventive Maßnahmen und frühzeitige Interventionen versprechen den größten Erfolg für den Entwicklungsverlauf in der frühen Kindheit, in eben diesem Zeitraum, in dem ein Kind den größten Risiken ausgesetzt sein kann. Flächendeckende Unterstützungsangebote, die während der Schwangerschaft oder ab dem Zeitpunkt der Geburt einsetzen, hätten das Potenzial Vernachlässigung und Misshandlung von Kindern zu reduzieren. Eine gute Vernetzung zwischen den Systemen des Gesundheitswesens und der Sozialarbeit könnte dazu beitragen ehest möglich hilfsbedürftige, armutsbelastete oder sozial benachteiligte Kinder und Familien zu identifizieren ohne sie zu stigmatisieren.
Ohne ausreichende Hilfe von außen führt Überforderung oft zu Vernachlässigung und / oder Gewalt. Kindliche Entwicklung orientiert sich nicht an institutionellen Grenzen, sie verläuft als Gesamtprozess, der deshalb eine funktionierende Vernetzung aus den unterschiedlichsten Disziplinen zwingend erforderlich macht. Vorrangiges Ziel sollte sein, so rasch als möglich, unbürokratisch und passgenau Hilfen anbieten zu können um umgehend Druck aus einer prekären Situation nehmen zu können. (vgl. Sann/Schäfer 2008, S. 108f.) Da Eltern quer durch alle sozialen Schichten in der Erziehung ihrer Kinder zunehmend […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Persönlicher Zugang zur Thematik
1.2 Forschungsziel und Forschungsfragen
2 Frühe Hilfen
2.1 Begriffsbestimmung
2.2 Mögliche Ursachen für die Zunahme von Beratungs- und Betreuungsbedarf
2.2.1 Gesteigerte Beratungs- und Informationsbedürfnisse von Schwangeren, Müttern / Eltern von Säuglingen und Kleinkindern
2.3 Frühe Hilfen: Hilfen unterhalb von Erziehungshilfen
2.4 Zentrale Elemente eines sozialen Frühwarnsystems
2.5 Notwendigkeit Früher Hilfen
2.6 Zielgruppe Früher Hilfen
2.7 Zugang zur Zielgruppe finden
2.7.1 Aufsuchende Sozialarbeit - ein Plädoyer für den Hausbesuch
2.7.2 Freiwilligkeit versus verordnete Dienste
2.8 Familien gerecht werden
2.9 Geeignete Methoden und Fertigkeiten im Kontext „Früher Hilfen“
3 Aufgaben und Funktion der Familie aus soziologischer und psychologischer Perspektive
3.1 Was eine Familie ausmacht – ein Definitionsversuch
3.2 Familie im Wandel der Zeit
3.3 Familie als Risiko oder Ressource
3.4 Sozialisationsphasen
3.4.1 Primärsozialisation
3.4.2 Sekundär- und Tertiärsozialisation
3.5 Sozialisationstheorien innerhalb der Familie
3.5.1 Sozialpsychologische Modelle
3.5.2 Psychoanalytische Dimension
3.5.3 Sozialökologische Theorien
3.5.4 Schichtenspezifische Sozialisation
4 Das Verständnis von Gesundheit und Prävention
4.1 Stellenwert der Prävention in Österreich
4.2 Prävention in der Sozialarbeit
4.3 Präventionsstufen nach Caplan
4.4 Präventionstypen nach Munoz, Mrazek & Haggerty
5 Kindliche Entwicklung zwischen Risiko und Resilienz
5.1 Risikofaktoren
5.1.1 Kindeswohlgefährdung durch Vernachlässigung und Misshandlung
5.2 Erscheinungsformen von Vernachlässigung und Misshandlung
5.3 Risikofaktorenmodelle
5.4 Salutogenesemodell nach Antonovsky
5.5 Grundlagen der Resilienzforschung
5.5.1 Protektive Faktoren
5.5.2 Bindungsqualität als bedeutender Resilienzfaktor
6 Bindungstheorie als handlungsleitende Theorie
6.1 Grundlagen der Bindungstheorie
6.2 Bindungsformen
6.2.1 Sichere Bindung
6.2.2 Unsicher – vermeidende Bindung
6.2.3 Unsicher – ambivalente Bindung
6.2.4 Unsicher – desorientierte Bindung
6.3 Bindungsphasen und -qualität aus Sicht der Bindungstheorie und Entwicklungspsychologie
6.4 Bindungsqualität
6.5 Potential Früher Hilfen im Kontext der Bindungstheorie
6.5.1 Weitergabe von Bindungsqualität
7 Kooperation von Gesundheitswesen und Sozialarbeit
7.1 Nahverhältnis von gesundheitlichen und sozialen Problemen
7.2 Zielsetzung der Erhebung
7.3 Auswahl der Forschungsmethode
7.4 Auswahl der Interviewpartner/innen
7.5 Durchführung der Befragung
7.6 Rahmenbedingungen gelingender Kooperation
7.6.1 Rechtliche Rahmenbedingungen
7.6.2 Finanzierung
7.7 Erfahrungen mit interdisziplinärer Kooperation
7.8 Involvierte Berufsgruppen
7.9 Schnittstellen
7.10 Gewünschte Formen der Zusammenarbeit
7.11 Wirkfaktoren gelingender Kooperation
7.11.1 Gemeinsame Ziele und Aufgaben
7.11.2 Kooperationsvereinbarungen
7.11.3 Kommunikation
7.11.4 Koordination aus einer Hand
7.11.5 Wirkfaktor persönliche Beziehungen
7.12 Nutzen für die einzelnen Gruppen
7.13 Grenzen interdisziplinärer Kooperation
7.14 Chancen und Potential Früher Hilfen in Oberösterreich
8 Quantitative empirische Erhebung (Elternbefragung)
8.1 Problemstellung und Zielsetzung der Befragung
8.2 Zentrale Fragestellungen
8.3 Auswahl der Forschungsmethode
8.3.1 Gruppendiskussion
8.3.2 Fragebogen
8.4 Auswahl der Stichprobe
8.5 Durchführung der Befragung
8.6 Auswertung und Darstellung der erhobenen Daten
8.6.1 Demografische Daten
8.6.2 Schwangerschaft und Geburt
8.6.3 Veränderungen durch die Geburt des Kindes
8.6.4 Die ersten Lebensjahre mit dem Kind
8.6.5 Ansprechpartner/innen für Mütter und Eltern
8.6.6 Gewünschte Beratungsinhalte und Formen
9 Fazit und Ausblick
10 Quellenverzeichnis
11 Verzeichnisse
11.1 Abbildungsverzeichnis
11.2 Tabellenverzeichnis
12 Anhang
1 Einleitung
Die Vernachlässigung von Kindern und das damit verbundene Interesse an einem verbesserten Kinderschutz sind in den letzten Jahren vermehrt in das öffentliche Bewusstsein gerückt. Die in den Medien aufgegriffenen tragischen Verwahrlosungs- und Todesfälle, die durch reißerische Aufbereitung für Schlagzeilen sorgen, stellen allerdings nur die Spitze des Eisbergs dar und lassen aufgrund einer vermuteten hohen Dunkelziffer die Tragweite dieses gesellschaftlichen Problems erkennen. (vgl. Tarneden 2003, S. 1) Besonderes Interesse gilt der Verbesserung des Schutzes von Säuglingen und Kleinkindern, da diese aufgrund ihrer Bedürftigkeit und Hilflosigkeit besonders für Vernachlässigung und Misshandlung gefährdet sind. Kinder unter drei Jahren stellen für die Jugendwohlfahrt einen „blinden Fleck“ dar, weil sie meist ausschließlich innerfamiliär betreut werden und dadurch weniger mit anderen Erwachsenen oder Organisationen in Kontakt kommen. Deshalb scheinen die meisten Fälle von Vernachlässigung oder Misshandlung erst dann auf, wenn Kinder in Einrichtungen wie Kindergärten oder Schulen regelmäßig außerhalb ihrer Familie beaufsichtigt werden. (vgl. Hensen/Rietmann 2008, S. 36)
Präventive Maßnahmen und frühzeitige Interventionen versprechen den größten Erfolg für den Entwicklungsverlauf in der frühen Kindheit, in eben diesem Zeitraum, in dem ein Kind den größten Risiken ausgesetzt sein kann. Flächendeckende Unterstützungsangebote, die während der Schwangerschaft oder ab dem Zeitpunkt der Geburt einsetzen, hätten das Potenzial Vernachlässigung und Misshandlung von Kindern zu reduzieren. Eine gute Vernetzung zwischen den Systemen des Gesundheitswesens und der Sozialarbeit könnte dazu beitragen ehest möglich hilfsbedürftige, armutsbelastete oder sozial benachteiligte Kinder und Familien zu identifizieren ohne sie zu stigmatisieren.
Ohne ausreichende Hilfe von außen führt Überforderung oft zu Vernachlässigung und / oder Gewalt. Kindliche Entwicklung orientiert sich nicht an institutionellen Grenzen, sie verläuft als Gesamtprozess, der deshalb eine funktionierende Vernetzung aus den unterschiedlichsten Disziplinen zwingend erforderlich macht. Vorrangiges Ziel sollte sein, so rasch als möglich, unbürokratisch und passgenau Hilfen anbieten zu können um umgehend Druck aus einer prekären Situation nehmen zu können. (vgl. Sann/Schäfer 2008, S. 108f.) Da Eltern quer durch alle sozialen Schichten in der Erziehung ihrer Kinder zunehmend verunsichert sind, eignen sich niederschwellige und aufsuchende Angebote besonders, da sie Familien in ihrer Lebenswelt eingebettet wahrnehmen und so passgenaue Hilfen anbieten können, die in ihrer Lebenssituation ansetzen. Frühe Hilfen sind präventive und universelle Unterstützungsangebote, die unterhalb der Erziehungshilfen anzusiedeln sind. Eine der Kernaufgaben Früher Hilfen, liegt in der Stärkung elterlicher Erziehungskompetenzen, die als wesentlicher Faktor zur Reduzierung des Risikos einer Kindeswohlgefährdung zu bewerten ist und deshalb wesentlich zu einem verbesserten Kinderschutz beiträgt.
In Österreich gibt es ein sehr breites, flächendeckend ausgebautes Präventionsangebot, vorwiegend angesiedelt im medizinischen Kontext, das von sehr vielen Schwangeren, Müttern und Eltern in Anspruch genommen wird. Geburtsvorbereitungskurse, Stillberatung, die vor- und nachgeburtliche Betreuung durch Hebammen oder die Eltern-Mutterberatung sind nur einige der Angebote, die gut angenommen werden. Dennoch ist festzuhalten, dass die Inanspruchnahme vieler Angebote, beispielsweise die kostenlosen Vorsorgeuntersuchungen verankert im Mutter-Kind-Pass, seit einigen Jahren im Abnehmen begriffen sind. Bei allen freiwilligen Angeboten basierend auf einer „Komm-Struktur“ kann davon ausgegangen werden, dass diese vor allem von Familien in schwierigen sozialen Lebenslagen und niedrigen sozialen Schichten wenig genutzt werden. (vgl. Baum 2006, S. 238 ff. und S. 336f.)
Zudem kommt hinzu, dass die meisten Mitarbeiter/innen von Einrichtungen des Gesundheitswesens oft nur sehr wenig über Unterstützungs- und Interventionsmöglichkeiten der Sozialarbeit Bescheid wissen und deshalb auch nur in konkreten Verdachtsfällen von Vernachlässigung, Verwahrlosung oder Misshandlung mit Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern in Kontakt treten. Es ist deshalb anzunehmen, dass vor allem bei Vernachlässigung oder Misshandlung von Säuglingen und Kleinkindern eine oder mehrere Institutionen bereits etwas geahnt oder vermutet haben, allerdings aufgrund fehlender interdisziplinärer Vernetzung Informationen nicht ausgetauscht werden. Mit einem gut funktionierenden System Früher Hilfen sollte es gelingen, die vorhandenen Lücken im Versorgungssystem für Schwangere, Mütter und Väter von Säuglingen und Kleinkindern zu schließen. Eltern sollten bei der Wahrnehmung und Bewältigung ihrer Erziehungsaufgaben unterstützen und ihnen Sicherheit im Umgang mit ihren Kindern vermittelt werden.
1.1 Persönlicher Zugang zur Thematik
Mein Interesse an diesem Thema entwickelte sich während meiner langjährigen Tätigkeit als Babymassagetrainerin und Mitarbeit in einem Eltern – Kind – Zentrum. Die Fragen und Anliegen der Mütter und Väter, die mit ihren Babys meine Kurse besuchten, gingen vielfach über die eigentlichen Kursinhalte hinaus, und ich musste feststellen, dass meine bisherigen Ausbildungen nicht ausreichten um den Teilnehmerinnen und Teilnehmern kompetente Auskünfte erteilen zu können bzw. dass diese meinen Kompetenzbereich überstiegen. Oft genügte es jedoch, den jungen Mütter und Eltern einfach nur zuzuhören, Verständnis für ihre Situation aufzubringen und sie in ihren elterlichen Kompetenzen und ihrer Intuition zu stärken.
Die Förderung und Unterstützung von Müttern und Vätern gelangte immer mehr in den Fokus meines Interesses und ich beschloss darauf hin das Studium der Sozialarbeit zu beginnen. Im Rahmen meines Studiums und meiner Praktika richtete sich meine Aufmerksamkeit vermehrt auf die Chancen und Möglichkeiten von Präventionsarbeit mit Familien. Aufgrund sehr aufschlussreicher Publikationen und Evaluationen von Projekten Früher Hilfen und der steigenden Aufmerksamkeit von fachlicher als auch von öffentlicher Seite hinsichtlich eines verbesserten Kinderschutzes, entschied ich, mich im Rahmen meiner Diplomarbeit mit dieser Problematik noch eingehender auseinander zu setzen.
Kein Kind soll verloren gehen.
1.2 Forschungsziel und Forschungsfragen
Die vorliegende Arbeit beleuchtet das komplexe Zusammenspiel unterschiedlicher Professionen in einem immer mehr ausdifferenzierten System von Hilfen und Unterstützungsangeboten für Familien mit Säuglingen und Kleinkindern. Die unbedingt notwendige Vernetzung zwischen Gesundheitssystem und Sozialarbeit zu einem verbesserten Kinderschutz wird ebenso erörtert, wie die Bedeutsamkeit von Präventionsangeboten im diesem Kontext.
Ziele der vorliegenden Diplomarbeit sind, die Vorteile präventiver Modelle interdisziplinärer Zusammenarbeit aufzuzeigen und dadurch die Notwendigkeit der Kooperation aller Institutionen und Einrichtungen zu unterstreichen, die zur Unterstützung von Schwangeren, Müttern und Eltern von Säuglingen und Kleinkindern bis drei Jahren beitragen. Es gilt Stärken und Schwächen des derzeit bestehenden Beratungsangebots, deren Nutzung zu ermitteln und mit den Wünschen und Bedürfnissen von jungen Familien abzugleichen. Die Kombination von qualitativen und quantitativen Methoden erschien zur Erfassung dieses komplexen Themengebietes am besten geeignet. Die Arbeit stützt sich auf folgende zentrale Forschungsfragen, die anhand einer theoretischen Auseinandersetzung mit Fachliteratur und den Forschungsergebnissen diskutiert werden.
- Worin liegen die Chancen und Grenzen interdisziplinärer Zusammenarbeit von Gesundheitswesen und Sozialarbeit?
- Welche Bedürfnisse und Probleme haben schwangere Frauen, Mütter und Familien mit Säuglingen und Kleinkindern?
- Mit welchen Angeboten wird auf diese Bedürfnisse eingegangen?
- Welche Unterstützung wünschen sich Eltern für eine gelingende
Eltern – Kind – Beziehung?
Der Theorieteil widmet sich zunächst der begrifflichen Definition Früher Hilfen, den zentralen Elementen eines sozialen Frühwarnsystems sowie der Zielgruppe Früher Hilfen. Die Beschreibung geeigneter Methoden und Fertigkeiten, die es ermöglichen Familien mit ihren individuellen Problemlagen und Bedürfnissen gerecht zu werden sind ebenfalls Teil des ersten Kapitels. Um die Aktualität und Dringlichkeit des Ausbaus eines funktionierenden Netzes Früher Hilfen zu unterstreichen. Einige relevante Fakten zu Vernachlässigung und Misshandlung werden dargestellt und der im Steigen begriffene Bedarf an Beratung und Betreuung näher erörtert.
Im zweiten Kapitel werden Aufgaben und Funktion der Familie aus soziologischer und psychologischer Perspektive genauer dargestellt, ferner Sozialisationsphasen und Sozialisationstheorien beleuchtet.
Im dritten Kapitel erfolgt eine Auseinandersetzung mit dem Gesundheits- und Präventionsbegriff. Der Stellenwert von präventiven Maßnahmen wird ebenso beschrieben wie die Unterscheidungsmöglichkeiten nach Präventionsstufen und
-typen.
Das vierte Kapitel widmet sich den Grundlagen der Risiko- und Resilienzforschung. Das Salutogenesemodell nach Antonovsky, welches einen bedeutenden Einfluss auf die Entwicklung von Resilienzkonzepten hat, wird ebenso präsentiert, wie Risikofaktorenmodelle. Die Erscheinungsformen von Vernachlässigung und Misshandlung werden abschließend kurz ausgeführt.
Die Notwendigkeit einer gemeinsamen Sprache wird im sechsten Kapitel dieser Arbeit erörtert. Der Bindungstheorie nach Bowlby wird im Kontext Früher Hilfen und sozialer Frühwarnsysteme besondere Bedeutung zuteil, da sich diese aufgrund ihrer Anerkennung im medizinischen, psychologischen und pädagogischen Kontext als gemeinsame Sprache der interdisziplinären Zusammenarbeit besonders eignet.
Im siebten Kapitel liegt der Fokus auf der Identifizierung von Wirkfaktoren und Rahmenbedingungen gelingender Kooperation, den möglichen Grenzen und Chancen der interdisziplinären Zusammenarbeit und dem Nutzen für die beteiligten Gruppen. Diese werden anhand der Ergebnisse der empirischen Befragung von Expertinnen und Experten aus dem Gesundheitswesen und der Sozialarbeit identifiziert und mit Erkenntnissen aus der theoretischen Auseinandersetzung hinsichtlich ihrer Relevanz für den Raum Oberösterreich überprüft.
Die Erforschung der Bedürfnisse, Wünsche und Problemlagen von Schwangeren, Müttern und Eltern von Säuglingen und Kleinkindern von stehen im Mittelpunkt der quantitativen Erhebung, die anonym mit Fragebögen durchgeführt wurde und deren Ergebnisse im achten Kapitel dieser Arbeit dargestellt werden. Zunächst wird auf die Forschungsmethode, die Auswahl der Stichprobe und die Zielsetzung der Erhebung eingegangen. Die Darstellung und Interpretation der Forschungsergebnisse stellen den Schwerpunkt dieses Kapitels dar.
Daran anknüpfend werden die gewonnenen theoretischen und empirischen Erkenntnisse in Bezug auf die entwickelten Forschungsfragen, Arbeitsannahmen und zentralen Fragestellungen im letzten Kapitel dieser Arbeit dargestellt und mögliche Chancen und Perspektiven für ein gelingendes Netzwerk Früher Hilfen in Oberösterreich angeregt.
2 Frühe Hilfen
Kinder aus sozial benachteiligten Familien entwickeln sich überdurchschnittlich häufig auch zu Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten, gesundheitlichen Beeinträchtigungen, oder Schulproblemen. Obwohl Forschungsergebnisse belegen, dass Erkrankungen und Verhaltensprobleme, aber auch delinquentes Verhalten im Erwachsenenalter ihren Ursprung in der frühen Kindheit haben erfolgen Interventionen in der Regel erst dann wenn Auffälligkeiten und Probleme unübersehbar und untragbar werden. (vgl. Bowlby 2005, S. 76ff.)
Allerdings nehmen Studien zufolge Eltern gerne Beratungsangebote an, wenn sie sich in ihrer Rolle unsicher fühlen. Das Informationsbedürfnis von Müttern / Eltern ist vor allem während der Schwangerschaft und den ersten drei Lebensjahren des Kindes besonders hoch, weshalb dies als ein günstiger Einstiegszeitraum für Unterstützungsangebote gesehen wird. (vgl. Peveling 2009, S. 5) Warum der Beratungsbedarf generell und speziell bei Schwangeren und Müttern / Eltern von Säuglingen und Kleinkindern im Steigen begriffen ist wird im Anschluss an das Kapitel „Begriffsbestimmung Früher Hilfen“ beleuchtet.
2.1 Begriffsbestimmung
Der Begriff „Frühe Hilfen“ bildet den Rahmen für eine schier unüberschaubare Vielfalt von Unterstützungsangeboten und Projekten für Schwangere, Mütter / Eltern von Säuglingen und Kleinkindern, die durch folgende zentrale Aspekte gekennzeichnet sind:
- Der Fokus liegt auf der Prävention von Vernachlässigung und Misshandlung bei Säuglingen und Kleinkindern, beginnend mit der Schwangerschaft bis zum Ende des dritten Lebensjahres.
- Die Risiken für das Kindeswohl durch die Früherkennung von familiären Belastungen zu reduzieren.
- Die frühzeitige Unterstützung von Müttern und Eltern zur Stärkung ihrer Erziehungskompetenzen.
(vgl. Sann/Schäfer 2008, S. 109)
Eine weitere Unterscheidung kann im Bezug auf die Zielgruppe getroffen werden. Frühe Hilfen, die auf die Unterstützung von Eltern bei ihren Erziehungskompetenzen ausgerichtet sind, werden unter präventive „Family Support Programme“ subsumiert. Im Unterschied dazu richten „Family Preservation Programme“ ihre Hilfen an Familien in Hochrisikokonstellationen. (vgl. Blum 2006, S.6)
Die Begrifflichkeit Frühe Hilfen soll im weitern Verlauf dieser Arbeit für alle primärpräventiven Unterstützungsmöglichkeiten und Angebote für Schwangere, Mütter, Eltern und Familien mit Säuglingen und Kleinkindern bis 3 Jahren stehen, die von Expertinnen und Experten des Gesundheitswesens und der Sozialarbeit in Kooperation geleistet werden. Frühe Hilfen sollen Eltern motivieren Unterstützung anzunehmen und ihnen beim Erlangen und Festigen von Beziehungs- und Erziehungskompetenzen helfen. Besonders wenn sich Eltern in ihrer Rolle unsicher fühlen, nehmen sie gerne Beratungsangebote an. Durch nachhaltige niederschwellige Angebote sollen Defizite frühzeitig erkannt, reduziert und zu beheben versucht werden. Die positive Entwicklung von Säuglingen und Kindern steht im Vordergrund von Angeboten Früher Hilfen. Darüber hinaus soll der Schutz des Kindeswohls durch frühzeitige Erkennung von Vernachlässigung gewährleistet bleiben, weshalb Frühe Hilfen auch als ein wichtiger Baustein eines sozialen Frühwarnsystems gelten. Warum der Beratungs- und Betreuungsbedarf generell, und somit ebenso der Bedarf an Frühen Hilfen im Steigen begriffen ist, wird folgend genauer beleuchtet.
2.2 Mögliche Ursachen für die Zunahme von Beratungs- und Betreuungsbedarf
Eine Zunahme von Beratungsangeboten ist in allen gesellschaftlichen Lebensbereichen zu beobachten. Erhardt (2010) unterscheidet drei große Teilbereiche von möglichen Ursachen:
- Der demografische Wandel, Veränderungen der Rahmenbedingungen am Arbeitsmarkt hinsichtlich neuer Zeit- und Arbeitsformenmodelle oder Genderpolitik führen zu Unsicherheiten und Orientierungslosigkeit, die ohne professionelle Hilfe für viele nicht bewältigbar ist. Die Individualisierung der Lebensführung bringt Entscheidungsspielräume mit sich, wodurch es allerdings auch notwendig wird Entscheidungen zu treffen, die für manche eine Überforderung darstellt.
„Die Propagierung ungeahnter Chancen mit der individualisierenden Zuschreibung der Verantwortung für das eigene Leben führt bei einer gleichzeitigen Verknappung der Ressourcen zu einem Phänomen, das in der Sozialpsychologie Demoralisierung genannt wird“ (Homfeldt/Sting 2006, S. 106).
Die mit der Individualisierung einher gehende Pluralisierung stellt jedoch nicht nur für die Individuen eine Herausforderung dar, sondern im Besonderen auch für die unterstützenden Institutionen. Somit verlangt es nach einem gemeinsamen Prozess des Aushandelns dessen, was als Lebensschwierigkeit angesehen wird und welche Hilfsangebote für den Einzelnen vorstellbar sind. (vgl. Thiersch 2000, S. 132 und Wohlgemuth 2009, S. 63f.)
- Als weitere Ursache für den steigenden Beratungsbedarf wird die Veränderung der Familiensituation genannt, die im 3.2 Familie im Wandel der Zeit ausführlich beschrieben ist und besonders relevant für das Beratungsangebot Früher Hilfen erscheint.
- Als einen wesentlichen Bereich nennt Erhardt (2010) kritische Lebensereignisse, die Krisen auslösen können und nur mit professioneller Hilfe bewältigbar sind und somit zum Anstieg des Bedarfs an Beratungsangeboten beitragen. Beispiele dafür sind Arbeitslosigkeit, Verschuldung, Bedrohung von Wohnungslosigkeit, Süchte und Krankheiten, Zuwanderungshintergrund und viele Faktoren wiederum Familien betreffend, wie Erziehungsschwierigkeiten, Probleme in der Schule, Paar- und Familienkonflikte und Schwangerschaftsproblematik. (vgl. Erhardt 2010, S. 74f. und Germain/Gitterman 1999, S. 164ff.)
Nach Terkelsens (1980) werden diese Übergänge als Lebensprobleme erster Ordnung bezeichnet. Im Gegensatz dazu treten Stressoren zweiter Ordnung oft unvorhergesehen auf und sind vergleichsweise schwerwiegender. Zu dieser Kategorie werden ungeplante Schwangerschaften, Gewalttätigkeit in der Familie, schwere oder chronische Erkrankungen oder der plötzliche Verlust eines geliebten nahestehenden Menschen gezählt. Lebensprobleme zweiter Ordnung verursachen stark veränderte Lebensbedingungen, sind meist nur mit formeller oder informeller Hilfe bewältigbar und deshalb in der Sozialarbeit häufig anzutreffen. Dennoch können auch Probleme erster Ordnung, wie Beispielsweise eine Schwangerschaft, eine schwerwiegende Veränderung der Routine des Familienlebens aufgrund eines Mangels an internen oder externen Ressourcen, auslösen (vgl. Germain/Gitterman 1999, S. 304ff.)
2.2.1 Gesteigerte Beratungs- und Informationsbedürfnisse von Schwangeren, Müttern / Eltern von Säuglingen und Kleinkindern
Ein Kind zu bekommen, gehört wohl für die meisten Menschen zu den glücklichsten Ereignissen im Leben. Schwangerschaft und die Gründung einer Familie wird gesellschaftlich vorwiegend sehr positiv bewertet weshalb es als selbstverständlich betrachtet wird, dass sich die werdenden Eltern auf den Nachwuchs freuen. Doch nicht alle können sich bedingungslos auf ihr Kind freuen. Oft begleiten Angst, Zweifel und Unsicherheit auch jene Frauen und Männer, die sich nichts sehnlicher als ein Kind gewünscht haben. Manche werdenden Eltern haben Schuldgefühle, weil sie das Kind nicht gleich annehmen können oder auch eine Abtreibung in Erwägung gezogen haben. Oft fehlen jegliche Erfahrungen im Umgang mit Säuglingen und kleinen Kindern und die eigene Unsicherheit wirft immer einen Schatten auf die Schwangerschaft und das Erziehungsverhalten des Kindes. Viele Frauen und Männer trauen sich nicht, solche oder ähnliche Gedanken zuzugeben, geschweige denn auszusprechen und ihre Sorgen und Ängste mit jemandem zu teilen. Selbst Gespräche mit der eigenen Partnerin / dem eigenen Partner fallen oft schwer. (vgl. Türkmen-Barta 1994, S. 7ff.)
Nicht nur die Schwangerschaft an sich, sondern die gesamte veränderte Lebenssituation und die Rolle als Mutter lösen bei vielen Sorgen aus. Die gute medizinische Versorgung einer schwangeren Frau reicht deshalb oft nicht aus um die bestehenden Ängste aus dem Weg zu räumen. Psychische Dauerbelastungen der Mutter wirken sich allerdings sehr ungünstig auf die Entwicklung des Fötus aus. Diese Säuglinge haben oft ein vermindertes Geburtsgewicht und sind krankheitsanfälliger als Kinder von Frauen, deren Schwangerschaft positiv erlebt wurde. So führen seelische Belastungen der Mutter zu einer gesteigerten Aktivität oder einem erhöhten Herzschlag des Ungeborenen. Da die meisten Probleme auch nach der Geburt weiter bestehen, wird angenommen, dass diese Kinder mit ihren Müttern bzw. Bezugspersonen keine optimale Bindung aufbauen und deshalb auffälliger sind. Studien belegen, dass pränatale Stressfaktoren zwar durch positive Erfahrungen nach der Geburt abgeschwächt oder gemildert werden können, sich viele Kinder aber zu labilen, ängstlichen und verhaltensauffälligen Persönlichkeiten entwickeln, die eher zu Depressionen neigen. Im Interesse des Kindes und der schwangeren Frau sollte deshalb die psychologische Betreuung ebenso wichtig genommen werden wie die physische Begleitung von Schwangeren. (vgl. Schenk-Danzinger 1996, S. 16ff.) Durch die veränderte Lebenssituation treten während der Schwanger- und Elternschaft auch vermehrt soziale Probleme, wie beispielsweise finanzielle Belastungen, Beziehungsschwierigkeiten oder Suchterkrankungen auf, da bestehende Lebensverhältnisse neu gestaltet werden müssen. Elternschaft ist somit generell eine Zeit, in der häufiger psychosoziale Risiken auftreten können, da sie einen kritischen Übergang im Lebenszyklus darstellt. (vgl. Maschewsky-Schneider/Sonntag/Endruschat-Nowack 1989, S. 101) Aufgrund der meist sehr vielschichtigen Problemlagen ist eine interdisziplinäre Kooperation unterschiedlichster Expertinnen und Experten aus dem Sozial- und Gesundheitswesen für eine gelingende Unterstützung von Schwangeren, Müttern und Familien dringend erforderlich. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch das Verständnis darüber, wie in unterschiedlichen Kulturen soziale Transitionen bewältigt werden. Um Menschen bei der Bewältigung von belastenden Lebensumständen unterstützen zu können, ist es für die Helfer unabdinglich spezifisches Wissen über die Bedeutung von biologischen Veränderungen in einem ethischen Kontext zu erwerben. Neuanfänge bedeuten Veränderungen, die in einem gewissen Maß immer mit Stress verbunden sind, da sich Anforderungen, verbunden mit dem Erwerb einer neuen Rolle, verändern. (vgl. Germain/Gitterman 1999, S. 164ff.)
Zahlreiche Hinweise aus der Literatur belegen, dass Hilfsangebote, die sehr früh, entweder zu einem frühen Zeitpunkt im Leben eines Kindes bzw. zu einem Zeitpunkt bevor sich Problemlagen manifestieren, implementiert werden, immer mehr an Bedeutung gewinnen. (vgl. Diepholz 2007, S. 12)
Eine besondere Herausforderung für die Planung und Entwicklung eines Konzepts für Frühe Hilfen ist ein passendes Angebot für individuelle Problemlagen von belasteten Familien zu erstellen. Familien brauchen, je nach Lebenssituation, sehr unterschiedliche und unterschiedlich intensive Angebote, die von Informationsbeschaffung bis zu Erziehungshilfemaßnahmen reichen können. Eine besondere Schwierigkeit stellen dabei die fließenden Übergänge zwischen Normalität, Belastung und der Gefährdung des Kindeswohles dar. (vgl. Ziegenhain et al. 2010, S. 34)
2.3 Frühe Hilfen: Hilfen unterhalb von Erziehungshilfen
Die Interventionsziele bei Kindeswohlgefährdung bzw. bei Frühen Hilfen können folgendermaßen unterschieden werden: bei einer Gefährdung des Kindeswohls hat die Sicherheit und der sofortige Schutz des Kindes höchste Priorität. Im Gegensatz dazu gilt bei Frühen Hilfen, rasch jene Kinder und Familien zu finden und zu identifizieren, deren Lebenssituation von Risikofaktoren gekennzeichnet ist im ihnen möglichst rasch und zielgerichtet Angebote zur Entlastung ihrer Lebenslage zur Verfügung zu stellen. Diese Unterstützungs- und Hilfsangebote sollen potentielle Gefährdungssituationen frühzeitig erkennen und somit Vernachlässigung und Gewalt vorbeugen. (vgl. Schone 2007, S. 52)
Zur bildlichen Darstellung der Übergänge von einem Unterstützungsbedarf im Rahmen Früher Hilfen und Erziehungshilfen zur Sicherung des Kindeswohles eignet sich ein Ampel- oder Phasenmodell.
Abbildung 1: Phasenmodell Früher Hilfen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: eigene Darstellung, in Anlehnung an Jordan/Schneider/Wagenblass 2008, S. 7
Ziel Früher Hilfen und eines sozialen Frühwarnsystems ist es, im Vorfeld anzusetzen und Probleme in ihrem Entstehungsprozess zu bearbeiten. Bildlich dargestellt anhand des Ampelmodells an der Schwelle von grün zu gelb bzw. im gelben Bereich. Akute bzw. verfestigte Problemlagen, die eine Gefährdung des Kindeswohls darstellen, würden bei einem Ampelmodell im günstigsten Fall im Übergang von gelb auf rot eingeleitet werden bzw. würden sich im roten Bereich befinden. (vgl. Jordan/Schneider/Wagenblass 2008, S. 7f.)
2.4 Zentrale Elemente eines sozialen Frühwarnsystems
Risiken entstehen meist nicht von einem Tag auf den anderen. Sie kündigen sich gewöhnlich schon weit vor einer akuten Krise mit schwachen Signalen an, welche auch oft von einzelnen Stellen wahrgenommen werden. Durch die fehlende Kommunikation und Vernetzung zwischen den einzelnen Professionen oder Institutionen gelingt die richtige Einschätzung hinsichtlich ihres Risikopotentials vielfach nicht richtig. (vgl. Jordan/Schneider/Wagenblass 2008, S. 11) Auch wenn mit Hilfe des Phasenmodells ersichtlich wird, wann Frühe Hilfen oder Erziehungshilfen ansetzen, ist es unabdingbar Bewertungskriterien und Schwellenwerte zu definieren, was als kritische, problematische oder krisenhafte Entwicklung eines Kindes angesehen wird. (Böttcher/Bastian/Lenzmann 2008, S. 11f.) Es gilt gemeinsame und fachlich begründete Standards zu entwickeln, die verbindliche Reaktionen in den einzelnen Institutionen auslösen. „Das Zusammenführen der Basiselemente zu einer geschlossenen Reaktionskette ist das Innovative eines sozialen Frühwarnsystems gegenüber klassischen Präventionsansätzen“ (Ministerium für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familien 2005, S. 17, zit. nach Böttcher/Bastian/Lenzmann 2008, S. 12).
Abbildung 2: Basiselemente eines sozialen Frühwarnsystems
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: eigene Darstellung, in Anlehnung an Jordan/Schneider/Wagenblass 2008, S. 11
Basiselement 1: Wahrnehmen
Zunächst ist es erforderlich den Problembereich klar festzulegen, um für diesen Bereich Indikatoren entwickeln zu können. Diese Indikatoren sind messbare Sachverhalte, die von den Kooperationspartnern in einem gemeinsamen Aushandlungsprozess definiert werden und mit hoher Wahrscheinlichkeit eine riskante Entwicklung vorhersagen können. (vgl. Böttcher/Bastien/Lenzmann 2008, S. 12) Aufgrund der unterschiedlichen Zugänge der einzelnen Professionen in einem Netz Früher Hilfen müssen gemeinsame Kriterien für die Wahrnehmung und Beurteilung kindlicher Entwicklung eingebettet in ihrem sozialen Kontext vielfach erst geschaffen werden. (vgl. Jordan/Schneider/Wagenblass 2008, S. 12)
Basiselement 2: Warnen
Das bloße Vorhandensein eines oder mehrerer Risikofaktoren an sich, sagt nichts über die tatsächliche Gefährdung eines Kindes aus. Das Zusammenspiel und die Ausprägung der Merkmale bilden Gefahrenschwellen, die es in einem sozialen Frühwarnsystem zu benennen gilt und deren Überschreitung einen Besorgnis erregenden oder gefahrvollen Zustand erwarten lässt. Deshalb sind nicht nur die Indikatoren, sondern auch die Schwellenwerte und die damit verbundenen weiteren verbindlichen Handlungsschritte und Reaktionen der beteiligten Kooperationspartner gemeinsam fest zu legen und des Weiteren transparent und nachvollziehbar zu dokumentieren. Verbindliche Vereinbarungen und Kontrakte werden bei der interdisziplinären Zusammenarbeit als hilfreich bewertet. (vgl. Böttcher/Bastian/Lenzmann 2008, S. 12 und Jordan/Schneider/Wagenblass 2008, S. 12f.)
Basiselement 3: Handeln
Durch klare Regelungen und Verfahren wird ein nachvollziehbares und zeitnahes Reagieren und zielgerichtetes Handeln, sowohl innerhalb als auch zwischen den Institutionen ermöglicht. Dadurch wird einem wesentlichen Leitgedanken Früher Hilfen, der optimalen Nutzung bereits vorhandener Versorgungsstrukturen und deren Effektivität durch verbindliche Zusammenarbeit, Folge geleistet. Jordan/Schneider/Wagenblass 2008, S. 13)
2.5 Notwendigkeit Früher Hilfen
Aufgrund der medialen Aufbereitung von dramatischen Fällen der Vernachlässigung und Misshandlung von Kindern und der Sensibilität der Bevölkerung wird ein verbesserter Kinderschutz zu einem hoch aktuellen sozialpolitischen Thema. Aufgrund fehlender repräsentativer Forschungsergebnisse können allerdings keine Aussagen darüber gemacht werden, ob die Zahl der Vernachlässigungen, Verwahrlosungen oder Misshandlungen von Kindern gestiegen ist oder sich lediglich die öffentliche Wahrnehmung durch die mediale Darstellung verändert hat. Aufgrund dieser fehlenden Ergebnisse ist eine Planung im Hinblick auf Präventions- und Hilfemaßnahmen sehr schwierig.
Nachfolgend einige Fakten, die erahnen lassen, wie wichtig ein funktionierendes Netz Früher Hilfen zum Schutz und Wohlergehen von Kleinkindern und Säuglingen ist. 15 % aller Säuglinge in Deutschland zeigen bereits in den ersten 3 Lebensmonaten schwere Verhaltensauffälligkeiten. Allerdings werden kindliche Verhaltensauffälligkeiten erst im Vorschulalter diagnostiziert. 5 % aller deutschen Kinder wachsen in einem risikobelasteten Umfeld für Vernachlässigung auf, welche oft die Vorstufe für Misshandlungen sind. Zudem ist das Risiko an einer Misshandlung zu sterben ist im ersten Lebensjahr größer als in jedem späteren Alter. (vgl. Fegert 2007, S. 10ff.)
Die Autoren des Österreichischen Familienberichts 2010 gehen davon aus, dass Kinder und Jugendliche mehrheitlich in ihrer Erziehung sowohl psychischer als auch körperlicher Gewalt ausgesetzt sind. Lediglich 30 % der österreichischen Kinder werden völlig frei von körperlichen Strafen erzogen. Der Bedarf an Frühen Hilfen ist anhand dieser Ergebnisse auf jeden Fall gegeben. Bedenklich ist weiters, dass knapp 40 % der österreichischen Eltern ohne Mitgrationshintergrund und mehr als zwei Drittel der Eltern mit Migrationshintergrund keine professionellen Ansprechpartner oder Einrichtungen kennen, an die sie sich im Falle eines größeren innerfamiliären Problems wenden könnten. (vgl. Bussmann/Erthal/Schrot 2009, S. 219 und S. 223)
Ebenso können Anhand der Ergebnisse des Jugendwohlfahrtsberichts 2009 Rückschlüsse auf einen Bedarf an früh einsetzenden Unterstützungsangeboten gezogen werden. In Österreich erhielten 2009 27.261 Kinder und Jugendliche Unterstützung der Erziehung, eine Steigerung um 5 % zum Vergleichsjahr 2008. Weitere 10.659 Minderjährige wurden im Rahmen der vollen Erziehung in vollstationären Einrichtungen oder bei Pflegeeltern betreut, was eine Steigerung zum Vorjahr von 0,9 Prozent bedeutet. Im Jahr 2009 wurden in Oberösterreich 458 Familien mit einem Kind unter 5 Jahren durch eine Unterstützungsmaßnahme bei der Erziehung begleitet. 57 Säuglinge und Kleinkinder wurden in einer voll stationären Einrichtung betreut. Zum Stichtag 31.12.2009 befanden sich zudem 161 Kinder im Alter von 0 – 5 Jahren in einer Pflegefamilie. (vgl. Bundesministerium für Wirtschaft, Jugend und Familie 2010, S. 2ff.) In dieser Statistik sind jene Familien, die Erziehungshilfen der Jugendwohlfahrt erhalten erfasst, wo also bereits eine Kindeswohlgefährdung festgestellt wurde. Besorgniserregend ist hierbei auch die Tatsache, dass etwa die Hälfte der Österreicher/innen Bedenken haben, sich in die Privatsphäre anderer Menschen einzumischen und würden beim Entdecken von schwerer Gewalt in einer Familie weder eine staatliche noch nicht-staatliche Beratungsstelle einschalten. (vgl. Bussmann/Erthal/Schrot 2009, S. 219 und S. 292)
Hinzu kommt noch, dass es derzeit ein regional sehr unterschiedliches Angebot gibt, das ausschließlich freiwillig von Schwangeren, Müttern und Eltern in Anspruch genommen werden kann. Deshalb werden derzeit auch in Österreich Forderungen laut, die vielen vorhandenen Angebote zu evaluieren und mehr Beratungsstellen für überforderte Eltern einzurichten. (vgl. o.V., 2010, http://derstandard.at) Dass dies allerdings nicht ausreichen wird belegen Studien aus Deutschland. Bei klassischen Bildungsangeboten beträgt der Anteil an sozial benachteiligten Familien nur ca. 10 %, da sich Mütter / Eltern benachteiligter Schichten scheuen Angebote wahr zu nehmen oder sie ihnen gar nicht bekannt sind. Darüber hinaus bemängeln jene bildungsungewohnten Eltern häufig die hohen Kosten von Kursen und Vorträgen und die schlechte Erreichbarkeit. (vgl. Peveling 2009, S. 7) Kostenlose und niederschwellige Angebote, wie sie vor allem vom Gesundheitswesen angeboten werden, könnten mit einer Vernetzung des Sozialwesens diesem Anspruch gerecht werden.
2.6 Zielgruppe Früher Hilfen
Zielgruppe Früher Hilfen sind alle Schwangeren, Mütter und Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern von 0 – 3 Jahren, die über das Beratungs- und Unterstützungsangebote in ihrer Region informiert werden. Gleichzeitig soll dabei ausfindig gemacht werden, ob ein erweiterter Bedarf an Unterstützung besteht. Es ist sinnvoll, sich auf werdende Mütter bzw. Familien mit Säuglingen und Kleinkindern im Alter von 0 bis 3 Jahren zu konzentrieren, da Kinder in diesem Alter besonders gefährdet sind Opfer von Gewalt und Vernachlässigung zu werden. Sie sind hilflos, brauchen eine kontinuierliche Versorgung und die Abhängigkeit von betreuenden und versorgenden Menschen ist sehr hoch. (vgl. Schone 2007, S. 52 und Wohlgemuth 2009, S. 98ff.) „Die Gefahr von Vernachlässigung und Kindeswohlgefährdung ist am größten in den ersten fünf Lebensjahren. Während des ersten Lebensjahres sterben mehr Kinder in der Folge von Vernachlässigung und Misshandlung als in jedem späteren Alter“ (US Department of Health and Human Services 1999, zit. nach Ziegenhain/Fegert 2007, S. 68). Darüber hinaus ist „keine Lebensphase von so schnellen und existenziellen Entwicklungsschüben geprägt wie die frühe Kindheit“ (Schone 2007, S. 52).
Die frühzeitige Identifizierung von Familien, die einen Hilfe- und Unterstützungsbedarf haben, setzt eine lückenlose Zusammenarbeit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Gesundheits- und Sozialwesens voraus. Für eine Verzahnung dieser zwei Systeme, die in der Regel getrennt voneinander agieren, sprechen viele Aspekte die nun hier skizziert werden.
2.7 Zugang zur Zielgruppe finden
Schwangere, Mütter und Familien mit Säuglingen und Kleinkindern stehen im Regelfall in engem Kontakt mit dem Gesundheitssystem, da fast jede Frau die kostenlosen Vorsorgeuntersuchungen im Rahmen des Mutter-Kind-Passes in Anspruch nimmt und bei und nach der Geburt sowohl im Krankenhaus als auch bei einer Hausgeburt, durch medizinisches Personal betreut wird. Sollen Familien mit Kindern von 0 bis 3 Jahren erreicht werden, können Einrichtungen des Gesundheitswesens eine wichtige Zugangs- und Vermittlungsfunktion übernehmen. Für viele Familien sind die Angebote im Jugendwohlfahrtssystem weniger selbstverständlich, da mit diesen Behörden und den dazugehörigen Institutionen eher eine Gefährdung des Kindeswohls assoziiert wird und weniger als eine Einrichtung zur Unterstützung von Müttern und Eltern wahrgenommen wird. Darüber hinaus sind die meisten Einrichtungen des Gesundheitswesens vom Beratungsangebot eher niederschwellig angelegt somit für die Mütter und Erziehungsberechtigten einfacher zu erreichen. (vgl. Helming et al. 2006, S. 30ff.). Den meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Gesundheitswesens wird Vertrauen entgegengebracht, besonders Hebammen genießen in der Zeit der Schwangerschaft und nach der Geburt bei den meisten Müttern einen hohen Stellenwert. Aber auch Ärztinnen und Ärzte aus den Bereichen der Gynäkologie, Pädiatrie oder Allgemeinmedizin, Kinderkrankenschwestern oder Stillberaterinnen stellen oft wichtige Vertrauenspersonen dar, die Mütter / Eltern motivieren können Hilfe und Unterstützung anzunehmen. Mit geeigneten Kooperationsmöglichkeiten könnten diese Schlüsselpersonen eine Brückenbaufunktion zwischen Gesundheitswesen und Sozialarbeit bilden, welche die vielschichtigen Bedürfnisse, Wünsche und Probleme von Schwangeren und Familien mit Säuglingen und Kleinkindern besser befriedigen und abdecken könnten. Eine effektivere Betreuung und Beratung sowie eine ökonomische, rasche und effizientere Vermittlung und Bereitstellung von Hilfsangeboten wäre dadurch besser gewährleistet.
Dennoch stehen alle Institutionen, Organisationen und Einrichtungen vor dem gleichen Problem: nur ein kleiner Teil der Bevölkerung nimmt vorhandene Angebote in Anspruch. Vor allem diejenigen Personen und Zielgruppen, die am dringendsten Hilfe brauchen würden und von den Angeboten am meisten profitieren würden bleiben unerreicht. Diese Tendenzen sind sowohl in der Inanspruchnahme medizinischer Versorgung als auch bei der Erreichbarkeit sozial benachteiligter Gruppen durch Prävention zu erkennen. Als Gründe werden eine erschwerte Kommunikation zwischen Zugehörigen der Unterschicht und Fachpersonal im Gesundheitswesen oder die Mittelschichtsorientierung bei Präventionsangeboten oder gesundheitsfördernden Maßnahmen genannt. (vgl. Maschewsky-Schneider/Sonntag/Endruschat-Nowack 1989, S. 244ff. und S. 257f.) Frühe Hilfen müssen deshalb noch niederschwelliger und vorzugsweise nachgehend sein als die bisher üblichen Informations- und Beratungsmöglichkeiten für Schwangere, Mütter und Eltern, wie etwa die Eltern-Mutterberatung oder Schwangerschafts- und Geburtsvorbereitungskurse.
2.7.1 Aufsuchende Sozialarbeit - ein Plädoyer für den Hausbesuch
In der Geschichte der Sozialarbeit spielte der Hausbesuch eine zentrale Rolle, doch die aufsuchende Hilfe gerät immer mehr Vergessenheit und wird in Oberösterreich in der Familiensozialarbeit meist nur noch im Rahmen einer Abklärung von Kindeswohlgefährdung, im Rahmen von Maßnahmen oder bei der Begutachtung von Pflegefamilien durchgeführt. Eine große Ausnahme stellen hier die Eltern-Mutter-Beratungsstellen „Iglu“ in Linz-Dorfhalle, Wels, Mauthausen, Marchtrenk, und Traun dar. In diesen Einrichtungen ist es üblich, alle Mütter mit Neugeborenen in der betreffenden Stadtgemeinde, zu Hause besuchen, falls die Mütter / Eltern nicht von sich aus in den ersten Wochen nach der Geburt die Institution aufsuchen. Dabei wird das Angebot der Eltern-/Mutterberatungsstelle vorgestellt. (vgl. Interview 5, Zeile 10 – 16) In dieser Arbeit sollen besonders die Vorteile von nachgehenden Ansätzen in der präventiven Elternarbeit aufgezeigt und deren nachhaltige positive Wirkung betont werden.
In einigen Ländern in und außerhalb Europas, beispielsweise England, den Niederlanden, USA oder Kanada, gehören Beratungsangebote wie die aufsuchende Sozialarbeit in Kooperation mit dem Gesundheitswesen zum Standard der psychosozialen Versorgung von Müttern bzw. jungen Familien. (vgl. Blum 2006, S.4) Heute wird der aufsuchende Kontakt im Wohnumfeld sowohl seitens der Klientinnen und Klienten aber auch seitens der Sozialarbeiter/innen tendenziell eher als negativ bewertet. Hausbesuche werden als Kontrolle der Familiensituation und Eingriff in die Privatsphäre erlebt. Viele Familien fühlen sich, besonders durch die unangekündigten Besuche, überrumpelt und kooperieren nur gezwungener Maßen, meist nur um noch größeres Übel zu verhindern. (vgl. Germain/Gitterman 1999, S. 116ff.) Im Gegensatz dazu wird allerdings berichtet, dass Müttern und Eltern durch aufsuchende Sozialarbeit in ihrer Lebenswelt das Gefühl von Wertschätzung und positivem Interesse entgegengebracht wird. (vgl. Blum 2006, S. 3) Wie Ergebnisse des Münchner Modells der Frühen Hilfen für psychosozial hoch belastete Familien zeigen, sind Familien, die selbst um einen Hausbesuch bitten, überdurchschnittlich oft von schweren Problemlagen betroffen. Insgesamt sind 94 % der besuchten Familien mit dem Hausbesuchsprogramm hoch zufrieden, wobei die Tendenz bei Folgebesuchen, zurückzuführen auf die geschaffene Vertrauensbasis, ansteigt. (vgl. Eder-Debye/Mielck/Schunk 2008, S. 2)
Sehr viele Argumente sprechen für die nachgehende bzw. aufsuchende Sozialarbeit, die in der Literatur auch als „Geh-Struktur“ bezeichnet wird. Als wichtigste Argumente sind die Niederschwelligkeit des Angebots und der Erkenntnisgewinn über die Lebenssituation der Familie zu erwähnen. Meistens fühlen sich die Kinder, aber auch die Eltern, im eigenen Wohnumfeld sicherer und benehmen sich deshalb auch authentischer, man erhält ein Gespür für die Familiensituation, was ein wesentlicher Vorteil für die Einschätzung der Problemlagen sein kann. Durch die Wahl eines günstigen Zeitpunkts in Absprache mit der Familie ermöglicht ein Hausbesuch den Miteinbezug aller Familienmitglieder. Anfahrtswege und Wartezeiten fallen weg, Ängste und Scheu können im gewohnten Umfeld der Familie oft rasch abgebaut werden und ermöglichen die Herstellung von Nähe. Aber nicht nur das unmittelbare Wohnumfeld wird kennen gelernt, sondern auch die Wohn- und Lebenssituation im Stadtteil oder Viertel wird wahrgenommen.
Erhardt (2010) bezeichnet die aufsuchende Sozialarbeit sogar als „vierte Kraft“ neben den klassischen Methoden Einzelfallhilfe, Gruppen- und Gemeinwesenarbeit, die dem Fachpersonal allerdings großes Einfühlungsvermögen und Geduld abverlangt, da oft schlechte Vorerfahrungen und negative Assoziationen mit Hausbesuchen verbunden sind. (vgl. Erhardt 2010, S. 60ff.) Müller (2008) stellt deshalb klar definierte Richtlinien auf, die eine solche Intervention rechtfertigen. Nicht erwünschte Hausbesuche dürfen „vorhandenes Potential der Selbstbestimmung nicht zerstören. Erniedrigende Eingriffe sind deshalb ebenso illegitim wie alle Versuche, mit Gewaltmitteln Menschen zu bessern oder glücklich machen zu wollen“ (Müller 2008, zit. nach Erhardt 2010, S. 61). Deshalb muss den schwangeren Frauen oder jungen Eltern immer eine Entscheidungsfreiheit eingeräumt werden, die es ihnen möglich macht einen Hausbesuch abzulehnen. Eine Ausnahme stellt natürlich die begründete Annahme über eine Gefährdung des Kindeswohles dar.
2.7.2 Freiwilligkeit versus verordnete Dienste
Werden soziale Hilfeleistungen als Bedingungen verordnet, beispielsweise um finanzielle Unterstützung zu erhalten, erleben viele Klientinnen und Klienten das Angebot oft als Zwang, fühlen sich in ihrer Entscheidungsfreiheit eingeschränkt und erleben die Hilfe von Expertinnen und Experten als eine potenzielle Bedrohung. (vgl. Germain/Gitterman 1999, S. 116ff.) Bei flächendeckenden Angeboten, die alle Familien, egal welcher Schicht- oder Milieuzugehörigkeit einschließen, könnten darüber hinaus Schamgefühle und Hemmschwellen von unterstützungsbedürftigen Familien vermindert werden.
„Potentielle Klienten wenden sich für gewöhnlich an soziale Dienststellen, wenn die Lebensstressoren für sie unerträglich geworden sind. Der Akt des Hilfesuchens kann selbst ein weiterer Stressor sein. In einer Gesellschaft, Eigenständigkeit hoch bewertet, kann das Hilfebedürfnis leicht als persönliche Unfähigkeit und Kontrollverlust über die eigenen Angelegenheiten interpretiert werden. Ein Schamgefühl oder auch die Angst davor, wie man vom Sozialarbeiter aufgenommen wird, mischt sich mit der Hoffnung, dass die Not behoben, der Stressor aufgelöst und der Streß (sic!) erleichtert wird“ (Germain/Gitterman 1999, S. 102)
Bei Hebammen oder Kinderkrankenschwestern gehören Hausbesuche zum Leistungsangebot und werden von vielen Müttern und Familien sehr geschätzt auch wenn ihnen von ärztlicher Seite dazu geraten wird. Medizinische Leistungen wirken auf die Mütter / Eltern weniger stigmatisierend, im Gegenteil, sie werden meist sehr gerne angenommen. Allerdings übernimmt die Krankenkasse bei einer vorzeitigen Entlassung, einer ambulanten Geburt oder einer Hausgeburt maximal die Kosten für sieben Hausbesuche, bzw. Sprechstunden in der Hebammenordination, zwischen dem sechsten Tag und der achten Woche nach der Geburt, wenn Probleme oder Komplikationen auftreten. Von einer frei praktizierenden Hebamme wird allerdings angemerkt, dass dieser Zeitraum bei manchen Frauen / Familien als zu kurz erachtet wird und die Hilfe von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern bzw. anderen Berufsgruppen als wünschenswert und hilfreich erachtet wird. (vgl. Interview 1, Zeile 105 – 115) Die ganzheitliche Betreuung rund um das Thema Schwangerschaft, Geburt und das Zusammenleben mit einem Säugling und die bei Bedarf notwendige Involvierung von unterschiedlichen Berufsgruppen des Gesundheitswesens könnte durch eine gute Kooperation zwischen Sozialarbeit und Gesundheitswesen gewährleistet werden und durch den primärpräventiven Ansatz Kosten und Leid eingespart werden. In der Literatur gibt es zahlreiche Hinweise und Belege dafür, dass präventive Angebote, die sehr früh, entweder zu einem frühen Zeitpunkt im Leben eines Kindes bzw. zu einem Zeitpunkt, bevor sich Problemlagen manifestieren, immer mehr an Bedeutung gewinnen. (vgl. Diepholz 2007, S. 12)
2.8 Familien gerecht werden
Die meisten Probleme in Familien sind vielschichtig, daher bietet sich eine multiprofessionelle Herangehensweise an. Vor allem bei kleinen Kindern und Säuglingen äußern sich Probleme oft somatisch, so sind beispielsweise Schreibabys oft die Symptomträger von überforderten Müttern, oder es existieren Ängste und Störungen der Eltern. (vgl. Vom Lehn 2007, www.welt.de) Die Trennung zwischen gesundheitlichen und sozialen Themen kann demnach nicht strikt erfolgen, da viele dieser Problemlagen größtenteils miteinander verknüpft sind und sich auch wechselseitig begünstigen. Hilfen müssen an den Bedarf der Familien angepasst werden, nicht umgekehrt. Als wichtige Arbeitsansätze hierzu beschreibt Abel (2000):
„Die Akzeptanz der Lebensform der Familien ist eine unabdingbare Voraussetzung; Schlüsselpersonen erhalten eine hohe Bedeutung; intensive Beziehungsarbeit und Maßnahmen zur Vertrauensbildung sind wichtig und im Umgang mit bestimmten (tendenziell stigmatisierenden) Themen und Begriffen ist eine besondere Sensibilität erforderlich“ (Abel 2000, S. 191 zit. n. Homfeldt / Sting 2006, S.105).
Vor allem Aufgrund des Anspruchs einer ganzheitlichen Problemanalyse und der methodischen Vielfalt sind Sozialarbeiter/innen geradezu prädestiniert um in diesem Handlungsfeld Einsatz zu finden. Auch wenn sich die meisten Kinder in einem förderlichen familiären Umfeld positiv oder unauffällig entwickeln, lässt sich dennoch feststellen, dass die Belastung von Familien wächst und deshalb auch politisch der Verantwortung nachzukommen ist, Familien in Beziehungs- und Erziehungskompetenzen zu unterstützen. (vgl. Ziegenhain 2007, S. 120)
„Durch eine verbindliche Kooperation zwischen Jugend- und Gesundheitshilfe werden soziale und gesundheitliche Aspekte der Familien bzw. der Kinder wahrgenommen. Man wird den Familien so eher gerecht“ (Diepholz 2007, S. 13).
2.9 Geeignete Methoden und Fertigkeiten im Kontext „Früher Hilfen“
Wie bereits beschrieben, werden nachgehende Hilfsangebote, besonders jene in Form von Hausbesuchen, von den Klientinnen und Klienten sehr unterschiedlich bewertet und angenommen. Ein Repertoire an professionellen Methoden und Fertigkeiten ist für die Unterstützung in belastenden Lebenssituationen unbedingt erforderlich. Die eigene Problemlösungsfähigkeit, Selbstwirksamkeit, Entscheidungs- und Wahlmöglichkeiten sollen in den Mittelpunkt der Beratung rücken. Die Mütter und Familien sollen ermutigt werden über ihre Probleme, Wünsche oder belastende Situationen zu sprechen.
„Gerade in der Schwangerschaft und rund um die Geburt haben die meisten Frauen ein großes Redebedürfnis. Sie brauchen jemand, der ihnen zuhört, der Erfahrung hat und ihnen Mut und Selbstvertrauen schenkt, daß (sic!) sie mit den Aufgaben, die auf sie zukommen, besser fertig werden“ (Türkmen-Barta 1994, S. 16).
Gemeinsam mit den Müttern / Eltern soll geklärt werden, ob es einen Unterstützungsbedarf gibt, und in welche Richtung die Beratung und Betreuung gehen und der Fokus gelegt werden soll. Die Hilfeplanung muss sich immer an der individuellen Situation der Familie orientieren und Mütter bzw. Väter in den Hilfeprozess angemessen mit einbeziehen, ihnen eine aktive Rolle zuordnen. (vgl. Institut für soziale Arbeit e.V. 2006, S. 46ff.) Besonders wichtig ist das Identifizieren von Stärken und Fähigkeiten, da viele Mütter / Eltern von Selbstzweifeln geplagt sind und sich im Umgang mit ihrem Kind unsicher fühlen. Sozialarbeiter/innen sollen Zuversicht vermitteln, Hoffnung geben und die Klientinnen und Klienten ermutigen vorhandene Copingfähigkeiten zu aktivieren und einzusetzen. Ein besonderes Augenmerk bei der Beratung von Müttern und Familien liegt auch in der Vermittlung von relevanten Informationen bzw. in der Korrektur von Falschinformationen, die oft zu einem zusätzlichen Belastungsfaktor werden. (vgl. Germain/Gitterman 1999, S. 171ff.) Besonders Informationen über mögliche finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten, rechtliche Beratung und über die Entwicklung, Ernährung und Förderung von Säuglingen und Kleinkindern sind Eltern wichtig. (vgl. Stierle 2006, http://bertelsmann-stiftung.de)
Wenn in schwierigen Lebensphasen Menschen nicht bereit oder im Stande sind vorhandene soziale oder materielle Ressourcen zu nutzen, liegt es entweder daran, dass diese mit den Bedürfnissen der Klientinnen und Klienten nicht oder nur teilweise übereinstimmen, oder in der gestörten Kommunikation zwischen den Klientinnen und Klienten und den zur Verfügung stehenden Umweltressourcen. Es gilt eine Übereinkunft mit den Klientinnen / den Klienten zu treffen, um sie mit den vorhandenen Angeboten von Organisationen, Einrichtungen und Netzwerken zu verbinden bzw. diese zu koordinieren. Zudem sollen Mütter / Eltern dazu ermutigt werden, ihre persönlichen Ressourcen und die des Familiensystems zu aktivieren und die bereits vorhandenen Angebote auch zu nutzen. (vgl. Germain/Gitterman 1999, S. 236ff.) Wie allerdings bereits mehrfach angeführt, ist und war das Erreichen von Familien mit besonderen Bedürfnissen wohl eines der zentralen Probleme in der Familiensozialarbeit.
3 Aufgaben und Funktion der Familie aus soziologischer
und psychologischer Perspektive
Die wohl zentralste Frage in der Sozialisationstheorie beschäftigt sich damit, wie aus einem Neugeborenen ein autonomes und handlungsfähiges Mitglied der Gesellschaft wird. Laut Durkheim muss ein Säugling erst auf das gesellschaftliche Leben vorbereitet werden. Er spricht auch von einer „Tabula rasa“, ein unbeschriebenes Blatt, das erst beschrieben werden muss. Zahlreiche Studien widerlegen jedoch die Ansicht, dass ein Neugeborenes als ein primär asoziales Wesen anzusehen ist, sondern man nimmt an, dass Säuglinge grundlegende Fähigkeiten für soziale Interaktion bereits mitbringen. Hierfür spricht vor allem auch die Tendenz, dass Kinder im ersten Lebensjahr Beziehung zu ihren Bezugspersonen aufbauen. (vgl. Hopf 2005, S. 25ff.)
Geulen sieht Sozialisation als einen Prozess der Persönlichkeitsentwicklung in Abhängigkeit von seiner historisch-gesellschaftlichen Umwelt. (vgl. Zimmermann 2003, S. 13f.) Sozialisation geht über die erzieherischen Maßnahmen im Elternhaus, Kindergarten oder Schule hinaus. Sie beschreibt alle sozialen Erfahrungen, mit denen ein Mensch im Laufe seines Lebens konfrontiert ist. Deshalb ist Sozialisation mehr als nur Erziehung, wird aber unter anderem erst durch Erziehung ermöglicht.
3.1 Was eine Familie ausmacht – ein Definitionsversuch
Schlägt man in den verschiedenen Lexika unter dem Begriff Familie nach, findet man meist sehr unterschiedliche Erklärungen vor. Familie leitet sich vom lateinischen Wort familia ab, welches man mit „Hausgemeinschaft“ ins Deutsche übersetzen könnte. Doch auch dieser Begriff schafft nicht wirklich Klarheit, was genau eine Familie ausmacht und welche Aufgaben sie übernehmen soll. Biologisch gesehen erfüllt eine Familie die Funktion der Reproduktion. Sie ist aber dennoch auch der wichtigste Bestandteil für die Sozialisation eines Kindes. Sie soll Kinder zu vollwertigen Mitgliedern in unserer Gesellschaft machen, ganz gleich aus welchen Mitgliedern sich eine Familie zusammensetzt.
Die Soziologin Nave-Herz beschreibt eine Familie als eine Verbindung, in der Eltern oder ein Elternteil mit ihren bzw. seinen Kindern zusammenleben, zumeist in einer Haushaltsgemeinschaft. Sie unterscheidet die Drei-Generationen-Familie (Großeltern, Eltern, Kinder), die Eltern-Familie und Ein-Eltern-Familie, hier wiederum die Mutter- und die Vater-Familie (vgl. Zimmermann 2003, S. 86)
Noch viel weiter betrachtet der Familiensoziologe Hans Betram den Begriff der Familie. „Familienmitglieder sind meist Verwandte, müssen es aber nicht sein. Aus der Sicht der Befragten sind jedoch nicht alle, die zur Familie gehören könnten, auch tatsächlich Mitglieder ihrer Familie. Andererseits werden Personen zur eigenen Familie gerechnet die nach dem allgemeinen Verständnis nicht dazu gehören. (Zimmermann 2003 S. 86f.).
3.2 Familie im Wandel der Zeit
Wie anhand oben genannter Definitionen ersichtlich wird, gibt es keine Normal- oder Standardfamilien mehr sondern viele verschiedene Formen des familiären Zusammenlebens. Der Familienbegriff unterliegt einem ständigen gesellschaftlichen Wandel und kann am ehesten als ein Beziehungsgefüge verstanden werden dessen gemeinsamer normativer Kern beträchtlich kleiner geworden ist. (vgl. Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge 2002, S. 312) Familien unserer Zeit befindet sich im Umbruch und vielfach sind junge Familien auf sich alleine gestellt. Soziale Netze, wie die Großfamilie oder Nachbarschaft, die halfen Krisen abzufedern sind brüchig geworden. Deshalb sind viele Familien in kritischen Lebenslagen oft auf sich alleine gestellt, was flächendeckende, bedarfsgerechte Einrichtungen zur Unterstützung bei Problemsituationen erfordert. Besonders auch in der ersten Zeit nach der Geburt brauchen Mütter viel Unterstützung, Anerkennung und Entlastung bei der Betreuung des Kindes. (vgl. Institut für soziale Arbeit e.V. 2006, S. 24ff.)
3.3 Familie als Risiko oder Ressource
Die bedeutendste Funktion der Familie ist die Förderung und Stärkung ihrer Kinder durch liebevolle Fürsorgliche und Feinfühligkeit, eine Quelle an Ressourcen für einen heranwachsenden Menschen. Das Zusammenleben in einer Familie birgt aber auch Risiken in sich. Frühe Hilfen versuchen Eltern in ihrer individuellen Lebenslage zu stärken und gefährdete Familien mit Säuglingen und Kleinkindern möglichst früh zu erkennen, zu beraten und ggf. zu unterstützen, da eine gute Beziehungs- und Bindungsqualität einen bedeutsamen protektiven Faktor darstellt und Risikofaktoren kompensieren kann.
Für die psychische Gesundheit eines Kindes ist es wichtig, dass besonders in den ersten drei Lebensjahren eine kontinuierliche, intensive und innige Beziehung zu seiner Mutter oder einer Bezugsperson vorherrscht. Mutter und Kind haben das Bedürfnis sich mit den Gefühlen des Anderen zu identifizieren, das Empfinden des gebraucht Werdens und der gegenseitigen Freude füreinander. Dies ist allerdings nur in einer konstanten und dauerhaften Beziehung zu erreichen, die nur möglich wird, wenn eine Frau eine tiefe Befriedigung in der Erfüllung ihrer Mutterpflichten erlebt. Selbst Eltern, die ihren Pflichten nur schlecht nachkommen und ihr Kind vernachlässigen ermöglichen ihren Kindern meist eine günstigere Entwicklung als es eine Fremdunterbringung in einem Heim kann. (vgl. Bowlby 2005, S. 65ff.) Aufgrund dieses Wissens gilt für Helfer/innen aus Unterstützungssystemen als oberste Priorität Kinder bei ihren Eltern aufwachsen zu lassen. Deshalb ist es notwendig die Lebensbedingungen von Familien zu verbessern und sie bestmöglich in ihrem häuslichen Umfeld zu unterstützen.
„Weil ein Kind noch nicht fähig ist, ein selbständiges Leben zu führen, bedarf es einer besonderen sozialen Institution, um im während der Periode der Unreife behilflich zu sein. Diese soziale Institution muss ihm auf zweierlei Weise helfen: erstens bei der Befriedigung seiner unmittelbaren vitalen Bedürfnisse nach Nahrung Wärme und Behausung sowie Schutz vor Gefahr; zweitens durch eine Umwelt, die ihm ermöglicht, seine körperlichen, seelischen und sozialen Fähigkeiten so vollkommen zu entwickeln, dass es als Erwachsener in der Lage ist, sich in seine physische und soziale Umwelt sinnvoll einzuordnen. Dies erfordert eine Atmosphäre der Zuwendung und Sicherheit“ (Bowlby 2005, S. 71).
3.4 Sozialisationsphasen
Säuglingen ist es angeboren eine Beziehung zu ihren engsten Bezugspersonen zu entwickeln. Diese Eigenschaft sagt jedoch nichts über den weiteren Verlauf der Beziehung und deren Qualität aus. Vielmehr sind die Erfahrungen aus den Interaktionsbeziehungen mit der Mutter oder anderen Bezugspersonen für die soziale Entwicklung eines Kindes entscheidend. (vgl. Hopf 2003, S. 30f.) Bedeutende Vertreter der Soziologie, wie beispielsweise Talkott Parsons oder Uri Bronfenbrenner, unterstreichen die Rolle der Familie als die erste und wichtigste Sozialisationsinstanz, die Orientierung und Handlungsmuster vorgibt. (vgl. Zimmermann 2003, S. 85)
3.4.1 Primärsozialisation
Diese erste und wichtige Phase der Sozialisation wird auch als Primärsozialisation bezeichnet, die nahezu ausschließlich in der Primärgruppe Familie stattfindet. Ihr wird eine besonders nachhaltige Wirkung für die Persönlichkeit zugesprochen. Es wird von der Bildung einer Grundpersönlichkeit gesprochen, was bedeutet dass andere soziale Einflüsse nur mehr von untergeordneter Bedeutung sind. Diese Erkenntnisse stoßen besonders dann auf großes Interesse, wenn sich durch die Sozialisation in der frühen Kindheit negative Auswirkungen auf das gesellschaftliche Leben ergeben. So wird angenommen, dass sich eine autoritäre Persönlichkeit durch den Erziehungsstiel der Eltern bedingt wird, weil durch die Interaktionen mit den Bezugspersonen normative Erwartungen verinnerlicht werden. Identität entsteht also durch Identifikation mit anderen. Da Primärsozialisation in den meisten Fällen innerhalb der Familie mit nur einigen Personen passiert, identifizieren sich Kinder sozusagen automatisch mit ihren Eltern bzw. Bezugspersonen und übernehmen somit auch deren Werte und Normen. (vgl. Mühler 2008, 50ff.)
Aufgrund dieser Erkenntnisse ist es umso wichtiger, dass Eltern in der Schwangerschaft und der Betreuung ihrer Kinder in den ersten Lebensjahren unterstützt werden. Sie legen einen Grundstein für die weitere Entwicklung des Charakters und der Persönlichkeit ihrer Kinder, da sie als wichtigste Bezugspersonen Werte und Normvorstellungen quasi identisch an ihre Kinder weitergeben. Die beste Verhütung von Vernachlässigung und Misshandlung und in weiterer Folge die Weitergabe an die nächste Generation stellt somit die bestmögliche Unterstützung der Eltern auf wirtschaftlicher, sozialer und medizinischer Basis dar.
3.4.2 Sekundär- und Tertiärsozialisation
In der Phase der Sekundärsozialisation spielen vor allem Einrichtungen, wie Kindergärten, Schulen oder Tagesbetreuungsstätten eine wesentliche Rolle. In dieser Entwicklungsperiode werden vor allem Beziehungen zu Gleichaltrigen oder Gleichgesinnten intensiver und bedeutender. Immer bedeutender wird aber auch die Sozialisation durch Medien, vor allem durch das Internet.
Zu wichtigen Instanzen der Tertiärsozialisation zählen vor allem Bildungseinrichtungen, in weiterer Folge der Arbeitsplatz und nicht zuletzt Freunde und Lebenspartner.
Der Einfluss der Familie und die damit verbundene Sozialisierung nehmen in der Regel im Lauf der Sozialisationsphasen kontinuierlich ab, Peer-Groups nehmen an Bedeutung zu, das Leben wird zunehmend öffentlicher.
3.5 Sozialisationstheorien innerhalb der Familie
In diesem Abschnitt der Arbeit werden verschiedene Sozialisationstheorien beleuchtet, wobei die sozial-ökologische Sichtweise nach Bronfenbrenner (1981) besonders relevant im Kontext Früher Hilfen erscheint. Sie dient in einigen Projekten aus Deutschland als eine theoretische Grundlage, neben der Bindungstheorie.
3.5.1 Sozialpsychologische Modelle
Um das Zusammenleben und die Interaktionen in Familien beschreiben zu können wird mit Hilfe der Sozialpsychologie die Bedeutung des Zusammenlebens für die Beteiligten beschrieben. In weiterer Folge werden rationale Theorien und die Familienstresstheorie erörtert.
Rationale Theorien
Bei rationalen Familientheorien wird angenommen, dass Menschen nach rationalen Gesichtspunkten agieren. Entscheidungen werden vielfach nach folgenden Kriterien getroffen: Ist es wert ein Mitglied dieser Familie zu sein oder gibt es andere lohnende Alternativen? Welche Ressourcen stehen für eine Beziehung zur Verfügung? Es werden Vergleiche angestrebt, ob man in der Relation so viel zurück erhält wie man gibt. Anders ausgedrückt ist jede Handlung mit einer Nutzenerwartung verbunden – auch die Entscheidung Kinder zu zeugen wird mit einem Nutzen verknüpft. Nauck unterscheidet in drei verschiedene Kategorien der Erwartungen
- Ökonomischer Nutzen: Eltern erwarten sich Mithilfe im Haushalt oder elterlichen Betrieb und auch eine Unterstützung im Alter.
- Psychischer Nutzen: Eltern haben Freude daran ihre Kinder aufwachsen zu sehen und fühlen durch den Nachwuchs eine Stärkung der innerfamiliären Beziehung.
- Sozial-normativer-Nutzen: Eltern entscheiden sich für Kinder um einen Statusgewinn erzielen zu können. Sie erfahren Kompetenzgewinn in der Elternrolle und dadurch auch Anerkennung durch Dritte. Ebenso ist für diese Eltern die Weiterführung des Familiennamens sehr wichtig. (vgl. Zimmermann 2003, S. 91f.)
„Bei Eltern mit ökonomischen Nutzenvorstellungen ist ein höheres Ausmaß von Behütung und Kontrolle sowie eine stärkere Betonung on Gehorsam zu erwarten als beim Überwiegen von psychischen Nutzenvorstellungen. Umgekehrt werden Eltern, die vorwiegend expressive Beziehungen mit ihren Kindern anstreben, mehr Wert auf deren Selbständigkeit und Individualität legen. In interkulturell vergleichenden Studien zeigen sich deutliche Zusammenhänge zwischen Nutzenerwartungen und elterlichen Erziehungsstilen“ (Hofer/Klein-Allermann/Noack 1992, S. 23 zit. nach Zimmermann 2003, S. 92).
Mit dieser Theorie wird verdeutlicht, dass unterschiedliche Erwartungen der Eltern ihr Erziehungsverhalten und somit die Sozialisation des Kindes beeinflussen. Die Nutzungserwartungen sind aber nur ein Sozialisationsfaktor unter vielen anderen ist. Emotionale oder psychosoziale Aspekte kommen in dieser Theorie so gut wie gar nicht vor. (vgl. Zimmermann 2003, S. 92)
Familienstresstheorie
Diese Theorie untersucht, wie sich Krisen und belastende Ereignisse auf die Sozialisation innerhalb der Familie auswirken. Hierbei wird in normale und außergewöhnliche Stressoren unterschieden. Normaler Stress wird durch vorhersehbare Ereignisse, wie eine Heirat, Geburt oder den Schuleintritt, hervorgerufen. (vgl. Zimmermann 2003, S. 92f.) Solche Geschehnisse durch Übergänge in andere Lebensphasen werden auch Life-Events genannt.
Außergewöhnliche Vorkommnisse, wie eine schwere Erkrankung, der Tod einer nahe stehenden Person oder der plötzliche Arbeitsplatzverlust werden nicht nur als belastend , sondern auch als bedrohlich erlebt. Bewältigungsmuster und Copingstrategien hängen natürlich von persönlichen Ressourcen, wie dem Bildungsniveau, der finanziellen Situation und der Möglichkeit sich selbst Hilfe zu holen ab. Es spielen aber auch innere Ressourcen, wie der Umgang mit sich selbst und seiner Umwelt und Hilfsangebote durch Dritte, wie Nachbarn, Freunde oder Gesundheitseinrichtungen und soziale Organisationen eine wichtige Rolle. Grundsätzlich kann man allerdings sagen, dass Familien, die in ein soziales Bindungsgefüge eingebettet sind mit Problemen und Belastungssituationen umgehen. Die immer loseren Familiengefüge in den modernen Industriegesellschaften stellen für Kinder und Jugendliche enorme Risiken für ihre Persönlichkeitsentwicklung dar. (vgl. Zimmermann 2003, S. 92f.)
[...]
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2010
- ISBN (eBook)
- 9783842836167
- DOI
- 10.3239/9783842836167
- Dateigröße
- 3.3 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Johannes Kepler Universität Linz – Sozialwissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2012 (August)
- Note
- 1
- Schlagworte
- frühe hilfe prävention kooperation kinderschutz schwangerschaft
- Produktsicherheit
- Diplom.de