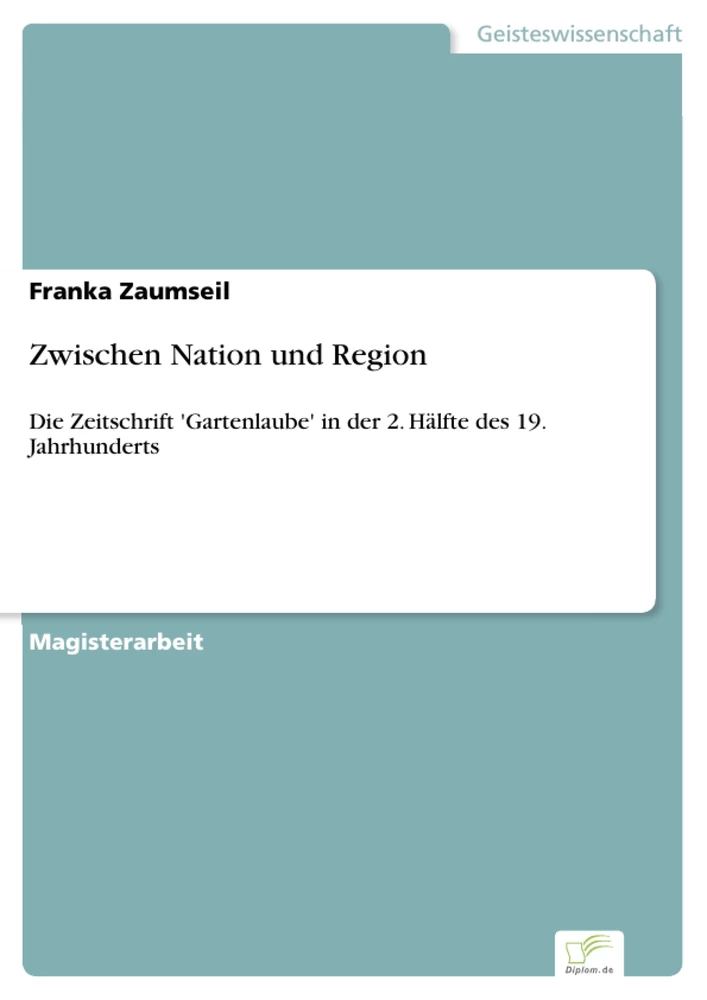Zwischen Nation und Region
Die Zeitschrift 'Gartenlaube' in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts
©2006
Magisterarbeit
102 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Zusammenfassung:
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der 1853 gegründeten Familienzeitschrift Die Gartenlaube. Mittels einer quantitativen Inhaltsanalyse von vier Jahrgängen (à 52 Ausgaben) im Zeitraum von fünfzig Jahren soll gezeigt werden, inwieweit bestimmte nationale, regionale und internationale Themen von den Medien des langen 19. Jahrhunderts, zumindest von der Gattung der unterhaltenden Presse, für die die Gartenlaube stellvertretend stehen soll, aufgegriffen, bearbeitet und an das lesende Publikum weiter- bzw. zurückgegeben wurden. Die Gartenlaube ist ein Spiegel für die Verhältnisse der damaligen Zeit, sie war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die auflagenstärkste Zeitschrift im deutschen Raum.
Die anvisierte Fragestellung dieser Arbeit lautete, wie der Wandel der Öffentlichkeit einhergehend mit dem sozialen Wandel in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts innerhalb der Gartenlaube abgebildet bzw. sich aus der Analyse der dort abgedruckten Beiträge nachvollziehen lässt. Zwar konzentrierte sich die Zeitschrift (naturgemäß) weniger auf die politischen Tagesereignisse, trotzdem kann man in den Aufsätzen der Gartenlaube [ ] das Gesicht einer ganzen Nation auch politischer Art wieder finden. Die Gartenlaube war ein Sprachrohr (Hermann Zang) des Bürgertums (wenn auch kein offizielles der liberalen Parteien) und zeigt, wie eben diese Schicht Lösungen bzw. Sinn konstruierte für ihre Handlungsaufgaben, speziell für eine Aufgabe: die Gründung einer deutschen Nation 1871. Nation und bürgerliche Gesellschaft waren im 19. Jahrhundert durch ein Spannungsverhältnis von integrativen und abgrenzenden, von vergemeinschaftenden und vergesellschaftenden Mechanismen bestimmt. Die hier durchgeführte Analyse hat gezeigt, dass die Abgrenzung nach außen (sei es durch Feind- oder Freundbilder) ein konstituierendes Element in der Repräsentation der inneren Einheit darstellte.
Um gegen Ende des 19. Jahrhunderts mit der Kälte und den Bedrohungen einer aus Sicht der Betroffenen - äußerst schwierig gewordenen Welt fertig zu werden, musste ein Ausgleich geschaffen werden. Durch Themen wie die Darstellung des von Fortschritt angeblich unberührt gebliebenen Landlebens sowie der Familie als Ort der Sicherheit und der Stabilität wurde Harmonie erzeugt als Pendant zu einem zunehmend ins Wanken geratenen, instabilen Lebensgefühl. Fazit: Die Gartenlaube war eine bürgerliche Familienzeitschrift, anfänglich liberal mit einem […]
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der 1853 gegründeten Familienzeitschrift Die Gartenlaube. Mittels einer quantitativen Inhaltsanalyse von vier Jahrgängen (à 52 Ausgaben) im Zeitraum von fünfzig Jahren soll gezeigt werden, inwieweit bestimmte nationale, regionale und internationale Themen von den Medien des langen 19. Jahrhunderts, zumindest von der Gattung der unterhaltenden Presse, für die die Gartenlaube stellvertretend stehen soll, aufgegriffen, bearbeitet und an das lesende Publikum weiter- bzw. zurückgegeben wurden. Die Gartenlaube ist ein Spiegel für die Verhältnisse der damaligen Zeit, sie war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die auflagenstärkste Zeitschrift im deutschen Raum.
Die anvisierte Fragestellung dieser Arbeit lautete, wie der Wandel der Öffentlichkeit einhergehend mit dem sozialen Wandel in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts innerhalb der Gartenlaube abgebildet bzw. sich aus der Analyse der dort abgedruckten Beiträge nachvollziehen lässt. Zwar konzentrierte sich die Zeitschrift (naturgemäß) weniger auf die politischen Tagesereignisse, trotzdem kann man in den Aufsätzen der Gartenlaube [ ] das Gesicht einer ganzen Nation auch politischer Art wieder finden. Die Gartenlaube war ein Sprachrohr (Hermann Zang) des Bürgertums (wenn auch kein offizielles der liberalen Parteien) und zeigt, wie eben diese Schicht Lösungen bzw. Sinn konstruierte für ihre Handlungsaufgaben, speziell für eine Aufgabe: die Gründung einer deutschen Nation 1871. Nation und bürgerliche Gesellschaft waren im 19. Jahrhundert durch ein Spannungsverhältnis von integrativen und abgrenzenden, von vergemeinschaftenden und vergesellschaftenden Mechanismen bestimmt. Die hier durchgeführte Analyse hat gezeigt, dass die Abgrenzung nach außen (sei es durch Feind- oder Freundbilder) ein konstituierendes Element in der Repräsentation der inneren Einheit darstellte.
Um gegen Ende des 19. Jahrhunderts mit der Kälte und den Bedrohungen einer aus Sicht der Betroffenen - äußerst schwierig gewordenen Welt fertig zu werden, musste ein Ausgleich geschaffen werden. Durch Themen wie die Darstellung des von Fortschritt angeblich unberührt gebliebenen Landlebens sowie der Familie als Ort der Sicherheit und der Stabilität wurde Harmonie erzeugt als Pendant zu einem zunehmend ins Wanken geratenen, instabilen Lebensgefühl. Fazit: Die Gartenlaube war eine bürgerliche Familienzeitschrift, anfänglich liberal mit einem […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Franka Zaumseil:
Zwischen Nation und Region - Die Zeitschrift 'Gartenlaube' in der
2. Hälfte des 19.
Jahrhunderts
ISBN: 978-3-8366-0501-4
Druck Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2007
Zugl. Universität Leipzig, Leipzig, Deutschland, Magisterarbeit, 2006
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2007
Printed in Germany
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
S. 3
I. Forschungsstand und Methode
S. 6
II. Theoretische Grundlagen
2.1.
Öffentlichkeit
und
Wandel
S. 9
2.2. Nationale Identität als sozial konstruiertes kollektives Bewusstsein
S. 14
2.3. Regionalismus als Gegen- oder Parallelphänomen zum Nationalismus
S. 20
2.4. Internationalisierung als Abgrenzung nach Außen
S. 23
III. Empirische Grundlagen
3.1. ,,Die Gartenlaube" als Massenmedium ihrer Zeit
S. 26
3.2.
Der soziopolitische Rahmen: Reichseinigungs- und Konsolidierungsbewegungen
S. 29
3.3. Der ideelle Rahmen: Staatsnation vs. Kulturnation
S. 31
IV. Die massenmediale Konstruktion von Öffentlichkeit im Prozess der Reichsgründung
4.1.
Konzeption
der
Inhaltsanalyse
S. 33
4.1.1.
Hypothesen
S. 36
4.1.2. Stichprobe und Operationalisierung
S. 38
4.2. Auswertung der Ergebnisse aus der Inhaltsanalyse
S. 42
4.2.1. Die Phase vor der Reichsgründung 1853-1871
S. 43
Zwischen Suchen und Finden die Kategorie ,,Nation"
S. 43
Die unbekannte Größe die Kategorien ,,Region/Lokal"
S. 52
Im Spiegel der Anderen die Kategorie ,,Internationalisierung"
S. 53
4.2.2. Die Phase nach der Reichsgründung 1872-1900
S. 56
Zwischen Für und Wider die Kategorie ,,Nation"
S. 57
Zwischen Urbanisierung und Agrarromantik die Kategorien
,,Region/Lokal"
S. 61
Zwischen Abgrenzung und Öffnung - die Kategorie
,,Internationalisierung"
S. 68
4.3. Fazit: Die ,,Gartenlaube" zwischen ,,deutscher Identität" und den ,,Anderen"
S.
72
V. Zusammenfassung
S. 77
Anhang
S. 80
Literaturverzeichnis
S. 94
3
Einleitung
Mit der Gründung des Deutschen Reiches am 18. Januar 1871 wurden für die deutschen
Bürger Schritte vollzogen, die jeden unmittelbar betrafen: im Zuge der Harmonisierung
der verschiedenen bundesstaatlichen Institutionen wurden neue gesetzliche Regelungen
festgelegt, eine gemeinsame deutsche Währung eingeführt sowie ein gemeinsames
Verkehrs- und Telekommunikationssystem etabliert.
Mit der Reichsgründung sollten aber nicht nur wirtschaftliche Transaktionen erleichtert
werden. Ein wichtiges Ziel der Gründer des Deutschen Reiches bestand darin, den
Partikularismus
1
und damit die Einzelinteressen der deutschen Bundesstaaten
zurückzudrängen und diesen durch einen Nationalismus
2
, d.h. eine starke Identifikation
mit der neu gegründeten Nation zu ersetzen. Damit sollte nicht nur das friedliche
Zusammenleben der deutschen Bürger in den unterschiedlichen Bundesstaaten gefördert
werden, sondern es ging auch darum, in dem System der etablierten Großmächte
endlich als geschlossene Einheit aufzutreten, als eine deutsche Nation. Von dem späten
aber umso heftiger betriebenem Griff nach der ,,Weltmacht" (Horst Gründer) erhoffte
man sich, erfolgreich in die europäische Staatenpolitik einzugreifen.
Zugleich sollte
dadurch die Bereitschaft im Inneren für die ,,deutsche Idee" (Friedrich Meinecke)
gestärkt und damit die negativen Konsequenzen partikularistischer Einstellungen
gemildert werden. Inwiefern diese Zielsetzungen, in den Köpfen der Deutschen die
Nation an die Stelle der Region(en) zu setzen, erfüllt wurden, gilt es in dieser Arbeit zu
hinterfragen.
Zwischen den Prozessen
3
der Nationalisierung und den Regionalismen lassen sich aber
auch erste staatliche Tendenzen der Internationalisierung erkennen: Prozesse der
Transnationalisierung
4
oder Globalisierung kommen wenn auch noch nicht unter
diesen Begriffen als dritte Strategie hinzu. Das ,,lange 19. Jahrhundert"
5
ist ein
1
Als Partikularismus (lat.: pars = Teil; Partikel = sehr kleines Teilchen) wird hier ein Zustand bezeichnet,
in dem innerhalb eines Ganzen stets der kleineren Einheit der Vorzug gegeben wird.
2
Nationalismus bezeichnet eine politische Ideologie, die auf eine Kongruenz zwischen einer (meist ethnisch
definierten) Nation und einem Staatsgebilde abzielt (Gellner, 1983). Das Nationalgefühl des Einzelnen gilt als
emotionale Bindung an die Idee der Nation, setzt aber nicht zwingend einen Staat voraus.
3
Diese Arbeit folgt den Regeln der neuen Rechtschreibung von 2004 mit ihrer Überarbeitung von 2006,
davon abweichende Schreibweisen sind den Regeln des Zitierens geschuldet.
4
Der Begriff zielt auf Beziehungen und Konstellationen, welche die nationalen Grenzen transzendieren.
Dies schließt auch die Geschichte der Außenpolitik und der internationalen Beziehungen mit ein, ist aber
nicht nur auf staatliche Institutionen beschränkt.
5
Darunter versteht man die Phase von 1789 bis 1914/1918. Charakteristisch für diese Epoche ist der Weg
in die Moderne, der sich im Fortschrittsdenken ebenso spiegelt wie in Säkularisierung und
4
Jahrhundert der Wandlungen auf allen Ebenen: Industrialisierung, technische
Revolution, Bevölkerungsexplosion
6
, Kolonialisierung das alles kumuliert in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. An dessen Ende ist die Welt durch Globalisierung
und Verflechtung in einer Art und Weise strukturiert, wie es erst lange nach den
Weltkriegen wieder erreicht werden wird.
Doch all diese Wandlungen hatten für den einzelnen Menschen innerhalb des Deutschen
Reiches auch negative Folgen, die mit der Reichsgründung zusammenfielen und das
unmittelbare tägliche Leben der Bürger betrafen. Innerhalb der sich industrialisierenden
Gesellschaften veränderten sich die Lebensweisen teilweise drastisch. Der soziale
Wandel zerstörte althergebrachte Verhaltens- und Denkweisen. Die Verkehrsrevolution
und die Suche nach Arbeit erhöhten die Mobilität. Die Städte wuchsen nicht nur in
quantitativer Hinsicht, sondern entwickelten sich mit der Urbanisierung auch qualitativ
weiter, indem sich eine spezifisch neuzeitliche städtische Lebensweise durchsetzte. Das
alles ging einher mit dem Zerfall von traditionellen (familiären) Strukturen und äußerte
sich in einer wachsenden Orientierungslosigkeit, in einer Unsicherheit und speziell
gegen Ende des 19. Jahrhunderts in einer Endzeit-Stimmung, auch bekannt als ennui
oder decadénce
7
.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Wandel der Öffentlichkeit in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Am Beispiel der 1853 gegründeten
Familienzeitschrift Die Gartenlaube soll gezeigt werden, inwieweit bestimmte
nationale, regionale und internationale Themen von den Medien, zumindest von der
Gattung der unterhaltenden Presse, für die die Gartenlaube stellvertretend stehen soll,
aufgegriffen, bearbeitet und an das lesende Publikum weiter- bzw. zurückgegeben
wurden. Die Gartenlaube ist ein ,,Spiegel" für die Verhältnisse der damaligen Zeit, sie
war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die auflagenstärkste Zeitschrift im
deutschen Raum
8
. Zwar konzentrierte sich die Zeitschrift (naturgemäß) weniger auf die
politischen Tagesereignisse, trotzdem kann man in ,,den Aufsätzen der Gartenlaube [...]
Rationalisierung, Nationenbildung, Liberalismus und konstitutioneller Staatsbildung. Vgl. Jürgen Kocka,
Das lange 19. Jahrhundert. Arbeit, Nation und bürgerliche Gesellschaft, Stuttgart 2002, S. 13ff.
6
In ganz Europa wuchs die Bevölkerung von 188 Millionen im Jahr 1800 auf 401 Millionen gegen Ende
des 19. Jahrhunderts an. Zu Zahlen für deutsche Gebiete vgl. Wilhelm Treue, Gesellschaft, Wirtschaft
und Technik Deutschlands im 19. Jahrhundert, München 1999, S. 10ff .
7
Vgl. Wolfgang Drost (Hg.), Fortschrittsglaube und Dekadenzbewusstsein im Europa des 19.
Jahrhunderts: Literatur Kunst Kulturgeschichte, Heidelberg 1986, S. 13ff.
8
Vgl. Eva-Annemarie Kirschstein, Die Familienzeitschrift Ihre Entwicklung und Bedeutung für die
deutsche Presse, Charlottenburg 1937, S. 77f.
5
das Gesicht einer ganzen Nation"
9
auch politischer Art wieder finden. Dabei darf
allerdings nicht außer Acht gelassen werden, dass die besonders in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts beobachtete rasante Entwicklung der Nachrichtentechnik, die
Urbanisierung und die damit zusammenhängende Expansion neuer Leserschichten, aber
auch die Entstehung politischer Parteien und die Formierung gesellschaftlicher
Interessengruppen in Vereinen und Verbänden, unübersehbar nicht nur zu einer
enormen quantitativen Ausweitung des öffentlichen Kommunikationsraumes, sondern
auch zu dessen Fragmentierung führte. Die Gartenlaube jedoch war kein regionales
Blatt, sie war ein ,,deutsches"
10
Blatt, welches sich an ,,deutsche" Leser richtete und
nicht etwa nur an ,,Sachsen" oder ,,Thüringer". Trotzdem oder gerade deswegen kann
eine Untersuchung dieser Zeitschrift aussagekräftige Ergebnisse über nationale wie
auch regionale Belange liefern, zumal der Großteil des Publikums aus dem
Bürgertum
11
, und hier speziell aus dem Bildungsbürgertum, stammte, der Schicht, die
von sich behauptete, maßgeblich an der Nationsbildung beteiligt gewesen zu sein.
Im Deutschland der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dominierte die Gartenlaube
uneingeschränkt. Die vorliegende Arbeit beschränkt sich daher bei der Analyse auf die
Zeit bis 1900. Es ist, nach dem Anlauf in den fünfziger und sechziger Jahren, die Zeit
der größten Wirksamkeit des Blattes. Es war eine Zeit, in der es zwar viele
Tageszeitungen und viele andere Zeitschriften, auch andere illustrierte Familienblätter
gab; Rundfunk, Film und Fernsehen waren aber noch nicht bekannt. Nicht zuletzt
daraus erklärt sich die ungewöhnlich große Verbreitung der Gartenlaube. Nach 1918,
mit dem Ende der Wilhelminischen Ära, reduzierte sich die Rolle des Blattes mehr und
mehr.
9
Herman Zang, Die "Gartenlaube" als politisches Organ: Belletristik, Bilderwerk u. literar. Kritik im
Dienste d. liberalen Politik 1860-1880, Coburg 1935, S. 5 Vorwort.
10
Rede Ernst Keils anlässlich der Auflagenzahl von über 100.000 zu Beginn des 1861er Jahrgangs. Zit. n.
Heinrich Proelß, Zur Geschichte der Gartenlaube, in: ,,Die Gartenlaube" (im Folgenden: Gl) 1902 , S.
132-137.
11
Auf die umfangreiche Forschung zum Thema Bürgertum und der zentralen Stellung desselben im
ausgehenden 18. und vor allem im 19. Jahrhundert kann hier nicht näher eingegangen werden. Um vor
allem das Bildungsbürgertum grob einzugrenzen soll im Folgenden darunter verstanden werden: ,,Der
Bürgerstand begreift zumeist alle Einwohner einer Stadt, welche weder zum Adel, noch zum Bauernstand
gerechnet werden können. [...] ,,Bildungsbürger", das meint [...] Leute, die ein akademisches Studium
absolviert und mit Prüfungen, dem Erwerb von ,,Bildungspatenten", abgeschlossen haben, auf Grund
dieser Tatsache ihren Beruf ausüben und ihr Einkommen beziehen. Demgegenüber ist die Klassenposition
[...], der Vermögensstand und wenigstens die Höhe des Einkommens [...] gleichgültig; freilich, das so
erzielte Einkommen ist gemeinhin auskömmlich, es ermöglicht einen Lebensstil oberhalb der
handarbeitenden Klassen [...]. Aber es ist nicht ein ökonomisches Interesse, sondern es ist die Bildung,
die die Gruppe konstituiert." Vgl. Thomas Nipperdey, Deutsche Geschichte 1866-1918, Bd.I. Arbeitswelt
und Bürgergeist, München 1994, S. 382ff., s. a. Werner Conze/Jürgen Kocka (Hg.), Bildungsbürgertum
im 19. Jahrhundert, 4 Bde., Stuttgart 1985-1992.
6
I. Forschungsstand und Methode
In der Forschung wurde der Wandel der Öffentlichkeit oder besser: der
Strukturwandel der Öffentlichkeit , der in der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert
verortet wird, umfassend analysiert. Eine der bedeutendsten Personen, die insbesondere
im Zusammenhang mit der Erforschung von Öffentlichkeit erwähnt werden muss, ist
Jürgen Habermas mit seiner Habilitationsschrift Strukturwandel der Öffentlichkeit.
Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft (1961). Ausgehend
vom Begriff der repräsentativen Öffentlichkeit beschreibt Habermas die Geschichte und
den Wandlungsprozess zu einer räsonierenden bürgerlichen Öffentlichkeit, welche als
das grundlegende Strukturelement einer jeden neuzeitlichen demokratischen Staatsform
angesehen wird. So streitbar ein Begriff von Öffentlichkeit in der zeitgenössischen
Diskussion auch ist, der Strukturwandel der Öffentlichkeit ist und bleibt das
grundlegende Werk zum Verständnis eben dieser (vgl. Kapitel 2.1. in dieser Arbeit).
Ausgehend von Habermas beschäftigen sich viele Werke mit dieser Theorie sowie mit
den Kommunikationsmedien, die in dieser Zeit entstehen oder sich verändern
12
. Als
Arbeit aus der jüngsten Zeit ist unter anderem der Sammelband von Bernd Sösemann
13
zu nennen. Darin betrachten er und andere Autoren das Feld der Öffentlichkeit in
Preußen im 19. Jahrhundert aus dem Blickwinkel unterschiedlicher Disziplinen
vorwiegend kommunikationsgeschichtlich mit Beiträgen über Lesegesellschaften,
Verleger, aber auch über Pressefreiheit und Meinungsmarkt. Werner Faulstich
14
gibt aus
mediengeschichtlicher Sicht einen Überblick über die Entwicklung der
Kommunikationsmedien, angefangen vom Buch über die Erfindung des Telefons bis
hin zur Litfaßsäule. Und auch Jürgen Schiewe
15
, ein Germanist, behandelt das Thema.
Er bietet eine umfassende Darstellung von Entstehung und Wandel der Öffentlichkeit
und beleuchtet sozial-, medien- und kommunikationsgeschichtliche Aspekte des
Themas.
Das Thema Medien und Öffentlichkeit fand ab den 1930er Jahren verstärktes Interesse
in den Zeitungswissenschaften (Publizistik). In dieser Zeit entstanden grundlegende
Arbeiten überwiegend zum Zeitungsmarkt und seinen Anfängen. Besonders
12
vgl. u.a. Lucian Hölscher, Jürgen Gerhards, Kurt Imhof, Jörg Requate
13
Bernd Sösemann (Hg.), Kommunikation und Medien in Preußen vom 16. bis zum 19. Jahrhundert,
Stuttgart 2002
14
Werner Faulstich, Medienwandel im Industrie- und Massenzeitalter (18301900), Göttingen 2004.
15
Jürgen Schiewe, Öffentlichkeit. Entstehung und Wandel in Deutschland, Paderborn 2004.
7
erwähnenswert sind die Arbeiten von Eva-Annemarie Kirschstein
16
, die die Rolle der
Familienzeitschrift innerhalb der Pressegeschichte des 19. Jahrhunderts im Allgemeinen
beschreibt oder das Werk von Karl-Heinz Wallraf
17
, der sich mit dem Bürgertum und
dessen Auseinandersetzung mit dem Adel und dem wachsenden Arbeiterstand
beschäftigt. Beide Arbeiten verwenden ebenso wie die vorliegende Arbeit auch Artikel
der Zeitschrift Die Gartenlaube als sozialgeschichtliche Quellengrundlage.
Zur Gartenlaube liegen bereits zahlreiche Forschungsarbeiten aus den
unterschiedlichsten Gebieten vor. So beschäftigt sich beispielsweise Heidemarie
Gruppe
18
mit dem Begriff des Volkes und seiner Funktion und weist nach, inwiefern die
Zeitschrift die Geschichte des ökonomischen und politischen Liberalismus
widerspiegelte. Die Politik war zuvor schon Thema einer anderen Arbeit, der Hermann
Zangs
19
; jedoch wenn auch oft zitiert sind in seinem Werk deutlich antisemitische
Tendenzen zu spüren; auch versucht er, der Zeitschrift eine antijüdische Gesinnung zu
unterstellen, die so zu bezweifeln ist. Als neuere Werke sind zudem noch die von
Kirsten Belgum
20
und von Marcus Koch
21
hervorzuheben. Beide beschäftigen sich
grundlegend mit den Themen, die auch dieser Arbeit als Schwerpunkt zugrunde gelegt
sind. Während Belgum die Zeitschrift als Quelle und Produzenten von mythischen
Erinnerungen darstellt, die ein neues Selbstbewusstsein der Deutschen zum Ziel haben,
fasst Koch verstärkt die Konstruktion der Nation als vielschichtigen und historischen
Prozess am Beispiel der Zeitschrift ins Auge.
Zusammenfassend ist den Forschungen zur Zeitschrift Die Gartenlaube gemeinsam,
dass sie die deutsche Nationsbildung im Zentrum der Betrachtung haben. Die damit
zusammenhängenden Konzepte der Region oder Internationalisierungstendenzen
werden aber nur am Rande betrachtet. In den meisten Kontroversen, die um die
Deutung des Kaiserreichs geführt werden, spielt z.B. das Verhältnis von Innen und
Außen kaum eine Rolle.
16
Eva-Annemarie Kirschstein 1937.
17
Karl-Heinz Wallraf (Diss.), Die ,,Bürgerliche Gesellschaft" im Spiegel deutscher Familienzeitschriften,
Köln 1940.
18
Heidemarie Gruppe, ,,Volk" zwischen Politik und Idylle in der ,,Gartenlaube" 1853-1914, Bern u.a.
1976.
19
Hermann Zang 1935.
20
Kirsten Belgum, Popularizing the nation: audience, reprensentation, and the production of identity in
Die Gartenlaube; 1853 1900, London 1998.
21
Marcus Koch, Nationale Identität im Prozess nationalstaatlicher Orientierung: dargestellt am Beispiel
Deutschlands durch die Analyse der Familienzeitschrift ,,Die Gartenlaube" von 1853 - 1890, Frankfurt a.
M.; u.a. 2003.
8
Für die im Verlauf der vorliegenden Arbeit gemachten Ausführungen zu
Internationalisierungstendenzen wurde überwiegend auf Michael Jeismanns
22
grundlegende Studie zu Feindschaft und Nationsbildung in Deutschland und Frankreich
und den Sammelband von Sebastian Conrad und Jürgen Osterhammel
23
zurückgegriffen. Letzterer versucht sowohl die Bedeutung des Kaiserreichs für die
Weltwirtschaft als auch die Bedeutung der Weltwirtschaft für das Kaiserreich
einzuschätzen und hinterfragt verschiedene Handlungsfelder auf Transnationalität.
Das Themenfeld Region haben vor allem Landeshistoriker aus den unterschiedlichsten
Blickwinkeln erkundet. Daran schließen sich Forschungen zu Regionalisierung
24
und
regionenbezogene Identifikationsprozesse
25
an, die auch mit Hinblick auf aktuelle
Prozesse innerhalb der EU diskutiert werden. Besonders zu erwähnen ist die Arbeit von
Siegfried Weichlein
26
, die sich umfangreich mit dem Themenkomplex beschäftigt. Er
untersucht die Nationsbildung des 19. Jahrhunderts im Rahmen von Mittelstaaten wie
Sachsen und Bayern und zeigt an ihnen, inwiefern ,,der Faktor Region"
27
neben der
neuen Nation bestehen blieb. Auch in dem kürzlich erschienenen Buch von Michael
Klein
28
wird dieses Thema aufgegriffen er macht jedoch die Selbstidentifikation der
Deutschen überwiegend an der Funktion von und dem Umgang mit Denkmälern fest.
Auf der Grundlage der hier genannten Werke baut die Konzeption der vorliegenden
Arbeit auf. Wegen ihrer großen Verbreitung im gewählten Zeitraum ist die Zeitschrift
Gartenlaube für eine Untersuchung des Wandels von Öffentlichkeit sowie der
gewählten Konzepte besonders geeignet. Ihre starke Popularisierung legitimiert zudem,
dass das gewählte Thema nur an einer Zeitschrift untersucht wird. Mittels einer
quantitativen Inhaltsanalyse von vier Jahrgängen (à 52 Ausgaben) im Zeitraum von
fünfzig Jahren soll gezeigt werden, welche Themen in welchem Umfang in der
Öffentlichkeit diskutiert, wann und warum Themen aufgegriffen und wann und warum
sie wieder fallengelassen wurden. Das Interesse der Menschen aus allen Teilen und
Schichten der Bevölkerung an der Zeitschrift zieht die Frage nach der Funktion
22
Michael Jeismann, Das Vaterland der Feinde. Studien zum nationalen Feindbegriff und
Selbstverständnis in Deutschland und Frankreich 1792-1918, Stuttgart 1992.
23
Sebastian Conrad/Jürgen Osterhammel (Hg.), Das Kaiserreich transnational. Deutschland in der Welt
1871-1914, Göttingen 2004.
24
Vgl. u. a. Hannes Siegrist/Manuel Schramm.
25
Vgl. u. a. Kurt Mühler/Karl-Dieter Opp.
26
Siegfried Weichlein, Nation und Region. Integrationsprozesse im Bismarckreich, Düsseldorf 2004.
27
Ebd. S. 184.
28
Michael Klein, Zwischen Reich und Region. Identitätsstrukturen im Deutschen Kaiserreich (1871-
1918), Stuttgart 2005.
9
derselben im deutschen Nationsbildungsprozess nach sich, kann aber hier nur peripher
betrachtet werden. Ebenso ließen die Ergebnisse Rückschlüsse auf das (Bildungs-)
Bürgertum zu, welches als relevante gesellschaftliche Gruppe im Zusammenhang mit
der Nationsbildung identifiziert wird. Der Grund dafür liegt in der besonderen
Bedeutung des Bildungsbürgertums als tragende Schicht des Kaiserreichs. Es stellte
,,den größten Teil der Machteliten"
29
im gesamten administrativen System des Reiches
und besetzte ebenso die hoch spezialisierten ,,freien Berufe", wie etwa im Rechtswesen
und auch im Journalismus. Somit lagen sowohl die öffentliche Deutungsmacht von
Kultur als auch deren Vermittlung in der Hand des Bildungsbürgertums doch auch
diese Rolle kann nur am Rande betrachtet werden.
II. Theoretische Grundlagen
2.1. Öffentlichkeit und Wandel
Aufgrund der Komplexität des Begriffes Öffentlichkeit ist zunächst eine kurze
begriffshistorische Betrachtung hilfreich, da ein historisch-politisches Phänomen immer
nur in Bezug auf eine bestimmte Zeit oder Epoche zu deuten ist und sich erst durch die
begriffshistorische Analyse die Bedeutungsvielfalt nachvollziehen lässt. Begonnen
werden soll mit einem Zitat aus dem Jahre 1793: ,,Das einzige, was mich irre macht, ist
der unlängbar weite Abstand, in welchem wir hinter den Ländern mit großen
Hauptstädten zurückgeblieben sind, [...] schon haben wir siebentausend Schriftsteller,
und dessen ungeachtet, wie es keinen deutschen Gemeingeist giebt, so giebt es auch
keine deutsche öffentliche Meynung. Selbst diese Wörter sind uns so neu, so fremd, daß
jedermann Erläuterungen und Definitionen fordert, indeß kein Engländer den anderen
mißversteht, wenn vom public spirit, kein Franzose den andern, wenn von opinion
publique die Rede ist."
30
Anhand diesen Zitats von Johann Georg Adam Forster wird
deutlich, wie diffus bzw. wenig greifbar das Verständnis vom Konzept der
Öffentlichkeit und der öffentlichen Meinung gewesen ist. Dieses Verständnisproblem
zieht sich bis in die heutige Zeit. Gleichzeitig zeigt das Zitat von Forster aber auch, wie
Öffentlichkeit bzw. die öffentliche Meinung in den deutschen Staaten ,,entstanden" ist
29
Hans-Ulrich Wehler, Deutsches Bildungsbürgertum in vergleichender Perspektive Elemente eines
,,Sonderwegs"?, in: Kocka, Jürgen (Hg.), Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert. Teil IV.: Politischer
Einfluß und gesellschaftliche Formation, Stuttgart 1989, S. 215-37, hier S. 217.
30
Georg Forster, Ueber die öffentliche Meinung. (Fragment eines Briefes.) 1793, in: Jürgen Schiewe,
Entstehung und Wandel der Öffentlichkeit in Deutschland. Kurseinheit 4: Texte zur Geschichte der
Öffentlichkeit in Deutschland. Teil 2: 18. Jahrhundert, Hagen 2003, S. 158-159.
10
zum einen mit Verspätung und zum anderen in der Übernahme des Begriffes aus den
benachbarten Gesellschaften und dem Auffüllen mit deutschen Inhalten.
Begriffsgeschichtlich ,,existiert" Öffentlichkeit erst seit dem 17. Jahrhundert, jedoch
ohne dass sich eine als allgemein verbindlich akzeptierte Definition findet. Lucian
Hölscher weist nach, dass sich der Begriff ,,Öffentlichkeit" aus dem Attribut
,,öffentlich" ableitet, welches seit Ende des 17. Jahrhunderts in der Bedeutung
,,staatlich" mit dem lateinischen ,,publicus" synonym verwendet wird
31
. Eine ähnliche
Bedeutung erfährt das Wort in der Abgrenzung zum Privaten oder Geheimen
(Arkanpolitik). Dabei weist das Wort ,,öffentlich" immer auf die Repräsentation von
staatlicher Gewalt hin. Die Äußerungen der Volksmeinung hatten keine
,,herrschaftslegitimierende Bedeutung"
32
, weil ihnen der Vernunftsaspekt abgesprochen
wurde. Carl Hoffmann bezeichnet diese Äußerungen als ,,unqualifizierte öffentliche
Meinung"
33
;
der vormodernen Öffentlichkeit habe ein ,,einseitiges
Kommunikationsmodell" zugrunde gelegen.
Hier ist auch Immanuel Kants Schrift
Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? (1784) zu nennen, die unter anderem
auch Äußerungen zur ,,Öffentlichkeit" bzw. zur ,,öffentlichen Meinung" beinhaltet.
Kant verweist darin auf eine öffentliche Sphäre, in der durch die Befreiung ,,aus der
selbstverschuldeten Unmündigkeit [...]der öffentliche Gebrauch seiner Vernunft [...]
jederzeit frei sein"
34
soll. Zwar bezog sich Kant hier ausschließlich auf die
Schriftgelehrten, diese sollten jedoch alle Teile der Gesellschaft lehren, sich ebenfalls
ihrer Vernunft zu bedienen. Kant versteht jedoch unter ,,öffentlich" ein räsonierendes
Publikum, welches über sich selbst als Lesepublikum reflektiert; die Sphäre der
staatlichen Gewalt aus seinem Räsonnement aber (noch) ausklammert.
Im Gegenzug hierzu kommen im Laufe des 18. Jahrhunderts in England und Frankreich
zusammengesetzte Begriffe wie das bereits erwähnte ,,opinion publique" auf, die dem
kollektiven Urteil der aufgeklärten bürgerlichen Gesellschaft zu Gegenständen der
Moral, der Ästhetik, schließlich auch der Politik ein bisher unbekanntes Gewicht
zuschreiben. In den deutschen Staaten wurde das englische bzw. französische ,,public"
31
Vgl. Lucian Hölscher, Öffentlichkeit, in: Otto Brunner; Werner Conze; Reinhart Koselleck (Hg.),
Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Bd.4.,
Stuttgart 1978, S. 413-467 sowie Ders., Öffentlichkeit, in: Joachim Ritter u.a. (Hg.), Historisches
Wörterbuch der Philosophie, Bd.6., Basel 1984, S.1134-1140.
32
Carl A. Hoffmann, Öffentlichkeit und Kommunikation in den Forschungen zur Vormodern. Eine
Skizze, in: Ders., Rolf Kießling (Hg.), Kommunikation und Region, Konstanz 2001, S. 69-110, hier S. 76.
33
Ebd.
34
Immanuel Kant, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? in: DigBib.Org: Die freie digitale
Bibliothek, unter:
http://www.digbib.org/Immanuel_Kant_1724/Was_ist_Aufklaerung
(10.10.2006).
11
schon um die Mitte des 18. Jahrhunderts eingedeutscht. Dennoch ging das Wort erst um
die Jahrhundertwende in den Sprachgebrauch der gebildeten Stände ein, wo es nach den
Befreiungskriegen von 1813 schnell zum Schlagwort des politischen Liberalismus
35
avancierte.
Für das 19. Jahrhundert war damit ein Strukturwandel vollzogen: das nun als ,,mündig"
postulierte bürgerliche Publikum drängte zur aktiven Teilhabe am öffentlichen Leben
des Staates. Zeitungen sorgten im Wesentlichen und ganz verstärkt für den Prozess der
Meinungsbildung; Carl Hoffmann spricht in diesem Zusammenhang von einem
,,wechselseitige[n] Kommunikationsmodell"
36
. Doch bereits in der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts, noch vor der bürgerlichen Revolution von 1848, gerät das eben erst in
Grundrechtscharten
37
gefeierte Potenzial von Öffentlichkeit in Misskredit. 1819 sehen
sich die Minister zehn deutscher Regierungen in Karlsbad gezwungen, die Zensur im
neuen ,,Preßgesetz" wieder einzuführen (Karlsbader Beschlüsse). Im Entwurf dazu heißt
es: ,,In einem Staatenbunde, wie der, welcher in Deutschland unter der Sanction aller
Europäischen Mächte gestiftet worden ist, fehlen, seiner Natur nach, jene mächtigen
Gegengewichte, die in geschlossenen Monarchien die öffentliche Ordnung gegen die
Angriffe vermessener oder übelgesinnter Schriftsteller schützen"
38
. Die Verbindung des
Attributs ,,öffentlich" mit dem Nomen ,,Ordnung" zeigt, dass auf den
Ministerkonferenzen die Bedeutung von ,,öffentlich" als das ,,Politische oder das, was
den Staat, das Gemeinwesen angeht"
39
gehandelt wurde. Dieser Bereich sollte vor den
Übergriffen der Bürger geschützt werden, die ,,öffentlich" unter der Bedeutung dessen,
,,was alle einzelne Bürger, alle Theilnehmer des Societas oder Genossenschaft, angeht,
was ihnen Allen gemeinschaftlich ist als Gut und Recht, oder als Last und Pflicht"
40
verstanden haben wollten. Hier prallten zwei Bedeutungen unmittelbar aufeinander,
35
Zentrale politische Forderung des Liberalismus ist die nach Grundrechten als institutionalisierter Form
der Menschenrechte. Diese sind vom Staat zu garantieren und haben Vorrang auch vor demokratisch
herbeigeführten Entscheidungen. Forderungen des deutschen Liberalismus 1848 waren: Verfassungen,
Liberalisierung des Handels durch Beseitigung der Zollschranken und demokratische Rechte für das
Volk. Zugleich traten sie für die Einigung der Staaten des deutschen Bundes in einem gesamtdeutschen
Nationalstaat ein. Zu den liberalen Parteien vgl. u.a. Karl Erich Born 1999, S. 27ff.
36
Carl A. Hoffmann 2001, S. 76.
37
Gemeint ist hier Artikel XVIII. der Deutschen Bundesakte von 1815, der die Zensur abschafft.
38
Die Karlsbader Beschlüsse 1819, In: Protokolle der deutschen Bundesversammlung. Achter Band.
Drittes Heft. Frankfurt am Main 1819, in: Jürgen Schiewe 2003, S. 221-243 hier S. 230f.
39
Carl Theodor Welcker, Oeffentlichkeit; Oeffentlichkeit der Gesetzgebung, der Regierung, der
Ständeverhandlung und der Verwaltung; Oeffentlichkeit des Civil- und Criminalprocesses. Oeffentliche
Meinung und Zeitgeist und deren staatsrechtliche Theorie, Staatscontrole, System der öffentlichen und
der Geheimregierung. In: Staats-Lexikon oder Encyklopädie der Staatswissenschaften in Verbindung mit
vielen der angesehensten Publicisten Deutschlands Hg. Von Carl von Rotteck und Carl Welcker. Zwölfter
Band. Altona 1841, in: Jürgen Schiewe 2003, S. 269-306, hier S. 272f.
40
Ebd.
12
deren Erklärung so in Theodor Welckers 1841 erschienenem Staats-Lexikon zu finden
ist. Er führt weiter aus, dass die Verbindung beider Bedeutungen ,,in einem und
demselben Worte" auf ,, zwei große Wahrheiten" hindeute. Zum einen wäre da die
Auffassung, ,,daß alle Angelegenheiten des vaterländischen Gemeinwesens alle Bürger
angehen",
zum anderen der daraus folgende Schluss,
,,daß alle diese
gemeinschaftlichen oder politischen Angelegenheiten [...] nicht geheim für sie selbst
bleiben dürfen, daß sie vielmehr auch in diesem Sinne als Sachen des Populus oder
nationalen Publicums be- und verhandelt, daß sie also so öffentlich, als es der Natur
der Sache nach thunlich ist, vorgenommen"
41
. Diese Definition verdeutlicht den
vielfach beschworenen ,,Strukturwandel der Öffentlichkeit"
42
, den Jürgen Habermas
unter diesem Titel als erstes konzeptionell ausführt. Die bürgerliche Gesellschaft ist für
ihn auch als eine Öffentlichkeit zu verstehen, die sich am Maßstab des vernünftigen
Gesprächs zwischen grundsätzlich allen Bürgern orientiert und politische
Entscheidungen nur dann als gerechtfertigt ansieht, wenn sie in einem Konsens
begründet werden können. ,,Die bürgerliche Öffentlichkeit entfaltet sich im
Spannungsfeld zwischen Staat und Gesellschaft, aber so, daß sie selbst Teil des privaten
Bereiches bleibt."
43
Doch mit der Märzrevolution 1848 und der erneuten prinzipiellen
Abschaffung der Pressezensur vollzog sich ein weiterer Wandel, der der Zeitung als
öffentlichkeitskonstituierendes Medium von der auslandsorientierten Nachrichten-
presse zur inlandsorientierten Meinungs- und Parteipresse, zur ,,Gesinnungspresse"
(Emil Dovifat). Zusammenhänge wurden nun nicht mehr verschwiegen und Wahrheiten
nicht mehr unterdrückt - Hans-Ulrich Wehler spricht von einer ,,unaufhaltsamen
Kommerzialisierung der Medien"
44
. Durch diesen Umstand wurden nicht nur bestimmte
Schichten zu ,,Begründern und Beherrschern von Kommunikationsräumen"
45
, bald
traten als solche auch bestimmte Institutionen und Funktionsträger auf. Diese
Kommunikationsräume wurden mehr und mehr von einem Forum zur Findung und
Verbreitung der ,,öffentlichen Meinung" zu einem Ort der ,,veröffentlichten Meinung",
die lediglich konsumiert, nicht aber mitbestimmt werden konnte. Laut Habermas wurde
die politisch fungierende Öffentlichkeit im ausgehenden 19. Jahrhundert zunehmend
konstitutionalisiert und mit den Interessen der bürgerlichen Gesellschaft tendenziell
41
Carl Theodor Welcker, in: Jürgen Schiewe 2003, S. 269-306, hier S. 272f.
42
Jürgen Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit: Untersuchungen zu einer Kategorie der
bürgerlichen Gesellschaft, Frankfurt a.M. 1962.
43
Jürgen Habermas 1962, S.172 Einleitung zu §16.
44
Hans-Ulrich Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Bd. 2, Von der Reformära bis zur industriellen
und politischen ,,Deutschen Doppelrevolution" 1815-1845/49, München 1987, S. 521.
45
Jürgen Schiewe, Öffentlichkeit. Entstehung und Wandel in Deutschland, 2004, S. 14.
13
gleichgeschaltet. Öffentliche Kompetenzen wurden auf private Körperschaften
übertragen. So vollzog sich ein struktureller Wandel des Verhältnisses von öffentlicher
Sphäre und privatem Bereich der Staat wurde vergesellschaftlicht, die Gesellschaft
verstaatlicht. Auf diese Weise löste sich allmählich das Modell der ,,bürgerlichen
Öffentlichkeit" mit seiner strikten Trennung zwischen ,,Öffentlichkeit" und ,,Privatem"
auf. Habermas führt weiter aus: ,,Der Prozeß des politisch relevanten Machtvollzugs
und Machtausgleichs spielt sich direkt zwischen den privaten Verwaltungen, den
Verbänden, den Parteien und der öffentlichen Verwaltung ab; das Publikum als solches
wird in diesen Kreislauf der Macht sporadisch und auch dann nur zu Zwecken der
Akklamation einbezogen."
46
Dieser Funktionswandel der politischen Öffentlichkeit
führte ,,zu einer Verschränkung von Staat und Gesellschaft, die der Öffentlichkeit ihre
alte Basis entzog, ohne ihr eine neue zu geben"
47
, d.h. eine Rationalisierung jener
Prozesse des Machtvollzugs und Machtausgleichs kann vom Publikum kaum noch
gewährleistet werden. Das Ergebnis: jene Öffentlichkeit, die einst zwischen Staat und
Gesellschaft vermittelte, wird nun missbraucht: ,,Inzwischen ermöglicht sie [die
Publizität, Anm. d. V.] die eigentümliche Ambivalenz einer Herrschaft über die
Herrschaft der nichtöffentlichen Meinung: Sie dient der Manipulation des Publikums in
gleichem Maße wie der Legitimation vor ihm."
48
Ein wesentlicher Faktor beim politischen Funktionswandels der ,,Öffentlichkeit" spielte
dabei die Professionalisierung (und Institutionalisierung) des Journalismus, der Wandel
von einem Produkt schriftstellernder Privatleute hin zu einer massenmedialen (und
manipulierbaren) Dienstleistung. Werner Faulstich spricht hierbei von ,,zwei
gegenläufigen Tendenzen: einerseits als Ausdifferenzierung, andererseits als
Konsolidierung"
49
, womit er die Entwicklung hin zu (zeitungsfundiert) verschiedenen
Teilöffentlichkeiten meint, die in ihrer Gesamtheit zur ,,vierten Gewalt"
50
im demo-
kratischen Staat avancieren, zu einer Maschinerie, die Öffentlichkeit unentwegt und
professionell produziert.
Auch Die Gartenlaube ist Ausdruck einer solchen Entwicklung. In einem Artikel von
1873 über die Weltausstellung in Wien beschreibt die Zeitschrift einen deutschen
Pavillon, der von der Zeitung Freie Presse ausgestattet wurde und den Besuchern
46
Jürgen Habermas 1962, S. 212.
47
Ebd., S. 213.
48
Ebd., S. 213 Hervorhebungen wie im Original.
49
Werner Faulstich 2004, S. 28f.
50
Vgl. Andreas Schulz, Der Aufstieg der ,,vierten Gewalt". Medien, Politik und Öffentlichkeit im
Zeitalter des Massenkommunikation, in: Historische Zeitschrift 270, 2000, S. 65 97.
14
veranschaulichen soll, ,,[w]ie eine große Zeitung hergestellt wird"
51
. Diesem Artikel
fügt der Herausgeber, Ernst Keil, einen Nachsatz hinzu, der verallgemeinernd wohl
auch für seine Zeitschrift gelten soll: ,,Er [der Pavillon, Anm. d. V.] wird Jenen, denen
auch heute noch die Presse zu schnell im Urtheil, zu wenig genau im Detail ist, die
Ueberzeugung beibringen, daß die Journalistik nur deshalb eine solche Macht, ein
solch imponirender Factor des öffentlichen Lebens geworden, weil sie mit der
Plötzlichkeit der Inspiration arbeitet; jene aber, [...] werden durch den Augenschein
erfahren, daß unsere größte Kunst nicht darin besteht, Alles, was wir erfahren, zu
bringen, sondern in dem sicheren Geschmack, der uns aus der Ueberfülle der uns
zugehenden Nachrichten, ohne lange zu wählen, stets das Wichtigste aufgreifen, das
Gleichgültige [...] aber bei Seite schieben läßt. Unermüdlich, treffsicher, Alles
beachtend so soll eine große Zeitung sein". Dieser Nachsatz soll bei den Lesern der
Gartenlaube sicherlich um Seriösität und Vertrauen werben. Die Gartenlaube selbst
sieht sich ebenfalls als ,,große" Zeitschrift
52
doch dieser Nachsatz zeigt auch ganz
eindeutig, was die ,,Journalistik" zu diesem Zeitpunkt bereits ist ein ,,Gatekeeper",
eine Kontrollinstitution, und eine Macht des öffentlichen Lebens.
Im weiteren Verlauf wird sich diese Macht immer wieder neu verteilen, einhergehend
mit dem Wandel der Medien insgesamt. So steigt beispielsweise die Zahl der
gesellschaftlich relevanten Einzelmedien im 19. Jahrhundert von 12 auf 16 an
53
(neu
waren z.B. elektronische Medien wie Telefon, Film, Schallplatte), was im Folgenden
,,zu Ausdifferenzierung, Kapitalisierung und Konzernbildung verbunden mit
Industrialisierung und Ökonomisierung" führte. Davon ist gegen Ende des 19.
Jahrhunderts auch Die Gartenlaube betroffen.
54
2.2. Nationale Identität als sozial konstruiertes kollektives Bewusstsein
Ebenfalls wie der Begriff der Öffentlichkeit ist auch der Begriff der Nation ein sehr
komplexer. Der Begriff Nation (über franz. nation aus lat. natio ,,Geburt; Herkunft;
Volk(sstamm)") bezeichnet begrifflich eine Abstammungsgemeinschaft, wird jedoch
zumeist für eine durch gemeinsame Traditionen, Sitten oder Gebräuche definierte
51
So lautet der Titel des Artikels, Gl 1873, S. 214-215.
52
Zu diesem Zeitpunkt hat "Die Gartenlaube" eine Auflagenhöhe von mehr als 310.000 Exemplaren.
Ihren Höhepunkt erreichte sie 1875 mit 382.000 Ausgaben. In: Eva-Annemarie Kirschstein 1937, S. 77f.
53
Werner Faulstich 2004, S. 256ff.
54
Vgl. u.a. Heidemarie Gruppe 1976, S. 13.
15
Gruppe von Personen mit Anspruch auf staatliche Souveränität verwendet.
55
Lange Zeit
waren mit natio nur diejenigen gemeint, die im status politicus standen, also eine
Beziehung zur Krone oder Geistlichkeit besaßen.
Erst im 18. Jahrhundert in Folge der Französischen Revolution und durch zunehmende
(globale) Mobilität begünstigt, entfaltete die Idee der Nation eine hohe Dynamik, die
anfangs gegen Feudalismus und Autokratie (Frankreich, Deutschland), gegen
wirtschaftlich und politisch einengende Kleinstaaterei (Deutschland bzw. deutscher
Sprachraum) oder aber gegen imperiale Herrschaft (Russland, Donaumonarchie)
gerichtet war. In dieser Zeit wandelt sich der Begriff der Nation und spaltet sich in zwei
unterschiedliche Konzepte auf: das der Staatsnation als Homogenität des Staatswillens
einerseits und das der Kulturnation als Homogenität von Sprache und Tradition
andererseits. Beide Konzepte werden in Kapitel 3.3. der vorliegenden Arbeit
ausführlicher diskutiert.
Wichtig im Zusammenhang mit dem Begriff der Nation ist die Unterscheidung zum
Begriff des Volkes. Beide Begriffe werden heute wie damals häufig synonym
verwendet, darauf weist auch Heidemarie Gruppe hin. Sie stellt fest, dass erst ab 1837
beide Begriffe in die Lexika aufgenommen worden seien, wobei der Begriff der Nation
ausführlicher erklärt werde als der des Volkes
56
. Dies läge womöglich an der Tatsache,
dass die Nation im europäischen Ausland seit der Französischen Revolution zum
Schlüsselbegriff für die Bezeichnung eines staatspolitischen Gebildes geworden ist. Erst
ab 1880 erfolge in den Lexika eine strikte Trennung beider Begriffe. So setzt z.B. auch
Meyers Konversationslexikon von 1889 den Begriff der Nation nicht mit dem Begriff
Volk gleich. Nation wird hier bezeichnet als ,,Kulturbegriff", Volk hingegen als
,,Staatsbegriff"
57
. Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass ,,nach englischem und
französischem Sprachgebrauch der Ausdruck N. gerade umgekehrt das Staatsvolk (die
sogen. politische Nationalität) bezeichnet, während für die N. im deutschen Sinn des
Wortes, für das Naturvolk (die sogen. natürliche Nationalität), die Worte Peuple
(franz.) und People (engl.) gebräuchlich sind." Darüber hinaus ist in Meyers
Konversationslexikon auch die Rede von einem Bewusstsein, das dem Begriff der
55
Vgl. ,,Nation" In: Sills, David L. (Hg.): International encyclopedia of the social sciences. New York
1968-1979, Bd. 11 S. 7-14, hier S. 7 sowie Reinhart Koselleck , Volk, Nation , in: ders.; Otto Brunner;
Werner Conze (Hg.), Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch- sozialen Sprache
in Deutschland, Bd.7., Stuttgart 1992, S. 142-431.
56
Heidemarie Gruppe 1976, S. 22.
57
Vgl. ,,Nation" in: Meyers Konversationslexikon 1889 unter:
http://susi.e-technik.uni-
ulm.de:8080/Meyers2/seite/werk/meyers/band/12/seite/0002/meyers_b12_s0002.html
(10.10.2006).
16
Nation zugrunde liegt: das ,,Bewußtsein der gemeinsamen Abstammung und das
Bewußtsein der Zusammengehörigen überhaupt: das Nationalgefühl." Dieses Gefühl,
so heißt es dort weiter, sei ein distinktives Element, welches die Mitglieder einer Nation
dazu veranlasse, ,,auf die Erhaltung ihrer nationalen Eigentümlichkeiten bedacht" zu
sein, da diese ,,die Stammesgenossen am engsten verbindet".
Hier geht es um das
Bewusstwerden dessen, was der Nation, der man angehört, eigen ist: um nationale
Identität als sozial konstruiertes kollektives Bewusstsein, um Nationalismus.
Im sozialwissenschaftlichen Kontext wird der Begriff der Nation in sehr
unterschiedlicher Weise verwendet, so z. B. als auf primordialen Bindungen beruhende
Gruppe (vgl. Clifford Geertz), als historisch kontingentes Konzept (vgl. Rogers
Brubaker), als Kombination vorstehender Begriffe (vgl. Anthony D. Smith) oder auch
als Produkt der Krise (vgl. Heinrich August Winkler). Es werden im Folgenden aus der
Vielzahl der Konzepte zwei herausgegriffen, die dabei keinen Anspruch auf
Vollständigkeit erheben und nur einen Teil des Raumes aufzeigen, innerhalb dessen
sich die Vorstellung einer deutschen Nation und einer deutschen Identität bewegt.
Benedict Anderson stellt in seinem 1983 erschienenen Werk Die Erfindung der Nation
58
selbige als Konstruktion und als kollektives Bewusstsein dar.
Er geht von der
vorindustriellen Gesellschaft aus, in der es einen Gelehrtenstand gab, der über eine
,,heilige" Schriftsprache verfügte, die nicht identisch war mit der Alltagssprache der
restlichen Bevölkerung des jeweiligen Gebietes (im deutschen Raum ist diese im
Mittelalter das Lateinische). Somit hatte dieser Stand als einzige Gruppe Zugang zur
,,Wahrheit". Diese Schriftgelehrten hielten als Teil der Macht eine Monopolstellung
59
,
deswegen konnte, Anderson zufolge, ihrerseits kein Interesse daran bestehen, eine
kulturelle Homogenität der übrigen Bevölkerung zu fördern. Die Erfindung des
Buchdrucks im 15. Jahrhundert im Zusammenhang mit marktwirtschaftlichen
Gesetzmäßigkeiten (,,kapitalistischen Beweggründen"
60
) jedoch setzte grundlegende
Veränderungen in Gang als eines der ersten von ,,drei grundlegende[n] kulturelle[n]
Modelle[n]", die ,,ihren langen axiomatischen Zugriff auf das Denken der Menschen"
61
verlieren sollen. Immer mehr Werke wurden in den unterschiedlichen Landessprachen
58
Der Originaltitel von Andersons "Erfindung der Nation" lautet: "Imagined Communities: Reflections
on the Origin and Spread of Nationalism." Beim ersten Erscheinen der deutschen Ausgabe 1988 wurde
Anderson vorgeworfen, dass seine Perspektive außereuropäisch und kulturanthropologisch sei. Er löste
damit Debatten aus, die bis heute nicht abgeschlossen sind.
59
Benedict Anderson 1998, S. 22.
60
Ebd., S. 45.
61
Ebd., S. 37.
17
geschrieben und standen somit einem vergleichsweise größeren Leserkreis zur
Verfügung. Dazu, so Anderson, kamen geographische und naturwissenschaftliche
Entdeckungen, die zu einem Wandel des Weltbildes führten. Der Mensch an der
Schwelle zur Neuzeit habe seinen Ursprung und den der Welt nicht länger als identisch
begriffen und durch z.B. die Entdeckung und Besiedlung Amerikas die Parallelität
verschiedener Kulturen erkannt.
62
Buchdruck und Zeitungswesen ermöglichten es nun,
dass historische Erfahrungen (wie z.B. die Amerikanische Unabhängigkeitserklärung
1776, oder die Französische Revolution 1789 und ihre Auswirkungen für die
Entwicklung in Europa) zu Modellen werden konnten, an denen sich später andere
Gesellschaften orientierten, was wiederum die ,,Richtigkeit" dieser Modelle zu
bestätigen schien wobei regelmäßig bestimmte Details ,,übersehen" oder
unterschlagen wurden
63
. Auf die Einführung der Landessprachen als Staatssprachen und
die wachsende Wertschätzung des Nationalgedankens in Europa folgte dann nach
Andersons Darstellung ein ,,offizieller Nationalismus"
64
der Monarchien. Dieser habe
aber lediglich das Auseinandertreten von Dynastien und eben entstandenen Nationen
verdecken wollen
65
.
Nach der Entwicklung des Nationalstaates zur legitimen Norm habe die Nation
schließlich nicht mehr als etwas Neues erfahren werden können, argumentiert
Anderson, weshalb sich ihr Bewusstsein änderte. Deshalb werde die Art der Erinnerung
an die Geschichte der betreffenden Nation den neuen Gegebenheiten angepasst. So
werden bspw. frühere Auseinandersetzungen innerhalb einer Nation ,,vergessen" oder
mythologisiert: ,,Alle tiefgreifenden Bewußtseinsänderungen führen Kraft ihrer
Eigenart zu charakteristischen Amnesien."
66
Die Identität einer Nation entspringe, wie
die eines Individuums, vor allem der Vorstellung und nicht der Erinnerung. Nach
Andersons Auslegung gibt es also einen Nationalismus vor und nach der Entstehung
einer Nation; letzterer macht mehr oder weniger zufällige Entwicklungen nachträglich
zum Schicksal.
Zusammengefasst weist Anderson jeder Nation die vier folgenden Eigenschaften zu
67
:
Sie ist erstens ,,vorgestellt [...] weil die Mitglieder selbst der kleinsten Nation die
meisten anderen niemals kennen [...] werden, aber im Kopf eines jeden die Vorstellung
62
Benedict Anderson 1998, S. 42ff.
63
Ebd. S. 85ff.
64
Ebd. S. 90ff.
65
Ebd. S. 114.
66
Ebd. S. 205ff.
67
Ebd. S. 15ff.
18
ihrer Gemeinschaft existiert." Sie ist zweitens ,,begrenzt [...], weil selbst die größte von
ihnen [...] in genau bestimmten, wenn auch variablen Grenzen lebt, jenseits derer
andere Nationen liegen. [...] Selbst die glühendsten Nationalisten träumen nicht von
dem Tag, da alle Mitglieder der menschlichen Rasse ihrer Nation angehören werden" -
im Gegensatz etwa zu Religionsgemeinschaften mit Missionsansprüchen. Sie ist drittens
,,souverän [...], weil ihr Begriff in einer Zeit geboren wurde, als Aufklärung und
Revolution die Legitimität der als von Gottes Gnaden gedachten hierarchisch-
dynastischen Reiche zerstörten. [...] Maßstab und Symbol dieser Freiheit ist der
souveräne Staat". Und sie ist viertens eine ,,Gemeinschaft [...], weil sie, unabhängig
von realer Ungleichheit und Ausbeutung, als 'kameradschaftlicher' Verbund von
Gleichen verstanden wird."
Zeitgleich zu Andersons Werk erschien Ernest Gellners Nationalismus und Moderne
68
,
das einen ähnlichen Ansatz verfolgt; beide Werke gelten als Vorboten einer
,,konstruktivistischen Wende" der Nationalismusforschung in den 1980er/1990er
Jahren. Wie Anderson weist auch Gellner auf die durch den Buchdruck ermöglichte,
wachsende Bedeutung der Landessprachen als einen Auslöser für den sozialen Wandel
hin, der letztendlich die Entstehung von Nationen begünstigte. Hat die entstandene
Hochkultur erst einmal die gesamte Gesellschaft durchdrungen, so definiert sich diese
über die Kultur. Diese gilt es in einem weiteren Schritt zu erhalten nach Gellner ist
das die Grundlage für den Nationalismus.
69
Soziale Mobilität wird zum Kennzeichen der von kognitivem und ökonomischem
Wachstum abhängigen Industriegesellschaft, in der ein Egalitarismus der Erwartungen
und Hoffnungen herrscht: ,,Die alte Stabilität der sozialen Rollenstruktur ist mit
stetigem Wachstum und beständiger Innovation einfach inkompatibel"
70
. Um die
Fortdauer des Wachstums zu gewährleisten, ist eine den beruflichen Wandel jedes
Einzelnen ermöglichende, verallgemeinerte Ausbildung erforderlich, dem, so Gellner,
nur ein staatlich organisiertes Erziehungssystem gerecht werden kann. Demzufolge sieht
er im Erziehungsmonopol des Staates die Wurzel für den Nationalismus, welcher sich
lediglich gerne als ,,Erwachen einer uralten, latenten, schlafenden Kraft"
71
darstelle,
während er in der Realität erst in Folge der neuen sozialen Organisation entstanden sei.
68
Der Originaltitel von Gellners "Nationalismus und Moderne" lautet: ,,Nations and Nationalism".
69
Ernest Gellner, Nationalismus und Moderne, Berlin 1991, S. 33.
70
Ebd., S. 41.
71
Ebd., S. 76.
19
Erst über den Nationalismus ließe sich demzufolge die Nation definieren.
72
Gellner
spricht von einer ,,grundlegenden Täuschung und Selbsttäuschung des
Nationalismus"
73
, der auf einer anonymen Gesellschaft austauschbarer Individuen
basiere (zusammengehalten durch gemeinsame Sprache und staatlich geregelte
Ausbildung), sich aber gleichzeitig auf eine gemeinsame Volkskultur berufe, die es in
dieser Form nie gegeben habe.
74
Bei näherer Betrachtung weisen beide Konzepte viele Gemeinsamkeiten auf, nur die
Basis ist jeweils eine andere. Bei Gellner sind Nationen ,,Artefakte menschlicher
Überzeugungen, Loyalitäten und Solidaritätsbeziehungen"
75
, also künstliche und damit
ebenfalls erfundene
76
aber bewusst gewählte Produkte; Anderson spricht von einer
,,vorgestellte[n] politische[n] Gemeinschaft - vorgestellt als begrenzt und souverän"
77
und meint damit ebenfalls etwas Künstliches, jedoch haftet diesem eine vermeintliche
,,Natürlichkeit" bzw. das ,,Element des 'Nicht-bewußt-Gewählten'"
78
an. Anderson
kritisiert jedoch, speziell Gellner assoziiere auch schon in früheren Werken die
,,Erfindung der Nation" zu sehr mit der Herstellung von etwas ,,Falschem"
79
. Zwar
seien alle sozialen Gemeinschaften, die über ein Dorf hinausgingen, vorgestellt oder
,,kreiert", deswegen aber nicht ,,falsch".
Tatsächlich lassen sich beide Konzepte auf die vorliegende Thematik der deutschen
Nationsbildung anwenden.
Zum einen gibt es zunächst relativ ,,zufällige", d.h. nicht auf
bestimmte Ideologien rückführbare Entwicklungen wie etwa der Deutsch-Dänische
Krieg 1864, der Auslöser für den Deutsch-Österreichischen Krieg zwei Jahre später
war, welcher auf lange Sicht betrachtet zur klein-deutschen Variante 1871 führte , die
einen gesellschaftlichen Wandel und die Entstehung von Nationen begünstigten. Auf
der anderen Seite können Nationen nur ,,überleben", indem sie sich ständig neu
definieren, also das Bild, das sie von sich haben, immer wieder neu erschaffen und an
die gesellschaftlichen Verhältnisse und Entwicklungen anpassen. Das Deutsche Reich
72
Ernest Gellner 1991, S. 87: ,,Es ist der Nationalismus, der die Nationen hervorbringt, und nicht
umgekehrt.".
73
Ebd., S. 89.
74
Vgl. dazu Ebd., S. 91-95.
75
Ebd., S. 16.
76
,,Nationalismus ist keineswegs das Erwachen von Nationen zu Selbstbewußtsein: man erfindet
Nationen, wo es sie vorher nicht gab." Ebd., S. 169.
77
Benedict Anderson 1996, S. 15.
78
Ebd. S. 124.
79
Ebd. S. 16, Anderson spricht speziell über Gellners "Thought and Change" (1964).
20
gilt als ,,von oben
80
" gesetzt, trotzdem kam der Wille dazu auch aus der Bevölkerung
heraus. Volk wie staatliche Institutionen arbeiteten im Folgenden daran, die ,,deutsche
Idee" in den Köpfen der Menschen zu verankern. Die, wie bei jeder Nation, dabei
auftretende typische, rückwirkende Mythologisierung der Entstehungszusammenhänge
kommt durchaus einer Erfindung gleich. Beides Zufall und Mythologisierung
geschehen im Verlauf jeweils einzigartiger und nicht abgeschlossener geschichtlicher
Prozesse, die Nation oder den Nationalismus als Idealtyp, um Anderson zu folgen, kann
es deshalb nicht geben.
2.3. Regionalismus als Gegen- oder Parallelphänomen zum Nationalismus
Erst in den letzten drei Jahrzehnten hat sich neben der Landesgeschichte bzw. der
historischen Landeskunde eine sehr ähnliche Disziplin herausgebildet, die ebenfalls die
Bedeutung der kleinräumigen Strukturen unterhalb der Gesamtstaats- und Länderebene
erforscht: die Regionenforschung.
Eine Region bezeichnet im allgemeinen Sprachgebrauch ein homogenes, abgegrenztes
Gebiet, welches kulturelle, sprachliche oder wirtschaftliche Charakteristiken aufweist
und sich dadurch von anderen Gebieten unterscheidet
81
. Als Teil einer Nation besitzt die
Region ein Bewusstsein ihrer meist historisch gewachsenen Bräuche und Traditionen
und entwickelt so eine gemeinschaftlich empfundene regionale Identität, auch als
Regionalismus bezeichnet. Der Begriff wird aber auch synonym für Verhandlungen
oder Beschlüsse über intergouvernementale Vereinbarungen oder Regime verwendet.
Zu unterscheiden ist Regionalismus zudem vom Begriff der Regionalisierung, mit dem
verstärkt menschliche und Handelsbeziehungen innerhalb einer geographischen Region
bezeichnet werden, wie etwa der Austausch von Ideen, Kapital, Gütern und
Dienstleistungen; treibende Kraft sind hier Märkte und Unternehmen
82
. Betrachtet
werden soll im Folgenden lediglich die Region im Zusammenhang mit ihrer
konnotativen Bedeutung, der regionalen Identität.
Wird dieser Begriff nun auf die Situation der Reichsgründungszeit bezogen, ergibt sich
für eine Eingrenzung dessen, was regionale Identität ist bzw. wie sie im
Nationsbildungsprozess des 19. Jahrhunderts verortet werden kann, zunächst folgendes
80
Vgl. U.a. Hans-Ulrich Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Bd. 3, Von der ,,Deutschen
Doppelrevolution" bis zum Beginn des ersten Weltkrieges 1849-1914, München 1995, S. 251ff.
81
Vgl. ,,Region" In: Sills, David L. (Hg.): International encyclopedia of the social sciences. New York
1968-1979, Bd. 13, S. 377-382, hier S. 377.
82
Vgl. Dieter Nohlen ,,Regionalismus" in: Ders. (Hg.), Kleines Lexikon der Politik, BpB 2002, S. 430.
21
Problem: Regionen, so wie man sie heute definiert, hat es damals nicht unbedingt
gegeben. Das Deutsche Reich war ein Bundesstaat und setzte sich bei seiner Gründung
1871 aus 25 Einzelstaaten zusammen: vier Königreiche, sechs Großherzogtümer, fünf
Herzogtümer, sieben Fürstentümer, drei freie Städte und einem Reichsland.
83
Vor der
Reichsgründung waren diese Bundesstaaten zwar auch schon in anderer Form gruppiert
(sei es das Heilige Römische Reich deutscher Nationen oder der Norddeutsche Bund),
jedoch vergleichsweise lose. Fest steht aber: Bezugspunkt für jeden deutschen Bürger
war der eigene Territorialstaat, da dieser allein die politische, wirtschaftliche und
soziale Realität darstellte. Ländergrenzen änderten sich oft, ohne dass die Menschen, die
innerhalb derer lebten, davon betroffen waren; ihre Identifikation war eine
personenbezogene keine regionenbezogene. Erst mit dem Deutschen Reich schrieben
sich die Grenzen weitestgehend fest. Und doch jeder der 25 Bundesstaaten war immer
noch ein eigenes politisches Gebilde
84
,
mit unterschiedlichen politischen
Verfahrensweisen, man betrachte nur das unterschiedliche Prozedere des Wahlrechts
auch nach 1871.
85
Nur weil mit der Gründung des Deutschen Reiches ein offizielles
neues Identifikationsangebot vorhanden war, änderte sich die Identifikation der Bürger
nicht schlagartig. Doch das Gründungsdatum des Deutschen Reiches gilt trotzdem als
Zäsur, da es den Anfang regionenbezogener Identifikationsprozesse darstellt.
86
Mit der Reichsgründung standen sich jetzt beide Konzepte gegenüber, doch lassen sich
dazu unterschiedliche Positionen finden, die von der These der Konkurrenz bis zu der
der Abhängigkeit variieren. So meint z.B. Wolfgang Mommsen, dass das Eine mit dem
Entstehen des Anderen verschwand, es also, wie er meint, zur ,,Einebnung des alten
deutschen Territorialbewusstseins zugunsten einer neudeutschen nationalen
Reichsidee"
87
kam. Wohingegen Siegfried Weichlein behauptet, dass ,,nationale und
regionale Eigenschaften das Ergebnis von Beziehungen"
88
seien und dem historischen
Wandel unterlägen. Denn, so stellt er mit Blick auf die Situation der deutschen
Reichsgründung fest, ,,in den Regionen bildete sich gleichzeitig ein neues
Selbstbewußtsein aus. Im deutschen Nationalstaat und nicht gegen ihn sicherten die
83
Karl Erich Born, Von der Reichsgründung bis zum Ersten Weltkrieg. Handbuch der deutschen
Geschichte, Bd. 16, 1999, S. 14.
84
Die meisten von ihnen waren konstitutionelle Monarchien, nur die drei hanseatischen Stadtrepubliken
und die beiden mecklenburgischen Großherzogtümer wichen von diesem Verfassungstyp ab.
85
Vgl. u.a. Alon Confino, The Nation as a Local Metaphor. Württemberg, Imperial Germany, and
National Memory, 1871-1918, Chapel Hill and London 1997, S.14.
86
Vgl. Michael Klein 2005, S. 52ff und S. 84ff.
87
Wolfgang Mommsen, Der autoritäre Nationalstaat. Verfassung, Gesellschaft und Kultur im deutschen
Kaiserreich, Frankfurt a.M. 1990, S. 66.
88
Siegfried Weichlein 2004, S.13.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2006
- ISBN (eBook)
- 9783836605014
- Dateigröße
- 831 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Leipzig – Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie, Kulturwissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2014 (April)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- gartenlaube zeitschrift berlin nationenbildung öffentlichkeit sozialer wandel geschichte bürgertum liberalismus zeitschriften internationalisierung
- Produktsicherheit
- Diplom.de