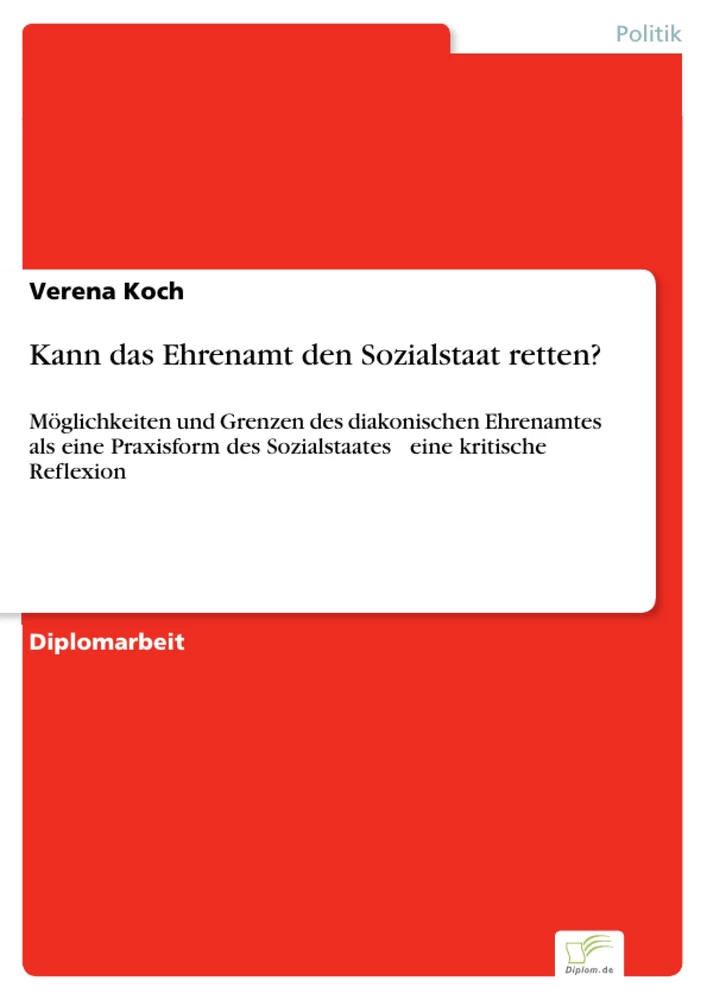Kann das Ehrenamt den Sozialstaat retten?
Möglichkeiten und Grenzen des diakonischen Ehrenamtes als eine Praxisform des Sozialstaates eine kritische Reflexion
©2007
Diplomarbeit
97 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Das Ehrenamt, das vor einigen Jahren noch in der Versenkung verschwunden zu sein schien, taucht heute wieder verstärkt in der Öffentlichkeit auf. In vielen Stellenanzeigen wird der Umgang mit Ehrenamtlichen als Kompetenz gefordert. Politiker verweisen in ihren Reden und Podiumsdiskussionen auf den Wert ehrenamtlicher Mitarbeit, um Einsparungen zu erreichen. In der Gesellschaft lassen sich viele Formen ehrenamtlicher Hilfe beobachten. Spontane, aber auch langfristige Hilfsaktionen einzelner Bürger existieren neben organisierter Mitarbeit in Vereinen und Wohlfahrtsverbänden.
Aber was ist gemeint, wenn wir heute von Ehrenamt sprechen? Das Ehrenamt wird mittlerweile in viele neue Begriffe, wie zum Beispiel Bürgerschaftliches Engagement, Freiwilligenarbeit und Selbsthilfe, gekleidet. Im Anschluss an Einleitung und Begründung der Fragestellung soll es im zweiten Kapitel darum gehen, den Begriff Ehrenamt von anderen Formen freiwilliger Hilfe abzugrenzen, ihn zu definieren und Merkmale des Ehrenamtes herauszuarbeiten. Darüber hinaus werden die geschichtliche Entwicklung des Ehrenamtes sowie die Auswirkungen gesellschaftlicher Veränderungen auf das Ehrenamt in den Blick genommen, die den Wandel vom alten zum neuen Ehrenamt im Hinblick auf verschiedene Aspekte wie zum Beispiel Finanzierung, Qualifizierung und Motive hervorrufen.
Gang der Untersuchung:
Im Kontext einer caritaswissenschaftlichen Arbeit betrachtet das folgende dritte Kapitel Ehrenamt aus der Perspektive der Diakonie. So werde ich als Grundlage den Begriff Diakonie definieren und seine theologische Begründung aufzeigen. Daraus lassen sich im nächsten Schritt Konsequenzen für den Einsatz Ehrenamtlicher und für den Umgang Ehrenamtlicher mit Not Leidenden aus diakonischem Verständnis formulieren.
Das Ehrenamt, das Politiker oft als eine Rettung des Sozialstaates ausrufen, scheint für diesen eine wesentliche Bedeutung zu haben. Das vierte Kapitel rückt den Begriff Sozialstaat, seine Aufgaben und seine geschichtliche Entwicklung in den Blickpunkt. Anschließend wird versucht, die Bedeutung des Ehrenamtes als eine Praxisform des Sozialstaates zu charakterisieren. Dabei ist die Verortung und die Rolle der Diakonie im Sozialstaat zu berücksichtigen.
An diese Überlegungen schließt sich direkt die Frage an, was das viel beschworene Ehrenamt denn tatsächlich für den Staat leisten kann. Können Ehrenamtliche als Lückenbüßer dienen oder für Einsparungen herhalten? Besteht […]
Das Ehrenamt, das vor einigen Jahren noch in der Versenkung verschwunden zu sein schien, taucht heute wieder verstärkt in der Öffentlichkeit auf. In vielen Stellenanzeigen wird der Umgang mit Ehrenamtlichen als Kompetenz gefordert. Politiker verweisen in ihren Reden und Podiumsdiskussionen auf den Wert ehrenamtlicher Mitarbeit, um Einsparungen zu erreichen. In der Gesellschaft lassen sich viele Formen ehrenamtlicher Hilfe beobachten. Spontane, aber auch langfristige Hilfsaktionen einzelner Bürger existieren neben organisierter Mitarbeit in Vereinen und Wohlfahrtsverbänden.
Aber was ist gemeint, wenn wir heute von Ehrenamt sprechen? Das Ehrenamt wird mittlerweile in viele neue Begriffe, wie zum Beispiel Bürgerschaftliches Engagement, Freiwilligenarbeit und Selbsthilfe, gekleidet. Im Anschluss an Einleitung und Begründung der Fragestellung soll es im zweiten Kapitel darum gehen, den Begriff Ehrenamt von anderen Formen freiwilliger Hilfe abzugrenzen, ihn zu definieren und Merkmale des Ehrenamtes herauszuarbeiten. Darüber hinaus werden die geschichtliche Entwicklung des Ehrenamtes sowie die Auswirkungen gesellschaftlicher Veränderungen auf das Ehrenamt in den Blick genommen, die den Wandel vom alten zum neuen Ehrenamt im Hinblick auf verschiedene Aspekte wie zum Beispiel Finanzierung, Qualifizierung und Motive hervorrufen.
Gang der Untersuchung:
Im Kontext einer caritaswissenschaftlichen Arbeit betrachtet das folgende dritte Kapitel Ehrenamt aus der Perspektive der Diakonie. So werde ich als Grundlage den Begriff Diakonie definieren und seine theologische Begründung aufzeigen. Daraus lassen sich im nächsten Schritt Konsequenzen für den Einsatz Ehrenamtlicher und für den Umgang Ehrenamtlicher mit Not Leidenden aus diakonischem Verständnis formulieren.
Das Ehrenamt, das Politiker oft als eine Rettung des Sozialstaates ausrufen, scheint für diesen eine wesentliche Bedeutung zu haben. Das vierte Kapitel rückt den Begriff Sozialstaat, seine Aufgaben und seine geschichtliche Entwicklung in den Blickpunkt. Anschließend wird versucht, die Bedeutung des Ehrenamtes als eine Praxisform des Sozialstaates zu charakterisieren. Dabei ist die Verortung und die Rolle der Diakonie im Sozialstaat zu berücksichtigen.
An diese Überlegungen schließt sich direkt die Frage an, was das viel beschworene Ehrenamt denn tatsächlich für den Staat leisten kann. Können Ehrenamtliche als Lückenbüßer dienen oder für Einsparungen herhalten? Besteht […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Verena Koch
Kann das Ehrenamt den Sozialstaat retten?
Möglichkeiten und Grenzen des diakonischen Ehrenamtes als eine Praxisform des
Sozialstaates eine kritische Reflexion
ISBN: 978-3-8366-0479-6
Druck Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2007
Zugl. Theologische Fakultät Paderborn, Paderborn, Deutschland, Diplomarbeit, 2007
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2007
Printed in Germany
1
Inhaltsverzeichnis
1
Ausgangssituation
7
1.1
Begründung
der
Fragestellung 8
1.2
Sozialstaatliche
Entwicklung
9
1.2.1
Individualisierung und Solidarisierung
9
1.2.2
Demographische
Entwicklung 10
1.2.3
Wachsende
Arbeitslosigkeit
11
1.3
Vom fürsorglichen zum schlanken und aktivierenden Staat
12
1.4
Ehrenamt in der Diakonie
12
1.4.1
Ehrenamt als Ersatz für das Hauptamt in der Diakonie
13
1.4.2
Ehrenamt
als
Rekrutierung
14
2
Allgemeines Verständnis des Ehrenamtes
15
2.1
Abgrenzung des Ehrenamtes von anderen Arten des Engagements 15
2.1.1
Selbsthilfe
15
2.1.2
Freiwilligenarbeit
16
2.1.3
Bürgerschaftliches
Engagement
16
2.1.4
Ehrenamt
17
2.2
Elemente des Begriffes Ehrenamt
18
2.2.1
Definition
des
Ehrenamtes
18
2.2.2
Kriterien
ehrenamtlichen
Handelns
19
2.2.2.1
qualifiziert
19
2.2.2.2
organisiert
19
2.2.2.3
identitätsbildend
20
2.2.2.4
werteorientiert 20
2.2.2.5
unentgeltlich
20
2
2.3
Geschichte
des
Ehrenamtes
21
2.3.1
Preußische
Städteordnung
21
2.3.2
Elberfelder
System
22
2.3.3
Berufliche Professionalisierung sozialer Arbeit
22
2.3.4
Bedeutungsverlust
des
Ehrenamtes
23
2.3.5
Renaissance
des
Ehrenamtes
24
2.4
Ehrenamt im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen
25
2.4.1
Individualisierung
25
2.4.1.1
Einflussfaktoren der Individualisierung
26
2.4.1.2
Der Wandel vom ,,alten" zum ,,neuen" Ehrenamt
26
2.4.1.2.1 Zunahme der Gratifikationsleistungen
27
2.4.1.2.2 Ehrenamt als Verwirklichung eigener Lebensbedürfnisse
28
2.4.1.2.3 Ehrenamt als gegenseitige Leistungsvereinbarung
28
2.4.1.2.4 Ehrenamt als Baustein der eigenen Biographie
29
2.4.1.2.5 Ehrenamt als flexibles Handeln
29
2.4.1.3
Konsequenzen für das Ehrenamt
30
2.4.1.3.1
Akzeptanz
der
Individualisierung
30
2.4.1.3.2 Ehrenamt als Anklage notverursachender Strukturen
31
2.4.2
Funktionale
Differenzierung
32
2.4.2.1
Grundlagen der Systemtheorie
32
2.4.2.2
Die Aufgabe der Religion im System
33
2.4.2.3
Diakonie als Leistung der Religion
34
2.4.2.4
Konsequenzen für das Ehrenamt
34
2.4.2.4.1 Abwehr der Instrumentalisierung des Ehrenamtes
34
2.4.2.4.2 Ehrenamt als Kritik an sozialstrukturellen Zusammenhängen
35
2.5
Fazit
36
3
3
Theologische Grundlagen für das Ehrenamt in der Diakonie 37
3.1
Vorklärungen
37
3.1.1
Allgemeines Verständnis von Diakonie
37
3.1.2
Ehrenamt als Praxisform der Diakonie
38
3.2
Diakonie als Reich-Gottes-Praxis Jesu
40
3.2.1
Kennzeichen und Optionen der Reich-Gottes-Botschaft
40
3.2.2
Das Reich Gottes zwischen Gegenwart und Zukunft
40
3.2.3
Das Reich Gottes zwischen Geschenk und Anspruch
42
3.2.4
Reich-Gottes-Botschaft
und
Prophetie 43
3.2.5
Diakonie
als
prophetischer
Prozess
44
3.2.6
Anforderungen
an
die
Diakonie
45
3.2.7
Konsequenzen für das Ehrenamt in der Diakonie
46
3.2.7.1
Ehrenamt als politisch ambitioniertes Handeln
46
3.2.7.2
Ehrenamt unter dem Prinzip der Option für die Armen
47
3.2.7.3
Ehrenamt als Ort der Beziehung gleichberechtigter Subjekte
47
3.2.7.4
Offenheit für Prophetie im Ehrenamt
49
3.3
Die Beziehung Gottes zum Menschen in der Diakonie
50
3.3.1
Der Mensch als selbstherrliches Subjekt
50
3.3.2
Der Mensch in der Beziehung zum Anderen
50
3.3.3
Die Gestaltung der Beziehung zum Anderen
51
3.3.4
Gottes Spur im Angesicht des Anderen
51
3.3.5
Der Vorrang der Not Leidenden
52
3.3.6
Diakonie
als
Zeugnis
Gottes
53
3.3.7
Konsequenzen für das Ehrenamt aus diakonischem Verständnis 53
3.3.7.1
Ehrenamt als Ort der Verwirklichung des Zeugnisses Gottes
53
3.3.7.2
Ehrenamt als Anspruch der Verantwortung für den Anderen
54
4
3.4
Zuwendung Gottes zu Not Leidenden im Alten Testament
56
3.4.1
Klage
56
3.4.2
Nächstenliebe
57
3.4.3
Konsequenzen für das Ehrenamt aus diakonischem Verständnis 58
3.5
Fazit
59
3.5.1
Theologisches Verständnis der Diakonie
60
3.5.2
Konsequenzen für das Ehrenamt aus diakonischem Verständnis 61
4
Diakonisches Ehrenamt im Kontext des Sozialstaates
63
4.1
Allgemeines
Verständnis
Sozialstaat
63
4.1.1
Ziele und Aufgaben des Sozialstaates
64
4.1.2
Finanzierungssysteme sozialstaatlicher Leistungen
65
4.1.3
Gesetzliche Grundlagen des Sozialstaates
67
4.2
Geschichte
des
Sozialstaates
68
4.2.1
Die
Sozialgesetzgebung
Bismarcks
68
4.2.2
Weimarer
Republik
69
4.2.3
Ausbau des Sozialstaates in der Nachkriegszeit
69
4.2.4
Krise des Sozialstaates ab Mitte der 70iger Jahre
70
4.3
Diakonie
und
Sozialstaat
71
4.3.1
Verortung der Diakonie im Sozialstaat
71
4.3.2
Diakonie als Partner des Sozialstaates
72
4.3.3
Diakonisches Ehrenamt als Praxisform des Sozialstaates
74
4.4
Fazit
75
5
5
Möglichkeiten des diakonischen Ehrenamtes im Sozialstaat 76
5.1
Ehrenamt als Entlastung von Steuerungsproblemen des Staates
76
5.2
Ehrenamt als Partizipationsmöglichkeit der Bürger
78
5.3
Ehrenamt zur Erschließung neuer Handlungsfelder
79
5.4
Ehrenamt als kostengünstige Ressource
80
5.5
Symbolische Bedeutung des Ehrenamtes für den Sozialstaat
81
6
Grenzen des diakonischen Ehrenamtes im Sozialstaat
83
6.1
Verdrängung regulärer Beschäftigungsverhältnisse
83
6.2
Verlust von Professionalität und Qualität von Sozialleistungen
84
6.3
Ehrenamt als Kompensation gesellschaftlicher Defizite
85
6.4
Profilverlust und Überforderung des Ehrenamtes
86
6.4.1
Diakonisches Ehrenamt als Praxisform des Sozialstaates?
Fazit
88
Literaturverzeichnis
90
7
1 Ausgangssituation
Das Ehrenamt, das vor einigen Jahren noch in der Versenkung verschwunden zu sein
schien, taucht heute wieder verstärkt in der Öffentlichkeit auf. In vielen Stellenanzeigen
wird der Umgang mit Ehrenamtlichen als Kompetenz gefordert. Politiker verweisen in
ihren Reden und Podiumsdiskussionen auf den Wert ehrenamtlicher Mitarbeit, um
Einsparungen zu erreichen. In der Gesellschaft lassen sich viele Formen ehrenamtlicher
Hilfe beobachten. Spontane, aber auch langfristige Hilfsaktionen einzelner Bürger
existieren neben organisierter Mitarbeit in Vereinen und Wohlfahrtsverbänden.
Aber was ist gemeint, wenn wir heute von Ehrenamt sprechen? Das Ehrenamt wird
mittlerweile in viele neue Begriffe, wie zum Beispiel Bürgerschaftliches Engagement,
Freiwilligenarbeit und Selbsthilfe
1
, gekleidet. Im Anschluss an Einleitung und
Begründung der Fragestellung soll es im zweiten Kapitel darum gehen, den Begriff
Ehrenamt von anderen Formen freiwilliger Hilfe abzugrenzen, ihn zu definieren und
Merkmale des Ehrenamtes herauszuarbeiten. Darüber hinaus werden die geschichtliche
Entwicklung des Ehrenamtes sowie die Auswirkungen gesellschaftlicher
Veränderungen auf das Ehrenamt in den Blick genommen, die den Wandel vom ,,alten"
zum ,,neuen" Ehrenamt im Hinblick auf verschiedene Aspekte wie zum Beispiel
Finanzierung, Qualifizierung und Motive hervorrufen.
Im Kontext einer caritaswissenschaftlichen Arbeit betrachtet das folgende dritte Kapitel
Ehrenamt aus der Perspektive der Diakonie. So werde ich als Grundlage den Begriff
Diakonie definieren und seine theologische Begründung aufzeigen. Daraus lassen sich
im nächsten Schritt Konsequenzen für den Einsatz Ehrenamtlicher und für den Umgang
Ehrenamtlicher mit Not Leidenden aus diakonischem Verständnis formulieren.
Das Ehrenamt, das Politiker oft als eine Rettung des Sozialstaates ausrufen, scheint für
diesen eine wesentliche Bedeutung zu haben. Das vierte Kapitel rückt den Begriff
Sozialstaat, seine Aufgaben und seine geschichtliche Entwicklung in den Blickpunkt.
Anschließend wird versucht, die Bedeutung des Ehrenamtes als eine Praxisform des
1
Vgl. Rauschenbach, Thomas: Ehrenamt, in: Otto, Hans-Uwe / Thiersch, Hans: Handbuch Sozialarbeit,
Sozialpädagogik, Neuwied 2001, 351-354
8
Sozialstaates zu charakterisieren. Dabei ist die Verortung und die Rolle der Diakonie im
Sozialstaat zu berücksichtigen.
An diese Überlegungen schließt sich direkt die Frage an, was das viel beschworene
Ehrenamt denn tatsächlich für den Staat leisten kann. Können Ehrenamtliche als
Lückenbüßer dienen oder für Einsparungen herhalten? Besteht hier nicht die Gefahr der
Verdrängung hauptberuflicher Kräfte? Das fünfte Kapitel stellt heraus, was das
Ehrenamt für den Staat leisten kann. Daran anknüpfend weist das sechste Kapitel
kritisch auf die Grenzen ehrenamtlichen Einsatzes hin. Beide Kapitel münden
abschließend in der provozierenden Frage, ob das diakonische Ehrenamt überhaupt als
eine Praxisform des Sozialstaates gefordert werden darf? Sind Ehrenamtliche vielleicht
nicht sogar zu schützen, dass sie nicht zu Vollzugsgehilfen der Politiker für eine
ungerechte Sozialpolitik werden? Diese Ausgangsfrage meiner Arbeit ist unter
Berücksichtigung der theologischen Kriterien, denen das Ehrenamt genügen muss, zu
reflektieren. Auf diese Frage Antworten zu entwickeln, ist Intention des siebten
Kapitels.
1.1 Begründung der Fragestellung
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem diakonischen Ehrenamt im Kontext des
Sozialstaates und setzt sich damit auseinander, was es für den Staat leisten bzw. nicht
leisten kann, und ob das diakonische Ehrenamt überhaupt als eine Praxisform desselben
angefragt werden darf. Woher rührt das plötzliche sozialstaatliche Interesse an der
Wiederbelebung des Ehrenamtes, nachdem es jahrelang in der Versenkung
verschwunden war? Welche Gründe gibt es für die Aktualität des Ehrenamtes in der
Sozialpolitik? Warum rufen Politiker es heute als Rettung des Sozialstaates aus?
Um auf diese Fragen Antworten herauszuarbeiten, ist bereits an dieser Stelle ein grober
Blick auf die Entwicklung des Sozialstaates und die Situation des Ehrenamtes in der
Diakonie zu werfen. Die sozialstaatliche Entwicklung wird von Faktoren wie der
Individualisierung, der demographischen Entwicklung und der wachsenden
Arbeitslosigkeit nachhaltig beeinflusst und fördert die Veränderung des Leitbildes vom
fürsorglichen zum schlanken und aktivierenden Staat.
9
1.2 Sozialstaatliche Entwicklung
Der Sozialstaat in Deutschland zeichnete sich bis Mitte der 70iger Jahre durch eine
expandierende Sozialpolitik aus. Beeinflusst vom Wirtschaftswunder in den 50iger und
60iger Jahren erfolgte zunächst der Wiederaufbau der Systeme der sozialen Sicherung,
bevor die Weiterentwicklung der sozialpolitischen Institutionssysteme vorgenommen
wurde. Neben der Einführung des Bundessozialhilfegesetzes von 1961 ist die 1957
verabschiedete Rentenreform als eine der wichtigsten Sozialreformen in Deutschland zu
erwähnen. Ab Mitte der 70iger Jahre setzte jedoch aufgrund des stagnierenden
Wirtschaftswachstums das Problem der Finanzierbarkeit expandierender
Sozialleistungen ein. Die Politik begegnete dieser Krise mit selektiven Kürzungen in
der Sozialpolitik nach der Logik des geringsten politischen Widerstandes und der
größten finanziellen Entlastung des Bundes. Im Zuge dieser Entwicklung mehren sich
wieder die Rufe nach der individuellen Eigenverantwortung und der Förderung
traditioneller Gemeinschaftsformen wie Familie, Nachbarschaft und Ehrenamt.
2
Welche Faktoren die Kostenexplosion der Sozialleistungen verursachen und den
Wunsch nach Ehrenamt fördern, veranschaulichen folgende Beispiele. Anhand der
Erläuterungen wird deutlich, wie sehr diese Bedingungen zusammenhängen und
einander beeinflussen.
1.2.1 Individualisierung und Solidarisierung
Eine Herausforderung für die künftige Sozialpolitik stellt der soziale Wandel in Gestalt
der Individualisierung dar. Der Verlust tradierter Bindungen, wie zum Beispiel Familie
und informelle Sozialbeziehungen in Nachbarschaft und Stadtteil, führt zu einer
wachsenden ,,Dienstleistungslücke", die von den herkömmlichen Instrumenten der
sozialen Risikoabsicherung nicht mehr bewältigt werden kann.
3
So wird zum Beispiel
durch den Anstieg der Ein-Personen-Haushalte Pflege älterer Menschen immer weniger
2
Vgl. Olk, Thomas: Sozialstaat, in: Kreft, Dieter / Mielenz, Ingrid: Wörterbuch Soziale Arbeit.
Aufgaben, Praxisfelder, Begriffe und Methoden der Sozialarbeit und Sozialpädagogik. Weinheim und
München 2005, 872-880, 874-875
3
Vgl. Olk, Thomas: Zwischen Hausarbeit und Beruf. Ehrenamtliches Engagement in der aktuellen
sozialpolitischen Diskussion, in: Müller, Siegfried / Rauschenbach, Thomas ( Hg.): Das soziale
Ehrenamt. Nützliche Arbeit zum Nulltarif, Weinheim, München 1992, 19-36, 27
10
geleistet werden können.
4
Um hier Einsparungen für die Pflegeversicherung zu
erreichen, wird von Politikern oft der Ruf nach dem Ehrenamt laut. Gleichzeitig regt
sich Kritik an der Individualisierung, die oft als Vereinzelung, Beziehungslosigkeit,
Vereinsamung und das Ende der Gesellschaft
5
verteufelt wird. Mit der
Individualisierung der Lebensführung wird oft der Verlust der Solidarität in der
Gesellschaft beklagt. Vor diesem Hintergrund gewinnt das Ehrenamt enorme
symbolische Bedeutung als Vorzeigestück und Grundlage einer Gesellschaft mit einem
humanen, solidarischen Anspruch. Es ist sozusagen eine der letzten Bastionen, in der
Sozialintegration in einer individualisierten Gesellschaft noch gelingen kann.
6
Jedoch
greift die These, dass die Individualisierung jegliche Solidarisierung vereitelt, zu kurz
und ist empirisch nicht haltbar.
7
Die Individualisierung verdrängt zwar durch den
Wunsch nach Selbstentfaltung zunehmend das Pflichtgefühl, befreit das Ehrenamt aber
auch vom kollektiven Druck und moralischen Zwang. Verwurzelungen lösen sich auf,
aber die steigende Mobilität ermöglicht gleichsam neue überregionale
Solidarisierungen. Der Wunsch der Individuen nach neuen sinnstiftenden Beziehungen
eröffnet neue Solidaritätspotentiale.
8
Ehrenamt wird frei vom Zwang zum Ausdruck und
Vollzug realer Subjektivität, wenn es Handlungsfähigkeit und soziale Integration schafft
und fördert.
9
Individualisierung ist demnach von dem Vorwurf freizusprechen, die über
Herkunft und Zugehörigkeit vermittelte Bedeutung kultureller und sozialer Ressourcen
gänzlich zu beseitigen.
10
1.2.2 Demographische Entwicklung
Die Individualisierung, die auch die Zunahme kinderloser Ehen und somit den
4
Vgl. Olk, Thomas: Zwischen Hausarbeit und Beruf, in: Müller, Siegfried / Rauschenbach, Thomas
( Hg. ): Das soziale Ehrenamt. Weinheim, München 1992, 19-36, 29
5
Vgl. Hobelsberger, Hans: Jugendpastoral des Engagements. Eine praktisch-theologische Reflexion und
Konzeption des sozialen Handelns Jugendlicher. Würzburg 2006, 38
6
Vgl. Rauschenbach, Thomas / Müller, Siegfried / Ulrich, Otto: Vom öffentlichen und privaten Nutzen
des sozialen Ehrenamtes, in: Müller, Siegfried / Rauschenbach, Thomas ( Hg. ): Das soziale Ehrenamt.
Weinheim, München 1992, 223-242, 223-224
7
Vgl. Klages, Helmut: Engagement und Engagementpotential in Deutschland, zitiert in: Haslinger,
Herbert: Konkretion: Ehrenamt, in: Handbuch Praktische Theologie 2, Mainz 2000, 308-322, 311-312
8
Vgl. Heinze, Rolf G. / Strünck, Christoph: Die Verzinsung des sozialen Kapitals, zitiert in: Haslinger,
Herbert: Konkretion: Ehrenamt, in: Handbuch Praktische Theologie 2, Mainz 2000, 308-322, 312
9
Vgl. Hobelsberger, Hans: Jugendpastoral des Engagements. Würzburg 2006, 269
10
Vgl. Hobelsberger, Hans: Jugendpastoral des Engagements. Würzburg 2006, 42
11
Rückgang der Kinderzahl bedingt
11
, fördert die ungünstige demographische
Entwicklung, die eine weitere Herausforderung der Sozialpolitik darstellt. Die steigende
Alterung der Bevölkerung führt zu steigender Nachfrage sozialpolitischer Leistungen.
12
Aufgrund sinkender Kinderzahlen und einem wachsenden Anteil älterer Menschen wird
der Generationenvertrag brüchig. Dieser sieht vor, dass die erwerbstätige, jüngere
Generation einen Teil ihres Einkommens für die materielle Sicherung im Alter abtritt
und dadurch selber das Anrecht auf materielle Unterstützung der nachfolgenden
Generation erwirbt.
13
Werden aber keine zukünftigen Beitragszahler geboren, können
steigende Ausgaben für Rente und Pflege nicht mehr finanziert werden. Deshalb sehen
sich Politiker wiederum zu der Forderung veranlasst, die sich verschärfende
Versorgungslücke durch Ehrenamtliche zu schließen.
14
1.2.3 Wachsende Arbeitslosigkeit
Der Anstieg der Arbeitslosigkeit ist neben der sinkenden Kinderzahl ein weiteres
Problem, das die materielle Sicherung im Alter und das gesamte soziale
Sicherungssystem gefährdet. Die Beschäftigungslosigkeit führt zu sinkenden
Einnahmen der sozialen Sicherungssysteme, während der Anspruch auf
Sozialleistungen zunimmt. Finanziell sind die sozialen Sicherungssysteme auf eine hohe
Anzahl erwerbstätiger Beitragszahler angewiesen, um funktionsfähig zu bleiben.
15
Wegen der Arbeitsmarktabhängigkeit der sozialen Sicherungssysteme ist die
Sozialpolitik hier vor neue Anforderungen gestellt, die Politiker oft mit Hilfe
ehrenamtlicher Kräfte bewältigen möchten.
11
Vgl. Olk, Thomas: Zwischen Hausarbeit und Beruf, in: Müller, Siegfried / Rauschenbach, Thomas
( Hg. ): Das soziale Ehrenamt. Weinheim, München 1992, 19-36, 29
12
Vgl. Olk, Thomas: Sozialstaat, in: Kreft, Dieter / Mielenz, Ingrid: Wörterbuch Soziale Arbeit.
Weinheim und München 2005, 872-880, 877
13
Vgl. Olk, Thomas: Zwischen Hausarbeit und Beruf, in: Müller, Siegfried / Rauschenbach, Thomas
( Hg. ): Das soziale Ehrenamt. Weinheim, München 1992, 19-36, 31
14
Vgl. Olk, Thomas: Zwischen Hausarbeit und Beruf, in: Müller, Siegfried / Rauschenbach, Thomas
( Hg. ): Das soziale Ehrenamt. Weinheim, München 1992, 19-36, 31
15
Vgl. Olk, Thomas: Sozialstaat, in: Kreft, Dieter / Mielenz, Ingrid: Wörterbuch Soziale Arbeit.
Weinheim und München 2005, 872-880, 878
12
1.3 Vom fürsorglichen zum schlanken und aktivierenden Staat
Die Entwicklung des Sozialstaates wirkte sich ebenfalls auf die Leitbilder staatlichen
Handelns aus. Während der expandierende und fürsorgliche Staat ,,erlernte
Hilflosigkeit" und eine ,,Anspruchsmentalität" beklagt, zeichnet sich der ,,schlanke
Staat" durch Reduzierung des Umfangs öffentlicher Aufgaben, tief greifende
Einschnitte ins soziale Netz und die Stärkung der Eigenverantwortung und
Selbstbeteiligung aus.
16
Im Jahre 1998 entwickelte sich der ,,schlanke Staat" weiter zum
,,aktivierenden Staat". Der Staat begreift sich dabei als Rahmensetzer und
Vermittlungsinstanz, um gesellschaftliche Initiativen und Aktivitäten anregen,
koordinieren und fördern zu können. Er erbringt die Leistungen nicht mehr selbst,
sondern fordert und fördert die Gesellschaft und deren Ressourcen und Potentiale, damit
sie eigenständig Probleme zu lösen vermag.
17
Zu den Ressourcen, die der Staat fördert
und fordert, ist auch das Ehrenamt zu zählen. Der Staat möchte auf das Ehrenamt
zurückgreifen, um sich von manchen vielleicht unattraktiven und kostenintensiven
Aufgaben, wie zum Beispiel der Pflege, ein Stück weit zu dispensieren.
Ausgehend von dieser Entwicklung des staatlichen Leitbildes stelle ich in meiner
Diplomarbeit die Frage, was das Ehrenamt tatsächlich für den Staat leisten kann und wo
Grenzen des Einsatzes Ehrenamtlicher gegeben sind. Als weitere Größe ist neben dem
Sozialstaat die Diakonie in den Blick zu nehmen, da sich die Problemstellung meiner
Arbeit auf das diakonische Ehrenamt bezieht. Deshalb ist das Ehrenamt ebenfalls im
Kontext der Diakonie zu betrachten. Was steckt dahinter, wenn der Ruf nach
Ehrenamtlichen in diakonischen Arbeitsfeldern laut wird? Wie ist hier das
wiedererwachte Interesse am Ehrenamt zu erklären?
1.4 Ehrenamt in der Diakonie
Nicht nur in der Politik, sondern auch in kirchlichen Arbeitsfeldern erlebt das Ehrenamt
16
Vgl. Olk, Thomas: Sozialstaat, in: Kreft, Dieter / Mielenz, Ingrid: Wörterbuch Soziale Arbeit.
Weinheim und München 2005, 872-880, 879
17
Vgl. Olk, Thomas: Träger der sozialen Arbeit, in: Otto, Hans-Uwe / Thiersch, Hans: Handbuch
Sozialarbeit, Sozialpädagogik, Neuwied 2001, 1910-1926, 1922
13
offenbar Konjunktur. Es ist Gegenstand empirischer Untersuchungen und wird von
Synoden und Kirchenleitungen gewürdigt. Zur Förderung des Ehrenamtes werden
Konzepte und Leitlinien ausgearbeitet.
18
Diese Bemühungen um das Ehrenamt und um
die Gewinnung Ehrenamtlicher fordern die Frage nach möglichen Gründen für das
Interesse am Ehrenamt nahezu heraus.
1.4.1 Ehrenamt als Ersatz für das Hauptamt in der Diakonie
Eine Möglichkeit für das wiedererwachte Interesse am Ehrenamt ist wie in der Politik in
der Verringerung finanzieller Mittel zu suchen. Ehrenamt wird als Ressource bewertet,
Lücken in den Reihen der weniger werdenden Hauptamtlichen günstig und zweckmäßig
zu füllen. Darin ist bereits das Problem der Überforderung der Ehrenamtlichen angelegt,
aber darüber hinaus lässt sich auf weitere Schwierigkeiten hinweisen. Hauptamtliche
bekommen durch den Zuwachs an Ehrenamtlichen die Gelegenheit, sich aus den
alltäglichen Praxiszusammenhängen zurückzuziehen. Die operativen Aufgaben wie zum
Beispiel Trauerbegleitung, Sakramentenvorbereitung, Seelsorge usw. übernehmen nun
Ehrenamtliche, während die Hauptamtlichen auf die Ebene der supervidierenden
Begleitung wechseln und ihr Tätigkeitsfeld in Beratung, Fortbildung und Begleitung
verlagern.
19
Aufgrund der Entwicklung, dass das Ehrenamt mit geringen Entgelten
verbunden ist und formale Qualifizierungsprozesse voraussetzt, erlangt es den
Stellenwert einer Vorform beruflich-professioneller Tätigkeit.
20
Im Zusammenhang mit
den Sparzwängen in diakonischen Einrichtungen ergibt sich meiner Einschätzung nach
die Gefahr, dass die Hauptamtlichen ihre Qualifikation für die operativen Arbeitsfelder
entwerten und sich überflüssig machen, da sie durch Ehrenamtliche und angelernte
Billiglohnkräfte ersetzbar sind.
21
18
Vgl. Foitzik, Karl: Mitarbeit in Kirche und Gemeinde. Grundlagen, Didaktik, Arbeitsfelder. Stuttgart,
Berlin, Köln 1998, 35
19
Vgl. Haslinger, Herbert: Konkretion: Ehrenamt, in: Handbuch Praktische Theologie 2, Mainz 2000,
308-322, 317-319
20
Vgl. Olk, Thomas: Zwischen Hausarbeit und Beruf, in: Müller, Siegfried / Rauschenbach, Thomas
( Hg. ): Das soziale Ehrenamt. Weinheim, München 1992,19-36, 26
21
Vgl. Bendele, Ulrich: Soziale Hilfen zu Discountpreisen. Unbezahlte Ehren-Arbeit in der Grauzone des
Arbeitsmarktes, in: Müller, Siegfried / Rauschenbach, Thomas: Das soziale Ehrenamt.
Weinheim, München 1992, 71-86, 84
14
1.4.2 Ehrenamt als Rekrutierung
Ein weiteres Problem beim Ruf nach Ehrenamtlichen in der Diakonie liegt im Verdacht
der Rekrutierung und Vereinnahmung der Menschen. So besteht oft die Vermutung, die
Zuwendung zu Ehrenamtlichen geschieht als Mittel zum Zweck der Reproduktion von
Kirche. Dabei entsteht der Eindruck, dass es nicht um die Ehrenamtlichen selber geht,
sondern um dahinter liegende Ziele wie Kirchenbindung oder den Nachweis der
Attraktivität kirchlicher Arbeit.
22
In der diakonischen Konzeption des
Synodenbeschlusses wird die Intention der Vereinnahmung deutlich. Deshalb sind auch
wohlmeinende Aufforderungen zur Partizipation und zum Engagement stets kritisch zu
hinterfragen, ob dahinter nicht eine Beziehungsfalle oder der Versuch der Ausnützung
lauert.
23
Ehrenamtliche werden nicht als kritisches Innovationspotential und
eigenständige Subjekte wahrgenommen, sondern es geht darum, sie in bestehende
Systeme und Organisationen zu integrieren
24
und unter dem Aspekt der
Zweckmäßigkeit einzusetzen.
25
Die Betrachtung des Ehrenamtes im Kontext der Diakonie eröffnet einen neuen
Blickwinkel auf die Ausgangsfrage meiner Arbeit. Es geht um die Auseinandersetzung
mit der Frage, was das diakonische Ehrenamt für den Sozialstaat leisten kann und wo
die Grenzen beim Einsatz Ehrenamtlicher vorhanden sind. Diese Überlegungen gipfeln
abschließend in der provozierenden Frage, ob ein Ehrenamt in der Diakonie, das
theologischen Kriterien genügen muss, überhaupt als Praxisform des Sozialstaates
angefragt werden darf.
22
Vgl. Hobelsberger, Hans: Jugendpastoral des Engagements. Würzburg 2006, 172
23
Vgl. Haslinger, Herbert u.a.: Ouvertüre: Zu Selbstverständnis und Konzept dieser Praktischen
Theologie, in: Haslinger, Herbert: Handbuch Praktische Theologie 1, zitiert in: Hobelsberger, Hans:
Jugendpastoral des Engagements. Würzburg 2006, 255
24
Vgl. Hobelsberger, Hans: Jugendpastoral des Engagements. Würzburg 2006, 202
25
Vgl. Münchmeier, Richard: Gemeinschaft als soziale Ressource. Von der symbolischen Bedeutung des
Ehrenamtes für den Sozialstaat. in: Müller, Siegfried / Rauschenbach, Thomas ( Hg. ): Das soziale
Ehrenamt. Weinheim, München 1992, 57-69, 58
15
2 Allgemeines Verständnis des Ehrenamtes
Das folgende Kapitel nimmt den Versuch der Abgrenzung des Ehrenamtes von anderen
Formen des Engagements, seine Definition und die Entwicklung von Kriterien für
ehrenamtliches Handeln vor. Anschließend wird die geschichtliche Entstehung des
Ehrenamtes verfolgt und das Ehrenamt im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen
betrachtet.
2.1 Abgrenzung des Ehrenamtes von anderen Arten des Engagements
Übereinstimmend wird in der Literatur festgestellt, dass keine einheitliche und
konsensfähige Definition für das Ehrenamt vorliegt.
26
Der Begriff Ehrenamt ist zu
diffus und charakterisiert unterschiedliche Tätigkeiten.
27
Die vielfältigen
Bezeichnungen für das Ehrenamt sind jedoch mehr als nur Varianten und Nuancen einer
gemeinsamen Idee. Nach Rauschenbach ergeben sich aus den Konzepten Differenzen in
der Wahrnehmung, Akzentuierung und Profilierung. Im Folgenden beziehe ich mich auf
die Erläuterungen der Begriffe Selbsthilfe, Bürgerschaftliches Engagement und
Freiwilligenarbeit, bevor ich die Abgrenzung und Definition des Ehrenamtes
vornehme.
28
2.1.1 Selbsthilfe
Selbsthilfe stand in ihrer Blütezeit in den 80iger Jahren für ein ,,autoritäts- und
expertenskeptisches, organisationsfernes, emanzipiertes und tendenziell
26
Vgl. Rauschenbach, Thomas: Ehrenamt, in: Otto, Hans-Uwe / Thiersch, Hans: Handbuch Sozialarbeit,
Sozialpädagogik, Neuwied 2001,344-360, 345
Vgl. Blätter der Wohlfahrtspflege. Engagement als Ressource, in: Deutsche Zeitschrift für Sozialarbeit.
Baden-Baden 2006, 205
Vgl. Foitzik, Karl: Mitarbeit in Kirche und Gemeinde. Grundlagen, Didaktik, Arbeitsfelder. Stuttgart,
Berlin, Köln 1998, 37
Vgl. Olk, Thomas: Zwischen Hausarbeit und Beruf, in: Müller, Siegfried / Rauschenbach, Thomas
( Hg. ): Das soziale Ehrenamt. Weinheim, München 1992,19-36, 23
27
Vgl. Foitzik, Karl: Mitarbeit in Kirche und Gemeinde. Grundlagen, Didaktik, Arbeitsfelder. Stuttgart,
Berlin, Köln 1998, 37
28
Vgl. Rauschenbach, Thomas: Ehrenamt, in: Otto, Hans-Uwe / Thiersch, Hans: Handbuch Sozialarbeit,
Sozialpädagogik, Neuwied 2001, 344-360, 351-354
16
wertepluralistisches Selbstbewusstsein moderner Milieus"
29
, die sich von dem
traditionell an Vereine und Verbände gebundenen Ehrenamt abgrenzen wollte. Sie
forderte Eigenzuständigkeit, Mündigkeit, Autonomie und Selbstbetroffenheit der
engagierten Personen, während beim Ehrenamt der Einsatz für Dritte, eine Sache oder
Idee in den Blickpunkt rückte. Nach dem Abflauen der Konjunktur der Selbsthilfe kehrt
sie jedoch zum Ehrenamt und den Institutionen zurück, wie zum Beispiel die
Selbsthilfegruppen der Alkoholiker, die von der Caritas initiiert werden.
2.1.2 Freiwilligenarbeit
Das Konzept der Freiwilligenarbeit bezeichnet ,,ein modernes, schwach
institutionalisiertes, kaum wertegebundenes und eher milieuunabhängiges Engagement
individualisierter, freier, spontaner Menschen"
30
. Sie sind nicht in Verbänden integriert,
sondern engagieren sich als freie, unabhängige Menschen nach Lust und Laune, aus
Kontakt- oder Selbstverwirklichungsgründen.
2.1.3 Bürgerschaftliches Engagement
Das bürgerschaftliche Engagement steht ,,für die Wiederbelebung der
zivilgesellschaftlichen Idee eines lebendigen Gemeinwesens, einer Demokratie der
aktiven Bürgerinnen und Bürger"
31
. Diese lebensweltlich organisierte Solidarität ist auf
persönliche Hilfe im Sozialraum konzentriert, nicht auf die politische Gestaltung einer
modernen Gesellschaft. So lässt sich das Engagement als Aktivierungsprogramm der
,,Basis" charakterisieren, welches jedoch ,,von oben" implementiert wurde. Daher wird
der Begriff nicht selten als eine politische Perspektive von oben kritisiert.
32
29
Rauschenbach, Thomas: Ehrenamt, in: Otto, Hans-Uwe / Thiersch, Hans: Handbuch Sozialarbeit,
Sozialpädagogik, Neuwied 2001, 344-360, 352
30
Rauschenbach, Thomas: Ehrenamt, in: Otto, Hans-Uwe / Thiersch, Hans: Handbuch Sozialarbeit,
Sozialpädagogik, Neuwied 2001, 344-360, 352
31
Rauschenbach, Thomas: Ehrenamt, in: Otto, Hans-Uwe / Thiersch, Hans: Handbuch Sozialarbeit,
Sozialpädagogik, Neuwied 2001, 344-360, 352
32
Vgl. Blätter der Wohlfahrtspflege. Engagement als Ressource, in: Deutsche Zeitschrift für Sozialarbeit.
Baden-Baden 2006, 205
17
2.1.4 Ehrenamt
Mit Ehrenamt verbinden die traditionsgebundenen Organisationen, wie zum Beispiel
die Wohlfahrtsverbände, ,,die Idee der organisierten, unentgeltlichen
Mitarbeit in den
eigenen Reihen aufgrund der Identifikation mit den Werten und Zielen ihrer
Organisation"
33
. Bei der ehrenamtlichen Tätigkeit steht der Aspekt der
Gemeinnützigkeit im Vordergrund, weniger die Autonomie, Offenheit und
Unbestimmtheit einer Selbsthilfegruppe.
Anhand der Darstellung der verschiedenen Begriffe lassen sich Differenzen in den
dahinter liegenden Konzepten aufzeigen. Dabei wird deutlich, dass Ehrenamt und
bürgerschaftliches Engagement den gemeinwohlorientierten Formen des Engagements
zuzuordnen sind, während Selbsthilfe und Freiwilligenarbeit zu den individualisierten
Engagementarten zählen.
34
Jedoch ist auch diese Abgrenzung meiner Einschätzung nach
nur als Versuch zu bewerten, die Spielarten des Engagements und dahinterliegende
Konzepte zu profilieren. Die Freiwilligenarbeit ist ebenfalls am Gemeinwohl orientiert,
was auch der Selbsthilfe nicht abgesprochen werden kann aufgrund der gegenseitigen
Unterstützung der Menschen in den Selbsthilfegruppen.
In meinen weiteren Ausführungen werde ich den Begriff Ehrenamt verwenden, da ich
mich auf die Mitarbeit in christlichen Wohlfahrtsverbänden konzentriere. Diese
traditionsorientierte Bezeichnung findet weite Verbreitung und große Akzeptanz in den
christlichen als auch nicht christlichen Wohlfahrtsverbänden, denn sie ist historisch
gewachsen und nimmt eine klare Abgrenzung zu den Hauptamtlichen vor. Zudem
beinhaltet sie mittlerweile die neueren Formen des befristeten und stärker
selbstbezogenen Engagements.
35
33
Rauschenbach, Thomas: Ehrenamt, in: Otto, Hans-Uwe / Thiersch, Hans: Handbuch Sozialarbeit,
Sozialpädagogik, Neuwied 2001, 344-360, 351-352
34
Vgl. Rauschenbach, Thomas: Ehrenamt, in: Otto, Hans-Uwe / Thiersch, Hans: Handbuch Sozialarbeit,
Sozialpädagogik, Neuwied 2001, 344-360, 352-353
35
Vgl. Blätter der Wohlfahrtspflege. Engagement als Ressource, in: Deutsche Zeitschrift für Sozialarbeit.
Baden-Baden 2006, 205
18
2.2 Elemente des Begriffes Ehrenamt
Wie kann das komplexe Konstrukt Ehrenamt heute gefasst werden? Was verbirgt sich
hinter dem Ehrenamt und welche Kriterien kennzeichnen ehrenamtliches Handeln? Im
Folgenden werde ich eine Definition des Ehrenamtes zugrundelegen und darauf
aufbauend weitere Charakteristika ehrenamtlichen Handelns herausarbeiten, die das
Phänomen Ehrenamt weiter eingrenzen.
2.2.1 Definition des Ehrenamtes
Obwohl Ehrenamt nicht einheitlich zu definieren ist, liegen einige Definitionsversuche
vor. Eine Definition verfasst Thomas Rauschenbach: ,,Demgegenüber lässt sich in einer
eher funktionalen Bestimmung das Ehrenamt umschreiben als eine Form der
gesellschaftlich-sozialen Tätigkeit, die weit unterhalb tariflicher Entlohnung
überwiegend in milieugeprägten oder milieuerzeugenden, lokalen Vereinen, Verbänden
und Initiativen aus unterschiedlichsten Motiven von Menschen aller Altersgruppen im
sozialen Sektor insbesondere von Frauen ausgeübt wird, ohne Vertrag und ohne
zeitliche Verpflichtung, aber auch ohne Gewährleistung einer gewissen Qualität des
Handelns, mit einer Rückerstattungserwartung, die vorrangig an immateriellen,
symbolischen, in jüngerer Zeit aber auch zunehmend an indirekten, materiellen
Gratifikationen ausgerichtet ist."
36
In meiner weiteren Arbeit beziehe ich mich auf diese
Definition, da sie für das Ehrenamt wichtige Aspekte wie Unentgeltlichkeit und
Werteorientierung thematisiert. Jedoch unterschätzt sie die Qualität und Verbindlichkeit
des Handelns. Die Telefonseelsorge zum Beispiel nimmt eine gründliche Auswahl der
Mitarbeiter durch Einstellungsgespräche und Auswahltagungen vor, bevor sie in einer
anschließenden Ausbildung auf den Dienst am Telefon vorbereitet werden.
Zugangsvoraussetzung für die Ausbildung und Mitarbeit ist außerdem die
Verpflichtung, sich mindestens zwei Jahre für die Tätigkeit zur Verfügung zu stellen.
Ausgehend von dieser Definition werde ich weitere Kriterien ehrenamtlichen Handelns
formulieren, um den Begriff noch deutlicher zu charakterisieren.
36
Rauschenbach, Thomas: Ehrenamt, in: Otto, Hans-Uwe / Thiersch, Hans: Handbuch Sozialarbeit,
Sozialpädagogik, Neuwied 2001, 344-360, 346
19
2.2.2 Kriterien ehrenamtlichen Handelns
Anhand der Darstellung der Kriterien ehrenamtlichen Handelns ist nachzuvollziehen,
wie vielseitig und komplex sich das Ehrenamt heute gestaltet. Die Mitarbeit ist
2.2.2.1 qualifiziert
Formale Einarbeitungszeit und Fortbildungsprozesse bilden Komponenten
ehrenamtlicher Mitarbeit.
37
Es besteht die Anforderung einer ausreichenden
Qualifikation für die jeweilige Tätigkeit, was das Recht der Mitarbeiter auf
entsprechende Qualifizierung voraussetzt.
38
2.2.2.2 organisiert
Wie anhand der zu gewährleistenden Qualifizierung deutlich wird, geschieht
ehrenamtliches Handeln geplant und zielgerichtet.
39
Es vollzieht sich in Verbänden und
Vereinen und geht über die bloße Mitgliedschaft hinaus.
40
Die Organisation
ehrenamtlicher Tätigkeit schließt auch eine gewisse Verbindlichkeit und Verpflichtung
zur Mitarbeit in Form mündlicher oder schriftlicher Vereinbarungen ein.
41
37
Vgl. Olk, Thomas: Zwischen Hausarbeit und Beruf, in: Müller, Siegfried / Rauschenbach, Thomas
( Hg. ): Das soziale Ehrenamt. Weinheim, München 1992,19-36, 24
38
Vgl. Haslinger, Herbert: Konkretion: Ehrenamt, in: Handbuch Praktische Theologie 2, Mainz 2000,
308-322, 316
39
Vgl. Haslinger, Herbert: Konkretion: Ehrenamt, in: Handbuch Praktische Theologie 2, Mainz 2000,
308-322, 316
40
Vgl. Hobelsberger, Hans: Jugendpastoral des Engagements. Eine praktisch-theologische Reflexion und
Konzeption des sozialen Handelns Jugendlicher. Würzburg 2006, 28
41
Vgl. Olk, Thomas: Zwischen Hausarbeit und Beruf, in: Müller, Siegfried / Rauschenbach, Thomas
( Hg. ): Das soziale Ehrenamt. Weinheim, München 1992, 19-36, 23-24
20
2.2.2.3 identitätsbildend
Menschen übernehmen ein Ehrenamt, um persönliche Befriedigung bzw.
Weiterentwicklung zu erfahren.
42
Das Ehrenamt fördert sowohl die persönliche Identität
durch Bildung von Einstellungen und Werteorientierung
43
als auch die berufliche
Identität. Es dient Menschen zum Beispiel dazu, berufsrelevante Erfahrungen zu
sammeln und kann als berufliche Einstiegshilfe fungieren.
44
2.2.2.4 werteorientiert
Ehrenamt fördert nicht nur die Bildung einer Werteorientierung, sondern setzt sie
bereits voraus. Der Einsatz für das Gemeinwohl ist an positiven Werten orientiert und
motiviert, also nicht allein auf den eigenen Vorteil bedacht. Deshalb kann das Handeln
als christlich, humanistisch und diakonisch-caritativ bewertet werden.
45
Zudem ist es
eingebunden in die grundlegende gesellschaftliche Werteordnung und mit
Wertschätzung der Tätigkeit bzw. gesellschaftlicher Anerkennung der Person
verknüpft.
46
2.2.2.5 unentgeltlich
Ehrenamtliches Handeln basiert auf der freiwilligen Entscheidung einer Person. Es ist
eine nicht berufliche Tätigkeit und dient nicht zur Sicherung des Lebensunterhaltes.
Abgesehen von geringen Aufwandsentschädigungen wird der Einsatz nicht vergütet.
47
42
Vgl. Haslinger, Herbert: Konkretion: Ehrenamt, in: Handbuch Praktische Theologie 2, Mainz 2000,
308-322, 316
43
Vgl. Hobelsberger, Hans: Jugendpastoral des Engagements. Eine praktisch-theologische Reflexion und
Konzeption des sozialen Handelns Jugendlicher. Würzburg 2006, 28
44
Vgl. Rauschenbach, Thomas / Müller, Siegfried / Otto, Ulrich: Vom öffentlichen und privaten Nutzen
des sozialen Ehrenamtes, in: Müller, Siegfried / Rauschenbach, Thomas ( Hg. ): Das soziale Ehrenamt.
Weinheim, München 1992,223-242, 237
45
Vgl. Hobelsberger, Hans: Jugendpastoral des Engagements. Eine praktisch-theologische Reflexion und
Konzeption des sozialen Handelns Jugendlicher. Würzburg 2006, 28
46
Vgl. Haslinger, Herbert: Konkretion: Ehrenamt, in: Handbuch Praktische Theologie 2, Mainz 2000,
308-322, 317
47
Vgl. Hobelsberger, Hans: Jugendpastoral des Engagements. Eine praktisch-theologische Reflexion und
Konzeption des sozialen Handelns Jugendlicher. Würzburg 2006, 28
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2007
- ISBN (eBook)
- 9783836604796
- Dateigröße
- 503 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Theologische Fakultät Paderborn – Aufbaustudiengang Diplom-Caritaswissenschaft
- Erscheinungsdatum
- 2014 (April)
- Note
- 1,5
- Schlagworte
- deutschland diakonie ehrenamtliche tätigkeit sozialstaat sozialpolitik ehrenamt caritas beschäftigungspolitik
- Produktsicherheit
- Diplom.de