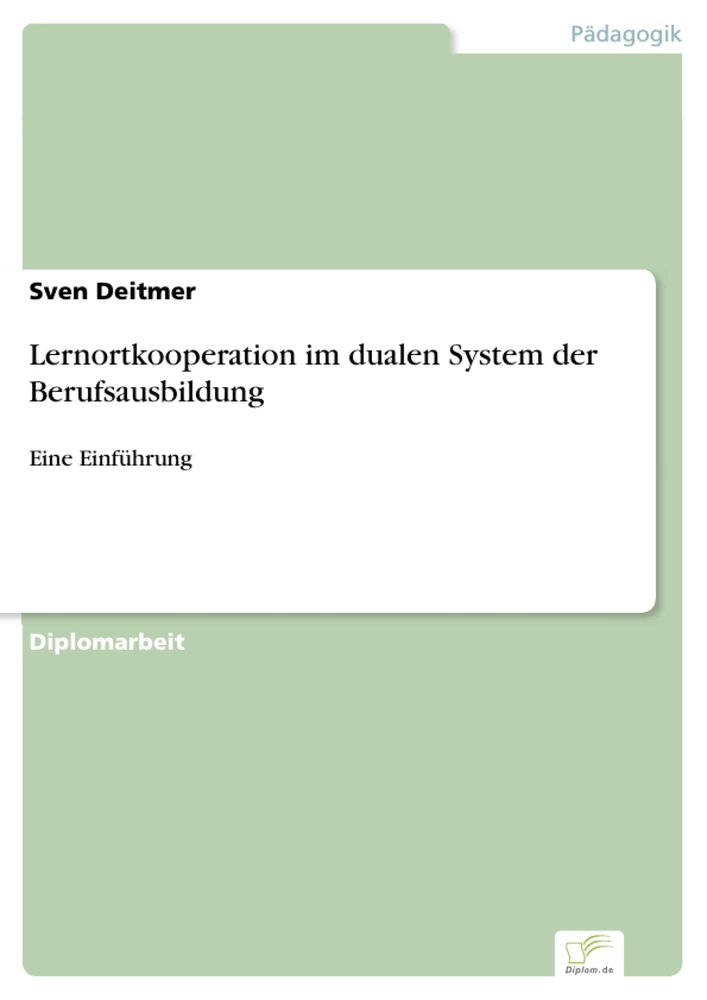Lernortkooperation im dualen System der Berufsausbildung
Eine Einführung
©2005
Diplomarbeit
114 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Bereits durch die Schaffung des dualen Ausbildungssystem und die daraus resultierende Aufteilung der Berufsausbildung auf zwei Orte, den Ausbildungsbetrieb und die Berufsschule, wurde auch die Kooperation dieser beiden Lernorte zum Thema. Durch die schwierige wirtschaftliche Situation und die hohe Arbeitslosigkeit in Deutschland ist es wichtig, eine qualitativ hochwertige Ausbildung zu gewährleisten. Die duale Berufsausbildung soll den jungen Menschen eine Perspektive für ihr berufliches Leben geben und die Konkurrenzfähigkeit der deutschen Wirtschaft im internationalen Wettbewerb durch qualifizierte Fachkräfte erhalten und steigern. Die Lernortkooperation von Berufsschule und Ausbildungsbetrieb wird oft im Zusammenhang einer Weiterentwicklung, Qualitätssteigerung oder Rationalisierung der Berufsausbildung genannt.
Gang der Untersuchung:
Ziel dieser Diplomarbeit ist es, das Thema Lernortkooperation im dualen System durch eine Betrachtung seiner theoretischen und praktischen Seiten kritisch zu bewerten. Um einen Überblick und ein Verständnis für den Begriff Lernortkooperation im dualen System zu entwickeln, wird im ersten Teil dieser Arbeit das Thema in seinen unterschiedlichen Fassetten anhand von Literatur dargestellt. Im zweiten Teil der Arbeit werden empirische Studien mit den Schwerpunkten der aktuelle Stand der Lernortkooperation im Münsterland und der Stand der Effizienz von Lernortkooperationsprojekten in Nordrhein-Westfalen vorgestellt. Zur Darstellung der Lernortkooperation im dualen System wird im Kapitel 2.1. der Begriff Lernortkooperation definiert und abgegrenzt. Um verschiedene Betrachtungsebenen des Themas zu ermöglichen, werden Vorschläge zur Differenzierung und Typisierung von Lernortkooperation nach Verständnis, Aktivitäten und Intensitäten unterbreitet.
Die Entwicklung des Themas Lernortkooperation von seinen Anfängen in den 50er Jahren bis heute wird im Kapitel 2.2. dargestellt. Durch dieses Kapitel soll ein Verständnis für die Vergangenheit und laufende Entwicklung des Themas in der dualen Ausbildung bis heute entwickelt werden.
Das Kapitel 2.3 stellt die Rahmenbedingungen der Lernortkooperation im dualen Ausbildungssystem vor. Hierzu werden die rechtlichen, die institutionellen und personellen Rahmenbedingungen sowie die Einstellungen der Kooperationspartner zur Lernortkooperation dargestellt. Diese Rahmenbedingungen haben einen unmittelbaren, prägenden Einfluss auf die Art und […]
Bereits durch die Schaffung des dualen Ausbildungssystem und die daraus resultierende Aufteilung der Berufsausbildung auf zwei Orte, den Ausbildungsbetrieb und die Berufsschule, wurde auch die Kooperation dieser beiden Lernorte zum Thema. Durch die schwierige wirtschaftliche Situation und die hohe Arbeitslosigkeit in Deutschland ist es wichtig, eine qualitativ hochwertige Ausbildung zu gewährleisten. Die duale Berufsausbildung soll den jungen Menschen eine Perspektive für ihr berufliches Leben geben und die Konkurrenzfähigkeit der deutschen Wirtschaft im internationalen Wettbewerb durch qualifizierte Fachkräfte erhalten und steigern. Die Lernortkooperation von Berufsschule und Ausbildungsbetrieb wird oft im Zusammenhang einer Weiterentwicklung, Qualitätssteigerung oder Rationalisierung der Berufsausbildung genannt.
Gang der Untersuchung:
Ziel dieser Diplomarbeit ist es, das Thema Lernortkooperation im dualen System durch eine Betrachtung seiner theoretischen und praktischen Seiten kritisch zu bewerten. Um einen Überblick und ein Verständnis für den Begriff Lernortkooperation im dualen System zu entwickeln, wird im ersten Teil dieser Arbeit das Thema in seinen unterschiedlichen Fassetten anhand von Literatur dargestellt. Im zweiten Teil der Arbeit werden empirische Studien mit den Schwerpunkten der aktuelle Stand der Lernortkooperation im Münsterland und der Stand der Effizienz von Lernortkooperationsprojekten in Nordrhein-Westfalen vorgestellt. Zur Darstellung der Lernortkooperation im dualen System wird im Kapitel 2.1. der Begriff Lernortkooperation definiert und abgegrenzt. Um verschiedene Betrachtungsebenen des Themas zu ermöglichen, werden Vorschläge zur Differenzierung und Typisierung von Lernortkooperation nach Verständnis, Aktivitäten und Intensitäten unterbreitet.
Die Entwicklung des Themas Lernortkooperation von seinen Anfängen in den 50er Jahren bis heute wird im Kapitel 2.2. dargestellt. Durch dieses Kapitel soll ein Verständnis für die Vergangenheit und laufende Entwicklung des Themas in der dualen Ausbildung bis heute entwickelt werden.
Das Kapitel 2.3 stellt die Rahmenbedingungen der Lernortkooperation im dualen Ausbildungssystem vor. Hierzu werden die rechtlichen, die institutionellen und personellen Rahmenbedingungen sowie die Einstellungen der Kooperationspartner zur Lernortkooperation dargestellt. Diese Rahmenbedingungen haben einen unmittelbaren, prägenden Einfluss auf die Art und […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Sven Deitmer
Lernortkooperation im dualen System der Berufsausbildung - Eine Einführung
ISBN: 978-3-8366-0372-0
Druck Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2007
Zugl. Fachhochschule Münster, Münster, Deutschland, Diplomarbeit, 2005
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2007
Printed in Germany
Lernortkooperation im dualen System der Berufsausbildung - Eine Einführung
I
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis ...I
Abkürzungsverzeichnis ... IV
Abbildungsverzeichnis ...VIII
Tabellenverzeichnis ... IXI
1
Einleitung ... 1
2
Theoretische Beschreibung der Lernortkooperation im dualen
Ausbildungssystem ... 3
2.1 Definition und Typisierung von Lernortkooperation ... 3
2.2 Lernortkooperation in historischer und aktueller Betrachtung... 7
2.3 Rahmenbedingungen der Lernortkooperation im dualen
System der Berufsausbildung ... 9
2.3.1 Rechtliche
Rahmenbedingungen
... 9
2.3.2 Institutionelle und personelle Rahmenbedingungen in
den Lernorten Ausbildungsbetrieb und Berufsschule... 13
2.3.3 Einstellung der Kooperationspartner und Auszu-
bildenden ... 19
2.4 Ziele der Lernortkooperation im dualen System der
Berufsausbildung ... 24
2.4.1 Ziele aus pädagogischer Sicht ... 24
2.4.2 Ziele und Motive auf operativer Ebene
aus systemischer und individueller Perspektive ... 28
2.4.2.1 Ziele und Motive der Ausbildungsbetriebe
und Berufsschulen aus systemischer
Perspektive... 29
Lernortkooperation im dualen System der Berufsausbildung - Eine Einführung
II
2.4.2.2 Ziele und Motive der Ausbilder und
Berufsschullehrer aus individueller
Perspektive ...31
2.4.3 Ziele und Maßnahmen auf bundespolitischer Ebene
zur Lernortkooperation...32
2.4.3.1 Ziele und Maßnahmen des Bundes...32
2.4.3.2 Ziele und Maßnahmen der Kultus-
verwaltungen ...34
2.4.3.3 Ziele und Maßnahmen der Wirtschaft ...35
2.4.3.4 Ziele und Maßnahmen der Gewerkschaften...36
2.5 Organisation und Umsetzung von Lernortkooperation ...38
2.5.1 Organisationsformen ...38
2.5.2 Kooperationsstellen als Organisationsform zur
Verstetigung ...39
2.5.3 Probleme bei der Wahl der Organisationsform und der
Einrichtung von Kooperationsstellen. ...41
2.5.4 Informations- und Kommunikationstechnologien...42
2.6 Aussichten und Perspektiven von Lernortkooperation im
dualen
System...44
3
Studien zum Stand der Lernortkooperation...47
3.1 Studie zum Stand der Aktivitäten der Lernortkooperation im
dualen System an Berufsschulen im Münsterland...47
3.1.1 Methodik der Studie ...47
3.1.1.1 Bestimmung des Forschungsproblems und
Theoriebildung ...47
3.1.1.2 Konzeptspezifikation, Operationalisierung und
Bestimmung der Untersuchungsform...48
3.1.1.3 Auswahl der Untersuchungsobjekte ...50
3.1.1.4 Datenerhebung...51
3.1.1.4.1
Standardisiertes Interview ...51
3.1.1.4.2 Fragebogen ...52
3.1.1.4.3 Durchführung ...53
Lernortkooperation im dualen System der Berufsausbildung - Eine Einführung
III
3.1.2 Beschreibung der Ergebnisse der Studie ... 54
3.1.3 Bewertung der Ergebnisse der Studie und
Rückschluss auf die Theorie... 58
3.2 Studie zum Stand der Effizienz der Lernortkooperation im
dualen System an den Berufsschulen in Nordrhein-Wesfalen .. 59
3.2.1 Methodik der Studie ... 59
3.2.1.1 Auswahl des Forschungsproblems und
Theoriebildung... 60
3.2.1.2 Konzeptspezifikation,
Operationalisierung
und Bestimmung der Untersuchungsform... 60
3.2.1.3 Auswahl der Untersuchungsobjekte ... 62
3.2.1.4 Datenerhebung... 63
3.2.1.4.1 Internetgestützte
schriftliche
Befragung ... 63
3.2.1.4.2 Fragebogen ... 64
3.2.1.4.3 Durchführung... 68
3.2.2 Beschreibung der Ergebnisse der Studie ... 69
3.2.3 Bewertung der Ergebnisse und Rückschluss auf die
Theorie der Studie ... 82
4
Schlussbetrachtung... 86
Literaturverzeichnis ... 91
Anhang... 95
Lernortkooperation im dualen System der Berufsausbildung - Eine Einführung
V
Abkürzungsverzeichnis
Abb.
-
Abbildung
BBiG
- Berufsbildungsgesetz
BIBB
- Bundesinstitut für Berufsbildung
BerBiFG
- Gesetz zur Förderung der Berufsbildung durch
Planung und Forschung
BLK
-
Bund-Länder-Kommission
BMBF
- Bundesministerium für Bildung und Forschung
BRD
- Bundesrepublik Deutschland
bzw.
- beziehungsweise
ca.
-
cirka
evtl.
- eventuell
ggf.
-
gegebenenfalls
Hrsg.
- Herausgeber
HwO
- Handwerksordnung
i.d.R.
- in der Regel
i.V.m.
- in Verbindung mit
KMK
- Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder
der Bundesrepublik Deutschland
kolibri
- Kooperation der Lernorte in der beruflichen Bildung
lt. -
laut
Nr.
-
Nummer
NRW
- Nordrhein-Westfalen
S. -
Seite
sog.
- so genannte
u.a.
- unter anderem
ÜBS
- überbetriebliche Bildungsstätten
usw.
- und so weiter
vgl.
-
vergleiche
WSF
- Wirtschaft- und Sozialforschung Kerpen
z.B. .
- zum Beispiel
z.T.
- zum Teil
Lernortkooperation im dualen System der Berufsausbildung - Eine Einführung
VII
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Zusammenhang von Handlungskompetenz, Lernfeldern
und
Lernsituationen
... 27
Abb. 2:
Stand der Zusammenarbeit aus Lehrer- und Schülersicht
... 73
Abb. 3: Inhaltliche Abstimmung der Ausbildungsinhalte aus der
Sicht der Auszubildenden... 74
Abb. 4: Zeitliche Abstimmung der Ausbildungsinhalte aus der
Sicht der Auszubildenden... 75
Abb. 5: Einfluss der Kooperation auf den Theorie-Praxis-Transfer
aus der Sicht der Auszubildenden ... 76
Abb. 6:
Einfluss der Lernortkooperationsprojekte auf die
Fachkompetenz
... 77
Abb. 7: Einfluss der Lernortkooperationsprojekte auf die
Methodenkompetenz ... 78
Abb. 8: Einfluss der Lernortkooperationsprojekte auf die
Sozialkompetenz... 79
Abb. 9: Einfluss der Lernortkooperationsprojekte auf die Noten in
den
Berufsschulzeugnissen... 80
Abb. 10: Einfluss der Lernortkooperationsprojekte auf die Abschluss-
prüfungen der zuständigen Stellen ... 81
Lernortkooperation im dualen System der Berufsausbildung - Eine Einführung
IX
Tabellenverzeichnis
Tab. 1:
Formen der Lernortkooperation
... 70
Tab. 2:
Struktur der Betriebe in den Lernortkooperationsprojekten
... 71
Tab. 3:
Intensitätsformen der Zusammenarbeit
... 72
Lernortkooperation im dualen System der Berufsausbildung - Eine Einführung
1
1 Einleitung
Bereits durch die Schaffung des dualen Ausbildungssystem und die daraus
resultierende Aufteilung der Berufsausbildung auf zwei Orte, den Ausbil-
dungsbetrieb und die Berufsschule, wurde auch die Kooperation dieser bei-
den Lernorte zum Thema. Durch die schwierige wirtschaftliche Situation
und die hohe Arbeitslosigkeit in Deutschland ist es wichtig, eine qualitativ
hochwertige Ausbildung zu gewährleisten. Die duale Berufsausbildung soll
den jungen Menschen eine Perspektive für ihr berufliches Leben geben und
die Konkurrenzfähigkeit der deutschen Wirtschaft im internationalen Wett-
bewerb durch qualifizierte Fachkräfte erhalten und steigern. Die Lernortko-
operation von Berufsschule und Ausbildungsbetrieb wird oft im Zusam-
menhang einer Weiterentwicklung, Qualitätssteigerung oder Rationalisie-
rung der Berufsausbildung genannt.
Ziel dieser Diplomarbeit ist es, das Thema ,,Lernortkooperation im dualen
System" durch eine Betrachtung seiner theoretischen und praktischen Seiten
kritisch zu bewerten. Um einen Überblick und ein Verständnis für den Beg-
riff ,,Lernortkooperation im dualen System" zu entwickeln, wird im ersten
Teil dieser Arbeit das Thema in seinen unterschiedlichen Fassetten anhand
von Literatur dargestellt. Im zweiten Teil der Arbeit werden empirische
Studien mit den Schwerpunkten ,,der aktuelle Stand der Lernortkooperation
im Münsterland" und ,,der Stand der Effizienz von Lernortkooperationspro-
jekten in Nordrhein-Westfalen" vorgestellt. Zur Darstellung der Lernortko-
operation im dualen System wird im Kapitel 2.1. der Begriff ,,Lernortkoope-
ration" definiert und abgegrenzt. Um verschiedene Betrachtungsebenen des
Themas zu ermöglichen, werden Vorschläge zur Differenzierung und Typi-
sierung von Lernortkooperation nach Verständnis, Aktivitäten und Intensitä-
ten unterbreitet.
Die Entwicklung des Themas ,,Lernortkooperation" von seinen Anfängen in
den 50er Jahren bis heute wird im Kapitel 2.2. dargestellt. Durch dieses Ka-
pitel soll ein Verständnis für die Vergangenheit und laufende Entwicklung
des Themas in der dualen Ausbildung bis heute entwickelt werden.
Das Kapitel 2.3 stellt die Rahmenbedingungen der Lernortkooperation im
Lernortkooperation im dualen System der Berufsausbildung - Eine Einführung
2
dualen Ausbildungssystem vor. Hierzu werden die rechtlichen, die instituti-
onellen und personellen Rahmenbedingungen sowie die Einstellungen der
Kooperationspartner zur Lernortkooperation dargestellt. Diese Rahmenbe-
dingungen haben einen unmittelbaren, prägenden Einfluss auf die Art und
Weise, wie Lernortkooperation heute praktiziert wird.
Die unterschiedlichen Ziele, die mit der Lernortkooperation verbunden wer-
den, sind Thema des Kapitels 2.4. Es werden die Ziele aus pädagogischer
Sicht und die Ziele und Maßnahmen auf der operativen und bundespoliti-
schen Ebene vorgestellt. Auf der operativen Ebene geht es um die verschie-
denen Ziele und Motive der Ausbildungsbetriebe und Berufsschulen sowie
der Ausbilder und Berufsschullehrer, welche die Lernortkooperation unmit-
telbar umsetzen sollen. Auf bundespolitischer Ebene, welche u.a. die Rah-
menbedingungen für die Lernortkooperation setzt, werden die Ziele und
Maßnahmen des Bundes, der Länder, der Wirtschaft und der Gewerkschaf-
ten aufgezeigt.
In Kapitel 2.5. wird die Organisation von Lernortkooperation behandelt. Es
werden in diesem Abschnitt verschiedene mögliche Organisationsformen
genannt, die Organisationsform der Kooperationsstelle als Möglichkeit zur
Verstetigung vorgestellt, die Probleme bei der Wahl der Organisationsform
und Einrichtung einer Kooperationsstelle beschrieben und die Möglichkei-
ten und Voraussetzungen zur Nutzung von Informations- und Kommunika-
tionstechnologien vorgestellt.
Zum Abschluss der Darstellung des Themas ,,Lernortkooperation im dualen
System" werden im Kapitel 2.6. die möglichen Aussichten und Perspektiven
der Lernortkooperation für die Zukunft vorgestellt.
Den zweite Teil dieser Diplomarbeit bilden zwei Studien zur Lernortkoope-
ration. Diese beiden Studien sollen einen Einblick in den aktuellen Stand
der Kooperationspraxis und der Effizienz von Lernortkooperationsprojekten
geben.
In der ersten Studie wird der aktuelle Stand der Lernortkooperation an Be-
rufsschulen im Münsterland untersucht. Es sollen die verschiedenen Ansätze
von Lernortkooperation sowie die Bedeutung und Nützlichkeit der Lernort-
kooperation für die Berufsschulen festgestellt werden. Dazu wird zuerst die
Lernortkooperation im dualen System der Berufsausbildung - Eine Einführung
3
Methodik der Studie vorgestellt und anschließend werden die Ergebnisse
beschrieben, um zuletzt bewertet zu werden.
Die zweite Studie betrifft die Berufsschulen in NRW. Diese Studie soll die
Effizienz von Lernortkooperationsprojekten im dualen System feststellen.
Es soll die Frage beantwortet werden: ,,Was bringen Lernortkooperations-
projekte eigentlich?". Hierzu werden die Projekte auf mögliche Verbesse-
rungen der Handlungskompetenz, der Zusammenarbeit von Schule und Be-
trieb, des Theorie-Praxis-Transfers der Schüler und der Leistungen der Aus-
zubildenden in den Abschlussprüfungen und Berufsschulzeugnissen unter-
sucht. Auch hier werden die Methodik vorgestellt, die Ergebnisse der Studie
beschrieben und am Ende ausgewertet.
2 Theoretische
Beschreibung
der Lernortkooperation im
dualen Ausbildungssystem
2.1 Definition und Typisierung von Lernortkooperation
Die Bezeichnung ,,Lernortkooperation" wird in der Diskussion in vielen
unterschiedlichen Bedeutungszusammenhängen genutzt. Um den Begriff
jedoch pragmatisch in dieser Arbeit nutzten zu können, ist eine klare Defini-
tion notwendig. Unter ,,Lernortkooperation" wird in dieser Arbeit das tech-
nisch-organisatorische und das pädagogisch begründete Zusammenwirken
des Lehr- und Ausbildungspersonals der an der beruflichen Bildung betei-
ligten Lernorte verstanden.
1
Meistens wird bei dem Begriff Lernort in der
Berufsbildung an den Ausbildungsbetrieb oder die Berufsschule gedacht. In
der Berufsbildung werden aber mehrere Lernorte von den Ausbildungsbe-
trieben und Berufsschulen genutzt, wie z.B. überbetriebliche Ausbildungs-
stätten, Lernbüros und -werkstätten. In dieser Arbeit wird unter dem Begriff
1
Vgl. Pätzold, G.: Lernfelder Lernortkooperation Neugestaltung der Beruflichen Bil-
dung. In: Dortmunder Beiträge zur Pädagogik - Band 30. Bochum 2002, S. 72
Lernortkooperation im dualen System der Berufsausbildung - Eine Einführung
4
Lernort die Berufschule oder der Ausbildungsbetrieb verstanden, alle ande-
ren Lernorte werden explizit extra benannt. Unter dem dualen System wird
die Berufsausbildung im Ausbildungsbetrieb und in der Berufsschule nach
dem BBiG verstanden.
Es gibt verschiedene Ansätze den Begriff ,,Lernortkooperation" zu typisie-
ren und damit zu strukturieren. Man kann Lernortkooperation nach dem
Verständnis, den Aktivitäten und der Intensität der Kooperation differenzie-
ren. Für die Typisierung nach PÄTZOLD ist eine intensive Zusammenarbeit
von Ausbildern und Lehrern, die Einstellung dieser zur Zusammenarbeit
und die Wichtigkeit, die diese der Zusammenarbeit zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben beimessen, von besonderer Bedeutung. Hierbei entstehen nach PÄT-
ZOLDs pädagogischer Typisierung vier handlungsleitende Verständnisebe-
nen der Kooperation:
2
1. Das
pragmatisch-formale Kooperationsverständnis, in dem die Ko-
operationsaktivitäten ausschließlich auf äußere, formale Veranlassungen
zurückgehen. Es werden über die Ableistungen von Verpflichtungen und
die Orientierung an prüfungsrelevanten Zielen und Inhalten hinaus kei-
nerlei Intentionen mit der Lernortkooperation verbunden.
2. Beim
pragmatisch-utilitaristischen Kooperationsverständnis werden
die Kooperationsaktivitäten unmittelbar aus subjektiven Problemerfah-
rungen in den täglichen Arbeitszusammenhängen abgeleitet. Ausgangs-
punkt für Formen der Zusammenarbeit ist ein einseitiger Bedarf, von
dem sich ggf. Gegenleistungen für die Kooperationsbereitschaft abhan-
deln lassen.
3. Das
didaktisch begründete Kooperationsverständnis basiert auf der
Auseinandersetzung mit Begründungszusammenhängen berufsbezoge-
nen Lernens sowie auf kriteriengeleiteten Entscheidungen über die der
eigenen Praxis vorzugebenden didaktischen-methodischen Grundlinien.
Ein solches Selbstverständnis leitet sich ab aus didaktisch-methodischen
Konzepten beruflichen Lernens.
2
Die 4. Verständnisebenen vgl. Pätzold, G.: Lernfelder Lernortkooperation Neugestal-
tung der Beruflichen Bildung: S. 75+76
Lernortkooperation im dualen System der Berufsausbildung - Eine Einführung
5
4. Das
bildungstheoretisch begründeten Kooperationsverständnis
nimmt das didaktisch-methodisch begründete Kooperationsverständnis
in sich auf und stützt sich zusätzlich auf eine umfassende Bildungstheo-
rie, aus der entsprechende Zielperspektiven für das gesellschaftliche
Handeln abgeleitet sind.
Der Typisierungsvorschlag von PÄTZOLD richtet sich auf die Verständnis-
ebene von Lernortkooperation. Für ihn soll Lernortkooperation die berufs-
pädagogischen Prozesse in der Berufsbildung optimieren. Kooperation lt.
PÄTZOLD ist am Verhalten bzw. an den Haltungen des in Betrieb und
Schule tätigen Ausbildungspersonals festzumachen.
3
Eine andere Betrachtungsebene als PÄTZOLD haben BERGER und
WALDEN, welche zur Typisierung die in der Praxis vorzufindenden Ko-
operationsaktivitäten zugrunde legen. Diese Typisierung nach den Koopera-
tionsaktivitäten ist lt. den Autoren eine Ergänzung zu der Typisierung nach
PÄTZOLD und soll diese nicht ersetzen, da es sich um eine andere Betrach-
tungsebene handelt.
4
Bei der Typisierung der Lernortkooperation orientieren
sich BERGER und WALDEN an den Merkmalen Kontakthäufigkeit, Ko-
operationsrahmen und Kooperationsinhalt, welche eine Differenzierung der
Kooperationsaktivitäten in der Kooperationspraxis ermöglichen.
5
Dem ent-
sprechend werden fünf Typen unterschieden:
6
1.
Keine Kooperationskontakte Die Ausbildung findet weitgehend
ohne Kontakte der Ausbildungsbetriebe und somit ohne Informations-
austausch zur zuständigen Berufsschule statt. Der Ausbildungsbetrieb
erkennt der Berufsschule nur einen geringen Stellenwert zu.
2.
Sporadische Kooperationsaktivitäten Kontakte werden meist durch
Zugehörigkeit zu Arbeitskreisen zwischen Betrieben und Berufsschulen
3
Vgl. Beutner, M.; Scheel, B.: Betriebsprojekttage Inhaltliche Ausgestaltung zwischen
Praxis-, Handlung- und Fachorientierung sowie anknüpfende Bestimmung des Typs der
Lernortkooperation. In: Kölner Zeitschrift für ,,Wirtschaft und Pädagogik" Heft 33 (2002)
S. 141
4
Vgl. Beutner, M.; Scheel, B.: Betriebsprojekttage Inhaltliche Ausgestaltung zwischen
Praxis-, Handlung- und Fachorientierung sowie anknüpfende Bestimmung des Typs der
Lernortkooperation. S. 142
5
Vgl. Pätzold, G.: Lernfelder Lernortkooperation Neugestaltung der Beruflichen Bil-
dung: S. 83
6
Vgl. Walden, G.: Verhaltensmuster und Bestimmungsgründe der Kooperation von Aus-
bildern und Berufsschullehrern. In: Lernortkooperation Stand und Perspektiven. Bielefeld
1999, S. 136-137
Lernortkooperation im dualen System der Berufsausbildung - Eine Einführung
6
vom Berufsbildungsgesetz/Handwerksordnung vorgeschrieben und in
Berufsbildungs- und Prüfungsausschlüssen realisiert. Die zeitlich-
organisatorische Abstimmung oder der prüfungsbezogene Informations-
austausch auf individuelle Veranlassung ist eher sporadisch. Der Aus-
bildungsprozess im Betrieb ist weitgehend autonom und in Abgrenzung
zur Berufsschule.
3.
Kontinuierlich-probleminduzierte Kooperationsaktivitäten Die
Berufsschulkontakte entstehen vorwiegend als Reaktion auf Ausbil-
dungs- und Prüfungsprobleme. Der Ausbildungsbetrieb akzeptiert die
Berufsschule durchaus als hilfreichen Ansprechpartner.
4.
Kontinuierlich-fortgeschrittene Kooperationsaktivitäten Hier zei-
gen sich erste Ansätze zu einem konstruktiven, teilweise didaktisch-
methodischen Kooperationsansatz. Es findet ein regelmäßiger Kontakt
unabhängig von aktuellen Problemen mit den Berufsschullehrern statt.
5.
kontinuierlich-konstruktive Kooperationsaktivitäten Die didak-
tisch-methodischen Ansätze zur organisierten Formen der Lernortkoope-
ration verfestigen sich. Durch individuelle Kontakte und regelmäßige
Mitarbeit in lernortübergreifenden Gremien findet die kontinuierliche
Zusammenarbeit statt. Diese Kooperation führt zur Durchführung ge-
meinsamer Ausbildungsprojekte.
Neben den Ansätzen die Lernortkooperation durch Kooperationsaktivitäten
oder das Kooperationsverständnis zu typisieren, kann auch der Grad der
Intensität der Zusammenarbeit betrachtet werden. Kooperatives Handeln
lässt sich demnach in unterschiedliche Grade aufteilen. Gegenseitiges In-
formieren über Erwartungen, Erfahrungen und Probleme als auch das Ab-
stimmen des berufspädagogischen Handelns zwischen Ausbildern und Be-
rufsschullehrern wird als kooperatives Handeln verstanden. Das Zusam-
menwirken, indem Lehrer und Ausbilder im Rahmen einer an pädagogi-
schen Kriterien ausgerichteten Zusammenarbeit gemeinsam vereinbarte
Vorhaben verfolgen, ist hier die höchste Form des kooperativen Handelns.
7
Bei all den Möglichkeiten Lernortkooperation zu typisieren und zu klassifi-
7
Vgl. Pätzold, G.: Lernfelder Lernortkooperation Neugestaltung der Beruflichen Bil-
dung. S. 72
Lernortkooperation im dualen System der Berufsausbildung - Eine Einführung
7
zieren gibt es nach WALDEN noch keine geschlossene Theorie, aus der
abzuleiten wäre, zu welchen Formen, über welche Inhalte und welchen In-
tensitäten die Partner im dualen System miteinander kooperieren sollten.
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass es keine für alle Konstellationen in der
beruflichen Bildung gleichermaßen sinnvollen Muster der Kooperation ge-
ben kann. Im dualen System haben sich sehr unterschiedliche Lernortkonfi-
gurationen herausgebildet, die durch die Lernorte selbst, die Rollenvertei-
lung im Ausbildungsprozess, die zu vermittelnden Curricula, personelle und
räumlich-sachliche Bedingungen sowie historisch herausgebildete Bezie-
hungsgefüge, eine sinnvolle, allgemein gültige Lernortkooperation aus-
schließen.
8
2.2 Lernortkooperation in historischer und aktueller Betrachtung
Das Thema Lernortkooperation ist nicht erst vor 10 Jahren in den Fokus der
Berufsbildung getreten, sondern hat sich seit den 50er Jahren ständig verän-
dert und unterliegt neuen Erwartungen. Diese Veränderungen und Erwar-
tungen an die Lernortkooperation sollen in diesem Kapitel dargestellt wer-
den, um ein Verständnis für das Thema zu vermitteln.
Das Bestreben der Berufsschulen war in den 50er Jahren weniger auf eine
kooperative Anbindung ausgelegt, sondern lag vielmehr in dem Bestreben
nach Abgrenzung, Autonomie und Souveränität. Die Berufsschulen wollten
sich nicht von den Ausbildungsbetrieben vereinnahmen lassen.
9
Berufsschu-
le und Ausbildungsbetriebe waren bis Mitte der 60er Jahre mittels eines
,,Gleichlauf-Curriculums" verbunden, welches die Ausbildungsinhalte di-
daktisch aber auch lehrmethodisch trennte. Den Ausbildungsbetrieben wur-
den inhaltlich und zeitlich die Praxis und den Berufsschulen die Theorie
8
Vgl. Walden, G.: Lernortkooperation und zukünftige Anforderungen an das duale System
der Berufsausbildung. In: Lernortkooperation Stand und Perspektiven. Bielefeld 1999, S.
80
9
Vgl. Euler, D.: Lernortkooperation eine unendliche Geschichte?. In: Handbuch der
Lernortkooperation Band 1: theoretische Fundierung. Bielefeld 2004, S. 12
Lernortkooperation im dualen System der Berufsausbildung - Eine Einführung
8
zugeordnet.
10
In den 60er Jahren wurde auch der Systemcharakter, z.B.
durch die Einführung des Berufsbildungsgesetzes 1969, stärker betont und
die Berufsschulen wurden formal ein ,,vollwertiger" Partner des dualen Sys-
tems.
11
In dem Begriff des ,,duales Systems" wird die Vorstellung, dass
zwei Subsysteme, Berufsschule und Ausbildungsbetrieb, im Interesse eines
übergeordneten Ganzen zusammenwirken, gesehen. Die Notwendigkeit ei-
ner engen Kooperation wird weitgehend aus dieser Dualität abgeleitet, was
erstmals 1964 in einem Gutachten des Deutschen Ausschusses für Erzie-
hung- und Bildungswesen formuliert wurde.
12
Seitdem ist die Lernortkoope-
ration nach EULER ein ,,Omnibusbegriff", auf den viel Wünschenswertes
aufgeladen wird.
13
Mit Kooperation war in den 60er Jahren vielfach ein ab-
gestimmtes Nebeneinander anstatt ein unmittelbares Zusammenwirken in
gemeinsamen Projekten gemeint. Neben begrifflichen Unschärfen gab es
auch Unkenntnis über die Praxis von Lernortkooperation und über den
Standort, welchen die Lernortkooperation konzeptionell und normativ in-
nerhalb der organisatorischen und didaktischen Strukturen des dualen Sys-
tems besitzen soll.
14
Erst in den 70er Jahren begannen die Forschungsbemü-
hungen zu diesen Fragestellungen, welche in den vergangenen 10 Jahren an
Intensität gewannen.
15
Bis Ende der 80er Jahre konzentrierten sich die theo-
retischen Bemühungen auch auf die spezifischen Stärken und Schwächen
der Lernorte, um eine optimale Aufgabenverteilung vorzunehmen. Um der
Differenziertheit des dualen Systems gerecht zu werden, waren die Ergeb-
nisse jedoch zu allgemein.
16
In der aktuellen Betrachtung sind in den vergangenen Jahren eine Vielzahl
von Beiträgen erschienen, die Fragen der Lernortkooperation mit Überle-
gungen zur Modernisierung des dualen Systems verbunden haben.
17
Allge-
mein finden Überlegungen zur Lernortkooperation eine breite Zustimmung,
10
Vgl. Euler, D.: Kooperation der Lernorte in der Berufsbildung Heft 73. Hrsg: Bund-
Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung, Bonn 1999, S. 9
11
Vgl. Euler, D.: Lernortkooperation eine unendliche Geschichte? S. 12
12
Vgl. Euler, D.: Kooperation der Lernorte in der Berufsbildung Heft 73. S. 8
13
Vgl. Euler, D.: Kooperation der Lernorte in der Berufsbildung Heft 73. S. 8
14
Vgl. Euler, D.: Kooperation der Lernorte in der Berufsbildung Heft 73. S. 9
15
Vgl. Euler, D.: Kooperation der Lernorte in der Berufsbildung Heft 73. S. 9
16
Vgl. Euler, D.: Kooperation der Lernorte in der Berufsbildung Heft 73. S. 9
17
Vgl. Euler, D.: Lernortkooperation eine unendliche Geschichte? S. 19
Lernortkooperation im dualen System der Berufsausbildung - Eine Einführung
9
solange die zugrunde liegenden Ziele ungeklärt und die Überlegungen im
Grundsatz verharren.
18
In den aktuellen Zielen hinsichtlich der Lernortko-
operation können pädagogische Ziele und Ziele auf der operativen- und be-
rufsbildungspolitischen Ebene unterschieden werden. Die aktuelle Bedeu-
tung zeigt sich auch in einer Reihe von Projekten zur Lernortkooperation
aus den Jahren 1999 bis 2003, die unter dem Programm ,,kolibri" von der
Bund-Länder-Kommission (BLK) durchgeführt wurden.
Zusammengefasst kann gesagt werden, dass die Berufsschule in den 50er
Jahren das Bestreben nach Abgrenzung, Autonomie und Souveränität hatte,
welches bis Mitte der 60er Jahre zu einer Trennung von Theorie in der Be-
rufsschule und Praxis im Ausbildungsbetrieb führte. Es gab auch begriffli-
che Unschärfen, was Lernortkooperation eigentlich ist und wie sie in der
Praxis umgesetzt werden soll. Erst in den 70er Jahren begann die theoreti-
sche Forschung zum Thema ,,Lernortkooperation", welche sich bis Ende der
80er auf spezifischen Stärken und Schwächen der Lernorte konzentrierte,
um eine optimale Aufgabenverteilung vorzunehmen. In den 90er Jahren bis
heute sind zur Modernisierung des dualen Systems mehrere Versuchsmodel-
le zur Lernortkooperation durchgeführt worden, um pädagogische, bil-
dungspolitische und operative Ziele zu erreichen.
2.3 Rahmenbedingungen der Lernortkooperation im dualen System
der Berufsausbildung
2.3.1 Rechtliche Rahmenbedingungen
Um das Thema ,,Lernortkooperation" zu verstehen, müssen die rechtlichen
Hintergründe des deutschen Berufsbildungssystems verdeutlicht werden, die
eine Kooperation der Lernorte u.a. bedingen. Dieses Kapitel zeigt die recht-
lichen Rahmenbedingungen der Berufsbildung und die daraus resultierenden
Kooperationen auf.
Die Berufsausbildung im dualen System in Deutschland findet hauptsäch-
18
Vgl. Euler, D.: Lernortkooperation eine unendliche Geschichte? S. 19
Lernortkooperation im dualen System der Berufsausbildung - Eine Einführung
10
lich in zwei rechtlich von einander getrennten Lernorten, dem Ausbildungs-
betrieb und der Berufsschule, statt. Diese rechtliche Situation trägt zur Zu-
sammenhangslosigkeit der Lernprozesse in der Berufsbildung bei.
Bei der Erstellung der Ausbildungspläne orientieren sich die Ausbildungs-
betriebe an den jeweiligen Ausbildungsordnungen, die vom zuständigen
Fachministerium im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) als Rechtsverordnung erlassen werden.
19
Die ge-
setzliche Grundlage für die Berufsausbildung in den Betrieben stellt das
Berufsbildungsgesetz (BBiG) zusammen mit den ,,Gesetz zur Förderung der
Berufsbildung durch Planung und Forschung,, (BerBiFG) dar. Für die Aus-
bildung im Handwerk gilt die Handwerksordnung (HwO), welche an das
BBiG angelehnt ist.
20
Die Fachaufsicht über die Berufsbildung liegt lt.
BBiG bei den Kammern als öffentlich-rechtliche Selbstverwaltungsorgane
der Wirtschaft bzw. bei den zuständigen Stellen. Die Kammern bzw. zu-
ständigen Stellen überwachen die gesetzlichen und ordnungsrechtlichen
Normen für die Berufsausbildung.
21
Die Länder verfügen über die Kulturhoheit und damit über die Zuständig-
keit für die Regelung des schulischen Teils der Berufsausbildung. Der Be-
rufsschulunterricht kann von den Länder, unabhängig von der betrieblichen
Ausbildung und der zuständigen Ausbildungsordnung des Bundes, geregelt
werden, welches in der Praxis jedoch nicht geschieht. Für die Berufsschulen
gelten die von den Landesparlamenten beschlossenen Schulgesetze der je-
weiligen Bundesländer. Auf Basis dieser Schulgesetze schaffen die Länder
Rechtsnormen. Das Kultusministerium als oberste Schulaufsichtsbehörde
der Länder erlässt Richtlinien und Lehrpläne und setzt damit einen Rahmen
für Ziele, Inhalte und Verfahrensgrundsätze.
22
Auf der Ebene der Bezirksre-
gierungen werden sogenannte ,,innere Angelegenheiten", wie pädagogische
19
Vgl. Pätzold, G.: Rechtliche Rahmenbedingungen der dualen Berufsausbildung und Be-
darf an Lernortkooperation. In: Lernortkooperation Stand und Perspektiven. Bielefeld
1999, S. 88
20
Vgl. Pätzold, G.: Rechtliche Rahmenbedingungen der dualen Berufsausbildung und Be-
darf an Lernortkooperation. S. 96
21
Vgl. Pätzold, G.: Rechtliche Rahmenbedingungen der dualen Berufsausbildung und Be-
darf an Lernortkooperation. S. 96
22
Vgl. Pätzold, G.: Rechtliche Rahmenbedingungen der dualen Berufsausbildung und Be-
darf an Lernortkooperation. S. 98
Lernortkooperation im dualen System der Berufsausbildung - Eine Einführung
11
Fragen und Aufgaben, behandelt. Die kommunalen Schulverwaltungsämter
sind für äußere Angelegenheiten, wie z.B. die Errichtung und Ausstattung
von Schulen zuständig. Die Lehrpläne für die Berufsschulen leiten sich aus
den Rahmenlehrplänen der ,,ständigen Konferenz der Kultusminister der
Länder der Bundesrepublik Deutschland" (KMK) ab. Die Rahmenlehrpläne
basieren auf einstimmigen Beschlüssen der KMK und sind ein wesentliches
Instrument zur Vereinheitlichung der schulischen Berufsausbildung und
Grundlage für die Abstimmung mit den Ausbildungsverordnungen des
Bundes. Diese Rahmenlehrpläne der KMK haben für die Länder den Cha-
rakter von Empfehlungen, welche i.d.R. aber übernommen werden.
23
Um diesem Dilemma der unterschiedlichen rechtlichen Grundlagen der
Lernorte zu begegnen, gibt es verschiedene Ausschüsse und Institutionen
auf Bundes-, Landes- und Regionalebene. Sie sollen die Abstimmung und
Koordinierung der Berufsausbildung an den beiden Lernorten unterstützen.
Auf der Bundesebene findet lt. PÄTZOLD die einzige Abstimmung unter
den Institutionen Betrieb und Schule unter rechtlichem Aspekt durch die
Bundesregierung und die KMK im Koordinierungsausschuss statt.
24
In dem
Koordinierungsausschuss sollen die Rahmenlehrpläne der KMK und die
Ausbildungsordnung des Bundes aufeinander abgestimmt werden. Eine
funktionierende Kooperation von betrieblicher und schulischer Ausbildung
kann nur nach weitgehend verbindlichen, zwischen dem Bund und den Län-
der abgestimmten, Plänen erfolgen.
25
Die Abstimmung der Rahmenlehrpläne und der Ausbildungsordnungen wird
nach dem BerBiFG im Hauptausschluss und den Landesausschüssen vom
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) unterstützt und vorbereitet.
26
Die
Landesausschüsse des BIBB sind ein ständiger Unterausschuss des Haupt-
ausschusses. Das BIBB hat noch weitere Aufgaben wie u.a. die Vorberei-
tung von Rechtsverordnungen, Mitarbeit an Modellversuchen und Beratung
23
Vgl. Pätzold, G.: Rechtliche Rahmenbedingungen der dualen Berufsausbildung und Be-
darf an Lernortkooperation. S. 105
24
Vgl. Pätzold, G.: Rechtliche Rahmenbedingungen der dualen Berufsausbildung und Be-
darf an Lernortkooperation. S. 90
25
Vgl. Pätzold, G.: Rechtliche Rahmenbedingungen der dualen Berufsausbildung und Be-
darf an Lernortkooperation. S. 89
26
Vgl. § 6 (2) Nr. 1a i.V.m. § 8 BerBiFG
Lernortkooperation im dualen System der Berufsausbildung - Eine Einführung
12
der Bundesregierung in der beruflichen Bildung.
Auf Landesebene gibt es weitere Abstimmung in den Landesausschüssen
der Länder nach §§ 54 und 55 BBiG. In diesen Landesausschüssen der Län-
der soll im Interesse einer einheitlichen Berufsbildung die Zusammenarbeit
zwischen schulischer und betrieblicher Berufsbildung gesichert werden. Der
Landesausschuss hat die Aufgabe, auf eine Abstimmung und Koordinierung
zwischen den Ausbildungsordnungen und den schulischen Rahmenlehrplä-
nen der Länder hinzuwirken.
27
Hier können vor der Übernahme der KMK-
Rahmenlehrpläne bzw. vor deren Konkretisierung und Inkraftsetzung durch
Landeslehrpläne länderspezifische Abstimmungen mit den Ausbildungsver-
ordnungen des Bundes vorgenommen werden.
28
All diese Ausschüsse auf Bundes- und Länderebene beziehen sich nur auf
übergeordnete Fragen der Berufsbildung. Auf der Kreis- und Ortsebene gibt
es kaum organisierte Kooperation zwischen Berufsschullehrern und betrieb-
lichen Ausbildern. Allenfalls Prüfungsausschüsse nach § 37 BBiG und lt. §
56 59 BBiG die Berufsbildungsausschüsse der zuständigen Stellen, die zur
Förderung der Kooperation auf regionaler Ebene angesiedelt sind. Diese
Berufsbildungsausschüsse sind drittelparitätisch mit Arbeitgebern, Arbeit-
nehmern und Lehrern besetzt, letztere haben aber nur eine beratene Stimme.
Die Abstimmungsverfahren auf der Kreis- und Kommunalebene sind jedoch
lt. PÄTZOLD rechtlich und institutionell nicht abgesichert
29
. Die Zusam-
menarbeit ist abhängig von der Initiative der betrieblichen Ausbilder und
der Berufsschullehrer. Um die engagierten Ausbilder und Berufsschullehrer
zu unterstützen, gibt es Lehrerkonferenzen bzw. in NRW Bildungsgangkon-
ferenzen. Bildungsgangkonferenzen sind ein Schulmitwirkungsgremium,
das die herkömmlichen Fachkonferenzen ersetzt bzw. ergänzt und sich aus
Vertretern der Eltern, Schüler, Lehrenden und Ausbildungsbetrieben zu-
sammensetzt.
30
27
Vgl. § 9 (1) BerBiFG
28
Vgl. Pätzold, G.: Rechtliche Rahmenbedingungen der dualen Berufsausbildung und Be-
darf an Lernortkooperation. S. 102
29
Vgl. Pätzold, G.: Rechtliche Rahmenbedingungen der dualen Berufsausbildung und Be-
darf an Lernortkooperation. S. 102
30
Vgl. Pätzold, G.: Rechtliche Rahmenbedingungen der dualen Berufsausbildung und Be-
darf an Lernortkooperation. S. 102
Lernortkooperation im dualen System der Berufsausbildung - Eine Einführung
13
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in der Berufsausbildung zwei Ler-
norte beteiligt sind, welche neben der räumlich-organisatorischen Trennung,
auch unterschiedliche rechtliche Grundlagen zur Berufsausbildung haben:
Daher ist eine Kooperation der Lernorte besonders notwendig, um eine
bestmögliche Ausbildung zu gewährleisten. Auf der Ebene des Bundes und
der Länder werden die übergeordneten Fragen und Abstimmungen zu den
Rahmenlehrplänen und Ausbildungsordnungen getroffen. Hierzu sind auf
diesen Ebenen feste Ausschüsse und Institutionen verankert. Auf regionaler
Ebene gibt es nur wenige Ausschüsse der zuständigen Stellen, in denen Leh-
rer und Ausbilder zusammenkommen können. Die Kooperation in diesen
Ausschüssen sowie weitere Kooperation auf der lokalen Ebene darüber hin-
aus ist abhängig vom Engagement der Ausbilder und Berufsschullehrer.
2.3.2 Institutionelle und personelle Rahmenbedingungen in den Lern-
orten Ausbildungsbetrieb und Berufsschule
Zum weiteren Verständnis des Themas ,,Lernortkooperation im dualen Aus-
bildungssystem" müssen die Rahmenbedingungen in den beiden wichtigsten
Lernorten dieses Systems, dem Ausbildungsbetrieb und der Berufsschule,
näher betrachtet werden. Ergänzend werden kurz auch die überbetrieblichen
Bildungsstätten betrachtet, welche bei der Ausbildung in Handwerksbetrie-
ben eine Rolle spielen. Die Rahmenbedingungen in den beiden Institutionen
Betrieb und Schule sowie ihre Vertreter sind Grundlage für ein Verständnis
der Ziele und Erwartungen, Einstellungen und Verhaltensmuster, Aufgaben
und Probleme zur Lernortkooperation.
Um die Rahmenbedingungen in der Institution Betrieb zu verstehen, muss
die Berufsausbildung auf die allgemeinen Ziele des Unternehmens bezogen
werden. Die Ausbildung ist für die Betriebe kein Selbstzweck, sondern vom
ökonomischen Zweck des Unternehmens abhängig. Die Ausbildung muss
dem Betrieb einen Nutzen einbringen. Je nach Schwerpunktsetzung hat die
betriebliche Ausbildung für die Unternehmen unterschiedliche Ziele. Aus-
bildung ist für die Betriebe nach einer von WALDEN ausgewerteten Studie
des BIBB von 1991 in erster Linie ein Mittel, die wirtschaftliche Existenz
Lernortkooperation im dualen System der Berufsausbildung - Eine Einführung
14
durch die langfristige Rekrutierung von Fachkräftenachwuchs zu sichern.
Weitere Ziele wie die Steigerung der Reputation des Unternehmens durch
Ausbildung und der produktive Einsatz im Unternehmen sind von eher ge-
ringerer Bedeutung.
31
Für die Zusammenarbeit mit den Berufschulen bedeu-
tet dies, dass Inhalte und Ausrichtungen einer Kooperation unter dem
Blickwinkel der betrieblichen Interessenlage betrachtet werden. Dadurch,
dass die Ausbildung von Nachwuchskräften und deren bestmögliche Integ-
ration in die betriebliche Arbeitsorganisation für die Betriebe ein wichtiges
Ziel darstellt, sind sie in erster Linie an der Vermittlung solcher Qualifikati-
onen interessiert, die zur Erfüllung der Arbeitsaufgaben auch tatsächlich
gebraucht werden. Durch diese betriebliche Interessenlage an der Ausbil-
dung im Betrieb sind Rahmenbedingungen für eine mögliche Kooperation
der Lernorte gesetzt worden.
32
Auch sind die Interessen der Betriebe an der
Ausbildung untereinander nicht homogen und müssen im Rahmen der Ko-
operation ausgeglichen werden.
33
Weitere Unterschiede unter den Ausbil-
dungsbetrieben liegen in den Ausbildungsberufen, den Branchen und der
Größe der Betriebe.
34
Grundlegend können nach EULER Betriebe mit ei-
nem hochstrukturierten und mit einem niedrigstrukturierten Ausbildungsbe-
reich unterschieden werden. Hochstrukturierte Betriebe haben im Gegensatz
zu niedrigstrukturierten einen organisatorischen Rahmen für die Ausbil-
dung, insbesondere sichtbar an einem Mindestanteil an produktionsunab-
hängigen Lernprozessen, einem hauptamtlichen, qualifizierten Ausbil-
dungspersonal, definierten ausbildungsbezogenen Tätigkeitsprofilen und
Leitlinien sowie Planvorgaben für die Ausbildungspraxis, wie z.B. Ausbil-
dungspläne und die Überprüfung von Qualitätsstandards.
35
Die Zusammenarbeit mit den Berufsschulen findet meistens mit den Vertre-
tern des betrieblichen Ausbildungspersonals statt. Bei den Ausbildern han-
31
Vgl. Walden, G.: Institutionelle und personelle Rahmenbedingungen der Zusammenar-
beit zwischen Ausbildern und Berufsschullehrern. In: Lernortkooperation Stand und Per-
spektiven. Bielefeld 1999, S. 113-114
32
Vgl. Walden, G.: Institutionelle und personelle Rahmenbedingungen der Zusammenar-
beit zwischen Ausbildern und Berufsschullehrern. S. 115-116
33
Vgl. Walden, G.: Institutionelle und personelle Rahmenbedingungen der Zusammenar-
beit zwischen Ausbildern und Berufsschullehrern. S. 116
34
Vgl. Euler, D.: Kooperation der Lernorte in der Berufsbildung Heft 75. Hrsg: Bund-
Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung, Bonn 1999, S. 15
35
Vgl. Euler, D.: Kooperation der Lernorte in der Berufsbildung Heft 75. S. 16
Lernortkooperation im dualen System der Berufsausbildung - Eine Einführung
15
delt es sich um einen sehr heterogenen Personenkreis hinsichtlich ihres Sta-
tus im Betrieb, ihrer Branche, Tätigkeit, Bildung und ihrem berufsbiogra-
phischen Hintergrund. Bei diesen Mitarbeitern kann es sich um einen haupt-
oder nebenamtlichen Ausbilder handeln. Hauptamtliche Ausbilder sind oft
in größeren Unternehmen mit hochstrukturierten Ausbildungsbereichen an-
zutreffen, neben ihnen gibt es an den Ausbildungsplätzen meist mehrere
nebenamtliche Ausbilder. In kleineren Betrieben wie im Handwerk ist häu-
fig der Inhaber auch der Hauptverantwortliche für die Ausbildung.
36
Der
hauptamtliche Ausbilder beschäftigt sich mit der Planung und Organisation
der Ausbildung, während unterschiedliche Fachkräfte die Unterweisung der
Auszubildenden übernehmen. Der Kontakt zur Berufsschule ist i.d.R. Auf-
gabe des hauptamtlichen Ausbilders, der im Schnitt, mit Ausnahme des
Handwerks, auch mehr Zeit für eine Zusammenarbeit mit der Berufsschule
hat.
37
Für die Lernortkooperation sind lt. EULER hauptamtliche Ausbilder
von großem Vorteil, da diese die nötige Zeit zur Verfügung haben und i.d.R.
auch aus einer pädagogischen Perspektive agieren und argumentieren.
38
Der
größte Teil der Ausbilder ist aber nur nebenberuflich mit Ausbildungsauf-
gaben befasst. Nebenberufliche Ausbilder sehen sich lt. WALDENs Inter-
pretation einer Studie des BIBB von 1990 selbst mehr als Fachleute und
nicht als Ausbilder.
39
Sie sind zumeist nicht auf ihre pädagogische Aufgabe
vorbereitet und somit ist die Vermittlung von in der Praxis erforderlichen
Fachaufgaben begrenzt.
40
Aufgrund dieser Heterogenität der Ausbilder
müssen sich die Berufsschullehrer bei der Lernortkooperation auf z.T. sehr
unterschiedliche Partner einstellen. Die Arbeitssituation und die Anforde-
rungen an das betriebliche Ausbildungspersonal wird von PÄTZOLD als
,,komplex", ,,disparat" und ,,dynamisch" bezeichnet. ,,Komplex" ist die Si-
tuation aufgrund der Vielzahl von Institutionen, wie z.B. Kammern, Eltern,
Betriebsrat usw., die Ansprüche an die verschiedenen Ebenen betrieblicher
36
Vgl. Walden, G.: Institutionelle und personelle Rahmenbedingungen der Zusammenar-
beit zwischen Ausbildern und Berufsschullehrern. S. 118
37
Vgl. Walden, G.: Institutionelle und personelle Rahmenbedingungen der Zusammenar-
beit zwischen Ausbildern und Berufsschullehrern. S. 118+120
38
Vgl. Euler, D.: Kooperation der Lernorte in der Berufsbildung Heft 75. S. 16
39
Vgl. Walden, G.: Institutionelle und personelle Rahmenbedingungen der Zusammenar-
beit zwischen Ausbildern und Berufsschullehrern. S. 120
40
Vgl. Euler, D.: Kooperation der Lernorte in der Berufsbildung Heft 75. S. 16
Lernortkooperation im dualen System der Berufsausbildung - Eine Einführung
16
Berufsausbildung herantragen. Die verschiedenen, teilweise gegensätzlichen
Anforderungen machen die Situation disparat. Der stetige Wandel in den
Rahmenbedingungen der Ausbildung zeigt die Dynamik der Arbeitssituati-
on der Ausbilder auf.
41
Allgemein richten die Ausbilder ihre Ausbildungs-
aktivitäten an den wirtschaftlichen Zielen eines Betriebes aus, dabei sollen
die betrieblichen Ausbildungstätigkeiten möglichst reibungsfrei in den nor-
malen betrieblichen Arbeitsablauf integriert werden.
42
Zur Unterstützung
und Ergänzung für Betriebe mit spezialisierten Verfahrens-, Produktions-
und Dienstleistungsstrukturen gibt es die überbetrieblichen Berufsbildungs-
stätten (ÜBS).
43
Diese Unterstützung ist wichtig, da diese spezialisierten
Betriebe keine komplette Grundausbildung vermitteln können.
44
Die ÜBS
vermitteln Selbstlernkompetenz im Sinne von Lernmethodik und Fachbil-
dung orientiert am neuesten Stand der Technik.
45
Dabei bekommt die ÜBS
eine Katalysefunktion zwischen Schule und Betrieb und soll Erfahrungen an
den beiden Lernorten verknüpfen.
46
Die Entwicklung der ÜBS geht heute
weg von den Berufsausbildungsstätten hin zu Berufsbildungsstätten, welche
mit den Berufsschulen Kompetenzzentren bilden sollen.
47
Die Aufgaben der Berufsschulen sind in Ländergesetzen und entsprechen-
den Verordnungen rechtlich normiert. Die Kooperation mit den Ausbil-
dungsbetrieben ist gar nicht oder, wie z.B. in der Ausbildungsordnung für
Berufsschulen in NRW, nur in Form von allgemeinen Kooperationsver-
pflichtungen rechtlich normiert.
48
Vielerorts existieren zwar Arbeitskreise
41
Vgl. Pätzold, G.; Drees, G.: Betriebliche Realität und pädagogische Notwendigkeit. Köln
1989, S. 32+33
42
Vgl. Walden, G.: Institutionelle und personelle Rahmenbedingungen der Zusammenar-
beit zwischen Ausbildern und Berufsschullehrern. S. 125
43
Vgl. Pätzold, G.: Kooperation der Lernorte im dualen System der Berufsbildung be-
rufspädagogische Begründung und historische Aspekte. In: Lernortkooperation Stand und
Perspektiven. Bielefeld 1999, S. 35
44
Vgl. Twardy, M.: Auf dem Weg zu Kompetenzzentren: Strukturelle, personelle und kul-
turelle Bedingungen in überbetrieblichen Ausbildungsstätten. In: Handbuch der Lernortko-
operation Band 1: theoretische Fundierung. Bielefeld 2004, S. 243
45
Vgl. Twardy, M.: Auf dem Weg zu Kompetenzzentren: Strukturelle, personelle und kul-
turelle Bedingungen in überbetrieblichen Ausbildungsstätten. S. 243
46
Vgl. Twardy, M.: Auf dem Weg zu Kompetenzzentren: Strukturelle, personelle und kul-
turelle Bedingungen in überbetrieblichen Ausbildungsstätten. S. 243
47
Vgl. Twardy, M.: Auf dem Weg zu Kompetenzzentren: Strukturelle, personelle und kul-
turelle Bedingungen in überbetrieblichen Ausbildungsstätten. S. 243+252
48
Vgl. Walden, G.: Institutionelle und personelle Rahmenbedingungen der Zusammenar-
beit zwischen Ausbildern und Berufsschullehrern. S. 126
Lernortkooperation im dualen System der Berufsausbildung - Eine Einführung
17
aus Lehren und Ausbildern bei den Kammern, doch erfassen diese zum ei-
nen i.d.R. nur die stärker besetzten Ausbildungsbereiche, zum anderen wird
selbst dort die Kooperationsintensität zumeist als niedrig beurteilt.
49
Im
Hinblick auf die vorhandenen institutionellen und personellen Bedingungen
gibt es unter den Berufsschulen große Unterschiede. Diese Unterschiede
bilden sich lt. WALDEN durch das Spektrum der vertretenen Ausbildungs-
berufe, das Angebot an sonstigen berufsbildenden Schularten, die persönli-
chen Voraussetzungen der Auszubildenden, Zusammensetzung des Kollegi-
ums und Schwerpunktsetzung des Schulleiters
50
. Durch den Ausbildungsbe-
ruf und regionale Einflüsse kommt es zu Unterschieden in den Lernvoraus-
setzungen und -motivationen der Schüler. Für den Berufsschullehrer können
sich je nach Leistungsstand und Lernmotivation unterschiedliche Ansatz-
punkte zur Notwendigkeit für eine Zusammenarbeit mit den Ausbildungsbe-
trieben ergeben.
51
Für EULER lassen sich die Schulen am besten über die
,,Kooperationskultur im Innenverhältnis" unterscheiden. Hierunter fallen für
ihn sowohl das Führungsverständnis der Schulleitung als auch die Verant-
wortung- und Kooperationsbereitschaft im Kollegium.
52
Auch WALDEN
sieht die Unterstützung des Schulleiters bei der Zusammenarbeit mit den
Ausbildungsbetrieben sowie die Sichtweise der Kooperation innerhalb der
Schule unter den Lehrenden selbst als bedeutend an, da für ihn das Koopera-
tionsklima wesentlich von der Einstellung und den Aktivitäten des Schullei-
ters abhängig ist.
53
Die Berufsschullehrer besitzen nach WALDEN große Gestaltungsfreiräume,
welche zu einem Engagement im Rahmen der Lernortkooperation führen
können. Ob sie diese Freiräume auch zur Lernortkooperation nutzen, liegt
an der Einschätzung des Berufsschullehrers, ob diese Zusatzbelastung den
eigenen Zielen, seien sie didaktisch oder arbeitsökonomisch, nützt.
54
Die
49
Vgl. Euler, D.: Kooperation der Lernorte in der Berufsbildung Heft 75. S. 18
50
Vgl. Walden, G.: Institutionelle und personelle Rahmenbedingungen der Zusammenar-
beit zwischen Ausbildern und Berufsschullehrern. S. 126
51
Vgl. Walden, G.: Institutionelle und personelle Rahmenbedingungen der Zusammenar-
beit zwischen Ausbildern und Berufsschullehrern. S. 126
52
Vgl. Euler, D.: Kooperation der Lernorte in der Berufsbildung Heft 75. S. 17
53
Vgl. Walden, G.: Institutionelle und personelle Rahmenbedingungen der Zusammenar-
beit zwischen Ausbildern und Berufsschullehrern. S. 126
54
Vgl. Euler, D.: Kooperation der Lernorte in der Berufsbildung Heft 75. S. 18
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2005
- ISBN (eBook)
- 9783836603720
- DOI
- 10.3239/9783836603720
- Dateigröße
- 655 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Fachhochschule Münster – Wirtschaftswissenschaften, Studiengang Betriebswirtschaftslehre
- Erscheinungsdatum
- 2007 (Juni)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- duales system lernort kooperation berufsschule kooperationsstellen organisationsformen lernortkooperation
- Produktsicherheit
- Diplom.de