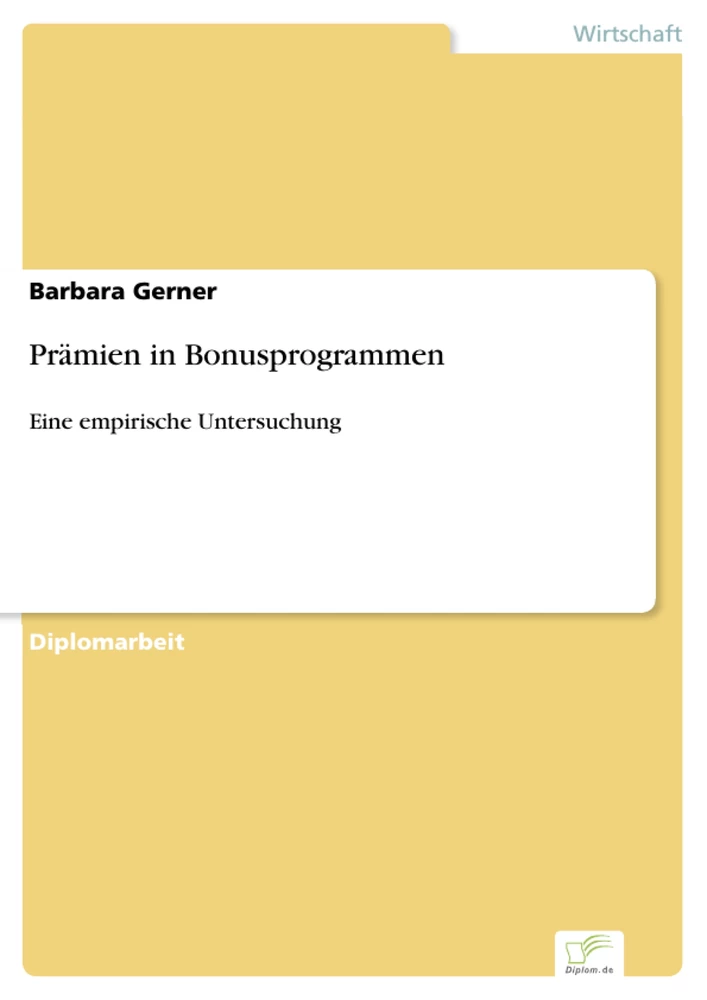Prämien in Bonusprogrammen
Eine empirische Untersuchung
©2006
Diplomarbeit
110 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine empirische Untersuchung. Untersuchungsgegenstand ist das Bonusprogramm und seine Wirkungsweise als Kundenbindungsmaßnahme. Besonderer Fokus der Untersuchung liegt auf der Ausgestaltung der Prämien als Kaufanreiz für den Kunden. Welche Prämien eignen sich besonders, die Kaufmotivation des Konsumenten zu steigern?
Die Untersuchung basiert auf fundierten Erkenntnissen aus der Verhaltenspsychologie, aus denen Hypothesen bezüglich der Ausgestaltung von Bonusprogrammen abgeleitet werden. Der empirischen Untersuchung vorgelagert ist außerdem eine ausführliche Darstellung von Wirkungsweise, historischer und rechtlicher Entwicklung u.ä. von Bonusprogrammen.
Problemstellung:
Spätestens seit dem Wegfall des Rabattgesetzes im Jahr 2001 erfreuen sich Bonusprogramme auch in Deutschland immer größerer Beliebtheit. Lange Zeit wurden Bonusprogramme nur im Bereich der Fluggesellschaften als sogenannte Vielfliegerprogramme eingesetzt. Mittlerweile entdecken auch viele andere Branchen dieses Instrument der Kundenbindung wieder.
Die Aktualität des Themas hat bereits diverse wissenschaftliche Arbeiten zu verschiedenen Aspekten des Bonusprogramms hervorgebracht. Bisher hat sich jedoch keine Arbeit detaillierter mit der Frage beschäftigt, welche Arten von Prämien Teilnehmern von Bonusprogrammen angeboten werden sollten. Für den Erfolg von Bonusprogrammen bei Kunden ist aber gerade die Art der angebotenen Prämien von hoher Bedeutung. Denn die Prämien sind es, welche die Kunden mit ihrer Teilnahme am Programm anstreben. Entsprechen diese nicht den Bedürfnissen der Kunden, so werden diese auch nicht zum Kauf von Produkten bzw. Dienstleistungen oder anderen gewünschten Verhaltensweisen motiviert.
Gerade aber die Schaffung eines Anreizes für den Kunden, regelmäßig beim Anbieter des Bonusprogramms anstelle bei der Konkurrenz einkaufen zu gehen, ist zentraler Bestandteil eines Bonusprogramms. Der Kunde soll für ein treues, regelmäßiges Einkaufen beim Bonusprogrammanbieter durch die Prämien belohnt und von einem Wechsel zur Konkurrenz abgehalten werden. Werden nun aber dem Kunden zu wenig Anreize in Form von attraktiven Prämien geboten, ist der zentrale Wirkungsmechanismus des Bonusprogramms außer Kraft gesetzt und die Zielsetzung des Programms gefährdet.
Diese zentrale Stellung der Prämien im Gesamtkonzept eines Bonusprogramms gebietet es, über ihre Ausgestaltung und Wirkungsweise […]
Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine empirische Untersuchung. Untersuchungsgegenstand ist das Bonusprogramm und seine Wirkungsweise als Kundenbindungsmaßnahme. Besonderer Fokus der Untersuchung liegt auf der Ausgestaltung der Prämien als Kaufanreiz für den Kunden. Welche Prämien eignen sich besonders, die Kaufmotivation des Konsumenten zu steigern?
Die Untersuchung basiert auf fundierten Erkenntnissen aus der Verhaltenspsychologie, aus denen Hypothesen bezüglich der Ausgestaltung von Bonusprogrammen abgeleitet werden. Der empirischen Untersuchung vorgelagert ist außerdem eine ausführliche Darstellung von Wirkungsweise, historischer und rechtlicher Entwicklung u.ä. von Bonusprogrammen.
Problemstellung:
Spätestens seit dem Wegfall des Rabattgesetzes im Jahr 2001 erfreuen sich Bonusprogramme auch in Deutschland immer größerer Beliebtheit. Lange Zeit wurden Bonusprogramme nur im Bereich der Fluggesellschaften als sogenannte Vielfliegerprogramme eingesetzt. Mittlerweile entdecken auch viele andere Branchen dieses Instrument der Kundenbindung wieder.
Die Aktualität des Themas hat bereits diverse wissenschaftliche Arbeiten zu verschiedenen Aspekten des Bonusprogramms hervorgebracht. Bisher hat sich jedoch keine Arbeit detaillierter mit der Frage beschäftigt, welche Arten von Prämien Teilnehmern von Bonusprogrammen angeboten werden sollten. Für den Erfolg von Bonusprogrammen bei Kunden ist aber gerade die Art der angebotenen Prämien von hoher Bedeutung. Denn die Prämien sind es, welche die Kunden mit ihrer Teilnahme am Programm anstreben. Entsprechen diese nicht den Bedürfnissen der Kunden, so werden diese auch nicht zum Kauf von Produkten bzw. Dienstleistungen oder anderen gewünschten Verhaltensweisen motiviert.
Gerade aber die Schaffung eines Anreizes für den Kunden, regelmäßig beim Anbieter des Bonusprogramms anstelle bei der Konkurrenz einkaufen zu gehen, ist zentraler Bestandteil eines Bonusprogramms. Der Kunde soll für ein treues, regelmäßiges Einkaufen beim Bonusprogrammanbieter durch die Prämien belohnt und von einem Wechsel zur Konkurrenz abgehalten werden. Werden nun aber dem Kunden zu wenig Anreize in Form von attraktiven Prämien geboten, ist der zentrale Wirkungsmechanismus des Bonusprogramms außer Kraft gesetzt und die Zielsetzung des Programms gefährdet.
Diese zentrale Stellung der Prämien im Gesamtkonzept eines Bonusprogramms gebietet es, über ihre Ausgestaltung und Wirkungsweise […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Barbara Gerner
Prämien in Bonusprogrammen
Eine empirische Untersuchung
ISBN: 978-3-8366-0278-5
Druck Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2007
Zugl. Universität zu Köln, Köln, Deutschland, Diplomarbeit, 2006
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2007
Printed in Germany
Prämien in Bonusprogrammen - Eine empirische Untersuchung
I
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis ... III
1 Problemstellung und Gang der Untersuchung ... 1
2 Definitorische und historische Grundlagen ... 3
2.1 Begriffliche Erfassung von Bonusprogrammen ... 3
2.3 Historische und rechtliche Entwicklung von Bonusprogrammen ... 4
2.2 Funktionsweise von Bonusprogrammen ... 6
2.4 Typologisierung von Prämien ... 7
3 Theoretische Grundlagen... 9
3.1 Motivationstheorie... 9
3.1.1 Instrumentalitätstheorie ... 10
3.1.2 Konsummotive ... 13
3.2 Equity-Theorie... 17
3.3 Modellrahmen der empirischen Untersuchung ... 20
3.4 Hypothesenbildung... 22
4 Die empirische Untersuchung... 27
4.1 Operationalisierung der Hypothesen ... 27
4.2 Erhebungsdesign und Durchführung der Befragung... 28
Prämien in Bonusprogrammen - Eine empirische Untersuchung
II
4.3 Auswertung und Darstellung der Ergebnisse ... 32
4.3.1 Auswertung der Hypothesen zur Motivationstheorie anhand
einzelner Regressionsanalysen ... 33
4.3.2 Auswertung des Gesamtmodells mit AMOS ... 46
5 Bewertung der Untersuchungsergebnisse und Ableitung von
Handlungsempfehlungen ... 57
6 Zusammenfassung ... 65
Anhang ... 67
Literaturverzeichnis... 101
Prämien in Bonusprogrammen - Eine empirische Untersuchung
III
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Überblick über Definitionen des Begriffs ,,Bonusprogramm"... 3
Abbildung 2: Funktionsweise von Bonusprogrammen
(Quelle: in Anlehnung an Lauer, T., 2002, S.99) ... 6
Abbildung 3: Attraktivität der Prämie (1) ... 11
Abbildung 4: Konsumentenmotivation (1)... 12
Abbildung 5: Bedürfnispyramide nach Maslow... 14
Abbildung 6: theoretischer Modellrahmen... 20
Abbildung 7: Attraktivität der Prämie (2) ... 22
Abbildung 8: Konsumentenmotivation (2)... 24
Abbildung 9: Kundenaufwand ... 25
Abbildung 10: Nutzung des Internets 2005 nach Geschlecht, Angaben in %... 30
Abbildung 11: Nutzung des Internets 2005 nach Alter, Angaben in % ... 30
Abbildung 14: Cronbach´s Alpha Sparmotiv ... 34
Abbildung 15: Regressionsanalyse: Einkaufsgutschein Sparmotiv Anova... 35
Abbildung 16: Regressionsanalyse: Einkaufsgutschein Sparmotiv
Koeffizienten ... 36
Abbildung 17: Regressionsanalyse: Einkaufsgutschein Sparmotiv ... 36
Abbildung 18: Regressionsanalyse: Bargeld Erlebnismotiv Anova... 38
Abbildung 19: Regressionsanalyse: Musical Erlebnismotiv Anova ... 40
Abbildung 20: Regressionsanalyse: Musical Erlebnismotiv Koeffizienten... 40
Abbildung 21: Regressionsanalyse: Musical Erlebnismotiv... 41
Prämien in Bonusprogrammen - Eine empirische Untersuchung
IV
Abbildung 22: Regressionaanalyse: Erlebnismotiv Prämie Wellness Koeffizienten42
Abbildung 23: Regressionsanalyse Joop Ohrringe Prestigemotiv ... 43
Abbildung 24: Regressionsanalyse: Joop Ohrringe Prestigemotiv Anova... 43
Abbildung 25: Regressionsanalyse: Joop Ohrringe Prestigemotiv Koeffizienten ... 44
Abbildung 26: Pfaddiagramm des Modells... 47
Abbildung 27: Schätzung des Gesamtmodells mit AMOS ... 49
Abbildung 28: Standardized Regression Weights Motivation ... 50
Abbildung 29: Standardized Regressions Weights Aufwand... 53
Abbildung 30: Normed-fit-Index und Compared-fit-Index... 55
Prämien in Bonusprogrammen - Eine empirische Untersuchung
1
1 Problemstellung und Gang der Untersuchung
Spätestens seit dem Wegfall des Rabattgesetzes im Jahr 2001 erfreuen sich Bonuspro-
gramme auch in Deutschland immer größerer Beliebtheit. Lange Zeit wurden Bonus-
programme nur im Bereich der Fluggesellschaften als sogenannte Vielfliegerprogramme
eingesetzt. Mittlerweile entdecken auch viele andere Branchen dieses Instrument der
Kundenbindung wieder.
1
Die Aktualität des Themas hat bereits diverse wissenschaftli-
che Arbeiten zu verschiedenen Aspekten des Bonusprogramms hervorgebracht. Bisher
hat sich jedoch keine Arbeit detaillierter mit der Frage beschäftigt, welche Arten von
Prämien Teilnehmern von Bonusprogrammen angeboten werden sollten. Für den Erfolg
von Bonusprogrammen bei Kunden ist aber gerade die Art der angebotenen Prämien
von hoher Bedeutung. Denn die Prämien sind es, welche die Kunden mit ihrer Teilnah-
me am Programm anstreben. Entsprechen diese nicht den Bedürfnissen der Kunden, so
werden diese auch nicht zum Kauf von Produkten bzw. Dienstleistungen oder anderen
gewünschten Verhaltensweisen motiviert. Gerade aber die Schaffung eines Anreizes für
den Kunden, regelmäßig beim Anbieter des Bonusprogramms anstelle bei der Konkur-
renz einkaufen zu gehen, ist zentraler Bestandteil eines Bonusprogramms. Der Kunde
soll für ein treues, regelmäßiges Einkaufen beim Bonusprogrammanbieter durch die
Prämien belohnt und von einem Wechsel zur Konkurrenz abgehalten werden. Werden
nun aber dem Kunden zu wenig Anreize in Form von attraktiven Prämien geboten, ist
der zentrale Wirkungsmechanismus des Bonusprogramms außer Kraft gesetzt und die
Zielsetzung des Programms gefährdet.
Diese zentrale Stellung der Prämien im Gesamtkonzept eines Bonusprogramms gebietet
es, über ihre Ausgestaltung und Wirkungsweise nachzudenken. Die zentrale Frage
dieser Arbeit soll darum folgendermaßen lauten:
·
Welche Art von Prämien sollten in einem Bonussystem Teilnehmern angeboten
werden?
1
Vgl. Lauer, Thomas: Bonusprogramme richtig gestalten, in: Harvard Business Manager, Jg. 74 (2002), Heft 3,
S. 98.
Prämien in Bonusprogrammen - Eine empirische Untersuchung
2
Aus der Kernfragestellung ergeben sich folgende Unterfragen, die zur Beantwortung der
Hauptfrage wertvolle Hilfestellung leisten können:
·
Welche Arten von Prämien gibt es und wie lassen sie sich typologisieren?
·
Welche Prämienarten befriedigen welche Kundenbedürfnisse?
·
Wie stark nimmt die Prämienattraktivität Einfluss auf die Kaufmotivation des
Kunden?
Der Aufbau der Arbeit gestaltet sich folgendermaßen:
Zunächst erfolgt in Kapitel 2 eine allgemeine Einführung in das Thema Bonuspro-
gramme. Nach einer begrifflichen Erfassung und Festlegung auf eine Definition des
Begriffs wird die prinzipielle Funktionsweise und historische sowie rechtliche Entwick-
lung von Bonusprogrammen betrachtet. Außerdem wird eine Typologisierung von
Prämien vorgenommen.
In Kapitel 3 werden zwei verhaltenspsychologische Theorien vorgestellt und auf ihre
Erklärungskraft bezüglich der empfundenen Attraktivität von Prämien aus Kundensicht
sowie der Auswirkung auf das Kaufverhalten untersucht. Die Theorien werden zu einem
Modellrahmen zusammengefügt, aus denen Hypothesen mit Bezug auf die interessie-
renden Fragen der Arbeit abgeleitet werden.
In Kapitel 4 folgt die empirische Untersuchung. Nach der Erläuterung des Operationali-
sierung und des Erhebungsdesigns werden die einzelnen Hypothesen mit Hilfe der
Regressionsanalyse ausgewertet und die Ergebnisse vorgestellt.
In Kapitel 5 erfolgt eine Bewertung der Ergebnisse der empirischen Untersuchung, aus
denen sodann Handlungsempfehlungen bezüglich der Ausgestaltung eines Prämienan-
gebots in Bonusprogrammen abgeleitet werden.
Im letzten Kapitel wird eine kurze Zusammenfassung der Arbeit sowie der wesentlichen
Ergebnisse gegeben.
Prämien in Bonusprogrammen - Eine empirische Untersuchung
3
2
Definitorische und historische Grundlagen
In diesem Kapitel werden zunächst einige wichtige Definitionen erörtert. In Anschluss
an die Erläuterung der Funktionsweise von Bonusprogrammen wird ein Überblick über
die historische und rechtliche Entwicklung von Bonusprogrammen in Deutschland
gegeben. Im letzten Abschnitt erfolgt eine Typologisierung von Prämien.
2.1
Begriffliche Erfassung von Bonusprogrammen
In der Marketingliteratur finden sich bisher kaum einheitliche Definitionen des Begriffs
,,Bonusprogramm". Daher sei in Tab. 1 vorerst ein Überblick über relevante Definitio-
nen gegeben:
Arbeit
Definition des Begriffs ,,Bonusprogramm"
Sharp, B./Sharp, S.
1997, S.474.
"Loyalty programs provide customers with loyalty incentives such as points
redeemable for prizes or discounts...Loyalty programs are structured marketing
efforts which reward, and therefore encourage, loyal behaviour..."
Müller, S.
2003, S.6-7.
,,Bonusprogramme sind ,,Kundenbindungsprogramme", bei denen der Kunde
bei Erreichung bestimmter Absatz- oder Umsatzkriterien einen Bonus erhält, der
in Form einer Geld- , Sach- oder Leistungsprämie ausbezahlt werden kann."
Woratschek, H.,
2001, S. 85
Ein Bonusprogramm ist ein ,,preispolitisches Kundenbindungsinstrument, bei
welchem dem Kunden bei Inanspruchnahme von Leistungen Bonuspunkte
gutgeschrieben werden, die entweder bar oder durch andere materielle Kompen-
sationsangebote eingetauscht werden können.
Johnson, K.
2003, S.1.
"Many companies have designed loyalty programs in an effort to make it more
rewarding for customers to do business with them than to switch to their
competitors. These programs, intended to maximize the lifetime value of current
customers, offer a variety of rewards to involve customers in long-term interac-
tive relationships."
Abbildung 1: Überblick über Definitionen des Begriffs ,,Bonusprogramm"
Anhand der Definitionen und weiterer Literatur lässt sich erkennen, dass neben dem
Begriff ,,Bonusprogramm" noch weitere Bezeichnungen synonym benutzt werden. Der
Begriff ,,loyalty program" ist oft in der angelsächsischen Literatur zu finden. Wie sich
gut anhand der Definition von JOHNSON erkennen lässt, stellt dieser Begriff das Ziel
der Kundenbindung in Form von Loyalität und Treue des Kunden zum Unternehmen in
Prämien in Bonusprogrammen - Eine empirische Untersuchung
4
den Vordergrund. Diese begriffliche Erfassung entspricht aber vor allem der gängigen
Definition von Kundenbindungsprogrammen, die sich im Vergleich zum Bonuspro-
gramm jedoch in ihren Kundenbindungsinstrumenten nicht nur auf die nachträgliche
Gewährung von Rabatten beschränken. Der Begriff ,,loyalty program" ist somit in
seiner Bedeutung weitreichender als der Begriff ,,Bonusprogramm". Ein Bonuspro-
gramm kann darum als Unterform eines Kundenbindungsprogramms verstanden wer-
den.
2
Das charakteristische Leistungsmerkmal von Bonusprogrammen ist in Anlehnung
an MÜLLER der Bonus, der als nachträglich gewährter Mengen- oder Umsatzrabatt
verstanden und in Form einer Geld-, Sach-, oder Leistungsprämie ausgezahlt werden
kann.
3
Für diese Arbeit soll darum im folgenden die Definition von MÜLLER gelten:
,,Bonusprogramme sind ,,Kundenbindungsprogramme", bei denen der Kunde bei
Erreichung bestimmter Absatz- oder Umsatzkriterien einen Bonus erhält, der in Form
einer Geld- , Sach- oder Leistungsprämie ausbezahlt werden kann."
2.2
Historische und rechtliche Entwicklung von Bonusprogrammen
Der Ursprung von Bonusprogrammen in Deutschland findet sich in den Rabattmarken-
programmen der 50er Jahre. Damals erhielt der Kunde in Abhängigkeit seines individu-
ellen Einkaufsbetrags eine festgelegte Anzahl von Rabattmarken, welche er in sein
Rabattmarkenheft klebte. Diese konnten später gegen eine entsprechende Belohnung
oder eine Einheit des erworbenen Produkts eingetauscht werden.
4
Die Zielsetzung der langfristigen Kundenbindung ist bei den heutigen Bonusprogram-
men zwar mit den damaligen Rabattmarkenprogrammen identisch, jedoch sind die
heutigen Programme vor allem technisch wesentlich weiter entwickelt.
2
Vgl. Dittrich, Sabine: Kundenbindung als Kernaufgabe im Marketing, Dissertation, St. Gallen 2000, S. 161.
3
Vgl. Müller, Steffen: Bonusprogramme als Instrumente des Beziehungsmarketing, Arbeitspapier Nr. 115,
Lehrstuhl für Marketing an der Universität ErlangenNürnberg, Nürnberg 2003, S.6.
4
Für Informationen zur Geschichte der Rabattmarken vgl. o.V.: Die Vereinheitlichung der Rabattmarken,
Langenthal, 1959, S.4ff.
Prämien in Bonusprogrammen - Eine empirische Untersuchung
5
Die Bonusprogramme der modernen Art entstanden nach dem Vorbild der Vielflie-
gerprogramme der amerikanischen Luftfahrt. 1981 rief AMERICAN AIRLINES sein
Programm ,,A ADAVANTAGE" ins Leben, um sich von Wettbewerbern zu differenzie-
ren.
Diesem Trend folgten viele weitere Luftfahrtgesellschaften - so auch die deutsche
LUFTHANSA mit der Einführung ihres Programms ,,MILES AND MORE" 1992.
5
Seit Ende der 90er Jahre nimmt die Verbreitung von Bonusprogrammen auch in ande-
ren Branchen wie dem Handel und bei Dienstleistern stetig zu.
Diese Entwicklung wird vor allem durch die Änderung des Wettbewerbsrechts im Jahr
2001 unterstützt. Wegen der EU-Forderung zur Angleichung des deutschen Wettbe-
werbsrechts an das Recht der anderen EU-Länder wurden sowohl die Zugabenverord-
nung wie auch das Rabattgesetz abgeschafft.
Bis zu diesem Zeitpunkt waren Rabatte sowie Zugaben grundsätzlich verboten und nur
in gesetzlich geregelten Ausnahmen (z.B. Rabatt bis maximal 3% des Verkaufspreises
sowie höhere Rabatte nur zu Sonderverkäufen) erlaubt.
6
Nach neuer Regelung sind sie
nun grundsätzlich erlaubt. Rabatte und Zugaben müssen jedoch mit dem Gesetz gegen
unlauteren Wettbewerb (UWG), dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
(GWB) und der Preisangaben-Verordnung im Einklang stehen.
Diese Änderungen eröffnen einen großen Spielraum für innovative Vertriebs- und
Marketingformen sowie neue Möglichkeiten der Gestaltung von Kundenbindungspro-
grammen.
Infolge der beseitigten Restriktionen entstehen verstärkt flächendeckende, unterneh-
mensinterne oder branchenübergreifende Bonusprogramme wie bspw. PAYBACK oder
HAPPY DIGITS. Nahezu alle größeren Handelsunternehmen im Endverbraucherbe-
5
Vgl. O.V.: Miles and More, unter:
http://www.milesandmore.com
, Zugriff am 15.11.05.
6
Vgl. Bibo, Andreas/Graf, Erika: Rabattpolitik, in: Marketing Journal, Jg. 44 (2001), Heft 4, S. 202 f. sowie
Braun, Susanne: Die Aufhebung von Rabattgesetz und Zugabenverordnung in der Bundesrepublik Deutschland:
eine Auswirkung des Internethandels, Lüneburg 2001, S. 8f.
Prämien in Bonusprogrammen - Eine empirische Untersuchung
6
reich arbeiten mittlerweile mit Bonusprogrammen oder haben zumindest Planungen
zum Einsatz eingeleitet.
7
2.3
Funktionsweise von Bonusprogrammen
Die Funktionsweise eines Bonusprogramms wird anhand der Abbildung 2 ersichtlich.
Abbildung 2: Funktionsweise von Bonusprogrammen (Quelle: in Anlehnung an Lauer, T., 2002,
S. 99)
Zu Beginn der Wirkungskette steht das vom Unternehmen gewünschte Kundenverhal-
ten. Klassischerweise handelt es sich hierbei um den Kauf eines Produkts oder einer
Dienstleistung. Es kann sich aber ebenso um jedes andere Verhalten handeln, welches
dem wirtschaftlichen Wohl des Unternehmens dient.
8
Das gewünschte Kundenverhalten
wird mit einem festgelegten Prozentsatz an Punkten vergütet. Durch die bestimmte
Vergabe von Bonuspunkten kann das Verhalten des Kunden gezielt und differenziert
durch den Anbieter gesteuert werden. So können nach Werbung eines Neukunden
beispielsweise auf den anschließenden Einkauf 5fach Punkte vergeben werden oder
beim Bereitstellen von detaillierten Kundendaten für Marketing- oder Vertriebszwecke
Extrapunkte vergeben werden.
7
Vgl. Lauer, T., 2002, S. 98.
8
z.B. empfiehlt ein Kunde das Bonusprogramm einem Bekannten und wirbt diesen für die Teilnahme am
Programm an.
Kunde tätigt Umsatz-
geschäft oder zeigt
gewolltes Verhalten
Kunde erhält Bonus-
punkte (Rabatt- oder
Statuspunkte)
Kunde spart bis
zum Erreichen der
Einlöseschwelle
Kunde erhält Bonus-
leistung
Prämien in Bonusprogrammen - Eine empirische Untersuchung
7
Die Bonuspunkte können entweder in Form von Rabattpunkten oder Statuspunkten
vergeben werden. Rabattpunkte spart der Kunde durch wiederholtes Einkaufen oder
sonstige gewünschte Verhaltensweisen bis zum Erreichen der Einlöseschwelle an und
kann dann die Punkte in eine einmalig lieferbare Prämie in Form von Geld, eines Pro-
dukts oder Dienstleistung eintauschen. Die Einlöseschwelle ist für jede Prämie indivi-
duell festgelegt. Werden die Punkte nicht innerhalb eines programmspezifischen Zeit-
raums gegen Prämien eingelöst, so verfallen diese meist.
Bei Statuspunkten muss der Kunde in der Regel einen bestimmten gleitenden Durch-
schnitt überschreiten (bspw. innerhalb von 12 Monaten mehr als 1000 Punkte sam-
meln), um einen höheren Kundenstatus und somit Vorzugsleistungen zu erhalten.
9
Für
die vorliegende Arbeit wird nur der Fall der Rabattpunkte betrachtet.
2.4
Typologisierung von Prämien
In Hinblick auf die Zielsetzung der Arbeit wird bei der folgenden Typologisierung von
Prämien primär aus Konsumentenperspektive argumentiert. Hierbei wird auf die Nut-
zendimensionen eingegangen, die unterschiedliche Prämienarten dem Konsumenten
stiften.
LAUER
10
unterscheidet bei seiner Betrachtung der Bonusdimensionen Prämien, die
tendenziell auf einem ökonomisch- rationalen Nutzen gründen und Prämien, bei denen
der emotionale Nutzen im Vordergrund steht. Der ökonomische Nutzen wird hierbei als
geldwerter Vorteil des Kunden bezeichnet, während es sich bei emotionalem Nutzen um
positiv empfundene Gefühle handelt wie beispielsweise Genuss, Spannung oder Ent-
spannung.
9
Vielflieger bei der Lufthansa erhalten mit dem Kundenstatus ,,Senator" beispielsweise die Möglichkeit, in
speziellen Lounges auf den Flieger zu warten.
10
Vgl.: Lauer, Thomas: Bonusprogramme Rabattsysteme für Kunden erfolgreich gestalten, Berlin-Heidelberg
2004, S. 44.
Prämien in Bonusprogrammen - Eine empirische Untersuchung
8
Analog hierzu unterscheiden sowohl MEYER-WAARDEN/BENAVENT
11
als auch
DILLER
12
zwischen rein finanziellen, greifbaren oder rationalen Belohnungen und
jenen, die von emotionaler oder immaterieller Natur sind. CHANDON ET AL. untertei-
len in utilitaristische und hedonistische Zusatzleistungen und definieren diese folgen-
dermaßen: ,,Utilitarian benefits are primarily instrumental, functional, and cognitive;
they provide customer value by being a means to an end. Hedonic benefits are non-
instrumental, experimential and affective; they are appreciated for their owns sake,
..."
13
Folgt man dieser zweidimensionalen Unterteilung, so lassen sich grundsätzlich zwei
Prämientypen mit unterschiedlicher Nutzendimension voneinander trennen: ,,Prämien
mit rein hedonistischen Nutzen" und ,,Prämien mit rein ökonomischen Nutzen". Im
folgenden wird zwischen hedonistischen und utilitaristischen Prämien differenziert.
11
Vgl.: Meyer-Waarden, Lars/Benavent, Cristophe:Loyalty Programs: Strategies and Practice, Madrid 2001, S.
20.
12
Vgl. Diller, H.: Was leisten Kundenclubs?, in: Marketing Zeitschrift für Forschung und Praxis, Jg. 19 (1997)
H.1, S. 33-41.
13
Vgl. Chandon, Pierre/Wansink, Brian/Laurent, Gilles: A Benefit Congruency Framework of Sales Promotion
Effectiveness, in: Journal of Marketing, Vol. 64, Oktober 2000, S.69.
Prämien in Bonusprogrammen - Eine empirische Untersuchung
9
3
Theoretische Grundlagen
Im folgenden Kapitel werden zwei verhaltenswissenschaftliche Theorien vorgestellt, die
einen Erklärungsbeitrag zu der dieser Arbeit zugrundeliegenden Fragestellung leisten
können. Die den Motivationstheorien zugehörige Instrumentalitätstheorie von VROOM
soll insbesondere die Frage beantworten, welche Prämien der Kunde als attraktiv beur-
teilt. Die Equity-Theorie beleuchtet primär die Frage, wie sich die Beurteilung der
Prämien in ihrem Attraktivitätsgrad auf die Kaufmotivation des Konsumenten auswir-
ken. Die beiden Theorien werden zu einem Modell zusammengeführt, welches als
Grundlage der anschließenden empirischen Untersuchung dient.
3.1
Motivationstheorie
,,Die Motivationsforschung fragt nach den Gründen (Ursachen) konkreter Verhaltens-
weisen."
14
Motivationstheorien versuchen also das Verhalten von Personen anhand der
dahinterliegenden Ursachen und Beweggründe zu erklären. Warum tauscht Teilnehmer
A eines Bonusprogramm seine erreichten Bonuspunkte gegen die Prämie x ein und
nicht wie Teilnehmer B gegen die Prämie y?
Die Gründe für bestimmte Verhaltensweisen werden in der Motivationstheorie als
Motive bezeichnet. Motive haben sowohl einen genetischen Ursprung wie zum Beispiel
das Neugier- oder Hungermotiv, können aber auch ,,gesellschaftlich fundierte Wert-
schätzungen enthalten, die vom Individuum im Verlauf seiner Lerngeschichte über-
nommen wurden."
15
So wird beispielsweise dem Erlebnismotiv ein gewisser geneti-
scher Ursprung in Anlehnung an das Neugiermotiv zugestanden; durch die Erlebnisori-
entierung der heutigen Gesellschaft wird dieses Motiv jedoch ebenso vom Individuum
erlernt.
16
14
Vgl. Fischer, Lorenz/Wiwede, Günter: Grundlagen der Sozialpsychologie, 2. Aufl., München 2002, S. 95.
15
Vgl. Schneider, Klaus/Schmalt, Hans-Dieter: Motivation, Stuttgart 2000, S.16.
16
Vgl. Fischer, L./Wiswede, G., München 2002, S. 235-237.
Prämien in Bonusprogrammen - Eine empirische Untersuchung
10
Motive werden auch als überdauernde Verhaltensdispositionen bezeichnet, die bei
Anregung durch einen äußeren Anreiz den Motivationsprozess auslöst. Die motivierte
Person zeigt nun ein Verhalten, welches auf die Zielerreichung ausgerichtet ist, wobei
das Ziel wiederum durch das angesprochene Motiv bestimmt wird. Die Gleichung
,,Motivation = f (Motiv, Anreiz)" verdeutlicht dieses Verständnis von Motivation.
17
3.1.1 Instrumentalitätstheorie
Die Instrumentalitätstheorie gehört in der Familie der Motivationstheorien zu den
kognitiven Theorien und entspricht im Allgemeinen dem Aufbau und der Argumentati-
onslinie eines Wert-Erwartungsmodells.
Nach dem Wert-Erwartungsmodell ist die Stärke der Motivation abhängig von 1. dem
subjektiven Wert, der dem durch das gezeigte Verhalten angestrebten Ziel (Motiv)
zugesprochen wird und 2. der subjektiven Erwartung, dieses Ziel zu erreichen.
Die Instrumentalitätstheorie erweitert bzw. verändert diesen Grundgedanken um den
Begriff der Instrumentalität.
Das Individuum versucht zunächst vor seinem Handeln das resultierende Handlungser-
gebnis j zu antizipieren, bildet also eine Erwartung bezüglich des Handlungsergebnis-
ses. Hat das Handlungsergebnis einen hohen Wert (Valenz = Vj) für das Individuum, so
ist die Motivation, das hierzu führende Verhalten (Handeln) auszuführen, hoch.
Fj = f [ ( Eij X Vj
)
]
Fj = Motivation, Handlung i auszuführen
Eij = subjektive Erwartung, dass die Handlung i zum Handlungsergebnis j führt
Vj = Valenz des Handlungsergebnisses j
17
Vgl. Fischer, L./Wiswede, G., 2002, S.99.
Prämien in Bonusprogrammen - Eine empirische Untersuchung
11
Der Wert des Handlungsergebnisses Vj bestimmt sich folgendermaßen:
18
V
j
= f [ (V
k
X I
jk)
]
Vj = Valenz des Handlungsergebnisses j
Vk = Valenz der Handlungsfolge k
I
jk
=Instrumentalität des Handlungsergebnisses j für das Eintreten der Handlungsfolge k
Das Handlungsergebnis in sich selbst hat keine Valenz, sondern gewinnt diese erst
durch den Wert der resultierenden Handlungsfolgen und der Instrumentalität, diese
Handlungsfolgen zu generieren.
So gewinnt beispielsweise ein Sportwagen als Handlungsergebnis eines Kaufaktes
seinen Wert erst durch seine Instrumentalität, weitere wertbesetzte Ziele des Käufers
wie z.B. Sozialprestige zu verwirklichen.
Übertragen auf die ausgehende Frage- und Problemstellung dieser Arbeit lässt sich
somit der Wert einer Prämie (aus Kundensicht) als Handlungsergebnis eines konsequen-
ten Punktesammelns bestimmen aus 1. der Instrumentalität, die eigentlichen Ziele und
Konsummotive der Teilnehmer zu befriedigen und 2. der individuell durch die Teil-
nehmer zugesprochenen Wichtigkeit dieser Ziele und Motive.
Abbildung 3: Attraktivität der Prämie (1)
Je besser ein Bonusprogrammanbieter demnach die Bedürfnisse, Motive und Ziele
seiner Kundschaft kennt, desto besser kann er sein Prämienangebot danach ausrichten
und desto attraktiver werden die Kunden die Prämien beurteilen.
18
Vgl. Heckhausen, Heinz: Motivation und Handeln, 2.Aufl., Berlin 1989, S.183 184.
Wichtigkeit des Konsummotiv i
Wert/Attraktivität der Prämie
Instrumentalität der Prämie
Prämien in Bonusprogrammen - Eine empirische Untersuchung
12
Eine Frage, die sich hieran anschließt, ist die Frage nach den Konsummotiven und
-zielen, durch die Konsumenten in ihrem Kaufverhalten wesentlich beeinflusst und
gelenkt werden. Da sich diese Frage aber nicht in kurzen Zügen beantworten lässt, soll
ihr ein eigenes Unterkapitel gewidmet werden (siehe Kapitel 3.1.2.).
Weitere Schlussfolgerungen aus der Instrumentalitätstheorie können bezüglich der
Kaufmotivation der Konsumenten gemacht werden. Beurteilt ein Konsument die ange-
botenen Prämien als attraktiv besitzen sie also eine hohe Valenz aus Sicht des Kunden
so ist der Kunde laut Theorie stark motiviert, die Bonuspunkte für die Wunschprämie
zu sammeln und folglich Einkäufe beim Bonusprogrammanbieter zu tätigen. Zwischen
der Motivation, ein bestimmtes Verhalten zu zeigen und dem tatsächlichen Verhalten ist
an dieser Stelle jedoch zu differenzieren. So wird das tatsächliche Kaufverhalten zwar
stark durch die Motivation des Kunden beeinflusst - jedoch ergeben sich zahlreiche
weitere durch die Theorie nicht antizipierte Einflüsse, die auf das tatsächliche Kaufver-
halten ebenso einwirken.
Laut Theorie ist die Stärke der Motivation nicht nur abhängig von der Attraktivität der
Prämien, sondern ebenso von der Erwartung, die benötigte Bonuspunktezahl für den
Erhalt der Prämie zu erreichen. (Fj = f [ ( Eij X Vj) ] )
Die folgende Abbildung verdeutlicht diesen Zusammenhang.
Abbildung 4: Konsumentenmotivation (1)
Auf die Bedeutung der Erreichbarkeit von Prämien weisen verschiedene Autoren hin.
So gehen O´BRIEN und JONES
19
sowie JOHNSON
20
in ihren Arbeiten unter anderem
der Frage nach, welche Gestaltungsmerkmale ein Bonusprogramm für den Kunden
19
Vgl. O´Brien, Louise/Jones, Charles: Do Rewards really create loyalty?, in: Harvard Business Review, 1995,
Heft 3, S. 76.
20
Vgl. Johnson, Kurt: Making loyalty programs more rewarding, unter:
www.onetoone/fischersarchiv/dmtrends/JB _02 _03_Pdf/28_29_KUNDENBINDUNGSPRO/028_029_Jost.pdf,
Zugriff am 20.10.05.
Wert/Attraktivität der Prämie
Kaufmotivation
Wert/Attraktivität der Prämie
Prämien in Bonusprogrammen - Eine empirische Untersuchung
13
attraktiv machen. Die Höhe der geforderten Bonuspunkte zum Tausch für eine Prämie
und somit die Erreichbarkeit von Prämien wird in beiden Arbeiten als ein wesentliches
Argument genannt. Wird die geforderte Bonuspunktzahl so hoch gesetzt, dass der
Kunde diese kaum erreichen kann, so wird das Bonusprogramm als unattraktiv empfun-
den und die Motivation für das Sammeln von Bonuspunkten stark herabgesetzt.
Diesen Gedanken wird auch in Kapitel 3.2 die Equity-Theorie wieder aufgreifen und
ausführlicher diskutieren.
3.1.2 Konsummotive
In Kapitel 3.1.1 wurde verdeutlicht, dass Konsumenten Prämien nicht um ihrer selbst
willen erwerben, sondern Produkte zur Erreichung persönlicher Ziele und Motive
instrumentalisieren. Verspricht eine Prämie bei der Erlangung eines subjektiv hochbe-
werteten Ziels von Nutzen zu sein, wird diese als erstrebenswert beurteilt. Die Frage,
die sich nun an dieser Stelle ergibt, ist die Frage nach den Konsummotiven und Zielen
der Konsumenten.
Welche Motive sind es, die ein Konsument im Rahmen eines Bonusprogramms ver-
folgt? Welche Motive sollte eine Prämie im Konsumenten ansprechen, um positiv
beurteilt zu werden?
Eine Antwort auf diese Fragen zu finden, bereitet einige Schwierigkeiten. So sollten die
ausgewählten Motive als Grundlage der folgenden empirischen Untersuchung einerseits
theoretisch begründet und ausreichend erforscht sein; andererseits müssen die Motive
praktisch anwendbar und auf die interessierende Fragestellung zugeschnitten sein d.h.
sie sollten bei Teilnehmern von Bonusprogrammen tatsächlich relevant sein. Außerdem
sollten die ausgewählten Motive einen optimalen Allgemeinheitsgrad aufweisen. Sind
sie zu allgemein definiert, so lassen sich verschiedene Käufertypen nicht voneinander
differenzieren. Sind sie zu speziell, treffen sie nur noch auf eine kleine Zielgruppe zu
und verlieren breitere Anwendbarkeit.
21
21
Vgl. Trommsdorff, Volker: Konsumentenverhalten, 4.Aufl., Stuttgart 2002, S.114-115.
Prämien in Bonusprogrammen - Eine empirische Untersuchung
14
Physiologische Grundmotive
Selbst-
verwirklichung
Sicherheit/ Geborgenheit
Zuwendung/ Liebe
Selbstwertschätzung
In der bestehenden Literatur gibt es mittlerweile zahlreiche Systematisierungsversuche
von Motiven. Am bekanntesten und in den Wirtschaftwissenschaften häufig referierte
Systematisierung ist wohl die Bedürfnispyramide von Maslow, die Motive hierarchisch
ordnet.
22
Bedürfnisse auf den unteren Stufen wie physiologische und Sicherheitsbedürf-
nisse müssen zunächst befriedigt werden, bevor höhere Motive wie Selbstwertschätzung
und -verwirklichung wirksam werden.
Abbildung 5: Bedürfnispyramide nach Maslow
Dieses Modell würde zwar eine gute theoretische Grundlage bilden, ist in seinem All-
gemeinheitsgrad jedoch viel zu generell und liefert somit nur einen geringen Erklä-
rungsbeitrag zur interessierenden Fragestellung. Trommsdorf hat sich der zuvor be-
schriebenen grundsätzlichen Problematik angenommen und eine Liste mit theoretisch
begründeten und praktisch verwendbaren Konsummotiven mittlerer Reichweite erstellt,
die als Grundlage für diese Arbeit dienen soll:
23
·
Ökonomik/Sparsamkeit/Rationalität,
·
Prestige/Status/soziale Anerkennung,
·
Soziale Wünschbarkeit,
22
Vgl. Maslow, Abraham: Motivation and Personality, New York u.a. 1954, S.73f.
23
Vgl. Trommsdorf, V. , 2002, S.121-129.
Prämien in Bonusprogrammen - Eine empirische Untersuchung
15
·
Lust/Erregung/Neugier ,
·
Sex/Erotik,
·
Angst/Furcht/ Risikoneigung,
·
Konsistenz/Konflikt/Dissonanz.
Um nun aber zu überprüfen, inwieweit diese noch recht allgemeinen Konsummotive
tatsächlich auch bei Teilnehmern von Bonusprogrammen relevant werden, werden
zusätzlich die folgenden empirischen Studien zu Bonusprogrammen herangezogen:
Peterson fand in einer Studie zu Nutzermotiven innerhalb von Loyalty Programs heraus,
dass bei 81% der Befragten das Sparmotiv den Hauptteilnahmegrund an einem Bonus-
programm darstellt. Der Wunsch nach sozialer Anerkennung und Prestige und einer
Erleichterung beim Einkauf sind weitere Gründe.
24
Auch bei der Studie von Wright und
Sparks steht das Sparmotiv im Vordergrund.
25
Kwok und Uncles hingegen identifizie-
ren den Wunsch nach Unterhaltung und Anregung als Motiv vieler Bonusprogramm-
teilnehmer.
26
Weitere Studien kamen zu analogen Ergebnissen.
Vergleicht man die Ergebnisse der Studien untereinander und mit der Motivliste von
Trommsdorf, so lassen sich die folgenden drei für Bonusprogramme relevante Kon-
summotive zusammenfassend herausstellen:
·
Ökonomik/Sparsamkeit/Rationalität,
·
Prestige/Status/soziale Anerkennung,
·
Erlebnis- und Neugiermotiv.
24
Vgl. Peterson, Robert: Relationship Marketing and the consumer, in: Journal of the Academy of Marketing
Science, Vol. 23, No. 4, S.278-281.
25
Vgl. Wright, Claire/Sparks, Leigh: Loyalty saturation in retailing exploring the end of retail loyalty cards, in:
International Journal of Retail & Distribution Management, Jg. 27 (1999), Heft 10, S. 429-439.
26
Vgl. Kwok, Simon/Uncles, Mark: Sales Promotion Effectiveness: The Impact of Culture at an Ethnic-Group
Level, unter:
http://www.marketing.unsw.edu.au/HTML/mktresearch/workingpapers/Uncles_Kwok03_3.pdf
,
Zugriff am 13.12.05.
Prämien in Bonusprogrammen - Eine empirische Untersuchung
16
Diese Motive werden dem zuvor gestellten Anspruch gerecht, einerseits theoretisch
fundiert zu sein, andererseits aber auch für das Untersuchungsziel hinreichend konkret
zu sein.
Im folgenden werden die einzelnen Motive kurz vorgestellt.
3.1.2.1
Ökonomik und Sparsamkeit
Das Motiv der Ökonomik und Sparsamkeit bezeichnet das wirtschaftliche Grundmotiv
des ,,homo oeconomicus". Das Kaufverhalten ist darauf ausgerichtet, zu möglichst
preiswerten Konditionen einzukaufen und hierbei Geld zu sparen. Das Motiv der Spar-
samkeit ist das bedeutendste Kundenmotiv laut bisheriger empirischer Studien zu Bo-
nusprogrammen.
3.1.2.2
Prestige und soziale Anerkennung
Dieses Motiv spiegelt das Bedürfnis des Menschen nach sozialer Anerkennung und
gesellschaftlicher Stellung wider. Der Mensch strebt nach sozialer Belohnung, Prestige
und sozialem Status. Der soziale Status eines Individuums in einer Gesellschaft wird
angezeigt durch äußere Merkmale, sogenannte Statussymbole. Sichtbarer Besitz und
demonstrativer Konsum können als Statussymbole fungieren. So kommt nur für eine
gewisse Kategorie von Produkten die Ansprache des Prestigemotivs in Frage. Sie müs-
sen limitiert und nach außen hin sichtbar sein, so dass eine Abgrenzung gegenüber dem
,,durchschnittlichen Anderen" möglich wird. Prämien mit Prestigecharakter sind klassi-
scherweise bei den Vielfliegerprogrammen der Luftfahrtgesellschaften anzutreffen. So
bietet die Lufthansa dem Kundenkreis der ,,Senatoren" eine Vielzahl von Leistungen
(Extra Check-in Schalter, Wartelounges, First-Class-Sitzplätze) an, die anderen Kun-
dengruppen verwehrt bleiben. Diese Leistungen sind nach außen sichtbar, so dass von
Ihnen eine elitäre Prestigewirkung ausgeht.
Prämien in Bonusprogrammen - Eine empirische Untersuchung
17
3.1.2.3
Das Erlebnis- und Anregungsmotiv
Der Wunsch nach Erlebnissen, positiven Emotionen und Anregung ist in unserer
Wohlstandsgesellschaft mittlerweile stark ausgeprägt. Die grundlegenden Bedürfnisse
der Maslow´schen Bedürfnispyramide sind befriedigt. ,,Höhere Bedürfnisse" wie
Selbstverwirklichung und der Wunsch nach sensualer Anregung und emotionalen Erle-
ben werden relevant.
27
Diese Motive werden insbesondere durch einen erlebnisorientier-
ten Konsum zu stillen versucht.
28
,,Produzierte Erlebnisse" spielen für viele Bevölke-
rungskreise eine herausragende Rolle.
29
3.2
Equity-Theorie
Die Equity-Theorie besagt, dass der Mensch nahezu alle Beziehungen, in denen er sich
befindet, auf Ausgeglichenheit und Beitragsgerechtigkeit (= equity) untersucht. So
vergleicht das Individuum das Verhältnis seines eigenen Inputs und Outcomes mit dem
Input und Outcome des Beziehungspartners. Input wird hierbei als Investition oder
persönlicher Aufwand verstanden, die das Individuum zur Aufrechterhaltung dieser
Beziehung investiert. Der Outcome wird als Ertrag verstanden. Welche Vorteile entste-
hen dem Individuum durch die Beziehung; welche Bedürfnisse werden befriedigt?
30
Übertragen auf das Untersuchungsziel dieser Arbeit können auch Beziehungen zwi-
schen Kunden und Unternehmen unter equity-theoretischen Überlegungen betrachtet
werden.
27
Vgl. Kroeber-Riel, Werner/Weinberg, Peter, 8. Aufl., München 2003, S. 124.
28
Vgl. Scitovski, Tibor: Psychologie des Wohlstandes die Bedürfnisse des Menschen und der Bedarf des
Verbrauchers, 2. Aufl., Frankfurt am Main, 1989.
29
Vgl. Lauer, T., 2004, S. 52.
30
Vgl. Wiswede, Günther: Einführung in die Wirtschaftspsychologie, 3. Aufl., München 2000, S. 99-100.
Prämien in Bonusprogrammen - Eine empirische Untersuchung
18
So wird ein Konsument seine Beziehung zu einem Bonusprogrammanbieter unter
Aufwands-Ertrags-Betrachtungen beurteilen: Welche Vorteile erlangt er durch das
Bonusprogramm und welcher Aufwand entsteht ihm? Welche Vorteile hat das Unter-
nehmen durch dieses Bonusprogramm und was ist es bereit, hierfür im Austausch zu
geben?
Der Ertrag des Kunden lässt sich vor allem über die erhaltenen Prämien bestimmen. Der
Nutzen, der durch diese Prämien dem Kunden erwächst, wird aber vor allem durch die
Befriedigung der dahinterliegenden Konsummotive und Bedürfnisse generiert, wie
bereits in Kapitel 3.1 erläutert wurde.
Entsprechen die angebotenen Prämien diesen Bedürfnissen und Konsummotiven und
werden vom Kunden als attraktiv beurteilt, so ist der Outcome des Austauschverhältnis-
ses aus Kundensicht hoch. Der Outcome der Equity-Theorie kann also mit der Attrakti-
vität der Prämien aus der Instrumentalitätstheorie verglichen werden. Da der Outcome
jedoch ins Verhältnis zum erbrachten Aufwand gesetzt wird, muss an dieser Stelle
darauf eingegangen werden, wie der Kunde den zu erbringenden Aufwand beurteilt und
einschätzt.
In Anlehnung an eine Studie von DE WULF ET AL.
31
kann der Aufwand eines Teil-
nehmers an einem Bonusprogramm durch die folgenden vier Größen bestimmt werden:
die Freigabe persönlicher Daten, eventuell anfallende Teilnehmergebühren, die notwen-
dige Einkaufshäufigkeit bis zur Erreichung der gewünschten Prämie und die Anstren-
gung, die aufgebracht werden muss, seine Einkäufe regelmäßig beim Bonusprogramm-
anbieter zu tätigen.
Die notwendige Einkaufshäufigkeit legt der Bonusprogrammanbieter fest durch die
Höhe der Punkte, die der Kunde pro ausgegebener Geldeinheit erhält, und die Einlöse-
schwelle der Punkte im Tausch für eine Prämie.
Die Beurteilung der Anstrengung, sein Kaufverhalten auf das Sammeln der Punkte
auszurichten, wird abhängig sein von den bestehenden Einkaufsgewohnheiten des
Teilnehmers. Kaufte der Kunde bereits vor Teilnahme am Bonusprogramm regelmäßig
31
Vgl. De Wulf, Kristof/Odekerken-Schröder, Gaby/de Canniere, Marie et al.: What drives consumer participa-
tion to loyalty programs? A conjoint analytical approach, unter:
http://www.vlerick.be/research/workingpapers/2002-2.pdf, Zugriff am 3.11.2005.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2006
- ISBN (eBook)
- 9783836602785
- DOI
- 10.3239/9783836602785
- Dateigröße
- 683 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität zu Köln – Wirtschaftswissenschaften, Betriebswirtschaftslehre
- Erscheinungsdatum
- 2007 (April)
- Note
- 2,3
- Schlagworte
- unternehmen kundenbindung bonus kundenkarte bonusprogramm kaufmotivation prämienwirkung equity-theorie
- Produktsicherheit
- Diplom.de