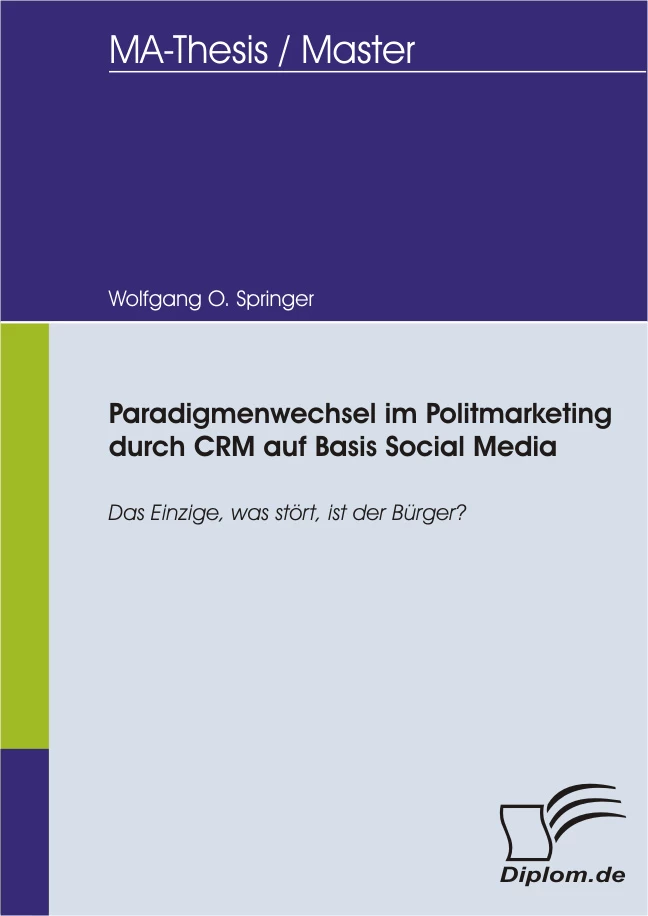Paradigmenwechsel im Politmarketing durch CRM auf Basis Social Media
Das Einzige, was stört, ist der Bürger?
©2011
Masterarbeit
139 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Durch die täglich über Rundfunk, Fernsehen, Tages- und Wochenzeitungen kolportierten Meldungen über den Einfluss von Social Media auf politische Entwicklungen in geografisch meist entfernt liegenden Regionen der Welt drängt sich die Frage auf, welche Rahmenbedingungen konkret und aktuell in Österreich und hier wiederum auf Gemeindeebene vorliegen, welche eine Ableitung der Wirkungsweise von Social Media auf politische Organisationen auf kommunaler Ebene rechtfertigen.
Anlass der Exploration:
Das Nutzungsverhalten in Bezug auf das Internet hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert und eine Verlagerung wenn nicht sogar eine Umkehr in der Bereitstellung der Inhalte von einigen wenigen Medien, Organisationen und Unternehmen und gelegentlich Einzelpersonen in Richtung der Konsumenten des Internets herbeigeführt. Diese Möglichkeit der Bereitstellung von Inhalten repräsentiert jedoch nur einen Teil der neuen Eigenschaften der Internetanwendungen, von denen die aktuell hervorstechendste wohl die Möglichkeit darstellt, dass sich die Nutzer untereinander vernetzen und in Interaktion treten. Für Wirtschaftsunternehmen ebenso wie für politische Organisationen bedeutet dies eine Änderung der Rahmenbedingungen der Kommunikation, deren Steuerung nicht mehr nach den Gesetzen und Regeln der Vergangenheit gestaltbar ist: Die Möglichkeiten zur bewussten Steuerung der Informationsflüsse und Inhalte durch Unternehmen und Organisationen verändern sich oder gehen zunehmend verloren. Die Anforderungen an die Medienkompetenz steigen und es bedarf auch in Nicht-Wahlkampfzeiten eines konzeptionellen Vorgehens, das als wesentliche Ergänzung der bislang im Vordergrund stehenden rhetorischen Kompetenz auf kommunalpolitischer Ebene anzusehen ist. Für den Nutzer sind Politik, Shopping, Fun, Enter- und Infotainment, Lernen, die eigene Finanzverwaltung etc. und auch der Dialog mit anderen Menschen nur wenige Mausklicks voneinander entfernt und es beeinflussen sich wechselseitig die Erwartungshaltung der Anwender ebenso wie die Form der Nutzung dieses Mediums. Die Beziehungsqualität zwischen Unternehmen und ihren Geschäftspartnern wie den Repräsentanten der diversen relevanten Umwelten sowie zwischen politischen Organisationen und den Bürgern befindet sich im Umbruch.
Aufbau der Arbeit:
Diese Arbeit beleuchtet explorativ und kritisch den aktuellen Status dieses antizipierten Umbruches auf kommunalpolitischer Ebene und lässt sich von der […]
Durch die täglich über Rundfunk, Fernsehen, Tages- und Wochenzeitungen kolportierten Meldungen über den Einfluss von Social Media auf politische Entwicklungen in geografisch meist entfernt liegenden Regionen der Welt drängt sich die Frage auf, welche Rahmenbedingungen konkret und aktuell in Österreich und hier wiederum auf Gemeindeebene vorliegen, welche eine Ableitung der Wirkungsweise von Social Media auf politische Organisationen auf kommunaler Ebene rechtfertigen.
Anlass der Exploration:
Das Nutzungsverhalten in Bezug auf das Internet hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert und eine Verlagerung wenn nicht sogar eine Umkehr in der Bereitstellung der Inhalte von einigen wenigen Medien, Organisationen und Unternehmen und gelegentlich Einzelpersonen in Richtung der Konsumenten des Internets herbeigeführt. Diese Möglichkeit der Bereitstellung von Inhalten repräsentiert jedoch nur einen Teil der neuen Eigenschaften der Internetanwendungen, von denen die aktuell hervorstechendste wohl die Möglichkeit darstellt, dass sich die Nutzer untereinander vernetzen und in Interaktion treten. Für Wirtschaftsunternehmen ebenso wie für politische Organisationen bedeutet dies eine Änderung der Rahmenbedingungen der Kommunikation, deren Steuerung nicht mehr nach den Gesetzen und Regeln der Vergangenheit gestaltbar ist: Die Möglichkeiten zur bewussten Steuerung der Informationsflüsse und Inhalte durch Unternehmen und Organisationen verändern sich oder gehen zunehmend verloren. Die Anforderungen an die Medienkompetenz steigen und es bedarf auch in Nicht-Wahlkampfzeiten eines konzeptionellen Vorgehens, das als wesentliche Ergänzung der bislang im Vordergrund stehenden rhetorischen Kompetenz auf kommunalpolitischer Ebene anzusehen ist. Für den Nutzer sind Politik, Shopping, Fun, Enter- und Infotainment, Lernen, die eigene Finanzverwaltung etc. und auch der Dialog mit anderen Menschen nur wenige Mausklicks voneinander entfernt und es beeinflussen sich wechselseitig die Erwartungshaltung der Anwender ebenso wie die Form der Nutzung dieses Mediums. Die Beziehungsqualität zwischen Unternehmen und ihren Geschäftspartnern wie den Repräsentanten der diversen relevanten Umwelten sowie zwischen politischen Organisationen und den Bürgern befindet sich im Umbruch.
Aufbau der Arbeit:
Diese Arbeit beleuchtet explorativ und kritisch den aktuellen Status dieses antizipierten Umbruches auf kommunalpolitischer Ebene und lässt sich von der […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Wolfgang O. Springer
Paradigmenwechsel im Politmarketing durch CRM auf Basis Social Media
Das Einzige, was stört, ist der Bürger?
ISBN: 978-3-8428-2311-2
Herstellung: Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2012
Zugl. WWEDU - Worldwide Education, Josef Schumpeter Institut, Wels, Wels, Österreich,
MA-Thesis / Master, 2011
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und der Verlag, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplomica.de, Hamburg 2012
Vorwort
Das Internet hat die Kommunikation im Wirtschaftsleben verändert und es ist unübersehbar,
dass zunehmend jeder Einzelne in unserer Gesellschaft von den Auswirkungen dieser Technik
betroffen ist, aber auch viele Menschen sich aktiv an den Veränderungen beteiligen. Warum
sollen gerade politische Organisationen diese Entwicklungen ignorieren, nicht darauf reagieren,
wenn nicht sogar eine führende, beispielgebende Rolle einnehmen?
Wenn man als Betroffener oder Beteiligter mitten in diesem Sog der sich permanent selbst
überholenden Entwicklungen steht, ist es schwer, sich zu orientieren und neu auszurichten.
Diese Arbeit soll dazu beitragen, eine Standortbestimmung vorzunehmen und sie soll kritisch
die aktuellen Rahmenbedingungen eines zentralen Problems in unserem demokratischen Ge-
sellschaftsgefüge, der Bürgerpartizipation am politischen Leben, im Hinblick auf Lösungsmög-
lichkeiten mit Hilfe der Internettechnologie evaluieren. Es ist damit Ziel dieser Arbeit, ein struktu-
riertes Bild zu liefern, das Ansatzpunkte aufzeigt, wo heute damit begonnen werden kann, auch
als politische Organisation vom Betroffenen zum Akteur und Gestalter zu werden.
Während ich diese Zeilen schreibe, verändert sich bereits wieder das Umfeld und schafft fast
täglich neue Rahmenbedingungen. Dies ist jedoch nur die halbe Wahrheit. Niemand weiß bes-
ser als Menschen in der Politik, dass sich trotz aller Turbulenzen und scheinbar zwingender Er-
eignisse die Einstellungen und das Verhalten der Menschen gegenüber Neuerungen nur sehr
langsam verändern. Diese Arbeit löst daher die Social-Media-Diskussion nicht aus dem gesell-
schaftlichen Kontext heraus, sondern betrachtet das Thema Social Media in der Politik bewusst
breit gefasst vor diesem gesellschaftspolitischen Hintergrund und zeigt auf, dass scheinbar
konservative Werte durchaus ihre Gültigkeit und Kraft auch im Umfeld von Social Media ja ge-
rade in diesem Umfeld! haben und zu ihrer Entfaltung gebracht werden können. Ich möchte
mit meiner Arbeit einen kleinen Mosaikstein zu diesem Verständnis und in dieser Entwicklung
beitragen.
Gendering: Im vorliegenden Dokument wird überwiegend die männliche Form verwendet wie z.
B. Bürger oder Politiker. Der einzige Grund hierfür ist, dass die Nennung beider Geschlechts-
formen zu einer Strapaze beim Lesen führen und damit die Verständlichkeit des Textes beein-
trächtigen würde. Alle Aussagen gelten vom inhaltlichen her selbstverständlich für beide Ge-
schlechter gleichermaßen und sollen keinesfalls Männer gegenüber Frauen oder Frauen ge-
genüber Männern diskriminieren.
Inhaltsverzeichnis
1.
Einleitung ... 1
1.1
Anlass der Exploration ... 1
1.2
Aufbau der Arbeit ... 1
1.3
Erkenntnisinteresse ... 3
1.4
Methodik ... 3
1.5
Festlegung der Stichprobe ... 4
2.
Die Bürger und die Politik ... 7
2.1
Die Erwartungshaltung an politische Parteien ... 7
2.2
Die Erwartungshaltung an die Bürger ... 7
2.3
Die Erwartungshaltung an das politische System ... 8
2.4
Auswirkungen auf politische Organisationen ... 8
2.5
Diskussionspunkt ,,Jungwähler" ... 9
2.6
Diskussion über neue Partizipationsformen ... 10
2.7
Erkenntnisse ... 11
3.
Die Bürger und Social Media ... 11
3.1
Internet ... 12
3.1.1
Status der Internetnutzung in Österreich ... 12
3.1.2
Entwicklung der Internetnutzung in Österreich ... 13
3.1.3
Entwicklung der Internetnutzung je Altersgruppe ... 14
3.1.4
Internetnutzung je Altersgruppe, umgelegt auf eine Beispielgemeinde ... 15
3.1.5
Verwendung des Internets ... 16
3.1.6
Internetnutzung je privatem Zweck und Altersgruppe ... 18
3.1.7
Argumente der Nicht-Nutzer des Internets ... 19
3.2
Social Networks allgemein ... 20
3.2.1
Status der Nutzung von Social Networks ... 20
3.2.2
Social-Network-Nutzung gesamt (Top 6) ... 21
3.3
Facebook ... 22
3.3.1
Status der Facebook-Nutzung in Österreich ... 22
3.3.2
Die Entwicklung von Facebook ... 24
3.3.3
Facebook-Nutzer in Beispielstadt ... 25
3.4
Twitter... 26
3.4.1
Status der Twitter-Nutzung in Österreich ... 26
3.4.2
Twitter-Entwicklung in Österreich ... 27
3.4.3
Twitter-Nutzer in Beispielstadt ... 28
3.5
Rolle des Internets im Medienmix ... 28
3.6
Zukunft des Internets ... 30
3.7
Erkenntnis ... 31
4.
Die politischen Organisationen und deren Online-Präsenz ... 31
4.1
Festlegungen und Prämissen ... 32
4.1.1
Vorgehensweise in der Feldbeobachtung ... 32
4.1.2
Untersuchungsobjekt und dessen Struktur ... 32
4.2
Die 7 Säulen für Social Media ... 33
4.2.1
Der Name ... 34
4.2.2
Präsenz & Vernetzung im Internet ... 38
4.2.3
Struktur und formale Organisation ... 40
4.2.4
Persönlichkeit & Selbstverständnis der Organisation ... 43
4.2.5
Verhalten & Leistung ... 50
4.2.6
Relevanz & Aktualität ... 52
4.2.7
Interaktionsfähigkeit und -bereitschaft... 54
5.
Die politischen Organisationen und Social Media ... 54
5.1
Adresse/Niederlassung ... 56
5.2
Persönlicher Kontakt ... 57
5.3
Telefon ... 57
5.4
E-Mail ... 57
5.5
Kontaktformular ... 58
5.6
Formular zur Mitarbeit ... 58
5.7
Beitrittsformular ... 59
5.8
Gästebuch ... 60
5.9
Kommentare... 60
5.10
Online-Foren ... 61
5.11
Online-Umfragen ... 62
5.12
Facebook ... 63
5.13
Twitter ... 65
5.14
flickr ... 67
5.15
YouTube ... 68
6.
Politiker und deren Einstellung zu Social Media ... 70
6.1
Methodisches Vorgehen zur Einstellungsmessung... 70
6.2
Inhaltlicher Aufbau... 71
6.3
Inhalte und Ergebnisse der Einstellungsmessung ... 72
6.3.1
Herausforderungen in der politischen Arbeit ... 72
6.3.2
Herausforderungen an die Kommunikationsleistung pol. Organisationen ... 75
6.3.3
Herausforderungen durch das Medium Internet ... 77
6.3.4
Herausforderungen durch Social Media ... 80
7.
Das Management der Beziehungen (CRM) ... 87
7.1
Definition von CRM ... 89
7.1.1
Wer ist der ,,Customer/Client/Citizen"? ... 89
7.1.2
Die Beziehung zum Customer/Client ... 90
7.1.3
Den Customer/Client managen oder Relationship eingehen? ... 91
7.2
Kontinuierlicher Dialog ... 92
7.3
Instrumente des Beziehungsmanagements ... 93
7.4
Die Rolle von Internet & Social Media im CRM ... 94
7.5
Der Aufbau von Beziehungsnetzen ... 96
7.6
Basis und rechtliche Aspekte im Beziehungsmanagement ... 97
7.6.1
Basisdaten zugänglich machen ... 97
7.6.2
Kommunikationskanäle legalisieren ... 98
7.6.3
Relevanz sicherstellen Basiskategorisierung ... 99
7.6.4
Dialog aufnehmen ... 99
7.6.5
Sukzessive Feinkategorisierung ... 99
7.6.6
Den Bürger einbinden ... 100
7.6.7
Dem Bürger Verantwortung übertragen ... 100
8.
Resümee ... 100
9.
Verzeichnisse ... 103
9.1
Literaturverzeichnis ... 103
9.2
Glossar ... 109
9.3
Abkürzungsverzeichnis ... 116
9.4
Abbildungsverzeichnis ... 116
9.5
Tabellenverzeichnis ... 117
10.
Anhang ... 119
10.1
Tabellen ... 119
10.2
Fragebogen ... 121
10.3
Rohdaten ... 123
10.4
Arbeitsmaterialien ... 124
10.4.1
Suchabfrage Online-Präsenz ... 124
10.4.2
Suchabfrage anhand von Synonymen ... 128
10.4.3
Analyse der Homepages ... 129
1
1. Einleitung
Durch die täglich über Rundfunk, Fernsehen, Tages- und Wochenzeitungen kolportierten Mel-
dungen über den Einfluss von Social Media auf politische Entwicklungen in geografisch meist
entfernt liegenden Regionen der Welt drängt sich die Frage auf, welche Rahmenbedingungen
konkret und aktuell in Österreich und hier wiederum auf Gemeindeebene vorliegen, welche eine
Ableitung der Wirkungsweise von Social Media auf politische Organisationen auf kommunaler
Ebene rechtfertigen.
1.1 Anlass
der
Exploration
Das Nutzungsverhalten in Bezug auf das Internet hat sich in den letzten Jahren deutlich verän-
dert und eine Verlagerung wenn nicht sogar eine Umkehr in der Bereitstellung der Inhalte von
einigen wenigen Medien, Organisationen und Unternehmen und gelegentlich Einzelpersonen in
Richtung der ,,Konsumenten" des Internets herbeigeführt. Diese Möglichkeit der Bereitstellung
von Inhalten repräsentiert jedoch nur einen Teil der neuen Eigenschaften der Internetanwen-
dungen, von denen die aktuell hervorstechendste wohl die Möglichkeit darstellt, dass sich die
Nutzer untereinander vernetzen und in Interaktion treten.
Für Wirtschaftsunternehmen ebenso wie für politische Organisationen bedeutet dies eine Ände-
rung der Rahmenbedingungen der Kommunikation, deren Steuerung nicht mehr nach den Ge-
setzen und Regeln der Vergangenheit gestaltbar ist: Die Möglichkeiten zur bewussten Steue-
rung der Informationsflüsse und Inhalte durch Unternehmen und Organisationen verändern sich
oder gehen zunehmend verloren. Die Anforderungen an die Medienkompetenz steigen und es
bedarf auch in Nicht-Wahlkampfzeiten eines konzeptionellen Vorgehens, das als wesentliche
Ergänzung der bislang im Vordergrund stehenden rhetorischen Kompetenz auf kommunalpoliti-
scher Ebene anzusehen ist.
Für den Nutzer sind Politik, Shopping, Fun, Enter- und Infotainment, Lernen, die eigene Finanz-
verwaltung etc. und auch der Dialog mit anderen Menschen nur wenige Mausklicks voneinan-
der entfernt und es beeinflussen sich wechselseitig die Erwartungshaltung der Anwender eben-
so wie die Form der Nutzung dieses Mediums. Die Beziehungsqualität zwischen Unternehmen
und ihren Geschäftspartnern wie den Repräsentanten der diversen relevanten Umwelten sowie
zwischen politischen Organisationen und den Bürgern befindet sich im Umbruch.
1.2 Aufbau
der
Arbeit
Diese Arbeit beleuchtet explorativ und kritisch den aktuellen Status dieses antizipierten Umbru-
ches auf kommunalpolitischer Ebene und lässt sich von der allgemeinen Euphorie ebensowenig
beeinflussen wie von den Beschwichtigungsversuchen, dass für Politik auch im Internet gänz-
2
lich andere Regeln gelten. Eher im Gegenteil sollen hier auch politische Organisationen in ihrer
Webpräsenz ganz nüchtern aus der Sicht des Marketings betrachtet werden und bewusst nach
denselben Kriterien analysiert werden wie Wirtschaftsunternehmen.
Bewusst weicht diese Arbeit von der im Internet überhandnehmenden Darstellung von ,,coo-
len" bis visionären Anwendungsmöglichkeiten ab, für die das dazu passende Problem oft erst
konstruiert und den Nutzern bewusst gemacht werden muss. Der erste Analyseschritt befasst
sich demnach mit dem Identifizieren zentraler Problemstellungen, welche mit Hilfe des Mediums
Internet einen realistischen Lösungsweg erwarten lassen.
Im zweiten Schritt soll kritisch beleuchtet werden, wieweit mittels der Technologie Internet
auf lokaler Ebene, direkt in den Gemeinden, die Bürger grundsätzlich erreicht werden können
und welche Nutzungsgewohnheiten und -entwicklungen tatsächlich erkennbar sind. Auch wenn
wenig Datenmaterial dazu vorhanden ist, sollen die Angaben der Kommunikationsindustrie be-
sonders kritisch geprüft und ihre Relevanz für politische Organisationen auf kommunaler Ebene
in Österreich abgeleitet werden.
Nicht weniger kritisch wird im darauf folgenden Kapitel die Webpräsenz ausgewählter politi-
scher Organisationen sehr differenziert analysiert werden. Der Maßstab dafür ist auch hier wie-
der das Erscheinungsbild eines durchschnittlichen, modernen Unternehmens im Internet. Er-
gänzt wird die statische Betrachtung der grundsätzlichen Informations- und Interaktionsfähigkeit
durch einen Test der tatsächlichen Interaktionsbereitschaft.
Nachdem die Arbeit die Identifikation einer zentralen Problemstellung politischer Organisati-
onen vorgenommen hat, die mediale Infrastruktur für einen webbasierten Lösungsansatz analy-
siert hat, die Ausprägung des Fundamentes in Form der aktuellen webbasierten Informations-
und Kommunikationsfähigkeit beleuchtet hat, soll im Kapitel 6 eine Einstellungsmessung bei
den Verantwortlichen der ausgewählten politischen Organisationen vorgenommen werden, wel-
che die wahrgenommene Brisanz, sich mit Internet und Social Media auseinanderzusetzen,
misst.
Das letzte Kapitel rundet die Exploration ab, indem es einerseits anhand eines Bezie-
hungsmodells aus der politischen Praxis wie aus den in der Wirtschaft inzwischen praktisch an-
gewandten Beziehungs-Management-Systemen (CRM) die Übertragbarkeit dieser Modelle auf
die Internet- und Social-Media-Welt analysiert. Dabei werden auch allgemeine und besondere
rechtliche Rahmenbedingungen für politische Organisationen hinterfragt. Die Übertragbarkeit
von Wirtschafts-Modellen und Methoden der Beziehungsentwicklung und -pflege auf politische
Organisationen wird analysiert und dargestellt. Damit wird ein Lösungsweg aufgezeigt, der un-
ter Zuhilfenahme von Mitteln der Informationstechnik das im ersten Analyseschritt identifizierte
3
Problem mit in Wirtschaftsunternehmen mittlerweile erprobten und etablierten Methoden mit Hil-
fe des Internets und Social Media auch ökonomisch lösbar macht und damit einen Paradig-
menwechsel im ,,Politmarketing" auszulösen imstande ist.
1.3 Erkenntnisinteresse
In einer zusammenfassenden Betrachtung dieser aufeinander aufbauenden bzw. Bezug neh-
menden Stufen der Erkenntnisgewinnung kann das Erkenntnisinteresse und damit das Ziel der
Gesamtarbeit durch folgende Forschungsfragen definiert werden.
x Problemstellung:
Ist bei politischen Organisationen auf kommunaler Ebene ein aktuelles Problem erkennbar,
für welches das Medium Internet einen Problemlösungsweg verspricht?
x Medienreichweite:
Hat das Medium Internet die Reichweite und zeigt das Anwenderverhalten der Bürger eine
Eignung zur Problemlösung?
x Onlinepräsenz:
Welcher Status des Einsatzes des Mediums ist seitens der politischen Organisationen fest-
stellbar?
x Einstellung:
Welche Einstellung ist seitens der Verantwortlichen bei den politischen Organisationen hin-
sichtlich des Mediums erkennbar?
x Übertragbarkeit:
Ist die Methode des Kundenbeziehungsmanagements der Wirtschaft auf politische Organi-
sationen übertragbar?
1.4 Methodik
Zur Gewinnung von Erkenntnissen soll eine Bestandsaufnahme des Istzustandes, also ein Bild,
wie gegenwärtig das Feld für die Nutzung der neuen Möglichkeiten der elektronischen Medien
bereits aufbereitet ist, in Form spezifischer Erhebungen durchgeführt werden:
Kap
Fragestellung
Forschungs-
methode
Erhebungs-
methodik
Medien/Quellen
2
Problemstellung
Literaturanalyse
Literatur, Internet
3
Mediendurchdringung
Literaturanalyse
Internet
4
Onlinepräsenz
Empirie (Teil 1)
Feldbeobachtung
Internet
Empirie (Teil 2)
Quasi-Experiment
,,Mystery-E-Mail"
5
Einstellung zum Medium
Empirie (Teil 3)
Befragung
Fragebogen
6
Methodenübertragung
Literaturanalyse
Literatur, Praxiserfahrung
Tabelle 1
Angewandte Forschungs- und Erhebungsmethodiken
4
Um der Geschwindigkeit und Dynamik der Veränderungen des Mediums Internet auch im Rah-
men dieser Arbeit gerecht zu werden, erfordert es eine Auseinandersetzung mit dem Thema,
die das Internet nicht nur als Beobachtungsobjekt sieht, sondern es auch selbst für die Informa-
tionsgewinnung heranzieht, um aktuelle und damit gültige Informationen der Exploration zug-
rundezulegen. Für einige der in dieser Arbeit getroffenen Aussagen und Darstellungen besteht
eine Halbwertszeit von wenigen Monaten. Diese soll den Wert der Arbeit jedoch nicht schmä-
lern, da der Fokus nicht auf den notwendigerweise zu berücksichtigenden technischen Rah-
menbedingungen, sondern vorrangig auf der Wahrnehmung der Anwendungs- und Befra-
gungsergebnisse liegt, die das vorangegangene Verhalten und die zugrunde liegende Einstel-
lung der Anwender erfassbar machen.
1.5
Festlegung der Stichprobe
Für die Festlegung der Stichprobe bilden die nachfolgenden Rahmenbedingungen die ent-
scheidenden Auswahlkriterien:
Niederösterreich wird in den kommenden Jahren infolge der verstärkten Zuwanderung
weiter stark an Bevölkerung gewinnen und von 1,61 Mio. (2009) bis 2050 um ein Fünftel
(20%) auf 1,94 Mio. anwachsen. Auf Niederösterreich entfällt damit neben der Bundes-
hauptstadt Wien das zweithöchste Bevölkerungswachstum aller Bundesländer. [...] Über-
durchschnittlich starkes Bevölkerungswachstum wird für Wien und Niederösterreich prog-
nostiziert. [...] Die Einwohnerzahl in den Städten und insbesondere in deren Umlandge-
bieten wird deutlich steigen, wobei der Großraum Wien besondere Dynamik zeigt. [...] Im
Wiener Umland wächst die Bevölkerungszahl künftig am stärksten.
1
Diese herausragende Dynamik und die durch das Wachstum zu antizipierenden demografi-
schen Veränderungen lenken den Fokus dieser explorativen Studie auf die Beobachtung der
ÖVP-Organisationen in den 10 größten Umlandgemeinden Wiens in Niederösterreich.
Das Land Niederösterreich weist insgesamt 573 Gemeinden
2
auf, davon 22 Gemeinden mit
mehr als 10.000 Einwohnern. Von diesen 22 Gemeinden verzeichnen 13 Gemeinden einen An-
teil an Auspendlern nach Wien, der über 25% der Erwerbstätigen
3
liegt. Diese 13 Gemeinden
stellen eine Einwohnerzahl von ca. 200.000 Menschen, die sich je zur Hälfte im unmittelbaren
Agglomerationsraum der Stadt Wien befinden und in Groß-Trabantenstädten im Umkreis von
ca. 50 km der Stadt. Die Zahl der Erwerbstätigen in diesem Großraum Wien innerhalb dieser
Groß-Trabantenstädte liegt bei 43% der Einwohner. Im Schnitt arbeiten ebenfalls ca. 43% da-
von als Pendler in der Großstadt Wien. Die in die Stichprobe aufgenommenen Markt- und
1
Statistik Austria. Ergebnisse der Bevölkerungsprognosen 2010. Internet:
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/bevoelkerung/demographische_prognosen/
bevoelkerungsprognosen/index.html#index2, (Abfrage: 09.05.2011)
2
Brinkhoff, Thomas (2010). City Population. Internet: http://www.citypopulation.de/php/austria-
niederosterreich_d.php. (Abfrage: 09.05.2011)
3
Statistik Austria (2001). Volkszählung, 15. Mai 2001, Erwerbspendler nach Pendelzielen. In-
ternet: http://www.statistik.at/blickgem/gemList.do?bdl=3, (Abfrage: 09.05.2011)
5
Stadtgemeinden weisen folgende Gemeinsamkeiten auf:
x Einwohnerzahl
>
10.000
Einwohner
x Erwerbspendleranteil
nach
Wien
>
25%
x Entfernung
von
Wien
<
50
km
Abbildung 1 Kartografische Darstellung der Stichprobenauswahl
Bevöl-
kerung*)
Wahlbe-
rechtigt
% Aus-
pendler
nach Wien
Km Ent-
fern.
von Wien
Anteil
ÖVP-
Wähler
an
Wahlber.
Wahl-
beteiligung ÖVP-Repr.
Baden
25.136
23.987
29%
33
23%
55% männlich
Brunn am Gebirge
11.095
10.486
48%
16
20%
59% männlich
Gerasdorf
10.019
10.316
73%
15
15%
59% weiblich
Klosterneuburg
25.686
25.806
58%
15
31%
55% männlich
Korneuburg
12.230
10.585
48%
20
28%
60% weiblich
Mödling
20.443
18.706
41%
18
23%
53% männlich
Perchtoldsdorf
14.524
14.523
57%
17
38%
60% männlich
Schwechat
16.352
14.321
46%
15
9%
52% männlich
Stockerau
15.412
13.695
37%
31
19%
62% weiblich
Tulln
14.721
12.685
28%
47
36%
67% männlich
Tabelle 2
Demografische Daten zur Stichprobe
Diese Stichprobe repräsentiert somit 11% der bei Gemeinderatswahlen wahlberechtigten Be-
völkerung des Landes Niederösterreich und weist folgende Kennzahlen auf:
6
Die Stichprobe für die explorative Studie umfasst die ÖVP-Organisationen der 10 größten Ge-
meinden im unmittelbaren Umland von Wien. In den Gemeinden dieser Stichprobe ist auf Basis
der Gemeinderatswahl 2010
4
eine breite Streuung der ÖVP-Wähler zu verzeichnen. Diese be-
trägt gemessen an der Gesamtzahl der Wahlberechtigten zwischen 9% und 38%. Der Landes-
durchschnitt liegt bei 36%.
Die durchschnittliche Wahlbeteiligung lag 2010 landesweit in Niederösterreich bei 72%. Alle
Gemeinden der Stichprobe liegen zwischen 52% bis 67% und damit unter dem landesweiten
Durchschnitt und auch unter dem Vergleichswert von 68%, der bei der Gemeinderatswahl in
Wien 2010 erreicht wurde. Von den ÖVP-Obleuten der Gemeinden sind bei dieser Stichprobe 7
von 10 männlich und 3 weiblich.
Abbildung 2 Nahtstelle zwischen politischer Organisation und den Bürgern
Die ÖVP hat mit ihrer Bündestruktur in punkto Marketingkommunikation eine sektorale Gliede-
rung. Sie ist damit in der Lage, definierte Zielgruppen zu fokussieren, die sich mit Hilfe der de-
mografischen Variablen Alter (Junge & Senioren), Geschlecht (Frauen) und Beruf (Arbeiter, An-
gestellte, Wirtschaftstreibende und Bauern) beschreiben lassen. Für die Studie wird unterstellt,
dass die Struktur der Organisation auch auf der Ebene, wo sie unmittelbar auf die Bürger trifft,
von diesen wahrnehmbar sein soll, damit sich die Menschen in die Organisation einordnen kön-
nen und sich damit in ihren Themen und Anliegen wiederfinden können.
4
Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (2010). Wahlen in Niederösterreich. Die Ge-
meinderatswahl 2010 in Niederösterreich. Internet: http://www.noel.gv.at/Politik-
Verwaltung/Wahlen/NOe-Gemeinderatswahlen/Gemeinderatswahl2010IT.wai.html, (Abfrage:
09.05.2011, 13:56)
7
2.
Die Bürger und die Politik
Im ersten Teil der Analyse soll im Sinne der ersten Forschungsfrage herausgearbeitet werden,
welche Problemstellung politischer Organisation vorliegt, deren Rahmenbedingungen und Lö-
sungsansätze im Verlaufe dieser Arbeit behandelt werden soll. Wie jedes Unternehmen müssen
sich auch politische Organisationen kontinuierlich mit den Veränderungen der Beziehung zu
den Kunden bzw. in diesem Fall den Bürgern bzw. den Veränderung in der Kunden- bzw. Wäh-
lerstruktur auseinandersetzen, um Entwicklungen zu antizipieren bzw. darauf zu reagieren.
Das Modewort unserer Zeit scheint jedoch ,,Politikverdrossenheit" zu sein, aktuell gefolgt von
,,Wutbürger". Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht die Presse diese Vokabel verwendet und die
öffentliche Wahrnehmung der Politik bzw. deren Repräsentanten thematisiert. Vermehrt wird die
öffentliche Diskussion dahingehend geführt, dass der Politikverdrossenheit als Ursache eine
Politikerverdrossenheit unterstellt wird. ,,Die Fäden zwischen der Bevölkerung und ihren regie-
renden Politikern sind zerfranst und oft schon abgerissen. Man hat sich auseinandergelebt"
5
,
bringt Herbert Kohlmaier selbst jahrzehntelang aktiver Politiker in einem Gastkommentar in
der Zeitung ,,Die Presse" die aktuelle Stimmung auf den Punkt.
2.1
Die Erwartungshaltung an politische Parteien
Gerade die Österreichische Volkspartei, die im Fokus dieser Arbeit steht, hat sich vorgenom-
men, das Vertrauen in die Politik zu festigen und hat schon 1995 in ihrem Grundsatzprogramm
dazu die Leitlinien und Ziele für ihr eigenes Handeln definiert:
Wir wollen das Vertrauen der Bürger in die demokratischen Einrichtungen festigen. De-
mokratische Institutionen sind auf das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger angewiesen
und müssen dieses ständig neu erringen. Wir wollen dies durch Sicherstellung der Hand-
lungsfähigkeit der politischen Institutionen und der Glaubwürdigkeit der politischen Funkti-
onsträger erreichen. Wir wollen die Menschen zur Mitarbeit und zur Mitwirkung immer
wieder einladen.
6
2.2
Die Erwartungshaltung an die Bürger
Aber die ÖVP hat auch die Erwartungshaltung an die Bürger formuliert:
Wir wollen, daß [sic!] die Bürger an den politischen Vorgängen, die ihr Leben bestimmen,
teilnehmen. Durch die Teilnahme möglichst vieler kann die Demokratie weiterentwickelt
werden und auf Dauer Belastungen standhalten.
7
5
Kohlmaier, Herbert (2011). Die ÖVP im Sturm des gesellschaftlichen Wandels. Wien
6
ÖVP (Österreichische Volkspartei) Bundespartei (1995). Grundsatzprogramm. Internet:
http://www.oevp.at/download/000298.pdf, 5
7
ÖVP (Österreichische Volkspartei) Bundespartei (1995). Grundsatzprogramm. Internet:
http://www.oevp.at/download/000298.pdf, 8
8
Und sie ergänzt in ihren Ausführungen pleonastisch und sehr allgemein gehalten die besondere
Rolle der Bürger in einer Demokratie: ,,Lebendige Demokratie bedarf der Mitwirkung der Bürger
an der öffentlichen Diskussion und an politischen Entscheidungen."
8
Wesentlich unverblümter
nimmt hingegen 2009 Christian Felber die Bürger in die Pflicht und benennt auch eine, seiner
Meinung nach, verantwortliche Ursache für die aktuelle Schieflage der Beziehung zwischen Po-
litik und Volk:
Es fehlt uns an demokratischer Verantwortung: Wir alle sind die InhaberInnen der Demo-
kratie und es ist unser aller Pflicht, auf das gemeinsame Gut zu achten, es zu pflegen und
weiterzuentwickeln.
9
2.3
Die Erwartungshaltung an das politische System
Eine gänzlich andere Position vertritt Peter Pelinka, der nicht sosehr die Ursache in der Einstel-
lung und im Verhalten der Bürger sieht, sondern überhaupt in der Rolle der Politik in unserer
Gesellschaft, die ihr einen anderen Stellenwert einräumt als noch vor zehn oder zwanzig Jah-
ren:
Etablierte »Politik« ist heute auch in Österreich, nach mehr als zehn Jahren neuerlicher
Großer Koalition, mehr »out« als jemals zuvor: Das betrifft Objekt wie Subjekte: Politik
kann heute nicht einmal mehr den Anschein verbreiten oberstes Leitungssystem zu sein,
ist ebenso wie »Wirtschaft«, »Medien«, oder »Kultur« zu einem Rädchen in einer immer
komplexeren, differenzierteren, schwieriger zu steuernden Gesellschaft geworden.
10
2.4
Auswirkungen auf politische Organisationen
Dieses von Peter Pelinka wahrgenommene ,,Out", also der Bedeutungsverlust der Politik, kann
auch als Ursache für eine geringere Bereitschaft der Bürger gedeutet werden, sich an eine Par-
teiorganisation zu binden:
Der Organisationsgrad der österreichischen Wählerschaft in den beiden traditionellen
Großparteien, der Anfang der 80er Jahre (unter Einrechnung der Familienmitglieder) noch
rund 26% betrug, ist bis zur Mitte der 90er Jahr auf rund 18% zurückgegangen, mit weiter
fallender Tendenz.
11
Nicht nur der Mitgliederschwund bringt politische Organisationen in Bedrängnis, sondern auch
von den Auswirkungen der demografischen Veränderungen in der Gesellschaft bleiben sie nicht
8
ÖVP (Österreichische Volkspartei) Bundespartei (1995). Grundsatzprogramm. Internet:
http://www.oevp.at/download/000298.pdf, 9
9
Felber, Christian (2009). Kooperation statt Konkurrenz. 10 Schritte aus der Krise. Wien, 116
10
Pelinka, Peter (1998). Österreich 19451998. Eine Bestandsaufnahme aus journalistischer
Sicht, in: Kriechbaumer, Robert (Hg.). Österreichische Nationalgeschichte nach 1945. Der
Spiegel der Erinnerung: Die Sicht nach innen. Band I, Wien Köln Weimar, 183195, 186
11
Müller, Wolfgang C. (1998). Das Parteiensystem in der Zweiten Republik: Entwicklungspha-
sen und Dynamik seit 1986, in: Kriechbaumer, Robert (Hg.). Österreichische Nationalgeschichte
nach 1945. Der Spiegel der Erinnerung: Die Sicht nach innen. Band I, Wien Köln Weimar, 199
230, 213
9
verschont:
Alarmierender als der Rückgang der Parteimitglieder ist die fortschreitende Überalterung
der Mitgliederstöcke. Ohne neue und attraktive Rekrutierungsanstrengungen decken die
Parteiorganisationen Ende der neunziger Jahre nur mehr das Seniorenspektrum der ös-
terreichischen Wählerschaft ab. Auch die Altersstruktur der Wählerschaft der Traditions-
parteien ist verzerrt. Gelingt es den Traditionsparteien nicht, ihre mangelnde Attraktivität
für jüngere Wählergenerationen durch ein attraktives Politik- und Personenangebot aus-
zugleichen, erscheint ihre strukturelle Erosion als unausweichlich und vorprogrammiert.
12
Mit der dadurch erzwungenen Erweiterung des Fokus, der bislang vorrangig auf die eigenen
Mitglieder gerichtet war, auf neue Wählerschichten, geht fast zwangsläufig eine Veränderung
des Kommunikationsverhaltens einher:
Mit dem Verschwinden des Stammwählers müssen sich die Parteien ebenso wie die Ver-
bände bei jedem einzelnen Wahlgang die Stimmen aufs Neue erkämpfen. [...] Die Partei
kann Mehrheiten nur erzielen, wenn sie über ihre (einstige) Kernschicht hinaus andere
Wählerschichten anspricht.
13
2.5
Diskussionspunkt ,,Jungwähler"
Obwohl, wie wir in den folgenden Ausführungen zu dieser Arbeit noch sehen werden, der Anteil
der Nichtwähler in den beobachteten 10 Gemeinden bereits bis fast an die 50%-Marke heran-
reicht, konzentrieren sich beinahe alle Parteien bei der Erweiterung der Zielgruppe auf die
Gruppe der Jung- und Erstwähler.
Nach der Wahlrechtsreform 2007 konnten im Jahr 2008 bei der Nationalratswahl erstmals
auch schon 16- und 17-Jährige ihre Stimme abgeben. Österreich ist damit in Sachen
Senkung des Wahlalters Pionier in Europa. Damit waren am 28. September rund 93.000
Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren erstmals wahlberechtigt. Dazu kamen etwa
91.000 ErstwählerInnen, insgesamt kann man also von ca. 184.000 Erstwählern spre-
chen.
14
Ob das Senken des Wahlalters alleine ausreicht, ohne auch das Kommunikationsverhalten auf
die neue Zielgruppe hin auszurichten, ist zu hinterfragen. Ob und in welchem Umfang die Orga-
nisationen der Stichprobe dies tut bzw. dies über deren Onlinepräsenz auch erkennbar ist, da-
mit wird sich das übernächste Kapitel beschäftigen.
Während die erwachsene Öffentlichkeit darüber nachdenkt, wie man junge Menschen an
politischen Prozessen und Entscheidungen stärker beteiligen könnte, präsentiert sich der
12
Plasser, Fritz (1999). Von ,,Parteisoldaten" zu Online-Parteisympathisanten. Eine Zeitreise
durch Österreichs Parteiengeschichte. Internet: http://www.demokratiezentrum.org/fileadmin-
/media/pdf/plasser.pdf
13
Karlhofer, Ferdinand (2010). Die Partei und ihre Gewerkschaft. Verflechtungen und Span-
nungslinien im Verhältnis SPÖFSG, in: Broukal, Josef / Ablinger, Sonja (Hg.). Nachrichten
vom Ableben der SPÖ sind stark übertrieben! Schafft die Sozialdemokratie den Tournaround?
Wien, 249268, 267
14
Moitzi, Wolfgang (2010). Vom Fackelzug zum Clubbing und wieder retour?, in: Broukal, Josef
/ Ablinger, Sonja (Hg.). Nachrichten vom Ableben der SPÖ sind stark übertrieben! Schafft die
Sozialdemokratie den Tournaround? Wien, 1134, 11
10
jugendkulturelle Mainstream heute weitgehend apolitisch. Die breite Mehrheit der Jugend-
lichen identifiziert sich mit Jugendkultur(en), doch sie nutzt diese nicht für politische Posi-
tionierungen, sondern vielmehr für ein bewusstes Ausklinken aus der Beschäftigung mit
den großen politischen Themen unserer Zeit.
15
Ob die politischen Organisationen auf Kommunalebene zu dieser, allerdings in Deutschland
wahrgenommenen, Einstellung der Jugend zu Politik einen Beitrag zu ihrem eigenen Kommuni-
kationsverhalten sehen können, werden die finalen Erkenntnisse aus dieser Arbeit zeigen.
Diese offensichtliche Distanz und die wahrgenommenen Hürden zeigen sich auch im Ver-
gleich der Jugendwertestudien aus den Jahren 1990, 2000 und 2006/07: Dieser Zeitver-
gleich belegt, dass die politischen Aktivitäten sowohl bei den männlichen wie den weibli-
chen Jugendlichen deutlich abgenommen haben. So zum Beispiel bei Unterschriften-
sammlungen (1990: 59%, 2006: 32%) oder bei Demonstrationen von 30% im Jahre 1990
auf nunmehr nur 15% (2006). Das lässt unter anderem den Schluss zu, dass Jugendliche
wenig Vertrauen in die derzeitige Ausgestaltung der Partizipationsmöglichkeiten haben.
16
Gerade die Frage nach der Ausgestaltung der Partizipationsformen ist Gegenstand dieser Stu-
die.
2.6
Diskussion über neue Partizipationsformen
Besonders bei den letzten Ausführungen muss jedoch beachtet werden, dass die ,,Jugendwer-
testudie" lediglich Partizipationsmöglichkeiten hinterfragt, die sich über einen Zeitablauf von 20
Jahren vergleichen lassen. Neue Partizipationsformen im Web 2.0 kommen daher hier nicht
vor. Den Schluss zu ziehen, dass die jeweilige Halbierung der Werte beim Unterschriftensam-
meln oder der Beteiligung an Demonstrationen einen Vertrauensverlust in die Partizipations-
möglichkeiten darstellt, erscheint nicht mehr zeitgemäß, weil er moderne Formen der Partizipa-
tion wie z. B. Facebook-Gruppen oder sonstige Internetforen ausklammert:
Mit der zunehmenden Verbreitung des Internets und sozialer Netzwerke (Twitter, Face-
book usw.) ist ein neues Leitmedium der Jugend als eine direkte und im Unterschied zum
TV duale Kommunikationsmöglichkeit mit partizipativem Potenzial entstanden, das die
Sozialdemokratie für sich nützen kann.
17
Wieweit das Medium Internet insbesondere mit dem angesprochenen ,,partizipativen Potenzial"
wirklich primär ein Medium der Jugend ist und welche Zielgruppen darüber erreichbar sind, wird
noch im nachfolgenden Kapitel analysiert werden.
15
Großegger, Beate. Jugend zwischen Partizipation und Protest, in: Bundeszentrale für politi-
sche Bildung (Hg.): Aus Politik und Zeitgeschichte. Bonn (Aus Politik und Zeitgeschichte ist Be-
standteil der Wochenzeitung Das Parlament.), 812, 9
16
Moitzi, Wolfgang (2010). Vom Fackelzug zum Clubbing und wieder retour?, in: Broukal, Josef
/ Ablinger, Sonja (Hg.): Nachrichten vom Ableben der SPÖ sind stark übertrieben! Schafft die
Sozialdemokratie den Tournaround? Wien, 1134, 16
17
Moitzi, Wolfgang (2010). Vom Fackelzug zum Clubbing und wieder retour?, in: Broukal, Josef
/ Ablinger, Sonja (Hg.): Nachrichten vom Ableben der SPÖ sind stark übertrieben! Schafft die
Sozialdemokratie den Tournaround? Wien, 1134, 16
11
Voraussetzung dafür (Nutzung des Internets für Zwecke der politischen Partizipation,
Anm.) ist aber, dass Jugendliche wirklich in Entscheidungsprozesse eingebunden werden
und gehört werden, denn nichts ist fataler, als Jugendliche zu Wort kommen zu lassen
und sie dann mit den Erfahrungen über die mangelnde Wirksamkeit ihres Engagements
alleine zu lassen.
18
Mit ,,gehört werden" und zwar nicht als Politiker, sondern umgekehrt als Bürger spricht Wol-
fang Moitzi einen Aspekt an, mit dem wir uns im vorletzten und letzten Kapitel im Rahmen von
CRM auseinandersetzen werden, doch davor soll noch abgeklärt werden, wieweit auf Gemein-
deebene die bestehenden gesetzlichen Rahmenbedingungen überhaupt die geforderte Einbin-
dung in Entscheidungsprozesse vorsehen und ermöglichen. Doch bei aller Bereitschaft, sich auf
die Klientel der Jungwähler auszurichten, soll im übernächsten Kapitel analysiert werden, wie-
weit die beobachteten politischen Organisationen sich bereits heute mit dem Einfluss des neuen
Mediums Internet generell und mit der speziellen Ausprägung von Social Media auf alle Bürger
aller Altersgruppen ausgerichtet haben und welche Einstellung zu diesen Veränderungen bei
den Politikern von 10 Umlandgemeinden Wiens zu beobachten ist.
2.7 Erkenntnisse
Dieses Kapitel hat aufgezeigt, dass ein Problembewusstsein über die Veränderungen der Be-
ziehung der Bürger zur Politik ausgeprägt vorhanden ist, dass die Entwicklungen nicht erst heu-
te intensiv diskutiert werden, sondern schon im letzten und vorletzten Jahrzehnt Gegenstand öf-
fentlich kolportierter Überlegungen, Befürchtungen und Zielformulierungen waren. Es wird so-
wohl die verstärkte Ausrichtung auf neue Wählerschichten in Form von Jungwählern diskutiert
als auch geänderte Partizipationsformen an politischen Prozessen. Die wachsende Bedeutung
der neuen Medien Internet und hier insbesondere Social Media und die Möglichkeit, auf die of-
fensichtlich bevorstehenden Veränderungen in der Beziehung zwischen Politik und Bürgern sei-
tens der politischen Organisationen zu reagieren, wird erkannt und ist unbestritten. Wie groß je-
doch Reichweite und Akzeptanz dieses Mediums bei den Bürgern speziell für den Einsatz auf
kommunalpolitischer Ebene sind, soll das folgende Kapitel klären.
3.
Die Bürger und Social Media
Marketing bedeutet, sehr vereinfacht formuliert, sich sorgfältig und kritisch mit seinem Markt
auseinanderzusetzen und sich als Unternehmen bzw. Organisation auf ihn auszurichten. Zum
Markt zählen in erster Linie die Menschen, aber auch das Kommunikationsverhalten und die
Nutzung von Kommunikationsmedien. Um in einem Markt erfolgreich agieren zu können, sind
18
Moitzi, Wolfgang (2010). Vom Fackelzug zum Clubbing und wieder retour?, in: Broukal, Josef
/ Ablinger, Sonja (Hg.): Nachrichten vom Ableben der SPÖ sind stark übertrieben! Schafft die
Sozialdemokratie den Tournaround? Wien, 1134, 1617
12
dies die wichtigsten Aspekte, mit denen sich nun dieses Kapitel kritisch auseinandersetzt, um
eine Antwort auf folgende Frage zu finden:
Hat das Medium Internet die Reichweite und zeigt das Anwenderverhalten der Bürger eine
Eignung zur Problemlösung?
Zur Beantwortung dieser Frage sollen die gegenwärtige Nutzung des Mediums Internet generell
und dann in der Folge die speziellen Ausprägungen und Anwendungen von Social Media be-
leuchtet werden, bevor die zwei wesentlichen Vertreter dieser Anwendung noch gesondert in ih-
rer lokalen Bedeutung analysiert werden. Um den Stellenwert dieses Kommunikationsmediums
zur Beantwortung der gestellten Frage umfassender beantworten zu können, wird das Medium
noch im Medienmix betrachtet und ein Ausblick auf die zukünftige Entwicklung vorgenommen.
Das alles wäre jedoch zu wenig, um wirklich eine Antwort auf die gestellte Frage geben zu kön-
nen. Nicht nur, dass hier konsequent der Fokus auf den Status in Österreich gelegt wird, soll
zur besseren Veranschaulichung im Sinne der Fragestellung das Zahlenmaterial auch auf eine
,,Beispielgemeinde" heruntergebrochen und dargestellt werden.
3.1 Internet
Die Nutzung von Social Media setzt die Möglichkeit, das Medium Internet zu nutzen, voraus und
ist somit untrennbar damit verbunden. Es soll daher im ersten Teil dieses Kapitels die Basis für
Social Media beleuchtet werden. So wie das Internet die technische Voraussetzung für Social
Media darstellt, sind diese wiederum das Instrument für Soziale Netzwerke, mit deren Durch-
dringungs- und Anwendungsstatus sowie deren besonderen Rolle im Medienmix wir uns in der
Folge auseinandersetzen werden, bevor wir uns der Zukunft des Mediums Internet im letzten
Abschnitt dieses Kapitels zuwenden.
3.1.1 Status der Internetnutzung in Österreich
Die in Abbildung 3 dargestellten Ergebnisse einer in Österreich relativ zeitnahe zu dieser Arbeit
durchgeführten Studie zeigen, dass das Medium Internet in der Zielgruppe der österreichischen
Bürger bereits eine Reichweite von 80% aufweist, wobei die Erreichbarkeit von Frauen über
dieses Medium mit 74% noch deutlich hinter der der Männer (87%) zurückliegt. Die Gliederung
der erhobenen Werte nach Altersgruppen ist in 7 Stufen erfolgt, wobei die jüngsten drei Alters-
gruppen (1419, 2029 und 3039 Jahre) eine Nutzung des Mediums von nahezu 100% auf-
weisen. Die gewöhnlich noch im Erwerbsleben befindlichen zwei Altersgruppen zwischen 4049
und 5059 Jahren zeigen eine Nutzung des Mediums von 90 bzw. 81%. Die erste überwiegend
im Ruhestand befindliche Bevölkerungsgruppe im Alter von 60 bis 69 Jahren weist zu knapp
zwei Drittel und die Altersgruppe von 70 Jahren und älter noch eine Nutzung des Mediums von
13
über einem Viertel auf. Menschen mit Matura nutzen mit 93% das Medium signifikant häufiger
als Menschen ohne Matura (76%).
Abbildung 3 Status der Internetnutzung in Österreich, gegliedert nach Zielgruppen
Die grundsätzliche Akzeptanz dieses Mediums bei den Bürgern in ihrer Rolle als aktive oder
passive Nutzer ist demnach augenscheinlich. Dieser Zahl an Nutzern steht der Zugang zu al-
len weltweit verfügbaren Internetseiten offen. Das ,,indizierte Web enthält mindestens 18,77 Mil-
liarden Seiten (Dienstag, 21. Juni 2011)."
19
Diese Zahlen zeigen, dass das Medium sowohl für
Konsumenten als auch für Anbieter von Inhalten und Funktionen im Internet eine enorme Be-
deutung erlangt hat.
3.1.2 Entwicklung der Internetnutzung in Österreich
Wie in Abbildung 4 ersichtlich ist, verzeichnet das Medium einen kontinuierlichen Akzeptanzge-
winn bei den Bürgern in Österreich. Die zugrundeliegende Erhebung weist nicht nur den Besitz
eines Internet-Anschlusses aus, sondern ergänzend dazu auch den Grad der ,,regelmäßigen
Nutzung". Darunter wird in dieser Erhebung eine Nutzung mehrmals pro Woche verstanden.
19
de Kunder, Maurice (2011). World Wide Web Size. daily estimated size of the world wide
web. Internet: http://www.worldwidewebsize.com/ (Abfrage: 21.06.2011)
14
Abbildung 4 Entwicklung der Internetnutzung
repr. Österr. ab 14 Jahren, Erhebung Jänner bis März 2011, n = 3000 pro Quartal, Angabe in %
Als Zusatzinformation wurden die Zeitpunkte der Gemeinderatswahlen in Niederösterreich ein-
gefügt. Dies zeigt den gravierend veränderten Stellenwert dieses Mediums bei der letzten Ge-
meinderatswahl gegenüber den beiden vorangegangenen Wahlen. War eine regelmäßige In-
ternetnutzung in der Zeit des Wahlkampfes im Jahr 2000 im Ausmaß von 30% zu verzeichnen,
erhöhte sich diese zum Wahlkampf der Gemeinderatswahl 2005 bereits auf knapp 50% und er-
reichte im Wahlkampf 2010 bereits einen Wert von fast 70%.
3.1.3 Entwicklung der Internetnutzung je Altersgruppe
Abbildung 5 liefert eine Koppelung der beiden vorangegangenen Bilder, die Elemente der Struk-
tur der Bevölkerung mit der Entwicklung der Nutzung kombiniert. Die Darstellung zeigt je Al-
tersgruppe den Anteil an Personen, die in den letzten drei Monaten das Internet genutzt haben
in % aller Personen der Altersgruppe. Bemerkenswert ist bei dieser Darstellung, dass sich die
Linien der drei jüngsten Altersgruppen (1624, 2534 und 3544) bereits auf sehr hohem Ni-
veau abflachen, während die Linien der anderen drei Altersgruppen (4554, 5564 und 6574)
weiter steigen.
15
Abbildung 5 Personen, die in den letzten drei Monaten das Internet genutzt haben
Angabe in % aller Personen.
20
Erstellt am: 17.11.2010. Befragungszeitpunkte: Juni 2002, März 2003,
Zweites Quartal 2004, Februar bis April 2005, Februar und März 2006 bis 2008, Februar bis April 2009,
Mai und Juni 2010
Die Darstellung bestätigt somit auf der einen Seite, dass die älteren Bevölkerungsgruppen über
das Internet nur eingeschränkt erreichbar sind, zeigt aber auch deutlich Steigerungsraten in der
jüngeren Vergangenheit. Die den Originaldaten dazugestellte Trendlinie deutet eine mögliche
weitere Entwicklung an, die für zukünftige Kommunikationsstrategien von Bedeutung sein kann.
3.1.4 Internetnutzung je Altersgruppe, umgelegt auf eine Beispielgemeinde
Die Darstellung in Abbildung 6 zeigt die Nutzungsintensität des Internets, strukturiert nach Al-
tersgruppen am Beispiel einer der 10 in der Folge analysierten Umlandgemeinden Wiens. Dazu
wurden zu den spezifischen demografischen Daten der Bürger dieser Gemeinde die Durch-
schnittsdaten der Internetnutzung in Österreich ergänzt. Umgelegt auf diese Beispielgemeinde
ergibt sich anhand der verwendeten Datenbasis für 2010 die dargestellte Abstufung zwischen
Bürgern einer bestimmten Altersgruppe und den darin vorhandenen aktiven Internetnutzern.
Die Grafik gibt Aufschluss darüber, welche Zielgruppen innerhalb der Bevölkerung einer bei-
spielhaften Stadtgemeinde im Umland von Wien über das Medium Internet in welchem Ausmaß
erreicht werden können. Die Angaben sind die Anzahl der Bürger.
20
Statistik Austria (2010). IKT-Einsatz in Haushalten. Internetnutzerinnen oder Internetnutzer
2002 bis 2010. Internet: http://www.statistik.at/web_de/statistiken/informationsgesellschaft/ikt-
einsatz_in_haushalten/index.html, (Abfrage: 17.05.2011)
16
Abbildung 6 Errechnete Nutzungsintensität des Internets
21
Darstellung je Altersgruppe
22
anhand einer Beispielgemeinde
Die Grafik zeigt, dass in dieser Beispielgemeinde die Zielgruppe der JVP in den Altersgruppen
1624 und 2534 Jahre 3.367 (1.567 + 1.800) Personen umfasst und über das Medium Internet
3.145 (1.489 + 1.656) Personen, also 93% der Zielgruppe potenziell erreichbar sind.
3.1.5 Verwendung des Internets
Wir haben uns in diesem Kapitel bis jetzt damit auseinandergesetzt, wieweit in der Zielgruppe
der politischen Organisationen das Medium Internet grundsätzlich akzeptiert wird. Dazu haben
wir uns die Nutzungsintensität angesehen und diese nach den demografischen Merkmalen wie
Geschlecht, Alter und Bildungsgrad aufgeschlüsselt. Anhand einer Beispielgemeinde haben wir
betrachtet, welche Erreichbarkeit der Bürger über dieses Medium grundsätzlich und im Verhält-
nis zur Gesamtbevölkerung für eine politische Organisation gegeben ist. Hier wollen wir uns
nun der Frage widmen, für welchen Zweck die Bürger das Medium verwenden.
Abbildung 7 zeigt verschiedene Nutzungsmöglichkeiten des Mediums Internet, welche bei In-
ternetnutzern dahingehend abgefragt wurden, ob das Internet in den letzten 4 Wochen dafür
benutzt wurde.
21
Statistik Austria (2010). IKT-Einsatz in Haushalten. Internetnutzerinnen oder Internetnutzer
2002 bis 2010. Internet: http://www.statistik.at/web_de/statistiken/informationsgesellschaft/ikt-
einsatz_in_haushalten/index.html, (Abfrage: 17.05.2011)
22
Statistik Austria (2010). Ein Blick auf die Gemeinde. Aktuelle Bevölkerung und Bevölkerungs-
entwicklung. Bevölkerungsstand und -struktur. Internet:
http://www.statistik.at/blickgem/index.jsp, (Abfrage: 17.05.2011)
17
Abbildung 7 Verwendung des Internets
23
rep. Österr. Internetnutzer ab 14 Jahren, Jänner bis März 2011, n = 3000 pro Quartal, Angabe in %
a) Kommunikation
Die Darstellung zeigt, dass die Nutzung für die Kommunikation via E-Mail im 1. Quartal 2011
mit 86% den höchsten Stellenwert aller Nutzungsmöglichkeiten einnimmt, dieser Wert jedoch
gegenüber der Vergleichsperiode im Vorjahr um 5 Prozentpunkte gesunken ist. Dem gegenüber
steht an letzter Stelle der Nutzungshäufigkeit die Nutzung von Networking-Plattformen, die auf
einem Niveau von 44% im 1. Quartal 2010 um 5 Prozentpunkte gegenüber der Vergleichsperi-
ode im Jahr 2011 zugelegt hat. Ebenso zwar auf einem hohen Niveau von aktuell 64%, jedoch
mit 4 Prozentpunkten rückläufig, ist die ,,Suche nach Adressen und/oder Telefonnummern".
Damit ist erkennbar, dass Kommunikation einer der wesentlichen Aspekte für die Nutzung des
Internets ist, sich die Kommunikationsformen jedoch deutlich verschieben.
b) Information
Auf dem zweiten Platz der Nutzungsmöglichkeiten liegt mit 77% der ,,Zugriff auf aktuelle Infor-
mationen und Nachrichten". Dieser Wert hat auf bereits hohem Niveau gegenüber dem Vorjahr
eine Steigerung um 8 Prozentpunkte zu verzeichnen. Die zweithöchste Steigerung in der Nut-
zung wurde mit einem Plus von 7 Prozentpunkten beim Item ,,Zugriff auf Online-Lexikon und
wissenschaftliche Studien" verzeichnet. Eine Steigerung von 6 Prozentpunkten verzeichnet das
Item ,,Zugriff auf aktuelle Ausgabe einer Zeitung/Zeitschrift" und zeigt damit aktuell eine Nutzung
von 61% der Internetanwender für diesen Zweck. Die aktive Informationsbeschaffung ist damit
23
Barth, Bertram / Cerny, Sandra (2011). Austrian Internet Monitor (AIM). Kommunikation und
IT in Österreich. 1. Quartal 2011. Internet: http://www.integral.co.at/downloads/Internet/2011/05-
/AIM-Consumer_-_Q1_2011.pdf, 5
18
neben der Kommunikation die zweite starke Säule der Internetanwendung (vgl. hierzu die Moti-
ve der Mediennutzung in Abbildung 17 am Schluss dieses Kapitels).
c) Fun
&
Entertainment
Ebenfalls mit 6 Prozentpunkten stark wachsend und für aktuell 62% der Internetnutzer der
Grund ins Internet einzusteigen drückt sich im Item ,,Multimedia Inhalte, wie Filme, Musikvideos
ansehen" aus. Insgesamt sind jedoch besonders hier die Grenzen fließend, weil multimedial
aufbereitete Inhalte auch in den anderen Verwendungsbereichen Einzug halten und mehr und
mehr auch im Bereich der Informationsbereitstellung die Erwartungshaltung beeinflussen.
3.1.6 Internetnutzung je privatem Zweck und Altersgruppe
Es wäre unzureichend, die Antworten auf die Frage, wofür Bürger das Internet nutzen, hier un-
reflektiert stehen zu lassen und die erhobenen Werte nicht mit der Altersstruktur in Relation zu
setzen. Die Items bei dieser Befragung beziehen sich zwar nur grob auf dieselben Erhebungs-
gegenstände der zuletzt benutzten Befragungsergebnisse, geben aber wesentliche zusätzliche
Informationen im Bereich der Nutzung des Internets für Kommunikationszwecke.
Alter
1624
2534
3544
4554
5564
6574
Insge-
samt
Senden oder Empfangen von E-Mails
92%
93%
90%
85%
88%
85%
90%
Finden von Informationen über Waren oder
Dienstleistungen
70%
85%
84%
76%
76%
66%
78%
Lesen oder Herunterladen von Zeitungen, Zeit-
schriften oder Magazinen
53%
63%
58%
61%
57%
53%
58%
Internet-Banking
39%
68%
56%
48%
41%
36%
51%
Suchen von gesundheitsbezogenen Informatio-
nen
42%
54%
53%
51%
53%
51%
51%
Nutzen von Angeboten oder Leistungen für Rei-
sen oder Unterkünfte
37%
49%
49%
49%
50%
50%
47%
Chatten oder Nachrichten in Social-
Networking-Sites, Blogs, Newsgroups oder
Online-Diskussionsforen stellen oder Nutzen
von Instant-Messaging
73%
50%
27%
19%
15%
12%
37%
Nutzen des Internets, mit dem Ziel zu lernen
56%
37%
32%
29%
31%
24%
36%
Tabelle 3
Personen mit Internetnutzung für private Zwecke 2010
24
Personen mit Internetnutzung in den letzten drei Monaten. Erstellt am: 17.11.2010. Befragungszeitpunkt:
Mai und Juni 2010.
Am auffälligsten in Tabelle 3 erscheint der geringe Abfall der Prozentwerte mit zunehmendem
Alter beim Punkt ,,Senden & Empfangen von E-Mails". Die zweite Auffälligkeit, bei der es sich
24
Statistik Austria (2010). Europäische Erhebung über den IKT-Einsatz in Haushalten 2010.
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/informationsgesellschaft/ikt-
einsatz_in_haushalten/index.html, (Abgefragt: 21.06.2011)
19
lohnt, den Nutzungsdaten nach Altersgruppen gegliedert besondere Aufmerksamkeit zu wid-
men, ist das Item mit den typischen Social-Media-Aktivitäten ,,Chatten oder Nachrichten in So-
cial-Networking-Sites, Blogs, Newsgroups oder Online-Diskussionsforen stellen oder Nutzen
von Instant-Messaging". Hier ist nach der jüngsten Internet-Nutzergruppe sofort ein deutlicher
Abfall bei den folgenden Altersgruppen zu verzeichnen.
Gerade die letzten Betrachtungen zeigen, dass Aussagen über die Nutzung des Mediums In-
ternet sehr differenziert vorzunehmen sind und nur auf eine spezifische Zielgruppe bezogen
Sinn ergeben.
3.1.7 Argumente der Nicht-Nutzer des Internets
Wie bei jedem Kommunikationsmedium ist auch beim Internet für die Entwicklung eines Me-
dienkonzeptes nicht nur die Auseinandersetzung mit den fokussierten Zielgruppen erfolgsent-
scheidend, sondern auch mit Argumenten des Bevölkerungsanteils, der dieses Medium ablehnt.
Abbildung 8 Gründe für die Ablehnung des Mediums Internet
25
Personen ab 14 Jahren in Österreich, die das Internet nicht nutzen, n = 271, Zeitraum der Erhebung:
September 2008
Abbildung 8 zeigt die Ergebnisse einer gestützten Befragung, bei der 10 Argumente für eine
Nicht-Nutzung vorgegeben wurden und der Grad der Zustimmung erhoben wurde.
Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass die Nicht-Nutzer des Internets zu 77% keine Not-
wendigkeit sehen, ihren Informationsbedarf ergänzend oder alternierend zu Zeitungen, Radio
25
Austrian Internet Monitor (2008). Motive TV- versus Internet-Nutzung. Motive Nicht-Nutzung
Internet. Herausgegeben von ORF Mediaresearch. Media Research. Internet:
http://mediaresearch.orf.at/index2.htm?internet/internet_aim.htm, (Abgefragt: 21.06.2011)
20
und TV über das Medium Internet abzudecken. Diesen auffälligsten Punkt der Ergebnisse der
Studie ergänzt inhaltlich der von 40% der Befragten angegebene Grund, dass die Angebote des
Internets nicht interessierten. Die zwar in der Beurteilung der Befragten geringste Häufigkeit
weist die generelle Ablehnung dieses Mediums auf, den aber immerhin noch mehr als 1/3 der
Nicht-Nutzer (35%) anführten.
Bemerkenswert bei dem Ergebnis der Studie ist besonders der hohe Wert der Nennung des Ar-
gumentes, dass die klassischen Medien den Informationsbedarf abdecken. Verglichen mit den
Ergebnissen der zwei Jahre später durchgeführten Studie (siehe Abbildung 18) zu Rolle und
Stellenwert des Internets im Medienmix zeigt sich, dass gerade dieser Punkt von den Nutzern
als Stärke wahrgenommen wird.
3.2
Social Networks allgemein
Social Networks bedienen sich der Social Media, wobei der Begriff eine Vielfalt digitaler Medien
und Technologien umfasst, die es dem Internet-Anwender erlauben, sich inhaltlich einzubringen
bzw. mit anderen Internet-Anwendern Kontakt aufzubauen, sich auszutauschen und zu vernet-
zen. Social Networks stellen dabei den Aspekt der Vernetzung und Gruppenbildung besonders
heraus. Die Begriffe ,,Social Media" und ,,Social Networks" werden meist synonym verwendet,
wobei der vorliegenden Arbeit in ihrem Denkansatz der etwas weiter gefasste Begriff ,,Social
Media" zugrunde liegt und daher der Interaktionsmöglichkeit dasselbe Gewicht beimisst wie der
Möglichkeit der Vernetzung bzw. Gruppenbildung.
3.2.1 Status der Nutzung von Social Networks
In Abbildung 9 wird die generelle Nutzung von Social Media in Österreich 2009, also ,,am Vor-
abend" zur Gemeinderatswahl 2010 in Niederösterreich, dargestellt. Die Balken geben jedoch
nicht die Social-Media-Nutzung in den einzelnen demografischen Gruppen in % der Gesamtbe-
völkerung wieder, sondern in der Gruppe der Internetnutzer unabhängig von der Häufigkeit der
Nutzung. In der weiteren Folge werden in diesem Kapitel diese Zahlen in einzelnen Aspekten
relativiert dargestellt, um die Bedeutung der Aussage für politische Organisationen einer Kom-
mune (anhand einer ,,Beispielstadt") transparent zu machen.
Beide Parameter, also sowohl die Internetnutzung als auch die Häufigkeit der Social-Media-
Nutzung sind je dargestellter Bevölkerungsgruppe mitunter deutlich unterschiedlich. Auch ist
damit weder zum Ausdruck gebracht, wie viele soziale Netze es im Internet gibt noch welche
genutzt wurden.
21
Abbildung 9 Nutzung von Social Networks gesamt nach Geschlecht und Alter
26
Angabe Anzahl Personen mit Nutzung von zumindest 1 Social Network, Status per 25.11.2009, Angabe
in % der Internetnutzer ab 14 Jahren
Deutlich erkennbar ist in Abbildung 9, dass bereits 2009 die Nutzung von Social Media bei 69%
der Internetnutzer gelegen hat und die jüngeren Internetnutzer das Medium wesentlich stärker
angenommen haben als die älteren.
3.2.2 Social-Network-Nutzung gesamt (Top 6)
Ein noch differenzierteres, ergänzendes Bild als in Abbildung 9 liefert Abbildung 10:
Wie aus der Studie sehr schnell ersichtlich wird, Social Network ist nicht gleich Social
Network. Jedes Social Network hat seine Zielgruppe, mal sind es die jüngeren, mal die äl-
teren, mal die Schüler/Studenten, mal die Berufstätigen.
27
Darüber hinaus muss auch in dieser Abbildung berücksichtigt werden, dass die angeführten
Werte als Anteil aus der Grundgesamtheit der Internetnutzer zu sehen sind und es wie schon
bei der vorangegangenen Darstellung keine Aussage über die Häufigkeit der Nutzung gibt. Be-
merkenswert in Abbildung 10 ist jedoch, dass YouTube mit 47% die häufigste Nennung in der
Frage der Nutzung aufweist und noch deutlich vor dem größten der ,,klassischen" sozialen Net-
ze im Internet, Facebook (39%), aufscheint. Die in weiterer Folge dargestellten Wachstumsra-
ten der einzelnen sozialen Netze geben jedoch ein Bild von der permanenten Veränderung des
,,digitalen Medienumfeldes" einer politischen Organisation.
27
Kostner, Maria (2009). Social Networks 2009, in: Pressemitteilung. Wien, 2
22
Abbildung 10 Social-Networks-Nutzung die Top 6
28
Status per 25.11.2009, Angabe in % der Internetnutzer ab 14 Jahren
Um zu einer aussagefähigeren Betrachtung des Themas Social Media zu kommen, greife ich in
der Folge die zwei in Österreich aktuell bedeutendsten Netzwerke Facebook und Twitter her-
aus, wobei letzteres so jung ist, dass es in der vorgenannten Grafik aus dem Jahre 2009 noch
nicht vorkommt.
3.3 Facebook
Facebook ist gegenwärtig eine der populärsten Websites, welche primär Möglichkeiten zum
Aufbau und Betrieb sozialer Netze bereitstellt. Die Beliebtheit dieser Internetplattform wird mit
der offenen Architektur begründet, welche das Einbinden von mittlerweile unzähligen speziellen
Applikationen sogenannten ,,Apps" erlaubt und damit den Funktionsumfang um für den An-
wender attraktive Facetten erweitert.
3.3.1 Status der Facebook-Nutzung in Österreich
Abbildung 11 weicht in ihrer Darstellung der Nutzung des Mediums Facebook bewusst von der
üblichen Darstellung in absoluten Zahlen oder dem Anteil an den Internetnutzern ab. Die Nut-
zung wird hier in Relation zur Gesamtbevölkerung dargestellt und beantwortet die Frage: Wel-
che demografische Gruppe kann ich über Facebook grundsätzlich in welchem Ausmaß errei-
chen?
28
Kostner, Maria (2009). Social Networks 2009, in: Pressemitteilung. Wien, 3
23
Abbildung 11 Facebook-Nutzung
29
Angaben des Social-Media-Radars umgerechnet auf %-Anteil an Gesamtbevölkerung
30
In Summe besitzen 30% der österreichischen Bevölkerung einen Facebook-Account, was je-
doch auch hier keine Aussage über die tatsächliche Nutzung durch die Anwender dieses Medi-
ums erlaubt. Die Verteilung zwischen den Geschlechtern ist auch hier immer noch ungleich und
weist 31% bei Männern und 28% bei Frauen auf, was eine deutliche Reduktion der Diskrepanz
der geschlechtsspezifischen Nutzung des Mediums Internet generell darstellt (vgl. Abbildung 3.)
Die Verteilung der Nutzer auf die einzelnen Altersgruppen zeigt deutlich den in Zusammenhang
mit Tabelle 3 beschriebenen Effekt, dass die Wahl des Social Networks sehr zielgruppenab-
hängig ist. War noch bei der generellen Internetnutzung zwischen den ersten drei Altersgruppen
beinahe dasselbe Niveau (98%, 99%, 97%) zu beobachten (vgl. Abbildung 3) ist die Nutzung
von Facebook in diesen Altersgruppen deutlich unterschiedlich. Bei der Altersgruppe 50 Jahre
und älter ist die Erreichbarkeit über dieses Medium nur mehr zu 5 bzw. 3% gegeben.
Abbildung 11 macht deutlich, dass die einzelnen Zielgruppen der ÖVP auf sehr unterschiedli-
chen Kanälen in sehr unterschiedlicher Art und Weise erreichbar sind. Dies ist jedoch eine Mo-
mentaufnahme zum gegenwärtigen Zeitpunkt und unterliegt dem bereits bei der generellen In-
ternetnutzung angesprochenen (vgl. Abb. 3) unterschiedlichen Wachstum je Nutzergruppe.
29
Bäck, Gerald (2011). Social Media Radar Austria. Internet: http://socialmediaradar.at/
facebook.php, (Abfrage: 16.05.2011)
30
Statistik Austria (2011). Bevölkerungsstruktur. Internet:
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/bevoelkerung/bevoelkerungsstruktur/index.html, (Ab-
frage: 19.05.2011)
24
3.3.2 Die Entwicklung von Facebook
Das dynamische Wachstum der Nutzung des Internets (vgl. Abbildung 3) integriert ein Wachs-
tum in der Nutzung von sozialen Netzwerken im Internet, wie die folgende Grafik am Beispiel
der Social-Media-Plattform Facebook zeigt:
Abbildung 12 Facebook-Entwicklung in Österreich
31
Angabe innerhalb eines halben Jahres dargestellt in Mio. aktive Facebook-Accounts je Kalenderwoche
ergänzt um eine Trendlinie (Status per 16.05.2011)
Die Darstellung in Abbildung 12 zeigt einen in Wellenbewegungen sich nach oben schaukeln-
den Verlauf in der Nutzung der Social-Media-Plattform Facebook. Die Wellenbewegung ergibt
sich aus neuen Accounts wie auch aus einer gesteigerten Nutzung. Die Gründe für die Ände-
rung der Nutzungsintensität können in speziellen Ereignissen begründet sein, bei denen dieses
Medium Bestandteil einer Kommunikationsstrategie ist. Die insgesamt steigende Tendenz kann
ebenso in Abwanderung von anderen weniger attraktiven sozialen Netzen begründet sein wie
durch Ersteinsteiger in Facebook.
Per 10.05.2010 erreichte Facebook österreichweit einen ausgewiesenen Nutzungsgrad von
30%. Für die Entwicklung von Kommunikationsstrategien bedeutet das, dass der dynamischen
Entwicklung und unterschiedlichen Akzeptanz im Zeitablauf größere Aufmerksamkeit geschenkt
werden muss als den absoluten, gegenwärtigen Anwenderzahlen. Diese Dynamik und Unbere-
chenbarkeit im Nutzungsverhalten von Social Media macht auch deutlich, dass ein zentraler
,,Content-Pool" in Form einer ,,klassischen" Website Sinn macht, von der aus die diversen ziel-
31
Bäck, Gerald (2011). Social Media Radar Austria. Internet:
http://socialmediaradar.at/facebook.php, (Abgefragt: 16.05.2011)
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2011
- ISBN (eBook)
- 9783842823112
- Dateigröße
- 2.8 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Joseph Schumpeter Institut – Business Administration
- Erscheinungsdatum
- 2014 (April)
- Note
- 1
- Schlagworte
- politmarketing social media internet kommunikation
- Produktsicherheit
- Diplom.de