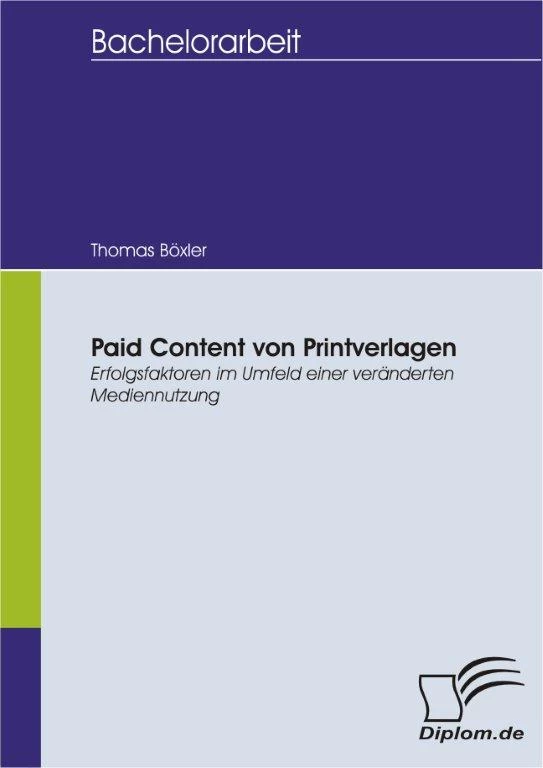Paid Content von Printverlagen - Erfolgsfaktoren im Umfeld einer veränderten Mediennutzung
©2011
Bachelorarbeit
79 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Zeitungs- und Zeitschriftenverlage durchlaufen einen strukturellen Veränderungsprozess, der primär durch die zunehmende Konvergenz von Medien-, Technologie- und Telekommunikationsmärkten geprägt ist. Das mediale Printprodukt, welches über Jahrhunderte optimiert und an das Mediennutzungsverhalten der Leser angepasst wurde, scheint ausgereizt.
Die Entstehung des Internets und die damit einhergehende Digitalisierung hatte für die Anbieter von redaktionellen Inhalten gravierende Folgen: der Begriff Zeitungssterben beschreibt treffend die seit Jahren drastisch sinkenden Absätze von Printmedien, allen voran Zeitungen und Zeitschriften. Dabei mangelt es den Verlagen nicht an potenziellen Lesern. Zahlreiche deutsche Tageszeitungen konnten ihre Leserschaft in den letzten zehn Jahren fast verdoppeln, allerdings mit hohen Einbußen bei den verkauften Printtiteln. Die neuen Leser kommen über Smartphones, soziale Netzwerke und Suchmaschinen auf die Webseiten der Verlage. Das Internet ist zur beliebtesten Quelle für die schnelle und aktuelle Informationssuche geworden - Informationen, die nicht durch den starren Sendeplan von Rund- und Hörfunk beschränkt und durch mobile Endgeräte überall und jederzeit verfügbar sind. Dabei ist eine zunehmende Bedeutung von redaktionellen Empfehlungen zu erkennen. Im vernetzten Web 2.0 nehmen Nutzer die Rolle von Filtern ein, indem sie aus dem unendlichen Informationsangebot des Internets qualitativ hochwertige und interessante Inhalte selektieren und darauf innerhalb ihres Netzwerks verweisen.
Um hohe Reichweiten zu erzielen, und somit attraktiv für Werbekunden zu werden, wurden Inhalte anfänglich kostenfrei im Internet angeboten. Dabei wurde viel Geld in den Reichweitenaufbau investiert, ohne einen entsprechenden Umsatzstrom an anderer Stelle zu generieren. Die daraus entstandene mangelnde Zahlungsbereitschaft für digitale Inhalte (Content) konnte bisher nicht umfassend korrigiert werden.
Doch das klassische Modell der Medien, die Erstellung und den Vertrieb der redaktionellen Inhalte über die Einnahmen aus dem Verkauf von Anzeigen zu refinanzieren, ließ sich im Internet nicht problemlos umsetzen. Exogene Wirtschaftsschocks und das Auftreten neuer Werbeträger im Internet erhöhten den Wettbewerb um die Werbebudgets der Unternehmen. Eine Studie der Unternehmensberatung Transaction Consulting prognostiziert alleine für den deutschen Markt einen Rückgang der Werbe- und Anzeigenerlöse von 500 […]
Zeitungs- und Zeitschriftenverlage durchlaufen einen strukturellen Veränderungsprozess, der primär durch die zunehmende Konvergenz von Medien-, Technologie- und Telekommunikationsmärkten geprägt ist. Das mediale Printprodukt, welches über Jahrhunderte optimiert und an das Mediennutzungsverhalten der Leser angepasst wurde, scheint ausgereizt.
Die Entstehung des Internets und die damit einhergehende Digitalisierung hatte für die Anbieter von redaktionellen Inhalten gravierende Folgen: der Begriff Zeitungssterben beschreibt treffend die seit Jahren drastisch sinkenden Absätze von Printmedien, allen voran Zeitungen und Zeitschriften. Dabei mangelt es den Verlagen nicht an potenziellen Lesern. Zahlreiche deutsche Tageszeitungen konnten ihre Leserschaft in den letzten zehn Jahren fast verdoppeln, allerdings mit hohen Einbußen bei den verkauften Printtiteln. Die neuen Leser kommen über Smartphones, soziale Netzwerke und Suchmaschinen auf die Webseiten der Verlage. Das Internet ist zur beliebtesten Quelle für die schnelle und aktuelle Informationssuche geworden - Informationen, die nicht durch den starren Sendeplan von Rund- und Hörfunk beschränkt und durch mobile Endgeräte überall und jederzeit verfügbar sind. Dabei ist eine zunehmende Bedeutung von redaktionellen Empfehlungen zu erkennen. Im vernetzten Web 2.0 nehmen Nutzer die Rolle von Filtern ein, indem sie aus dem unendlichen Informationsangebot des Internets qualitativ hochwertige und interessante Inhalte selektieren und darauf innerhalb ihres Netzwerks verweisen.
Um hohe Reichweiten zu erzielen, und somit attraktiv für Werbekunden zu werden, wurden Inhalte anfänglich kostenfrei im Internet angeboten. Dabei wurde viel Geld in den Reichweitenaufbau investiert, ohne einen entsprechenden Umsatzstrom an anderer Stelle zu generieren. Die daraus entstandene mangelnde Zahlungsbereitschaft für digitale Inhalte (Content) konnte bisher nicht umfassend korrigiert werden.
Doch das klassische Modell der Medien, die Erstellung und den Vertrieb der redaktionellen Inhalte über die Einnahmen aus dem Verkauf von Anzeigen zu refinanzieren, ließ sich im Internet nicht problemlos umsetzen. Exogene Wirtschaftsschocks und das Auftreten neuer Werbeträger im Internet erhöhten den Wettbewerb um die Werbebudgets der Unternehmen. Eine Studie der Unternehmensberatung Transaction Consulting prognostiziert alleine für den deutschen Markt einen Rückgang der Werbe- und Anzeigenerlöse von 500 […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Thomas Böxler
Paid Content von Printverlagen - Erfolgsfaktoren im Umfeld einer veränderten
Mediennutzung
ISBN: 978-3-8428-2239-9
Herstellung: Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2011
Zugl. Mediadesign Hochschule für Design und Informatik, Düsseldorf, Deutschland,
Bachelorarbeit, 2011
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und der Verlag, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplomica.de, Hamburg 2011
III
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis ... V
Abkürzungsverzeichnis ... VI
Kapitel 1 Einführung ... 1
1.1 Zielsetzung und Methodik der Arbeit ... 3
1.2 Aufbau der Arbeit ... 4
Kapitel 2 Grundlagen und Begriffsdefinitionen ... 5
2.1 Erfolg und Erfolgsfaktoren in der Betriebswirtschaftslehre ... 5
2.2 Einordnung von Printverlagen auf dem Medienmarkt ... 7
2.3 Definition und Einordnung von Content ... 10
2.3.1 Marktfähigkeit und besondere Gütereigenschaften von Content ... 11
2.3.2 Paid Content und Paid Services ... 12
2.4 Grundlagen des Mediennutzungsverhaltens ... 14
2.5 Das Internet Entwicklung und Verhalten der Marktteilnehmer ... 15
2.5.1 Von den Anfängen bis zum Web 2.0 ... 15
2.5.2 Die Zahlungsbereitschaft im Internet ,,Free Lunch Mentalität" ... 17
2.6 Herausforderungen durch konvergierende Märkte ... 18
Kapitel 3 Untersuchung des digitalen Gutes Content und seiner
Vermarktung ... 20
3.1 Marktfähigkeit von Content - Der Wert einer Information ... 20
3.1.1 Wertbestimmung aus Anbietersicht ... 21
3.1.2 Wertbestimmung aus Nachfragersicht ... 23
3.2 Technische Voraussetzungen für Paid Content Angebote ... 26
3.3 Zahlungsbereitschaft für kostenpflichtige Inhalte ... 29
3.4 Determinanten des Entscheidungsprozesses ... 32
3.5 Modelle zur Ausgestaltung der Paid Content Angebote ... 33
3.5.1 Grad der Zugangsrestriktion ... 34
IV
3.5.2 Formen der Finanzierung ... 37
3.6 Beispiele aus der Verlagspraxis ... 40
Kapitel 4 Untersuchung der veränderten Mediennutzung durch Online-
Medien ... 43
4.1 Aktuelle Trends in der Mediennutzung ... 43
4.2 Information Overload - Aufmerksamkeit als knappe Ressource ... 44
4.2.1 Folgen dieser Entwicklungen für das Mediennutzungsverhalten ... 46
4.2.2 Kollaborative Filtermechanismen ... 48
Kapitel 5 Determinanten eines erfolgreichen Paid Content Modells ... 52
5.1 Potenzielle Erfolgsfaktoren für Paid Content Angebote ... 52
5.2 Einflüsse aus der Unternehmensumwelt ... 58
5.3 Operative Handlungsoptionen ... 60
Kapitel 6 Fazit ... 63
Zusammenfassung und Ausblick ... 63
Quellenangaben ... VII
Literaturverzeichnis... VII
Internetquellen ... XI
V
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1 | Typisierung von Medienmärkten ... 7
Abb. 2 | Klassische Wertschöpfungskette von Printverlagen ... 8
Abb. 3 | Dreiecksbeziehung werbefinanzierter Medien ... 9
Abb. 4 | Disintermediation bei PCA ... 13
Abb. 5 | Gütertypologie ... 20
Abb. 6 | Möglichkeiten der Preisdifferenzierung ... 22
Abb. 7 | Alternative Anbieter von Content im Internet ... 23
Abb. 8 | Möglichkeiten zum Abbau von Informationsasymmetrien ... 24
Abb. 9 | Typisierung von Informationen ... 24
Abb. 10 | Marktanteile der Handybetriebssysteme in Deutschland ... 27
Abb. 11 | Zahlungsarten im Internet ... 28
Abb. 12 | Zahlungsbereitschaft für Content ... 30
Abb. 13 | Onlinespende bei der taz ... 31
Abb. 14 | Entscheidungsprozess bei der Inanspruchnahme von PCA ... 33
Abb. 15 | Paywall bei der Times und der New York Times ... 35
Abb. 16 | Quersubventionierung innerhalb des Freemium Modells ... 36
Abb. 17 | Relevante Formen der Finanzierung für PCA ... 38
Abb. 18 | Veränderter Selektionsprozess von Themen ... 45
Abb. 19 | Mitgliederzuwachs von Facebook in Deutschland ... 47
Abb. 20 | Social Media Anbindung auf www.spiegel.de ... 49
Abb. 21 | Die Paywall als Hindernis für Referrals ... 50
Abb. 22 | Anteil der Nutzer die über Facebook generiert wurden ... 51
Abb. 23 | Erfolgsfaktoren für PCA ... 53
VI
Abkürzungsverzeichnis
Abb.
Abbildung
Bspw.
Beispielsweise
ebd.
Ebenda
et
al.
Und
andere
HTML
Hypertext
Markup
Language
i.S.
im
Sinne
o.g.
oben
genannt
o.S.
ohne
Seite
PCA
Paid
Content
Angebote
PDF
Portable
Document
File
S.
Seite
Kapitel 1 Einführung
1
Kapitel 1 Einführung
,,Die Leute sind bereit, für Qualitätsinhalte zu zahlen. Es hat nur noch keiner
ernsthaft versucht."
1
Rupert Murdoch, CEO News Corp.
Zeitungs- und Zeitschriftenverlage durchlaufen einen strukturellen Verände-
rungsprozess, der primär durch die zunehmende Konvergenz von Medien-,
Technologie- und Telekommunikationsmärkten geprägt ist. Das mediale Print-
produkt, welches über Jahrhunderte optimiert und an das Mediennutzungs-
verhalten der Leser angepasst wurde, scheint ausgereizt.
Die Entstehung des Internets und die damit einhergehende Digitalisierung hat-
te für die Anbieter von redaktionellen Inhalten gravierende Folgen: der Begriff
,,Zeitungssterben" beschreibt treffend die seit Jahren drastisch sinkenden Ab-
sätze von Printmedien, allen voran Zeitungen und Zeitschriften. Dabei mangelt
es den Verlagen nicht an potenziellen Lesern. Zahlreiche deutsche Tageszei-
tungen konnten ihre Leserschaft in den letzten zehn Jahren fast verdoppeln,
allerdings mit hohen Einbußen bei den verkauften Printtiteln.
2
Die ,,neuen Le-
ser" kommen über Smartphones, soziale Netzwerke und Suchmaschinen auf
die Webseiten der Verlage. Das Internet ist zur beliebtesten Quelle für die
schnelle und aktuelle Informationssuche geworden - Informationen, die nicht
durch den starren Sendeplan von Rund- und Hörfunk beschränkt und durch
mobile Endgeräte überall und jederzeit verfügbar sind. Dabei ist eine zuneh-
mende Bedeutung von redaktionellen Empfehlungen zu erkennen. Im vernetz-
ten Web 2.0 nehmen Nutzer die Rolle von Filtern ein, indem sie aus dem un-
endlichen Informationsangebot des Internets qualitativ hochwertige und inte-
ressante Inhalte selektieren und darauf innerhalb ihres Netzwerks verweisen.
Um hohe Reichweiten zu erzielen, und somit attraktiv für Werbekunden zu
werden, wurden Inhalte anfänglich kostenfrei im Internet angeboten. Dabei
wurde viel Geld in den Reichweitenaufbau investiert, ohne einen entspre-
1
Vgl. Steinkirchner (2010), S. 37.
2
Vgl. Meier (2011), S.71; Pürer (2006), S. 22. Die Auflagen der Tageszeitungen san-
ken zwischen 1995 und 2005 um knapp 15% (von 25,4 Mio. auf 21,7 Mio. Exempla-
re). Ihre Reichweite schrumpfte im selben Zeitraum um 6,2% (von 81,0 auf 74,8 Mio.
Leser).
1.1 Zielsetzung und Methodik der Arbeit
2
chenden Umsatzstrom an anderer Stelle zu generieren. Die daraus entstan-
dene mangelnde Zahlungsbereitschaft für digitale Inhalte (Content) konnte
bisher nicht umfassend korrigiert werden.
Doch das klassische Modell der Medien, die Erstellung und den Vertrieb der
redaktionellen Inhalte über die Einnahmen aus dem Verkauf von Anzeigen zu
refinanzieren, ließ sich im Internet nicht problemlos umsetzen.
3
Exogene Wirt-
schaftsschocks und das Auftreten neuer Werbeträger im Internet erhöhten
den Wettbewerb um die Werbebudgets der Unternehmen. Eine Studie der Un-
ternehmensberatung Transaction Consulting prognostiziert alleine für den
deutschen Markt einen Rückgang der Werbe- und Anzeigenerlöse von 500
Millionen Euro bis 2015.
4
Das Modell Paid Content zählt aufgrund dessen zu
einem der aktuell meist diskutiertesten Themen der Medienindustrie.
Dabei ist die Option für die Verlage, mit Inhalten im Internet Geld zu verdie-
nen, nicht neu. Seit 1996 bietet das US-amerikanische Wall Street Journal auf
seiner Website Inhalte kostenpflichtig im Abonnement an.
5
Die ersten Versu-
che Paid Content gewinnbringend einzusetzen, und die Nutzer von der Not-
wenigkeit von finanzierten Inhalten zu überzeugen, gleichen dabei jedoch dem
,,Trial & Error" Prinzip. Problematisch bei der Ausgestaltung eines Geschäfts-
modells ist nicht nur die mangelnde Zahlungsbereitschaft der Nutzer, sondern
auch die Struktur des verkauften Produkts und der Wettbewerb im Internet
durch Anbieter von kostenfreiem Content. Die durchgehend gesättigten Mas-
senmärkte und deren Fragmentierung in kleine zielgruppenspezifische Märkte
(,,Long Tail"), erschweren den Absatz von Bezahlinhalten an eine große Zahl
von Abnehmern. Dabei befinden Sich die Verlagsangebote im Netz nicht nur
in Konkurrenz untereinander - branchenfremde Anbieter, die Content als Zu-
satzangebot ihres Kerngeschäfts kostenfrei anbieten, torpedieren den Aufbau
eines Geschäftsmodells für Paid Content Angebote.
6
Trotz all dieser Barrieren arbeiten zahlreiche Verlage mit Nachdruck an der
Kommerzialisierung ihrer bislang kostenlosen Online-Angebote. Dass die
Branche mit einem rein werbefinanzierten Erlösmodell nicht zu retten ist, hat
die Mehrheit der Verlagsmanager eingesehen.
7
Bis 2013 sollen ca. 40% des
3
Vgl. Breyer-Mayländer/Seeger (2006), S. 3ff.
4
Vgl. Gabe (2010), S. 31.
5
Vgl. Fehr (2003),S. 10.
6
Im Folgenden mit PCA abgekürzt.
7
Vgl. Theyson/Prokpowicz/Skiera, (2005), S. 174.
Kapitel 1 Einführung
3
Umsatzes mit digitalen Angeboten erwirtschaftet werden.
8
Die Erfolge beim
Vertrieb von kostenpflichtigen Applikationen an die Nutzer von mobilen End-
geräten, über die redaktionelle Inhalte abgerufen werden können, beweisen,
dass Potenzial für das Modell vorhanden ist. Im stationären Internet gelang es
bisher jedoch nur international führenden Zeitungs-und Zeitschriftenmarken,
wie dem Wall Street Journal und der Financial Times, Bezahlmodelle erfolg-
reich durchzusetzen.
1.1 Zielsetzung und Methodik der Arbeit
Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Ableitung von Erfolgsfaktoren, die für
die Ausgestaltung eines Geschäftsmodells das auf dem Verkauf von Bezahl-
inhalten an Endkunden aufbaut, konstitutiv sind. Dabei geht es bewusst nicht
um Erfolgsfaktoren, die einzelne Anbieter nutzen können um Vorteile gegen-
über dem Wettbewerb zu generieren, sondern um Faktoren, die zum Erfolg
des Modells und zum Nutzen der gesamten Branche beitragen. Eine normati-
ve Perspektive, die auf die Wichtigkeit von qualitativ hochwertigem Journalis-
mus eingeht, wird außer Betracht gelassen. Eine Orientierung erfolgt anhand
betriebswirtschaftlicher Gesichtspunkte.
Zentraler Untersuchungsgegenstand ist dabei, welchen Einfluss das veränder-
te Mediennutzungsverhalten auf ein solches Geschäftsmodell hat. Die Verän-
derungen in der Mediennutzung beziehen sich sowohl auf die Verbreitung
neuer Technologien (mobile onlinefähige Endgeräte), als auch auf die Beteili-
gung und das kollaborative Verhalten der Mitglieder in sozialen Netzwerken.
Dabei werden interdisziplinär Modelle und Erkenntnisse aus den Feldern der
Medien- und Internetökonomie und der Kommunikationswissenschaft mitei-
nander verknüpft.
Bei dieser Arbeit handelt es sich um eine literaturgestützte Arbeit, die keine
eigens erhobenen empirischen Erkenntnisse verwendet. Als theoretische Ba-
sis dienen externe empirische Studien, Lehrbücher aus den entsprechenden
Fachbereichen, wissenschaftliche Arbeiten sowie Artikel aus der branchenre-
levanten Presse (Print und Online). Besonders zu Beispielen für Bezahl-
schranken und Fakten zu den Entwicklungen in sozialen Netzwerken wurde
auch auf Internetquellen und aktuelle Fachartikel zurückgegriffen. Die erarbei-
8
Vgl.
www.dermerkur.de/artikel/zeitungsverlagesetzenaufpaidcontent
(08.08.2011).
1.2 Aufbau der Arbeit
4
teten Erfolgsfaktoren basieren daher auf dem Niveau der Plausibilität und ha-
ben die genannten wissenschaftlichen Arbeiten und Fakten als Grundlage. Zur
Fundierung der Ergebnisse empfiehlt sich eine empirische Untersuchung, die
Validität und Umsetzbarkeit dieser Erfolgsfaktoren stützt.
1.2 Aufbau der Arbeit
Der theoretische Grundlagenteil (Kapitel 2) definiert die Untersuchungsgegen-
stände und legt damit den Rahmen dieser Arbeit fest. Diese Definitionen und
Begriffserklärungen liefern ein grundlegendes Verständnis für die Thematik
und dessen Bedeutung im aktuellen Kontext.
Kapitel 3 untersucht das Gut Content und befasst sich mit dessen Marktfähig-
keit sowohl aus Anbieter- als auch aus Nachfragerperspektive. Zentral ist wei-
ter eine Untersuchung der Zahlungsbereitschaft für Paid Content. Der Be-
schreibung, wie ein Geschäftsmodell für Bezahlinhalte ausgestaltet werden
kann, folgen zwei Praxisbeispiele.
Das 4. Kapitel untersucht das veränderte Mediennutzungsverhalten, dass sich
primär auf eine Verschiebung der Nutzungsgewohnheiten in Bezug auf den
technischen Zugang zu redaktionellen Online Angeboten und eine Verände-
rung bei der Informationssuche durch das Engagement in sozialen Netzwer-
ken bezieht. Es wird untersucht, wie Internetnutzer redaktionelle Inhalte aus-
wählen und welchen Einfluss dies auf ein Paid Content Modell der Printverla-
ge hat.
Kapitel 5 führt die Analysegegenstände der vorherigen Kapitel zusammen.
Dieses Kapitel stellt das Ergebnis dieser Arbeit dar und benennt Erfolgsfakto-
ren, die sowohl externe Umwelteinflüsse als auch interne Herausforderungen
an das Geschäftsmodell einbeziehen. Weiterhin werden operative Handlungs-
optionen aufgezeigt.
Eine Zusammenfassung mit Ausblick stellt das Ende der Arbeit dar.
Kapitel 2 Grundlagen und Begriffsdefinitionen
5
Kapitel 2 Grundlagen und Begriffsdefinitionen
Um den Leistungsprozess von Printverlagen darzustellen, erfolgt in diesem
Kapitel eine Einordnung der Printverlage in das Mediensystem, sowie definito-
rische Abgrenzungen zur Bestimmung der Untersuchungsgegenstände dieser
Arbeit.
2.1 Erfolg und Erfolgsfaktoren in der Betriebswirtschaftslehre
In ökonomischen Zusammenhängen wird der Begriff Erfolg traditionell als Er-
gebnis der Wirtschaftstätigkeit angesehen, welches in monetären Kennzahlen
ausgedrückt wird.
9
Aus gegenwärtiger Perspektive scheint diese Dimension
der Erfolgsmessung aufgrund eines äußerst komplexen Wirtschaftssystems
jedoch nicht ausreichend. Durch den Wandel von Verkäufer- zu Käufermärk-
ten und der damit einhergehenden Notwendigkeit, Kundenbeziehungen auf-
zubauen, gewinnen auch nichtmonetäre Kennzahlen als Darstellung des Un-
ternehmenserfolges an Bedeutung.
10
Die Messung des Erfolges kann sich da-
bei auf verschiedene Betrachtungspunkte beziehen.
Nach dem Zielansatz wird der Erfolg eines Unternehmens anhand des Gra-
des der Zielerreichung gemessen. Dabei liegt die Annahme zugrunde, dass
jedes Unternehmen ein Ziel (bzw. ein Bündel von Zielen innerhalb eines Ziel-
systems) verfolgt, auf dessen Erreichung alle Aktivitäten und Maßnahmen des
wirtschaftlichen Handels ausgerichtet werden.
11
Der Stakeholderansatz misst die Erfolgserreichung anhand der Interessens-
berücksichtigung aller internen (z.B. Mitarbeiter) und externen (z.B. Kunden)
Interaktionspartner des Unternehmens.
12
Besonders in diesem Bereich kann
Erfolg auch anhand psychographischer und nichtmonetärer Kennzahlen (z.B.
Kundenzufriedenheit) gemessen werden.
Der Systemansatz betrachtet Erfolg als die Fähigkeit eines Unternehmens,
Ressourcen (menschlich und technologisch), Prozesse und Strukturen so ein-
zusetzen, dass ein langfristiges Überleben des Unternehmens gesichert ist.
9
Vgl. Gabler Wirtschafts-Lexikon (2010), S. 911.
10
Vgl. Meffert/Burmann/Kirchgeorg (2007), S. 7.
11
Vgl. Fritz (1995), S. 220.
12
Vgl. Bleicher (1989), S. 150f.
2.1 Erfolg und Erfolgsfaktoren in der Betriebswirtschaftslehre
6
Dazu ist eine möglichst weitreichende Anpassung an die Umwelt nötig
(economic fit).
13
Als Determinanten zur Erreichung des Unternehmenserfolges werden weithin
Erfolgsfaktoren genannt. Zahlreiche Autoren und Studien beschäftigen sich
mit der Erforschung von Erfolgsfaktoren sowie deren Wirkung auf die Strate-
gie eines Unternehmens. So vielfältig die Thematik in der Literatur behandelt
wird, so viele verschiedene Definitionsansätze gibt es. Nach Kreilkamp (1987)
umfasst der Begriff Erfolgsfaktor verschiedene Komponenten. Einerseits sind
danach Erfolgsfaktoren die Maßnahmen, die ein Unternehmen wählt um seine
Ziele zu erreichen. Andererseits sind Erfolgsfaktoren auch in umweltspezifi-
schen Bedingungen und Gegebenheiten zu finden.
14
Diese Definition ist somit
analog zum Systemansatz der Erfolgsbetrachtung zu verstehen, der eine posi-
tive Wechselwirkung aus unternehmensinternen und -externen Umständen
fordert. Nach einer Definition von Adrian (1989) sind Erfolgsfaktoren Orientie-
rungspunkte, an denen alle Handlungen ausgerichtet werden, um unterneh-
merischen Erfolg zu gewährleisten.
15
Eine sehr prägnante Definition von Er-
folgsfaktoren lieferte Rockart bereits 1979: ,,They are the few key areas where
`things must go right` for the business to flourish".
16
Das Konzept der ,,kriti-
schen Erfolgsfaktoren" bezeichnet dabei die Fokussierung auf einige wenige
Maßnahmen, die den Erfolg des Unternehmens sicherstellen.
17
Erfolgsfaktoren können weiterhin anhand ihres Geltungsbereichs differenziert
werden. Dieser kann sich auf eine Branche, eine Unternehmen oder auf ein
Geschäftsfeld beziehen und ist somit ausschlaggebend für die Ableitung von
Erfolgsfaktoren. Der Begriff Geschäftsmodell bezieht sich dabei auf die Aus-
gestaltung des Leistungssystems und bildet ab, wie Unternehmen ihre Res-
sourcen verwenden um marktfähige Güter zu erstellen und abzusetzen.
18
In dieser Arbeit werden Erfolgsfaktoren als die maßnahmenbestimmenden
Determinanten betrachtet, auf denen das Geschäftsmodell der Printverlage in
Bezug auf Paid Content Angebote aufbauen muss, um zu einer langfristigen
Zielerreichung beizutragen.
13
Vgl. Wohlgemuth/Hess (1999), S. 32.
14
Vgl. Kreilkamp (1987),S. 176.
15
Vgl. Adrian (1989), S. 224ff; Tjaden (2003), S. 58ff.
16
Vgl. Rockart (1979), S. 85.
17
Vgl. hier und im Folgenden Tereschenko/Kieneke (2007), S. 4f.
18
Vgl. Wirtz (2008), S. 74ff.
Kapitel 2 Grundlagen und Begriffsdefinitionen
7
2.2 Einordnung von Printverlagen auf dem Medienmarkt
Medienunternehmen werden über ihren Leistungsprozess charakterisiert, der
(stark komprimiert) das Erzeugen (Content Creation), Bündeln (Content
Transformation) und Distribuieren (Content Distribution) von Informationen
und Unterhaltung umfasst.
19
,,Aus Sicht der Mediennutzer produzieren Medi-
enunternehmen gebündelte, mediale Inhalte in Form von Texten, Bildern, ver-
schiedenen Varianten von Audio- und Videoangeboten sowie in wachsendem
Maße auch interaktive Angebote zur Befriedigung des Bedürfnisses nach Un-
terhaltung und Information."
20
Die so entstehenden marktfähigen Güter wer-
den als Endprodukte an die Rezipienten weitergegeben.
Die Typisierung von Medienunternehmen wird nach den von Ihnen erstellten
Produkten vorgenommen, die eine Zuordnung zum Medienteilmarkt ermög-
licht.
Abb. 1 | Typisierung von Medienmärkten
21
Im Rahmen dieser Arbeit erfolgt eine Fokussierung auf die Printmärkte, ge-
nauer auf Zeitungs- und Zeitschriftenmärkte. Die Buchmärkte sind aufgrund
ihrer abweichenden Eigenschaften in Bezug auf das Nutzungsverhalten der
Rezipienten und die Modelle zur Verwertung von Inhalten nicht Gegenstand
der Betrachtung. Die mediale Konvergenz schließt eine Betrachtung der Inter-
net- bzw. Mobilemärkte ein.
22
19
Vgl. Gläser (2010), S. 73.
20
Vgl. Rawolle (2002), S. 6.
21
In Anlehnung an Wirtz (2008), S. 22.
22
Vgl. hierzu Kap. 2.6.1
Medienmärkte
Zeitungsmärkte
Zeitschriftenmärkte
Buchmärkte
TV-Märkte
Radiomärkte
Musikmärkte
Internetmärkte
Mobile Märkte
Printmedien
E-Business
M-Business
Konvergenz
2.2 Einordnung von Printverlagen auf dem Medienmarkt
8
Printmärkte: Zeitungs- und Zeitschriftenverlage
Printverlage sind demnach gewerbliche Unternehmen, deren Kernkompetenz
in der Produktion, Bündelung und Distribution von Informationen liegt. Die Dis-
tribution erfolgt an ein Trägermedium gebunden (Papier) oder über technische
Infrastrukturen (Internet, Mobiltelefon).
Abb. 2 | Klassische Wertschöpfungskette von Printverlagen
23
Konstitutive Merkmale der so entstehenden Güter sind das regelmäßige Er-
scheinen (Periodizität), die Aktualität der Informationen sowie die inhaltliche
Vielfalt der Themen. Eine Einschränkung in der Zugänglichkeit existiert nicht
(Publizität).
24
Printprodukte können weiter nach ihrem Verbreitungsgebiet (re-
gional, überregional) und der Art des Verkaufs (Gratis-/ Kaufzeitung, Abonne-
ment) klassifiziert werden.
25
Bei Zeitschriften erfolgt eine thematische Untertei-
lung nach dem Adressatenkreis: General-Interest- oder Publikumszeitschriften
richten sich an ein thematisch breit gestreutes Publikum und decken primär
das Bedürfnis nach Unterhaltung oder Informationen.
26
Special-Interest Titel
sind thematisch auf verschiedene Zielgruppen zugeschnitten und ermöglichen
so eine individuellere Ansprache. So werden nicht nur geschlechtsspezifische
Interessensgebiete abgedeckt, sondern auch Hobby- und Freizeitinteressen.
Fachzeitschriften richten sich mit überwiegend wissenschaftlich geprägtem In-
halt an bestimmte Berufsgruppen oder Verbände.
27
Über das Angebot von Printprodukten hinaus sind die Verlage mit redaktionel-
len Inhalten im Internet vertreten. Gegenüber der Printausgabe werden die In-
halte substitutiv (gleiche Inhalte wie in der Printausgabe) oder additiv (weiter-
führende Informationen) angeboten.
28
Durch die Verbreitung von Informatio-
nen über das Internet ist eine Abgrenzung anhand des Kriteriums der Periodi-
23
In Anlehnung an Hess/Schumann (1999), S. 206.
24
Vgl. Heinrich (2001), S. 228f; Schulze (2005), S. 117ff.
25
Vgl. Wirtz (2008), S. 182f.
26
Vgl. Meffert/Burmann/Kirchgeorg (2008), S. 653.
27
Vgl. Wirtz (2008), S. 183f.
28
Vgl. Gläser (2010), S. 125.
Contenterstellung
und - beschaffung
Produktion
Aufbereitung
des Contents
Absatz &
Marketing
Vertrieb
Kapitel 2 Grundlagen und Begriffsdefinitionen
9
zität nicht mehr gegeben, da Inhalte unmittelbar nach ihrer Produktion veröf-
fentlicht werden können.
Finanzierungsmöglichkeiten für Inhalte
Für die Verlage bestehen verschiedene Möglichkeiten Umsätze zu generieren.
Beim direkten Verkauf des Gutes an den Konsumenten wird gegen ein Entgelt
ein physisches (z.B. eine Ausgabe einer Zeitschrift) oder digitales Produkt
(z.B. Inhalte auf einer Website) abgegeben. Alternativ können Inhalte dem
Rezipienten kostenfrei angeboten werden, wenn deren Herstellungskosten
über eine Umwegfinanzierung (z.B. Einnahmen aus dem Verkauf von Werbe-
raum) gedeckt werden können.
29
In der Praxis finden sich zahlreiche Misch-
formen und verschiedene Modelle zur Finanzierung.
Um die Herstellungskosten des Produktionsprozesses von Inhalten zu refi-
nanzieren, agieren Verlage traditionell auf einem dualen Markt. Die Leser von
redaktionellen Angeboten (Print und Online) dienen dabei als Zielgruppe für
die Produkte der werbetreibenden Industrie. Durch den Verkauf von Anzei-
genplätzen in ihren Angeboten sichern sich die Verlage zusätzliche Einnah-
men.
Abb. 3 | Dreiecksbeziehung werbefinanzierter Medien
30
29
Vgl. Sigler (2010), S. 18ff.
30
In Anlehnung an Gläser (2010), S. 148.
Rezipient
Werbekunde
Verlag
Befriedigt Bedürfnisse
nach Unterhaltung und
Information
Generiert Reichweite
und Zielgruppen
Stellt Reichweite
zur Verfügung
Kauft
Anzeigenplätze
Kauft beworbene Produkte
Bewirbt Produkte
2.3 Definition und Einordnung von Content
10
Verlagsprodukte stellen somit aus ökonomischer Perspektive Kuppelprodukte
dar: Sie vertreiben sowohl Informationen als auch Werbebotschaften an die
Endkunden (Rezipienten).
31
In der Literatur liegen unterschiedliche Angaben
zugrunde, wie hoch die Einnahmen aus dem Verkauf von Werbung sind.
Mehrheitlich wird von einer 50-70%-Finanzierung durch Werbekunden ausge-
gangen, woraus eine hohe Abhängigkeit der Verlage von werbetreibenden
Unternehmen resultiert.
32
Deren Ausgaben für werbliche Maßnahmen sind
stark von der wirtschaftlichen Lage abhängig und somit anfällig für konjunktu-
relle Schwankungen. Eine steigende Reichweite durch eine größere Leser-
schaft geht mit steigenden Einnahmen aus dem Verkauf von Anzeigenraum
einher. Die Gewinne können in die Verbesserung des Angebots und der re-
daktionellen Qualität investieren werden. Diese Abhängigkeit wird im Print-
und Onlinebereich als Anzeigen-Auflagen-Spirale bezeichnet.
33
2.3 Definition und Einordnung von Content
Die Produktion von Informationen, die in Form von verwertbaren Inhalten
(engl. Content) gebündelt werden, stellt das Ergebnis des Wertschöpfungs-
und Leistungsprozesses der Printverlage dar. Damit ist Content ,,the key re-
source of the information economy."
34
Der Begriff Content unterliegt, je nach
Kontext, abweichenden Definitionen. Aus einer Perspektive, die Grundlage für
die Speicherung und Verwaltung von digitalen Gütern ist, beschreibt Gläser
(2008) Content als ,,die um Metadaten ergänzte Essence."
35
Diese steht dabei
als das Ergebnis der originären Arbeit von Printverlagen (dem Erstellen und
Aufbereiten von Informationen in Form von Bild, Text, Ton und Bewegtbild).
Im Rahmen einer digitalen Speicherung werden diesen Inhalten Metadaten
(beschreibende Informationen) hinzugefügt, die Auffindbarkeit und effiziente
Weiterverarbeitung (i.S. einer Mehrfachverwertung) gewährleisten. Wird mit
diesem Content ein Recht zur Nutzung (z.B. der Verkauf von Lizenzen) ver-
bunden, entsteht ein Asset.
31
Vgl. Beck (2002), S. 124ff.
32
Vgl. Heinrich (2001), S. 211f; Wirtz (2008), S. 189f.
33
Vgl. Bonfadelli/Jarren /Siegert (2005), S. 222.
34
Vgl. McGovern/Norton (2002), S. 24.
35
Vgl. Gläser (2010), S. 391; Hass (2006), S. 379.
Kapitel 2 Grundlagen und Begriffsdefinitionen
11
Content stellt somit ein immaterielles Gut dar, dessen Erzeugung und Spei-
cherung materielle Hilfsgüter verlangt.
36
2.3.1 Marktfähigkeit und besondere Gütereigenschaften von Content
Content zeichnet sich durch Immaterialität aus. Dadurch ist er leicht reprodu-
zierbar und verbraucht wenige Ressourcen in Bezug auf seine Lagerung. Die-
se findet in einer Datenbank (Content-Management-System) statt, in der die
produzierten Inhalte digital und medienneutral archiviert werden. Diese Art der
Speicherung ermöglicht es, Content kostengünstig zu archivieren und jeder-
zeit für eine medienübergreifende Weiterverwertung zu verwenden.
37
Da redaktionelle Inhalte individuell und jeweils neu produziert werden, erge-
ben sich hohe Herstellungskosten (First Copy Costs). Die ,,erste Kopie" ist
dementsprechend mit einem hohen finanziellen Aufwand verbunden, durch
den ein großes finanzielles Risiko entsteht falls der erhoffte Markterfolg nicht
eintritt (Sunk Costs).
38
Die First Copy Costs fallen unabhängig von der Anzahl
der Nutzer an (fixe Kosten). Die Kosten der Vervielfältigung tendieren bei ei-
nem digitalen Gut gegen Null, da durch den immateriellen Charakter keine va-
riablen Stückkosten anfallen.
39
Content, der digital angeboten wird, kann zeit-
gleich von mehreren Rezipienten genutzt werden, ohne dass sich der Nutzen
für den Einzelnen verringert.
40
Rivalität im Konsum besteht demnach nur bei
den Kopien auf einem materiellen Trägermedium, jedoch nicht beim Inhalt.
41
Weiterhin gilt für Content, dass ein Ausschluss vom Konsum auch durch tech-
nische Schranken nicht vollständig möglich ist. Zahlreiche Informationen (be-
sonders im Bereich der General-Interest Nachrichten) können nicht geschützt
werden. Beispielhaft sind hier politische Informationen zu nennen. Deren Kon-
sum ist sogar staatlich erwünscht, unabhängig davon, ob Teile der Gesell-
schaft sich den Zugang zu diesen leisten können.
42
36
Vgl. Choi/Stahl/Whinston (1997), S. 60ff.
37
Vgl. Rawolle (2002), S. 53ff. Es fallen lediglich Kosten für die Anmietung von Daten-
trägern (z.B. Server) an.
38
Vgl. Wöhe (2010), S. 941.
39
Vgl. Wirtz (2008), S. 34; Beck (2002), S. 224.
40
Vgl. Gläser (2010), S. 142.
41
Vgl. Kiefer (2005), S. 146.
42
Redaktionelle Inhalte haben oftmals den Charakter meritorischer Güter.
2.3 Definition und Einordnung von Content
12
Content Angebote weisen die Charakteristika einer Dienstleistung auf. Sie
sind (ebenfalls) immateriell und verlangen die Integration eines externen Fak-
tors - nämlich den Rezipienten, an dem die Dienstleistung erbracht wird. Die
Qualität kann analog zu Dienstleistungen erst nach der Nutzung abschließend
beurteilt werden (Informationsparadoxon). Content-Angebote unterliegen so-
mit den Eigenschaften eines Vertrauens- und Erfahrungsgutes.
43
2.3.2 Paid Content und Paid Services
Die Begriffe Paid Content, Paid Services und auch der übergeordnete Begriff
E-Commerce werden vielfach synonym verwendet und erfordern eine Abgren-
zung.
Eine allgemein gefasste Definition des Begriffes E-Commerce geben Picot/
Reichwald/ Wigand (2003). Für Sie ist E-Commerce ,,jede Art wirtschaftlicher
Tätigkeit auf der Basis elektronischer Verbindungen."
44
Damit ist eine Abgren-
zung zum Begriff Paid Content jedoch noch nicht eindeutig.
Kotler/ Bliemel (2001) definieren E-Commerce als Überbegriff für die Abwick-
lung digitaler Transaktionen.
45
Charakteristisch ist, dass diese Transaktionen
zwischen (mindestens) zwei Wirtschaftssubjekten digital angebahnt, ausge-
handelt und abgewickelt werden. Resultat dieses Transaktionsprozesses kann
dabei aber auch die Distribution eines physischen Produktes an den Nachfra-
ger sein.
46
Paid Content beschreibt hingegen ausschließlich die kostenpflichtige Nutzung
und/oder den Vertrieb von digitalen Inhalten über technische Infrastrukturen
direkt an den Nutzer.
47
Dabei gliedert sich Paid Content in unterschiedliche
Angebotstypen, Formate und Themen.
48
Die Zahlung eines Entgelts kann den
Zugang zu einem Content-Angebot und damit einhergehend ein Recht zur
Nutzung ermöglichen.
49
Alternativ entsteht eine Eigentumsübertragung, wenn
mit dem Zugriff auf den Content durch die Zahlung ein Recht auf eine format-
43
Vgl. Wirtz (2008), S. 31f; Clement /Schreiber (2010), S. 119.
44
Vgl. Picot/Reichwald/Wigand (2003),S. 23.
45
Vgl. Kotler/Bliemel (2001), S. 1220.
46
Als Beispiel dient der Onlineversandhändler Amazon, bei dem der Kaufvorgang
elektronisch erfolgt, das gelieferte Produkt aber materiell sein kann.
47
Nutzer wird hier synonym mit dem Begriff Kunde verwendet und bezieht sich auf
Endkunden des Transaktionsprozesses (B2C).
48
Vgl. Stahl (2005), S. 10; hierzu auch Kap. 3.
49
Bspw. das einmalige Abrufen und Lesen eines Artikels auf einer Website.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2011
- ISBN (eBook)
- 9783842822399
- DOI
- 10.3239/9783842822399
- Dateigröße
- 950 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Mediadesign Hochschule für Design und Informatik GmbH Düsseldorf – Medienmanagement
- Erscheinungsdatum
- 2011 (November)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- internet printverlag mediennutzung paid content reichweite
- Produktsicherheit
- Diplom.de