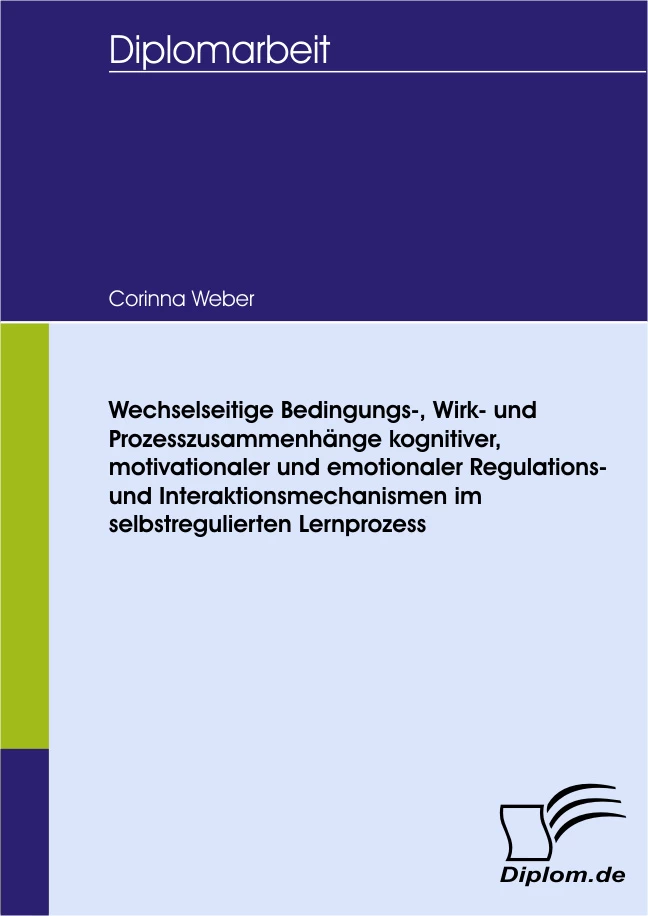Wechselseitige Bedingungs-, Wirk- und Prozesszusammenhänge kognitiver, motivationaler und emotionaler Regulations- und Interaktionsmechanismen im selbstregulierten Lernprozess
Zusammenfassung
Das deutsche Duale Berufsausbildungssystem zielt auf die Befähigung zur selbständigen und selbstverantwortlichen beruflichen Handlungskompetenz bzw. -fähigkeit (vgl. BBiG §§1 und 38; KMK, 2005; Ausbildungsordnungen der einzelnen Ausbildungsberufe). Die in diesem Rahmen einhergehende Auseinandersetzung mit der Kompetenzbegriffsbestimmung auf nationaler wie auch auf internationaler Ebene zeigt auf, dass zurzeit noch kein allgemein akzeptierter Kompetenzbegriff existiert. Die von Weinert für die OECD dargestellten Definitionsmöglichkeiten des Kompetenzbegriffes bilden die maßgebliche Basis für diverse Forschungsansätze. Die erste Empfehlung Weinerts, Kompetenz auf das Kognitive zu beschränken, erweiterte er später, indem er Kompetenz als die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können definierte und so eine viel zitierte Referenzdefinition erzeugte.
Die Kompetenz wird jedoch in kognitionspsychologischen Forschungsansätzen (Beispiele internationaler Schulvergleichsstudien: TIMSS, PISA) i. d. R. schwerpunktmäßig auf den Aspekt der kontextspezifischen kognitiven Leistungsdisposition reduziert. In der Begründung wird der Empfehlung Weinerts gefolgt, die motivationalen bzw. affektiven Voraussetzungen getrennt zu erfassen und vom Kompetenzbegriff abzugrenzen. Daraus resultiert eine immense Forschungslücke im Bereich der integrierten Kompetenzentwicklung. Die Persönlichkeitsentwicklung der Individuen, die sich im engeren Sinne in der Selbstkompetenz niederschlägt, resultiert aus dem Wechselspiel der kognitiven, emotionalen, motivationalen und moralischen Entwicklungsprozesse. Nur im Rahmen einer integrierten Analyse können Aussagen über Bedingungs-, Wirk- und Prozesszusammenhänge von Kognitionen und Prozeduren gewonnen werden.
Diese Feststellung führt zu der Frage, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse einen Beitrag leisten, um die wechselseitigen kognitiven, motivationalen und emotionalen Regulations- und Interaktionsmechanismen im Lernprozess zu beschreiben und diese als integrale Lernvoraussetzungen, -steuerungs- sowie -zielgrößen für die Entwicklung der gewünschten beruflichen Handlungskompetenz zu bestimmen. Eine Sichtbegrenzung auf die […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1 Problemstellung
2 Selbstreguliertes Lernen als Voraussetzung für lebenslanges Lernen
3 Theoretische Ansätze und Modelle des selbstregulierten Lernens
3.1 Konstrukt des selbstregulierten Lernens
3.2 Skizzierung der betrachteten Komponenten des selbstregulierten Lernens
3.3 Regulations-, Interaktions- und Prozessperspektive des selbst- regulierten Lernens – Entwicklung dreidimensionaler Sicht
4 Regulationsebene der Informationsverarbeitung – Interaktionsanalyse der Komponenten des selbstregulierten Lernens
4.1 Komplexität interaktiver Informationsverarbeitung
4.2 Interaktionen der Komponenten des selbstregulierten Lernens auf Ebene der Informationsverarbeitung aus struktureller und situativer Sicht
5 Regulationsebene der Lernprozesssteuerung – Interaktionsanalyse der Komponenten des selbstregulierten Lernens
5.1 Selbstregulation des Lernprozesses – Steuerung der Lernhandlung
5.2 Bedingungs-, Wirk- und Prozesszusammenhänge von Kognition, Emotion und Motivation auf der Ebene der Lernprozessregulation
6 Regulationsebene der Selbststeuerung - Interanalyse der Kompo- nenten des selbstregulierten Lernens
7 Konsequenzen für das Design der Lehr-Lern-Prozesse
7.1 Emotionale Komponente als Gestaltungsparameter und –faktor
7.2 Motivationale Komponente als Gestaltungsparameter und –faktor
7.3 Kognitive Komponente als Gestaltungsparameter und –faktor
7.4 Entwicklung und Förderung des selbstregulierten Lernens als Unterrichtsziel
8 Resümee
Literaturverzeichnis
Anhang
Eidesstattliche Erklärung
Abbildungsverzeichnis Seite
Abb. 1: Komponenten des selbstregulierten Lernens
Abb. 2: The three-layered model of self-regulated learning
Abb. 3: Phasenmodell des selbstregulierten Lernens
Abb. 4: Dreidimensionales Konstrukt des selbstregulierten Lernens
Abb. 5: Informationsverarbeitungsmodell
Abb. 6: Interactive cognitiv learning und thinking model
Abb. 7: Beziehung zwischen Leistung und emotionalen Zuständen
Abb. 8: Lernstrategien
Abb. 9: Bedingungsfaktoren der Zielbindung
Abb. 10: Schematische Darstellung des Emotionsprozesses
Abb. 11: Komponenten-Prozess-Modell
Abb. 12: Klassifikation von Emotionsregulationsstrategien
Abb. 13: Ausprägungen von Lernmotivation
Abb. 14: Selbstregulationsmodell
Abb. 15: Internalisierung von Zielen
Abb. 16: Regelkreis erfolgsmotivierter Lerner
Abb. 17: Zusammenhang Leistung und Stress
Abb. 18: Motivationsmodell
Abb. 19: Bedingungen der Interessiertheit am Unterricht
Abb. 20: Schema unterschiedlicher Motivationsformen und -probleme
Abb. 21: Ansätze zur Steuerung selbstgesteuerten Lernens
Tabellenverzeichnis Seite
Tabelle 1: Klassifikation aktivierende und desaktivierende Emotionen
1 Problemstellung
Das deutsche Duale Berufsausbildungssystem zielt auf die Befähigung zur selbständigen und selbstverantwortlichen beruflichen Handlungskompetenz bzw. -fähigkeit (vgl. BBiG §§1 und 38; KMK, 2005; Ausbildungsordnungen der einzelnen Ausbildungsberufe). Die in diesem Rahmen einhergehende Auseinandersetzung mit der Kompetenzbegriffsbestimmung auf nationaler wie auch auf internationaler Ebene zeigt auf, dass zurzeit noch kein allgemein akzeptierter Kompetenzbegriff existiert (vgl. Seeber et al., 2010, S. 3; Baethge et al., 2006, S. 18-38). Die von Weinert (1999, zit. in Klieme, 2004, S. 11-12) für die OECD dargestellten Definitionsmöglichkeiten des Kompetenzbegriffes bilden die maßgebliche Basis für diverse Forschungsansätze (Seeber et al., 2010, S. 3). Die erste Empfehlung Weinerts, Kompetenz auf das Kognitive zu beschränken, erweiterte er später, indem er Kompetenz als „die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können“ (Weinert, 2002, S. 27-28) definierte und so eine viel zitierte Referenzdefinition erzeugte (Klieme, 2004, S. 11-12).
Die Kompetenz wird jedoch in kognitionspsychologischen Forschungsansätzen (Beispiele internationaler Schulvergleichsstudien: TIMSS, PISA) i. d. R. schwerpunktmäßig auf den Aspekt der kontextspezifischen kognitiven Leistungsdisposition reduziert. In der Begründung wird der Empfehlung Weinerts gefolgt, die motivationalen bzw. affektiven Voraussetzungen getrennt zu erfassen und vom Kompetenzbegriff abzugrenzen (Klieme, Maag-Merki & Hartig, 2007, S. 6-7). Daraus resultiert eine immense Forschungslücke im Bereich der integrierten Kompetenzentwicklung. Die Persönlichkeitsentwicklung der Individuen, die sich im engeren Sinne in der Selbstkompetenz niederschlägt, resultiert aus dem Wechselspiel der kognitiven, emotionalen, motivationalen und moralischen Entwicklungsprozesse (Achtenhagen, 1996, S. 27). Nur im Rahmen einer integrierten Analyse können Aussagen über Bedingungs-, Wirk- und Prozesszusammenhänge von Kognitionen und Prozeduren gewonnen werden (Baethge et al., 2006, S. 41-42).
Diese Feststellung führt zu der Frage, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse einen Beitrag leisten, um die wechselseitigen kognitiven, motivationalen und emotionalen Regulations- und Interaktionsmechanismen im Lernprozess zu beschreiben und diese als integrale Lernvoraussetzungen, -steuerungs- sowie –zielgrößen für die Entwicklung der gewünschten beruflichen Handlungskompetenz zu bestimmen. Eine Sichtbegrenzung auf die kognitive Leistungsdisposition ist für die Analyse und Beschreibung von Kompetenzentwicklungen im Sinne beruflichen Erfolges durch Handlungskompetenz nicht zielführend. Dieses bestätigen wissenschaftliche Studien, indem z. B. dargelegt wird, dass die Intelligenz zwar unter den bisher erforschten Persönlichkeits- und Fähigkeitsfaktoren der hervorragendste Prädikator zur Vorhersage von Ausbildungs- und Berufsleistungen ist, jedoch wurde empirisch festgestellt, dass dieser Zusammenhang mit steigendem Ausbildungsniveau sinkt (Holling, Preckel & Vock, 2004, S. 47-50). Die von 1921 bis 1996 durchgeführte Langzeitstudie von Lewis Terman belegt ebenfalls, dass das IQ-Ausmaß keine Bedeutung für den späteren Berufserfolg besitzt, sondern vielmehr nichtkognitive Facetten der Persönlichkeit den Erfolg bestimmen, wie z. B. die Motivation, das Interesse, das Engagement, die Ausdauer und die Konzentrationsfähigkeit (Schneider, 2003, S. 8).
Grundlage dieser Arbeit bildet die Sicht, dass neben den kognitiven ebenfalls die emotionalen und motivationalen Dispositionen von Individuen als „konstitutives Element jedweder beruflicher Kompetenz [zu] betrachte[n]“ (Seeber et al., 2010, S. 4) und somit die wechselseitigen Bedingungs-, Wirk- und Prozesszusammenhänge zwischen den kognitiven, emotionalen und motivationalen Entwicklungsdeterminanten für die Befähigung zur beruflichen Handlungskompetenz zu bestimmen und aufzuzeigen sind.
Im Kern handelt es sich folglich um die Frage des Kompetenzerwerbs. Dieser findet grundsätzlich permanent (Spitzer, 2002, S. 19) über implizite und explizite Lernprozesse statt, die implizites und explizites Wissen aufbauen (vgl. Straka, 2005, S. 167; Stern, 2009, S. 356-360). Über den „Zirkel des Verstehens“, als ein dialektisches Wechselspiel von Erfahrungswissen (implizites Wissen) und Begriffswissen (explizites Wissen), entwickeln sich Wissen und Können (Neuweg, 2004, S. 11), welche zur Handlungsfähigkeit im beruflichen und außerberuflichen Bereich führen. Dieses Wissen und Können ist der Produktionsfaktor der Zukunft. Es erfordert persönliche Vorstellungen sowie individuelles Engagement. In einer Wissensgesellschaft steht im Gegensatz zur Informationsgesellschaft der Mensch mit seinen Fähigkeiten und Werten im Vordergrund (Reinmann-Rothmeier & Mandl, 2000, S. 27). Die Lernfähigkeit des Menschen ist die tragende Säule des sozialen Wissensnetzwerks und umfasst „nicht nur kognitive Fertigkeiten, sondern Neugier und Interesse, Kreativität und Begeisterungsfähigkeit, Selbstverantwortung und Selbständigkeit sowie Teamgeist und Kooperationsbereitschaft“ (Reinmann-Rothmeier & Mandl, 2000, S. 27-28). Aufgrund der Tatsache, dass Wissen eine immer kürzere „Halbwertzeit” besitzt, muss die Lernfähigkeit kontinuierlich über die gesamte Lebensspanne des Menschen bestehen (Jaspers, 2010).
Aus diesem Aspekt heraus orientieren sich die weiteren Ausführungen bei der Betrachtung der Interaktionsprozesse im Lernprozess zur Kompetenzentwicklung am Konzept des selbstregulierten Lernens als notwendige Voraussetzung für die Sicherung des lebenslangen Lernens.
Im Kapitel 2 erfolgt die Darstellung, aus welchen Gründen das lebenslange Lernen eine tragende Rolle im individuellen sowie im gesellschaftlichen Entwicklungsprozess spielt. Es erfolgt des Weiteren eine begriffliche Bestimmung des lebenslangen Lernens. In diesem Zusammenhang wird das Ziel verfolgt aufzuzeigen, welche Bedeutung und Stellung die Fähigkeit zur Selbstregulation der Lernprozesse in diesem Kontext einnimmt und aus welchem Grunde das selbstregulierte Lernen eine notwendige Voraussetzung für das lebenslange Lernen zur Kompetenzsicherung ist.
Anschließend folgt im Kapitel 3 die nähere Betrachtung des Konstrukts des selbstregulierten Lernens mit dem Fokus, eine Basis herzuleiten, die es ermöglicht, die als zentral zu betrachtenden Komponenten des selbstregulierten Lernens zu benennen und deren grundsätzliche Interaktionen zu beschreiben. Die darauf aufbauende Entwicklung einer dreidimensionalen Sicht des selbstregulierten Lernens betrachtet zunächst unterschiedliche Ansätze und Modelle des selbstregulierten Lernens mit dem Blick auf deren Fokus im Bezug auf die unterschiedlichen Sichten der Regulations- und Interaktionsmechanismen des selbstregulierten Lernens. Die entwickelte dreidimensionale Perspektive des selbstregulierten Lernens dient im Folgenden als Arbeitsgrundlage für die weiteren Ausführungen.
Die Kapitel 4 bis 6 stellen die wechselseitigen Bedingungs-, Wirk- und Prozesszusammenhänge zwischen den kognitiven, motivationalen und emotionalen Komponenten des Lernens auf den unterschiedlichen Regulationsebenen des selbstregulierten Lernens in Bezug auf das dreidimensionale Konstrukt dar. Die jeweilige Perspektive der diversen Regulationsebenen wird eingenommen, da jede dieser Ebenen eine spezielle Sicht der kognitiven, motivationalen und emotionalen Regulations- und Interaktionsmechanismen im Lernprozess bedingt. Diese Ausführungen sollen dazu dienen, die engen gegenseitigen Interaktionen und Verflechtungen der kognitiven, emotionalen und motivationalen Entwicklungsprozesse herauszuarbeiten, und damit die Bedeutung der These von Baethge (2006, S. 41-42) aus Kapitel 1 in der Hinsicht zu stützen, dass nur eine integrierte Analyse der betrachteten Komponenten Aussagen über die Kompetenzentwicklung fällen kann. Es gilt, die Definition von Weinert (siehe oben) und die Forschungsbedarfsforderung von Achtenhagen (siehe oben) im Lichte der aufzuzeigenden Wechselbeziehungen von Emotion, Kognition und Motivation im selbstregulierten Lernprozess zu stützen.
Aufbauend auf die in Kapitel 4 bis 6 erlangten Erkenntnisse, sollen im Kapitel 7 deren Konsequenzen für die Unterrichtsgestaltung analysiert und die Notwendigkeiten sowie Möglichkeiten in Bezug auf das Design der Lehr-Lern-Prozesse betrachtet werden. Letztendlich wird herausgearbeitet, wie die Entwicklung und Förderung des selbstregulierten Lernens als Unterrichtsziel realisierbar ist, indem die wechselseitigen Interaktionen der emotionalen, motivationalen sowie kognitiven Komponenten als Gestaltungsparameter und –faktor in der Unterrichtskonzeption Berücksichtigung finden.
Das Kapitel 8 betrachtet, aufbauend auf den Ausführungen und Erkenntnissen der vorstehenden Kapitel, die bedeutsamsten Faktoren bzw. Prämissen, die die Voraussetzungen des selbstregulierten Lernens bilden, mit dem Ziel, die Grundlagen und Fördermaßnahmen herauszuarbeiten, die für ein lebenslanges Lernen erforderlich sind.
2 Selbstreguliertes Lernen als Voraussetzung für lebens-langes Lernen
Die Menschen leben in Zeiten, in denen die Beschleunigung der kulturellen, wirtschaftlichen und technischen Veränderungen stetig zunimmt. Das Lernen und die damit verbundene Weiterentwicklung über die Lebensspanne hinweg sind Schlüssel zur persönlichen Bewältigung des Wandels (vgl. Achtenhagen & Lempert, 2000b, S. 11-18; Alheit & Dausien, 2010, S. 718). In diesem Zusammenhang zeigt sich auch die Bedeutung der drei zentralen Zieldimensionen des beruflichen Aus- und Weiterbildungssystems. Dieses System sieht die Entwicklung der beruflichen Handlungskompetenz unter den Gesichtspunkten der individuellen Nutzenperspektive, der Sicherstellung der gesellschaftlichen Humanressourcen sowie der Gewährleistung einer gesellschaftlichen Teilhabe (Achtenhagen & Winther, 2009, S. 7). Das von der European Commission geförderte Programm „education and training opportunities for all“ zeigt die politische Aktualität und Bedeutsamkeit des lebenslangen Lernens auf. Im Memorandum der Europäischen Kommission wurde festgehalten, dass “[l]ifelong learning is no longer just one aspect of education and training; it must become the guiding principle for provision and participation across the full continuum of learning contexts” (Commission of the European Communities, 2000, S. 3). Das Konzept lebenslanges Lernen beinhaltet formales, nicht-formales und informelles Lernen[1] an diversen Lernorten von der Kindheit bis ins hohe Alter hinein und ist ein konstruktivistischer Informationsverarbeitungs- und Erfahrungs-prozess, der zu Kenntnissen, Einsichten und Kompetenzen führt (Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung, 2004, S. 13).
Aus der Perspektive der individuellen Lernbiografie werden die formal, nicht-formal sowie informell erworbenen Lernergebnisse zu einem individuellen Kompetenzprofil integriert. Diese Entwicklung geht in der heutigen Zeit oftmals mit einer erhöhten Bildungsmobilität einher, die sich z. B. in nachgeholten Bildungsabschlüssen sowie in einer kontinuierlichen beruflichen Weiterqualifizierung niederschlägt, bedingt durch den stetig zunehmenden beschleunigten technologischen Wandel und der damit verbundenen kürzer werdenden Halbwertzeit des relevanten Wissens (Alheit & Dausien, 2010, S. 722-726). Die individuelle Lernbiografie gestaltet sich in allen Lebensphasen grundsätzlich im Wechselspiel zwischen Fremd- und Selbstregulation, deren Ausprägungsgrade je nach Lernsituation variieren (vgl. Alheit & Dausien, 2010, S. 728; Tiaden, 2006, S. 12-15; Schiefele & Pekrun, 1996, S. 250). Letztendlich ist bedeutsam, dass das Lernen grundsätzlich die Angelegenheit des Lernenden ist und in dessen Verantwortung liegt, da zum einen niemand zum Lernen gezwungen werden kann sowie zum anderen der Lernende zwar durch Anregungen und Anleitungen förderbar ist, er selbst jedoch den Lernprozess durchlaufen muss (Achtenhagen & Lempert, 2000b, S. 14).
Beim selbstregulierten Lernen[2] wählt der Lernende unter Einflussnahme seiner Lernmotivation selbstbestimmt die im Lernprozess einzusetzenden Steuerungsmaßnahmen (kognitive, metakognitive, volitionale sowie verhaltensmäßige u. a.) und evaluiert den Lernprozess eigenständig (Schiefele & Pekrun, 1996, S. 258). Im weiteren Sinne wird die Selbstregulation als „Prozess in Zielsetzung, Überwachung der Handlung, Evaluation des Lernprozesses und des Lernergebnisses sowie wenn nötig einer Anpassung von Zielen oder Ma[ß]nahmen unterteilt“ (Tiaden, 2006, S. 15). Die Selbstregulation des Lernens befähigt den Lernenden dazu, seine Lernprozesse eigenständig und erfolgreich zu regulieren, indem er diese selbst initiiert und steuert (Artel, Baumert & Julius-McElvany, 2003, S. 131). Das selbstregulierte Lernen ist explizites Lernen (Straka, 2005, S. 168). Diese Befähigung ist der Schlüssel zur Entfaltung und Erfüllung des Bedürfnisses nach Autonomie bzw. Selbstbestimmung[3], welche eine der drei in der Selbstbestimmungstheorie postulierten psychologischen Energiequellen darstellt, mit der die Entwicklung einer auf Selbstbestimmung beruhenden Motivation einhergeht. Autonomie bzw. Selbstbestimmung, im Zusammenhang mit dem Gefühl der Kompetenz und Selbstwirksamkeit[4] sowie einer sozialen Eingebundenheit, bilden die Basis für effektives Lernen und qualitativ hochwertige Lernergebnisse (Deci & Ryan, 1993, S. 229-236).
Lebenslanges Lernen, als Teil des individuellen biografischen Entwicklungsprozesses des Menschen, erfordert mit zunehmendem Alter eine steigende intrapersonale Autonomie des Lernens, d. h. eine auf Selbstbestimmung beruhende Selbstregulationsfähigkeit der Kompetenzentwicklung. Im Kindes- und Jugendalter wird das Lernen noch zu einem umfangreichen Teil von der formalen Bildungsinstitution „Schule“ durch ein verpflichtendes fremdorganisiertes Lernangebot konzipiert. In dieser schulischen Ausbildungsphase ist es bereits besonders wichtig bzw. notwendig, dass die Bildungsinstitutionen die Fähigkeit des selbständigen Lernens einüben sowie die Fähigkeit zur Regulation der Lernprozesse vermitteln, damit zum einen die fremdorganisierten Bildungsangebote verarbeitet und angenommen werden können sowie zum anderen auch nicht-formelles und informelles Lernen sich eigenverantwortlich entfalten kann (Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung, 2004, S. 17-23). Ein besonderes Augenmerk muss folglich auf die Qualität von Erziehung und Ausbildung von früher Kindheit an gelegt werden, denn dort wird das Fundament aufgebaut und das Niveau der Befähigung zum lebenslangen Lernen beeinflusst. Entscheidend ist folglich in diesem Zusammenhang, dass sich nicht nur wissensbasierte Fähigkeiten entwickelnt, sondern auch garantiert werden muss, dass eine positive Einstellung gegenüber dem Lernen sowie die Fähigkeit zum Lernen lernen sich ausbildet (Commission of the European Communities, 2000, S. 7). Hierüber wird den jungen und erwachsenen Menschen ermöglicht, sich in einer Welt des schnellen Wandels für dessen Bewältigung neuen Lernprozessen zu unterziehen und diese ohne fremde Hilfe bzw. selbständig zu initiieren sowie zu regulieren (Klafki, 2007, S. 70-71).
3 Theoretische Ansätze und Modelle des selbstregulierten Lernens
3.1 Konstrukt des selbstregulierten Lernens
Ziel der anschließenden Ausführungen in diesem Kapitel ist es, einen Modellansatz herzuleiten, der die Basis für eine strukturierte Analyse bildet und die wechselseitigen Bedingungs-, Wirk- und Prozesszusammenhänge von Kognition, Motivation und Emotion aus der Perspektive des selbstregulierten Lernprozesses differenziert betrachten lässt.
Die folgenden Ausführungen zum selbstregulierten Lernen bilden die Basis zur Klärung folgender Fragen:
- Welche Komponenten nehmen im selbstregulierten Lernen eine bedeutende Rolle ein?
- Auf welchen Regulationsebenen wirken diese Komponenten zusammen?
- Wie stellt sich das selbstregulierte Lernen als Prozess dar?
Pintrich (2005, S. 452-453) hat die grundlegenden Annahmen unterschiedlicher Modelle des selbstregulierten Lernens in vier Aussagen zusammengefasst:
1. „learners as active, constructive participants in the learning process […]
2. learners can potentially monitor, control, and regulate certain aspects of their own cognition, motivation, and behavior as well as some features of their environments […]
3. there is some type of criterion or standard against which comparisons are made in order to assess whether the process should continue as is or if some type of change is necessary […]
4. self-regulatory activities are mediator between personal and contextual characteristics and actual achievement or performance” (Pintrich, 2005, S. 452-453)
Selbstreguliertes Lernen ist folglich ein aktiver, konstruktiver Prozess, bei dem die Lernenden sich ihre Lernziele setzen und versuchen, diese zu überwachen und zu regulieren sowie ihre Kognition, Motivation und ihr Verhalten zu kontrollieren, geleitet und in Abhängigkeit von ihren Zielen sowie den kontextuellen Merkmalen ihrer Umwelt[5].
Im ersten Schritt werden die konstatierten Komponenten des selbstregulierten Lernens näher betrachtet (vgl. Friedrich & Mandl, 1997, S. 241 - 253; Boekaerts, 1997 in Boekaerts & Rozendall, 2006, S. 68; Artelt, Baumert & Julius-McElvany, 2003, S. 132; Boekaerts, 1997, S. 164). Sie stellen die Voraussetzungen des Lernprozesses auf Seiten des Lernenden dar (strukturelle Komponentensicht) und stehen in Interaktion mit den situativen Aspekten des Lernprozesses (prozessuale Komponentensicht). Die Differenzierung der Komponenten im Hinblick auf die Aspekte der strukturellen Anteile bzw. habituellen Persönlichkeitsmerkmale[6] sowie prozessualen bzw. situationsabhängigen Anteile[7] wird in dieser Arbeit mit dem Ziel verfolgt, deren unterschiedliche Entwicklung und Einflussnahme im Zusammenhang mit dem selbstregulierten Lernen zu erörtern (vgl. Friedrich & Mandl, 1997, S. 241 - 253; Winther, 2006, S. 5; Smith, Nolen-Hoeksema, Fredrickson & Loftus, 2007, S. 4). Diese Differenzierung soll z. B. dazu beitragen aufzuschlüsseln, wie habituelle Persönlichkeitsmerkmale den Lernprozess beeinflussen und wie diese im Lernprozess, mit Sicht auf die Unterstützung zum lebenslangen Lernen, positiv beeinflussbar sind und wie die aktuelle Motivierung in Abhängigkeit der situativen Anforderungen hier interagiert.
Lang und Pätzold (2006, S. 18) zeigen ebenfalls auf, dass die meisten Modelle des selbstregulierten Lernens den kognitiven, motivationalen, volitionalen sowie metakognitiven Komponenten eine entscheidende Rolle für das erfolgreiche Lernen zuweisen. Die Emotion[8] als eigenständige Komponente wird weitestgehend nicht explizit angesprochen. Die Begründung liegt zum einen darin, dass Emotionen als organismusnahe Botschaften für das menschliche Verhalten unter dem Begriff der Triebe bereits analysiert (Beckmann & Heckhausen, 2010, S. 94-95; Scheffer & Heckhausen, 2010, S. 53) und zum anderen „als ein rudimentäres Motivsystem bezeichnet werden, das der internen und externen Kommunikation von motivationalen Sequenzen dient“ (Scheffer & Heckhausen, 2010, S. 59). Die in der Psychologie publizierte kognitive Wende in den 60er-Jahren verlagerte die Sicht auf die kognitiven Emotionstheorien, die als Auslöser von Emotionen die kognitive Bewertung eines Objektes in Bezug auf seine Bedeutung für die subjektiven Ziele und Bedürfnisse sehen (Reisenzein, Meyer & Schützwohl, 2003, S. 58-59, S. 104-109, S. 140-143). Emotionen können als „hochkomplexe Muster körperlicher, kognitiver, situativer und verhaltenssteuernder Merkmale“ (Kuhl 2010a, S. 103) bezeichnet werden (vgl. Smith et al., 2007, S. 508-509; Frenzel, Götz & Pekrun, 2009, S. 206-208) (siehe Anhang 1). Sie spielen im selbstregulierten Lernprozess eine wichtige Rolle, da sie als eigenständige Komponente in kognitiven Prozessen entstehen (Kuhl, 2010a, S. 361-362) und wiederum in einer Feedbackschleife auf die kognitive Leistungsfähigkeit des Lernenden Einfluss nehmen (Spitzer, 2003, S. 177-179), das Motivationssystem hemmen oder stimulieren (Scheffer & Heckhausen, 2010, S. 61) sowie direkt den Einsatz von Lernstrategien und das Ausmaß des selbstregulierten Lernens beeinflussen (siehe Anhang 2).
Aus diesen soeben geschilderten Erkenntnissen heraus, soll die Emotion als eigenständige bedeutsame Komponente, neben der Kognition (einschließlich der Metakognition, siehe unten) und Motivation, betrachtet werden, welche als Voraussetzung und maßgeblich beteiligte Komponenten des selbstregulierten Lernens gelten und in ihrem Zusammenspiel die Persönlichkeit des Lernenden beschreiben.
Die bei Lang und Pätzold (2006, S. 18) erwähnte volitionale Komponente des selbstregulierten Lernens ist bedeutsam für die Realisierung konkreter Lernziele. Die motivationspsychologische Handlungspsychologie unterscheidet prädezisionale, postdezisionale, aktionale und postaktionale Handlungsphasen (siehe Rubikon-Modell im Anhang 3) und stellt die Notwendigkeit der Differenzierung zwischen der Motivation in der Phase der Zielsetzung und Volition in der Phase der Zielrealisierung dar (Achtziger & Gollwitzer, 2010, S. 310-314). Diese Differenzierung wurde gewählt, um den Handlungsprozess detaillierter zu beschreiben und folglich zu analysieren (Heckhausen & Heckhausen, 2010, S. 8). Die Volition ist wichtig und muss auf den jeweiligen Regulationsebenen des Lernens (siehe Kapitel 3.3) berücksichtigt werden. Als eigenständige Komponente des selbstregulierten Lernens soll die Volition jedoch in diese Arbeit nicht einfließen, da sie mit Bezug auf den allgemeineren Motivationsbegriff der als „eine Abstraktionsleistung, mit der von vielen verschiedenen Prozessen des Lebensvollzuges jeweils diejenigen Komponenten oder Teilaspekte herausgegriffen und behandelt werden, die mit der ausdauernden Zielausrichtung unseres Verhaltens zu tun haben“ (Rheinberg, 2006, S. 15) unter die Komponente der Motivation subsumiert werden kann.
3.2 Skizzierung der betrachteten Komponenten des selbstregulierten Lernens
Im Folgenden werden die als zentral erachteten Komponenten des selbstregulierten Lernens kurz beschrieben und ihre grundsätzlichen Interaktionen aufgezeigt. Im Rahmen dieser Ausführungen werden schwerpunktmäßig die im Fokus der aktuellen Emotions- und Motivationsforschung stehenden kognitiven Emotions- und Motivationstheorien herangezogen. Diese betrachten im Kern die wechselseitigen Verflechtungen zwischen den emotionalen, motivationalen und kognitiven Prozessen.
Die Kognitionen, als eine der zentralen Komponenten des selbstregulierten Lernens, umfassen alle Prozesse, die der Informationsverarbeitung, der Wahrnehmung, der Aufmerksamkeit des Gedächtnisses und Denkens dienen. Über die Kognition werden die Prozesse des Erkennens, der Aufnahme und der Verarbeitung von Wissen gesteuert (Kuhl, 2010a, S. 22-26). Die Metakognition bildet als Kognition über die eigenen Kognitionen einen kognitiven Prozess höherer Ordnung ab. Die kognitiven Prozesse und Zustände des Lernprozesses stellen die Objekte der kognitiven Re-flexion dar. Die Metakognition kann im Kern unter die kognitive Komponente des selbstregulierten Lernens subsumiert werden, weil sie eine signifikante Kognitionsform darstellt. In ihrem Fokus stehen das Wissen und die Kontrolle über das eigene kognitive System (vgl. Bannert, 2007, S. 23-24; Hasselhorn, 2010, S. 541).
Für die kognitiven Prozesse nutzt der Mensch sein Gehirn, welches für das Lernen optimiert ist. So liegt dieser Arbeit die Annahme zugrunde, dass, von extremen krankheitsbedingten Ausnahmen abgesehen[9], die kognitive Leistungsfähigkeit sich im Kontext des Wachstums, der Entwicklung und Reifung beim Menschen entwickelt (Spitzer, 2007, S. 13-15). Der genetisch bedingte Grundstock bildet zwar die Ausgangsposition, entscheidend für die kognitive Leistungsfähigkeit des Gehirns ist jedoch vielmehr, dass sich Erfahrungen und Gehirnreifung, im Sinne eines klassischen positiven Feedbackmechanismus, zeitlich parallel entwickeln. Die Gehirnreifung wird erst durch Erfahrungen - Lernen in den einzelnen Lebensbereichen - angestoßen und bildet über diesen Impuls die Entwicklung der entsprechenden Gehirnregionen aus, die dann wiederum weitere Erfahrungen auf einem höheren Niveau ermöglichen. Die Schwierigkeit liegt darin, dass es jeweils unterschiedlich kritische Perioden gibt, die eine bestimmte Anregung in einem bestimmten Zeitfenster benötigen, damit sich die einzelnen Regionen im Gehirn entwickeln können. „Während solcher [kritischen Perioden auch Tuning-Perioden genannt] ist das Erlernen bestimmter Sachverhalte oder Fähigkeiten besonders leicht und erschließt gleichsam einen bestimmten Raum für weiteres Lernen“ (Spitzer, 2007, S. 210). Diese Problematik wird weiterführend in Kapitel 4.2 behandelt.
Als weitere zu betrachtende Komponente des selbstregulierten Lernens begleiten bzw. beeinflussen die Emotionen den kognitiven Prozess, indem der wahrgenommene Erkenntnisgegenstand auf seine Relevanz bezüglich seiner Befriedigung für die eigenen Bedürfnisse hin bewertet wird. In der Phase der kognitiven Informationsaufnahme sowie –verarbeitung greifen demnach Bewertungsmechanismen auf „Basis von individuellen Werten, Erwartungen, Zielen und Attributionen“ (Hascher & Krapp, 2009, S. 367). In diesem Zusammenhang entstehen bei den Personen Gefühlsregungen bzw. Emotionen (z. B. Freude, Stolz, Enttäuschung, Angst), die sich in den Mittelpunkt ihres Bewusstseins stellen und so die Relevanz des Erkenntnisgegenstandes für die Bedürfnisbefriedigung widerspiegeln. Im Rahmen dieser Bewertungsprozesse spielen analog zur unten beschriebenen Personen-Situations-Interaktion der Motivation auch dispositionelle sowie situative Emotionen eine Rolle. Dispositionelle Emotionen, welche auch als geronnene oder Traits-Emotionen bezeichnet werden, klassifizieren die situationsübergreifenden emotionalen Eigenschaften einer Person, die diese im Laufe ihres Lebens über individuelle Erfahrungen gebildet hat. Diese zeigen sich in einer tendenziellen Sensibilität für bestimmte Emotionen und werden in emotionalen Schemata gespeichert (z. B. grundsätzlich positives oder ängstliches Erleben) (vgl. Scheffer & Heckhausen, 2010, S. 62; Kryspin-Exner, 2004, S. 232). In der Emotionsforschung wird des Weiteren zwischen primären und sekundären Emotionen differenziert (Hansch, 2005, S. 204-211), auf die im Kapitel 4.1 näher eingegangen wird. Die emotionalen Bewertungsprozesse lösen aktivierende oder hemmende Aktionen im kognitiven und motivationalen System aus, mit dem Ziel der Erreichung einer optimalen Bedürfnisbefriedigung.
Die Motivation, als die dritte der zentralen Komponenten des selbstregulierten Lernens, generiert die Motivationsprozesse. Diese begleiten und steuern die Vorbereitung und Durchführung von Handlungen, indem sie helfen, Frustrationen zu vermeiden und Bedürfnisse positiv zufriedenzustellen (Kuhl, 2010a, S. 22-26). Die Motivationsforschung befasst sich folglich mit der Richtung, Ausdauer und Intensität von Verhaltensprozessen, die an der Vorbereitung und Ausführung von Handlungen beteiligt sind (Rheinberg, 2006, S. 11-13). In der Motivationspsychologie wird aktuell davon ausgegangen, dass das Verhalten sowohl von den dispositionellen Eigenschaften der Person[10], als auch von den Umständen der Situation geprägt ist (vgl. Heckhausen & Heckhausen, 2010, S. 6-7; Scheffer & Heckhausen, 2010, S. 43, S. 54). Das Verhalten ist folglich ein „Resultat der Wechselbeziehung zwischen einer bestimmten Person und einer bestimmten Situation“ (Rheinberg, 2006, S. 42). Bei den dispositionellen Einflussfaktoren der jeweiligen akuten Motivation handelt es sich aus zeitlicher Perspektive um relativ stabile[11], überdauernde Persönlichkeitsmerkmale (Motive)[12], die in verschiedenen Situationen eine bestimmte Motiva-tionstendenz generieren. Hier stellt sich die Frage nach den situativen Anregungen auf die Aktivierung der einzelnen latenten Motivdispositionen. Dort zeigt sich das Grundproblem der Motivanregung. Erst wenn die Wechselwirkung zwischen Situation und Motivaktivierung geklärt ist, kann auch der Einfluss des Motivs auf die Motivationstendenz analysiert werden (Scheffer & Heckhausen, 2010, S. 43-44, S. 52-59). Motive sind grundsätzlich auf die Befriedigung von Bedürfnissen (z. B. Leistung, Autonomie und Beziehung)[13] ausgerichtet (Kuhl, 2010a, S. 258). Laut Scheffer und Heckhausen (2010, S. 62-63) erklären Bedürfnisse und Motive die Verhaltensziele (Was des Verhaltens) und die Motive im Zusammenwirken mit den Emotionen die Verhaltensausprägung (Wie des Verhaltens).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Komponenten des selbstregulierten Lernens (eigene Darstellung)
3.3 Regulations-, Interaktions- und Prozessperspektive des selbstregulierten Lernens – Entwicklung dreidimensionaler Sicht
Eine weiterführende Sicht des selbstregulierten Lernens eröffnet „The three-layered model of self-regulated learning“ (siehe Abbildung 2).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: “The three-layered model of self-regulated learning” (Boekaerts, 1999, S. 449)
Das Drei-Schichten-Modell definiert das Lernen in drei ineinandergreifenden Regelsystemen, die die von Boekaerts (1997, S. 164) definierten sechs Komponenten des selbstregulierten Lernens miteinander verbinden (siehe Anhang 4). In diesem Modell erlangen die kognitiven und die motivationalen Komponenten sowie ihre Regulierungsprozesse auf den Ebenen Ziele, Strategien und domänenspezifischen Wissens eine Gleichwertigkeit (Boekaerts & Rozendall, 2006, S. 68-69)[14]. Dieses Rahmenmodell des selbstregulierten Lernens zeigt das Lernen als einen komplexen, interaktiven und integrativen Prozess der kognitiven und motivationalen Lernkomponenten auf und liefert somit für den Kontext dieser Ausführungen einen wesentlichen Beitrag, auf den nachfolgend Bezug genommen wird. Die emotionale Komponente ist in dieses Modell nicht explizit eingeflossen. Auf ihre Bedeutung im Lernprozess hat Boekaerts (1992, S. 391) jedoch hingewiesen, indem sie die emotionale Kontrolle für die Aufrechterhaltung der Lernabsichten als wichtig erachtet.
Der Kern des Modells „regulation of processing modes“ integriert die Erkenntnisse der Lernstilforschung, in der das typische Lernverhalten, vor allem die Wahl der kognitiven Strategien sowie deren Einsatz im Lernprozess, betrachtet wird. Im Fokus steht die Gestaltung der Informationsverarbeitungsprozesse in Bezug auf die Frage, inwieweit kognitive Lernstrategien (z. B. Memorier-, Elaborations- und Trans-formationsstrategien) im Lernprozess eingesetzt und ausgewählt werden. Die Aus-prägung der Informationsverarbeitungsprozesse ist zentral für die Qualität des selbstregulierten Lernens (Boekaerts, 1999, S. 447-449).
Die mittlere Schicht „regulation of the learning process“ betrachtet die Regulation der Lernprozesse und legt hierfür die Erkenntnisse aus der Tradition der Metakognitionsforschung zugrunde. Hier steht das metakognitive Wissen im Fokus, welches sich in der Ausrichtung, Planung, Durchführung, Evaluation, Bewertung und Korrektur der Lernprozesse zeigt. (Boekaerts, 1999, S. 449-451).
Die äußere Schicht „regulation of the self“ betrachtet schwerpunktmäßig das Engagement des Lernenden, sich im Hinblick auf die eigenen Wünsche, Bedürfnisse sowie Erwartungen eigene Ziele zu setzen und unter Einsatz von Volition diese gegen konkurrierende Alternativen abzugrenzen (Boekaerts, 1999, S. 449-453).
Diese einzelnen Regelkreise sind für die Betrachtung der Interaktionsprozesse der Komponenten (Kognition, Motivation, Emotion) bedeutsam, da angenommen wird, dass auf jeder Ebene die Wechselwirkungen differenzieren.
Eine weitere Facette, ergänzend zu den Perspektiven, welche Komponenten im selbstregulierten Lernprozess beteiligt sind und auf welchen Ebenen diese in Interaktion treten, bildet die Sicht der interaktiven Regelkreisphasen des Lernprozesses. Sie rückt eine Lernprozessphasenbetrachtung in den Vordergrund und wird im Anschluss anhand von drei Modellen in ihren Grundzügen beschrieben.
Zimmermann (2005, S. 15-24) beschreibt den Prozess in drei „cyclical phases of self-regulation“ (siehe Anhang 5). In der Planungs- und präaktionalen Phase „Forethought Phase“ werden zwei Bereiche unterschieden, die jedoch eng miteinander verknüpft sind. Es handelt sich zum einen um die Aufgabenanalyse, in der Zielsetzungen sowie strategisches Planen von Handlungen erfolgen und zum anderen um selbstbezogene motivationale Überzeugung, die geprägt ist durch Selbstwirk-samkeit, Ergebniserwartung, intrinsische Motivation (Interesse und Werte) sowie Zielorientierung. Die anschließende Phase der Leistungs- bzw. Umsetzungsphase „Performance or Volitional Control Phase“ wird getragen durch die Selbstkontrolle und –observation. In dieser Phase ist das Maß die Regulierung der Aufmerksamkeit und des Handelns. Die Selbstkontrolle verfolgt das Ziel der „Optimierung der individuellen Wahrnehmungs- und Verhaltensebene“ (Tiaden, 2006, S. 30). Die Selbstobservation ist wichtig für die Erfassung der Lernprozesse und –ergebnisse. Diese werden im nächsten Prozessschritt der „Self-Reflection Phase“ zum einen über die Selbstbeurteilung evaluiert und führen zum anderen zu Kausalattributionen. Die Selbstbeurteilung löst bei den Lernenden Reaktionen aus, die zur Selbstbewertung der Lernhandlung führen. Diese Selbstbewertung erzeugt Emotionen, generiert motivationseinflussnehmende Selbstwirksamkeitsüberzeugung, beeinflusst zukünftige Anstrengungsbereitschaft und Selbstregulation. Die Selbstreflektion leitet die Feedback-Schleifen ein. Selbstregulation ist aus Sicht der Lernprozessphasenbetrachtung ein Regelkreis, der nicht nur eine zielorientierte Lernhandlung darstellt, sondern über die Self-Reflections-Phase den Einfluss der Lernerfolge oder auch Misserfolge auf die zukünftige Regulierung anschließender Lernziele und Lernhandlungen integriert (Zimmermann, 2005, S. 15-24).
Schmitz und Schmidt (2007, S. 12) erweitern den Ansatz von Zimmermann, indem aufgezeigt wird, dass Selektionsfilter auf die Ausführung der Selbstregulation wirken, und zwar in Abhängigkeit von den Merkmalen der Aufgabe (z. B. interessant), der Lernsituation (z. B. angenehm) und der personalen Faktoren (z. B. verfügbare Ressourcen).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Phasenmodell des selbstregulierten Lernens (eigene Darstellung in Anlehnung an Schmitz & Schmidt, 2007, S. 12)
Pintrich (2005, S. 453-455) splittet die „Performance or Volitional Control Phase“ in zwei Phasen auf, und zwar in eine Monitoring- und eine Kontrollphase. Des Weiteren wurden die kognitiven und motivational/emotionalen Regulationsbereiche beschrieben (siehe Anhang 6). Pintrich (2005, S. 451) betont die Notwendigkeit, dass in den Modellen des selbstregulierten Lernens die kognitiven und motivationalen Prozesse zu integrieren sind. In diesem Modell wird hervorgehoben, dass der Einsatz von Strategiewissen von der Beziehung zwischen Motivation und Kognition abhängt, da das Strategiewissen nicht automatisch zum Einsatz gelangt (siehe Kapitel 7.2). Die vier Phasen des Modells bilden einen chronologischen Rahmen des Lernprozesses ab, jedoch bestimmen sie keine hierarchische Struktur, die linear durchlaufen werden muss, sondern eher einen Regelkreis, der innerhalb eines Lernprozesses den dynamischen Fortschritt der Aufgabenbewältigung über die jeweilig sinnvoll gewählten Phasen steuert. Z. B. werden im Lernprozess Ziele angepasst, wenn in der Kontrollphase erkannt wird, dass Aufgaben zu ändern sind (Pintrich, 2005, S. 455).
Die zuvor dargestellten Perspektiven des selbstregulierten Lernens zeigen die unterschiedlichen Sichten und die damit verbundenen Schwerpunkte in deren Analysen auf. Im Rahmen dieser Arbeit wird das Ziel verfolgt, jene Ansätze bzw. Perspektiven miteinander zu integrieren. Hierzu erfolgt der Entwurf eines dreidimensionalen Konstrukts des selbstregulierten Lernens (siehe Abbildung 4). Dieses Gebilde verdeutlicht schemenhaft die Komplexität des selbstregulierten Lernprozesses sowie die Vielfalt der unterschiedlichen Forschungsfelder (vgl. Rosendahl, 2010, S. 28-54; Tiaden, 2006, S. 16-38; Landmann, Perels, Otto & Schmitz, 2009, S. 50-55).
Die Regulationsebenen geben die Gliederung der anschließenden Kapitel vor. Sie wurden als Richtschnur ausgewählt, da anhand ihrer Strukturierung des Lernprozesses verdeutlicht werden kann, dass die Komponenten Emotion, Kognition und Motivation auf diesen Ebenen unterschiedliche Wechselbeziehungen bzw. Einflussnahmen bewirken. Hierbei stehen die Komponenten des selbstregulierten Lernens im Fokus der anschließenden Ausführungen. Es soll vor allem auf die Analyse ihrer Wechselwirkungen, ihrer gegenseitigen Einflussnahme bzw. Bedingtheiten sowie prozessabhängigen Merkmale eingegangen werden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4: Dreidimensionales Konstrukt des selbstregulierten Lernens (eigene Darstellung in Anlehnung an Tiaden, 2006, S. 34)
Der Prozessgedanke des selbstregulierten Lernens ist in das Modell mit eingeflossen um aufzuzeigen, dass das Lernen grundsätzlich einen prozessualen Charakter besitzt. In Anlehnung an Pintrich (2005, S. 455) wird hier der Lernprozess in chronologischen Phasen abgebildet (siehe oben). Diese stellen jedoch keine hierarchischen Strukturen, die linear durchlaufen werden dar, sondern es handelt sich eher um einen Regelkreis innerhalb eines Lernprozesses, der den dynamischen Fortschritt der Aufgabenbewältigung über die jeweilig sinnvoll gewählten Phasen steuert. So lässt sich auch erklären, dass in den Prozessphasen grundsätzlich alle Komponenten miteinander interagieren, die Prozessphasen jedoch aus Sicht der Regulationsebenen unterschiedlich stark gefordert bzw. ausgeprägt sind.
4 Regulationsebene der Informationsverarbeitung – Interaktionsanalyse der Komponenten des selbstregu-lierten Lernens
4.1 Komplexität interaktiver Informationsverarbeitung
Die Regulation der Informationsverarbeitungsprozesse ist das Kernelement des Drei-Schichtenmodells von Boekaerts (1999, S. 449) (siehe Abbildung 2). In Bezug auf die dreidimensionale Perspektive des selbstregulierten Lernens (siehe Abbildung 4) erfolgt in diesem Kapitel die Darstellung der interaktiven Informationsverarbeitung mit Blick auf die beteiligten Komponenten (Kognition, Motivation und Emotion), deren States- und Traits-Perspektive sowie die Berücksichtigung der Prozessphasen.
Jean Piaget hat im Bereich der kognitiven Entwicklung des Menschen theoretische Pionierarbeit geleistet, indem er den Informationsverarbeitungsprozess als Bedeutungskonstruktion betrachtet und nicht als Übernahme von Reiz-Reaktions-Verbindungen. Er beschrieb die Wissensentstehung als Prozesse der Assimilation und Akkommodation, die die kognitiven Strukturen durch neue Informationsaufnahme ausdifferenzieren und führte Kompetenzunterschiede auf Differenzen in der Art der Wissensverarbeitung zurück (vgl. Schneider & Stern, 2007; S. 27; Anderson, 2007, S. 495-498). Die Resultate der Expertiseforschung zeigten dahingegen, dass Kompetenzunterschiede im Bereich des Wissens und der Erfahrungen liegen und nicht von der Art der Wissensverarbeitung abhängen (Gruber & Mandl, 1996, S. 589-592). Die enge Verknüpfung zwischen Kognition und emotionalen Äußerungen im Zusammenhang mit der kognitiven Entwicklung wird darauf zurückgeführt, dass es „kein Verhalten [gibt], so intellektuell es auch sein mag, das nicht als Triebfedern affektive Faktoren enthalten würde; doch umgekehrt kann es auch keine affektiven Zustände geben, ohne da[ss] Wahrnehmungen und Anschauungen mitwirken, die ihre kognitive Struktur ausmachen“ (Piaget & Inhelder, 2009, S. 156). Das Verhalten ist durch nicht von einander trennbare affektive und kognitive Aspekte geprägt. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass die kognitiven Strukturen die affektiven Aspekte erklären und dass die Affektivität die Kognitionen berücksichtigt. Die Selbstregulation erlangt eine wichtige Rolle für die Erklärung von affektiven Entwicklungen (Piaget & Inhelder, 2009, S. 156-157).
Diese Erkenntnis der gegenseitigen Einflussnahme wurde in den Anfängen der kognitiven Psychologie weitestgehend vernachlässigt. Man ging davon aus, dass die Input-Output-Beziehung von Wissen festen algorithmischen Regeln folgt und die Psyche des Menschen in einer Analogie zu den Computermodellen steht. Mit der Zeit kristallisierten sich die Unterschiede weiter heraus (siehe Anhang 7) und die Informationsverarbeitungsmodelle (z. B. das Gedächtnismodell von Atkinson & Shiffrin, 1968, siehe Anhang 8) erfuhren Erweiterungen, z. B. im Hinblick auf die Aspekte der Wahrnehmung, Motivation, Emotion, Persönlichkeit etc. (vgl. Smith et al., 2007, S. 12; Schneider & Stern, 2007, S. 30-33).
Das von Klauer und Leutner (2007, S. 64-65) ausgewählte und aus deren Sicht als allgemein gesichert definierte Informationsverarbeitungsmodell stellt die Stadien erfolgreich ablaufender Lernprozesse dar.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 5: Informationsverarbeitungsmodell (Klauer & Leutner, 2007, S. 65)
Dieses Informationsverarbeitungsmodell bildet für Klauer und Leutner (2007, S. 64) die Basis zur Entwicklung ihres präskriptiven Lehr-Lern-Prozessmodells (siehe Anhang 9). Die emotionale Komponente des Lernprozesses wird in diesen Modellen nicht beachtet. Die motivationale Komponente erlangt jedoch an Bedeutung, denn „[w]enn die Motivation des Lernenden an irgendeiner Stelle abreißt, so bricht der Lernprozess ab“ (Klauer & Leutner, 2007, S. 73).
Das interaktive Modell des Lernens und Denkens (Tennyson & Breuer, 2002, S. 652) steht nicht in der Tradition sequentieller Modelle und berücksichtigt sowohl sequenzielle als auch dynamische Elemente der Erkenntnis sowie die Wechselwirkungen zwischen der Wissensbasis (deklaratives, prozedurales und konditionales Wissen), den kognitiven Strategien für die kognitiven Prozesse höherer Ordnung und den affektiven Elementen. Die affektiven Komponenten sind in diesem Modell integraler Bestandteil des kognitiven Systems, “because of the clear need in instructional design to have a learning theory that implies that the affective domain is integral to the development of learning environments” (Tennyson & Breuer, 1997, S. 120). So finden unmittelbare Interaktionen zwischen den affektiven und den kog-nitiven Komponenten des Modelles entsprechend ihres Einflusses Berücksichtigung und sollen in der Entwicklung von Lerntheorien und Unterrichtsgestaltung berücksichtigt werden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 6: Interactive cognitiv learning and thinking model (eigene Darstellung in Anlehnung an Tennyson & Breuer, 2002, S. 652)
Die sensorischen Prozesse steuern über die Sinnessysteme die Aufnahme von Informationen aus der Umwelt. Eine Differenzierung zwischen Empfindung und Wahrnehmung zeigt über die Stufen des grundlegenden, unverarbeiteten Empfangens eines Signals und dessen Integration in eine sinnvolle Interpretation den Prozess der Verarbeitung auf (Smith et al., 2007, S. 140). Im Wahrnehmungsprozess stellt die Steuerung der Aufmerksamkeit auf die für die jeweilige Situation bzw. die Aufgabenbewältigung maßgebenden Informationen eine bedeutende Rolle dar (Tennyson & Breuer, 1997, S. 118). Die Wahrnehmung ist nur scheinbar ein passiver Prozess. Vielmehr werden die empfangenden Stimuli aktiv gefiltert. Die Wahrnehmungskapazität ist jedoch nicht unbegrenzt, d. h. in Abhängigkeit der notwendigen Wahrnehmungszentrierung auf eine bestimmte Aufgabe wird die Wahrnehmung weiterer Informationen möglich bzw. eingeschränkt (vgl. Smith et al., 2007, S. 233-235; Spitzer, 2007, S. 142- 146). Die Wahrnehmung muss sogar wie ein Eingangsfilter wirken, damit die Personen nicht dem Bombardement der Reize ihrer Umwelt vollständig ausgesetzt sind, sondern nur die für die jeweilige Aufgabenbewältigung relevanten Informationen aussondern (Smith et al., 2007, S. 195). Im sensorischen Wahrnehmungsprozess wirken im Gehirn bereits präsente Vorinformationen, diese generieren innere Bilder, welche zu 90% des neuen Inputs liefern. Das Gehirn prägt demnach über die innere Vorstellung der äußeren Welt die Wahrnehmung sehr viel stärker als durch neue sensorische Informationen (Hüther, 2004, S. 31). So erklärt sich auch, warum es für das Erinnern notwendig ist, die Aufmerksamkeit im Wahrnehmungsprozess aktivieren zu müssen. Informationen werden nur bewusst wahrgenommen, wenn ihnen Aufmerksamkeit zuteil wird, und nur über diesen Weg kann ein Behalten der Informationen erreicht werden (Spitzer, 2007, S. 146-155).
Die vom Individuum aufgenommenen und verarbeiteten Informationen bilden im Gehirn neuronale Netzwerke und synaptische Verschachtelungen aus, die das im Gedächtnis verankerte Wissen repräsentieren. In der Wissenschaft besteht Einigkeit darüber, dass die Wissensbasis keine Kapazitätsgrenzen besitzt und die Informationen permanent für den Abruf zur Verfügung stehen. Es zeigt sich jedoch, dass dieser Abruf in bestimmten Situationen nicht immer funktioniert und Schwierigkeiten in der Phase der Informationsanwendung bestehen. Das lässt sich darauf zurückführen, dass Wissen domänenspezifisch in komplexen Informationsnetzwerken gespeichert ist. Es können drei Wissensarten mit ihren jeweiligen Inhalts- bzw. Anwendungsrahmen differenziert werden (siehe Abbildung 6). Das Kontextwissen besitzt eine besondere Bedeutung für ein umfassenderes Verständnis des menschlichen Verhaltens, welches notwendig für die Definition pädagogischer Lerntheorie ist, da „contextual knowledge implies an understanding of “knowing why, when, and where“ to employ specific concepts , rules, and principles“ (Tennyson & Breuer, 1997, S. 120, Hervorhebungen im Orginal). Die Entwicklung der neuronalen Netzwerke und synaptischen Verschachtelungen ist abhängig von der Art, Häufigkeit und Intensität ihrer Nutzung. Besonderen Einfluss auf die Nutzung und Weiterentwicklung des verankerten Wissens nehmen die im Rahmen der Informationsverarbeitungsprozesse subjektiv vorgenommenen positiven sowie negativen Bewertungen, welche sich auch als wissenspräsente Erfahrungen bezeichnen lassen. Das verankerte Wissen ist nachhaltiger und wirksamer vernetzt, wenn es Bedeutung für die eigene Lebensbewältigung erlangt hat, indem es besonders erfolgreich oder erfolglos zur Problemlösung beitragen bzw. nicht beitragen konnte und sich dadurch als nützlich bzw. unbrauchbar erwies. Passive Erlebnisse und übernommene Fertigkeiten und Kenntnisse, die keinen Beitrag zur Lebensbewältigung leisteten, sind folglich nicht so nachhaltig im Gedächtnis verankert (Hüther, 2004, S. 25-26). Informationen werden besser behalten, wenn diese durch Aktivierung emotionaler Reaktionen im Lernprozess begleitet werden. Die Gedächtnisleistung steigt unter dem Einfluss von positiven emotionalen Regungen bzw. Grundstimmungen. Angst hingegen behindert den Lernprozess bzw. die Funktionalität des kognitiven Systems (Spitzer, 2007, S. 161-164) (weitere Ausführungen siehe unten).
Die Aktivierung der emotionalen Zentren im Lern- bzw. Informationsverarbeitungsprozess ist wichtig, da diese als Trigger fungieren, indem durch sie die Verarbeitung des Inputs wesentlich tiefgreifender und nachhaltiger erfolgt (Hüther, 2004, S. 26-27). Die emotionalen Zentren werden durch nicht routinemäßige Aufgaben aktiviert, die das emotionale Gleichgewicht stören, d. h. „wenn etwas Neues, Aufregendes und Unerwartetes geschieht, das nicht sofort und routiniert mit den bereits etablierten Denk- und Handlungsmustern bewältigbar ist, und deshalb subjektiv entweder als Bedrohung (Angst, Leid) oder als Glück (Belohnung, Lust) bewertet wird“ (Hüther, 2004, S. 31). Ebenso wird gelernt, wenn ein Handlungsresultat besser als vorhergesehen bzw. vorherberechnet ausfällt. Das Gehirn erhält im Fall einer unerwarteten positiven Erfahrung ein Signal, über welches das Lernen dann erst angeregt wird. Das Signal wird über einen Dopaminausstoß generiert. Das Dopamin führt zu einem Belohnungseffekt, der als „eine Art „Türöffner““ (Spitzer, 2003, S. 180) funktioniert, und die Erfahrung mit dem entsprechenden Wissen wird mit höherer Wahrscheinlichkeit weiterverarbeitet und abgespeichert (Spitzer, 2003, S. 176-181). Durch die Aktivierung des Dopaminsystems erlangt die Erfahrung incl. des damit verbundenen Wissens an Bedeutung. Im schulischen Kontext kann die Aktivierung durch nette Worte und Blicke erfolgen. Die Lehrperson ist im Unterricht das stärkste Medium, welches über die eigene Begeisterung bezüglich des Unterrichtsinhalts diese auf die Schüler überträgt und so deren Belohnungssystem aktiviert (Spitzer, 2003, S. 191-194). Voraussetzung für die Übertragung dieser emotionalen positiven Begeisterung der Lehrkraft auf die Schüler ist eine emotionale positive Beziehung zwischen den Schülern und der Lehrkraft (Hüther, 2004, S. 32-33). „Bindung und Bildung [..] sind untrennbar aneinander gekoppelt und [..] [eine Trennung] führt zwangsläufig dazu, dass beides nicht mehr gelingt“ (Hüther, 2004, S. 33). Gelernt wird durch positive Erfahrungen, und zwar besonders im positiven sozialen Kontext. Positive soziale Interaktionen sind wahrscheinlich die bedeutendsten Verstärker des Lern- bzw. Informationsverarbeitungsprozesses (Spitzer, 2003, S. 181).
Wie im Kapitel 3.1. dargestellt, entstehen Emotionen durch kognitive Bewertungen und können als „wertend-aktivierende Vermittlungsinstanzen zwischen Kognition und Verhalten“ (Hansch, 2005, S. 204) betrachtet werden. In jeder Prozessphase der Informationsverarbeitung wird die lernbegleitende Umgebungssituation kognitiv bewertet zu einem „Bild der gegenwärtigen Lage umgewandelt“ (Beckmann & Heckhausen, 2010, S. 94) und mit den Bedürfnissen abgeglichen. Die Bewertung erfolgt in Interaktion zwischen Person und ihrer Umwelt und führt so zu den emotionalen prozessimmanenten Zuständen (Smith et al., 2009. S, 511).
Diese Emotionen lassen sich nach Hansch (2005, S. 204-211) in primäre und sekundäre unterscheiden. Diese Differenzierung ist für das Verständnis der Interaktionen im Denk- und Informationsprozess von Interesse, weil nicht nur die primären Emotionen (z. B. Angst, Stolz, Interesse, Ärger) als Bewertungsergebnis in emotionalen Schemata abgespeichert und entsprechend in aktuellen Prozessen zur Bewertung herangezogen werden, sondern auch die sekundären Emotionen, als Produkt des Synergitätsbewertungssystems, Einfluss nehmen. Synergität charakterisiert Hansch (2005, S. 208-209) als Begriff, der den Tätigkeitsprozess im Hinblick auf dessen Ausführungsstabilität (je flüssiger und kompetenter eine Tätigkeit ausgeführt wird, desto stabiler ist diese), seiner hierarchischen Integriertheit und Komplexität zusammenfasst, d. h., Tätigkeitselemente werden sukzessiv in Zusammenhang gebracht und integrieren sich zu einem übergeordneten funktionalen Ganzen. Die kritische Sicht, die das kognitive „Vergleichs-Verknüpfungs-Prinzip als zu statisch-mechanisch“ (Hansch, 2005, S. 206) betrachtet, also die Bewertung der Objekt- bzw. Zustandseigenschaften, führte zu einer Prozesseigenschaftsbewertung, die emotionale Stimmigkeits- bzw. Unstimmigkeitsgefühle erzeugt. Diese werden in jedem aktuellen Prozess neu bewertet und nicht als emotionale Schemata abgespeichert. Positive Stimmigkeitsgefühle entstehen, je stabiler die Tätigkeitsprozesse erlebt werden (Harmonieempfinden und Funktionslust – z. B. im Flow-Erleben (Csikszentmihalyi, 2000) und je komplexer und hierarchischer die Integration der Tätigkeitsprozesse ist (Hansch, 2005, S. 208-209). Hansch (2005, S. 211) verwendet als Analogie für die sekundären Emotionen den Ariadnefaden, der den Weg durch das Komplexe bahnt. Sekundäre Emotionen, das Gefühl der Stimmig- oder Unstimmigkeit, leiten das Denken bzw. die Verarbeitung von Informationen zur Entscheidungsfindung. Sie sind das Resultat des Synergitätsbewertungssystems, das „die hierarchisch integrierte Gesamtkomplexität erfasst und die Stabilität aller voll oder latent aktivierten Attraktoren quasi mittelt“ (Hansch, 2005, S. 217-218). Sie nehmen ebenfalls die Vorselektion von Informationen vor und selektieren, ob Informationen festgehalten oder ignoriert werden, und zwar bereits bevor das kognitive System aktiv wurde (Hansch, 2005, S. 219).
Die motivationalen States- und Traitskomponenten spielen auf der Regulationsstufe der Informationsverarbeitung eine sekundäre Rolle, da sie indirekten Einfluss auf den Wissenserwerb nehmen und vorrangig Bedeutung auf der Lernprozessregulationsebene erlangen (Rheinberg & Donkoff, 1993, S. 117) (siehe Kapitel 5). Aus Prozesssicht ist der Informationsverarbeitungsprozess jeder Lernprozessphase zuzuordnen (siehe Abbildung 3). Der Lernprozess bzw. der Verarbeitungsmodus zeigt sich in seiner Qualität in Abhängigkeit von den eingesetzten Lernstrategien, die die kognitive Komponente entwickeln bzw. den Gedächtnisprozess unterstützen. Dieser vollzieht sich in den Phasen der Enkodierung, Speicherung und dem Abrufen von Informationen (Smith et al., 2007, S. 348-349). Straka (2005, S. 391-392) zeigt die bedeutenden Lernstrategien auf, die den kognitiven Prozess unterstützen. Hierzu zählen: Wiederhol-, Elaborations- und Strukturierungsstrategien, die um Lernstrategien zur Verständniskontrolle ergänzt werden. Zusätzlich wird die affektive Komponente des Informationsverarbeitungsprozesses unter Zuhilfenahme einer affektiven Strategie gestützt, welche den affektiven Bereich regulieren soll (z. B. die Aufmerksamkeit steuern, Ängste mindern, für Entspanntheit sorgen) (siehe Kapitel 5.1).
4.2 Interaktionen der Komponenten des selbstregulierten Lernens auf Ebene der Informationsverarbeitung aus struktureller und situativer Sicht
Aus der kognitiven psychologischen Forschung wurde die Modellkonstruktion der Informationsverarbeitung für zahlreiche pädagogische und didaktische Konzepte herangezogen (siehe Kapitel 4.1). Sie gilt als eine der erfolgreichsten Modelle, die sich mit der Wahrnehmung, der Gedächtnisbildung, dem Lernen und der Motivation befassen. Ihre Grundkonzeption geht davon aus, dass ein Lehrender Informationen sendet, diese in das informationsverarbeitende System des Lernenden eindringen, dort entschlüsselt, an Vorwissen angebunden, nach bestimmten Denkregeln verarbeitet und ins Langzeitgedächtnis abgelegt werden, um später abrufbar zu sein. Diese Sicht vermittelt, dass das Lernen optimierbar ist, indem der Prozess der Instruktion, Verarbeitung und Abspeicherung entsprechend gestaltet wird. Die Erkenntnisse der Neuro- und Kognitionsforschung zeigen jedoch auf, dass Wissen nicht übertragbar ist, sondern jeweils vom Lernenden neu geschaffen werden muss. Des Weiteren ist der Prozess im hohen Maß von den Rahmenbedingungen sowie zum Teil nicht bewussten und beeinflussbaren Faktoren abhängig (Roth, 2003, S. 20).
Jedes gesendete Wissen (z. B. sprachlich vermittelt) geht über die Sinnesorgane als Botschaft ins Gehirn ein und wird dort in einer unbewussten Prozedur von der linken (z. B. Aufnahme der syntax- und grammatikabhängigen Wortbedeutungen) wie auch von der rechten (Erfassung der affektiven-emotionalen Sprachanteile) Gehirnhälfte mit dem vorhandenen Wissen abgeglichen. Es werden in diesem Prozess Bedeutungs- und Handlungskontexte zum Wissensinput gebildet. Je bekannter der Kontext ist, desto schneller wird die Bedeutung des neuen Wissens konstruiert. Das neue und unbewusst konstruierte Wissen des Lernenden ist dem des Lehrenden umso ähnlicher, je mehr diese beiden Beteiligten über das gleiche Vorwissen und die gleichen Bedeutungskonstruktionen verfügen (Roth, 2003, S. 21-22).
[...]
[1] Auf europäischer Ebene gelten folgende Definitionen:
„Formales Lernen findet üblicherweise an Einrichtungen der allgemeinen oder beruflichen Bildung statt und weist strukturierte Lernziele, Lernzeiten und Lernförderung auf. Aus Sicht des Lernenden ist es zielgerichtet und führt zur Zertifizierung.
Nicht formales Lernen findet nicht an einer Einrichtung der allgemeinen oder beruflichen Bildung statt und führt üblicherweise nicht zur Zertifizierung. Es ist jedoch intentional aus Sicht des Lernenden und weist strukturierte Lernziele, Lernzeiten und Lernförderung auf.
Informelles Lernen findet im Alltag, am Arbeitsplatz, im Familienkreis oder in der Freizeit statt. Es ist nicht strukturiert und führt normalerweise nicht zur Zertifizierung. Es ist in den meisten Fällen nicht intentional aus Sicht des Lernenden“ (Europäische Kommission, 2010).
[2] In der Literatur wird die Konzeption des Begriffes „selbstreguliertes Lernen“ auch unter verwandten Bezeichnungen diskutiert, z. B. selbstorganisiertes, selbstbestimmtes, selbständiges, selbst-gesteuertes Lernen (vgl. Lang & Pätzold, 2006, S. 11-15; Sembill, 2000, S. 63-65; Rosendahl, 2010, S. 17-18). Im Rahmen dieser Arbeit wird der Begriff des selbstregulierten Lernens gewählt und die weiteren begrifflichen Konfundierungen nicht weiter diskutiert, da dieses nicht Ziel der Ausführungen ist, sondern vielmehr der identische und zum Teil komplementäre Kern der Konzepte betrachtet werden soll.
[3] Der Begriff Selbstbestimmung wird im Rahmen dieser Ausführungen entsprechend der Sicht der Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (1993) verwandt. Folglich bedeutet Selbstbestimmung, dass Prozesse auf Entscheidungen des Selbst (Definition siehe Kapitel 5.1) beruhen, die „nicht von äußeren und inneren Zwängen hervorgerufen werden“ (Deci & Ryan, 1993, S. 223).
[4] Selbstwirksamkeit resultiert aus der subjektiven Gewissheit, dass anstehende Anforderungen auf Basis der eigenen Kompetenz bewältigt werden können (Schwarzer & Jerusalem, 2002, S. 35).
[5] Originalzitate: “[A] general working definition of self-regulated learning is that it is an active, constructive process whereby learners set goals for their learning and then attempt to monitor, regulate, and control their cognition, motivation, and behavior, guided and constrained by their goals and the contextual features in the environment” (Pintrich, 2005, S. 453). “Students are self-regulated to the degree that they are metacognitively, motivationally, and behaviorally active participants in their own learning process” (Zimmermann, 1986 zit. in Zimmermann, 2001, S. 5).
[6] Diese werden z. B. auch als personal characteristics oder auch personale traits-Komponente bezeichnet (vgl. Winther, 2006, S. 5; Pintrich, 2005, S. 453).
[7] In der Literatur beispielsweise auch bezeichnet als contextual characteristics oder state-Komponente (vgl. Winther, 2006, S. 5; Pintrich, 2005, S. 453).
[8] Emotionsverwandte Konstrukte sind (vgl. Trimmel, 2003, S. 48; Smith et al, 2007, S. 509; Ciompi, 2005, S. 48-50):
- Stimmungen, diese dauern langfristiger an und sind schwächer ausgeprägt als Emotionen, desweiteren fehlt ein klarer Bezug zum Auslöser.
- Affekte gelten als heftige und kurzfristige Emotionen.
- Gefühle werden oft als ein Synonym für den Begriff Emotionen verwandt oder auch über den Bewusstseinszustand differenziert, in dem Gefühle als bewusst und Emotionen als unbewusst definiert werden (Dörner, 2004, S. 117-118).
[9] Spitzer (2007, S. 15) schildert den extremen Fall, dass nach der operativen Entfernung der linken kranken Gehirnhälfte eines dreijährigen Kindes, bei diesem im siebten Lebensjahr keine Befunde mehr vorlagen, die auf die Operation schließen ließen. Die rechte Gehirnhälfte hatte die Funktionen der linken Gehirnhälfte übernommen. Hier zeigt sich die enorme Flexibilität und Anpassungs-fähigkeit des menschlichen Gehirns.
[10] Es werden drei grundlegende dispositionale Perspektiven differenziert:
- Universelle Bedürfnisse und Verhaltenstendenzen sind grundlegende physische Bedürfnisse und das Entwickeln und Unterstützen der Motivwirksamkeit.
- Implizite Motive, unter denen sprachlich nicht bewusste, in der frühen Entwicklung entstandene, emotional geprägte habituelle Bereitschaften verstanden werden.
- Explizite Motive sind selbst attribuierte und bewusste Selbstbilder, Ziele und Werte. (vgl. Brunstein, 2010, S. 237-238; Heckhausen & Heckhausen, 2010, S. 3-5)
[11] Persönlichkeitsmerkmale sind grundsätzlich relativ stabil, weil sie sich über die Lebensspanne eher schwerfällig verändern. Sie sind jedoch nicht grundsätzlich unveränderbar und können sich im sozialen Interaktionsprozess durchaus entwickeln (Kuhl, 2010b, S. 337-338).
[12] „Motive sind […] nicht vollständig bewusste, […] kognitiv-emotionale Netzwerke, die aus autobiografischem Erfahrungswissen stammen […] [und im] jeweiligen Kontext angemessene Handlungsoptionen generieren […], sobald das Bedürfnis, das den Kern des jeweiligen Motivs ausmacht, anwächst“ (Kuhl, 2010b, S. 342).
[13] Einen populären Beitrag liefert in diesem Zusammenhang die Bedürfnispyramide nach Maslow, welche eine hierarchische Struktur der Bedürfnisse aufzeigt. Maslow (1999, S. 127-130) bildet Be-dürfnisgruppen, die entsprechend ihrer Hierarchiestufe Motive anregen, und zwar nur, wenn diese unbefriedigt sind und das Handeln aktivieren (Scheffer & Heckhausen, 2010, S. 57-59).
[14] Das Zwei-Schalen-Modell, welches ebenfalls das motivierte selbstgesteuerte Lernen thematisiert, zeigt desgleichen die Bedeutung der kognitiven wie motivationalen Bedingungsfaktoren im Lernprozess auf. In diesem Modell stehen das Vorgehensinteresse und inhaltliche Interesse als motivationale Komponente im Fokus der Lern- und Handlungsmotivation (Straka, Nenninger, Spevacek & Wosnitza, 1996, S. 151).
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2011
- ISBN (eBook)
- 9783842820111
- DOI
- 10.3239/9783842820111
- Dateigröße
- 5.4 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Johannes Gutenberg-Universität Mainz – Wirtschaftspädagogik
- Erscheinungsdatum
- 2011 (September)
- Note
- 1,7
- Schlagworte
- selbstreguliertes lernen lebenslanges design lehr-lern-prozesse kognition motivation
- Produktsicherheit
- Diplom.de