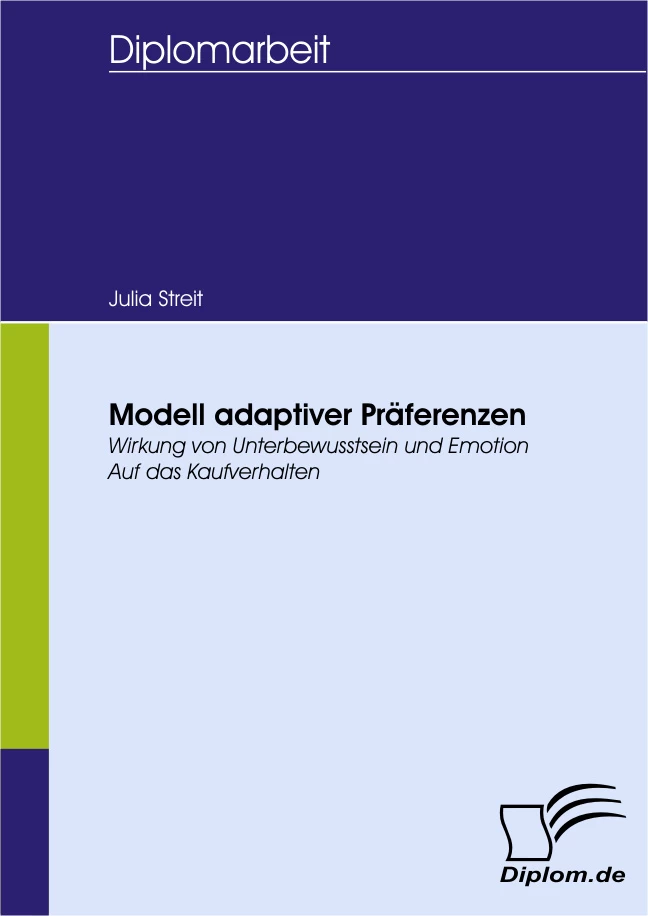Modell adaptiver Präferenzen
Wirkung von Unterbewusstsein und Emotion auf das Kaufverhalten
Zusammenfassung
Unsere einzige Sicherheit liegt in der Fähigkeit, Entscheidungen aus dem Bauch heraus zu treffen (Brad Blanton).
Das Leben besteht aus einer Aneinanderreihung von Entscheidungen. Täglich treffen wir unbemerkt hunderte davon und lernen nebenbei auch noch etwas dazu. Eine große Hilfe ist dabei die enorme Leistungsfähigkeit des Gehirns, das große Mengen an Informationen unbewusst verarbeiten kann. Auch Kaufentscheidungen werden zu großen Teilen unter Ausschluss des Bewusstseins durch Intuition bzw. unser Bauchgefühl getroffen.
Die Vorgänge im Gehirn während der unbewussten Reizverarbeitung werden gerade in den verschiedensten neuronalen Forschungszweigen intensiv untersucht, unter anderem auch durch das Neuromarketing. Dabei sind vor allem unbewusste und emotionale Prozesse immer mehr zu einem Untersuchungsschwerpunkt geworden: Welche Rolle spielen Emotionen bei einer Kaufentscheidung bzw. bei der Produktwahrnehmung? Wie funktioniert Werbung und wie die Markenbindung? In den vergangenen Jahren sind viele (hauptsächlich neuroanatomische) Studien durchgeführt worden, die versuchen Antworten auf diese und ähnliche Fragen zu finden. Sie zeigen, dass sehr viele kognitive Prozesse unbewusst und vor allem durch Emotionen gesteuert werden, darunter selektive Wahrnehmungs- und implizite Lernprozesse. Diese unterschwelligen Leistungen werden innerhalb der wissenschaftlichen Diskussion oft unter dem Konstrukt des adaptive unconscious (dt. adaptives Unterbewusstsein) zusammengefasst. Parallel sind eine ganze Reihe neuer Thesen zum emotionalen Lernen wie die Somatic Marker Hypothesis und zum unbewusst-adaptiven Verhalten entstanden, darunter diverse entscheidungsrelevante Phänomene wie Priming und die Affektheuristik. Allerdings existiert bisher kein übergreifend erklärendes Modell für diese Einzelthesen.
Das Ziel dieser Arbeit ist es daher, die wesentlichen Ergebnisse der Neurowissenschaften sowie die aktuellen Thesen der einzelnen Forschungszweige der Sozial-, Motivationsforschung und der Verhaltenspsychologie zu einer übergreifenden Theorie der unbewussten Steuerung von Kaufentscheidungsprozessen zusammenfassend darzustellen. Damit soll eine Brücke zwischen den einzelnen Disziplinen geschlagen werden, die zugleich eine Argumentationsgrundlage für die Einflüsse des adaptiven Unterbewusstseins und der nicht strategischen Informationsverarbeitung auf unbewusstes Konsumverhalten schafft. Das dafür eingeführte Modell […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Anhangsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Zentrale Begriffe und Konstrukte des Modells adaptiver Präferenzen
2.1 Aufmerksamkeitsausrichtende Hinweisreize zur Reizselektion
2.2 Bewusstsein und Unterbewusstsein als ineinandergreifender Prozess
2.3 Emotionen, ihre Funktion und Gefühle
2.4 Abgrenzung der Konstrukte Motiv, Präferenz und Einstellung
3 Basistheorien zur intuitiven Verhaltenssteuerung
3.1 Duale Prozesse während der Informationsverarbeitung
3.2 Geheimnis der Intuition: Damasio’s Somatische Marker und die Affektheuristik
3.3 Neuronale Prozesse und das limbische System
3.3.1 Neuronale Informationsverarbeitung
3.3.2 Aufbau und Funktionsweise des limbischen Systems
3.4 Adaptives Unterbewusstsein und Implizites Lernen von Mustern
4 Das Modell adaptiver Präferenzen
4.1 Was sind adaptive Präferenzen?
4.2 ‚Aktive Motive’ versus ‚adaptive Präferenzen’
4.3 Prozess zur Entwicklung von Produktpräferenzen
4.4 Ableitung und Erklärung des Modells adaptiver Präferenz (MAP)
4.4.1 Umwelt und adaptive Präferenz
4.4.2 Persönlicher Kontext adaptiver Kaufentscheidungen
4.5 Einfluss adaptiver Präferenzen auf das Käuferverhalten
5 Ergebnisse und Diskussion
6 Zusammenfassung
7 Verwendete Literatur
8 Anhang
Anlage 1 Entstehung von Emotionen
Anlage 2 Übersicht Bezeichnungen dualer Systeme
Anlage 3 Übersicht zum Aufbau des ‚limbischen Systems’
Anlage 4 Areale des ‚limbischen Systems’ und ihre Funktion
Anlage 5 Ehrenwörtliche Erklärung & Einverständniserklärung
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Funktionen von Emotion, in Anlehnung an Scherer 1987, S. 5, Damasio 2000, S. 53f., Peters 2006, S. 80f
Abb. 2: Zwei-System-Modell nach Kahneman (vgl. Kahneman 2002a, S. 451)
Abb. 3: Verschiedene 'processing'-Varianten entsprechend ihrer Automatizität und ihrer Ressourcenintensität, eigene Darstellung (J. Streit 2011)
Abb. 4: Duale Wege sensorischer Informationen zur Amygdala (LeDoux/Phelps 2000, S. 160)
Abb. 5 : Analogie von Wahrnehmung und intuitivem Denken als Vorstufe logischen Denkens (Kahneman 2002b, Nobel Prize Lecture)
Abb. 6: Modell adaptiver Präferenzen, eigene Darstellung
Tabellenverzeichnis
Tab. 1: Bewusstseinszustände nach Roth (vgl. Roth 2003, S. 197)
Anhangsverzeichnis
Anlage 1: Entstehung von Emotionen, eigene Darstellung (J. Streit 2011)
Anlage 2: Bezeichnungen ‚Dualer Systeme' (in Anlehnung an Evans 2008a, o. S.)
Anlage 3: Darstellung des limbischen Systems (in Anlehnung an o. V. 2007: ‚The neurobilogy of fear’, elektronisch veröffentlicht unter: http://scienceblogs.com/neurophilosophy/2007/10/the_neurobiology_of_fear.php, vom 30.04.2011)
Anlage 4: Areale des limbischen Systems und ihre Funktion
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Einleitung
Unsere einzige Sicherheit liegt in der Fähigkeit, Entscheidungen aus dem Bauch heraus zu treffen.
(Brad Blanton)
Das Leben besteht aus einer Aneinanderreihung von Entscheidungen. Täglich treffen wir unbemerkt hunderte davon und lernen nebenbei auch noch etwas dazu. Eine große Hilfe ist dabei die enorme Leistungsfähigkeit des Gehirns, das große Mengen an Informationen unbewusst verarbeiten kann. Auch Kaufentscheidungen werden zu großen Teilen unter Ausschluss des Bewusstseins durch Intuition bzw. unser Bauchgefühl getroffen.
Die Vorgänge im Gehirn während der unbewussten Reizverarbeitung werden gerade in den verschiedensten neuronalen Forschungszweigen intensiv untersucht, unter anderem auch durch das Neuromarketing. Dabei sind vor allem unbewusste und emotionale Prozesse immer mehr zu einem Untersuchungsschwerpunkt geworden: Welche Rolle spielen Emotionen bei einer Kaufentscheidung bzw. bei der Produktwahrnehmung? Wie funktioniert Werbung und wie die Markenbindung? In den vergangenen Jahren sind viele (hauptsächlich neuroanatomische) Studien durchgeführt worden, die versuchen Antworten auf diese und ähnliche Fragen zu finden. Sie zeigen, dass sehr viele kognitive Prozesse unbewusst und vor allem durch Emotionen gesteuert werden, darunter selektive Wahrnehmungs- und implizite Lernprozesse. Diese unterschwelligen Leistungen werden innerhalb der wissenschaftlichen Diskussion oft unter dem Konstrukt des ‚adaptive unconscious’ (dt. ‚adaptives Unterbewusstsein’) zusammengefasst. Parallel sind eine ganze Reihe neuer Thesen zum emotionalen Lernen wie die ‚Somatic Marker Hypothesis’ und zum unbewusst-adaptiven Verhalten entstanden, darunter diverse entscheidungsrelevante Phänomene wie ‚Priming’ und die ‚Affektheuristik’. Allerdings existiert bisher kein übergreifend erklärendes Modell für diese Einzelthesen.
Das Ziel dieser Arbeit ist es daher, die wesentlichen Ergebnisse der Neurowissenschaften sowie die aktuellen Thesen der einzelnen Forschungszweige der Sozial-, Motivationsforschung und der Verhaltenspsychologie zu einer übergreifenden Theorie der unbewussten Steuerung von Kaufentscheidungsprozessen zusammenfassend darzustellen. Damit soll eine Brücke zwischen den einzelnen Disziplinen geschlagen werden, die zugleich eine Argumentationsgrundlage für die Einflüsse des adaptiven Unterbewusstseins und der nicht strategischen Informationsverarbeitung auf unbewusstes Konsumverhalten schafft. Das dafür eingeführte ‚Modell adaptiver Präferenzen’ (MAP ) ist damit das erste Modell, das versucht, adaptives Unterbewusstsein und Präferenzurteile in einem einzigen Modell zusammen zu bringen, und erstellt eine neue Hypothese zur intuitiven Meinungsbildung und Verhaltenssteuerung. Hintergrund des Modells war es, dass Konsumenten im Alltag unbewusst oft simple, jedoch äußerst effektive Strategien zur optimalen Informationsnutzung verfolgen, die darauf ausgerichtet sind, auch unter suboptimalen Bedingungen (Zeitmangel, Unsicherheit) möglichst vorteilhafte Entscheidungen zu treffen. Eine zentrale Frage konnte dabei bis heute noch nicht vollständig geklärt werden: Wann und wodurch entscheidet sich, welche Informationen entscheidungsrelevante Kriterien darstellen und welche nicht? Dieser Frage versucht sich das MAP anzunähern.
Zunächst wird eine Argumentationsgrundlage geschaffen, indem wichtige Konstrukte definiert, ihre Funktion und Bedeutung erklärt und voneinander abgegrenzt werden, darunter der für das MAP wichtige ‚Präferenz-’ sowie der ‚Emotionsbegriff’. Außerdem soll die besondere Rolle des Unterbewusstseins für unser Denken und Handeln deutlich werden, das im Verhältnis zu den bewusst-kognitiven Prozessen bisher wenig theoretisch betrachtet wurde, welches jedoch ebenfalls großen Einfluss auf das Käuferverhalten hat (Kap. 2). Überleitend zum neuen Modell, werden daran anschließend grundsätzliche Basistheorien unbewusst-adaptiven Verhaltens vorgestellt, darunter Damasio’s ‚Somatic Marker Theory’ und der ‚adaptive unconscious’-Ansatz, auf denen das MAP aufbaut (Kap. 3). Daran anschließend folgt eine umfassende Erklärung des neuen Modellansatzes sowie des modellspezifischen Konstrukts ‚adaptiver Präferenzen’ (Kap. 4). Abschließend werden dann wichtige Ergebnisse sowie die Stärken und Schwächen des Modells zusammenfassend diskutiert (Kap. 5).
2 Zentrale Begriffe und Konstrukte des Modells adaptiver Präferenzen
Einführend in die Thematik sollen an dieser Stelle kurz einige Entscheidungen zur Definition wichtiger Begriffe und Konstrukte getroffen werden. Zusätzlich wird die Bedeutung der jeweiligen Konstrukte für die Informationsaufnahme und -verarbeitung diskutiert. Anschließend werden in Kapitel 3 wichtige Basistheorien und aktuell diskutierte, neurowissenschaftliche Erklärungsansätze zu den Vorgängen im menschlichen Gehirn während der Informationsverarbeitung vorgestellt, die zur Erklärung konsumenten- und situationsspezifischer Präferenzen herangezogen werden können. Sie bilden die spätere Argumentationsgrundlage für das ‚Modell adaptiver Präferenzen’.
2.1 Aufmerksamkeitsausrichtende Hinweisreize zur Reizselektion
Jede Form der Informationsverarbeitung (engl. ‚processing’) und daraus abgeleitete Handlungsentscheidungen beginnen mit der Wahrnehmung und Aufnahme von Informationen. Während der Wahrnehmung treten Teile aufgenommener Informationen gegenüber anderen Stimuli in den Vordergrund und lösen Aufmerksamkeitsfokus aus. Diese Teile aufgenommener Information werden ‚cues’, dt. ‚aufmerksamkeitsausrichtende Hinweisreize’, genannt. ‚Aufmerksamkeitsfokus’ liegt vor, wenn zumindest kurzzeitig Teile der sensorischen Wahrnehmung auf einzelne, ausgewählte Facetten innerhalb der Umwelt bzw. des Wahrnehmungsraumes gerichtet sind (vgl. Grunert 1996, S. 90). Die cues und der Aufmerksamkeitsfokus dienen der selektiven Wahrnehmung (vgl. Bernays/Wcislo 1994, S. 188ff.) und ermöglichen dem Organismus konsistentes, d. h. an die jeweilige Situation angepasstes und reaktivierbares Reiz-Reaktions-Verhalten. Cues ermöglichen uns damit intuitives Lernen und das Abrufen relevanter Informationen (vgl. Tulving/Thompson 1973, S. 365; Jacoby/Brooks 1984, S.2). Auf diese Weise können wir schnell auf Schlüsselereignisse unserer Umgebung reagieren und in ähnlichen Situationen wieder reaktivieren. Die Reizerkennung und die ‚Reiz-Reaktion’ laufen dabei vollkommen automatisiert ab und sind je nach neuronalem Entwicklungsstand entweder angeboren, z. B. Saugreflex (vgl. dazu die ‚Instinkttheorie’ nach Lorenz 1937, S. 299ff.; auch Roth 2003, S. 27, 53ff.) – oder erlernt, z. B. durch Konditionierung, Erziehung oder Einsicht (vgl. Roth 2003, S. 26ff., 93; Galliker 2009, S. 139ff.).
Die Abläufe im Gehirn während der Wahrnehmung und während der Reizselektion wurden bereits umfassend untersucht (v. a. Michotte 1963, o. S.; Leslie 1982, S.173ff.; Choi/Scholl 2006 S. 107f., Scholl/Nakayama 2002, S. 493ff.; Newman et al. 2008, S. 262ff.). Der Wahrnehmungsprozess stellt sich demnach als äußerst komplex dar. Es wird davon ausgegangen, dass während der Wahrnehmung Reaktionspfade sowohl ‚bottom-up’, d. h. durch exogene Reize, als auch ‚top-down’, d. h. durch endogene Reize in Form innerer Motiv- und Präferenzstrukturen, verlaufen (vgl. v. a. Dijksterhuis/Nordgren 2006, S. 97; Koch/Tsuchiya 2006, S. 16ff.; auch Lamme/Spekreijse 2000, S. 238; Brunsø 2002, S. 29). Externe Hinweisreize sind die einzelnen Facetten eines wahrgenommenen Objektes[1] (z. B. Farbe, Form, Bewegungsrichtung), deren Wahrnehmung mit unterschiedlich starken Assoziationen verbundenen sind. Mitbestimmend für den Aufmerksamkeitsfokus sind also äußere und innere Reize. In einer Art Rückkopplungsprozess wird die Aufmerksamkeit flüchtig auf die jeweilige Reizquelle gerichtet – unabhängig von den aktuell ablaufenden Prozessen (vgl. Koch/Tsuchiya 2006, S. 16).
Etablierte Reizstrukturen (vorhandene Muster), also Reize die bereits innerhalb einer bestimmten Umgebung erlernt wurden, können in einer ähnlichen Reizsituation automatisch reaktiviert werden (vgl. Logan 1988, S. 493). Man spricht dann von sog. ‚retrieval cues’ (RCs) bzw. ‚Hinweisreize zur Wiedergabe’ (Alba/Hutchinson 1987, S. 417; Raab et al. 2009, S. 136). RCs ermöglichen ein schnelles Abrufen situationsspezifischer Informationen in Form von ‚Wiedererkennen’ und ‚Wiedergabe’. Auch RCs wurden bereits in mehreren Studien untersucht (vgl. Tulving/Thompson 1973, S. 352ff.; Srull 1983, S. 1157ff.; Logan 1988, S. 492ff.; Demb et al. 1995, S. 5870ff.). Die Untersuchung der RCs hat auch zu einem besseren Verständnis der Funktionsweise des Gedächtnisses beigetragen. Während der visuellen Reizaufnahme werden offenbar bestimmte Hirnareale aktiviert, die dann zu einer ‚Gedächtnisspur’ für ein bestimmtes Erlebnis werden. Erfahrungen bilden demnach die neuronale Basis für die spätere Reizerkennung (vgl. Tulving/Thompson 1973, S. 370). Die Zugänglichkeit (‚accessibility’) eines RC’s hängt v. a. von den Bedingungen während des Codierens ab, besonders von der Reizintensität und dem assoziativen Kontext während der Reizaufnahme. Je reichhaltiger der assoziative Kontext während der Reizaufnahme ist, desto größer das neuronale Muster, in dem der cue gespeichert wird und desto größer die ‚accessibility’ (vgl. Tulving/Pearlstone 1966, S. 381f.).
Zusammenfassend sollen (retrieval) cues hier allgemein als exogene und endogene Reizstrukturen definiert werden, die über ein bestimmtes Maß hinausgehende Aktivierungssignale auslösen und so weitere Informationsverarbeitungsprozesse in Gang setzen.
2.2 Bewusstsein und Unterbewusstsein als ineinandergreifender Prozess
Der Begriff des Bewusstseins wurde bereits ausgiebig in Philosophie, Psychologie und Neurologie diskutiert. Jedoch existiert bis heute keine allgemein anerkannte Definition, da es sich beim Bewusstseinsbegriff um ein schwer greifbares gedankliches Konstrukt handelt, welches weder vollständig beschreibbar, noch durch Messung bisher eindeutig nachzuweisen war (vgl. Myers 2005, S. 280). Eine gute Definition stammt von Dijksterhuis und Nordgren, nach denen Bewusstsein „object-relevant or task-relevant cognitive or affective thought processes that occur while the object or task is the focus of one’s conscious attention“ (Dijksterhuis/Nordgren 2006, S. 96; Herv. d. Verf.) umfasst. Bewusstsein ist demzufolge ein kognitiver oder affektiver Denkprozess, der die Aufmerksamkeit auf ein Objekt oder eine Aufgabe ausrichtet. Diese Definition ist eine gute Basis für weitere Betrachtungen. Oft wird ‚Bewusstsein’ als Oberbegriff verschiedener Zustände gesehen. Roth unterscheidet bspw. acht solcher Bewusstseinszustände (vgl. Tab. 1).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Bewusstseinszustände 1-3 nennt Roth das ‚Aktualbewusstsein’, 4-8 fasst er als ‚Hintergrundbewusstsein’ zusammen. Roth’s Bewusstseinszustände geben Einblick in die Vielseitigkeit des Bewusstseins, sie sind jedoch nicht frei von Überlappung und können fließend ins Unbewusste übergehen. So können die ‚Verortung des Selbst’ (7.) oder die Wahrnehmung von Vorgängen in Körper und Umwelt (1.) bspw. auch als vollkommen unbewusste Prozesse ablaufen. Außerdem steht das Gefühl der (5.) ‚Meinigkeit’ des eigenen Körpers in sehr engem Zusammenhang sowohl mit der eigenen Emotions- und Handlungskontrolle (6.) als auch mit dem Erleben der eigenen Identität (4.). Abschließend stellt Roth fest: „Es gibt nicht das Bewusstsein schlechthin, sondern eine Vielzahl von verschiedenen Bewusstseinszuständen, die eben nur die beiden Merkmale gemein haben, dass sie bewusst erlebt und sprachlich berichtet werden können“ (Roth 2003, S. 198; Herv. d. Verf.). Bewusstseinszustände sind also lediglich als Momentaufnahmen dynamischer Prozesse anzusehen, die fließend ineinander (und in das Unterbewusste) übergehen.
Grundsätzlich wird zwischen gewollt-bewussten Prozessen und phänomenabhängigen, (ungewollt-)bewussten Prozessen unterschieden (vgl. Moors/De Houwer 2006, S. 311). Phänomenabhängiges Bewusstsein basiert auf vorangegangenen unbewussten Prozessen, z. B. wenn wir an einem vertrauten Ort ein neues Gesicht sehen, ein lautes Geräusch hören oder wenn wir uns automatisch umdrehen, weil in einer Unterhaltung unser Name fällt. Viele Kognitionstheorien, die phänomenabhängiges (d. h. unbeabsichtigtes) Bewusstsein untersuchen, basieren auf der Annahme, Bewusstsein entstehe aus dem komplexen Zusammenwirken mehrerer Systeme, die über ein sog. ‚Global Workspace’ miteinander interagieren und so die verschiedenen Bewusstseinszustände herstellen (s. dazu Baars 1997, S. 292ff.; 2005, S. 46ff.; Sergent/Dehaene 2004, S. 374ff.). Tatsächlich ist Bewusstsein stark modular aufgebaut, da für dessen Entstehung eine Vielzahl subkortikaler Gehirnregionen über ‚feedforward’-Verbindungen (dt. ‚Vorwärtskopplungsverbindungen’) interagieren müssen (vgl. Lamme/Spekreijse 2000, S. 232f.; Mulckhuyse/Theeuwes 2010, S. 307; Lamme 2003, S. 12; 2006, S. 495). Diese haben gemein, dass sie alle in die Großhirnrinde münden (vgl. Roth 2003, S. 212ff.). Darüber hinaus ist Bewusstsein stark selektiv. Über den Verlauf mehrerer Verarbeitungsstufen (Instanzen) erreicht lediglich ein sehr viel kleinerer Teil des Inputs das Bewusstsein (vgl. u. a. Miller 1967, S. 175ff.; Lamme 2003, S. 16; Dijksterhuis/Nordgren 2006, S. 96). Ausschlaggebend für das bewusste ‚processing’ sind Reize bzw. Reizkombinationen, die einerseits eine ausreichende Reizeinwirkung, d. h. die (1) hinreichend neu, (2) hinreichend komplex und/oder (3) hinreichend relevant sind, und anderseits eine gewisse Dauerhaftigkeit aufweisen (vgl. Moors/De Houwer 2006, S. 313; Roth 2003, S. 219; Raab 2009, S. 160; s. Kap. 4.3.1). ‚Hinreichend neu’ bedeutet, dass für eine bestimmte Reizkombination kein eindeutiger Deutungszusammenhang im Gedächtnis gefunden werden kann, der die Wahrnehmung erklären könnte. ‚Hinreichend komplex’ sind Reize, für die Ressourcen unbewusster Verarbeitung nicht mehr ausreichen. In den meisten Fällen bildet jedoch Relevanz die finale Bedingung für Bewusstsein. Dafür wird Input laufend auf seine Intensität und Wichtigkeit überprüft. Damit Reize jedoch als relevant bzw. bewusst wahrgenommen werden können, muss zu deren Beurteilung ein Vergleichsmaß vorhanden sein. Insgesamt ist also davon auszugehen, dass neue Stimuli zunächst mit den vorhandenen Informationen (Erfahrungswissen) in irgendeiner Form verglichen werden (vgl. Tulving 1996, S. 75). Unter Bewusstsein wird hier daher ein dynamischer, aus dem Unterbewusstsein aufsteigender Denkprozess verstanden, der – durch Überschreiten einer gewissen Reizschwelle exogen oder endogen ausgelöst – für die individuelle Ausrichtung der Aufmerksamkeit auf Objekte, Emotionen, Gedanken und Verhalten, verantwortlich ist.
Bewusstsein ist ohne unbewusste Informationsverarbeitung jedoch nicht möglich (vgl. u. a. Debner/Jacoby 1994, S. 315). Reize werden fast ausschließlich subliminal, d. h. unterhalb der Bewusstseinsschwelle, verarbeitet (vgl. u. a. Lewicki et al. 1987, S. 523ff; Grunert 1996, S. 88ff.; Hofmann et al. 2010, S. 2). Das Unbewusste ermöglicht es, schwache Reize ressourcensparend zu verarbeiten und adaptiv auf diese zu reagieren (vgl. Bargh/Morsella 2008, S. 74). Unbewusste Reizverarbeitung ist demnach naturgemäß die Regel und nicht die Ausnahme (ebd. S. 78). Im Unterbewusstsein werden nach Meinung von Bargh und Morsella Informationen ungewollt, ohne Aufmerksamkeit und ohne Kenntnis der durch die Auslösereize ausgelösten Effekte verarbeitet: „Unconscious processes are defined in terms of their unintentional nature and the inherent lack of awareness is of the influence and effect of the triggering stimuli and not of the triggering stimuli (...)“ (ebd.; Herv. d. Verf.). Dieser Definition von Unterbewusstsein ist ergänzend hinzuzufügen, dass sowohl bewusste als auch unbewusste Kognitionen ungewollt bzw. unkontrolliert auftreten können. Über unbewusste Vorgänge kann zudem im Nachhinein nicht berichtet werden (vgl. Roth 2003, S. 226).
Wie Bewusstsein und Unterbewusstsein in einander übergehen wurde bis heute nicht vollständig geklärt (s. dazu Moors/De Houwer 2006, S. 299). Hier wird der Sicht Hofmann’s und Wilson’s gefolgt, denen zufolge der Übergang unbewusster zu bewussten Prozessen als fließend angenommen wird (vgl. Hofmann/Wilson 2010, S. 1), wobei das Erreichen der Bewusstseinsschwelle von einer Reihe von Faktoren, v. a. von den Eigenschaften des Reizes, des Empfängers und des Situationskontextes, bestimmt wird (vgl. dazu LeDoux/Phelps 2000, S. 160f. und Bargh/Morsella 2008, S. 76; sowie Kap. 3.1 u. 3.4). Im Folgenden werden v. a. unbewusste Verarbeitungsvorgänge und deren Bedeutung für die intuitive Verhaltenssteuerung einen Schwerpunkt bilden.
2.3 Emotionen, ihre Funktion und Gefühle
Die Begriffe ‚Emotion’ und ‚Gefühl’ werden oft synonym verwendet. Innerhalb der verschiedenen neurowissenschaftlichen Disziplinen wird der Emotionsbegriff jedoch sehr viel weiter gefasst (vgl. LeDoux/Phelps 2000, S.157). Unser Verständnis von den Emotionen hat sich seit Beginn ihrer Erforschung stark gewandelt. Zunächst wurden sie lediglich als ein ‚färbender’ Einflussfaktor auf das rationale Denken gesehen, der zu irrationalen Entscheidungen führen kann (u. a. Epstein 194, S. 709; Pham et al. 2001,
S. 186). Heute weiß man, dass Emotionen eine zentrale Rolle bei der kognitiven Informationsverarbeitung (‚cognitive processing’) spielen bzw. diese erst ermöglichen (vgl. Damasio 2000, S.41). Mit der zunehmenden Relevanz der Emotions- und der Motivationsforschung entstand eine Vielzahl an Definitionen für den Begriff der Emotion. Eine verhältnismäßig kurze Definition kommt von Galliker: „Emotion ist die umfassende Bezeichnung für den inneren Aspekt des Erlebens“ (Galliker 2009, S.16; Herv. d. Verf.). Hinter dieser knappen Definition verbirgt sich jedoch eine große Komplexität, denn Emotionen sind im Organismus an einer Reihe von Aufgaben beteiligt, sei es beim Erleben innerer Erregungszustände, als motivativ eingreifendes Element während der bewussten Verhaltenssteuerung (vgl. Roth 2003, S.291) oder innerhalb von Austauschprozessen nonverbaler Kommunikation. So schreiben Purves et al.: " The word ‘emotion’ covers a wide range of states that have in common the association of visceral motor responses, somatic behavior, and powerful subjective feeling" (Purves et al. 2004, S. 708; Herv. d. Verf.; vgl. auch Scherer 1987, S. 5).
Die Emotions- und Bewusstseinsforschung wurde neben anderen v. a. von Damasio und seiner Frau Hanna vorangebracht. In ‚The Feeling of What Happens’ beschreibt
Damasio die Entstehung von Emotion als ein Aktivierungsmuster bestimmter emotionaler Strukturen im Gehirn, die aufgrund von Auslösereizen in Gang gesetzt werden (vgl. Damasio 2000, S. 50ff.). Die jeweiligen Aktivierungsschlaufen werden dann in ihrer Gesamtheit vom Organismus als Gefühl interpretiert, wodurch automatisch ‚innere Bilder’ entstehen (vgl. ebd., S. 79, 280). In einer Reihe von Experimenten konnten solche Aktivierungsmuster mithilfe von emotionsgeladenen Bildern identifiziert werden (vgl. z. B. Holland/Gallagher 1999, S. 65ff.; Damasio et al. 2000, S. 1049ff.; Phan et al. 2004; S. 264; Immordino-Yang et al. 2009, S. 8024). Emotionen lassen sich demnach anhand distinkter Gehirnareale bestimmen (vgl. Damasio 2000, S.61).
Eine weitere rein quantitative Definition von Emotion stammt vom Neurologen und Emotionsforscher Rolls. Er betont v. a. die Bewertungsfunktion und sieht Emotionen als „Zustände, die durch instrumentelle Verstärker in Form von Belohung und Bestrafung ausgelöst werden“: „emotions are states elicited by rewards and punishers, that is, by instrumental reinforcers“ (Rolls 2005, S.11; Herv. d. Verf.). Emotionen wären demnach ein Bewertungsmaß für äußere und innere Ereignisse. Tooby und Cosmides greifen den Vergleich von Emotionen mit einer einheitlichen Währung auf und nennen Emotion eine „Wette auf einen bestimmten Situationsausgang“ (vgl. Tooby/Cosmides 2008, S. 117). Emotionen spiegeln also unsere Erwartungen in Bezug auf das Ergebnis einer objekt- oder ereignisgerichteten Handlung wieder, um Folgen des Handelns bereits vor der Durchführung abwägen zu können (vgl. auch Rolls 2006, S. 4). Emotionen liefern demzufolge auch das für das ‚cognitive processing’ notwendige Bewertungsmaß (vgl. Damasio 2000, S. 273; Peters 2006, S. 80; s. dazu auch Roth 2003, S. 216), denn „Objects cannot exist for us before sensory experience has become imbued with meaning“ (Köhler, W. 1930, S. 54f.; Herv. d. Verf.). Köhler meint damit, dass wir Objekte als solche nicht unterscheiden könnten, wenn Wahrnehmungsinhalte nicht in einen Bedeutungszusammenhang bzw. in einen subjektiv-interpretativen Kontext gesetzt würden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bei Problemlösungsaufgaben können mithilfe der Emotionen verschiedene Handlungsalternativen intuitiv verglichen (vgl. Zajonc 1980, S. 152; Slovic et al. 2007, S. 1333; Stefanides 2010, IV, S.4) und jeweilige Handlungsausgänge in einer Art Prä-Simulation als positiv oder negativ erwogen werden (vgl. Peters et al. 2006, S. 79; Bargh/Morsella 2006, S. 77).
Neben der oben beschriebenen ‚Währungsgebenden Funktion’, übernehmen Emotionen noch weitere Funktionen, die in Abb. 1 zusammengefasst werden. Die ‚Währungsgebende Funktion’ bedingt im Organismus auch noch drei weitere Funktionen: So entsteht über die affektiv signalisierte Belohnungserwartung eine Art ‚Scheinwerferfunktion’ für den Aufmerksamkeitsfokus, der den Blick auf besonders relevante cues ausrichtet (vgl. Bechara et al. 1998, S. 436; Bijleveld et al. 2009, S. 2). Außerdem übernehmen im Organismus angelegte, emotionale Evaluationssysteme das ‚Monitoring und die Regulierung innerer Zustände’, zu denen auch die Vorbereitung motorischer Bewegungsabläufe gezählt werden. Schließlich ermöglicht Emotion die Aktivierung der individuellen Motive und Präferenzen und helfen so bei der Priorisierung von Verhalten (vgl. auch Kable/Glimcher 2009, S. 733f.; Peters et al. 2006, S. 80f.). Scherer beschreibt Emotion wegen seiner Vielschichtigkeit als „einen sich ständig und dynamisch entwickelnden, phylogenetischen Anpassungsmechanismus“ (vgl. Scherer 1987, S. 3; Herv. d. Verf.).
Damasio unterscheidet drei grundsätzliche Emotionsarten: primäre Emotionen wie Angst, Lust, Wut etc., sekundäre, d. h. durch Lernen erworbene Emotionen wie Scham, Stolz, Neid und als letztes ‚Hintergrundemotionen’. Mit Hintergrundemotionen sind v. a. Stimmungen gemeint (vgl. Damasio 2000, S. 50; vgl. auch McCauley/Franklin 1998, S. 126; Schmidt/Schaible 2005, S. 424).
Primäre Emotionen (auch Basisemotionen genannt) sind eng mit den angeboren Instinkten und Trieben des Organismus verbunden (s. Anlage 1). Der Ursprung von Instinkten ist jedoch umstritten. Sekundäre Emotionen entstehen dagegen nur in Zusammenhang mit persönlichen Erfahrungen und mit ‚cognitive processing’ und ermöglichen komplexes, alternatives Reaktionsverhalten. Bisher wird angenommen, dass sekundäre Emotionen aus dem Zusammenspiel einzelner basisemotionaler Reaktionen mit der Wahrnehmung bestimmter Auslösereize entstehen. Eifersucht bspw. ist eine komplexe Emotion, die ein ganzes Orchester emotionaler Empfindungen auslösen kann, darunter Liebe, Angst und Wut (vgl. Anlage 1). Komplexe Emotionen sind zudem sehr stark sozio-kulturell geprägt und werden subjektiv sehr unterschiedlich erlebt. Dies lässt darauf schließen, dass es ein umfassendes emotionales Gedächtnis geben muss, welches angepasst an die jeweilige Situation die gelernten emotionalen Reaktionen auslöst (vgl. Roth 2003, S. 157; Tooby/Cosmides 2008, S. 115ff.). Emotionen sollen hier abschließend als vorrationale Bewertungs- und Steuerungsmechanismen definiert werden, die zur Anpassung an einen veränderten, situativen Kontext somatische Reaktionen hervorrufen und so Intuition ermöglichen. Werden Emotionen bzw. ihre somatischen Reaktionen auf Ebene des Subjekts endogen interpretiert, spricht man von Gefühlen.
Emotionen spielen, wie oben gezeigt, für die Informationsaufnahme und -speicherung eine entscheidende Rolle. Daher sind sie auch für die Entstehung von Motiven, Präferenzen und Einstellungen mitverantwortlich (vgl. Raab et al. 2009, S. 245; Slovic 2007, S. 1336), deren Konstrukte nun vorgestellt werden.
2.4 Abgrenzung der Konstrukte Motiv, Präferenz und Einstellung
Handlungsweisende Informationen werden oft sinngleich als ‚Motiv’, ‚Präferenz’ oder ‚Einstellung’ bezeichnet. Für die spätere Ableitung des ‚Modells adaptiver Präferenzen’ ist es jedoch wichtig, die drei Begriffe abgrenzend zu definieren.
Praktisch jedes Verhalten kann durch Motive begründet werden. Motive fassen eine Vielzahl subordinierter Begriffe wie Ziele, Bedürfnisse, Interessen, Präferenzen und Emotionen unter sich zusammen (vgl. Scherer 1987, S. 44). Nach Galliker sind Motive „Beweggründe, die das menschliche Handeln hinsichtlich Inhalt, Richtung und Intensität beeinflussen“ (Galliker 2009, S. 16; Herv. d. Verf.). Hornung und Lächler kommen zu einem ähnlichen Schluss. Motive sind ihrer Meinung nach eine „Überdauernde Handlungsbereitschaft oder die einem bestimmten Verhalten zugrunde liegenden physiologischen und psychologischen Ursachen und Beweggründe“ (Hornung/Lächler 2005, S. 87; Herv. d. Verf.). Aus den Motiven ziehen wir also den Willen, Handlungen zu beginnen und diese zu beenden. Motive beinhalten eine aktivierende Komponente (durch positive oder negative Anreize) und eine lenkende Komponente, die das Verhalten in Abhängigkeit eines situativen Kontextes beeinflusst (vgl. ebd.; Scheier/Held 2006, S.105).
Eine Reihe von Autoren hat versucht, auf hohem Abstraktionsniveau eine vollständige Auflistung innerer Antriebskräfte bzw. Grundmotive von Lebewesen aufzustellen. Das ‚Zürcher Modell der sozialen Motivation’ von Norbert Bischof fand besondere Anerkennung und soll hier kurz erwähnt werden. Es integriert Erkenntnisse der Hirn- und Verhaltensforschung, der Evolutionsforschung sowie der Entwicklungs- und Motivationsforschung und nennt auf einem sehr hohen Abstraktionsniveau zusammenfassend drei Grundmotive, die innerhalb eines Regelkreises eng miteinander verknüpft sind: Das Sicherheitsmotiv, das Autonomiemotiv und das Erregungsmotiv (s. Anlage 1; für einen umfassenden Überblick s. Bischof-Köhler 2000, S. 145ff.; Bischof 2009, S. 438ff; auch Schönbrodt 2006, S. 11ff.; Scheier/Held 2006, S. 99ff.). Ein großer Vorteil dieses Modells ist, dass es bereits ein psychodiagnostisches Instrument gibt, welches die Motivstärke messbar und damit das Modell ökonomisch nutzbar macht (vgl. Schönbrodt 2006, S. 131). Wie bei den Emotionen werden auch bei den Motiven angeborene ‚Grundmotive’ (auch ‚primäre Motive’) von ‚erworbenen Motiven’ (auch ‚sekundäre Motive’) unterschieden. Ein besonders starkes, erlerntes Motiv bzw. Anreiz stellt bspw. Geld dar. Signalreize und alle Verhaltensweisen, die für den Organismus funktional mit demselben Ergebnis verbunden sind, werden zu einem Motiv zusammengefasst. Motive sind daher eigentlich hypothetische Konstrukte, die auf individueller Ebene sehr unterschiedlich empfunden werden (vgl. Rheinberg 2008, S. 14; Schönbrodt 2006, S. 5).
Zwischen Emotionen und Motiven besteht eine enge Beziehung (vgl. Raab et al. 2009, S. 245), denn die emotionale Reaktion bestimmt bereits beim ersten Kontakt, ob eine Erfahrung für längere Zeit gespeichert wird oder nicht. Erfahrungen werden im Gedächtnis mitsamt ihrem ‚Erfahrungswert’ bzw. mit ihrer Valenz, d. h. des während der Erfahrung empfundenen Zustands, gespeichert (s. Kap. 3.2). Emotionen bestimmen daher in erheblichem Maße die Stärke eines Motivs. Dies erklärt auch, warum jeder Mensch individuelle Ziele verfolgt und warum sich Motive im Zeitverlauf verändern.
Für den Begriff der Präferenz gibt es derzeit keine allgemein anerkannte Definition. Genannt werden soll jedoch eine Definition von Scherer: „Relativ dauerhafte Bewertungsurteile im Sinne von ‚Mögen’ und ‚Nicht-Mögen’ bzw. in Form eines einem anderen vorgezogenen Objekt oder Reiz, werden Präferenzen genann t“ (Scherer 2005, S. 703; Übers. u. Herv. d. Verf.). Von Präferenz spricht man also, wenn ein Objekt aufgrund positiv oder fehlender negativ bewerteter Eigenschaften (einschließlich der assoziierten Konsequenzen) einem anderen vorgezogen wird (vgl. auch Rogdaki 2004; S. 32). Präferenzen spiegeln intrinsische Motive wie Einstellungen, Interessen, Geschmäcker und Ziele wider (vgl. Sloman/Croucher 1981, S. 5). Im Gegensatz zu den Motiven haben sie jedoch stets einen eindeutigen Objektbezug. Diese konkrete Ausrichtung kann bei den allgemeinen Motiven fehlen (z. B. beim Langeweile-Motiv). Präferenzen sowie Motive dienen der Verhaltensanpassung an komplexe Situationen und der Realisation individueller Bedürfnisse. Dabei müssen Präferenzen nicht dauerhaft aktiv sein. Je nach Situation können sie anderen gegenüber auch in den Hintergrund rücken oder ganz relativiert werden (s. Kap. 4.2).
Ein Teil unseres erworbenen Wissens wird als Einstellungen gespeichert. Einstellungen und Präferenzen werden oft miteinander verwechselt oder synonym verwendet (z. B. Friese et al. 2006, S. 728ff.; Greenwald/Krieger 2006, S. 948). Der Unterschied zwischen beiden Konstrukten ist, dass Präferenzen grundsätzlich wenigstens zweier, assoziativ verknüpfter Objekte bedürfen, die sich alternativ gegenüberstehen. Einstellungen hingegen beziehen sich immer auf ein Wahrnehmungsobjekt oder eine übergeordnete Kategorie von Objekten. Außerdem haben Präferenzen einen deutlich stärker ausgeprägten motivatorischen Charakter als Einstellungen, weil diese meist in Verbindung mit einer Valenz auftreten. Einstellungen können hingegen ambivalent bewertet sein (vgl. Wilson 2000, S. 106f.). Scherer definiert Einstellungen als „relativ dauerhafte Annahmen, Anlagen bzw. Neigungen einem bestimmten Objekt bzw. einer bestimmten Person gegenüber“ (Scherer 2005, S. 703; Herv. d. Verf.). Einstellungen beziehen sich im weitesten Sinne also auf die durch Erfahrung gebildete Beziehung zu einem Objekt (z. B. ein Produkt oder einer Marke). Erfahrungen werden als komplexe neuronale Verknüpfungen und unter Einbeziehung des Erfahrungskontextes (z. B. Emotionen) im Gedächtnis gespeichert (s. Kap. 2.1). Einstellungen sind schließlich stark mit dem verwandt, was hier im späteren Verlauf als ‚Assoziation’ bezeichnet wird. Der Unterschied zwischen Assoziation und Einstellung besteht darin, dass Einstellungen Assoziationen gebündelt wiedergeben. Einstellungen geben unsere subjektiven Gesamturteile zu Einstellungsobjekten wieder (vgl. Wilson et al. 2000, S. 101f.).
Einstellungen werden in ‚implizite’ und ‚explizite Einstellungen’ unterschieden (vgl. Gawronski/Bodenhausen 2006, S. 692ff.; Wilson 2000, S. 101ff.; Payne et al. 2008, S. 16ff.). ‚Implizite Einstellungen’ werden sukzessiv erworben und sind relativ stabil (vgl. Gawronski/Bodenhausen 2006, S. 693). ‚Explizite Einstellungen’ sind hingegen relativ frisch erworbene, objektbezogene Argumente bzw. Erfahrungen, die neben bereits vorhandenen impliziten Einstellungen koexistieren und diese ggf. nachhaltig verändern können (vgl. Wilson et al. 2000, S. 102; Gawronski/Bodenhausen 2006, S. 692; Friese et al. 2006, S. 728, S. 736). Ein Problem impliziter Einstellungen ist, dass Argumente soweit konsolidiert wurden, dass es schwierig ist, sie mit Worten zu beschreiben oder zu begründen[2]. Implizite Einstellungen bilden das assoziative Reaktionsmuster (vgl. Gawronski/Bodenhausen 2006, S. 693), welches während der Reaktivierung des RC’s bzw. der expliziten Einstellung simultan abläuft.
3 Basistheorien zur intuitiven Verhaltenssteuerung
In diesem Abschnitt werden einige Basistheorien aufsteigend ihrer Spezifität vorgestellt, an die das ‚Modell adaptiver Präferenzen’ (MAP) später anknüpfen wird. Den Ausgangspunkt bildet dabei die ‚Duale Prozess Theorie’ (Kap. 3.1). Diese wird zusammen mit Damasio’s ‚Somatischer Marker Hypothese’ und der ‚Affektheuristik’ (Kap. 3.2) bereits durch verschiedene Studienergebnisse der neurobiologischer Grundlagenforschung (Kap. 3.3) gestützt. Auch die daran anschließenden Ansätze unbewusster Lern- und Verhaltenssteuerung werden bisher in Teilen von diesen Studien belegt (Kap. 3.4).
3.1 Duale Prozesse während der Informationsverarbeitung
Die ‚Dualen Prozess-Modelle’ entstanden möglicherweise bereits Ende des 19. Jahrhunderts und wurden dann entlang einzelner psychologischer Disziplinen wie der Kognitions[3] - und Sozialpsychologie[4] sowie auch der Emotions- und Lerntheorie[5] kontinuierlich weiterentwickelt. Bei der dualen Prozess-Theorie geht es um das Verhältnis von bewussten und unbewussten sowie kognitiven und affektiven Prozessen. Zunächst differenzierten die Dualen Prozess-Modelle vornehmlich assoziativ-affektive und rational-kognitive Informationsverarbeitung. Diese Differenzierung hat jedoch reinen Modellcharakter, da affektive und kognitive Prozesse tatsächlich stark interdependent sind. Neuere Duale Prozess-Modelle unterscheiden daher v. a. unbewusste (automatische) und bewusste (strategische) Informationsverarbeitung (vgl. Hofmann et al. 2008, S. 23; Friese et al. 2008, S. 398).
In der Diskussion zum Zusammenspiel von Bewusstsein und Unterbewusstsein während des ‚processing’ wird häufig auch von zwei Systemen gesprochen. System 1 ist schnell (durch paralleles ‚processing’), automatisiert, intuitiv und unterliegt einem geringen Ressourceneinsatz. Man spricht auch von ‚flacher’ Informationsverarbeitung. System 2 basiert hingegen auf ‚tiefer’ Informationsverarbeitung und ist entsprechend langsam, sequentiell, rational, strategisch, kontrolliert und damit bewusstseinsabhängig (vgl. Epstein 1994, S. 710; Evans 2008b, S. 202; Roth 2003, S. 237f.). Ein sehr bekanntes Duales System-Modell stammt von Kahneman. Es unterscheidet zwei verschiedene Verarbeitungsmodi – einen ‚intuitiven Verarbeitungsmodus’, während dem Überlegungen und Entscheidungen sehr schnell und automatisiert ablaufen können, und einen ‚kontrollierten Verarbeitungsmodus’, der reflektierend und elaboriert Ergebnisse des ersten Systems prüft und möglicherweise korrigiert (vgl. Abb. 2).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die duale Sicht wurde von diversen Autoren jeweils unter verschiedenen Systembezeichnungen übernommen (s. dazu ausführlich Evans 2008a, S. 255ff.; sowie Anlage 2). In allen Dualen Prozessmodellen stellt sich jedoch stets die Frage, ob Informationen eher affektiv oder elaboriert verarbeitet werden und ob diese Verarbeitungs- und Entscheidungsprozesse bewusst oder unbewusst erfolgen. Welche Reize strategisch, automatisiert oder gar nicht verarbeitet werden, ist dabei sehr stark kontextabhängig und die Übergänge sind fließend (vgl. Bargh 1989, S. 6f.; Kahneman/Frederick 2005, S. 288; s. Abb. 3). Aus diesem Grund ist eine trennscharfe Untersuchung differenzierter ‚processing’-Varianten nur eingeschränkt möglich. Eine Unterscheidung verschiedener ‚processing’-Formen hat dennoch Vorteile, denn die Art der Informationsverarbeitung hat einen großen Einfluss auf den Wirkungsgrad von Informationen auf den Organismus und dessen Verhalten: Wenn Tätigkeiten bspw. automatisch oder routiniert ablaufen, bedürfen sie kaum bewusster Kontrolle und sowohl die Auswahl beeinflussender Signale als auch die beteiligten Reaktionskreisläufe sind stärker begrenzt und werden funktional isoliert. Dadurch wird die Verarbeitungsgeschwindigkeit auf der einen Seite deutlich gesteigert, dafür findet ein Trade-off hin zu geringerer ‚accessiblity’ und Flexibilität statt (vgl. Baars 1988, S. 306; Tononi/Edelman 1998, S. 1847).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Eine Auswahl verschiedener processing-Formen in Abhängigkeit ihrer Automatizität (engl. ‚automaticity’) und Ressourcenintensität zeigt Abb. 3. Unbewusste Verarbeitung (‚automatic processing’) bedarf lediglich eines schwachen Auslösereizes und erfolgt subliminal und damit unkontrolliert. Der Elaborationsgrad kann jedoch in Abhängigkeit von den qualitativen Eigenschaften des Reizes und situationsbedingt variieren. Beispiele für automatic processing sind primäre Emotionen und implizites Lernen von Verstärkern (vgl. Bargh 1989, S. 11). Sehr häufig tritt Bewusstsein erst nach beiläufigen Informationsverarbeitungsprozessen auf (Phänomenabhängiges Bewusstsein, s. Kap. 2.2). Phänomenabhängiges Bewusstsein umfasst ein sehr weites Feld zunächst passiver Informationsverarbeitungsformen, die schließlich in bewusste Verarbeitung münden können. Beispiele für Phänomenabhängiges Bewusstsein reichen vom ‚klassischen Affekt’ über Wiedererkennung bereits verarbeiteter cues bis hin zur Inkubation, welches eine reflektiv-elaborierte Verarbeitung zuvor ungelöster Probleme darstellt (vgl. Baars 1997, S. 305; Perruchet/Vinter 2002, S. 320f.). Die kontrollierten Prozesse treten dagegen nur in Verbindung mit komplexeren Problemlösungsaufgaben auf, wobei bewusste Verarbeitung nicht ohne elaborierte Kognitionen gelingt (s. Kap. 2.2). Ebenso ist unbewusste Verarbeitung ohne affektiven Anteil nicht möglich (vgl. Grunert 1996, S. 90; s. Abb. 3).
Affektive Reizverarbeitung und die Rolle von Emotion als priorisierendes Bewertungsmaß und motivgebende Komponente zur Ausrichtung von Verhalten wurde im Marketing bereits umfassend unter dem Begriff Involvement thematisiert. Involvement drückt das persönliche Interesse aus, sich mit einem bestimmten Objekt auseinanderzusetzen, wobei die Einstellung zum Objekt[6] eine große Rolle spielt. Das Involvementkonstrukt umfasst neben der emotionalen Dimension auch eine Dimension, die auf den Grad bewusster Verarbeitung ausgerichtet ist. Die Wahrscheinlichkeit für Aufmerksamkeit und eine bewusste, strategische Informationsverarbeitung steigt demzufolge mit zunehmendem Involvement an. Hohes Involvement führt in der Regel auch zu steigenden Erfahrungswerten, welche ‚automaticity’ also unbewusste Reizverarbeitung begünstigen (vgl. Greenwald/Leavitt 1984, S. 581ff.). Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass implizites processing entweder bei geringer oder besonders großer Expertise bzw. Involvement des Konsumenten zum Produkt besteht, weil das Verhalten dann eher von Routinen und damit von Automatizität geprägt ist (s. dazu ausführlich Aarts/Dijksterhuis 2000, S. 53ff.).
3.2 Geheimnis der Intuition: Damasio’s Somatische Marker und die Affektheuristik
Wie bereits in Kapitel 2.3 einführend erklärt, haben Emotionen großen Einfluss auf unser Gedächtnis und auf unser Verhalten. Die Brücke zur Erklärung dieses Zusammenhangs stellt die von Damasio entwickelte ‚Somatische Marker Hypothese’ (SMH) dar. Nachweise für seine Hypothese fand Damasio zusammen mit Kollegen in verschiedenen experimentellen Studien (Damasio et al. 1990, S. 1039ff.; Bechara et al. 1994,
S. 7ff.; 1995, S. 1115ff., 1997, S. 1293f.). Aufgrund ihrer großen Erklärungskraft, haben sich auch andere Autoren (kritisch) mit der SMH auseinandergesetzt (vgl. Paulus/Frank 2003, S. 1311ff.; Dunn et al. 2006, S. 239ff.) und sie für eigene Thesen verwendet (s. z. B. Loewenstein 2001, S. 270; Pham/Avnet 2009, S. 267ff.).
Das Gehirn ist in der Lage, in sehr kurzer Zeit sehr viele Informationen zu verarbeiten und sogar Handlungsentscheidungen zu treffen, ohne dafür das Bewusstsein in Anspruch nehmen zu müssen. Ein berühmtes Experiment, mit dem dies nachgewiesen werden konnte, ist das ‚Iowa-Glücksspielexperiment’ (‚Iowa gambling task’), das von Bechara und Kollegen 1994 an der University of Iowa durchgeführt wurde und seitdem für viele weitere Experimente eingesetzt wurde. Für das Experiment wurden Probanden mit und ohne Läsionen im ventromedialen Bereich des Präfrontalen Cortex (VMPC; vgl. Anlage 3 u. 4) jeweils zwei Stapel mit Spielkarten vorgelegt. Der rote Stapel enthielt Karten, die hohe Gewinne, aber auch hohe Verluste einbrachten. Tatsächlich gewinnen konnte man nur mit dem blauen Stapel, der neben kleineren Verlusten v. a. kleinere Gewinne enthielt. Dabei kamen Bechara et al. zu einem erstaunlichen Ergebnis. Im Schnitt spürten gesunde Probanden bereits nach der zehnten gezogenen Karte das vom roten Stapel ausgehende höhere Risiko eines Verlustes – und dies lange bevor sie dies kognitiv deuten konnten. Ihre Hände schwitzten bereits vor dem Ziehen von diesem Stapel und sie begannen im Durchschnitt auch ab diesem Zeitpunkt intuitiv ihre Ziehtaktik zu verändern und weniger Karten von dem roten Stapel zu nehmen. VMPC-Patienten hingegen zeigten keine Stressreaktion und wählten signifikant häufiger Karten vom ‚schlechten’ Stapel. Sie hatten Probleme ihr Verhalten an das Erlernte anzupassen und konnten nicht dieselben Leistungssteigerungen zeigen wie gesunde Teilnehmer, die aus ihren Fehlern lernen konnten (vgl. Bechara et al. 1994, S. 7ff.; 1997, S. 1293f.). Die SMH findet eine Erklärung für dieses Phänomen. Sie besagt, dass emotionsverwandte Prozesse kognitive Prozesse begleiten und sie bei bewussten und unbewussten Abwägungs- und Entscheidungsaufgaben unterstützen (vgl. Bechara et al. 2005, S. 159). Dafür werden cues zusammen mit emotionalen Signalen positiver oder negativer Valenz versehen, sog. somatischen Markern (SM), und als mentale Einheit gespeichert. Ereignisse werden so auf zweierlei Weise erlebt und erinnert, räumlich-temporal und emotional (vgl. LeDoux/Phelps, 2000, S. 160). Damasio definiert SM als Empfindungen, die durch sekundäre Emotionen erzeugt werden, und die der Vorhersage zukünftiger Ereignisausgänge dienen: “In short, somatic markers are (. . .) feelings generated from secondary emotions. These emotions and feelings have been connected, by learning, to predicted future outcomes of certain scenarios” (Damasio 1994, S. 174; Herv. d. Verf.). Cues werden im Moment der Aufnahme mit entsprechenden SM versehen und können bei Wiederaufnahme zusammen mit RCs reaktiviert werden (vgl. Epstein 1994, S. 716). SM verbinden Erlebnisse mit konkreten körperlichen Zuständen, die neuronal durch Transmitterkonzentrationen hervorgerufen werden (vgl. Bechara/Damasio 2005, S. 340; Raab et al. 2009, S.209f.). Innerhalb differenzierter Neuronentypen können sie auch ambivalente Ladungen aufweisen (vgl. Belova et al. 2007, S. 980.). Die wahrgenommene sofortige somatische, d. h. körperliche, Reaktion stellt dabei eine Art Scheinwerfer für den Aufmerksamkeitsfokus dar, der den Blick auf besonders relevante cues ausrichtet (vgl. Bechara et al. 1998, S. 436; Bijleveld et al. 2009, S. 2). In Entscheidungssituationen richtet er den Aufmerksamkeitsfokus auf das tragende Argument eines Objektes innerhalb einer Auswahl aus (vgl. Loewenstein et al. 2001, S. 272; Gladwell 2005, S. 59). SM erhöhen so die Richtigkeit und die Effizienz von Entscheidungsprozessen (Slovic 2004, S. 4) und liefern eine neuroanatomische Erklärung für das oft zitierte ‚Bauchgefühl’, welches intuitiv eine Handlungsempfehlung in Entscheidungssituationen vorschlägt (vgl. Bechara/Damasio 2004, S. 360; vgl. Gladwell 2005, S. 3ff.).
Eine andere, an die SMH anknüpfende These, stammt von Slovic. Seine ‚Affektheuristik’ konnte ebenfalls in mehreren Studien nachgewiesen werden (vgl. v. a. Kahneman 2001, S. 6ff.; Finucane et al. 2000, S. 1ff.; Pham/Avnet 2009, S. 1ff.). Schnelle emotionale Reaktion auf Stimuli-Inputs beschreibt Slovic in seiner These als ‚affect heuristic’ (dt. ‚Affektheuristik’) und meint mit Affekt eine schnell und automatisch bei einem Objekt wahrgenommene Qualität, die ‚gut’ oder ‚schlecht’ unterscheidet. Dieser momentane Gefühlszustand wird aus einem individuell angelegten ‚Affekt-Pool’ gespeist. Die affektive Valenz ist dabei eine natürliche Form des Abwägens und wird in den unterschiedlichsten Situationen unbewusst oder bewusst eingesetzt. Statt sämtliche Attribute eines Objektes bzw. einer Situation einzeln abzuwägen, wird ein bestimmter Reaktionscode gesendet, der den während des Lernens erlebten Zustand reaktiviert (vgl. Kahneman 2001, S. 6). Es wird angenommen, dass die emotionale Reaktion der kognitiven Risiko-Vorteils-Bewertung vorangeht und diese beeinflusst (vgl. Slovic 2005, S. 35f.; 2007, S. 7; Finucane et al. 2000, S.1ff.). Die meisten Entscheidungen werden unter Unsicherheit und/oder (moderatem) Zeitdruck getroffen. Die Affektheuristik bietet in diesen Fällen intuitiv die stärksten Argumente in Form der zuvor gespeicherten emotionalen Valenz an und ermöglicht dem Organismus so schnelles und effizientes Reagieren (vgl. Kahneman/Frederick 2005, S. 271). Die Zugänglichkeit des stärkeren, heuristischen Attributs bestimmt dadurch die Zugänglichkeit schwächerer Attribute. Kahneman nennt diesen Vorgang ‚Attributsubstitution’ (vgl. ebd.; Kahneman 2002a, S. 456).
3.3 Neuronale Prozesse und das limbische System
Überleitend zum ‚Modell adaptiver Präferenzen’ sollen nun einige neuronale Grundlagen vermittelt werden. Ein Schwerpunkt wird dabei das ‚limbische System’ sein, welches entscheidend an der Entstehung von Emotionen und unbewusst-adaptiven Verhalten beteiligt ist. Zunächst erfolgt eine kurze Erklärung des Aufbaus und der Funktionsweise des Gehirns und der limbischen Areale. Danach werden typische Prozessverläufe und Verarbeitungspfade vorgestellt.
3.3.1 Neuronale Informationsverarbeitung
Die Neurowissenschaft ist eine sehr junge, interdisziplinäre Wissenschaft, die sich gezielt mit der Erforschung des menschlichen Gehirns und des Nervensystems beschäftigt (vgl. Raab et al. 2009, S.2). In den vergangenen zwei Jahrzehnten gewannen die Neurowissenschaften durch ihre bildgebenden Verfahren besondere Aufmerksamkeit, mit denen sich Emotionen und Gedanken als neuronale Aktivitätszentren lokalisieren lassen (vgl. ebd. S.3). Dank dieser Verfahren existieren heute detaillierte Landkarten des Gehirns sowie auch in Teilen von den intermodularen Prozessverläufen. In ihnen lässt sich eine Vielzahl verschiedenster, modular vernetzter Areale erkennen, die vertikal-funktional aufgebaut sind und jeweils ganz bestimmte Aufgaben übernehmen[7] (Tulving et al. 1996, S. 76f.; ‚global workspace’-Ansatz, Kap. 2.2). Ob alle diese Module bereits bei der Geburt angelegt sind, wird derzeit noch diskutiert (vgl. Scholl/Tremoulet 2000, S. 306; Saxe/Carey 2006, S. 144ff.; Newman et al. 2008, S. 262ff.). Ermöglicht wird dieser vertikal-funktionale Systemaufbau durch diverse multifunktionale Neuronentypen innerhalb der Neuronenketten. Jeder Neuronentyp ist dabei für spezifische Übertragungsfunktionen zuständig. Außerdem verfügt jede einzelne Nervenzelle im Schnitt über 10.000 erregende und abschwächende Synapsen und kann von dementsprechend vielen Seiten durch Stimuli aktiviert werden bzw. Informationen weitergeben oder auch hemmen (vgl. Riederer et al. 2009, S. 31). Einzelne Synapsen besitzen jedoch nicht genügend Aktionspotentiale, um das Neuron zu aktivieren. Das heißt, Neuronen müssen von mehreren anderen Neuronen gleichzeitig angesteuert werden, um selbst ‚feuern’ zu können. Durch diese Bedingung entsteht eine starke Filterwirkung (vgl. Roth 2003, S. 122f.). Über Assoziationsfasern (sog. Axone) bilden einzelne Zellen lokale Kollateralverzweigungen, Cluster genannt. Cluster sind wiederum über längere Axone miteinander verbunden. So kann jede Zelle jede weitere Zelle über spätestens drei Verbindungen erreichen (vgl. ebd. S. 132, 137).
Vereinfacht dargestellt werden neu eingehende Informationen mithilfe vorhandener Gedächtnisinhalte erkannt (‚decoded’), gleichzeitig jedoch auch in verschiedenen Teilen des Gehirns entsprechend angesprochener, assoziativer Areale sortiert gespeichert (‚encoded’), z. B. im akustischen Gedächtnis oder im Gedächtnis für Gesichter. Es gibt entsprechende Arbeitsgedächtnisse, die für die bewusste Informationsverarbeitung und -codierung zuständig sind. Für komplexe Wahrnehmungs- und Problemlösungsprozesse werden vorhandene Wissenselemente jeweils aus den einzelnen Arealen geleitet und problemspezifisch zusammengeführt. Diese Prozesse verlaufen hauptsächlich unbewusst und innerhalb vertikal-funktionaler Strukturen ab. Außerdem erfolgt die Verarbeitung in zwei Stufen. Teile der eingehenden Information werden zunächst unbewusst-affektiv vorverarbeitet und erst später sukzessiv ausgewertet (vgl. Raab et al. 2009, S. 133, 158; Rüdiger 2004, S. 92; Leslie 1987, S. 285).
Mithilfe der neuronalen Untersuchungsmethoden konnte nachgewiesen werden, dass bewusste Wahrnehmungsprozesse grundsätzlich an die Aktivierung der Großhirnrinde (Cortex) gebunden sind, deren Aktivierung jedoch nicht zwangsläufig die bewusste Verarbeitung der Stimuli bedeuten muss (vgl. Roth 2003, S. 210, 214f.). Sowohl bei den subliminalen als auch bei den bewusst wahrgenommenen Reizen können Reaktionen im präfrontalen Cortex (PC) gemessen werden (s. Anlage 3 u. 4). Lediglich die jeweilige Nuancierung und Zusammensetzung modularer Aktivierung zeigt an, ob ein Reiz bewusst erkannt wurde oder nicht[8] (vgl. Buckner et al. 1998, S. 285ff.; Supèr et al. 2001, S. 309; vgl. auch Dehaene et al. 2001, S. 752ff.). Roth findet eine neurobiologische Erklärung für diesen Zusammenhang: Bewusstsein ist besonders dafür geeignet, komplexe Aufgaben zu lösen. Für diese Aufgabe müssen vorhandene Erfahrungselemente neu verknüpft werden. Die Zusammenfügung neuer kortikaler Verbindungen erfolgt im ersten Schritt jedoch nicht strukturell, sondern zunächst funktional. D. h. bestimmte Neuronenverbindungen werden mithilfe neuronaler Transmitter zunächst kurz verstärkt, während andere abgeschwächt werden. Erst danach werden diese neuen Verknüpfungen durch Veränderungen in den Neuronen selbst und durch einübende, konsolidierende Prozesse gefestigt, z. B. bei der Neuverknüpfung von Objektbeziehungen oder bei der Einstellungsbildung zu einem Objekt (vgl. Roth 2003, S. 106, 219f.). Bei häufiger Aktivierung derselben Neuronenketten, z. B. bei gleicher Reizeinwirkung, werden diese leichter zugänglich, können schneller die Bewusstseinsschwelle erreichen und treten gegenüber anderen dominierend in den Vordergrund (vgl. Kelder 1994, S. 1125). Über die Zeit entwickeln sich Reiz-Reaktions-Routinen heraus, welche zu einer deutlichen Steigerung der Leistungsfähigkeit bei der Bewältigung bekannter Probleme führen. Da aber nicht jeder zunächst selektiv-affektiv verarbeitete Reiz zu Bewusstsein führen muss, können diese Lernprozesse auch völlig unbewusst erfolgen. Viele ‚unsichtbare’ Reize können auf diese Weise Neuronen-Ketten aktivieren, ohne dass diese zu einer weiteren Verarbeitungsstufe gelangen.
3.3.2 Aufbau und Funktionsweise des limbischen Systems
In vielen Studien konnte gezeigt werden, dass noch vor der Aktivierung des Bewusstseins v. a. emotional-assoziative Areale des Gehirns aktiv sind (vgl. z. B. Bechara et al. 1997, S. 1293ff.; LeDoux/Phelps 2000, S. 158ff.). In den vergangenen Jahren wurden diese emotional-assoziativen Areale besonders intensiv untersucht, die zusammen als limbisches System bezeichnet werden. Als limbisches System werden dabei „Hirnstrukturen zusammengefasst, die weniger räumlich als vielmehr in besonderer funktioneller Weise miteinander verbunden sind“ (Moll 2006 , S. 696; Herv. d. Verf.). Das limbische System ist evolutionsbiologisch sehr alt. Es ist untrennbar mit der Entstehung von Bewusstsein und mit dem kognitiven Denken verbunden, was auch ein Hinweis dafür ist, dass affektive und intuitive Prozesse eine Vorstufe des bewusst-kognitiven Denkens darstellen. Das limbische System ist v. a. für die emotionsgesteuerten Informationsverarbeitungs- und Denkprozesse verantwortlich (vgl. ebd.; u. a. auch Mehrabian 1987, S. 14) und sorgt auf diese Weise für die individuell verschieden empfundenen Gefühlszustände während der Informationsverarbeitung. Es ist weit über verschiedene Hirnareale verzweigt (vgl. Murphy et al. 2003, S. 223; Raab et al. 2009, S. 129; sowie Anlage 3 u. 4). Zu seinen Hauptelementen gehören die Großhirnrinde, auch Endhirn oder Cerebrum genannt, v. a. ventromedialer präfrontaler Cortex (VMPC) und Basales Vorderhirn (‚orbitofrontaler Cortex’ oder OFC), außerdem Areale des Mittelhirns wie die Amygdala (AM), der Thalamus (THA) und der Hypothalamus (HYP) (vgl. Raab 2009, S. 170; Damasio 2000, S. 280). Eine besondere Rolle nimmt der Hippocampus (HIP) ein. Er übernimmt die Funktion des zentralen Organisators für alle bewusstseinsfähigen Informationen an das deklarative Gedächtnis. Er bestimmt, wo und wie stark in welchem Kontext Informationen abgespeichert werden bzw. wieder abrufbar sind (vgl. Roth 2003, S. 167, 203ff.). Neben dem THA bildet er das ‚Tor zum Bewusstsein’(vgl. Raab et al. 2009, S. 140).
Physische Stimuli werden automatisch in sensorischen Speichern verlinkt und entsprechend ihrer Reizstärke über ‚feedforward’-Verbindungen an hierarchisch höher gelegene, kognitive ‚Kategorie-Netzwerke’ weitergeleitet, wenn vorangegangene Erfahrungsstrukturen dies ermöglichen (vgl. Grunert 1996, S. 90; Lamme/Spekreijse 2000, S. 232f.). Der präfrontale Cortex (PC) bildet zusammen mit dem HIP das Kurz- bzw. Arbeitsgedächtnis, welches als zentrale Anlaufstelle bewusster Informationsverarbeitung den berüchtigten selektiven Flaschenhals bildet. So konnte Miller bereits 1956 anhand mehrerer Studien nachweisen, dass das Arbeitsgedächtnis immer ‚nur fünf plus-minus-zwei’ ‚information chunks’ gleichzeitig, im Bewusstsein behalten und verarbeiten kann[9] (vgl. Miller 1967, S. 181 ff.; Roth 2003, S. 159). Zunächst gelangen visuelle Informationen aber über primäre und sekundäre visuelle Zentren und den THA zum VMPC. Der VMPC ist sowohl an der emotionalen Bewertung eingehender Information als auch am Überlernen emotional evaluierter Objekte beteiligt (vgl. Rolls 1999, o. S. zit. n. Bechara et al. 2005, S. 159). Ein wichtiger Teil des PC zur emotionalen Wahrnehmungs- und Verhaltenssteuerung ist der OFC. Der OFC sitzt oberhalb des Nasenbeins, am untersten Ende des PC. Er interpretiert eingehende Stimuli entsprechend ihrer Belohnungseigenschaften. Je stärker die Aktivierung dieses Areals ist, umso größer erscheint die erwartete Belohnung (vgl. O’Doherty 2001, S. 98). Neben dem OFC wird v. a. in der AM das emotionale Gedächtnis vermutet (vgl. Roth 2003, S. 157). Die AM ist an einer ganzen Reihe emotionaler Verarbeitungsprozesse beteiligt. Es wird u. a. davon ausgegangen, dass HIP und AM (neben anderen) arbeitsteilig das episodische Gedächtnis bilden, wobei der HIP Details des Erinnerten und die AM die Emotionen zum Erlebten beisteuern (vgl. Bechara et al. 1995, S. 1117; Roth 2003, S. 308f.). Die AM steuert damit die emotionale Bewertungskomponente zum erlernten Wissen und Verhalten bei (vgl. Roth 2003, S. 276), speichert angeborene und erlernte, emotionale Programme (z. B. zum Sozialverhalten) und ruft diese bei entsprechender Reizeinwirkung automatisiert ab. Der THA besteht aus mehreren Kernen. Es wird vermutet, dass er u. a. für die Reizmustererkennung und für den Aufmerksamkeitsfokus verantwortlich ist (vgl. ebd., S. 265f.). Schließlich ist als Teil des limbischen Systems noch der HYP zu erwähnen. Dieser ist mit fast allen anderen Arealen verbunden – nicht nur mit denen des limbischen Systems – und ist sein wichtigstes, somatisches Kontrollzentrum. Er ist an der Steuerung der wichtigsten Körperfunktionen beteiligt und reguliert auch den Wachheits- und Aktivitätszustand des Organismus (vgl. ebd., S. 161ff.; s. dazu ausführlich Anlage 4).
Gleichgerrcht et al. fassen die komplexe Interaktionsstruktur des limbischen Systems etwas übersichtlicher in drei grundsätzlichen Systemprogrammen zusammen. Sie unterscheiden das ‚stimulus encoding system’ (Stimuluscodiersystem), das ‚alternative selection system’ (Alternativenauswahlsystem oder ASS) und das ‚expected reward system’ (Belohnungserwartungssystem oder ERS; vgl. Gleichgerrcht et al. 2010. S. 614). Das ‚stimulus encoding system’ wäre demnach das emotionale Lernzentrum, welches Objektreize in emotionale Programme übersetzt und speichert. Für die Alternativauswahl ist als Hauptkomponente des ASS wahrscheinlich der anteriore cinguläre Cortex[10] (ACC) zuständig. Er selektiert die stärkeren emotionalen Reize bzw. Präferenzen und gibt sie als affektive Entscheidungshilfe an kognitive Module weiter. Das ERS[11] steuert dafür Bewertungssignale als subjektives, einheitliches Bewertungsmaß aus dem emotionalen Gedächtnis bei. Der erwartete Belohnungswert eines cues ist also eine Erfahrungsgröße. Die Subsystemstruktur von Gleichgerrcht et al. für das limbische System stellt dessen funktionale Zusammenhänge übersichtlich dar. Es kann jedoch noch nicht mit eindeutiger Sicherheit gesagt werden, ob sich das ‚encoding system’ tatsächlich im OFC oder nicht vielmehr im linken, posterioren Teil des VMPC befindet (vgl. Demb et al. 1995, S. 5870ff.; Bechara et al. 1998, S.435f.; O’Doherty 2004, S. 769ff.).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
LeDoux konnte zeigen, dass Emotionen dem Denken vorausgehen. Ihn interessierte in diesem Zusammenhang v. a. der Einfluss der AM beim Angstverhalten und bei sog. ‚quick-and-dirty’-Prozessen. Er vermutete, dass bestimmte Reaktionen noch vor der vollständigen Reiz-Verarbeitung im PC fast simultan mit der Reizaufnahme erfolgen (s. LeDoux/Phelps 2000, S. 158ff.; Bechara/Damasio 2004, S. 353). Er sah aus seinen Studien, dass Informationen zur AM über zwei verschiedene Bahnen gelangen – über eine thalamische und eine kortikale (vgl. Abb. 4). Die erste verkürzte Bahn ermöglicht ‚quick-and-dirty’-Reaktionen, die in erster Linie schnelles Handeln in kritischen Situationen sicher stellen soll, während die zweite, längere Verbindung eingehende Informationen mit Gedächtnisinhalten abgleicht. Reize werden dann mithilfe des vollständigen Erfahrungswissens verarbeitet, jedoch erst nachdem erste Dringlichkeitsuntersuchungen im TH-AM-Kreislauf vorgenommen wurden (vgl. Raab et al. 2009, S. 140).
Das limbische System ist in der Lage, in kürzester Zeit (< 100 Millisekunden) und völlig unbewusst relativ komplexe Risiko- und Belohnungseinschätzungen vorzunehmen (vgl. Roth 2003, S. 280). Die Art der Informationsverarbeitung (bewusst oder unbewusst) hängt damit wesentlich von den mit den aufgenommenen Reizen verbundenen Emotionen ab.
3.4 Adaptives Unterbewusstsein und Implizites Lernen von Mustern
Die Bedeutung des Unterbewusstseins für das Verhalten wurde schon in den Kapiteln 2.2 und 3.1 angesprochen. Subliminale und bewusste Verarbeitungsprozesse scheinen sich gegenseitig zu bedingen und fließend ineinander überzugehen (s. Kap. 3.3.1). Überleitend zur ‚Modell adaptiver Präferenzen’ werden nun zwei theoretische Ansätze vorgestellt, welche die Leistungsfähigkeit des Unterbewusstseins zusammenfassend betrachten: das ‚adaptive Unterbewusstsein’ (engl. ‚adaptive unconscious’) und aktuell diskutierte Thesen zum impliziten Lernen von Mustern.
Die Idee eines an eine bestimmte Umweltsituation angepassten Verhaltens kennen wir bereits aus der Biologie. Beim Menschen geht intuitives Verhalten jedoch über das reine Folgen angeborener Instinkte hinaus (interessant dazu Gladwell 2005, S. 3ff.). Der Begriff des durch die Kognitionspsychologie entwickelten ‚adaptiven Unterbewusstseins’, auch ‚kognitives Unterbewusstsein’ genannt, ist ein rein theoretisches Konstrukt, welches eine Reihe unbewusst-automatisierter Wahrnehmungs-, Lern- und somatisch-motorische Steuerungsprozesse unter sich zusammenfasst, die es uns ermöglichen, in sich schnell wandelnden situativen Kontexten angemessen zu reagieren. Sie geben uns ein sehr viel detaillierteres Verständnis von unserer Umwelt und die Fähigkeit, ein dementsprechend differenziertes Verhaltensrepertoire zu entwickeln. Und auch wenn diese völlig unbewusst ablaufenden Mechanismen nicht in jedem Fall perfekt funktionieren (z. B. wenn wir einen Menschen mit hoher Stirn automatisch für schlauer halten), bieten sie dennoch umgehend Lösungen an, die im Alltag oft sehr nützlich sind. Durch unbewusst-adaptive Fähigkeiten wurden unsere kommunikativen Fähigkeiten außerdem enorm erweitert. Wir können eine große Menge verbaler und nonverbaler cues in hoher Geschwindigkeit effizient de- und encodieren, um sie dauerhaft für ähnliche Situationen verfügbar zu halten. Kurz – wir lernen dank dem adaptiven Unterbewusstsein ‚zwischen den Zeilen zu lesen’, sei es beim Erfassen einer versteckten Kritik des Chefs, der Polemik in einem Zeitungsartikel oder in Situationen, in denen das oft zitierte ‚Bauchgefühl’ uns vor vermeintlich schlechten Entscheidungen warnt.
Ein sehr intensiv erforschtes Phänomen unbewusst-adaptiven Verhaltens ist der sog. ‚Priming-Effekt’ (vgl. v. a. Warrington/Weiskranz 1974, S. 419ff.; Tulving et al. 1990, S. 302ff.; Bargh et al. 1996, S. 230ff.; Buckner et al. 1998, S. 285; Abrams et al. 2002, S. 100ff.; Dehaene et al. 2001, S. 752ff.). Wenn Informationen subliminal verarbeitet werden, jedoch das Verhalten beeinflussen, spricht man von ‚Priming’ (dt. ‚Vorbereiten’ oder ‚Bahnen’). Priming bedeutet also das Agieren entsprechend einer Vorlage (bspw. Prototypen und Schemata) gefolgt auf einen bestimmten Signalreiz. Roth definiert Priming daher als „Reproduzieren von implizitem Wissen mithilfe von Lernhilfen“ (Roth 2003, S.156 u. 229 ff.; Herv. d. Verf.). Durch die unterschwellige Reizverarbeitung beim Priming können bestimmte Aufgaben schneller gelöst werden, weil ein entsprechender Kontext schon vorbereitet wurde (vgl. Raab et al. 2009, S. 127; Demb et al. 1995, S. 5870; Buckner et al. 1998, S. 285).
Eine andere wichtige Entdeckung sind sog. ‚Affekt-Primes’, deren Einfluss auf die Stimmungslage ebenfalls zu Verhaltensabweichungen führen kann (vgl. Fitzsimons et al. 2002, S. 276). So fiel in einem Experiment von Pham die Beurteilung eines Buches von Probanden in einer positiven Stimmung nachweislich besser aus (vgl. Pham/Avnet 2009, S. 273). Affekt-Primes können konditioniert (z. B. durch ‚repetition priming’, also durch Wiederholen gelernter Primes) auch länger nachwirken. Diesen Effekt macht sich u. a. auch die Werbung zu Nutze (vgl. Greenwald/Leavitt 1984, S. 588; O’Doherty et al. 2006, S. 164).
Die Effektivität von Primes ist jedoch begrenzt. So stellt Roth fest, dass Priming-Effekte nur bei einfachen Reizmerkmalen auftreten und nur solche Handlungen betreffen, die mehr oder weniger automatisiert, also auf einem sehr geringen Bewusstseinsniveau, und unmittelbar nach Aufnahme des Primes ablaufen. Es spielen beim Priming also auch persönliche Faktoren sowie der situative Kontext eine Rolle. Roth führt dabei das Beispiel der ‚Coca Cola-Werbung im Kino’ an. Die Absicht hinter der Werbung im Kino ist natürlich, Kinobesuchern unterschwellig Lust auf Cola zu machen. Dennoch können wir aus unserer Erfahrung schöpfend sagen, dass die Effekte der Werbung keine Anstürme auf die Getränkeausgabe kurz vor Filmbeginn auslösen. Der subliminale Erfolg der Werbung geht also nicht so weit, uns zum Aufstehen zu bewegen und dann roboterhaft eine Cola zu konsumieren. Für ein solches Verhalten müssten weitere begünstigende Faktoren zusammentreffen wie großer Durst und keine deutlich abweichenden Präferenzen. In diesem Fall könnte der Effekt der Werbung deutlicher ausfallen (vgl. Roth 2003, S. 234; sowie Karremans et al. 2006, S. 2, 6). Unser Verhalten passt sich also unbewusst dem jeweiligen Situationskontext an (vgl. Supèr et al. 2001, S. 306f.; Scholl/Nakayama 2002, S. 497).
Eine Erweiterung des ‚adaptive unconscious’-Ansatzes stellt der ‚nonconscious goal pursuit’-Ansatz dar. Er geht von einem neuronalen Mechanismus aus, der die persönlichen Ziele in Abhängigkeit von äußeren Auslösereizen aktiviert und stellt somit in Frage, ob bewusste Informationsverarbeitung für zielkonformes Handeln überhaupt notwendig ist. Unbewusst aktivierte Ziele würden demnach ebenso die Aufmerksamkeit auf zielkonforme Reize ausrichten und zur konsistenten Verfolgung intrinsischer Ziele führen (vgl. Chartrand/Bargh 1996, S. 464ff.; Bargh et al. 2001, S. 1014ff.; Custers/ Aarts 2005, S. 129ff.; Chartrand et al. 2008, S. 191, 197; auch Hofmann/Wilson 2010, S. 2ff.). Nachweise für diese aktivierenden Mechanismen fassen u. a. Kable und Glimcher in ihrem Artikel „The neurobiology of decision: consensus and controversy“ zusammen (vgl. Kable/Glimcher 2009, S. 739ff.; Paulus/Frank 2003, S. 1311ff.). Die Behauptung des ‚nonconscious goal pursuit’-Ansatzes, dass durch unbewusst verarbeitete cues direkt Ziele aktiviert werden, erscheint jedoch unlogisch. Nach allem, was wir über die Funktionsweise des Gedächtnisses relativ sicher wissen, scheint es eher wahrscheinlich, dass durch externe Reize lediglich die neuronalen Strukturen, also ‚innere Bilder’ und Gefühlszustände (SM), durch entsprechende RCs aktiviert werden können, die erst zu einem späteren Zeitpunkt durch bewusst-kognitive Inferenzen als Motive, Ziele und Präferenzen erkannt und formuliert werden können. Die Aktivierung der Ziele ist dafür nicht notwendig, denn innerhalb unbewusst-adaptiven Verhaltens erfolgt die Aktivierung tendenziell in Relation zu einem konkreten Aktivierungszeitpunkt und -kontext und nicht auf einen ‚positiv bewerteten Endzustand’ gerichtet (vgl. dazu Aarts et al. 2007, S. 175). Mit anderen Worten erfolgt jede Handlung motiviert, aber nicht für jede Handlung kann ein Motiv formuliert werden. Innerhalb des Coca-Cola-Beispiels heißt das: Auch wenn das primäre Durstmotiv nicht gegeben ist, können Umstände dazu führen, dass man bei der Getränkeausgabe (z. B. begleitend) steht und etwas bestellt. Auch bei solchen schwach motivierten Entscheidungen können einzelne cues Präferenzurteile auslösen.
In Zusammenhang mit dem adaptiven Unterbewusstsein wurden außerdem eine ganze Reihe unbewusster, kognitiver Strategien entdeckt, die das implizite Lernen peripherer Muster ermöglichen. Neuronale Muster dienen der Abbildung von Objekten und ihrer Beziehung bzw. der Umwelt im Gehirn (Damasio 2000, S. 9). Sie entstehen spontan durch das Sammeln selektiver Objektinformationen, bei denen eine Beziehung zunächst nur vermutet wird. Objekte bzw. Reizmuster werden also unterhalb der Bewusstseinsgrenze anhand zuvor encodierter Informationen zunächst nur ‚erraten’ (vgl. Duncan 1984, S. 514). Hinweisreize dieser Art wären bspw. die physische oder temporale Nähe peripher wahrgenommener Objektreize bzw. Regelmäßigkeiten in deren Wahrnehmung (vgl. Rüdiger 2004, S. 15). Aber auch sehr viel komplexere Beziehungsvarianten können assoziativ entschlüsselt werden (vgl. Lewicki et al. 1987, S. 523). Spontan und unbewusst werden darauf im Gehirn Gruppen bzw. Kategorien, repräsentiert durch Prototypen, sowie Regeln und Schemata erstellt (s. dazu ausführlich Nomura 2007, S. 37ff.). Eine Variante impliziter Regelbildung sind Entscheidungsheuristiken (vgl. Pachur/Hertwig 2006, S. 983). Neben der in Kapitel 3.2 eingeführten Affektheuristik gibt es viele weitere ‚adaptive Lern-Tools’, die auch Eigenschaften kognitiver Prozesse mit sich bringen, darunter Heuristiken wie die Wiedererkennungsheuristik (s. Goldstein/Gigerenzer 2002, S. 75ff.) und die Prototypheuristik (s. dazu Kahneman 2002a, S. 483). Diese ‚Tools’ ermöglichen schnelles und sparsames Lösen komplexer Probleme sowie automatisiertes Erfahrungslernen (vgl. Pham et al. 2001, S. 169; Goldstein/Gigerenzer 2002, S. 80). Oft wird in diesem Zusammenhang auch von ‚Kausalität’ gesprochen. Zu diesem Kausalitätsverständnis gelangen Menschen bereits nach den ersten Lebensmonaten (vgl. u. a. Leslie 1987, S. 265; Saxe/Carey 2006, S. 149). Das angeborene Verständnis von Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen unterscheidet sich stark von anderen elaborierten Prozessen (vgl. Schlottmann/Shanks 1992, S. 321ff.), weil es v. a. unbewusst eingesetzt wird und weil dessen Effekte nicht kognitiv steuerbar sind. Bspw. bleibt eine Illusion eine Illusion, selbst wenn sie kognitiv als solche ‚entlarvt’ wurde.
Die implizite Mustererkennung verläuft auf zwei Wegen. Zunächst durch automatisierte, aufsteigende Wahrnehmungsprozesse (vgl. Newman 2008, S. 264, 289; Scholl/Tremoulet 2000, S. 305f.) und dann in entgegengesetzter Richtung beim Wiedererkennen gespeicherter Informationen (Goldstein/Gigerenzer 2002, S. 75ff.). Die ‚flache’ bzw. implizite Verarbeitung dieser Reizzusammenhänge birgt ein enormes Ressourcensparpotential. „Mit einem ‚flachen’ Bewusstsein können wir viele Dinge gleichzeitig verfolgen, wenngleich nicht detailreich“ (Roth 2003, S. 206; Herv. d. Verf.). Unbewusste bzw. ungeplante Verarbeitungsmechanismen und Handlungen haben also viele Vorteile, weil sie die Leistungsfähigkeit und die Effizienz unseres Geistes deutlich erhöhen. Unsere intuitiv-adaptiven Fähigkeiten machen sich bspw. auch Regisseure zunutze, die meist in einem kappen Zeitfenster ihrem Publikum eine Geschichte vermitteln müssen. Sie übertragen daher viele stereotype Eigenschaften auf ihre Film-Charaktere und reichern ihre ‚Bilder’ mit nonverbalen cues an, die dem Publikum implizit Hintergrundinformationen zu den nicht gezeigten Bildern vermitteln.
[...]
[1] Der Begriff Objekt wird im Folgenden sehr allgemein verwendet. Im Grunde kann unter einem Objekt alles verstanden werden, worauf sich der Aufmerksamkeitsfokus richten lässt bzw. alle Facetten des Wahrnehmungsraumes, inklusive wahrgenommener Handlungsalternativen.
[2] Implizite Einstellungen können nun mithilfe des sog. ‚Implicit Association Test’ (IAT) gemessen werden, der die zugrunde liegenden automatisierten somatischen Effekte erfasst (s. dazu Greenwald et al. 1998, S. 1464ff.; Maison et al. 2004, S. 405ff.).
[3] v. a. Kahnemans von Stanovich und West übernommenes ‚Zwei-System-Modell’ (vgl. Abb. 2)
[4] v. a. Theorien zur ‚Einstellungsänderung’ wie das ‚Elaboration Liklihood Model’ (ELM; ausführlich dazu Chaiken/Trope 1999, S. 41ff.)
[5] z. B. das „CLARION“-Modell von Sun (s. dazu Sun et al. 1996, o. S.)
[6] So gehen Maison et al. davon aus, dass Low-Involvement-Produktentscheidungen tendenziell eher affektiv auf der Basis von impliziten Einstellungen und weniger kognitiv-elaboriert erfolgen (vgl. Maison et al. 2004, S. 413).
[7] Foder beschreibt in seiner Modularitätsthese Verarbeitungsinstanzen als grob modulare, domainspezifisch angelegte, kognitive Systeme, die phylogenetisch spezifiziert, fest miteinander verbunden sind, und die autonom und nicht zusammen agieren (Fodor 1983, S. 37)
[8] Sogar vollständig aufgenommene Stimuli können gelegentlich nicht bewusst wahrgenommen werden, weshalb von bestimmten Unterbrechungsmechanismen während des Wahrnehmungsprozesses ausgegangen werden kann (vlg. Supèr et al. 2001, S. 304 ff.; Lamme 2003, S. 12; Scholl/Tremoulet 2000, S. 306).
[9] Sog. ‚Verzögerungsneuronen’ des PC sind am Arbeitsgedächtnis beteiligt. Sie sorgen dafür, dass bestimmte Merkmale einer Situation für einige Sekunden bzw. Minuten für Problemlösungsaufgaben verfügbar sind (vgl. ebd., S. 211).
[10] wahrscheinlich zusammen mit laterealem PC und partialem Cortex, (prä)motorischem Cortex (vgl. Kable/Glimcher 2010, S. 739)
[11] wahrscheinlich bestehend aus AM, Basalganglien, Inselcortex und OFC (vgl. Gleichgerrcht et al. 2010, S. 614)
[12] AP decken sich damit mit der „recognition heuristic“ (s. dazu Goldstein/Gigerenzer 2002, S. 75ff.)
[13] Die Hierachie von Präferenzen ist damit immer an eine konkrete Auswahl gebunden.
[14] Affektive Reaktionen gehen kognitiven voraus: „preference needs no inference“ (Zajonc 1980, S. 151)
[15] Neuronal ausgedrückt, führt die mehrfache Reizaufnahme zu einer Vereinfachung der Reizverarbeitung (vgl. Alba/Hutchinson 1987, S. 412f.) und diese Vereinfachung wird mit einem stärkeren positiven „emotionalen Impuls“ verwechselt (vgl. Reber et al. 1998, S. 45ff.).
[16] Auf das „decoding system“ und „körperlich-motorisches System“ wurde aufgrund der Übersichtlichkeit verzichtet.
[17] s. dazu auch „imaging genetics“ (Ramsøy/Skov 2010, S. 818ff.)
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2011
- ISBN (eBook)
- 9783842819184
- DOI
- 10.3239/9783842819184
- Dateigröße
- 5.3 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Potsdam – Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, Betriebswirtschaft
- Erscheinungsdatum
- 2011 (August)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- neuromarketing käuferverhalten neurowissenschaft emotion unterbewusstsein
- Produktsicherheit
- Diplom.de