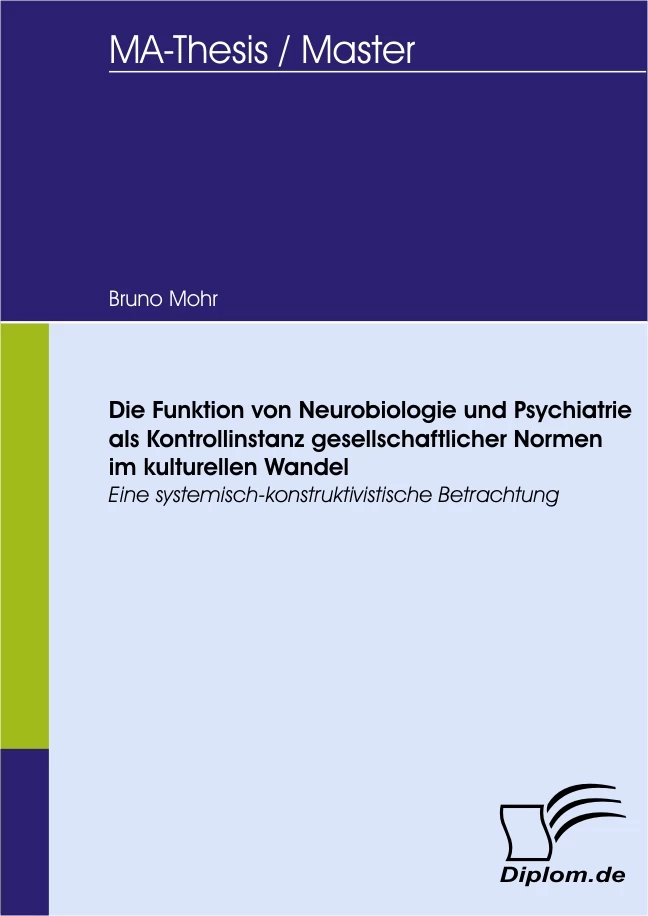Die Funktion von Neurobiologie und Psychiatrie als Kontrollinstanz gesellschaftlicher Normen im kulturellen Wandel
Eine systemisch-konstruktivistische Betrachtung
Zusammenfassung
Die vorliegende Masterarbeit stellt eine wissenschaftstheoretische Abhandlung über das Wesen und den Wandel gesellschaftlicher Normen und die Funktion von Psychiatrie und Neurobiologie als Kontroll- und Legitimationsinstanzen dieser Normen dar. Zentrales Anliegen der Arbeit ist es, den Anstieg gesellschaftlicher Kontrolle aus der Sicht der dynamischen Systemtheorie als einen vorübergehenden Prozess negativer Rückkopplungsprozesse darzustellen, die jeden kulturellen Wandel begleiten. Dieses Thema ist für die Kriminologie von Bedeutung, da exemplarisch am Beispiel der Psychiatrie aufgezeigt wird, wie die Legitimations- und Kontrollinstanzen gesellschaftlicher Normen Handlungen, die als Risiken für die soziale Ordnung wahrgenommen werden, durch Typisierung diagnostizier- und handhabbar machen. So werden die Abweichungen je nach abgegrenzter Deutungshoheit der jeweiligen Kontroll- und Legitimationsinstanz als Sünde (Kirche), als Revolte (Militär), Krankheit (Psychiatrie), Verwahrlosung (Erziehung) oder eben als Kriminalität stigmatisiert und bearbeitet. Welche Diagnosefigur jeweils Anwendung findet, ergibt sich aus den jeweiligen Macht- und Interessenverhältnissen und aus der Bedeutung des Verstoßes innerhalb der herrschenden Kultur. Es handelt sich hierbei somit immer um Deutungen von gesellschaftlichen Deutungen bzw. Konstruktionen.
Wissenschaftliche Erkenntnisse werden im Sinne des Konstruktivismus nicht als Wirklichkeit im allgemeinen (metaphysischen) Sinne, als objektive oder ontologische Realität, sondern als kognitive Realität dargestellt, die aufgrund wissenschaftlicher Operationen erscheint und in der Kommunikation semantisch (re-)konstruiert wird. In dieser Perspektive erscheint Kriminologie nicht als Spiegel der Kriminalität. Sie bildet Kriminalität nicht ab, sondern verständigt sich mit der Gesellschaft über dieses Thema, indem sie sich die Kriminalitätsverständnisse partikularer gesellschaftlicher Akteure erschließt und dadurch die Vielfalt möglicher Verständnisse bewusst macht. Stets werden Bilder interpretierend reproduziert und als neuerlich vorstellungsbildende Imagination der gesellschaftlichen Verständigung darüber ausgesetzt.
In der vorliegenden Masterarbeit soll die Darstellung psychiatrischer Normenkontrolle exemplarisch für die gesellschaftliche Reaktion auf Abweichung stehen, die auch bei kriminalisiertem Verhalten Anwendung findet. Eine zunehmende Bedeutung erfährt die Betrachtung durch den […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1 Kultureller Wandel
1.1 Der Kulturbegriff
1.2 Wissenschaft als Kulturprodukt
1.3 Kultureller Wandel aus Sicht des systemischen Konstruktivismus
1.4 Paradigmenwechsel
1.4.1 Vom metaphysischen Paradigma zum mechanistischen Paradigma
1.4.2 Der Einfluss des mechanistischen Paradigmas auf die Bedeutung von Gesundheit und Krankheit
2 Kultureller Wandel in der Postmoderne
2.1 Anstieg von Komplexität und Risiko als Folge der Ziel- und Zweckorientierung des mechanistischen Paradigmas
2.2 Individualisierung und die Auflösung gesellschaftsstabilisierender Normen und Werte
2.3 Auflösung des mechanistischen und Entstehung eines konstruktivistischen und systemischen Paradigmas
2.3.1 Wissenschaftliche Wirklichkeitskonstruktionen in der Postmoderne
2.3.2 Systemische Wirklichkeitskonstruktionen in der Neurobiologie
3 Die Funktionalität des „neurobiologischen Selbstverständnisses“ für das Regieren durch Freiheit
3.1 Das Entstehen einer Kontrollkultur
3.2 Die Psychiatrie als Legitimationsinstanz der gesellschaftlichen Sinnwelt
3.3 Die Konstruktion der psychiatrischen / neurologischen „Krankheit“
3.4 Der Vormarsch der „Lebenswissenschaften“
3.4.1 Molekularisierung in der Neurobiologie
3.4.2 Vom Risiko zur Anfälligkeit
3.4.3 Die Konstruktion des „neurobiologischen Selbst“ als Masterstatus und Verpflichtung zur Selbststeuerung
3.5 Regieren durch Freiheit
3.6 Die Wirksamkeit der Kontrolle durch Freiheit
4. Für einen systemisch–konstruktivistischen interdisziplinären Diskurs zwischen Sozial- und Neurowissenschaften
4.1 Das Krankheitskonzept in der systemisch-konstruktivistischen Perspektive
4.1.1 Das Krankheitskonzept auf der innersubjektiven Ebene
4.1.2 Das Krankheitskonzept auf der interkommunikativen Ebene
4.1.3 Das Krankheitskonzept auf der gesellschaftlichen Ebene
4.2 Vom genetischen Determinismus zu kreativen Lernprozessen neuronaler Netzwerke
4.2.1 Kritik des genetischen Determinismus
4.2.2 Kreative Lernprozesse neuronaler Netzwerke
4.3 Informationsaustausch als verbindendes Element zwischen Sozial- und Neurowissenschaften
4.3.1 Informationsaustausch zwischen Nervensystem und Umwelt
4.3.2 Informationsaustausch in sozialen Systemen
4.4 Ethisches Handeln im Umgang mit abweichendem Verhalten
4.4.1 Ethisches Handeln in der Perspektive der dynamischen Systemtheorie
4.4.2 Konsequenzen eines ethisch korrekten Handelns für den Umgang mit abweichendem Verhalten
Schlussbemerkungen
Literatur
Einleitung
Die vorliegende Masterarbeit stellt eine wissenschaftstheoretische Abhandlung über das Wesen und den Wandel gesellschaftlicher Normen und die Funktion von Psychiatrie und Neurobiologie als Kontroll- und Legitimationsinstanzen dieser Normen dar. Zentrales Anliegen der Arbeit ist es, den Anstieg gesellschaftlicher Kontrolle aus der Sicht der dynamischen Systemtheorie als einen vorübergehenden Prozess negativer Rückkopplungsprozesse darzustellen, die jeden kulturellen Wandel begleiten. Dieses Thema ist für die Kriminologie von Bedeutung, da exemplarisch am Beispiel der Psychiatrie aufgezeigt wird, wie die Legitimations- und Kontrollinstanzen gesellschaftlicher Normen Handlungen, die als Risiken für die soziale Ordnung wahrgenommen werden, durch Typisierung diagnostizier- und handhabbar machen. So werden die Abweichungen je nach abgegrenzter Deutungshoheit der jeweiligen Kontroll- und Legitimationsinstanz als Sünde (Kirche), als Revolte (Militär), Krankheit (Psychiatrie), Verwahrlosung (Erziehung) oder eben als Kriminalität stigmatisiert und bearbeitet (Hess, H. / Scheerer S. 2003: 5). Welche „Diagnosefigur“ jeweils Anwendung findet, ergibt sich aus den jeweiligen Macht- und Interessenverhältnissen und aus der Bedeutung des Verstoßes innerhalb der herrschenden Kultur. Es handelt sich hierbei somit immer um Deutungen von gesellschaftlichen Deutungen bzw. Konstruktionen.
Wissenschaftliche Erkenntnisse werden im Sinne des Konstruktivismus nicht als Wirklichkeit im allgemeinen (metaphysischen) Sinne, als objektive oder ontologische Realität, sondern als kognitive Realität dargestellt, die aufgrund wissenschaftlicher Operationen erscheint und in der Kommunikation semantisch (re-)konstruiert wird (Jensen, St. 1999: 325). In dieser Perspektive erscheint Kriminologie nicht als Spiegel der Kriminalität. „Sie bildet Kriminalität nicht ab, sondern verständigt sich mit der Gesellschaft über dieses Thema, indem sie sich die Kriminalitätsverständnisse partikularer gesellschaftlicher Akteure erschließt und dadurch die Vielfalt möglicher Verständnisse bewusst macht. Stets werden Bilder interpretierend reproduziert und als neuerlich vorstellungsbildende Imagination der gesellschaftlichen Verständigung darüber ausgesetzt“ (Kunz, K.-L. 2008: 28).
In der vorliegenden Masterarbeit soll die Darstellung psychiatrischer Normenkontrolle exemplarisch für die gesellschaftliche Reaktion auf Abweichung stehen, die auch bei kriminalisiertem Verhalten Anwendung findet. Eine zunehmende Bedeutung erfährt die Betrachtung durch den Anspruch der Psychiatrie auf Zuständigkeit in der Kriminologie unter dem Schlagwort des „geborenen Verbrechers“, der durch die wissenschaftlichen Konstruktionen der Neurobiologie gestützt wird.
Im ersten Abschnitt stelle ich das Wesen kultureller Wandlungsprozesse aus Sicht des systemischen Konstruktivismus dar. Zeiten kulturellen Wandels gehen mit der Auflösung von Sinnsystemen und ihnen inhärenter Normen einher und lösen Kontroll- und Sanktionsprozesse der Legitimationsinstanzen der gesellschaftlichen Sinnwelt aus (Berger, P. / Luckmann, Th. 1987). Somit eignen sich kulturelle Wandlungsprozesse, das Wesen gesellschaftlicher Normen und die gesellschaftlichen Reaktionen auf Abweichungen von ihnen exemplarisch darzustellen. Am Beispiel des Paradigmenwandels vom metaphysischen zum mechanistischen Weltbild stelle ich die Konstruktion gesellschaftlicher Normen und hieraus abgeleiteter Normalitäts- und Krankeitsdiagnosen der Psychiatrie dar.
Der zweiten Abschnitt beschreibt, dass das mechanistische Weltbild an einem Punkt angelangt ist, an dem seine Zweck- und Zielorientierung zu einem unüberschaubaren Anstieg von Komplexität und damit einher gehender Risiken geführt hat, die den Fortbestand der Menschheit bedrohen (z.B. Blanke, Th 1990, Grof, St. 1985). Hieran anschließend stelle ich die in der Postmoderne stattfindenden Auflösungsprozesse gesellschaftlicher Normen und Normalitätskonstrukte (Baumann, Z. 2008) als Ausdruck eines neuen Paradigmenwandels dar, der das mechanistische Weltbild radikal infrage stellt (z. B. Jantsch, E. 1988, Lewin, R., 1993, Mitchell, S. 2008).
Ich vertrete die These, dass den Herausforderungen von Komplexität und Risiken nur durch ein radikales Umdenken und ein virtuelles Spiel mit der Konstruktion und Kombination neuer kognitiver Systeme erfolgreich begegnet werden kann. Deshalb darf sich produktive, wissenschaftliche Forschung nicht an das Diktat einer Methode halten. Vielmehr muss sie auf opportunistische Weise (Feyerabend, P. 1978: 140) Methoden ausprobieren, aufgeben und variieren. Denn es ist auch ihre Aufgabe Modelle bereitzustellen, die in der Lage sind, reale Probleme zu bewältigen. Das in der Wissenschaft ungeschriebene Gesetz, dass man nur dann eine Theorie veröffentlicht, wenn sie zu überprüfbaren Beobachtungen führt, muss fallengelassen werden. Ideen sollten scheitern dürfen (Smolin, L. 2005: 2 f.). Deshalb plädiere ich, mit der Parole des Mai 1968 „Seien wir Realisten, fordern wir das Unmögliche“ ernst zu machen und „sich etwas auszudenken, was in den Koordinaten des bestehenden Systems unmöglich erscheint“ (Zizek, S. 2008: 17).
Während David Garland (2004) die durch Risiko und Unsicherheit geprägten sozialen und ökonomischen Verhältnisse als gesellschaftliche Grundlage einer übersteigerten Betonung von Kontrolle beschreibt, werde ich die Veränderung gesellschaftlicher Wirklichkeitsvorstellungen in den Mittelpunkt meiner Betrachtungen stellen. Hiermit möchte ich von einer scheinbar objektiven Analyse gesellschaftlicher Verhältnisse zu neuen Wirklichkeitskonstruktionen gelangen, die Antworten auf die Herausforderungen von Komplexität und Risiken aufzeigen. Dies erfordert, dass ich mich mit der Konstruktion von Wirklichkeit und ihren Wandlungsprozessen auseinandersetze. Deshalb werde ich den Kulturbegriff und seine Wandlungsprozesse aus Sicht des systemischen Konstruktivismus als kognitives Konstrukt darstellen (Jensen, St., 1999: 390 f.), welches sich über Kommunikation selbst reproduziert (Luhmann, N. 1984), aber auch durch koevolutionäre Prozesse (Jantsch, E. 1988) wandelt und an Komplexität gewinnt.
Im dritten Abschnitt beschäftige ich mich mit den Auswirkungen der Auflösung gesellschaftlicher Normen auf die Kontrollfunktion der Psychiatrie. Die These der biologischen Prädisponierung menschlichen Erlebens und Verhaltens werde ich als neue Form zeitgemäßer Kontrolle der Individuen durch die Medizin darstellen. Die Konstruktion eines „neurobiologischen Selbst“ (Rose, N. 2003) ermöglicht eine „Kontrolle durch Freiheit“, bei der die Individuen ihr gesellschaftlich unerwünschtes Verhalten selbst kontrollieren. Die Kontrollbestrebungen von Psychiatrie und Neurobiologie werde ich als Versuch der Legitimationsinstanzen der gesellschaftlichen Sinnwelt darstellen, das alte Sinnsystem zu stabilisieren und Entwicklungsprozesse zu verhindern (Berger, P. / Luckmann, Th. 1987: 98 ff.). Im Anschluss reflektiere ich die Frage, in wieweit diese Kontrollmechanismen angesichts eines zunehmenden Verlustes an Glauben in Metaerzählungen (Lyotard, J. F. 1982) Erfolg haben.
Im vierten Abschnitt ventiliere ich Gemeinsamkeiten und Möglichkeiten der Zusammenarbeit von Neuro- und Sozialwissenschaften, um neue Antworten auf die Herausforderungen von Komplexität und Risiken zu ermöglichen. Ich werde die Implikationen der systemisch konstruktivistischen Perspektive sowie aktueller neurowissenschaftlicher Forschungen für die psychiatrische Konstruktion von Krankheit und Normalität reflektieren und ein neues Verständnis von Kommunikation und Interaktion sowie ethisch korrektem Handeln als verbindende Phänomene von Neuro- und Sozialwissenschaften darstellen.
1 Kultureller Wandel
1.1 Der Kulturbegriff
Der Kulturbegriff ist schillernd und wenn man sich ernsthaft bemüht, stößt man auf außerordentliche Schwierigkeiten. Amerikanische Wissenschaftler fanden nicht weniger als 257 Definitionen des Kulturbegriffes (Barley, D. 1966: 62). Die meisten Versuche, das Wesen der Kultur darzustellen, blieben in einer allgemeinen Unverbindlichkeit stecken, die der Brisanz dieses Phänomens nicht gerecht wird, denn letztlich verhandelt die kulturelle Frage nichts Geringeres als die menschliche Gesellschaft zwischen Humanität und Barbarei (Metscher, Th. 1982: 16). Die Darstellung des Kulturbegriffes ist selbst Ausdruck der Kultur und der geistigen Haltung ihrer jeweiligen Vertreter, die den Begriff konstruieren. Er ist das Ergebnis von Filtrierungsprozessen der verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen, welche durch die Strukturierung ihrer Beobachtungen ihren Hypothesen zur Wahrheit verhelfen. Die Definition ist somit Ausdruck einer bestimmten geistigen Haltung und keinesfalls eine wissenschaftliche Tatsache.
Historisch lassen sich idealtypisch zwei gegensätzliche Geisteshaltungen herausarbeiten: Der Idealismus und der Materialismus, der sich als radikaler Rationalismus versteht (Rauschenbach, Th. / Müller, S. 1983: 19). Der Idealismus nimmt in seiner metaphysischen Weltschau ein geistiges Prinzip als letzten Seinsgrund alles Existierenden an. Für seinen bedeutenden Vertreter Friedrich Hegel ist Kultur Ausdruck der Selbstverwirklichung des sich in der Weltgeschichte objektivierenden Geistes (Steinbacher, F., 1976: 27 f.). Hegels idealistische Sichtweise wird von Marx gleichsam „vom Kopf auf die Beine gestellt“ (28), wenn er sagt, dass die Produktionsverhältnisse den geistigen Überbau bestimmen. Die rationale Betrachtungsweise folgt so der materiellen Daseinslogik, setzt die Einsicht in einen Zweck-Mittel-Zusammenhang voraus und lässt die Welt als ein technisches, auf die menschlichen Belange strukturierbares Gebilde erscheinen (59).
Aus systemisch-konstruktivistischer Sicht erscheint die Vorstellung einer kulturellen Außenwelt als Illusion, zumindest aber als nicht beweisbare Spekulation (Jensen, St., 1999: 327). Deshalb erklärt der systemische Konstruktivismus nicht die (Wirklichkeit der) Außenwelt, sondern ausschließlich die Konfigurationen von kognitiven Elementen eines Beobachters (die kulturelle Sinnarchitektur) (338). Kultur umfasst in dieser Betrachtungsweise sinnhafte Systembildungen, die sich physisch nicht greifen lassen. Was wir sehen, hören und greifen können sind kulturelle Artefakte, die sinnhaft zusammengefügt werden. So wie jedes Individuum eine einmalige Kombination von Genen ist, so ist jede soziale Systembildung eine einmalige Kombination kultureller Muster. Kultur lässt sich bildhaft als „genetic pool“ interpretieren, in dem die Gesamtheit aller kulturellen Informationen verschlüsselt ist (Parson, T. / Platt, G. M. 1973). Die Übertragung der kulturellen Informationen erfolgt durch symbolisch generalisierte Medien. Aufgabe dieser Medien ist es, kulturelle Muster zwischen Systemen zu übertragen oder ein System zu ähnlichen Musterbildern anzuregen, wie sie schon an anderer Stelle existieren. Die Übertragung solcher Elemente wirkt wie ein Programm: es führt zu einer Wiederholung (Replikation) des Systemaufbaus (Jensen, St. 1999: 391). Insbesondere die neuen Medien tragen als „Verbreitungsmedien“ (Luhmann, N. 1984) dazu bei. Der basale Prozess sozialer Systeme, der die Elemente produziert, aus denen diese Systeme bestehen, kann Niclas Luhmann zufolge nur Kommunikation sein (ebenda). Die so erzeugte und stabilisierte symbolische Sinnwelt stellt für ihre Mitglieder die kulturelle Realität als Wirklichkeit dar.
1.2 Wissenschaft als Kulturprodukt
Aus konstruktivistischer Sicht ist jegliches Wissen und damit auch wissenschaftliche Erkenntnis gesellschaftlich erzeugt. Erkenntnis ist das Ergebnis von Operationen, verarbeitet in wissenschaftlicher Kommunikation. Die kognitive Realität der Wissenschaft erscheint so als Ergebnis bestimmter Operationen, repräsentiert in semantischen Modellen (Jensen, St. 1999: 324 f.). „Realität ist ein Bereich, der durch Operationen des Beobachters bestimmt wird“ (Maturana, H. R. 1982: 264). Sie stellen einen „Atlas der Wirklichkeit“ dar. An diesem Atlas, der Sammlung kognitiver Karten, welche die Wissenschaften von der Wirklichkeit erstellen, orientieren sie sich bei ihrem Vorgehen in der Wirklichkeit. Die „Landschaft Wirklichkeit“ ist nicht objektiv vorhanden, sondern kartiert nur die Wege der Forschung; und der Beobachter ist kein Forschungsreisender, sondern der Erzeuger des Lebensraumes, den er sowohl erforscht als auch gestaltet.
Im Gesamtmodell der Wissenschaft addieren sich die einzelnen Forschungsbereiche zum Gesamtmodel „Wirklichkeit“. So erzeugt die Wissenschaft die Wirklichkeit, die sie zu entdecken glaubt. Auf dieser Ebene wird Realität nicht entdeckt, sondern geformt. Wissenschaft ist ein Teil der Wirklichkeit, die sie erforscht – und zwar der gesellschaftlichen Wirklichkeit, aus der heraus die kognitive Projektion erfolgt, die dann als Realität erscheint (328 f.). Wissenschaft ist sowohl ein gesellschaftliches Produkt, das nicht anders sein kann, als nach den Gegebenheiten der sie tragenden Kultur möglich; sie ist aber zugleich auch dynamischer Faktor dieser Kultur, der ihre eigenen Gegebenheiten verändert. Die Erkenntnisse sind Erzeugungen ihrer Theorien, das Ergebnis von Beobachtungen, die in einem spezifischen Feldbereich angestellt wurden. Sie sind somit ein Zivilisationsprodukt, keine Naturwirklichkeit, sondern Gesellschaftswirklichkeit. Die erkannte Naturwirklichkeit ist eine Vorstellung der Kultur, und folglich entsteht sie erst innerhalb der Kultur. Der Konstruktivist sieht in dem, was wir (als Erkenntnis) von der Wissenschaft erhalten, nicht das Bild der Wirklichkeit, sondern nur ein Bild – ein Bild, das nicht notwendiger Weise etwas abbildet, sondern eine Repräsentation von Phänomenen ist, die in der Beobachtung erzeugt wurden. „Erkennen“ ist nicht „wahrnehmen“, sondern eine formale Operation, die auf Beobachtung gründet, auf der Kommunikation von inneren Erlebnissen, die nun gemeinsam auf die Außenwelt hin ausgelegt werden. Erkenntnis ist Auslegung, Entscheidung, ein normatives Urteil (Jensen, St. 1999: 331). Diese Beschreibungen bzw. Unterscheidungen in Sprache bilden den kognitiven Bereich des Beobachters und so die einzig mögliche Realität, zu der er bewusst Zugang hat. „Realität ist ein Bereich, der durch Operationen des Beobachters bestimmt wird“ (Maturana, U. 1982: 264). Einmal entstanden, nehmen diese Unterscheidungen für alle praktischen Zwecke realen Charakter an.
Eine Option, die alle Aussagen vom Beobachter ausgehen lässt, sagt jedoch nichts darüber aus, ob es eine vom Beobachter unabhängige Welt gibt oder nicht, sondern besagt nur, dass jede Aussage über die Welt dem kognitiven Bereich eines Beobachters entstammt und auf diesen zurückweist. Die Realität des Konstruktivisten unterscheidet sich auf dieser Ebene nicht von der Realität des Realisten. Der Unterschied beider Realitätsauffassungen besteht einzig in den Annahmen, die hinsichtlich der Entsprechung zwischen der menschlichen Kognition und der Objektwelt gemacht werden. Die Realität unter realistischen Annahmen wird in letzter Konsequenz von den Eigenschaften der Objektwelt vermittelt, die Realität des Konstruktivisten von seinen innerbiologischen Operationen. Deshalb richtet sich sein Interesse auf die Prozesse, die Realität hervorbringen, während den Realisten die Annahme leitet, dass eine fortschreitende Annäherung an die reale Welt durch Verbesserung der Objektivität möglich sei. Die Entscheidung für die eine oder andere Sichtweise beruht letzen Endes auf unbeweisbaren Annahmen (Ludewig, K. 1996: 103-104). Sie bestimmen jedoch, welche Realität erfasst werden kann und schränken somit die Betrachtungsmöglichkeiten ein. Erkenntnisgewinn wird im konstruktivistischen Paradigma auf konstruktive Prozesse des Beobachtens zurückgeführt und nicht als mehr oder minder getreue Abbildung subjektunabhängiger Welteigenschaften verstanden.
Das traditionelle Wahrheitskriterium der Objektivität als Übereinstimmung von Erkenntnis und Objekt wird zugunsten von Nutzenerwägungen des Erkennens aufgegeben. Passung und Viabilität von Beschreibungen und Erklärungen werden vor diesem Hintergrund als Gütekriterien des Wissens diskutiert (Glaserfeld, E. v. 1987). Kurt Ludewig (1995: 59) zieht es in Anlehnung an Humberto Maturana und Francisco Varela (1992) vor, die Qualität des Wissens an das Kriterium der „kommunikativen Brauchbarkeit“ anzubinden. Dieses Kriterium ist dann erfüllt, wenn gezeigt werden kann, dass verschiedene Beobachter mit Hilfe der in Frage stehenden Beschreibung in der Lage sind, die damit beschriebenen Phänomene zu reproduzieren bzw. zu damit angestrebten Zielen zu gelangen.
In der systemisch- konstruktivistischen Perspektive wird das, was wir für „Information“ halten, erst in der Auslegung und Systematisierung dessen, was die Quelle angeblich liefert erzeugt. Sie ist eine besondere Wirklichkeit, die erst erscheint, wenn man bestimmte Methoden anwendet. Wissenschaftliche Realität ist, wie jede andere Realität auch, aus einem Interpretationskonstrukt hervorgegangen, aus partikularen Beobachtungen, die in der anschließenden Kommunikation generalisiert und auf die Wirklichkeit hin ausgelegt werden. Der Prozess der Erkenntnis orientiert sich somit nicht an einer objektiv vorgegebenen Wirklichkeit, sondern an der kulturellen Realität. Die „Wissenschaftsfabrik“ ist Teil der kulturellen Realität und operiert in dieser Wirklichkeit, nicht in der Naturwirklichkeit. Um Wissen oder gar Erkenntnis zu gewinnen, müssen die individuellen Wahrnehmungsinhalte aufeinander abgestimmt werden, um festzulegen, was „wirklich der Fall ist“. Es handelt sich somit um Aushandlungs- und Einigungsprozesse, die zu einer gemeinsamen Deutung der Wirklichkeit führen (333). Hierfür hat Niclas Luhmann (1997) das Konzept einer Beobachtung zweiter Ordnung eingeführt, was bedeutet, eigene Operationen zu reflektieren. Erkenntnistheorie ist somit ein Fall von Beobachtung zweiter Ordnung. Das Fundament, auf dem das Gebäude der Weltbeobachtung durch die Wissenschaft errichtet werden soll, erscheint so als eine Konstruktion, die ihrerseits nicht wissenschaftlich gerechtfertigt werden kann. Das Fundament ist die Kultur, in der sich die Wissenschaft (und die daran beteiligten Reflexionsprozesse) als „Spätkömmling“ entwickelt hat. Daher spricht der Konstruktivismus nur über die kognitive Realität, über Phänomene, die in der (wissenschaftlichen) Beobachtung erscheinen. Aus ihrer Deutung entwickelt sich das wissenschaftliche Weltbild (Jensen, St 1999: 335).
1.3 Kultureller Wandel aus Sicht des systemischen Konstruktivismus
Für Luhmann (1984) ist Kommunikation der basale Prozess, der die Elemente produziert, aus denen soziale Systeme bestehen. Sprache wird zum symbolischen Medium, das die Abläufe innerhalb des Systems steuert. Eine besondere Bedeutung kommt hierbei, Luhmann zufolge, den gesellschaftlichen Medien zu, die kulturelle Muster zwischen Systemen übertragen und zur Replikation des Systems beitragen. Medien werden als zusätzliche Kommunikationseinrichtungen interpretiert, als Strukturen, die den Transfer von Sinnelementen ermöglichen. Die Theorie der Medien umfasst sowohl den Code, in dem kulturelle Muster verschlüsselt sind, als auch den Mechanismus, mit dem sinnvoll codierte Musterbildungen übertragen werden. Die Auswirkungen der Medien auf die Evolution der Gesellschaft hat Luhmann (1997) in seiner Theorie der Gesellschaft dargestellt. Er stellt damit die Verbindung zwischen kulturellem Wandel und den Prinzipien der allgemeinen dynamischen Systemtheorie (Jantsch, E. 1988) her, die das Prinzip des „Werdens“ in die Systemtheorie eingebracht hat. Systembildung und ihre Veränderungsprozesse sind ein dynamisches Geschehen – ein Prozess, in dem diverse verknüpfte Elemente eine Phase durchlaufen, die dem Beobachter als Entwicklung einer Gestalt erscheinen: „Während eine vorgegebene Struktur, etwa eine Maschine, in hohem Maße die Prozesse bestimmt, die in ihr ablaufen können, und somit ihre Evolution verhindert, kann das Zusammenspiel von Prozessen unter angebbaren Bedingungen zu einer offenen Evolution von Strukturen führen. Die Betonung liegt dann auf dem Werden – und selbst das Sein erscheint dann in dynamischen Systemen als ein Aspekt des Werdens. Der Begriff des Systems selbst ist nicht mehr an bestimmte Strukturen gebunden oder an eine wechselseitige Konfiguration bestimmter Komponenten, noch selbst an eine bestimmte Gruppierung innerer oder äußerer Beziehungen. Vielmehr steht der Systembegriff jetzt nur für die Kohärenz evolvierender, interaktiver Bündel von Prozessen, die sich zeitweise in global stabilen Strukturen manifestieren und mit dem Gleichgewicht und der Solidität technischer Strukturen nichts zu tun haben" (32).
Sozialsysteme setzen mindestens zwei Akteure voraus. Die theoretische Aufmerksamkeit richtet sich in der Theorie offener, entwicklungsfähiger Systeme jedoch weniger auf die Akteure als vielmehr auf die Dynamik der Beziehung zwischen ihnen – die soziale Systembildung. Sozialsysteme sind in dieser Betrachtung nichts Substanzielles, sondern Prozesse, in denen sich diverse Komponenten verknüpfen. Bildlich gesprochen entsteht ein Netz. Die Gestalt des Netzes ändert sich im Prozessgeschehen; das Netz fluktuiert, und diese fluktuierende Gestalt (die Fluktuationen, welche das Netz der verknüpften Elemente durchläuft) ist das System – oder anders herum: Gesellschaftliche Systembildungen sind Fluktuationen des Netzes (der Beobachtung) normativer Komponenten (Jensen, St 1999: 401). Die Gesamtheit des in diesem „Netz“ enthaltenen Sinnzusammenhanges bezeichnen Peter Berger und Thomas Luckmann (1987: 103) als „symbolische Sinnwelt“ einer Gesellschaft. Die symbolische Sinnwelt integriere alle Ausschnitte der institutionellen Ordnung in ein umfassendes Bezugssystem, welches als Matrix aller gesellschaftlich objektivierbaren und subjektiv wirklichen Sinnwelt zu verstehen ist. So definiere die symbolische Sinnwelt die gesellschaftliche Wirklichkeit schlechthin, d.h. sie bestimmt, welche Phänomene als gesellschaftliche Wirklichkeit einbezogen und welche ausgegrenzt werden. Je rigider die Normen und Werte der Sinnwelt eines Gesellschaftssystems geworden sind, umso deutlicher reagiert es auf Abweichungen, die von der dynamischen Systemtheorie als positive Rückkopplungen beschrieben werden und mit Destabilisierung und Entwicklung neuer Formen zu tun haben (Jantsch, E. 1988: 31). Das System hat die Tendenz, seine Stabilität durch „negative Rückkopplungsmechanismen“ zu bewahren, die bestrebt sind, die Abweichungen vom Zustand der Ausgeglichenheit zu verringern (38).
So kann der Selbstausdruck und die individuelle Sinnrealisation der Mitglieder einer Gesellschaft zunehmend unterdrückt werden. In Übereinstimmung mit dem physikalischen Gesetz der Erhaltung der Energie glaubte bereits Sigmund Freud, dass ein nicht zu befriedigender Impuls sich im Körper manifestieren müsse. Auch Jacob, Levi Moreno folgerte, dass ein Mensch, der seine Spontaneität nicht in kreativer Entfaltung leben kann, sozusagen ein „Bankkonto“ an Spontaneität anlege. Je mehr ein Mensch darauf trainiert wird, auf die „kulturelle Konserve“ zurückzugreifen statt auf eigene Spontaneität, desto mehr wird es seinem Verhalten an Novität mangeln und eine strikte, rigide oder automatische Konformität zur Folge haben (Moreno, J. L., in: Petzold, H. / Orth, J. 1991: 191). Auf diese Weise entsteht in einer Gesellschaft, in der die Normen und Werte so verfestigt sind, dass sie individuelle Kreativität stark einschränken, ein Spannungspotential, welches nicht auf Dauer unter Kontrolle gehalten werden kann.
Die dynamische Systemtheorie beschreibt, wie die Stabilität offener, zur Entwicklung fähiger Systeme durch dynamische Abweichungen, Fluktuationen ständig auf die Probe gestellt wird. Keine lebendige Struktur lässt sich jedoch auf Dauer stabilisieren. Hat das Spannungspotential einer Gesellschaft eine Schwelle überschritten, in der es nicht mehr kontrolliert werden kann, so entsteht eine kulturelle Krisensituation. Immer mehr „Fluktuationen“ fallen so stark aus, dass sie das System über eine Instabilitätsschwelle in eine neue Struktur treiben. „In dieser Übergangsphase spielen nicht wie sonst makroskopische Durchschnittswerte eine Rolle, sondern Eigenverstärkung und das Durchdringen einer ursprünglich sehr kleinen Fluktuation. Mit anderen Worten, es setzt sich in dieser innovativen Phase das Prinzip der Individualität gegenüber dem Kollektivprinzip durch. Das Kollektiv wird immer versuchen, die Fluktuationen zu dämpfen, was je nach Koppelung der Subsysteme die Lebensdauer des alten Systems verlängern kann. In der Phase der Bildung einer neuen Struktur gilt das Prinzip höchstmöglicher Entropieerzeugung – keine Kosten werden gescheut, wenn es um den Aufbau einer neuen Struktur geht. Doch ist nicht vorbestimmt, welche neue Struktur gebildet wird“ (Jantsch, E. 1988: 38). Auf diese Weise bewirkt eine Verfestigung der Normen und Werte der gesellschaftlichen Sinnwelt eine zunehmende Selbstentfremdung ihrer Mitglieder, die sich nicht mehr im Einklang mit dem Sinnpotential des Systems wahrnehmen. So wird der Sinnverlust zum Katalysator kulturellen Wandels.
1.4 Paradigmenwechsel
Thomas Kuhn hat die Gesamtheit von Hypothesen, Modellen und Theoriegruppen, mit anderen Worten die zugrundeliegende übergreifende Weltsicht als Paradigma bezeichnet. Ein Paradigma ist eine Art umfassender Theorie von solcher Reichweite, dass sie einen Beschreibungs- und Erklärungshintergrund für möglichst alle bekannten Phänomene darstellt. Kuhn beschreibt ein Paradigma als ein Begriffsnetz, durch das die Wissenschaftler die Welt betrachten (Kuhn, Th., in: Schaeffer, M./Bachmann, A. 1988: 144). Die Anerkennung eines bestimmten Paradigmas ist absolut unerlässlich für jede ernsthafte wissenschaftliche Arbeit; denn da die Realität äußerst komplex ist, ist es ein unmögliches Unterfangen, sich mit ihr vollständig zu befassen. So muss der Wissenschaftler die Erforschung eines bestimmten Bereiches auf einen praktikablen Umfang reduzieren. Dabei wirkt das jeweils herrschende Paradigma als Auswahlfilter, so dass nicht vermieden werden kann, dass ein bestimmtes Überzeugungssystem in die Forschung einfließt und andere Arten von Informationen ausgeschlossen werden. Auf diese Weise formt das Paradigma die Wahrnehmung, den Gang der Untersuchung und die Interpretation der Ergebnisse so, dass es selbst bestätigt wird.
Ein Paradigma argumentiert also stets für die Wahrheit seiner eigenen Grundannahmen. Was außerhalb seiner Reichweite liegt, betrachtet es trotzdem aus seiner Perspektive und verzerrt es auf diese Weise, was dann „Falsifizieren“ genannt wird. So können Paradigmen, wie alle Modelle und Theorien, ein sehr nützliches Instrument für die Organisation und Integration des Wissens sein, werden aber zu verzerrenden Wahrnehmungsfiltern, sobald man ihre hypothetische Natur vergisst (Walsh, R. N./Vaughan, F. 1987: 26). Als „normative“ Paradigmen bilden sie jedoch einen unausgesprochen vorausgesetzten Begriffsrahmen und diktieren schließlich, was die „natürliche“ und „vernünftige“ Art, die Welt zu betrachten, ist. Ist ein Paradigma erst einmal implizit geworden (d.h. nicht mehr als bloße Theorie erkennbar), so gewinnt es eine ungeheure, aber unbemerkte Macht über seine Anhänger: „Sie werden zu Gläubigen“ (25). So werden hypothetische Annahmen zu Glaubenssätzen, die festlegen, was als wahr zu gelten hat und was nicht; sie bestimmen die kulturelle Wirklichkeit der Wissenschaft.
Paradigmenwechsel werden dadurch eingeleitet, dass Forschungsergebnisse auftreten, deren charakteristisches Merkmal ihr hartnäckiger Widerstand gegen jede Einordnung in das vorhandene Paradigma ist. Die Konstruktion des sich neu formierenden Theoriegebäudes ist mit dem alten Weltbild unvereinbar. Dies ist Thomas Kuhn zufolge der Brennpunkt, der den Paradigmenwechsel zu einer wissenschaftlichen Revolution macht. Denn durch die Anerkennung des neuen Weltbildes wird festgestellt, dass das alte falsch ist. Parallel mit der entstehenden Unruhe in der Wissenschaft treten in der Gesellschaft in zunehmendem Maße Sinnkrisen auf, die von den „Legitimationsinstanzen der gesellschaftlichen Sinnwelt“ (vgl. Berger, P. / Luckmann, Th. 1987: 112 ff.) trotz intensiver Kontrollmaßnahmen nicht eingedämmt werden können. Die neue Weltanschauung führt innerhalb der Wissenschaft zu sich bekämpfenden Lagern. Da die entgegen gesetzten Parteien aus ihrer dem Paradigma entsprechenden Naturanschauung argumentieren, kann jede Darstellung in sich schlüssig sein. Die Argumente können nur den Status eines Überredungscharakters haben. Der Sieg des neuen Paradigmas wird dann letztlich nur durch die Billigung der Gesellschaft ermöglicht. Die Annahme des neuen Paradigmas erfordert eine völlig neue Definition der Wissenschaft und des Universums (Kuhn, Th., in: Schaeffer, M./Bachmann, A. 1988: 135-138).
Der systemische Konstruktivismus beschreibt das wissenschaftliche Weltbild als die zu einem weltauslegenden Zusammenhang geordneten, kognitiven Sinnfiguren der Wissenschaft, die eine symbolische Struktur bilden (Jensen, St 1999: 339). Der Paradigmenbegriff bezieht sich auf ein gedankliches Ordnungsschema, das eine Gruppe verwendet, um Phänomene der Beobachtung zu organisieren. Das von Kuhn gemeinte „Neue“ entsteht aus der Veränderung des kognitiven Schemas, das Beobachter in ihrem bestimmten Feldbereich verwenden. Die Beobachter verändern ihre Operationen. Sie erweisen sich als überlegen, weil die nunmehr vorgelegte Methode als „die bessere Erklärung“ gegenüber der alten gilt. Dass die Veränderung (des Methodenparadigmas) als generelle Verbesserung der Erklärungsleistung akzeptiert wird, ist ein kulturelles Phänomen (346).
Kuhns Ausführungen haben in der wissenschaftlichen Welt einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Seine Feststellung, dass die „Normalwissenschaften“ nicht nach neuen Hypothesen suchen und nur kumulatives Wissen ohne Neuheiten anhäufen (Kuhn, Th. 1976: 23), ist in der Tat provokativ. Die elementarste Kritik an der Kuhnschen These bezieht sich auf seinen Begriff der Inkommensurabilität. Ein typisches Gegenargument konstatiert, dass solange Theorien erlernbar sind – und sie können nicht anders sein –, sie auch vergleichend beurteilt werden können (Hartmann, D. / Janich, P. 1996: 28). Diese Kritik macht deutlich, dass Kuhns Kritiker das Wesen seines Paradigmabegriffes nicht verstanden haben. Das herrschende Paradigma formt, Kuhns Argumentationslinie folgend, eben auch die Wahrnehmung, den Gang der Untersuchung und die Interpretation der Ergebnisse seiner Kritiker, denn die Vertreter eines Paradigmas argumentieren eben stets für die Wahrheit seiner Grundannahmen und falsifizieren, was diesen Annahmen widerspricht.
Die Inkommensurabilität zwischen unterschiedlichen Paradigmen wird deutlich beim Vergleich zwischen dem systemischen Konstruktivismus, der eine kulturelle Außenwelt für reine Spekulation hält, und dem Realismus, der glaubt durch seine Forschungen ein reales Abbild der Wirklichkeit zu erhalten. Das eine Paradigma schließt das jeweils andere aus. Howard S. Becker (1994:101) verdeutlicht die Bedeutung der Inkommensurabilität, die neben den kognitiven auch subjektive Komponenten enthält, am Beispiel der Kunst: “Jazzmusiker sagen, es `swingt` nicht; Theaterleute sprechen davon, dass eine Szene `rüberkommt` oder `nicht rüberkommt`. In beiden Fällen vermag auch der klügste Insider einem Außenstehenden, der mit dem Spezialjargon der Ingruppe nicht vertraut ist, nicht zu erklären, was diese Vokabeln genau bedeuten.“
1.4.1 Vom metaphysischen Paradigma zum mechanistischen Paradigma
In der metaphysischen Weltschau, vor der Entstehung des mechanistischen Paradigmas, erlebte der Mensch sein persönliches Schicksal als untrennbar mit dem Kosmos verbunden, und diese Verbindung gab seinem Leben Sinn. Er konnte sich zugehörig fühlen. Morris Berman (1983: 16 ff.) bezeichnet die Art des hiermit verbundenen Bewusstseins als „teilhabendes oder partizipierendes Bewusstsein“, welches die Verschmelzung und Identifikation mit der eigenen Umwelt umfasste.
Als im 17. Jahrhundert das metaphysische Weltbild nicht mehr in der Lage war, die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse zu erklären, begann das Denken und Forschen sich aus der kirchlichen Gebundenheit zu lösen, sich auf die Kraft der Persönlichkeit zu gründen und am Diesseits zu orientieren. Nach dem Herausfallen oder Heraustreten aus der göttlichen Weltordnung stand der Mensch schutzlos und verunsichert in der Welt der Erscheinungsformen. Er war gezwungen, sich einen neuen Sinn und eine neue Sicherheit zu suchen. „Dies war nur möglich, indem er das Prinzip der Allmacht auf sich übertrug. Deshalb musste er alles wissen, alles selber machen, um sich nicht mehr abhängig fühlen zu müssen. Die mit Descartes, Galilei und Leibnitz einsetzende stürmische, auf die Mathematik gestützte Naturforschung steht von Anfang an unter dem Druck der Angst, alle Ursachen erkennen zu müssen, um nicht am Ende von unbekannten Mächten überwältigt zu werden“ (Richter, H. E. 1988: 81). Somit musste die Umwelt restlos erkundet und unterworfen werden. Die Ordnungs- und Orientierungslosigkeit, die als Folge des Zerfalls der göttliche Ordnung entstand, wurde durch eine neue, nunmehr mechanistische Gesetzmäßigkeit ersetzt. Diese wurde von Newton als Weltmaschine dargestellt.
Die Natur wurde jetzt als ein System toter, träger Teilchen betrachtet, die durch äußere statt durch innere Kräfte in Bewegung versetzt werden. Die Natur funktioniert nach streng mechanischen Gesetzen und kann durch die Untersuchung der Lage und Bewegung von kleinen Bestandteilen verstanden werden. „Als einheitliches Modell für die Wissenschaft wie für die Gesellschaft hat das Bild der Maschine das menschliche Bewusstsein so restlos durchdrungen und umgestaltet, dass wir heute kaum mehr an seiner Gültigkeit zweifeln. Natur, Gesellschaft und menschlicher Körper setzen sich aus austauschbaren atomisierten Teilchen zusammen, die von außen repariert oder ersetzt werden können“ (Merchant, C. 1987:192). Ein grundlegendes Element dieses Paradigmas ist die strenge Unterscheidung von Geist und Materie, wobei der Geist in der Folge dann gleichgesetzt wurde mit dem Verstand, der der Materie folgerichtig übergeordnet ist. Dieses Verständnis drückt Rene´ Descartes in seiner Feststellung „Cogito ergo sum“ – „Ich denke also bin ich“ aus. Darüber hinaus hatte Descartes Trennung von Geist und Materie eine Spaltung in Objekt und Subjekt zur Folge. Der Wissenschaftler durfte nun davon ausgehen, sozusagen von außen, als objektiver Betrachter, Natur und Menschen beobachten und erklären zu können. So entwickelten sich aus dieser Weltsicht heraus wissenschaftliche Methoden, deren gemeinsames Kennzeichen die analytische Denkweise von Descartes und Newton ist. „Allgemeingültigkeit, Determinismus, Einfachheit und Einheitlichkeit wurden zu den charakteristischen Kennzeichen eines zuverlässigen Wissens, dass auf dem durch Induktion begründeten festen Fundament empirischer Tatsachen basierte“ (Mitchell, S. 2008: 21).
„Die wichtigste Änderung beim mechanistischen Weltbild war die Verlagerung von der Qualität zur Quantität, vom `Warum` nach dem `Wie`. Das Universum, das einst als belebt angesehen wurde und seine Ziele und Zwecke besaß, ist nun eine Ansammlung von träger Materie, die endlos und ohne Sinn herumschwirrt. Der Härtetest für etwas Existierendes ist Quantifizierbarkeit. Ziel der Wissenschaft ist die Kontrolle; Wahrheit ist gleichzusetzen mit Nützlichkeit, mit der absichtlichen Manipulation der Umwelt“ (Berman, M. 1983: 42). Bei dieser Darstellung des mechanistischen Paradigmas sollte jedoch nicht vergessen werden, dass die Zeit der Aufklärung auch ein Befreiungsschlag aus einem erstarrten Paradigma war, welches die Menschen durch die Macht der kirchlichen Moral entmündig hatte. Das Denken mit den Mitteln der Vernunft befähigte die Menschen, sich aus althergebrachten, starren und überholten Vorstellungen, Vorurteilen und Ideologien zu befreien. Hierdurch wurde sowohl ein individueller wie auch gesellschaftlicher geistiger Emanzipationsprozess eingeleitet, der bis heute anhält. Dennoch sollen mit der idealtypischen Darstellung des mechanistischen Paradigmas zentrale Merkmale aufgezeigt werden, die auch die wissenschaftliche Bestimmung von Krankheit und Gesundheit geprägt haben. Denn die Medizin ist eben Teil der Kultur und bestimmt ihre Begrifflichkeit und Erkenntnisse nach den Kriterien, die diese ihr vorgibt.
1.4.2 Der Einfluss des mechanistischen Paradigmas auf die Bedeutung von Gesundheit und Krankheit
Das mechanistische Bild der Materie wurde auf lebende Organismen übertragen. So wurde der Mensch zur Maschine reduziert mit einer rational erklärbaren Seele und einem mechanisch funktionierenden Körper. Der Einfluss des mechanistischen Weltbildes auf die moderne Medizin ließ den Arzt zu einem Körperingenieur werden. Krankheit wird als Funktionsfehler von biologischen Mechanismen angesehen, die mit Hilfe der Zell- und Molekularbiologie untersucht werden können. Die Aufgabe des Arztes ist es, in die Mechanismen einzugreifen, entweder physikalisch (durch Operation) oder chemisch (durch Medikamente), um Fehlfunktionen eines spezifischen Mechanismus zu korrigieren; dabei werden die verschiedenen Körperteile von unterschiedlichen Spezialisten behandelt. Krankheiten sind also immer ein mechanisches Problem und Therapie mechanische Manipulation (Capra, F. 1988: 131 ff.).
Im mechanistischen Paradigma liegt die Sinnhaftigkeit des Lebens im Diesseits. Sie stützt sich auf die Maxime Fortschritt, Leistungsfähigkeit, Effektivität, Selbstständigkeit und Kontrolle. Alle entgegen gesetzten Erscheinungen wie Krankheit, Ohnmacht und Abhängigkeit geraten ins Schattendasein, werden negativ bewertet und gelten als behandlungsbedürftig. Die Aufgabe des Arztes ist demzufolge die Bekämpfung des „unnormalen“ kranken Zustandes und die Herstellung der Symptomfreiheit, die dann Gesundheit genannt wird.
Auch die Psychologie folgte der Logik des mechanistischen Paradigmas. Sie übernahm von Descartes die strenge Unterscheidung von Geist und Materie, so dass sich auch in der Psychologie eine Betrachtungsweise entwickelte, die Körper und Geist voneinander trennt. Auch der Determinismus der Newtonschen Mechanik findet sich beispielsweise in der Freudschen Vorstellung des „psychischen Apparates“ wieder, wenn er sagt: „Wir nehmen an, dass das Seelenleben die Funktion eines Apparates ist, dem wir räumliche Ausdehnung und Zusammensetzung aus mehreren Stücken zuschreiben, den wir uns ähnlich vorstellen wie ein Fernrohr, ein Mikroskop u. dgl..“ (Freud, S. 1989: 9). Ebenso wie Newton die Interaktion von Objekten in einer linearen Ursachen-Wirkungs-Kette beschreibt, vereinigt Freud in seiner Darstellung psychischer Prozesse die Vorstellung räumlich-zeitlicher Ereignissen mit dem Prinzip der Kausalität. „Psychische Elemente“ haben bei ihm alle Eigenschaften materieller Objekte, die durch ihre Ausdehnung, Masse, Position und Bewegung bestimmt sind und sich nicht bewegen oder ausdehnen können, ohne andere zu verdrängen. Eine Ausdehnung des „Ich“ hat immer eine Reduktion des „Es“ oder des „Über-Ich“ zur Folge.
Ein weiterer Aspekt, der einerseits mit der kausal-deterministischen Sichtweise, andererseits mit der cartesianischen Trennung von Körper und Geist verbunden ist, betrifft die Vorstellung des objektiven wissenschaftlichen Beobachters, der in kühler und unbeteiligter Haltung die Daten „rein objektiv“ zur Kenntnis nimmt und in ein objektives Bewertungsschema einordnet (Capra, F. 1988: 195-198.).
Diese kurze exemplarische Darstellung der prägenden Wirkung eines Paradigmas am Beispiel der Medizin soll verdeutlichen, dass es sich eben nicht um eine Ansammlung von Theorien handelt, die erlernt werden können, sondern um ein umfassendes, auf seine Mitglieder zwingend wirkendes Bezugssystem, welches Abweichler als unnormal, krank oder im Bereich der Wissenschaft als unwissenschaftlich ausgrenzt.
2 Kultureller Wandel in der Postmoderne
Das Präfix „post“ drückt ein zeitliches und sachliches Jenseits dieses Zustandes aus, in dem die Gesetzmäßigkeiten und Normen der neuzeitlichen Kultur und Zivilisation nicht mehr greifen. Wurden die „neuzeitlichen Projekte“ innerhalb ihres eigenen Horizonts mit hohem Wahrheits- und Vorbildlichkeitsanspruch entworfen und legitimiert, so wird dieser Horizont nun selbst in Frage gestellt. Normen und Gesetzmäßigkeiten der modernen Gesellschaft werden zunehmend gesprengt und die Aufweichung bisher gültiger Ordnungen und Traditionen gibt einer nie gekannten Pluralität Raum (Preglau, M., in: Morel et. al. 1997: 266).
In der Postmoderne vernetzt sich die Gesellschaft immer mehr durch einen digitalen Medienverbund in einem globalen Weltsystem. Das Verhalten der Teilnehmer des „globalen Netzes“ wird nur noch aus dem Systemzusammenhang verständlich. Der Geltungsbereich des „Kultursystems“ büßt in einem globalen Weltsystem seinen Anspruch auf universale Zuständigkeit immer mehr ein. Globalisierung bedeutet ein zunehmendes Verschwinden von universalen kulturellen Ansprüchen und Zuständigkeiten. In einem globalen Weltsystem wird es keinen einzelnen Entwurf kultureller Identität mehr geben, der die unterschiedlichen Kulturen dominiert und allgemeine Verbindlichkeit beanspruchen kann. In diesem Sinne ist die Kultur eines Weltsystems eine nachhegemoniale Kultur (Bergesen, A. 1998).
Vor diesem Hintergrund stellt der Postmodernismus eine kulturelle Orientierung dar, die in dem Orientierungssystem des modernen Weltbildes, der modernen Kultur und ihres Wertesystems eine Zäsur vornimmt. Ihre Grundhaltung ist ein Skeptizismus gegenüber Expertentum, der aus der Inkommensurabilität sich widersprechender Deutungsansprüche einer chaotischen Mannigfaltigkeit der Wirklichkeit resultiert. Eine solche postmoderne Kultur und Zivilisation entzieht sich folglich auch den Erkenntnismöglichkeiten der exakten Wissenschaft und den Zugriffsversuchen der sozialen Herrschaft (Morel et al. 1997: 265). Sprache verliert ihren Realitätsbezug; es gibt keine Tatsachen, sondern nur Interpretationen. Die Postmoderne kann man somit als Grundsituation des sozialen Wandels und des Umbaus des kulturellen Orientierungssystems bezeichnen, der dahin geht, dass „Ziele“ und „Werte“ der Kultur keinen universalen Anspruch mehr erheben können.
2.1 Anstieg von Komplexität und Risiko als Folge der Ziel- und Zweckorientierung des mechanistischen Paradigmas
Die Gesellschaft ist sich selbst zum dominanten Risiko geworden. Ihr Fortbestand wird von ihr durch selbsterzeugte Risiken bedroht. Dies ist lt. Ulrich Beck (1986) der Preis, der für den Fortbestand der „Moderne“ gezahlt wird. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um ein zwingendes Gesetz sozialer Evolution, sondern um eine gesellschaftliche Pathologie. Sie ist die Antwort auf die Weltsicht automatischer Gesetzmäßigkeiten, die sich seit der Aufklärung durchgesetzt hat (Blanke, Th. 1990: 139). „Durch die gezielte Zweckverfolgung nehmen wir bewusst oder unbewusst selbsterzeugte Risiken in Kauf, die unseren Fortbestand bedrohen“ (134 f.). „Wir hatten gehofft, diese Natur in eine Hierarchie hineinzubekommen, die unserem alten Bild entspricht. Diese Hierarchie hat versagt. Die eigentlich schwierigen Probleme sind komplex. Sie sind derart, dass ich alle Menschheitsprobleme im Schoß habe, wenn ich an einer Stelle anfange zu ziehen. Bei einer solchen Verfilzung und Vernetzung der verschiedenen Kausalketten ist der Wissenschaftler überfordert. Er kann nur umgehen mit Problemen, die man auseinanderdröseln kann. Das ist auch der Grund, warum er so verschreckt ist und sich auf Probleme zurückzieht, die er lösen kann“ (Dürr, H. P. 1991: 19).
Ein Kernargument der Risikogesellschaft ist die besondere Qualität neuer Risiken. Sie treten als Nebenfolgen der industriellen Moderne in Erscheinung und sind verantwortlich für ihre Selbsttransformation (Beck, U. 1999: 77). Es sind in diesem Sinne die objektiven Qualitäten neuer Risiken, die es der Gesellschaft so schwer machen, mit ihnen in herkömmlicher Weise umzugehen. Mit seinem Konzept der Hybridität (27 ff.) rechtfertigt Beck seinen Risikoobjektivismus, indem er die Trennung von Natur und Kultur als eine Idee darstellt, die sich erst in der Moderne durchsetzte. Es sei unmöglich, die beiden Seiten trennscharf voneinander zu unterscheiden. Zugang zur Natur sei nur durch kulturell provozierte Beobachtungsstrategien möglich und Kultur sei ohne eingewobene Natur nicht denkbar. Wissenschaftliche Analysen könnten sich entsprechend nur daran abarbeiten, die Hybridität von Natur- / Kultur- Konstrukten zu beschreiben. Diese Problematik wird im Kontext der Risikovergesellschaftung noch einmal besonders deutlich. Denn die wissenschaftlich unterstellte Beherrschbarkeit und Kontrolle der Natur hat die impliziten normativen Annahmen bisher verdeckt. Der bis dahin stillschweigend unterstellte gesellschaftliche Wertekonsensus wird mit den Grenzen der Bearbeitbarkeit erneut zum Thema und in Frage gestellt. Die bis dahin als wünschenswert angesehene technische und wissenschaftliche Entwicklung wird durch ihre ungesehenen oder ausgeblendeten Nebenfolgen selbst fraglich und das Wissensmonopol der Wissenschaften aufgebrochen (Beck, U. 1986: 38). Mangelndes Wissen oder besser wachsendes Wissen über Nicht-Wissen ruft einerseits nach Strategien der Bearbeitung von Nicht-Wissen, andererseits nach normativ-moralischer Wertung.
Beck beschränkt Risikofragen jedoch nicht auf Umweltrisiken. Mit der Individualisierungsthese adressiert er „institutionenabhängige Individuallagen“. Für die gesellschaftliche Form des Zusammenhanges von Zweckerreichung und riskanten Nebenfolgen erscheint Beck der unaufhaltsame Trend zur Vereinzelung und Individualisierung bedeutsam. Er signalisiere den Siegeszug des Primats subjektiver Zweckverfolgung auf der Basis individueller Präferenzen (12 ff.). Entscheidungszwang und Entscheidungsunmöglichkeit bei gleichzeitiger individueller Verantwortungszurechnung würden das Individuum in ganz neuer und ungeahnter Form unter Druck setzen. In Becks Individualisierungsthese sind die Gestaltungswünsche und Gestaltungsnormen eines modernen Individuums verbunden. Unsicherheitsbearbeitung und Risikobewältigung werden so zu einem individuell zu bearbeitenden und zu verantwortenden Projekt (206 ff.).
In der systemtheoretischen Perspektive erscheint Risiko als Form gesellschaftlicher Selbstbeobachtung. Sie ist typisch für moderne Gesellschaften, die sich primär in Kategorien von Handeln und Entscheiden beschreiben anstelle von Zufall, Schicksal oder göttlicher Fügung. Durch den Wandel von einer stratifikatorischen (d.h. in Schichten und Stände) differenzierten Gesellschaft zu einer funktional differenzierten Gesellschaft, deren Funktionssysteme sich durch spezifische Codes gegenüber anderen gesellschaftlichen Bereichen abschließen, werden sie füreinander undurchschaubar. Dies hat zur Folge, dass es keine gesellschaftliche (Beobachtungs-)Position mehr gibt, die Allgemeingültigkeit für sich beanspruchen kann (vgl. Bonss, W. 1995: 64 ff).
Luhmann definiert (1984) die kleinste konstitutive Einheit von sozialen Einheiten und Gesellschaft als Kommunikation. Handlungen und Entscheidungen werden in diesem Sinne nur insofern sozial konstituiert, wie sie kommunikativ hergestellt werden. Da es keine allgemeingültige (Beobachtungs-)Position mehr gibt, existieren auch keine absoluten Gewissheiten mehr. Entscheidungen sind somit per definitionem immer riskant. In funktional differenzierten Gesellschaften wird Entscheiden und Verantwortungszuschreibung zum Dauerproblem und damit Risiko zur zentralen Größe gesellschaftlicher Selbstbeschreibung (Bonss, W. 1995: 64 ff). Mit wachsender Komplexität gesellschaftlicher Kommunikations- und Austauschprozesse, den zeitlich wie räumlich immer weiter ausufernden Interdependenzen sozialer Interaktionen, haben sich nicht nur die Handlungsoptionen potenziert, sondern auch die Reichweite der Handlungsfolgen sowie die Schwierigkeiten, diese abzuschätzen.
Diese Offenheit wurde und wird nicht allein als positive Erweiterung von Möglichkeiten, sondern zugleich als verstörende Entgrenzung erfahren. In dem Maße, wie für die Unwägbarkeit des menschlichen Lebens nicht länger ein göttliches Schicksal verantwortlich gemacht werden kann, erscheint es möglich und unabweisbar nötig, die bedrohlichen Seiten der Kontingenz aus eigener Kraft unter Kontrolle zu bringen (vgl. Bröckling, U. 2008). Hierzu ist es jedoch erforderlich, die Folgen des eigenen Handelns zu antizipieren und negative Folgen durch Prävention zu vermeiden. Dies ist aber immer weniger möglich, da es keine allgemeingültigen Gewissheiten mehr gibt. Vielmehr kann präventives Handeln selbst neue Risiken erzeugen – das Problem jeder Schutzimpfung. So lässt die Risikogesellschaft die bekannte Logik, die Auswirkungen gegenwärtiger Ereignisse im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf künftige Ereignisse zu beurteilen, obsolet werden. Prävention ufert unter dem Aspekt unberechenbarer und unvorhersehbarer Handlungsplanung aus (Kreissl, R. 200: 47).
Aus systemtheoretischer Sicht erweist sich Prävention als ein selbstreferentielles Unterfangen. Sie konstruiert die Bedrohung, gegen die sie Abhilfe verspricht. Insofern ist sie ein gesellschaftlich erzeugtes Kulturprodukt, welches die Ideologie des mechanistischen Paradigmas, alles sei beherrsch- und kontrollierbar, obsolet werden lässt. So erscheint es angemessen, von einer Krise des mechanistischen Paradigmas zu sprechen.
2.2 Individualisierung und die Auflösung gesellschaftsstabilisierender Normen und Werte
Ein Trend zu einer stärkeren Individualisierung und damit auch zu einer verstärkten Abkehr von gemeinsamen, allgemeinverbindlichen Normen und Werten wurde bereits von Durkheim (1992: 421-442) erkannt. Ursache hierfür sei die zunehmende Arbeitsteilung der Industrie. Insbesondere das Auftauchen der Großindustrie habe zu einer zunehmenden Zersplitterung und damit zur Desintegration der Individuen geführt. Die von ihm bereits 1889 erkannte Tendenz erreicht in der Postmoderne ihren vorläufigen Höhepunkt und wird mit einer Vielzahl von Ursachen in Zusammenhang gebracht. Zygmund Baumann (2008: 7 ff.) spricht von einem Übergang von der „festen“ zur „flüchtigen“ Phase der Moderne, in der soziale Formen ihre Gestalt nur für kurze Zeit behalten und schnell wieder zerfallen. Als Bezugsrahmen für menschliches Handeln oder gar für langfristige Lebensstrategien seien sie untauglich. Das Fehlen politischer Kontrolle sei eine Quelle tiefer Ungewissheit. Die Machtlosigkeit politischer Institutionen mit ihren Vorhaben und Initiativen lässt ihre Relevanz für die täglichen Probleme der Bürger schwinden, weshalb man ihnen immer weniger Aufmerksamkeit schenkt. Durch den Abbau staatlicher Sicherungssysteme gegen Schicksalsschläge und individuelles Scheitern würde die Attraktivität kollektiven Handelns und die sozialen Grundlagen gesellschaftlicher Solidarität untergraben. Zwischenmenschliche Bindungen würden immer brüchiger und als vorübergehend betrachtet. Der Begriff der „Gemeinschaft“ bekomme einen hohlen Klang. Die Gesellschaft werde immer mehr zu einem „Netzwerk“ zufälliger Verbindungen und Trennungen und werde als Matrix einer unendlichen Fülle möglicher Permutationen wahrgenommen. Das Leben jedes Einzelnen werde zu einer Reihe kurzfristiger Projekte und Episoden zusammengefügt.
Gerhard Preyer (2007) zufolge ist es vor allem die Globalisierung der Kommunikation und die Teilnahme an einem digitalen Medienverbund, die zur Auflösung allgemeinverbindlicher Normen und Werte sowie zu einer fortschreitenden Individualisierung bei gleichzeitiger „recursiver Vernetzung“ führen. Globalisierung wird als eine kulturelle globale Melange beschrieben, die eine modernistische individualistische (Rollen-) Identität auflöst. Durch eine kulturelle Globalisierung erfolgt nicht nur die Verbreitung westlicher Werte. Im gegenläufigen Prozess erfolgt auch eine Öffnung gegenüber nicht-westlichen Kulturen und Praktiken von Seiten der sozialen Systeme, zum Beispiel die Assimilation japanischer Managementstrategien, aber auch eine neue Rezeption asiatischer Religionen und Philosophien, z. B. des Buddhismus. Die kulturelle, ästhetische, aber auch die moralische Globalisierung führt zu einer Konkurrenz von Deutungsangeboten, die zu immer neuen Differenzerfahrungen führen. Die Massengesellschaft wandelt sich um zu einer segmentierten Gesellschaft, die durch die klassische soziologische Betrachtung von Kultur als gemeinsam geteilte Werte und Überzeugungen nicht mehr beschrieben werden kann. Die Mitglieder der Gesellschaft lösen sich zunehmend aus den als beengend empfundenen lokalen, kulturellen und familiären Bindungen. Dies stellt eine Befreiung, aber auch einen Verlust an Halt gebender Geborgenheit dar.
[...]
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2009
- ISBN (eBook)
- 9783842812765
- Dateigröße
- 632 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Hamburg – Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Studiengang Kriminologie
- Erscheinungsdatum
- 2014 (April)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- neurobiologie psychiatrie systemtheorie konstruktivismus kontrollkultur
- Produktsicherheit
- Diplom.de