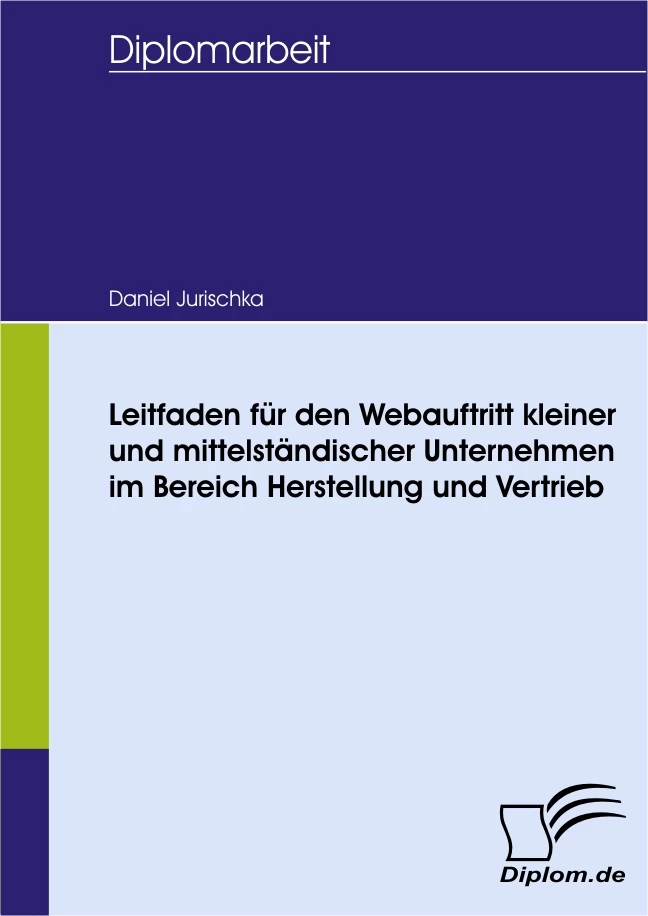Leitfaden für den Webauftritt kleiner und mittelständischer Unternehmen im Bereich Herstellung und Vertrieb
Zusammenfassung
Das Internet wird als Plattform verwendet, auf der Unternehmen unabhängig von Raum und Zeit präsent sein können. Diese Möglichkeit eröffnet neue Sphären: ein neuer Markt entsteht, potentielle Kunden werden auf ein Unternehmen durch die Verwendung von Suchmaschinen aufmerksam und können jederzeit unabhängig von Geschäftszeiten mit Informationen versorgt werden. Jedoch wird der Wettbewerb durch mehr Konkurrenz im Internet zunehmend größer und der Bedarf für professionelle Online-Auftritte wächst ständig, da Kunden eine zunehmend anspruchsvolle Erwartungshaltung an Websites von Unternehmen entwickeln. Dies gilt auch für Webauftritte von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Gerade kleinere Unternehmen haben jedoch häufig noch keinen professionellen Webauftritt, da ihnen oftmals die Bedeutung und Möglichkeiten einer Website nicht bekannt sind, unklar ist, wie man bei der Erstellung einer Website vorgehen muss oder Kapazitäten nicht vorhanden sind, um einen geeigneten Online-Auftritt zu entwickeln.
Diese Diplomarbeit soll eine Hilfestellung für kleine und mittelständische Unternehmen im Bereich Herstellung und Vertrieb darstellen. Dabei wird aufgezeigt, welche Aspekte bei der Planung eines Webauftritts beachtet werden müssen (Kapitel 3) und durch welche technischen Systeme die Erstellung von Webseiten und die Pflege von Website-Inhalten unterstützt werden können (Kapitel 4). Im zweiten Kapitel wird vorerst der Begriff der kleinen und mittelständischen Unternehmen näher beleuchtet und auf Unterschiede zu Großunternehmen eingegangen, um eine Kenntnisgrundlage für die darauffolgende Darstellung der Bedeutung dieser Unternehmensgruppe für die Wirtschaft zu schaffen. In diesem Kapitel wird ein fiktives Beispielunternehmen aus dem Bereich Herstellung und Vertrieb eingeführt, anhand dessen im weiteren Verlauf der Diplomarbeit die theoretischen Aspekte veranschaulicht werden.
Die Absicht dieser Diplomarbeit ist die Beantwortung folgender Fragestellungen: Was sind klein- und mittelständische Unternehmen und welche Bedeutung hat ein Webauftritt für sie? Was muss bei der Planung eines Webauftritts berücksichtigt werden? Wie lassen sich diese Anforderungen technisch umsetzen?
An dieser Stelle sollen einige in dieser Arbeit verwendeten Begrifflichkeiten definiert und kurz erläutert werden. Die Begriffe Website und Webseite finden unterschiedliche Verwendung. Dabei ist eine Website der Webauftritt als Ganzes und beinhaltet somit die […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Kleine und mittelständische Unternehmen
2.1 Definition von KMU
2.2 Unterschiede zwischen KMU und Großunternehmen
2.3 Bedeutung für die Wirtschaft
2.4 Wirtschaftsbereich Herstellung und Vertrieb – ein Beispielunternehmen
3 Planung eines Webauftritts
3.1 Informationsbedarf und Erwartungen der Website-Benutzer
3.2 Ziele eines Webauftritts für Unternehmen
3.3 Zugangswege zur Website
3.3.1 Webkataloge
3.3.2 Suchmaschinen
3.4 Website-Inhalte
3.5 Hosting einer Website
3.6 Berücksichtigung von Kosten
4 Content Management Systeme
4.1 Begriffsdefinition
4.2 Funktionsweise
4.2.1 Aufgabenbereiche
4.2.2 Unterstützende Funktionen
4.3 Auswahl eines CMS
4.3.1 Bedienbarkeit
4.3.2 Integrationsfähigkeit
4.3.3 Zukunftsfähigkeit und Erweiterbarkeit
4.3.4 CMS als Standardlösung oder individuell entwickeltes System
4.4 Vergleich von Joomla! und Typo3
5 Fazit
Anhangsverzeichnis
Anhang
Referenzen
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1 KMU-Definition der Europäischen Kommission
Tabelle 2 KMU-Definition des Instituts für Mittelstandsforschung Bonn
Tabelle 3 KMU und Großunternehmen im Vergleich
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1 Erwartungen von Benutzern an Websites
Abbildung 2 Erwartungen von Unternehmen an einen Webauftritt
Abbildung 3 Evolutionsprozess der Website-Entwicklung
Abbildung 4 Client-Server Interaktion zum Abruf statischer Webseiten
Abbildung 5 Client-Server Interaktion zum Abruf dynamischer Webseiten
Abbildung 6 Visuelle Begriffserklärung von WCMS
Abbildung 7 Template-basierte Generierung einer Webseite
1 Einleitung
Das Internet wird als Plattform verwendet, auf der Unternehmen unabhängig von Raum und Zeit präsent sein können. Diese Möglichkeit eröffnet neue Sphären: ein neuer Markt entsteht, potentielle Kunden werden auf ein Unternehmen durch die Verwendung von Suchmaschinen aufmerksam und können jederzeit unabhängig von Geschäftszeiten mit Informationen versorgt werden. Jedoch wird der Wettbewerb durch mehr Konkurrenz im Internet zunehmend größer und der Bedarf für professionelle Online-Auftritte wächst ständig, da Kunden eine zunehmend anspruchsvolle Erwartungshaltung an Websites von Unternehmen entwickeln. Dies gilt auch für Webauftritte von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Gerade kleinere Unternehmen haben jedoch häufig noch keinen professionellen Webauftritt, da ihnen oftmals die Bedeutung und Möglichkeiten einer Website nicht bekannt sind, unklar ist, wie man bei der Erstellung einer Website vorgehen muss oder Kapazitäten nicht vorhanden sind, um einen geeigneten Online-Auftritt zu entwickeln.
Diese Diplomarbeit soll eine Hilfestellung für kleine und mittelständische Unternehmen im Bereich Herstellung und Vertrieb darstellen. Dabei wird aufgezeigt, welche Aspekte bei der Planung eines Webauftritts beachtet werden müssen (Kapitel 3) und durch welche technischen Systeme die Erstellung von Webseiten und die Pflege von Website-Inhalten unterstützt werden können (Kapitel 4). Im zweiten Kapitel wird vorerst der Begriff der kleinen und mittelständischen Unternehmen näher beleuchtet und auf Unterschiede zu Großunternehmen eingegangen, um eine Kenntnisgrundlage für die darauffolgende Darstellung der Bedeutung dieser Unternehmensgruppe für die Wirtschaft zu schaffen. In diesem Kapitel wird ein fiktives Beispielunternehmen aus dem Bereich Herstellung und Vertrieb eingeführt, anhand dessen im weiteren Verlauf der Diplomarbeit die theoretischen Aspekte veranschaulicht werden.
Die Absicht dieser Diplomarbeit ist die Beantwortung folgender Fragestellungen: Was sind klein- und mittelständische Unternehmen und welche Bedeutung hat ein Webauftritt für sie? Was muss bei der Planung eines Webauftritts berücksichtigt werden? Wie lassen sich diese Anforderungen technisch umsetzen?
An dieser Stelle sollen einige in dieser Arbeit verwendeten Begrifflichkeiten definiert und kurz erläutert werden. Die Begriffe Website und Webseite finden unterschiedliche Verwendung. Dabei ist eine Website der Webauftritt als Ganzes und beinhaltet somit die Gesamtheit aller Webseiten. Webseiten wiederum sind einzelne HTML-Dokumente, die von einem Webbrowser dargestellt werden.
Des Weiteren wird stets unter dem Begriff Unternehmen ein klein- und mittelständisches Unternehmen verstanden. Alle Ausführungen zu Webauftritten und Herangehensweisen in dieser Diplomarbeit richten sich an solche kleinen und mittelständischen Unternehmen.
Mit dem Wirtschaftsbereich Herstellung und Vertrieb ist in dieser Diplomarbeit das produzierende Gewerbe gemeint. Da dieses Gewerbe sehr divers ist, versucht diese Arbeit möglichst allgemeingültige Aussagen zu treffen, weshalb keine detaillierten Ausführungen zu einzelnen Etappen der Wertschöpfungskette und den darin eingegliederten Unternehmen gemacht werden.
2 Kleine und mittelständische Unternehmen
Unternehmen sind sehr verschiedenartig. So gibt es bedeutende Unterschiede in deren Größe, Wirtschaftsbereich, Zielsetzung, Organisationsform, ethnischer Hintergrund, Wissensstand, verfügbare Ressourcen, Innovationspotential etc.[1] Diesbezüglich sind Unternehmen in unterschiedliche Bereiche klassifizierbar und werden häufig in Gruppen mit gemeinsamen Merkmalen zusammengefasst.
In Abschnitt 2.1 soll eine Begriffsdefinition von kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) erfolgen, die sich auf die in der Literatur angebotenen Definitionen bezieht und diverse Klassifikationsmöglichkeiten berücksichtigt. Weiterhin werden Unterschiede zwischen KMU und Großunternehmen (Abschnitt 2.2) und die Bedeutung für die Wirtschaft (Abschnitt 2.3) dargestellt. Nachdem allgemeingültige Aussagen zu KMU getroffen wurden, werden in Abschnitt 2.4 die Besonderheiten von KMU im Bereich Herstellung und Vertrieb verdeutlicht. Dabei wird ein fiktives Beispielunternehmen für den Bereich Herstellung und Vertrieb vorgestellt, an dem die theoretisch dargestellten Aspekte der darauf folgenden Abschnitte praktisch veranschaulicht werden.
2.1 Definition von KMU
In der Literatur werden Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen unter dem Begriff KMU zusammengefasst.[2] Deren Definition und Abgrenzung von Großunternehmen erfolgt meist sowohl anhand von quantitativen als auch von qualitativen Merkmalen.
Zu den gebräuchlichsten quantitativen Merkmalen zählen der Jahresumsatz, die Jahresbilanzsumme und die Anzahl der Beschäftigten. Diese dürfen eine festgelegte Obergrenze nicht überschreiten, um als KMU klassifiziert zu werden.
Wie in Tabelle 1 dargestellt, gehören laut der Europäischen Kommission Unternehmen zu den KMU, die weniger als 250 Beschäftigte haben und einen Jahresumsatz von maximal 50 Mio. Euro oder eine Jahresbilanzsumme von maximal 43 Mio. Euro aufweisen.[3]
Für die Begriffsdefinition von KMU wurden von der Europäischen Kommission eindeutig messbare Kriterien gewählt, um eine Voraussetzung für Förderprogramme für Unternehmen durch die öffentliche Hand zu schaffen. Dadurch wird garantiert, dass nur jene Unternehmen wirtschaftliche Unterstützung erhalten, die auch darauf angewiesen sind und eine bestimmte Unternehmensgröße haben.[4]
Tabelle 1: KMU-Definition der Europäischen Kommission
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an: Europäische Kommission, 2006, S. 14.
Eine von der Europäischen Kommission abweichende Definition gibt es bspw. vom Institut für Mittelstandsforschung Bonn.[5] Demnach zählen zu KMU Unternehmen mit weniger als 500 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von maximal 50 Mio. Euro, wie auch in Tabelle 2 verdeutlicht wird.
Tabelle 2: KMU-Definition des Instituts für Mittelstandsforschung Bonn
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an: Institut für Mittelstandsforschung Bonn 2009.
Da es keine einheitliche KMU-Definition gibt, ist die Vergleichbarkeit empirischer Studien und Statistiken über KMU problembehaftet, insofern unterschiedliche KMU-Definitionen zu Grunde gelegt werden.
Eine weitere Klassifizierung von KMU kann anhand von qualitativen Merkmalen erfolgen. Eines der zentralen, für KMU typischen Merkmale ist das Verhältnis zwischen dem Unternehmen und dem Unternehmenseigentümer. Die qualitativen Faktoren beziehen sich hierbei auf das Mitwirken des Eigentümers an der Unternehmensführung.[6] Dabei ist die persönliche Verantwortung für Erfolg und Misserfolg und somit auch die finanzielle Situation des Unternehmens als qualitative Besonderheit spezifisch.[7] Daher liegt die wirtschaftliche Autonomie in KMU in den meisten Fällen bei der Unternehmensführung.[8]
Darüber hinaus sind KMU oft traditionsorientierte Familienunternehmen, die gewachsene Familienstrukturen widerspiegeln und (Familien-)Traditionen als einen wichtigen Bestandteil der Unternehmenskultur sehen. Daraus könnte sich eine weitere qualitative Eigenschaft von KMU ableiten lassen: oft kann eine persönliche Bezugsebene zwischen Beschäftigten und Unternehmensführung festgestellt werden. Aufgrund der kleinen Zahl von Hierarchieebenen können Geschäftsprozesse mit geringem Formalisierungsgrad und ohne große Umwege ablaufen. Die Kommunikationswege in KMU sind formeller, häufig aber auch informeller Art und somit direkter, kürzer sowie effizienter und laufen vermehrt auf persönlicher Bezugsebene ab.[9]
Aufgrund der Vielfältigkeit der qualitativen Merkmale von KMU werden in dieser Diplomarbeit nur die quantitativen Kriterien für die Definition des Begriffes verwendet. Hierbei wird für die Abgrenzung der KMU von Großunternehmen die oben dargestellte Definition der Europäischen Kommission zu Grunde gelegt.
2.2 Unterschiede zwischen KMU und Großunternehmen
Um die Unterschiede zwischen KMU und Großunternehmen zu veranschaulichen, werden einige prägnante Merkmale herausgegriffen und erläutert. Dabei sind insbesondere Unternehmensführung, Organisation, Forschung und Entwicklung, Ressourcen sowie Medienpräsenz von Bedeutung. Um einen Überblick über diese Aspekte zu bekommen, stellt Tabelle 3 die Merkmale von KMU und Großunternehmen gegenüber.
Tabelle 3: KMU und Großunternehmen im Vergleich
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an: Ergenzinger, Rudolf et al., 2006, S. 67 f.; Verworn, Birgit et al. 2000, S. 4 f.; Bergmann, Lars et al., 2009, S. 5 ff. und Hilzenbecher, Uwe, 2006, S. 89 f.
Wie in Tabelle 3 ersichtlich, haben KMU einige Nachteile gegenüber Großunternehmen. So sind KMU aufgrund ihrer geringen finanziellen und personellen Ressourcen in ihren wirtschaftlichen Aktivitäten eingeschränkt. Weiterhin beschränkt sich der Bekanntheitsgrad von KMU auf ein bestimmtes regionales Einzugsgebiet. Darüber hinaus sind diese oftmals nur mäßig attraktiv für Hochqualifizierte.
Aber KMU haben auch bedeutende Vorteile gegenüber Großunternehmen. Neben den in Tabelle 3 dargestellten Vorteilen bilden KMU ein Gegengewicht zu global ausgerichteten multinationalen Unternehmen, die mit ihren wirtschaftlichen Verflechtungen und Einflüssen sehr viel Marktmacht aufweisen. Doch decken diese Großunternehmen nicht die gesamte Nachfrage auf dem Markt ab. Die bestehenden Nischen[10] können von KMU bedient werden. Vorteilhaft sind dabei auch ihre Flexibilität und Kundennähe, wodurch schnell auf veränderte Marktanforderungen reagiert werden kann.[11] Diese hier herausgestellten Besonderheiten von KMU sind nicht nur für die Unternehmen selbst von Bedeutung, sondern haben großen Einfluss auf die gesamtwirtschaftliche Situation, die im nächsten Abschnitt hervorgehoben wird.
2.3 Bedeutung für die Wirtschaft
KMU spielen eine wesentliche Rolle für die Volkswirtschaft und werden deshalb in der Literatur oftmals auch als tragende Säule oder Motor der Wirtschaft bezeichnet.[12] Sie leisten einen entscheidenden Beitrag für die Stabilisierung und Entwicklung von Wirtschaftsstandorten und treiben den Strukturwandel einer Volkswirtschaft voran.[13]
Etwa 99,3 % aller Unternehmen in Deutschland sind KMU. Durch ihre Existenz entstehen Arbeits- und Ausbildungsplätze. So waren im Jahr 2008 von den 20,7 Millionen Beschäftigten in Deutschland nahezu 60 % in KMU beschäftigt. Davon waren 18 % der Beschäftigten in Kleinstunternehmen, 22 % in Kleinunternehmen und 19 % in mittleren Unternehmen erwerbstätig.[14] Gemäß des Deutschen Bundestages (14. Wahlperiode) wurden ca. 80 % aller Ausbildungsplätze in Deutschland durch KMU zur Verfügung gestellt. KMU übernehmen damit nicht nur eine wirtschaftliche, sondern auch eine soziale Verantwortung in der Gesellschaft.[15] Doch nicht nur Deutschland kann eine solche Bedeutung von KMU für Arbeitsplätze aufweisen: rund 60 – 70 % aller Beschäftigten in den Mitgliedsländern der Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sind in KMU angestellt.[16]
KMU erlangen als Arbeitgeber einen immer größeren Einfluss. Dies zeigt eine empirische Untersuchung der Europäischen Kommission, in der festgestellt wurde, dass das durchschnittliche jährliche Wachstum der Mitarbeiterzahl in KMU von 1988 bis 2001 0,3 % betrug. Während dessen hat sich die Beschäftigung in Großunternehmen jährlich um durchschnittlich 0,1 % verringert. Diese Daten stellen klar heraus, dass Großunternehmen dazu tendieren, die Anzahl der Beschäftigten zu reduzieren, während die Beschäftigung in KMU steigt.[17] Grund dafür ist u.a. der immer größer werdende Outsourcing-Bedarf[18] von Großunternehmen, um sich auf Kernkompetenzen zu beschränken und ihre (auch internationale) Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.
Eine weitere Bedeutung der KMU für die Wirtschaft ist der Ausbau der Infrastruktur einer Region als Betriebsstättenstandort für KMU. Durch die Schaffung einer modernen und bedarfsgerechten Infrastruktur können die Anforderungen der Unternehmungen an den Wirtschaftsstandort (bspw. Anfahrwege oder Telekommunikationsanschlüsse) gedeckt werden. Dies wird auch dadurch möglich, dass KMU in ihren Ansiedlungsgebieten kommunale Abgaben (bspw. Gewerbe- oder Grundsteuer) tätigen müssen, wodurch wiederum Investitionsmöglichkeiten für Bildung und Infrastruktur in der entsprechenden Region entstehen. All diese Beiträge werden dort geleistet, wo sich KMU ansiedeln. Je attraktiver ein Wirtschaftsstandort für KMU ist, desto größer ist der Mehrwert für die Region. Deshalb ist es auch für ländliche Regionen und deren Entwicklung wichtig, dass sich KMU in diesen Bereichen ansiedeln. Primär durch die zahlreiche Existenz von KMU entstehen großflächig Arbeitsplätze und Wirtschaftsstandorte.
Die große wirtschaftliche Bedeutung von KMU wurde auch von der Europäischen Kommission erkannt, welche diese Art von Unternehmen mit diversen Maßnahmen fördert, um wirtschaftliches Wachstum voranzutreiben.[19] Der Anteil am europäischen BIP liegt laut Europäischer Kommission bei mehr als zwei Drittel und zeigt somit deren großen wirtschaftlichen Einfluss.[20]
Für die Entwicklung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit spielen KMU eine bedeutende Rolle für Deutschland. Mit ihrer Kreativität und unternehmerischen Fähigkeiten bringen sie neue Ideen sowie innovative Produkte und Verfahren hervor und wahren somit auch die Chance auf wirtschaftliches Wachstum. Laut der Bundesregierung Deutschland bringen jedes Jahr mehr als 100.000 Unternehmen[21] technologische Neuheiten oder innovative Produkte auf den Markt.
Trotz der hohen gesamtwirtschaftlichen Bedeutung von KMU ist deren Bedeutung in verschiedenen Wirtschaftsbereichen sehr unterschiedlich ausgeprägt. So waren in Deutschland 2005 ca. 90 % aller Erwerbstätigen des Bereiches Bau- und Gastgewerbe bei KMU beschäftigt. Weiterhin wurde mehr als 80 % des gesamtdeutschen Umsatzes des Bau- und Gastgewerbes von KMU erwirtschaftet.
Im Bereich der Energie- und Wasserversorgung waren KMU weitaus weniger bedeutsam für die Wirtschaft als es Großunternehmen waren, wobei hier der Anteil nur bei etwa 10 % des Umsatzes und 20 % der Beschäftigung ausmachten.[22]
2.4 Wirtschaftsbereich Herstellung und Vertrieb – ein Beispielunternehmen
Wie bereits in der Einleitung erwähnt, zählen Unternehmen im Bereich Herstellung und Vertrieb zum produzierenden Gewerbe. Darunter fallen der Bergbau, die Gewinnung von Steinen und Erden, das verarbeitende Gewerbe, die Energie- und Wasserversorgung sowie das Baugewerbe. Es handelt sich somit um Unternehmen des sekundären Sektors einer Volkswirtschaft.
In Deutschland hatten KMU 2005 in diesem Wirtschaftsbereich einen Anteil von 98,7 % und mit 52,3 % waren mehr als die Hälfte der Beschäftigten bei KMU angestellt. Der Umsatzanteil lag bei 25,6 % und die Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten[23] betrug 37,0 %.[24]
Um Unternehmen im Bereich Herstellung und Vertrieb einen greifbaren Leitfaden für einen gelungenen und zweckmäßigen Webauftritt zu bieten, werden die theoretisch dargestellten Aspekte dieser Diplomarbeit anhand eines fiktiven Beispielunternehmens unterstrichen.
Beispielunternehmen – LMS GmbH
Die LMS GmbH ist ein Hersteller von Anschlagmitteln (Ketten, Seile, etc.) und Ladungssicherungen mit Sitz in Brandenburg. Es handelt sich um ein rechtlich und wirtschaftlich selbstständiges Familienunternehmen. Seit dem Gründungsjahr 1993 konnte sich die LMS GmbH sehr erfolgreich auf dem Markt etablieren. In den vergangenen Jahren hat allerdings die Zahl der (auch ausländischen) Konkurrenten spürbar zugenommen, was sich durch einen stetig sinkenden Umsatz und Gewinn bemerkbar macht. Infolge dessen wurde die Belegschaft auf nunmehr 19 Mitarbeiter verringert. Sämtliche Angestellten sind voll ausgelastet. Aufgrund der wirtschaftlichen Lage sollen vorerst keine zusätzlichen Mitarbeiter eingestellt werden. Zu den Kunden zählen überwiegend Unternehmen aus den umliegenden Regionen innerhalb Deutschlands, die über den persönlichen Kontakt oder gezielte Werbemaßnahmen gewonnen wurden. Dabei spielte der Webauftritt bisher nur insofern eine Rolle, als dass er eine Art Visitenkarte war, um im Internet präsent zu sein. Auf diese Weise wurden jedoch die Potentiale, die eine Website zu bieten hat, nicht genutzt.
Mit diesen Merkmalen zählt das Unternehmen zu den Kleinunternehmen, die oftmals nur provisorische Websites haben und somit verbesserungsbedürftig sind.
Im Folgenden wird verdeutlicht, welche notwendigen Schritte und Vorkehrungen getroffen werden müssen, um KMU zu einem erfolgreichen Webauftritt zu verhelfen.
3 Planung eines Webauftritts
Bei der Planung eines Webauftritts ist es essentiell, die Erwartungen an die Website zu kennen. Dabei spielen sowohl der Informationsbedarf und die Erwartungen der Website-Benutzer -also bereits bestehender oder potentieller Kunden sowie Geschäftspartner- als auch die Vorstellungen und Anforderungen des Unternehmens selbst, welches sich im Internet präsentiert, eine entscheidende Rolle. Daneben werden in diesem Kapitel mögliche Zugangswege zur Website eines Unternehmens durch Kunden oder Geschäftspartner verdeutlicht. Dabei werden Webkataloge und Suchmaschinen erläutert und deren Funktionsweise überblickartig erklärt.
Für die Planung eines Webauftritts ist es weiterhin wichtig, sich über die Inhalte der Website sowie entstehende Kosten im Klaren zu sein.
3.1 Informationsbedarf und Erwartungen der Website-Benutzer
Der Informationsbedarf von Internetnutzern und deren Erwartungen an die Website eines Unternehmens sind sehr verschieden. Der Grund hierfür sind die unterschiedlichen Absichten, die Anwender veranlassen, eine bestimmte Seite im Internet aufzurufen. Es kann aber dennoch festgestellt werden, dass es einige allgemeingültige Ansprüche an Websites gibt.[25]
So verwenden 47 % der Nutzer mindestens einmal pro Woche das Internet, um gezielt nach bestimmten Angeboten zu recherchieren.[26] Dabei möchten sie umfassend über Produkte und deren Preise, Trends und Neuheiten informiert sowie mit Hintergrundinformationen versorgt werden, um auf dieser Basis eine Entscheidung über den Erwerb eines Produktes treffen zu können.[27] Aufgrund des immer größer werdenden Produktangebots auf dem Markt ist es für Kunden zunehmend schwieriger, die auf ihre individuellen Anforderungen abgestimmte Produktauswahl selbstständig zu treffen. Deshalb schätzen Kunden fachliche Beratung und erwarten, dass das anbietende Unternehmen ihre Ansprüche kennt und auf diese auf der Website eingeht.[28]
In einigen Fällen ist der direkte Informationsaustausch mit einem Mitarbeiter des anbietenden Unternehmens notwendig. Aus diesem Grund wünschen Kunden, dass die Angaben zu den verschiedenen Kommunikationskanälen (wie z.B. Telefon, Fax, E-Mail-Adressen oder Instant Messaging Systemen wie ICQ, Skype usw.) einfach auf der Website gefunden werden können und diese flexibel sind.
Abbildung 1: Erwartungen von Benutzern an Websites
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Eigene Darstellung.
Wie bei der Interaktion im Geschäft erwarten Kunden sofort eine Antwort auf ihre individuellen Fragen. Sie wollen nicht lange auf die Beantwortung von E-Mails warten oder bei der telefonischen Kontaktaufnahme Zeit in Warteschleifen verbringen.[29]
Wie in Abbildung 1 dargestellt, haben Website-Benutzer neben den individuellen Erwartungen hinsichtlich des Produktes und der Beratung auch das Ziel, schnell den Zweck ihres Website-Besuches erreichen zu können.[30] Deshalb werden kurze Ladezeiten, aktuelle und gut verständliche Informationen auf der Website sowie eine ansprechende optische Gestaltung erwartet. Dazu gehören bspw. ein übersichtlicher und strukturierter Seitenaufbau, eine verständliche Navigation sowie ansprechende und im Einklang stehende Farbabstimmungen der verwendeten Multimedia-Elemente. Vom Design der Website ziehen Internetbenutzer Rückschlüsse auf die Kompetenzen und die Zuverlässigkeit eines Unternehmens sowie auf die Qualität der angebotenen Produkte.[31]
Ferner ist es essentiell, ausschließlich funktionierende Links auf der Website einzubinden sowie sicherzustellen, dass Angebote, Ereignisse, Termine oder Stellenausschreibungen immer auf dem aktuellsten Stand sind.[32] Websites müssen gut funktionieren und Informationen bedürfen einer hohen Qualität. Andernfalls ist die Verweildauer der Benutzer auf der Seite nur sehr kurz und sie haben kein Interesse, diese zukünftig erneut aufzurufen.
Häufig informieren sich potentielle Kunden im Internet, kaufen aber dann das ausgewählte Produkt im Geschäft vor Ort. Hierfür benötigen sie Angaben zu Öffnungszeiten, die Adresse sowie eine ausführliche Anfahrtsbeschreibung mit diversen Verkehrsmitteln und Hinweise auf Parkmöglichkeiten.[33]
[...]
[1] Vgl. Taylor, Michael et al., 2004, S. 281.
[2] Vgl. Statistisches Bundesamt Deutschland, 2008, S. 1 und Ergenzinger, Rudolf et al., 2006, S. 66.
[3] Vgl. Europäische Kommission, 2006, S. 14.
[4] Vgl. Europäische Kommission, 2006, S. 8.
[5] Vgl. Institut für Mittelstandsforschung Bonn, 2009.
[6] Vgl. Fischer, Hajo, 2002, S. 34.
[7] Vgl. Hermann, Uwe, 2006, S. 260.
[8] Vgl. Fischer, Hajo, 2002, S. 34.
[9] Vgl. Ergenzinger, Rudolf et al., 2006, S. 67.
[10] „Nischen sind entweder neue Segmente welche für Großunternehmen (noch) zu klein sind oder alte Segmente, welche auch in einer reifen Phase des Marktes die für Großunternehmen nicht interessante Volumina erreichen.“ Hilzenbecher, Uwe, 2006, S. 92.
[11] Vgl. Deutscher Bundestag, 2002, S. 129.
[12] Vgl. Statistisches Bundesamt Deutschland, 2008, S. 1; Ergenzinger, Rudolf et al., 2009, S. 103; Rodewald, Bernd, 2001, S. 104 und Europäische Kommission, 2006, S. 3.
[13] Vgl. Ergenzinger, Rudolf et al., 2009, S. 103 und Deutscher Bundestag, 2002, S. 130.
[14] Vgl. Statistisches Bundesamt Deutschland, 2008, S. 2.
[15] Definition von KMU hier aber auf weniger als 500 Beschäftigte bezogen. Vgl. Deutscher Bundestag, 2002, S. 129.
[16] Vgl. Organisation For Economic Co-Operation and Development – OECD, 2009, S. 1.
[17] Vgl. European Commission, 2002, S. 28.
[18] Vgl. Organisation For Economic Co-Operation and Development – OECD, 2009, S. 2.
[19] Vgl. Europäische Kommission, 2006, S. 5.
[20] Vgl. European Commission, 2009.
[21] Diese Zahl bezieht sich nur auf mittelständische Unternehmen in Deutschland. Vgl. Bundesregierung Deutschland, 2006.
[22] Vgl. Statistisches Bundesamt Deutschland, 2008, S. 4.
[23] Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten ergibt sich aus dem Nettoproduktionswert minus sonstige Vorleistungen (= Bruttowertschöpfung) minus sonstige indirekte Steuern abzüglich Subventionen. Vgl.: Statistisches Bundesamt 2007, S. 3 ff.
[24] Vgl. Statistisches Bundesamt Deutschland, 2009.
[25] Vgl. Förster, Anja et al., 2002, S. 113.
[26] Vgl. Eimeren van, Birgit et al., 2009, S. 340.
[27] Vgl. Schwarz, Torsten, 2000, S. 193.
[28] Vgl. Meyer, Matthias, 2002, S. 9.
[29] Vgl. Stumpf, Christina, 2009 und Förster, Anja et al., 2002, S. 113.
[30] Vgl. Otim, Samuel et al., 2006, S. 535.
[31] Vgl. Förster, Anja et al., 2002, S. 113 und Otim, Samuel et al., 2006, S. 528.
[32] Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, 2006, S. 2.
[33] Vgl. Schwarz, Torsten, 2000, S. 194.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2010
- ISBN (eBook)
- 9783842808997
- DOI
- 10.3239/9783842808997
- Dateigröße
- 1.4 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Wilhelm Büchner Hochschule Private Fernhochschule Darmstadt – Informatik, Informatik
- Erscheinungsdatum
- 2011 (Januar)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- webauftritt planung website
- Produktsicherheit
- Diplom.de