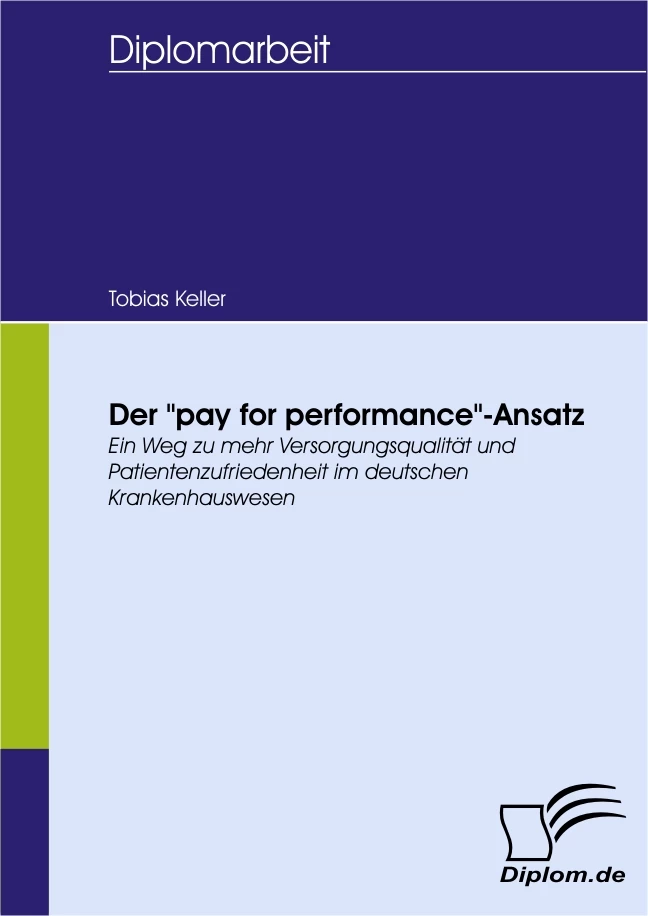Der "pay for performance"-Ansatz - ein Weg zu mehr Versorgungsqualität und Patientenzufriedenheit im deutschen Krankenhauswesen
Zusammenfassung
In den letzten Monaten waren Zeitungsartikel mit Überschriften wie z. B.
- Krankenhäuser zahlen Prämie für Patienten;
- Immer mehr Ärzte verkaufen ihre Patienten;
- Als Patient muss es einem mulmig werden: Ärzte überweisen Kranke nicht in das für sie beste Krankenhaus mit der besten Versorgung sondern in die Klinik, die am meisten für die Einweisung zahlt;
an der Tagesordnung. Diese zahlreichen Artikel machen auf ein Defizit im Gesundheitswesen aufmerksam, das in der Vergangenheit schon oft Gegenstand gesundheitspolitischer Diskussionen war, jedoch nur wenig systematisch einer Problemlösung zugeführt wurde:
Die Qualitätintransparenz des deutschen Gesundheitswesens:
Wäre der Patient in der Lage, selbst zu beurteilen, welche Ergebnisqualität ein Krankenhaus bei bestimmten medizinischen Leistungen liefert, würde er wahrscheinlich auch selbst entscheiden, welche Einrichtung für ihn bei einem elektiven Eingriff am besten geeignet ist. Ein Blick in die entsprechende Fachliteratur zeigt, dass die Qualitätsunterschiede zwischen einzelnen Fachabteilungen verschiedener Krankenhäuser gewaltig sind. Ein von Herrn Dr. Ernst Bruckenberger erstellter Herzbericht, der jährlich neu erscheint, weist aus, dass die Mortalitätsquote von Herzzentren stark differiert, ohne dass dieser Unterschied allein mit dem Schweregrad der Eingriffe erklärt werden kann. Ein typisches Beispiel stellt die risikoadjustierte In-Hospital-Letalität in der Koronarchirurgie dar. Bei ihr lag in Deutschland die Spannweite im Jahre 2008 zwischen 0,6% bis 7,8%. Das heißt, dass im Extremfall die Sterblichkeitsquote bei vergleichbaren Krankenhausleistungen um das 13-fache voneinander abweicht. Während somit in einem Herzzentrum bei hundert Eingriffen kein Patient verstarb, waren es möglicherweise in dem nur wenige Kilometer entfernten Herzzentrum knapp acht Patienten.
Derart große Unterschiede bezüglich der Sterberate bei operativen Eingriffen müssten nachdenklich stimmen und einen enorm großen gesundheitspolitischen Handlungsdruck auslösen. Doch nichts geschieht.
Der Sachverständigenrat für das Gesundheitswesen hat schon im Jahre 2003 die Zahl der vermuteten und der angezeigten Behandlungsfehler in Deutschland auf ca. 40.000 pro Jahr und die der anerkannten Schadensersatzansprüche auf ca. 12.000 pro Jahr geschätzt. Der Anteil der so genannten preventable adverse events, d.h. der vermeidbaren unerwünschten Ereignisse, liegt in deutschen […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1 Einführung
1.1 Problemstellung
2 Der Krankenhausmarkt
2.1 Die Bedeutung des Krankenhausmarkts
2.2 Entwicklungen im Krankenhausmarkt
2.3 Gesetzliche Restriktionen im Krankenhausmarkt und deren Auswirkungen auf den Wettbewerb
2.4 Gesetzgeberische Konsequenzen auf dem Krankenhausmarkt der Zukunft
3 Das Produkt „Gesundheit“ und dessen Bewertung
3.1 Das Produkt „Gesundheit“
3.2 Die Qualität von Krankenhäusern
3.3 Dimensionen der Qualität von Krankenhäusern
3.3.1 Strukturqualität
3.3.2 Prozessqualität
3.3.3 Ergebnisqualität
3.3.4 Patientenzufriedenheit als vierte Qualitätsdimension
3.4 Versorgungsqualitäten als Qualitätsbegriff zur Etablierung eines p4p-Ansatzes
4 Die Messung der Versorgungsqualität in Hinblick auf den „pay for performance“-Ansatz (p4p)
4.1 Die Messung von Struktur – und Prozessqualität mittels eines einrichtungseigenen Qualitätsmanagements
4.1.1 Etablierte Zertifizierungsverfahren
4.1.2 KTQ-Verfahren (Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen)
4.2 Die Messung von Ergebnisqualität
4.2.1 Die vergleichende Qualitätssicherung gemäß § 137 SGB V (BQS-Verfahren)
4.2.2 Die Verwendung von Abrechnungsdaten (Helios-Verfahren)
4.2.3 Die Bewertung der Qualitätsmessung auf Basis von BQS und von Abrechnungsdaten (Helios-Verfahren) im Hinblick auf den p4p-Ansatz
4.2.4 Das QSR-Verfahren
4.2.5 Die Bewertung des QSR-Verfahrens im Hinblick auf den p4p-Ansatz
4.3 Die Messung von Patientenzufriedenheit
4.3.1 Aufbau und Anforderungen an eine schriftliche Patientenbefragung
4.3.2 Exkurs: Die Patientenbefragung der Sächsischen Zeitung (SZ)
4.3.3 Die Durchführung der Patientenbefragung im Rahmen eines p4p-Ansatzes
4.4 Zusammenfassende Bewertung der in Deutschland gängigen Verfahren zur Messung von Versorgungsqualität
5 Der p4p-Ansatz als Instrument zur Weiterentwicklung des G-DRG Vergütungssystems
5.1 Der p4p-Ansatz
5.2 Internationale Erfahrungen mit dem p4p-Ansatz
5.2.1 Die p4p-Ansätze in den USA
5.2.2 Der p4p-Ansatz in Großbritannien
5.2.3 Bewertung der p4p-Ansätze beider Länder
5.2.4 Schlussfolgerungen für einen p4p-Ansatz in Deutschland
5.3 Die ordnungspolitischen Voraussetzungen für einen p4p-Ansatz in Deutschland
5.3.1 Die Organisation der Integrated Healthcare Association
5.3.2 Die Agentur für Qualitätsverbesserung im Krankenhauswesen (AFQK)
5.3.2.1 Die Aufgabenstellung der AFQK
5.3.2.2 Die Aufbauorganisation der AFQK
5.3.2.3 Die Finanzierung der AFQK
5.4 Gewichtung der Versorgungsqualitätsindikatoren im Hinblick auf die Umsetzung des p4p-Ansatz in Deutschland
5.4.1 Qualitätsindikatoren zur Messung von Struktur- und Prozessqualität
5.4.2 Qualitätsindikatoren zur Messung von Ergebnisqualität und Patientenzufriedenheit
5.5 Die Notwendigkeit der Veröffentlichung von Qualitätsinformationen im Rahmen der Einführung eines p4p-Vergütungsmodells in Deutschland
5.6 Der Entwurf eines public disclosure – Konzepts zur Implementierung eines p4p-Ansatzes in Deutschland
5.7 Der p4p-Ansatz als lernendes System
6 Die finanziellen Konsequenzen des p4p-Ansatzes für die Krankenhäuser und deren Auswirkungen auf die in der Arbeit formulierten Hypothesen
7 Fazit und Konsequenzen
Anlageverzeichnis
Anhang
Literaturverzeichnis
Eidesstattliche Erklärung
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Die prozentualen Veränderungen des Ärztlichen- und Pflegepersonals
Abbildung 2: Die Entwicklung der Krankenhausinvestitionsquote in Deutschland
Abbildung 3: Die Auswirkungen des CMI auf die Erlössituation deutscher Kliniken
Abbildung 4: Kontinuum der Evaluierung verschiedener Leistungsarten
Abbildung 5: Qualitätsdimensionen nach Donabedian
Abbildung 6: Übersicht über den Stand der Zertifizierung im Freistaat Sachsen
Abbildung 7: Der KTQ-Regelkreis
Abbildung 8: Gremien, Verfahrensebenen und Institutionen des BQS-Verfahrens
Abbildung 9: Die Systematik des strukturierten Dialogs
Abbildung 10: Entwicklung des standardisierten Mortalitätsverhältnisses bei der Herzinfarkt-sterblichkeit in den Helios Kliniken
Abbildung 11: Der Messvorgang beim QSR-Verfahren
Abbildung 12: Zusammenhang zwischen 90-Tage- und Krankenhaussterblichkeit bei Herz-insuffizienz
Abbildung 13: Feedback-Modell der Patientenzufriedenheit
Abbildung 14: Qualitätsdimensionen und deren Messverfahren
Abbildung 15: Varianten der p4p-Gestaltungen
Abbildung 16: Die Gewichtung der Qualitätsdimension bei dem p4p-Ansatz der IHA
Abbildung 17: Die Qualitätsindikatoren der IHA Teil 1
Abbildung 18: Die Qualitätsindikatoren der IHA Teil 2
Abbildung 19: Die Entwicklung der Ergebnisqualitätsindikatoren beim p4p-Ansatz der IHA
Abbildung 20: Die Aufschlüsselung des QOFs nach Qualitätsindikatoren
Abbildung 21: Versorgungsqualität vor und nach der Einführung des p4p-Ansatzes
Abbildung 22: Die Aufbauorganisation der IHA
Abbildung 23: Organigramm des WDR
Abbildung 24: Entwicklung der Gewichtung der Versorgungsqualitätsdimensionen
Abbildung 25: Messung von Weiterbildungsqualität Teil 1
Abbildung 26: Messung von Weiterbildungsqualität Teil 2
Abbildung 27: Messung der Koordinierung der Behandlung Teil 1
Abbildung 28: Messung der Koordinierung der Behandlung Teil 2
Abbildung 29: Sterblichkeit nach Hirninfarkt
Abbildung 30: Gewichtung des Frageninhalts bei der Messung der Patientenzufriedenheit
Abbildung 31: Der Vergabeschlüssel für Qualitätssterne von healthgrades.com
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Qualitätsindikatoren zur Messung von Struktur-,Prozess- und Ergebnisqualität
Tabelle 2: Beispielrechnung zur Messung der Strukturqualität
Tabelle 3: Beispielrechnung zur Messung der Prozessqualität
Tabelle 4: Der Vergabeschlüssel für Qualitätssterne von „The Leading Hospitals of Germany“
Tabelle 5: Anteil der variablen und fixen Kosten bei ausgewählten Kostenarten
1 Einführung
1.1 Problemstellung
In den letzten Monaten waren Zeitungsartikel mit Überschriften wie z. B.
- „Krankenhäuser zahlen Prämie für Patienten“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 31.8.2009, S.1),
- „Immer mehr Ärzte verkaufen ihre Patienten“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 31.8.2009, S.9), oder
- „Als Patient muss es einem mulmig werden: Ärzte überweisen Kranke nicht in das für sie beste Krankenhaus mit der besten Versorgung – sondern in die Klinik, die am meisten für die Einweisung zahlt.“ (Borstel, 3.9.2009, veröffentlicht im Internet (10.9.2009))
an der Tagesordnung. Diese zahlreichen Artikel machen auf ein Defizit im Gesundheitswesen aufmerksam, das in der Vergangenheit schon oft Gegenstand gesundheitspolitischer Diskussionen war, jedoch nur wenig systematisch einer Problemlösung zugeführt wurde:
Die Qualitätintransparenz des deutschen Gesundheitswesens.
Wäre der Patient in der Lage, selbst zu beurteilen, welche Ergebnisqualität ein Krankenhaus bei bestimmten medizinischen Leistungen liefert, würde er wahrscheinlich auch selbst entscheiden, welche Einrichtung für ihn bei einem elektiven Eingriff am besten geeignet ist. Ein Blick in die entsprechende Fachliteratur zeigt, dass die Qualitätsunterschiede zwischen einzelnen Fachabteilungen verschiedener Krankenhäuser gewaltig sind. Ein von Herrn Dr. Ernst Bruckenberger erstellter „Herzbericht“, der jährlich neu erscheint, weist aus, dass die Mortalitätsquote von Herzzentren stark differiert, ohne dass dieser Unterschied allein mit dem Schweregrad der Eingriffe erklärt werden kann. Ein typisches Beispiel stellt die risikoadjustierte In-Hospital-Letalität in der Koronarchirurgie dar. Bei ihr lag in Deutschland die Spannweite im Jahre 2008 zwischen 0,6% bis 7,8% (vgl. Bruckenberger (2009), S.197). Das heißt, dass im Extremfall die Sterblichkeitsquote bei vergleichbaren Krankenhausleistungen um das 13-fache voneinander abweicht. Während somit in einem Herzzentrum bei hundert Eingriffen kein Patient verstarb, waren es möglicherweise in dem nur wenige Kilometer entfernten Herzzentrum knapp acht Patienten.
Derart große Unterschiede bezüglich der Sterberate bei operativen Eingriffen müssten nachdenklich stimmen und einen enorm großen gesundheitspolitischen Handlungsdruck auslösen. Doch nichts geschieht.
Der Sachverständigenrat für das Gesundheitswesen hat schon im Jahre 2003 die Zahl der vermuteten und der angezeigten Behandlungsfehler in Deutschland auf ca. 40.000 pro Jahr und die der anerkannten Schadensersatzansprüche auf ca. 12.000 pro Jahr geschätzt (vgl. Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen (2003), S.138). Der Anteil der so genannten „preventable adverse events“, d.h. der vermeidbaren unerwünschten Ereignisse, liegt in deutschen Krankenhäusern zwischen 2 % bis 4 % (vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen (2007), S.310).
Die neuesten Berechnungen der „Aktion Patientenbündnis“, die auf 50 internationalen Studien beruhen, haben ergeben, dass 0,1% aller Krankenhauspatienten in deutschen Kliniken wegen vermeidbarer Behandlungsfehler sterben. Hochgerechnet auf ca. 17 Millionen stationäre Krankenhausbehandlungen jährlich bedeutet dies, dass in Deutschland ca. 17.000 Patienten versterben, die bei einem verbesserten Qualitätsmanagement Jahr für Jahr überleben könnten (vgl. Hardenberg, 24.4.2007, veröffentlicht im Internet (15.10.2009)). Die materiellen Folgekosten von ärztlichen Behandlungsfehlern werden auf ca. 10 Milliarden € p.a. geschätzt (vgl. Steria Mummert Consulting, (02/2007), S.45), was bei Gesamtausgaben für den Krankenhaussektor von 64,646 Mrd. € im Jahr 2007 (vgl. Statistisches Bundesamt (2009), veröffentlicht im Internet (15.10.2009)) einem Kostenanteil von rund 15% entspricht. Dementsprechend groß ist der Handlungsbedarf.
Die medizinische Versorgungsqualität der Bevölkerung ist suboptimal, dies wird auch deutlich, wenn man das Effizienzranking der OECD heranzieht (siehe Anlage 1). Hier belegt das Gesundheitssystem der BRD den 23. von 24 Plätzen (vgl. Blankart/ Fasten/ Schwintowski (2009), S.12). Für die Ineffizienz des deutschen Gesundheitswesens spricht auch, dass Deutschland bei der Überlebenswahrscheinlichkeit bei vielen lebensbedrohlichen Krankheitsbildern einen der hinteren Ränge belegt. So lag Deutschland bei der 5-jährigen Überlebenswahrscheinlichkeit beim Gebärmutterhalskrebs und beim Brustkrebs jeweils auf dem 18. von 19 Plätzen, beim Myokardinfarkt auf Rang 20 bei 24 Rängen (vgl. Blankart/ Fasten/ Schwintowski (2009), S.13).
Demgegenüber liegt Deutschland bei den Gesundheitsausgaben im internationalen Vergleich der OECD auf Rang vier. Insgesamt wurden 30 Nationen zu diesem Vergleich herangezogen. Die Gesundheitsausgaben lagen in Deutschland im Jahre 2007 bei 10,4% des BIP; der OECD-Durchschnitt lag nur bei 8,9% (siehe Gesamtübersicht im Anhang Anlage 2), (vgl. Pearson (2009), veröffentlicht im Internet, S.1, (20.10.2009)). Die Kennzahlen machen eines deutlich: Auf dem deutschen Gesundheitswesen lastet ein sehr hoher Handlungsdruck in Richtung mehr Versorgungsqualität und Effizienz.
Bei entsprechender Transparenz hätte deshalb auch das zu Beginn erwähnte Prämiensystem keine Chance mehr und die betreffenden Einrichtungen wären gezwungen, sich ihren Qualitätsmängeln zu stellen. Warum dies heute noch nicht der Fall ist und wie solchen Fehlanreizen im Krankenhauswesen durch mehr Transparenz entgegengesteuert werden kann, ist Gegenstand dieser Diplomarbeit.
Dabei beschränkt sich die Arbeit nicht darauf, verschiedene Qualitätsbegriffe und deren Messung zu beschreiben. Vielmehr soll, nachdem ein praktikabler Qualitätsbegriff gefunden wurde, in einem zweiten Schritt ein Vergütungssystem entwickelt werden, das mit dazu beiträgt, dass sich der Einsatz eines Krankenhauses für mehr Versorgungsqualität auch wirklich lohnt. Denn vor dem Hintergrund der eingangs erwähnten Qualitätsdefizite im Gesundheitswesen verwundert es schon sehr, dass bis heute im deutschen Gesundheitswesen nur die Leistung, ohne explizite Berücksichtigung der dabei erbrachten Qualität, vergütet wird. Die Versorgungsqualität spielt heute, abgesehen von Ausnahmesituationen, noch immer keine signifikante Rolle bei der Höhe der Vergütung von Krankenhausleistungen.
Ziel dieser Diplomarbeit ist deshalb, ein Vergütungssystem für den Krankenhaussektor zu entwickeln, welches die Qualität der erbrachten Leistung in den Mittelpunkt des Leistungsgeschehens eines Krankenhauses stellt. Dabei wirkt ein solches Vergütungssystem auch effizienzsteigernd, weil durch eine höhere Qualität immer auch weniger Ressourcen benötigt werden, da Behandlungsfehler, deren Beseitigung oft sehr kostenintensiv ist, häufiger vermieden würden.
Wenn darüber hinaus auch die Öffentlichkeit von den Qualitätsunterschieden einzelner Einrichtungen erfährt, indem ein einfaches und allgemeinverständliches Krankenhaus-Klassifikationssystem Auskunft darüber gibt, welcher Qualitätsstufe das jeweilige Krankenhaus angehört, dann hätte dies wahrscheinlich folgende unmittelbaren Folgen:
- Das Krankenhausmanagement würde sich persönlich um eine hohe Versorgungsqualität kümmern, weil die Höhe der Vergütung durch die Qualität der erbrachten Leistung unmittelbar beeinflusst wird.
- Die öffentliche Meinungsbildung beeinflusst die Patientenströme, was das Krankenhausmanagement dazu zwingt, sich mehr um die Zufriedenheit seiner Patienten zu kümmern.
2 Der Krankenhausmarkt
Um die Auswirkungen eines neuen, qualitätsorientierten Vergütungssystems im Krankenhaussektor bewerten zu können, ist es sinnvoll, zunächst die Größe des Krankenhausmarktes und dessen Stellenwert als Teilmarkt des Gesundheitswesens zu beschreiben. Dabei wird deutlich, dass die staatliche Lenkung und somit die Einflussnahme des Gesetzgebers beträchtlich ist, weshalb auch die Frage untersucht werden wird, wie der Gesetzgeber die ordnungspolitischen Rahmenbedingungen diese Marktsegments neu definieren muss, soll die Qualität der Leistungserbringung entscheidungsrelevant für das Krankenhausmanagement werden.
2.1 Die Bedeutung des Krankenhausmarkts
Die Gesundheitsausgaben in Deutschland betrugen im Jahr 2007 insgesamt 252,8 Mrd. € (vgl. Statistisches Bundesamt (2009), veröffentlicht im Internet (15.10.2009)). Der Krankenhausbereich stellt den größten Einzelposten bei den Gesundheitsausgaben dar. Im Jahr 2007 wurden allein für stationäre Leistungen 64,646 Mrd. € aufgewandt (ebenda).
Die gesamtwirtschaftliche Bedeutung des Krankenhausmarkts wird deutlich, wenn man ihn mit der für die deutsche Volkswirtschaft besonders wichtigen Automobilbranche vergleicht. Die Wertschöpfung der Automobilindustrie betrug im Jahr 2007 331.452 Mrd. € (vgl. Verband der Automobilindustrie (2009) veröffentlicht im Internet (22.10.2009)). Demnach wird im Krankenhausmarkt rund ein Fünftel der Wertschöpfung des deutschen Automobilmarkts generiert. Im Jahr 2007 betrug die Zahl der Beschäftigten in der Automobilindustrie 726.415 (ebenda), während dessen die Beschäftigungszahl im Krankenhaussektor mit 1.075.000 Beschäftigten (vgl. Statistisches Bundesamt (2009), veröffentlicht im Internet (20.10.2009)) deutlich höher lag. Wie aus diesem Vergleich ersichtlich ist, ist der Krankenhausmarkt nicht nur wegen seiner Bedeutung für die Gesundheit der Bevölkerung von allerhöchster Relevanz; er ist darüber hinaus ein sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor. Lösungsvorschläge für ein neues Vergütungsmodell im Krankenhausmarkt sind somit auch immer unter dem Blickwinkel zu bewerten, welche gesamtwirtschaftlichen Effekte damit einhergehen.
2.2 Entwicklungen im Krankenhausmarkt
Als Folge eines sich verschärfenden Wettbewerbs hat sich die Krankenhauslandschaft in Deutschland grundlegend verändert. Die Zahl der Krankenhäuser sank innerhalb von 17 Jahren von 2.411 Krankenhäusern im Jahr 1991 auf 2.083 im Jahr 2008 (vgl. Statistisches Bundesamt (2009), veröffentlicht im Internet (20.10.2009)). Dies entspricht einem Rückgang von 13,6%. Dass diese Entwicklung notwendig ist, beweisen die immer noch vorherrschenden und in diesem Zeitraum steigenden Überkapazitäten. Die Kennziffer für Überkapazitäten ist die sogenannte Bettenauslastung, die sich ebenfalls in diesem Zeitraum von 85,5% auf 77,2% zurückentwickelt hat (vgl. Deutsche Krankenhausgesellschaft (2009), S.16). Noch stärker gesunken ist die durchschnittliche Verweildauer der Patienten in einer stationären Einrichtung. Im Vergleich zu 1991 ist hier für das Jahr 2008 ein Rückgang von 14 auf 8,1 Tage zu verzeichnen gewesen, was einem Rückgang von mehr als 42 % entspricht (vgl. Statistisches Bundesamt (2009), veröffentlicht im Internet (21.10.2009)). Insbesondere haben der medizinische Fortschritt und gesetzliche Reformen, wie z. B. die Einführung des G-DRG-Systems, zu dieser Entwicklung beigetragen (vgl. Augurzky/ Beivers/ Neubauer/ Schwierz (2009), S.8).
Demgegenüber hat sich die Zahl der vollstationär behandelten Patienten in diesem Betrachtungszeitraum deutlich erhöht. Sie erhöhte sich von 14.576.613 um 16,80 % auf aktuell 17.519.579 behandelte vollstationäre Fälle (vgl. Statistisches Bundesamt (2009), veröffentlicht im Internet (20.10.2009)).
In den letzten zehn Jahren gab es eine Vielzahl an Gesetzen, die vor allem das Ziel hatten, den Wettbewerb im Krankenhausmarkt zu intensivieren. Bis zum Jahre 2003/04 fußte das deutsche Vergütungssystem der stationären Versorgung auf tagesgleichen Pflegesätzen und war damit eine Funktion der Verweildauer und der Höhe der Abteilungs- und Basispflegesätze. International wird dieses Vergütungssystem auch als „resource based payment system“ bezeichnet. Im Jahre 2004 wurde mit der Einführung des German-Diagnosis Related Groups (G-DRG) Systems die Funktion der Vergütungshöhe fundamental verändert, dadurch dass sie auf Diagnosen und Prozeduren umgestellt wurde. Seitdem findet auch die Morbidität des einzelnen Patienten bei der Höhe der Vergütung Berücksichtigung, indem der Schweregrad des Eingriffs bei der Höhe der Vergütung mit einbezogen wird (vgl. Klauber/ Robra/ Schellschmidt, (2008), S.159). Die Verweildauer, mit der bisher die Höhe der Vergütung durch das Krankenhaus beeinflusst werden konnte, hat deutlich an Bedeutung verloren. Ein Großteil des Verweildauerrückgangs im deutschen Gesundheitswesen ist diesem Umstand geschuldet. Nur noch bei den sogenannten Kurz – oder Langliegern besitzt die Verweildauer Vergütungsrelevanz beim G-DRG-System, da in diesen Fällen Zu- oder Abschläge auf die Normvergütung erhoben bzw. erstattet werden.
Das neue Vergütungssystem wird nach einer Konvergenzphase von sechs Jahren Ende 2009 vollständig eingeführt worden sein (vgl. Trefz/ Tuschen (2009), S.62 f. sowie Anlage 5). Die oben beschriebenen Veränderungen im Vergütungssystem haben auch zu Strukturveränderungen beim Krankenhauspersonal geführt. War in der Vergangenheit die Verweildauer umsatzrelevant, ist es heute der Schweregrad der Behandlung. Dementsprechend sank auch die Zahl der Pflegekräfte seit 2000 von 332.269 auf 298.325 im Jahre 2007, was einem Rückgang von 10,2 Prozent entspricht (vgl. Deutsche Krankenhausgesellschaft (2009), S.33). Demgegenüber stieg die Zahl der Ärzte im selben Zeitraum von 108.696 auf 126.000, was einer Zunahme von rund 16 Prozent entspricht (vgl. ebenda), da nur mit mehr Ärzten die Leistungen am Patienten in einer kürzeren Verweildauer erbracht werden konnten.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Die prozentualen Veränderungen des Ärztlichen- und Pflegepersonals
(Quelle: Eigene Darstellung nach Daten der Deutschen Krankenhausgesellschaft (2009), S.33)
Die Abbildung 1 zeigt, wie allein die Einführung des G-DRG-Systems (rote Linie) dazu geführt hat, dass sich die Struktur des Krankenhauspersonals deutlich veränderte. Vor diesem Hintergrund lässt sich für diese Diplomarbeit eine erste wichtige Hypothese ableiten:
Sobald die erbrachte Qualität des Krankenhauses vergütungsrelevant wird, führt diese ordnungspolitische Veränderung dazu, dass sich die Zahl der medizinischen Qualitätscontroller bzw.- manager deutlich erhöhen wird.
Diese Hypothese wird wie folgt begründet: In dem Maße, wie die erbrachte Qualität vergütungsrelevant wird, reagiert das Krankenhaus auf diese Entwicklung, indem sich mehr Mitarbeiter genau mit Fragen der Qualitätsverbesserung beschäftigen.
2.3 Gesetzliche Restriktionen im Krankenhausmarkt und deren Auswirkungen auf den Wettbewerb
Der Krankenhaussektor ist seit dem Inkrafttreten des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) im Jahre 1972 stark reguliert. Dies wird im Einzelnen durch folgende
gesetzgeberische Regelungen deutlich:
Planung der Krankenhauskapazitäten
Die Bundesländer haben nach § 6 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz(KHG) die Hoheit, die bedarfsnotwendigen Krankenhäuser mittels eines Landeskrankenhausplans zu bestimmen. Diese Krankenhäuser haben, unabhängig von ihrer Trägerschaft, die Verpflichtung, gesetzlich Versicherte zu behandeln (Versorgungsauftrag vgl. §109 f SGB V), und das Recht, die erbrachten Leistungen den Krankenkassen in Rechnung zu stellen. Damit die vom jeweiligen Bundesland gemachten Planvorgaben umsetzbar sind, werden die planmäßigen Investitionskosten der Krankenhäuser aus Steuermitteln der Länder finanziert (vgl. Trefz/ Tuschen (2009), S.22). In Folge dessen greifen die Bundesländer über die Investitionssteuerung direkt auf das Versorgungsniveau ein, um ihre intendierte Angebotsplanung zu verwirklichen. Ein Hauptproblem dieses Systems ist, dass die Bundesländer über Jahrzehnte hinweg ihre Investitionsquote (Anteil der KHG-Mittel an den GKV-/PKV-Ausgaben für die Krankenhausbehandlung) verringert haben. Die Abbildung 2 zeigt, wie stark die Investitionsfördermittel seit 1972 gesenkt wurden. Im Jahre 2007 betrug die Investitionsquote 4,7% (vgl. Burmann/ Malzahn(02/2009), S.29).
Dementsprechend ergab eine Schätzung der Deutschen Krankenhausgesellschaft einen Investitionsstau in den deutschen Krankenhäusern in Höhe von 50 Mrd. € (vgl. Augurzky/ Beivers/ Neubauer/ Schwierz (2009), S. 10).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Die Entwicklung der Krankenhausinvestitionsquote in Deutschland
(Quelle: Steiner (2008), veröffentlicht im Internet (30.10.2009), Folie 24).
Welche Leistungen (Leistungsbreite und -tiefe) die Krankenhäuser erbringen dürfen, wird u.a. dadurch beeinflusst, welcher Versorgungsstufe die jeweilige Einrichtung zugeordnet wird. Die Definitionen der Versorgungsstufen weichen in den Bundesländern von einander ab. In der Regel werden vier Versorgungsstufen ausgewiesen: Grund-, Regel-, Schwerpunkt- und Maximalversorgung (vgl. Fleßa (2007), S.29).
- Die Grundversorgung zeichnet sich durch ihre Wohnortnähe und einfache Versorgung aus. Krankenhäuser der Grundversorgung besitzen in der Regel zwischen 100 bis 250 Planbetten.
- Die Regelversorgung ist für eine allgemeine Versorgung in allen Disziplinen verantwortlich. Spezialfälle werden an Krankenhäuser der Schwerpunkt- oder Maximalversorgung überwiesen. Die Größe der Krankenhäuser der Regelversorgung schwankt zwischen 100 und 350 Planbetten (vgl. ebenda, S.29).
- Die Zentral- bzw. Schwerpunktversorgung beinhaltet alle Leistungen der Regelversorgung, ergänzt um Spezialversorgung in einigen Disziplinen. Häuser dieser Versorgungstufe verfügen über 400 bis 750 Planbetten.
- Die Krankenhäuser der Maximalversorgung besitzen die komplette Breite der medizinischen Fachrichtungen und einige Subspezialisierungen wie z. B. eine Herzchirurgie. Universitätskliniken sind immer Maximalversorger. Maximalversorger verfügen gewöhnlich über mehr als 800 Planbetten (vgl. Fleßa (2007), S.30).
Vorgabe des Preises
Über das G-DRG Vergütungssystem verpflichtet der Gesetzgeber die Plankrankenhäuser, eine vom Staat bzw. des Gemeinsamen Bundesausschusses definierte Versorgungsleistung zu vorgegebenen Preisen abzugeben. Die Preise für eine Krankenhausleistung werden dabei vom Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) kalkuliert und sind dann die sogenannten Fallpauschalen bzw. DRGs. Das G-DRG ist ein lernendes System mit stetiger Anpassungsdynamik (vgl. § 17b Abs.2 KHG). Ziel dieses lernenden Vergütungssystems ist es die Kostenstruktur der Behandlungen im Krankenhaus in Abhängigkeit von der Morbidität der Patienten zu approximieren. Hierfür erfasst das InEK statistisch stichprobenartig die Kostenstruktur von Krankenhäusern (vgl. InEK (2009), veröffentlicht im Internet (30.10.2009)). Durch diesen Mechanismus sind Wettbewerbsvorteile nur über niedrigere Kosten zu erzielen.
Kontrahierungszwang
Die Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhausleistungen (stationäre Versorgung) wird neben der Investitionssteuerung und der Preisfestsetzung auch durch einen Kontrahierungszwang reglementiert. Dieser sieht vor, dass Krankenkassen mit Plankrankenhäusern Versorgungsverträge abschließen müssen (vgl. § 109 Abs. 4 Satz 3 SGB V). Durch den Kontrahierungszwang gibt es zwischen der Leistungserbringer- und der Versicherungsseite keine Vertragsfreiheit, d. h. jede gesetzliche Krankenkasse muss mit einem Plankrankenhaus einen Versorgungsvertrag schließen. Darüber hinaus dürfen nur Plan- und Vertragskrankenhäuser ihre Leistungserbringung mit den Krankenkassen abrechnen (vgl. Augurzky/ Beivers/ Neubauer/ Schwierz (2009), S. 10). Nur im Fall einer Unterversorgung dürfen GKV-Krankenkassen Versorgungsverträge mit Krankenhäusern, die nicht Plankrankenhäuser sind, abschließen (vgl. Szabados (2009), S.45 ff.). Die Vertragskrankenhäuser sind im Gegensatz zu den Plankrankenhäusern von der Investitionskostenfinanzierung der Bundesländer ausgeschlossen (vgl. Augurzky/ Beivers/ Neubauer/ Schwierz (2009), S.36).
Versicherte als Markteilnehmer
Auch der Patient als Versicherter einer gesetzlichen Krankenkasse bewegt sich in einem geregelten Markt. Die Versicherten müssen sich über Vertragsärzte einweisen lassen (vgl. §73 Abs.4 SGB V), die dem Wirtschaftlichkeitsgebot verpflichtet sind. Die Vorschrift besagt, dass Einweisungen in ein Krankenhaus medizinisch indiziert und wirtschaftlich sinnvoll sein müssen (vgl. Wirtschaftlichkeitsgebot, §12 SGB V). Aus diesem Grund haben die Versicherten nur eingeschränkte Möglichkeiten, ambulante Leistungen in Klinken in Anspruch zu nehmen. Dementsprechend besteht keine Vertragsfreiheit zwischen den Versicherten der GKV und den Krankenhäusern.
2.4 Gesetzgeberische Konsequenzen auf dem Krankenhausmarkt der Zukunft
Aus den im Gliederungspunkt 2.3 genannten Gründen kann für den Krankenhaussektor nur eingeschränkt von einem offenen Markt im herkömmlichen Sinne gesprochen werden. Dennoch wirken schon heute in einem gewissen Umfang Marktmechanismen wie z. B. die erbrachte Qualität der Krankenhäuser, sonst würden nicht, wie eingangs erwähnt, Einweiserprämien gezahlt. Wie diese ordnungspolitischen Rahmenbedingungen weiterentwickelt werden müssen, damit die vom Krankenhaus erbrachte Qualität, neben der erbrachten Leistung, auch vergütungsrelevant wird, ist Gegenstand dieser Diplomarbeit.
Dabei soll ein Weg beschrieben werden, wie durch ein neues, stärker qualitätsorientiertes Vergütungssystem mehr Marktorientierung im Sinne
- von mehr Qualitätsorientierung bei gleichzeitig
- höherer Effizienz bei der Leistungserbringung erreicht werden kann.
Seit Beginn des neuen Jahrtausends hatten zahlreiche neue Gesetze, wie z.B. das Fallpauschalengesetz (Einführung des G-DRG Systems) vom April 2002, oder das Krankenhausfinanzierungsreformgesetz ( KHRG) vom März 2009, zum Ziel, den Wettbewerbsgedanken im Gesundheitswesen zu stärken, um durch mehr Wettbewerb Kosten zu senken (vgl. Blankart/ Fasten/ Schwintowski (2009), S.17 f.).
Initiiert durch den Gesetzgeber sollen durch das neue G-DRG Vergütungssystem einfachere Leistungen, die bisher primär stationär erbracht wurden, immer mehr in den ambulanten Bereich verlagert werden. Dabei soll der Grundsatz „ambulant vor stationär“ gelten. Methodisch geschieht dies, indem die Fallschwere für einfachere Eingriffe (z. B. eine diagnostische Linksherzkathederdiagnose) geringer bewertet wird. Die Fallschwere ist jedoch für die Vergütung der Krankenhausleistung von zentraler Bedeutung, weil durch sie die Höhe der Vergütung bestimmt wird. Prinzipiell gilt: Je höher die Fallschwere, desto höher die Erlöse für die Krankenhäuser. Die Fallschwere spiegelt sich im Case Mix Index (CMI) einer Klinik wider, der wiederum die durchschnittliche Fallschwere aller Behandlungsfälle eines Klinikums misst (vgl. Hamburgische Krankenhausgesellschaft (2009), veröffentlicht im Internet, (2.11.2009)). Verlierer dieser Entwicklung sind zumeist kleinere Krankenhäuser, die sich wegen ihrer geringen Größe nicht spezialisieren können.
Die Grenze, die Gewinner und Verlierer der Umbewertung trennt, liegt bei einem CMI-Wert von ca. 1,1. Kliniken mit einem niedrigeren CMI-Wert als 1,1 erhalten bei konstanter Fallzahl und Fallschwere eine geringere Vergütung als in den Vorjahren. Kliniken mit einem CMI-Wert größer als 1,1 können bei gleichbleibender Fallzahl und Fallschwere höhere Erlöse erzielen. Die Abbildung 3 zeigt, wie sich dieser Effekt auf die Krankenhauserlöse im Jahr 2006 im Vergleich zu 2007 ausgewirkt hat: Kleinere Einrichtungen verloren, bei sonst gleichen Bedingungen, bis zu 1,18 % ihres Umsatzes. Gewinner erzielten in der Spitze bis zu 1,05 % mehr Erlöse, ohne dass hierfür Aktivitäten der Einrichtung erforderlich waren (vgl. Bundesverband der Deutschen Chirurgen (2009), veröffentlicht im Internet (2.11.2009)).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Die Auswirkungen des CMI auf die Erlössituation deutscher Kliniken
(Quelle: Bundesverband der Deutschen Chirurgen (2009), veröffentlicht im Internet (2.11.2009))
Das kleine Regelversorgungskrankenhaus hat demnach nur noch dann realistische Überlebenschancen, wenn es sich in einem arbeitsteiligen Versorgungsnetz mit einem Schwerpunktkrankenhaus als sogenannte Portalklink einbringt (vgl. Klauber/ Robra/ Schellschmidt (2007), S. 75 f.). In solchen Versorgungsnetzwerken, die sich aus Schwerpunktkrankenhäusern, Portalkliniken und Medizinischen Versorgungszentren zusammensetzen, bieten diese Einrichtungen für ihre Kunden (Patienten) alles aus einer Hand oder unter einer gemeinsamen Dachmarke an: Ambulante, stationäre, rehabilitative und präventive Leistungen (vgl. Franz/ Günnewig/ Roeder (10/2009), S.919).
Außerdem wird aufgrund dieser Entwicklung, verstärkt durch die finanzschwachen öffentlichen Haushalte, die Zahl der Krankenhäuser sich weiter deutlich reduzieren. Ernst & Young gehen davon aus, dass die Zahl der Krankenhäuser bis zum Jahr 2020 um rund ein Viertel auf dann ca. 1.500 Krankenhäuser zurückgehen wird (vgl. Böhlke/ Söhnle / Viering (2005) ,S.9).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Damit diese Entwicklung der Versorgungsnetzwerke möglich wird, sind eine Reihe von ordnungspolitischen Rahmenbedingungen anzupassen, wobei die zu klärende ordnungspolitische Grundsatzfrage lautet:
Wird der Krankenhausmarkt der Zukunft ausschließlich nur über den Preis, wie bisher, reguliert oder gewinnt die vom Krankenhaus erbrachte Versorgungsqualität als Einflussfaktor auf den Preis einen größeren Stellenwert?
Da eine reine Preisregulierung des Krankenhausmarktes für die Zukunft ausgeschlossen werden kann, weil signifikante Qualitätsunterschiede zwischen Krankenhäusern durch den Gesetzgeber auf Dauer nicht toleriert werden können, geht der Autor dieser Arbeit davon aus, dass ein entscheidender Wettbewerbsparameter der Zukunft der Qualitätswettbewerb zwischen den Krankenhäusern sein wird.
Der Grundpreis (ohne Berücksichtigung der Qualität) für eine bestimmte Leistung spielt dabei für das einzelne Haus in Zukunft insoweit eine untergeordnete Rolle, als durch das bereits eingeführte Fallpauschalen-Vergütungssystem (G-DRG-System) dieser vom einzelnen Krankenhaus nicht mehr unmittelbar beeinflusst werden kann. Er wird vom Institut für Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) kalkuliert und festgesetzt (vgl. Gliederungspunkt 2.3). Da das einzelne Krankenhaus im Rahmen von Budgetverhandlungen nicht mehr mit den Krankenkassen darüber verhandeln kann, wie hoch z.B. die Vergütung für eine Blinddarmoperation sein muss, damit das Krankenhaus kostendeckend arbeitet, wird die zu erbringende Qualität ein wesentlicher Einflussfaktor auf Entscheidungen des Managements werden.
Gestaltungsparameter des einzelnen Krankenhauses wird zukünftig neben
- dem Leistungsprofil und
- der erbrachten Menge
- die Qualität der erbrachten Leistung
werden. Das Leistungsprofil, d.h. welche Leistungen in welcher Menge erbracht werden, waren schon immer die Variablen, die bei Budgetverhandlungen einen hohen Stellenwert hatten. Über sie wurde der Grundumsatz eines Krankenhauses bestimmt.
Der variable Anteil des Preises, der durch die Versorgungsqualität in einem qualitätsorientieren Vergütungssystem der Krankenhäuser beeinflusst wird, bekommt demgegenüber eine neue Schlüsselfunktion. Denn wenn die Qualität der erbrachten Leistung vergütungsrelevant wird, wird sie für das Krankenhausmanagement entscheidungsrelevant im Hinblick auf den wirtschaftlichen Erfolg bzw. Misserfolg des Krankenhauses sein. Die alte Erlösfunktion lautet bisher:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Zukünftig wird die Erlösfunktion eines Krankenhauses durch einen Qualitätszu- bzw. abschlag ergänzt. Die neue Erlösfunktion für das Krankenhaus lautet dann:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Da der Qualitätszu- bzw. abschlag eine signifikante Größe werden soll, lautet die zweite Hypothese dieser Diplomarbeit wie folgt:
Weil die Qualität der erbrachten Krankenhausleistung vom Management direkt beeinflusst werden kann und der Qualitätsanteil des Preises letztendlich darüber entscheiden wird, ob ein Krankenhaus mit Gewinn arbeitet oder nicht, wird die Qualität der Leistung zur Schlüsselgröße des neuen Vergütungssystems werden.
Diese Hypothese wird wie folgt begründet: Sobald die vom jeweiligen Krankenhaus erreichte Qualität Gewinnrelevanz erlangt, wird wahrscheinlich von Seiten des Krankenhausmanagements sehr viel dafür getan, dass das Krankenhaus auch eine entsprechend hohe Versorgungsqualität liefert, um einen höheren Preis erzielen zu können.
Dies hätte einen zweiten sehr positiven Nebeneffekt: Die Qualitätsorientierung führt dazu, dass teure Nachbehandlungen sich deutlich reduzierten ließen, weil bereits beim Ersteingriff entsprechend sorgfältig gearbeitet würde. Das Einsparpotenzial durch eine bessere Versorgungsqualität wird auf jährlich 10 Milliarden € geschätzt (vgl. Steria Mummert Consulting (02/07), S.45).
Zwar gibt es schon entsprechende Mechanismen,
- wenn ein Patient innerhalb einer bestimmten Frist wegen der gleichen Leistung wieder aufgenommen werden muss oder
- wenn die untere oder obere Grenzverweildauer unter- bzw. überschritten wird,
dass Abschläge auf das Budget zu akzeptieren sind. Jedoch haben diese Korrekturen noch nicht ausgereicht, das Qualitätsbewusstsein des Krankenhausmanagements maßgeblich zu schärfen (vgl. Böcker (5/2008), S.38 f.). Dementsprechend kann an dieser Stelle eine dritte Hypothese für diese Diplomarbeit formuliert werden:
Mit der Einführung von vergütungsrelevanten Qualitätsparametern wird sich das Qualitätsmanagement eines Krankenhauses für das Management zu einem Erfolgsfaktor erster Güte entwickeln.
Diese dritte Hypothese wird wie folgt begründet: Neben dem Umstand, dass durch Qualitätszuschläge bzw. Qualitätsabschläge das Betriebsergebnis möglicherweise entscheidend beeinflusst wird, ist des Weiteren davon auszugehen, dass dieser Umstand als solcher in der Öffentlichkeit bekannt wird. Eine weitere mögliche Folge dieser Maßnahme wäre, dass sich potenzielle Patienten wahrscheinlich erkundigen, ob die Einrichtung, in der sie sich behandeln lassen möchten, Qualitätszuschläge oder Qualitätsabschläge gewähren muss. Je nachdem würde vermutlich ein nicht unerheblicher Teil der Patientenschaft eine andere Einrichtung auswählen, in der Hoffnung, eine bessere Behandlung zu erhalten.
3 Das Produkt „Gesundheit“ und dessen Bewertung
3.1 Das Produkt „Gesundheit“
Im Gesundheitswesen, und hier insbesondere im Krankenhausmarkt, ist das gehandelte Produkt die Wiedererlangung der Gesundheit des Patienten.
Eine Krankenhausbehandlung wird allgemein als ein „Vertrauensgut“ bezeichnet (vgl. Haller (2005), S.14). Damit stellt der Produktionsprozess eines Krankenhauses insoweit eine Besonderheit dar, weil das Produkt oder die Dienstleistung am Menschen erbracht wird (Integration des externen Faktors), (vgl. Haller (2005), S.8). Denn sowohl Mitarbeiter als auch Patient sind am Erfolg der Leistung beteiligt und ihre Interaktion ist ein wichtiges Element des Behandlungserfolgs. Das Ergebnis ist zum Teil materiell (z. B. eine bestimmte Operation) und zum Teil auch immateriell. Der Patient kann die Gesundheitsdienstleistung nicht im Voraus prüfen und evaluieren, wie dies bei einem Sachgut (z. B. einem Fernseher) der Fall ist (vgl. Haller (2005), S. 7). Auch das Ergebnis ist nur zum Teil objektiv ermittelbar, weil die Bewertung des Ergebnisses von subjektiven Faktoren wie Befindlichkeiten und Bildungsgrad des Patienten, Schmerzempfindungen, soziales Umfeld etc. beeinflusst wird. Folglich kann die Leistung sowohl aus der subjektiven Sicht des Patienten als auch anhand von validierbaren Faktoren beurteilt werden.
Des Weiteren hängt die Bewertung des Produkts, d.h. die Qualität, auch sehr stark vom Zeitpunkt der Datenerhebung ab. So kann die Mortalität während des Eingriffs sehr gering ausfallen. Dieses Bild kann sich möglicherweise grundlegend verändern, wenn die Qualität der Behandlung nach 10 oder 30 Tagen bewertet wird (vgl. Heller (2009), veröffentlicht im Internet, (29.12.2009), Folie 6). Im Extremfall kann der Patient, wegen z. B. Mängeln in der Krankenhaushygiene, zwischenzeitlich verstorben sein.
Da neben dem Krankenhaus auch der Patient aktiv Einfluss auf den Erfolg der Behandlung hat, z. B. indem er sich an die Vorgaben des medizinischen Personals hält oder an den Erfolg der Maßnahme glaubt und sich somit nicht selbst aufgibt, ist er als Objekt zugleich Teil des Erfolgs. Hinzu kommt, dass der Behandlungserfolg von vielen weiteren Einflussfaktoren abhängt: Dazu zählen beispielsweise:
- der Zeitpunkt des Eingriffs,
- die personelle Ausstattung der Einrichtung zum Zeitpunkt des Eingriffs (erfolgt der Eingriff als ein Noteingriff am Wochenende oder als ein elektiver Eingriff während der Woche),
- die Möglichkeit, den Patienten auf den Eingriff vorzubereiten (z. B. Eigenblutspende).
Somit unterliegt der Behandlungserfolg großen Schwankungen. Dementsprechend schwankt die Qualität eines Eingriffs und die Zufriedenheit der Patienten, je nachdem wie sich die konkreten Rahmenbedingungen des Krankenhauses zum jeweiligen Zeitpunkt darstellen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4:Kontinuum der Evaluierung verschiedener Leistungsarten
(Quelle: Haller (2005), S.14)
Wie aus der Abbildung 4 zu entnehmen ist, fällt die Evaluierung von medizinischen Diagnosen dem Patienten äußerst schwer, weil er zugleich Subjekt und Objekt des Behandlungsprozesses ist. Er kann zumeist mangels Fachwissen nicht objektiv beurteilen, ob die medizinische Diagnose und Behandlung richtig oder falsch waren. Der Patient muss seinem Arzt größtenteils vertrauen.
Soll das Produkt Gesundheit in dem Sinne vergütungsrelevant werden, dass die Qualität der Leistungserbringung des einzelnen Krankenhauses vergütungsrelevant wird, muss sichergestellt werden, dass auch Gleiches mit Gleichem verglichen werden kann. Nur ein solcher methodischer Ansatz findet bei den beteiligten Leistungserbringern Akzeptanz, der sicherstellt, dass sich die Produktqualität auch valide messen lässt. Deshalb bietet es sich an, die Produktqualität einer Behandlung erst dann zu messen und zu bewerten, wenn die Behandlung abgeschlossen worden ist. Die Frage des richtigen Zeitpunkts wird im Gliederungspunkt 4 analysiert.
Nachfolgend wird die Frage untersucht, ob es geeignete Qualitätsindikatoren gibt, die diesen hohen Ansprüchen gerecht werden.
3.2 Die Qualität von Krankenhäusern
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA), das oberste Beschlussgremium der gemeinsamen Selbstverwaltung der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland, welcher die Maßnahmen der Qualitätssicherung für den ambulanten und stationären Bereich des Gesundheitswesens festlegt, definiert Qualität wie folgt:
„Unter Qualität kann man die Eignung einer Sache zu einem vorgegebenen Zweck verstehen.“ (vgl. G-BA (2007), S.5).
Damit diese Definition von Qualität Sinn macht, ist zu klären, über welche Eigenschaften die Gesundheitsdienstleistung verfügen muss, damit der „Zweck der Maßnahme“ auch erreicht werden kann.
In einem zweiten Schritt soll dann gemessen werden - „ wie viele dieser Eigenschaften oder in welchem Umfang diese tatsächlich vorzufinden sind“ (ebenda).
Exzellente Qualität bedeutet eine nahezu hundertprozentige Überlappung zwischen Erwartung und eingetretenem Ergebnis der medizinischen Leistung am Patienten. Bei suboptimaler Qualität bleibt das Ergebnis weit hinter dem zuvor avisierten Ziel zurück. Oftmals ist zuvor festzulegen, welche Erwartungen realistisch sind und welche Ergebnisse noch im Akzeptanzbereich liegen (ebenda). Insbesondere ist es wichtig, vor der Messung der Qualität den Referenzbereich zu definieren, mit dessen Hilfe die Messung erfolgen kann, um dann die Entscheidung treffen zu können, ob gute oder schlechte Qualität vorliegt.
Nachdem im Gliederungspunkt 3.3 die für diese Diplomarbeit relevanten Dimensionen von Qualität definiert werden, wird im Gliederungspunkt 4 die methodische Frage diskutiert, wie Qualität im Krankenhaus gemessen werden kann.
3.3 Dimensionen der Qualität von Krankenhäusern
Im Gesundheitswesen hat sich eine phasenorientierte Betrachtungsweise des Qualitätsbegriffs etabliert. Diese Betrachtungsweise wurde von Avedis Donabedian bereits in den 1960er Jahren entwickelt. Allgemeinem unterscheidet der Arzt und Gesundheitswissenschaftler drei Dimensionen der Qualität: die Struktur-, die Prozess- und die Ergebnisqualität (vgl. Roeder (2009), S.58). Zum Verständnis der Qualität im Krankenhaus ist es von besonderer Bedeutung zu erkennen, dass medizinische Leistungen in Prozessen gestaltet sind. Prozesse beschreiben einen Ablauf, z.B. die Patientenbehandlung in einem Krankenhaus, und zielen dabei auf ein übergeordnetes Ziel, die Gesundung des Patienten ab. Der Kern- oder Schlüsselprozess ist die Patientenbehandlung, die von der Aufnahme bis zur Entlassung des Patienten reicht. Dieser Schlüsselprozess besteht vorwiegend aus vielen verschiedenen Teilprozessen, z.B. die körperliche Untersuchung, die Operation, die ihrerseits auf Einzelkomponenten oder unterstützenden Prozessen aufbaut. Jeder dieser Teilprozesse ist mit für den Erfolg der medizinischen Behandlung verantwortlich. In der Managementwissenschaft ist dieses Phänomen mit dem Modell der Input-Output Transformation beschrieben. Das Modell zeigt, dass Prozesse und Ergebnisse direkt zusammenhängen sowie darüber hinaus, dass z.B. bestimmte Inputvariablen bzw. strukturelle Voraussetzungen vorhanden sein müssen, die zur Erreichung der Ergebnisse benötigt werden. Ein einfaches Beispiel zur Verdeutlichung dieses Zusammenhangs ist, dass ein Chirurg nicht ohne sein chirurgisches Werkzeug operieren kann und ohne Operation ist die Heilung des Patienten eventuell unmöglich (vgl. ebenda, S.58 f.).
3.3.1 Strukturqualität
Unter der Strukturqualität versteht man die strukturellen Voraussetzungen, die für die medizinische Versorgung benötigt werden. Im betriebswirtschaftlichen Sinne sind dies die Produktionsfaktoren bzw. Inputs (vgl. ebenda, S.59).
Dabei umfasst der Begriff die Bauwerke und materielle Ausstattung eines Krankenhauses, die technischen Geräte, ihre Instandhaltung und die Qualifikation der Mitarbeiter sowie die finanzielle Situation der Klinik (vgl. G-BA (2007), S.5). Die Strukturqualität lässt sich aufgrund ihres stark materiellen Charakters einfacher messen, weil sie durch einfaches Zählen, Messen, Wiegen etc. bestimmt werden kann. Oft geht es auch um die Frage, ob eine spezielle Qualifikation im Krankenhaus vorhanden ist oder nicht. Vereinfacht lautet dann z. B. die Frage: Gibt es in der Einrichtung einen Anästhesisten, der sich zum Schmerztherapeuten ausbilden ließe, oder nicht?
3.3.2 Prozessqualität
Die Prozessqualität beschreibt die Wertschöpfungskette eines Krankenhauses mit ihren Einzelprozessen. Sie bildet sich ab in der Qualität der Durchführung
- der jeweils anstehenden Operationen,
- der anschließenden Pflege und
- der sich anschließenden ambulanten Behandlungen.
(vgl. Roeder (2009), S.59).
3.3.3 Ergebnisqualität
Die Ergebnisqualität zeigt auf, welches Behandlungsergebnis zu einem bestimmten Zeitpunkt erreicht wurde. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob eine Heilung erfolgreich war und wie lange sie anhält (vgl. G-BA (2007), S.5). Darüber hinaus umfasst die Ergebnisqualität aber auch Aspekte, die eine Schnittmenge aus Prozess- und Strukturqualität bilden. Solch einen Faktor stellt z. B. die allgemeine Zufriedenheit des Patienten mit der erbrachten Leistung dar.
Wichtig ist hierbei, dass die drei Qualitätsdimensionen wechselseitig voneinander abhängen und nicht immer eindeutig voneinander abgrenzbar sind. Die Strukturqualität gilt beispielsweise als notwendige, nicht jedoch als hinreichende Bedingung für die Prozess- und Ergebnisqualität. Der Erfolg einer OP hängt so z.B. zunächst von den notwendigen Geräten und der Ausbildung der Ärzte ab. Dies stellt jedoch noch nicht sicher, dass die Abläufe auch effektiv verlaufen (Prozessqualität). Deshalb gibt nur die Ergebnisqualität eine zusammenfassende Aussage über den Grad der Qualität, da sie das erzielte Ergebnis als Summe aller drei Dimensionen misst (vgl. Roeder (2009), S.59).
Die Abbildung 5 zeigt noch einmal zusammenfassend die drei Dimensionen der Qualität nach Donabedian und die beschriebene Input-Output Transformation.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 5: Qualitätsdimensionen nach Donabedian
(Quelle: Roeder (2009), S.60)
In der Tabelle 1 befinden sich typische Beispiele dafür, anhand welcher Indikatoren die verschiedenen Qualitätsdimensionen gemessen werden können.
Für den Untersuchungsgegenstand dieser Diplomarbeit, die Vergütungsrelevanz von Qualität, reichen jedoch diese drei Qualitätsdimensionen noch nicht aus, weil ein wesentlicher Erfolgsfaktor bei der Leistungserbringung eines Krankenhauses, die Patientenzufriedenheit, noch fehlt. Deshalb wird nachfolgend die Patientenzufriedenheit als vierte Dimension untersucht.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 1: Qualitätsindikatoren zur Messung von Struktur-,Prozess- und Ergebnisqualität
(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Roeder (2009), S.60)
3.3.4 Patientenzufriedenheit als vierte Qualitätsdimension
Patientenzufriedenheit gibt die subjektive Sicht des Patienten wieder, inwieweit er mit dem Prozess der Genesung seiner Gesundheit zufrieden ist. Aussagen zur Patientenzufriedenheit beschreiben, ob und in welchem Umfang die Erwartungen des Patienten erfüllt wurden.
Daher stellt die Patientenzufriedenheit einen weichen Faktor dar, der nicht wie die vorher beschriebenen Dimensionen anhand objektiver Kriterien gemessen werden kann (vgl. Ziesche (2008), S. 13). Da der Patient im Sinne der Integration des externen Faktors (vgl. Gliederungspunkt 3) zugleich Objekt und Subjekt der Dienstleistung eines Krankenhauses ist, sollte seine eigene Meinung, obwohl rein subjektiv, immer auch bei der Gesamtbewertung der Qualität mit einbezogen werden. Der Patient hat einen großen Anteil daran, ob die medizinische Behandlung erfolgreich verläuft oder nicht.
Exemplarisch lässt sich dieser Effekt am sogenannten Placebo-Effekt beschreiben: Der Glaube an ein heilendes Medikament senkt beispielsweise die Schmerzen, obwohl das Medikament lediglich Substanzen wie Zucker enthält. Die psychische Wirkung der Patientenzufriedenheit auf den Heilungserfolg ist, wie der Placebo-Effekt zeigt, nicht zu unterschätzen (vgl. Westerhoff, 16.02.2007, veröffentlicht im Internet (8.11.2009))
Deshalb wird nachfolgend ein komplexer Qualitätsbegriff verwendet, der sich aus der gewichteten Summe aus Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität sowie einer weiteren vierten Dimension, der Patientenzufriedenheit, zusammensetzt. Die Summe aus diesen vier Qualitätsdimensionen wird als die Versorgungsqualität eines Krankenhauses definiert. Erst wenn in einer sachgerechten und angemessenen Form die Versorgungsqualität als gewichtete Summe aus der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität sowie der Patientenzufriedenheit gemessen werden kann, kann Qualität als Indikator zur Bewertung der Leistungserbringung eines Krankenhauses berücksichtigt werden. Die Höhe der Vergütung eines Krankenhauses hängt demnach zukünftig von der
- Menge und der Art der erbrachten Leistung,
- der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität sowie
- der Patientenzufriedenheit ab.
3.4 Versorgungsqualitäten als Qualitätsbegriff zur Etablierung eines p4p-Ansatzes
Für den Untersuchungsgegenstand dieser Diplomarbeit, der Entwicklung eines neuen qualitätsorientierten Vergütungssystems, wird, wie im Gliederungspunkt 3.3.4 beschrieben, der Begriff der Versorgungsqualität eingeführt, der sich aus der gewichteten Summe aus Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität sowie der Patientenzufriedenheit zusammensetzt.
Die Formel, nach der zukünftig die Leistung eines Krankenhauses vergütet werden soll, lautet deshalb vereinfacht wie folgt:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Noch nicht geklärt ist, welche Gewichtung ([Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]) die einzelnen Qualitätsdimensionen zukünftig haben werden. Diese Festlegung kann erst dann getroffen werden, wenn herausgearbeitet wurde, wie genau Qualität gemessen werden kann und welche gesundheitspolitischen Ziele mit der entsprechenden Gewichtung erreicht werden sollen.
Als Schlussfolgerung dieses Gliederungspunktes wird eine vierte Hypothese formuliert, die wie folgt lautet:
Durch die Berücksichtigung der Patientenzufriedenheit bei der Definition des Produkts „Gesundheit“ gewinnt diese Vergütungsrelevanz. Dementsprechend ist davon auszugehen, dass bei der Etablierung eines p4p-Ansatzes eine hohe Patientenzufriedenheit längerfristig einen hohen Stellenwert für das Qualitätsmanagement eines Krankenhauses gewinnen wird.
Aus der vierten Hypothese lässt sich unmittelbar noch eine weitere, die fünfte Hypothese ableiten:
Sobald die Patientenzufriedenheit vergütungsrelevant wird, ändert sich auch das Informationsverhalten der Krankenhäuser, da die Patientenzufriedenheit maßgeblich davon abhängt, wie sich der Patient eingebunden fühlt.
Auf diesen Aspekt wird im Gliederungspunkt 4.3 einzugehen sein, wenn analysiert wird, wie Patientenzufriedenheit gemessen werden kann und in welcher Weise die Patienten über das Ergebnis der Messung informiert werden sollten.
4 Die Messung der Versorgungsqualität in Hinblick auf den „pay for performance“-Ansatz (p4p)
Nachdem der Qualitätsbegriff für diese Arbeit definiert wurde, ist jetzt festzulegen, wie die Versorgungsqualität eines Krankenhauses gemessen werden kann. In einem letzten Schritt können dann die einzelnen Variablen zu einem neuen Vergütungsmodell zusammengesetzt werden. Eine exakte Abbildung der eben diskutierten Dimensionen von Qualität ist Voraussetzung dafür, dass die Versorgungsqualität eines Krankenhauses vergütungsrelevant werden kann. Die Versorgungsqualität exakt abzubilden, ist äußerst anspruchsvoll, weil ein Krankenhaus ein überaus komplexes Gebilde ist. Soll Qualität vergütungsrelevant werden, müssen alle relevanten Dimensionen von Qualität valide messbar sein, weil es sonst zu erheblichen Akzeptanzproblemen bei den Marktteilnehmern kommen kann. Dies erfordert eine valide Datenbasis, die nur über einen längeren Zeitraum gewonnen werden kann. Deshalb wird nachfolgend ein Stufenmodell vorgeschlagen, das als ein lernendes System konzipiert ist. Nur so kann sichergestellt werden, dass auch nur die Indikatoren zur Messung von Versorgungsqualität zum Einsatz kommen, die auch tatsächlich die Versorgungsqualität eines Krankenhauses valide messen.
Damit einher geht, dass auch institutionelle Veränderungen geplant und umgesetzt werden müssen. Das neue qualitätsorientierte Vergütungsmodell bedingt, dass es nicht oder möglichst nur in einem sehr geringen Umfang manipuliert werden kann. Wie die Analyse des Qualitätsbegriffs bereits ergab, muss die Messung von Versorgungsqualität objektiv nachvollziehbar sein, um sicherstellen zu können, dass auch nur die Leistungen mit einem Qualitätsaufschlag vergütet werden, die auch tatsachlich eine höhere Versorgungsqualität beinhalten.
4.1 Die Messung von Struktur – und Prozessqualität mittels eines einrichtungseigenen Qualitätsmanagements
Krankenhäuser sind gemäß § 135a Absatz 2 Satz 2 SGB V verpflichtet, ein einrichtungsinternes Qualitätsmanagement einzuführen und weiterzuentwickeln. Dabei besteht für das jeweilige Krankenhaus die Möglichkeit, sich sein einrichtungsinternes Qualitätsmanagement gemäß § 135a Absatz 2 Satz 2 SGB V von einem externen Gutachter zertifizieren zu lassen. Dies ist jedoch nicht bei jedem Zertifizierungsverfahren vorgeschrieben, so dass nachfolgend bei der Bewertung der verschiedenen Zertifizierungsverfahren immer darauf zu achten ist, ob unabhängige Dritte mit eingebunden werden müssen oder nicht.
Bei sachgerechter Anwendung des zertifizierten Verfahrens wird der jeweiligen Einrichtung bestätigt, „… dass ein Produkt, eine Dienstleistung oder eine ganze Organisation sich einem externen Prüfverfahren gestellt hat und alle vorgegebenen Anforderungen erfüllt“ (Westrick/ Weymayr (2007), S.38) wurden.
Beim Krankenhausmanagement fanden diese Gütesiegel und Zertifikate bis Anfang des neuen Jahrtausends nur geringe Beachtung, weil die unterschiedlichen Zertifizierungsverfahren zu einer hohen Intransparenz, u. a. auch beim Patienten führten, so dass durch eine Zertifizierung kein messbarer Zusatznutzen für das jeweilige Krankenhaus geschaffen wurde. Erschwerend kam bzw. kommt bei dieser freiwilligen Form der Zertifizierung hinzu, dass Krankenhäuser zur Zeit noch die Wahl haben, ob sie es nur bei einem internen Qualitätsmanagement belassen oder sie zusätzlich noch einen unabhängigen Dritten mit der Überprüfung beauftragen. Dadurch haben die Krankenhäuser bei der Wahl ihres Qualitätsmanagement-Systems einen sehr großen Freiraum, der faktisch zu einem großen Akzeptanzverlust führt, da der Verbraucher nicht einschätzen kann, was das jeweilige Zertifikat letztendlich bestätigt. Auch kann bei Verfahren der freiwilligen Zertifizierung des einrichtungsinternen Qualitätsmanagements nicht ausgeschlossen werden, dass ein Krankenhaus eine Form der Zertifizierung wählt, welche mit dem geringsten Aufwand verbunden ist (vgl. ebenda, S.40f.).
Im Rahmen eines Praktikums bei der Krankenhausgesellschaft Sachsen hatte der Autor die Möglichkeit, eine Markterhebung über den Stand der Zertifizierung von Krankenhäusern im Freistaat Sachsen durchzuführen. Dabei zeigte sich, dass ein Zustand besteht, den man “Zertifikate-Dschungel“ nennen könnte. Die Markterhebung, die im Mai 2009 durchgeführt wurde, ergab folgendes Bild:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 6: Übersicht über den Stand der Zertifizierung im Freistaat Sachsen
(Quelle: Eigene Abbildung und Recherche im Auftrag der Krankenhausgesellschaft Sachsen im Mai 2009)
Wie die Abbildung 6 zeigt, waren im Freistaat Sachsen im Mai 2009 rund 48 % der Krankenhäuser zertifiziert, wobei die folgenden fünf Zertifizierungsverfahren zum Einsatz kamen: DIN ISO 9001, KTQ, Joint Commission, EFQM und Procum Cert. Sie werden im Gliederungspunkt 4.1.1 kurz vorgestellt, um eine Entscheidung vorbereiten zu können, welches der gängigen Zertifizierungsverfahren sich für die Umsetzung eines p4p-Ansatzes eignet.
4.1.1 Etablierte Zertifizierungsverfahren
Nachfolgend werden die verschiedenen Zertifizierungsverfahren hinsichtlich ihrer Ziele und ihrer Vorgehensweise gegenübergestellt:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Gemeinsames Merkmal dieser Zertifizierungsverfahren ist, dass sie sich darauf beschränken, nur die Prozess- und Strukturqualität zu messen. Da bei der Messung von Prozess- und Strukturqualität nicht das Ergebnis, sondern nur der Weg zum Ergebnis analysiert bzw. gemessen wird, ist deren Einführung, wie Erfahrungen aus den USA und Großbritannien (vgl. Gliederungspunkt 5.2) zeigen, wesentlich einfacher. Dabei zählen nur Fakten, die durch einfaches Messen, Wiegen oder Zählen ermittelt werden können.
Zur Messung der Prozessqualität wird, z. B. bei einer Operation, von Visitoren überwacht, ob alle formalen Erfordernisse erfüllt werden. Dabei wird überprüft, ob der Patient
- umfassend vor dem Eingriff aufgeklärt wurde,
- eine umfassende Anamnese durchgeführt wurde,
- er richtig während der Operation gelagert wurde und Hygieneerfordernisse beachtet wurden.
Die Prozessqualität lässt sich leicht anhand von Checklisten bzw. Behandlungspfaden ermitteln, mit deren Hilfe überwacht wird, ob alle vorgesehenen Einzelschritte auch tatsächlich durchgeführt bzw. beachtet werden. Ähnlich wie bei einem Piloten vor dem Start, sind im Falle einer Operation die Operateure angehalten, sich exakt an die Vorgaben und Überprüfungsschritte zu halten, die in der Checkliste ausgewiesen werden, um Fehler zu vermeiden (vgl. Hehner/ Salfeld/ Wichels (2008), S.11).
Bei der Messung der Strukturqualität wird demgegenüber rein formal darauf geachtet, ob z.B. die OP-Ausstattung für den geplanten Eingriff angemessen ist. So kann eine große Herzoperation nur durchgeführt werden, wenn das notwendige Equipment im OP-Saal, wie z. B. eine Herz-Lungen-Maschine, zur Verfügung steht (vgl. Burchardi/ Jauch/ Larsen/ Kuhlen/ Schölmerich (2008), S.83).
Aufgrund der Einfachheit und Robustheit dieser Messmethoden sollte im Zuge der Einführung eines qualitätsorientierten Vergütungssystems darauf geachtet werden, dass die Qualitätsdimensionen zunächst stärker gewichtet werden, weil deren Messung weniger manipulationsanfällig ist.
Von den in Deutschland verwendeten Zertifizierungsverfahren bietet sich zur Einführung eines p4p-Ansatzes das KTQ-Verfahren am ehesten an, weil das KTQ-Verfahren eine gelungene Kombination aus Eigenbewertung und Fremdbewertung darstellt. Des Weiteren wurde dieses Verfahren von Praktikern aus den Krankenhäusern für den Einsatz im Krankenhaus entwickelt, was sicherstellt, dass es auch praktikabel ist und mit einem vertretbaren Aufwand umgesetzt werden kann (vgl. Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen (2006), S.1). Da dieses Verfahren am weitesten in der deutschen Krankenhauslandschaft verbreitet ist, bereits im September 2009 wurde das 1000. KTQ-Zertifikat verliehen (vgl. Das Krankenhaus (10/09), S.968), wird dieses Zertifizierungsverfahren nachfolgend näher beschrieben.
4.1.2 KTQ-Verfahren (Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen)
Das KTQ-Zertifizierungsverfahren besteht aus drei Teilen:
Teil 1: Selbstbewertung des Krankenhauses
Der erste Teil umfasst die Selbstbewertung des Krankenhauses. Die Selbstbewertung ist eine Gesamtabbildung des jeweiligen Krankenhauses in Bezug auf die im KTQ-Katalog beschriebenen Strukturdaten und Anforderungen zu einzelnen Prozessabläufen. Die Durchführung der Selbstbewertung erfolgt anhand des „KTQ-Manual“ (vgl. hierzu die Abbildungen im Gliederungspunkt 5.4.1). Die Selbstbewertung dient der Gewinnung eines Bildes über den IST-Zustand. Im Zuge der Eigenbewertung beurteilen die Mitarbeiter einer Fachabteilung eines Krankenhauses die folgenden sechs Bereiche:
1. Patientenorientierung
2. Mitarbeiterorientierung
3. Sicherheit im Krankenhaus,
4. Informationswesen
5. Krankenhausführung
6. Qualitätsmanagement
(vgl. Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen (2006), S.2)
Als Unterstützung für diesen Bewertungsprozess fungiert der KTQ-Regelkreis, der der Systematik:
Plan – Do – Check - Act
folgt.
Dabei bedeutet:
Plan: Die Beschreibung des Planungsprozesses
Do: Die Beschreibung des IST-Zustands des Krankenhauses
Check: Die Überprüfung des Zielerreichungsgrads zum jeweiligen Zeitpunkt
Act: Die Entwicklung von Verbesserungsvorschlägen auf Grundlage von Check (vgl. Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen (2004), S.30 f.)
Die Abbildung 7 zeigt schematisch den KTQ-Regelkreis.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 7: Der KTQ-Regelkreis
(Quelle: Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen (2009), veröffentlicht im Internet (15.11.2009))
Teil 2: Fremdbewertung
Der zweite Teil der KTQ-Zertifizierung ist die Fremdbewertung bzw. Visitation des Krankenhauses. Im Zuge der Fremdbewertung besuchen sogenannte Visitoren (Fachkollegen) die Abteilung bzw. das Krankenhaus und validieren die zuvor gemachte Selbstbewertung mit Hilfe von Kollegialen Dialogen. Dabei werden auch einzelne Fachabteilungen inspiziert. Durch einen intensiven Gedankenaustausch unter Kollegen soll erreicht werden, dass Verbesserungsvorschläge, die durch das KTQ-Verfahren generiert wurden, verstanden, akzeptiert und in die Praxis umgesetzt werden. Die Phase ist sehr sensibel, weil viel Einsichtigkeit, soziale Kompetenz und Kommunikationsvermögen von allen Beteiligten notwendig ist (vgl. Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen (2004), S.57).
Teil 3: Veröffentlichung des KTQ-Berichts und Verleihung des KTQ-Zertifikats
Im dritten Schritt wird der KTQ-Qualitätsbericht erstellt und veröffentlicht. Im Anschluss an eine erfolgreiche Fremdbewertung erfolgt die Verleihung eines KTQ-Zertifikates, mit dem nach außen dokumentiert wird, dass diese Fachabteilung bzw. dieses Krankenhaus den KTQ-Anforderungen (eine Art TÜV-Siegel) entspricht. Das KTQ-Zertifikat behält drei Jahre Gültigkeit, so dass jede zertifizierte Einrichtung angehalten ist, sich diesem Zertifizierungsprozess in regelmäßigen Abständen erneut zu unterziehen (vgl. Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen (2006), S.3).
Die breite Datenbasis des KTQ-Verfahrens, jedes zweite Krankenhaus in Deutschland ist mittlerweile nach KTQ zertifiziert, stellt eine gute Voraussetzung zur Einführung des p4p-Ansatzes dar, weshalb das KTQ-Verfahren im Weiteren als der Baustein zu der Messung von Struktur- und Prozessqualität herangezogen wird.
Jedoch ist kritisch anzumerken, dass es sich bei der KTQ-GmbH um eine private Organisation handelt, die zwar sehr breit vernetzt ist, jedoch mit ihrem Messverfahren gezwungen ist, immer auch eigene betriebswirtschaftliche Ziele zu verfolgen. Deshalb besteht die Gefahr, dass, sobald die gemessenen Qualitäten Umsatzrelevanz für die einzelnen Krankenhäuser erlangen, sich der Druck auf die KTQ-GmbH stark erhöht, und die für die Messung zwingend notwendige Unabhängigkeit nicht immer vollständig garantiert werden kann. Dieses Risiko nimmt noch zu, wenn neben der Prozess- und Strukturqualität auch die Ergebnisqualität und die Patientenzufriedenheit Vergütungsrelevanz bei einem p4p-Ansatz für die Krankenhäuser erlangen. Deshalb wird im Gliederungspunkt 5.3 nochmals die Frage aufgegriffen, wie zweckmäßiger Weise das Verfahren der Qualitätsmessung organisiert werden muss, um eine höchstmögliche Transparenz und Unabhängigkeit gewährleisten zu können.
[...]
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2010
- ISBN (eBook)
- 9783842804067
- DOI
- 10.3239/9783842804067
- Dateigröße
- 5.4 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Leipzig – Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Studiengang BWL
- Erscheinungsdatum
- 2010 (September)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- krankenhaus gesundheitswesen reform qualität
- Produktsicherheit
- Diplom.de