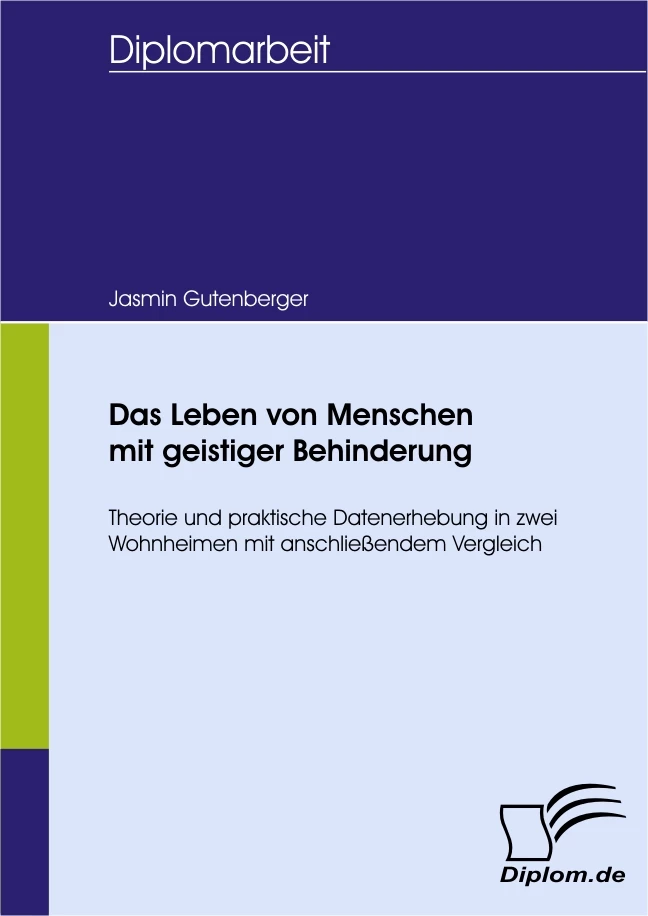Das Leben von Menschen mit geistiger Behinderung im Wohnheim unter besonderer Berücksichtigung der Selbstbestimmung
Theorie und praktische Datenerhebung in zwei Wohnheimen mit anschließendem Vergleich
Zusammenfassung
Primärer Gegenstand vorliegender Arbeit ist die Selbstbestimmung von Menschen mit geistiger Behinderung in Wohnheimen.
Die Selbstbestimmung von Menschen mit geistiger Behinderung ist zum großen Teil abhängig von den gegebenen Möglichkeiten und Chancen, die von der unmittelbaren und der mittelbaren Umwelt (...) eingeräumt werden. Genannter Personenkreis hat demnach nicht die gleichen Voraussetzungen und Möglichkeiten wie Menschen ohne Behinderung, die in der Regel ab einem bestimmten Alter das Elternhaus verlassen und ihren Weg selbst bestimmt und selbstständig gehen können.
Mehr als die Hälfte der erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung wohnen noch im Elternhaus.
Dafür ist nicht nur das oft anhängliche Verhalten der Eltern, sondern auch der Mangel an Platzangeboten sowie der Umgang mit dieser Personengruppe in Wohneinrichtungen für Menschen mit geistiger Behinderung verantwortlich.
Wie eigene Erfahrungen bei der Betreuung von Freizeiten für Menschen mit geistiger Behinderung zeigten, hat eine große Anzahl dieser Menschen den Wunsch, aus dem Elternhaus auszuziehen, um ihr Leben unabhängig von diesem führen zu können. Ihnen sollte diese Möglichkeit ebenso wie jungen Erwachsenen ohne Behinderung gegeben werden.
Die meisten Menschen mit geistiger Behinderung sind nicht fähig, alleine zu wohnen und daher auf die Hilfe anderer angewiesen. Sie begeben sich aus der Abhängigkeit von den Eltern in die Abhängigkeit neuer Personen. Es gibt für sie abgesehen von wenigen Ausnahmen nur die Möglichkeit, in einem Wohnheim oder in einer ähnlichen Wohnform zu leben.
Daher soll in dieser Arbeit exemplarisch untersucht werden, inwieweit Menschen mit geistiger Behinderung, die in Einrichtungen wohnen, tatsächlich über ihr Leben bestimmen und dieses genießen können. Fraglich ist, inwiefern sie der Fremdbestimmung durch Grenzen und Regeln einer Einrichtung unterliegen.
In vorliegender Arbeit wird ansatzweise dargestellt, was Selbstbestimmung und auch die damit verbundene Normalisierung generell und besonders in Bezug auf Menschen mit geistiger Behinderung in Wohnheimen bedeuten und voraussetzen. Es wird also ein so genannter Soll-Zustand beschrieben.
Diesem angedachten Soll-Zustand soll ein beschriebener Ist-Zustand gegenüber gestellt werden. Um die Realität, die in Wohneinrichtungen vorherrscht, exemplarisch aufzu- zeigen, ist es notwendig, einen Blick direkt in das Milieu hinein zu werfen. Dazu werden für diese […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Motivation und Gegenstand
1.2 Vorgehensweise und Aufbau
2 Der Personenkreis der Menschen mit geistiger Behinderung
2.1 Bezeichnungen
2.2 Der Versuch einer Begriffsklärung
2.3 Definitionen und Ansätze aus verschiedenen Sichtweisen
2.3.1 Rechtliche und sozial rechtlich Sichtweise
2.3.2 Medizinische Sichtweise
2.3.2.1 Pränatale Ursachen
2.3.2.2 Perinatale Ursachen
2.3.2.3 Postnatale Ursachen
2.3.3 Pädagogische Sichtweise
2.3.4 Soziologische Sichtweise
2.3.5 Psychologische Sichtweise
2.3.5.1 Adaptives Verhalten
2.3.5.2 Intelligenzdiagnostik
2.3.6 Verschiedene Sichtweisen – Schlussbetrachtung
2.4 Einstellungswandel gegenüber Menschen mit geistiger Behinderung
2.5 Verhalten der Bevölkerung im Laufe der Geschichte
2.6 Zusammenfassung
3 Aktuelle Leitideen in der Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung
3.1 Das Normalisierungsprinzip
3.1.1 Entstehung des Normalisierungsgedankens
3.1.1.1 Normalisierung nach Nils Erik Bank-Mikkelsen
3.1.2.2 Normalisierung nach Bengt Nirje
3.1.3.3 Normalisierung nach Wolf Wolfenberger
3.1.2 Zusammenfassung der Forderungen des Normalisierungsprinzips
3.1.3 Das Normalisierungsprinzip in Deutschland
3.1.4 Aktuelle Entwicklungen
3.1.5 Der Zusammenhang von Normalisierung und Selbstbestimmung
3.2 Das Paradigma der Selbstbestimmung
3.2.1 Der Begriff der Selbstbestimmung
3.2.2 Entstehungsgeschichte der Selbstbestimmung
3.2.2.1 Independent-Living-Bewegung
3.2.2.2 Self-Advocacy-Bewegung
3.2.3 Selbstbestimmung bei Menschen mit geistiger Behinderung
3.2.3.1 Die neue Rolle des Helfenden
3.2.3.2 Vorstellung neuer Konzepte
3.2.3.2.1 Das Konzept des Empowerments
3.2.3.2.2 Das Konzept der persönlichen Assistenz
3.2.3.2.3 Das Kundenmodell
3.2.3.3 Mehr Selbstbestimmung durch rechtliche Betreuung
3.2.3.4 Auswirkungen des Selbst bestimmt-Leben-Konzeptes
3.3 Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinderung am gesell- schaftlichen Leben: Komponenten der Inklusion
3.3.1 Barrierefreiheit
3.3.2 Das Gleichbehandlungsgesetz
3.3.3 Die Konvention der Vereinten Nationen
3.3.3.1 Perspektivenwechsel
3.3.3.2 Zweck der BRK
3.3.3.3 Verpflichtungen
3.3.3.4 Forderungen der BRK
3.4 Zusammenfassung
4 Wohnen
4.1 Bedeutung des Wohnens
4.2 Wohnqualität und Wohnbedürfnisse
4.3 Zentrale soziale Funktionen einer Wohnung
4.4 Wohnen bei Menschen mit geistiger Behinderung
4.4.1 Geschichte der Unterbringung
4.4.2 Gegenwärtige Wohnformen
4.4.3 Charakterisierung eines Wohnheims
4.4.3.1 Aufnahme in ein Wohnheim
4.4.3.2 Finanzierung
4.4.3.3 Personal
4.5 Selbst bestimmtes Leben in Wohnheimen für Menschen mit geistiger Behinderung
4.5.1 Kriterien für das selbst bestimmte Wohnen
4.5.1.1 Bestimmung des Wohnorts und Wahl des Wohnheims
4.5.1.2 Interne Notwendigkeiten in der Einrichtung
4.5.1.3 Notwendige Gegebenheiten in der Umgebung der Einrichtung
4.5.1.4 Bildung von Bedürfnissen
4.5.1.5 Veränderung der Beziehung zwischen Bewohnern und Betreuern
4.5.2 Gesetzliche Rahmenbedingungen als Voraussetzung
4.5.2.1 Allgemeine Gesetze und Bestimmungen
4.5.2.2 Bestimmungen und Verordnungen für das Wohnen
4.5.3 Qualitätsmessung in Wohnheimen
4.5.4 Schwierigkeiten bei der Umsetzung
4.6 Zusammenfassung Eigene Erhebung in zwei Wohnheimen
5 Vorstellung der Trägerschaft und der Wohnheime
5.1 Der Internationale Bund (IB)
5.1.1 Gründung
5.1.2 Geschichtliche Entwicklung
5.1.3 Zahlen: Mitarbeiter/ Einrichtungen/ Hilfeempfänger
5.1.4 Arbeitsfelder des IB
5.1.5 Die IB-Behindertenhilfe
5.1.5.1 Leitlinien und Menschenbild
5.1.5.2 Wohnformen für Menschen mit Behinderung
5.1.5.3 Stationäre Einrichtungen
5.1.5.3.1 Anzahl der Einrichtungen
5.1.5.3.2 Finanzierung der Einrichtungen
5.1.5.3.3 Gesetze als Voraussetzung für die Auf- nahme in ein Wohnheim
5.2 Vorstellung der Wohnheime
5.2.1 Wohnheim I
5.2.1.1 Fakten und Zahlen
5.2.1.2 Lage und Räumlichkeiten
5.2.1.3 Bewohner
5.2.1.4 Werkstatt und Tagesförderstätte
5.2.1.5 Tagesablauf
5.2.1.6 Freizeit und Urlaub
5.2.1.7 Allgemeine Gegebenheiten
5.2.1.8 Mitarbeiter
5.2.1.9 Qualitätsmessung
5.2.1.10 Finanzierung
5.2.2 Wohnheim II
5.2.2.1 Fakten und Zahlen
5.2.2.2 Lage und Räumlichkeiten
5.2.2.3 Bewohner
5.2.2.4 Werkstatt und Tagesförderstätte
5.2.2.5 Tagesablauf
5.2.2.6 Freizeit und Urlaub
5.2.2.7 Allgemeine Gegebenheiten
5.2.2.8 Mitarbeiter
5.2.2.9 Qualitätsmessung
5.2.2.10 Finanzierung
5.3 Zusammenfassung
6 Die Interviews mit den Bewohnern
6.1 Vorbereitungen
6.2 Vorstellung der Interviewpartner
6.2.1 Bewohner des Wohnheims I
6.2.2 Bewohner des Wohnheims II
6.3 Die Forschungsmethodik
6.3.1 Wahl des Interviews als Befragungsmethode
6.3.2 Vorgehensweise unter Berücksichtigung des Personenkreises
6.3.2.1 Wichtige Kriterien für die Durchführung der Interviews
6.3.2.2 Sprache und Umfang des Interviews
6.3.3 Das Leitfadeninterview
6.3.4 Die Interviewfragen
6.4 Durchführung der Interviews
6.5 Vorgehen bei der Auswertung der Interviews
6.5.1 Einteilung in Themenbereiche
6.5.2 Transkription
6.5.3 Anwendung der qualitativen Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring
6.6 Zusammenfassung
7 Ergebnisse der Interviews und Ergänzung durch Fragebögen
7.1 Ergebnisse der Interviews
7.1.1 Wohlfühlfaktor im Wohnheim und Selbstbestimmung beim Ein-und Auszug
7.1.2 Privatsphäre
7.1.3 Selbstbestimmung im Alltag I (Zimmergestaltung/ Ernährung/Bekleidung)
7.1.4 Selbstbestimmung im Alltag II (Freizeit/Urlaub/ Schlafenszeiten)
7.1.5 Zwischenmenschliche Kontakte und Beziehungen
7.1.6 Umgang der Betreuer mit den Bewohnern
7.1.7 Verfügungsgewalt der Bewohner über das Taschengeld
7.2 Darstellung des Fragebogens für die Betreuer
7.2.1 Aufbau des Fragebogens
7.2.2 Die Fragen
7.2.3 Ergebnisse der Befragung
7.2.3.1 Darstellung in Tabellen
7.2.3.2 Schriftliche Darstellung der Ergebnisse
7.3 Zusammenfassung
8 Reflexion und Interpretation der Ergebnisse
8.1 Zusammenfassung
9 Fazit
10 Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabellenverzeichnis
Tab.1 Gegenüberstellung der ICIDH und ICIDH-2 (WHO)
Tab.2 AAMD-Klassifikation nach IQ-Werten
Tab.3 Internationale Klassifikation psychischer Störungen (WHO 2000)
Tab.4 Historische Modelle der Behindertenhilfe
Tab.5 Von der Verwahrung über die Förderung zur Selbstbestimmung
Tab.6 Auswirkungen des Selbst-Leben-Konzeptes
Tab.7 Wohnformen und ihre Spezifikationen
Tab.8 Zielgruppenmanagement (ZGM)
Tab.9 Entscheidungsfreiheit
Tab.10 Bedürfnisbefriedigung
Tab.11 Der Umgang des Personals mit den Bewohnern
Tab.12 Einbeziehung der Bewohner
Tab.13 Genug Personal?
Tab.14 Würden Sie selbst sich in dem Wohnheim – in dem Sie arbeiten – wohl fühlen?
1 Einleitung
1.1 Motivation und Gegenstand
Primärer Gegenstand vorliegender Arbeit ist die Selbstbestimmung von Menschen mit geistiger Behinderung in Wohnheimen.
Die Selbstbestimmung von Menschen mit geistiger Behinderung ist zum großen Teil abhängig „von den gegebenen Möglichkeiten und Chancen, die von der unmittelbaren und der mittelbaren Umwelt (...) eingeräumt werden.“ (Knust-Potter 1997, S. 519). Genannter Personenkreis hat demnach nicht die gleichen Voraussetzungen und Möglich- keiten wie Menschen ohne Behinderung, die in der Regel ab einem bestimmten Alter das Elternhaus verlassen und ihren Weg selbst bestimmt und selbstständig gehen können.
Mehr als die Hälfte der erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung wohnen noch im Elternhaus.
Dafür ist nicht nur das oft anhängliche Verhalten der Eltern, sondern auch der Mangel an Platzangeboten sowie der Umgang mit dieser Personengruppe in Wohneinrichtungen für Menschen mit geistiger Behinderung verantwortlich.
Wie eigene Erfahrungen bei der Betreuung von Freizeiten für Menschen mit geistiger Behinderung zeigten, hat eine große Anzahl dieser Menschen den Wunsch, aus dem Elternhaus auszuziehen, um ihr Leben unabhängig von diesem führen zu können. Ihnen sollte diese Möglichkeit ebenso – wie jungen Erwachsenen ohne Behinderung – gegeben werden.
Die meisten Menschen mit geistiger Behinderung sind nicht fähig, alleine zu wohnen und daher auf die Hilfe anderer angewiesen. Sie begeben sich aus der Abhängigkeit von den Eltern in die Abhängigkeit neuer Personen. Es gibt für sie – abgesehen von wenigen Ausnahmen – nur die Möglichkeit, in einem Wohnheim oder in einer ähnlichen Wohnform zu leben.
Daher soll in dieser Arbeit exemplarisch untersucht werden, inwieweit Menschen mit geistiger Behinderung, die in Einrichtungen wohnen, tatsächlich über ihr Leben bestimmen und dieses genießen können. Fraglich ist, inwiefern sie der Fremd- bestimmung durch Grenzen und Regeln einer Einrichtung unterliegen.
In vorliegender Arbeit wird ansatzweise dargestellt, was Selbstbestimmung und auch die damit verbundene Normalisierung generell – und besonders in Bezug auf Menschen mit geistiger Behinderung in Wohnheimen – bedeuten und voraussetzen. Es wird also ein so genannter Soll-Zustand beschrieben.
Diesem angedachten Soll-Zustand soll ein beschriebener Ist-Zustand gegenüber gestellt werden. Um die Realität, die in Wohneinrichtungen vorherrscht, exemplarisch aufzu- zeigen, ist es notwendig, einen Blick direkt in das Milieu hinein zu werfen. Dazu werden für diese Arbeit – im Zuge einer eigenen Erhebung – Interviews mit Bewohnern und eine Fragebogenerhebung bei den pädagogischen Fachkräften in zwei Wohnheimen für Menschen mit geistiger Behinderung durchgeführt.
Es werden zehn Bewohner zu den Themen Selbstbestimmung, Zufriedenheit und zwischenmenschliche Beziehungen in den Wohneinrichtungen befragt.
Da die zehn Befragten keine zahlenmäßig repräsentative Gruppe darstellen, handelt es sich eher um eine Stichprobe, die Aufschluss über die subjektive Meinung dieser Bewohner geben soll. Wichtig sind dabei ihre situationsbedingte Zufriedenheit sowie die ihnen gegebenen Möglichkeiten zur Selbstbestimmung.
Die befragten Bewohner gehören nicht einer bestimmten Altersgruppe an, sondern es wird Wert darauf gelegt, dass erwachsene Menschen verschiedenen Alters zu Wort kommen. Denn vor allem in Wohnheimen für Menschen mit geistiger Behinderung leben unterschiedliche Generationen zusammen.
Darüber hinaus werden die pädagogischen Mitarbeiter der Wohnheime gebeten, Fragebögen auszufüllen, in welchen die oben genannten Themen behandelt werden. Somit kann letztendlich eine Meinung Dritter mit in das Gesamtergebnis einfließen.
Das Ziel vorliegender Arbeit soll es sein, herauszufinden, inwieweit die befragten Menschen mit geistiger Behinderung in den zwei – für diese Arbeit willkürlich ausgewählten Wohnheimen – ein Leben nach den Kriterien der Selbstbestimmung führen können.
Eventuell sind schlussendlich Verbesserungsvorschläge möglich.
1.2 Vorgehensweise und Aufbau
Im zweiten Kapitel wird der Personenkreis der Menschen mit geistiger Behinderung beschrieben. Es wird die Geschichte verschiedener Bezeichnungen und Begrifflichkeit dargestellt. Anschließend werden Definitionen und Ansätze bezüglich des Begriffes „Geistige Behinderung“ aus verschiedenen Sichtweisen genannt. Letztendlich wird in dem zweiten Kapitel die Geschichte des Schicksals der Menschen mit geistiger Behinderung in Bezug auf den Einstellungswandel in der Gesellschaft dargestellt. Die Informationen dieses Kapitels sollen dem Leser vermitteln, von welchem Personenkreis – aus verschiedenen wissenschaftlichen Sichtweisen – die Rede ist und einen kurzen Blick in die Vergangenheit ermöglichen.
Im dritten Kapitel werden dem Leser die aktuellen Leitideen der Pädagogik vorgestellt. Da unterschiedliche Leitideen zusammenhängen, werden hier die der Normalisierung, der Selbstbestimmung und der Inklusion beschrieben. Es wird neben der Bedeutung der jeweiligen Idee auf deren Entwicklungsgeschichte eingegangen.
Da in vorliegender Arbeit auf die Selbstbestimmung das Hauptaugenmerk gelegt wird, wird insbesondere diese Leitidee thematisiert. Im Zuge dessen wird auf Konzepte für Menschen mit geistiger Behinderung eingegangen, die aus dem Selbstbestimmungs- gedanken hervorgegangen sind.
Gegenstand des vierten Kapitels ist das Wohnen. Es wird zu Beginn auf das Wohnen allgemein eingegangen, dann speziell auf das Leben von Menschen mit geistiger Behinderung in Wohneinrichtungen.
Zunächst wird erläutert, welche Bedeutung eine Wohnung für den Menschen hat und welche Kriterien erfüllt sein sollten, damit Wohnqualität gegeben sein kann. Auch die sozialen Funktionen einer Wohnung werden erläutert.
Anschließend wird darauf eingegangen, wie Menschen mit geistiger Behinderung im Laufe der Geschichte untergebracht waren und gewohnt haben und dies gegenwärtig tun. Auch wird erläutert, welche Notwendigkeiten und Rahmenbedingungen gegeben sein müssen, damit Menschen mit geistiger Behinderung selbst bestimmt leben können. An dieser Stelle wird also der oben beschriebene Soll-Zustand für eine mögliche Selbstbestimmung von Menschen mit geistiger Behinderung beim Wohnen aufgezeigt.
Ab dem fünften Kapitel beginnt die eigene Erhebung dieser Diplomarbeit. In diesem Kapitel werden zunächst die Trägerschaft der beiden Wohnheime, der Internationale Bund, und die beiden Wohnheime vorgestellt, in welchen die Erhebung stattfinden soll. Dabei wird über Zahlen, räumliche und faktische Gegebenheiten, über die Bewohner und über die Mitarbeiter Auskunft gegeben. Diese Fakten aufzuzeigen, ist aus zwei Gründen wichtig: Der Leser soll die Möglichkeit haben, sich ein Bild von den zwei Wohnheimen zu machen. Zum anderen sind die gegebenen Umstände eines Wohnheims die Voraussetzung für ein selbst bestimmtes Leben der Bewohner.
Im sechsten Kapitel werden die einzelnen Interviewpartner anonymisiert vorgestellt, um dem Leser deren Vorgeschichte zu eröffnen. Durch das Wissen über die Vergangenheit eines Menschen können die späteren Antworten auf die Interviewfragen besser nachvollzogen werden.
Im Weiteren werden die Forschungsmethodik, das Vorgehen beim Interview und die Rahmenbedingungen bei diesem geschildert. Auch nach welchen Kriterien und in welchen Schritten die Auswertung der Interviews stattfindet, wird in diesem Kapitel veranschaulicht.
Das siebte Kapitel stellt die Ergebnisse der Interviews mit den Bewohnern dar. Die Ergebnisse werden in verschiedene Themenbereiche unterteilt, in welchen die Aussagen aus den verschiedenen Interviews komprimiert werden. In den Themenbereichen selbst sind erneut kleinere Themenabschnitte untergebracht. Somit hat der Leser zunächst einen Gesamtüberblick und kann letztendlich durch eingebrachte Zitate aus den Interviews bis ins Detail die Aussagen und Ergebnisse verfolgen.
In diesem Kapitel werden darüber hinaus die Fragebögen und deren Ergebnisse vorgestellt. Die eigens entwickelten Fragebögen wurden mit den pädagogischen Fachkräften durchgeführt um auch deren Meinung über die Selbstbestimmung der Bewohner zu ermitteln.
Im achten Kapitel findet eine Reflexion und Interpretation der gesammelten Ergebnisse statt. Hier fließen sowohl die Ergebnisse der Interviews und der Fragebögen mit den pädagogischen Mitarbeitern als auch die gewonnen Informationen über die beiden Wohnheime ein. Das Gesamtbild aus den drei genannten Komponenten lässt eine weitgehende Beurteilung über die Selbstbestimmung der Menschen mit geistiger Behinderung in den zwei Wohnheimen zu. Dabei wird Bezug zu dem in vorherigen Kapiteln erläuterten Soll-Zustand bezüglich der Selbstbestimmung genommen.
Das neunte Kapitel bildet das Fazit der vorliegenden Arbeit.
2 Der Personenkreis der Menschen mit geistiger Behinderung
Der Personenkreis der Menschen mit geistiger Behinderung ist nicht durch wenige Worte zu beschreiben oder zu definieren. Es ist ganz im Gegenteil eine schwierige Aufgabe, dieser Terminologie in jeder Hinsicht gerecht zu werden. Bei genauerer Betrachtung des genannten Personenkreises fällt der Fokus auf vergangene und aktuelle Begrifflichkeiten, auf verschiedene Definitionsansätze und Betrachtungsweisen. Eine alles umfassende Definition oder Beschreibung gibt es nicht. Menschen mit einer geistigen Behinderung müssen grundsätzlich zunächst zu diesen gemacht werden, sei es durch medizinische oder psychologische Gutachten oder durch einen Gesetzestext, der besagt, was es heißt, geistig behindert zu sein.
In Deutschland leben, nach Schätzungen der LEBENSHILFE[1], zur Zeit circa 420.000 Menschen, die – laut Diagnose bzw. Testergebnis - als geistig behindert gelten. Darunter kann man etwa 185.000 Kinder beziehungsweise Jugendliche und 235.000 Erwachsene zählen (vgl. Email der Lebenshilfe 2009: siehe Ende des Literaturverzeichnisses)
Angegebene Zahlen basieren, wie erwähnt, lediglich auf Schätzungen. Auch das Bundesamt für Statistiken konnte auf Nachfrage keine sicheren Zahlen über Menschen mit geistiger Behinderung herausgeben.
Die Unsicherheiten der statistischen Zählung gehen, wie ULRICH BLEIDICK es ausdrückt, mit dem Fehlen eines allgemeingültigen Begriffs von Behinderung einher (vgl. Bleidick 1999, S.15).
Wie die Bezeichnung des „Menschen mit geistiger Behinderung“ entstand und welche Bedeutung der Begriff hat, wird in den folgenden Punkten geklärt.
Darauf folgend werden verschiedene Sichtweisen und Definitionen der geistigen Behinderung genannt und letztendlich wird kurz auf die Geschichte des genannten Personenkreises eingegangen.
2.1 Bezeichnungen
Bis zum Jahr 1958, in welchem die Bundesvereinigung Lebenshilfe die Bezeichnung „geistig behindert“ nachhaltig prägte, hatte es bereits diverse andere Bezeichnungen gegeben (vgl. Mühl 2000, S. 45).
Die Tatsache, dass die bis dahin verwendeten Termini nach HEINZ MÜHL „einen Bedeutungswandel ins Negative erfahren haben“ (ebd.), machte es notwendig, eine allgemein akzeptierte Bezeichnung zu formulieren. Besonders wichtig war es, bei der Findung einer passenden Bezeichnung, dass man sowohl eine Klassifizierung als auch Stigmatisierung der zu beschreibenden Personen vermied.
Somit wurden „Idiot“, „Imbeziller“, „Stumpfsinniger“ und viele andere derartiger Bezeichnungen durch „geistig Behinderter“ ersetzt, welche von der Bundesvereinigung Lebenshilfe vom englischen Terminus „mentally handicapped“ abgeleitet wurde (vgl. ebd.).
Nach einer Mitgliederversammlung der Lebenshilfevereinigung im Jahr 1996 gab es erneut eine Änderung, nach welcher man nicht mehr von „geistig Behinderten“, sondern von „Menschen mit geistiger Behinderung“ sprach (vgl. Genvo 2008, o. S.).
So sollte möglichst verdeutlicht werden, dass „es normal ist, verschieden zu sein und Menschen mit Behinderungen als Subjekte angesprochen werden sollen“ (ebd.), anstatt als eine Gruppe eingestuft zu werden.
Mitglieder des Lebenshilfevereins forderten, dass es durch die Beschreibung des „Andersseins“ und der mentalen Beeinträchtigungen eines Menschen mit Behinderung nicht zu einer Abwertung der gesamten Person kommen solle (vgl. Fornefeld, 2000, S. 45).
Auch sollte eine geistige Behinderung keinesfalls länger als „Krankheit“ bezeichnet werden. Menschen mit geistiger Behinderung sollen dementsprechend auch nicht im Vergleich mit Menschen ohne Behinderung als „kranke Menschen“ beschrieben werden (vgl. Otto Speck 2005, S. 54).
2.2 Der Versuch einer Begriffsklärung
Auch bei der Klärung des Begriffs „Geistige Behinderung“ sind ebenso Unklarheiten und Schwierigkeiten gegeben. Bisher ist es nicht gelungen, eine einheitliche Definition zu finden. OTTO SPECK vertritt die Auffassung, dass es auch nur begrenzt sinnvoll sei, zu einer klaren Definition zu gelangen, da für eine lückenlose Begriffsklärung „ein unendlicher Regress nötig wäre“ (Otto Speck 2005, S. 52). Dies sei der Fall, da man sich bei jeder Definition auf andere Begriffe beziehen müsse, die wiederum zu definieren wären (vgl. ebd.). Es sei weitaus sinnvoller, nur soviel detailliert zu umschreiben, als dass es im Sinne einer hinreichenden Verständigung und auch Unterscheidung genügt. Auch sollte letztendlich entstandenes Ergebnis weder die Sozialsituation noch die pädagogische Förderung des entsprechenden Personenkreises belasten (vgl. Otto Speck 2005, S. 52).
Zahlreiche Personen und Organisationen haben sich darin versucht, eine Bedeutung des Begriffs „Geistige Behinderung“ zu formulieren. Wie später dargestellt wird, ist es auch wichtig, den Begriff in Berücksichtigung auf die jeweilige Perspektive, sei es beispielsweise die psychologische oder die rechtliche, zu formulieren.
HORST SUHRWEIER vertritt die Auffassung: „ Behinderungen entstehen (..) aus einer Diskrepanz zwischen den Anforderungen einer Gesellschaft, unangepassten Erwartun- gen, Benachteiligungen in der Lebensgeschichte und individuell beeinträchtigenden Dispositionen.“ (Suhrweier 1999, S. 24). Er bezieht sich dabei auf HEINZ BACH (1986), der den komplex-dynamischen Behinderungsbegriff entwickelte. Dieser stellt auch die Verhaltenserwartungen der Gesellschaft, die Verhaltensposition und die Verhaltensbedingungen als voneinander abhängig dar.
Die Weltgesundheitsorganisation, die WHO[2], „verfolgt einen sozialpolitischen Auftrag, indem sie mit ihren Richtlinien zur Verbesserung der Lebensumstände und der Lebensqualität von Menschen mit Behinderung in aller Welt beitragen will“. (Fornefeld 2000, S. 47). Die Organisation ist daher seit 1957 bemüht, ein internationales Klassifikationsschema der Behinderung zu erstellen, welches 1980 als „International Classification of Impairments, activities and Participation“ (ICIDH) veröffentlicht wurde (vgl. Schuntermann 1999). Das Schema stellt mit wenigen Schlagworten dar, was Behinderung bedeutet und welche Folgen diese für die Betroffenen haben können. Das Klassifikationsschema ICIDH wurde im Jahr 1999 revidiert und in „International Classification of Impairments, Activities and Participation“ (ICIDH-2) unbenannt. Der folgenden Tabelle sind die Unterschiede der beiden Schemata zu entnehmen. Des Weiteren werden die Begriffe aus dem Englischen übersetzt und deren Bedeutung erklärt bzw. definiert.
Tab.1 Gegenüberstellung der ICIDH und ICIDH-2 (WHO)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Fornefeld 2000, S. 49, Tab.1
Die Tabelle stellt die Begriffe aus der ICIDH und der ICIDH-2 gegenüber. Die ICIDH- 2 hat ihre Abkürzung „ICIDH“ beibehalten, obwohl die Begriffe nicht mehr zu dieser passen.
Die Klassifikation von 1980 legte ihr Hauptaugenmerk auf die verschiedenen Schädigungen, Störungen und Behinderungen, während die 1999 entstandene ICIDH-2 nicht mehr die Defizite eines Menschen, sondern positiv seine Teilhabe am sozialen Leben der Gesellschaft und die Möglichkeiten eines jeden Individuums aufzeigt (vgl. Fornefeld 2000, S. 47 f.). Somit ist zwischen den beiden Modellen eine Einstellungs- änderung zu erkennen. Insbesondere die Rubrik „Kontextfaktoren“ macht den Unterschied zwischen den beiden Klassifikationsmodellen deutlich.
Bei den unterschiedlichen Begriffserklärungen, die zwischen 1980 und in jüngerer Zeit entstanden sind, wird ein internationaler Perspektivenwandel bezüglich des Behinde- rungsbegriffs deutlich. Dabei werden nicht mehr in erster Linie die organischen Schädigungen des Menschen in den Vordergrund gestellt, sondern soziale Gegeben- heiten und Konsequenzen (vgl. Fornefeld 2000, S. 47).
Wie Bleidick es formuliert, sind „ Selbstbestimmung, Chancengleichheit und Teilhabe an allen Lebensbereichen (..) die Ziele, die zweckgerichtet in die Beschreibung menschlichen Behindertseins eingehen sollen.“ (Bleidick 1999, S. 15).
2.3 Definitionen und Ansätze aus verschiedenen Sichtweisen
Definieren bedeutet, „einen begrifflichen Tatbestand auf einfachere Sachverhalte zurückzuführen und ihn von anderen Inhalten abzugrenzen.“ (Bleidick 1999, S. 11).
Wie bereits erwähnt, existiert keine einheitliche Definition, die eine geistige Behinderung insgesamt betrachtend beschreibt.
Die Frage nach einer Definition für den Begriff „Geistige Behinderung“ kann also beispielsweise nicht von Pädagogen oder Psychologen separat beantwortet werden. Die verschiedenen, bisher genannten Definitionsansätze von einzelnen Personen oder Organisationen zeigen dies deutlich. Wie OTTO SPECK es ausdrückt, ist „geistige Behinderung als komplexes Phänomen (..) Gegenstand verschiedener Wissenschaften.“ (Otto Speck 2005, S.53). Folglich hat jede Wissenschaft ihre eigenen Ansätze. Durch die „gegenseitige Kenntnisnahme […]“ der verschiedenen Ansichten, wird letztendlich „so etwas wie ein Gesamtbild […] ermöglicht.“ (ebd.).
BARBABRA FORNEFELD spricht hier von „Interdisziplinarität“ und weist darauf hin, dass die Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung auf den Informations- austausch mit anderen Wissenschaften angewiesen ist (vgl. Fornefeld 2000, S.22). Sie nennt unter anderen als wichtige Wissenschaften die Medizin, die Psychologie, die Pädagogik, die Soziologie und die Rechtswissenschaften (vgl. Fornefeld 2000, S.23).
Bis vor 200 Jahren wurden besonders die Theorien der Mediziner gewichtet, im Laufe der Zeit gewannen aber auch die psychologischen und soziologischen Theorien an Gewichtung. Die pädagogische und juristische Sicht spielen in der heutigen Definition von „geistiger Behinderung“ ebenfalls ein wichtige Rolle (vgl. Otto Speck 2005, S.53).
Eine Definition finden zu wollen, ist aber nicht das einzige Ziel:
Nicht zu vergessen ist die Tatsache, dass nicht nur die Sichtweisen sich unterscheiden, sondern, dass in einem Sozialstaat wie Deutschland, verschiedene Systeme ineinander greifen und von einander abhängig sind. Das bedeutet, dass eine Behinderung zunächst von Ärzten und Psychologen festgestellt und eingestuft werden muss, bevor der Mensch als Mensch mit geistiger und/ oder körperlicher Behinderung gilt. Damit diese Menschen finanzielle Unterstützung erhalten können, sind Gesetze sehr wichtig, in welchen festgelegt wird, wer überhaupt als geistig behindert gilt und welche Ansprüche die Personen mit entsprechenden Behinderungsgraden haben. Rechtliche und sozial rechtliche Bestimmungen bilden somit Rahmenbedingungen für das gesamte System. Für die Mediziner und Psychologen ist die Feststellung der Behinderung der wichtigste Aspekt, während sich die Pädagogen der Erziehung und Bildung der Personen mit geistiger Behinderung widmen.
Es ist folglich nicht nur die Wissenschaft als Disziplin von Bedeutung, sondern auch die Rollenverteilung der Mediziner, Psychologen, Juristen und Pädagogen.
Auf die verschiedenen Definitionen geistiger Behinderung aus der jeweiligen Perspektive der einzelnen Wissenschaften wird im Folgenden eingegangen. Dabei ist zu beachten, dass jede Perspektive einen anderen Aspekt von Behinderung in den Vordergrund rückt.
Oft wird allgemein „Behinderung“ definiert, da die „geistige Behinderung“ in dieser Definition dann mit inbegriffen ist.
2.3.1 Rechtliche und sozial rechtliche Sichtweise
Die rechtliche Sicht definiert wie folgt Menschen mit Behinderung: „Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Sie sind von Behinderung bedroht, wenn die Beeinträchtigung zu erwarten ist“ (§ 2, Absatz 1; SGB IX: Lachwitz, Schellhorn&Welti 2005, S. 64). Hier ist zu erkennen, dass nicht nur geistige Behinderungen, sondern auch körperliche Beein- trächtigungen bei der Definition mit einbezogen werden.
Wie BARBARA FORNEFELD hervorhebt, widmen sich die Rechtswissenschaften der gesetzlichen und rechtlichen Situation der Menschen mit geistiger Behinderung (vgl. Fornefeld 2000, S. 24). Vor allem Gesetze, Rechte und Pflichten zum Schutz und zur Fürsorge von Menschen mit Behinderungen werden dabei berücksichtigt (vgl. ebd.). Aus diesem Grund ist ein klares Verständnis über den Begriff der Behinderung sehr wichtig (vgl. Schuntermann 1999, o.S.). Es wird auch folgende rechtliche Übereinkunft angewandt: "Behindert ist eine Person, deren Teilhabe am Gesellschaftsleben, insbeson- dere am Arbeitsleben, infolge ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung aufgehoben oder nicht nur vorübergehend eingeschränkt ist.“ (ebd.).
Nur durch festgelegte juristische Definitionen kann den Menschen mit geistiger und/ oder körperlicher Behinderung ein menschenwürdiges Leben mit gleichen gesetzlichen Voraussetzungen „für die freie Entfaltung der Persönlichkeit“ (ebd.) zugesichert werden. Auch der Erwerb des Lebensunterhalts durch eine möglichst frei gewählte Tätigkeit und die Abwendung oder der Ausgleich von besonderen Belastungen, so hebt MICHAEL SCHUNTERMANN hervor, ist gesetzlich vorgeschrieben. Personen mit Behinderungen sind außerdem gegen Diskriminierung geschützt. Letztendlich sei sicherzustellen, dass die sozialen Rechte auch weitgehend verwirklicht werden (vgl. ebd.).
Nach dem deutschen Gesetz ist eine Person, die von einer Behinderung bedroht ist, mit einem Behinderten auf rechtlicher Ebene gleichgestellt. Diese Personen stehen unter dem Schutz der gleichen Rechte (§ 10 SGB I).
Noch anzumerken ist, dass juristisch gesehen die Ursachen einer Krankheit nicht von Bedeutung sind (vgl. Dommermuth 2004, S. 29).
Die Ursachen einer geistigen Behinderung sind Gegenstand der medizinischen Sicht, die hier nachfolgend veranschaulicht wird.
2.3.2 Medizinische Sichtweise
Die medizinische Sicht befasst sich generell mit den Ursachen und der Entstehungs- geschichte einer Behinderung und bezieht sich auf Erkrankungen und Störungen des Organismus. Diese Erkrankungen gehen mit psychischen Äußerungsformen einher (vgl. Suhrweier 1999, S. 22).
Prinzipiell ist zu sagen, dass eine geistige Behinderung grundsätzlich eine organische Basis hat (vgl. Fornefeld 2000, S. 51).
Maßgeblich für die Entstehung einer geistigen Behinderung sind hirnorganische Schädigungen, Fehlbildungen oder Fehlfunktionen (vgl. Mühl 2000, S. 57). Auch OTTO SPECK hebt bei der Erläuterung der medizinischen Perspektive die zentrale Bedeutung der Gehirnschädigung hervor (vgl. Speck 2005, S. 53).
Laut GERHARD NEUHÄUSER und HANS-CHRISTOPH STEINHAUSEN gibt es eine Vielzahl an Ursachen für die Entstehung einer geistigen Behinderung. Bei der Benennung der Behinderungen ist die Rede von klinischen Syndromen, welche eine Kombination bestimmter Symptome bezeichnen (vgl. Neuhäuser 2003, S. 110).
Die klinischen Syndrome werden in erster Linie nach dem Zeitpunkt der Entstehung eingeteilt. Hierbei wird unterschieden zwischen pränatalen (vor der Geburt entstand- enen), perinatalen (während der Geburt entstandenen) und postnatalen (nach der Geburt entstandenen) Ursachen der geistigen Behinderung (vgl. ebd., S.18 f.).
Im Folgenden werden die Ursachen für die klinischen Syndrome aufgeführt:
2.3.2.1 Pränatale Ursachen
- Fehlentwicklungen des Nervensystems: Fehlbildungen und Entwicklungs- störungen (vgl. Neuhäuser 2003, S.114 ff.).
- Genmutationen: Änderung von Genen durch Mutation infolge von Strah- leneinwirkungen oder Chemikalien (→ Veränderung der Entwicklungs- abläufe: z.B. Stoffwechselstörungen) (vgl. Neuhäuser 2003, S. 115 ff.).
- Fehlbildungs-Retardierungssyndrom: monogen und multifaktoriell bedingte Störung → Kombination von körperlichen Syndromen (vgl. Neuhäuser 2003, S. 143 ff.).
- Chromosomenanomalien: Trisomien/Deletionen/Translokationen/Gonosomale Aberrationen (vgl. Neuhäuser 2003, S. 174 ff.).
- Exogen verursachte pränatale Entwicklungsstörungen: durch Infektionen der Mutter (z.B.Virus), durch chemische Einwirkungen (z.B. Alkohol/ Medikamente)/Strahlen/.Umweltbelastungen auf die Mutter (vgl. Neuhäuser 2003, S.191 ff.).
- Idiopathische geistige Behinderung: zerebrale Funktionsstörungen (eventuell durch Mikrodeletionen/ Strukturveränderungen), keine körperlichen Symptome (vgl. Neuhäuser 2003, S. 199 ff.).
2.3.2.2 Perinatale Ursachen
- Geburtstrauma: durch starke Verformung des Kopfes → Verletzungen des Gehirns und der Häute (vgl. Neuhäuser 2003, S. 201).
- Sauerstoffmangel: durch Kompression der Nabelschnur, unzureichende Atmung → Zerstörung von Nervenzellen/ Hirnabschnitten (vgl. Neuhäuser 2003, S. 202).
- Frühgeburt → unreife Organentwicklung (vgl. Neuhäuser 2003, S. 202 f.).
- Erkrankungen des Neugeborenen: Infektionen mit verschiedenen Erregern (Viren/ Bakterien) → z. B. neugeburtliche Hirnhautentzündung (neonatele Meningitis) (vgl. Neuhäuser 2003, S. 203 f.).
2.3.2.3 Postnatale Ursachen
- Entzündliche Erkrankungen des Zentralnervensystems → Hirnhautent- zündung (Meningitis) (vgl. Neuhäuser 2003, S. 205).
- Schädel-Hirn-Trauma: durch Unfälle oder Gewalteinwirkungen auf den Schädel → Hirnverletzungen, Läsionen im Bereich des Hirnstamms (vgl. Neuhäuser 2003, S. 205 f.).
- Hirntumore (vgl. Neuhäuser 2003, S. 206).
- Hirnschädigungen durch Vergiftungen (Intoxikation), Sauerstoffmangel (Hypoxie) und Stoffwechselkrisen → Gefahr einer bleibenden Hirn- schädigung (vgl. ebd.).
Auf die Benennung der einzelnen klinischen Syndrome wird aufgrund der großen vorhandenen Anzahl verzichtet.
Laut GERHARD NEUHÄUSER wird heutzutage die Verwendung der Bezeichnungen „endogener“ (innerer) und „exogener“ (äußerer) Faktoren als Ursache für eine Behinderung möglichst vermieden.
Die Aufgabe der Mediziner ist die Aufklärung der Entstehungsgeschichte einer geistigen Behinderung, die Ursachenforschung und letztendlich die Entwicklung therapeutischer Maßnahmen (Fornefeld 2000, S. 51).
Wird eine Behinderung frühzeitig erkannt, kann den voraussichtlichen Folgen teilweise, häufig sogar mit entscheidend positiver Auswirkung entgegengewirkt werden (ebd.).
Was eine geistige Behinderung aus pädagogischer Sicht bedeutet, wird im nächsten Punkt erläutert.
2.3.3 Pädagogische Sichtweise
ULRICH BLEIDICK formulierte eine Definition der Behinderung, die oft in der Pädagogik Verwendung findet: „Als behindert gelten Personen, die infolge einer Schädigung ihrer körperlichen, seelischen oder geistigen Funktionen soweit beein- trächtigt sind, dass ihre unmittelbaren Lebensverrichtungen oder ihre Teilnahme am Leben der Gesellschaft erschwert werden“ (Bleidick 1999, S. 15).
Er hebt bei seiner Definition vier Kriterien hervor:
1. „Die Definition beansprucht nur einen eingeschränkten Geltungsrahmen.
2. Behinderung wird als Folge einer organischen oder funktionellen Schädigung angesehen.
3. Behinderung hat eine individuelle Seite, die die unmittelbare Lebenswelt betrifft.
4. Behinderung ist eine soziale Dimension der Teilhabe am Leben der Gesellschaft.“ (Bleidick 1999, S. 15)
An diesen Kriterien verdeutlicht ULRICH BLEIDICK, dass Behinderung keine feststehende Eigenschaft eines Menschen ist, sondern von den Lebensumständen des Einzelnen und seinen sozialen Bezügen abhängt (vgl. ebd.).
Von großer Bedeutung in der Pädagogik ist auch die Auswirkung einer geistigen Behinderung auf die Bildung und Erziehung der Person (vgl. Bleidick 1999, S. 95). Menschen mit geistiger Behinderung unterscheiden sich in ihren Lernmöglichkeiten und haben auch unterschiedliche Lernbedürfnisse (vgl. Fornefeld 2000, S.67). Des Weiteren ist je nach Lern- und Entwicklungsstörung der Person ein individueller Erziehungs- bedarf notwendig. Der Erziehungsbedarf ergibt sich neben den individuellen Beein- trächtigungen und der Lebenssituation der Person zusätzlich aus den Erziehungs- erwartungen und den Erziehungsnormen der Gesellschaft.
Auch HORST SUHRWEIER hebt bei seiner Fassung des pädagogischen Zugangs die „Störung der Erzieh- und Bildbarkeit“ (Suhrweier 1999, S. 23) hervor.
Die Aufgaben der Pädagogen bestehen in der Unterstützung, der Begleitung, der Erziehung und der Bildung von Menschen mit geistiger Behinderung.
Im Folgenden wird die soziologische Sicht beschrieben.
2.3.4 Soziologische Sichtweise
Die Soziologie betrachtet die Wechselwirkungen zwischen einer Person mit einer geistigen Behinderung und der Gesellschaft. Dabei spielt die gesellschaftliche Einstellung gegenüber diesen Personen eine wichtige Rolle (Fornefeld 2000, S. 24). Die soziologische Sicht ist also grundsätzlich abhängig von der gesellschaftlichen Einstellung.
Die Behinderung einer Person ist nach soziologischer Auffassung nicht die an ihr fest gemachte Eigenschaft, sondern eine soziale Kategorie in der Interaktion mit der Gesellschaft. Wie ULRICH BLEIDICK es ausdrückt, wandelt sich eine Person nicht zum Behinderten, sondern die Gesellschaft definiert seine Beziehung zu dieser neu (vgl. Bleidick 1999, S. 33).
OTTO SPECK hebt die Sozialabhängigkeit von Intelligenzentwicklung hervor und geht auf die „primäre soziale Kausalität für die Entstehung einer geistigen Behinderung“ (Speck 2005, S. 60) ein. Demnach könne durch schwere soziale Deprivationen (soziale Ausgrenzungen ) die neuronale Entwicklung erheblich behindert werden und aus diesem Grund zurück bleiben.
Das soziale Milieu eines Menschen beeinflusst dessen Entwicklung. Somit weist OTTO SPECK auf verschiedene Untersuchungen[3] hin, die verdeutlichen, dass Kinder mit geistiger Behinderung vermehrt in Familien der unteren sozialen Schicht vertreten sind. Soziale Komponenten sind also von hoher Bedeutung für das Zustandekommen einer geistigen Behinderung (vgl. ebd., S. 60 ff. ).
Die soziale Situation prägt das Bild einer Behinderung. OTTO SPECK formuliert als wichtige Bestandteile dieser Situation: „das System und die Qualität sozialer Hilfen, die Einstellungen der Umwelt, die familiäre Situation.“ (Speck 2005, S. 64).
Der Soziologe betrachtet also das Gesamtbild eines Menschen mit Behinderung in seiner Umgebung und in einem sozialen Gefüge. Die Umgebung des Menschen kann somit zum einen mitverantwortlich für seine Behinderung sein und zum anderen wird der Mensch durch die Einstellung seiner sozialen Umgebung zu dem gemacht, was sie in ihm sehen.
Nach dem sozialen Modell von Behinderung entsteht sie maßgeblich durch gesellschaft- liche Barrieren.
Aus psychologischer Sicht werden andere Kriterien betrachtet, die im weiteren vorgestellt werden.
2.3.5 Psychologische Sichtweise
Die American Association on Mental Deficieny (AAMD), hat in den USA im Jahr 1983 folgende Definition für eine geistige Behinderung festgelegt: „Geistige Retardierung bezieht sich auf signifikant unterdurchschnittliche allgemeine Intelligenzfunktionen, die zu gleichzeitigen Beeinträchtigungen des Anpassungsverhaltens führen oder mit diesen assoziiert sind und während der Entwicklungsperiode andauern.“ (Patton u. a., 1990, S. 48, zit. nach Speck 2005, S. 57).
Für die Diagnose einer geistigen Behinderung müssen in der Psychologie drei Kriterien erfüllt sein:
1. Zum einen muss eine unterdurchschnittliche intellektuelle Leistungsfähigkeit vorliegen. Der IQ (Intelligenzquotient) liegt unter 70.
2. Gleichzeitig sollten Defizite im adaptiven Verhalten (Anpassungsfähigkeit) vorzufinden sein.
3. Letztendlich muss der Beginn jeglicher Störungen vor der Vollendung des 18. Lebensjahres liegen (vgl. Zimbardo 2004, S. 408).
Demzufolge ist aus psychologischer Sicht für eine geistige Behinderung nicht nur eine geminderte Intelligenz, sondern auch eine Störung des adaptiven Verhaltens von Bedeutung (vgl. Speck 2005, S. 57).
2.3.5.1 Adaptives Verhalten
Adaptives Verhalten bedeutet, dass ein Mensch lernt, sich an die Umwelt anzupassen. Dabei muss ein heranwachsender Mensch unterstützt werden. Wird der Mensch nicht genügend gefördert, spricht man von sozialer Deprivation, wie es bereits in der soziologischen Sicht erwähnt wurde (vgl. ebd.).
Die Anforderungen an das adaptive Verhalten werden von OTTO SPECK nach Lebensalter und kulturellen Erwartungen unterteilt. Es wird also unter normalen Umständen erwartet, dass sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene in folgenden genannten Abschnitten das aufgeführte adaptive Verhalten aneignen:
„Im Frühkindheits- und Vorschulalter:
1. Sensomotorische Fertigkeiten
2. Kommunikative Fertigkeiten (einschl. Sprechen und Sprache)
3. Fertigkeiten der Selbstversorgung und
4. Sozialverhalten (Interaktion mit anderen) In der Schul- und frühen Jugendzeit:
5. Anwendung grundlegender Kulturtechniken im Alltag,
6. Anwendung angemessener Begründungen und urteile in der Bewältigung der Umwelt,
7. Sozialfertigkeiten (Teilnahme an Gruppenfertigkeiten und interpersonale Beziehungen) Für Heranwachsende und Erwachsene:
8. Berufliche und soziale Verantwortlichkeiten und Leistungen (vgl. Speck 2005, S. 57 ff.).
Für die Einstufung einer geistigen Behinderung muss des Weiteren die Intelligenz der Person ermittelt werden.
2.3.5.2 Intelligenzdiagnostik
Die Intelligenzdiagnostik wurde Anfang des 20. Jahrhunderts durch WILLIAM STERN, ALFRED BINET und DAVID WECHSLER eingeführt. Ziel war die objektive Erfassung menschlicher Intelligenz. (Fornefeld 2000, S. 58).
Die Ergebnisse werden durch einen Intelligenzquotienten (IQ) angegeben, der wie folgt berechnet wurde:
IQ = Intelligenzalter/ Lebensalter x 100 (vgl. Suhrweier 1999, S. 31).
Heute wird der IQ eines Menschen nicht mehr durch diese Rechnung, sondern durch das Verhältnis der individuellen Intelligenzleistung zum Mittelwert der entsprechenden Altersgruppe ermittelt (vgl. Borchert & Dupuis 1992, S. 322). Wird also ein Intelligenztest gemacht, werden die erreichten Punkte zusammengezählt und direkt mit der Gesamtpunktzahl anderer Gleichaltriger verglichen (vgl. Zimbardo 2004, S. 407). Der Begriff des IQ ist trotz der neuen Verfahrensweise erhalten geblieben.
Der Quotient ermittelt also die Abweichung von den Erwartungswerten der entsprechenden Aufgabenerfüllung und gibt die relative Stellung der Leistung einer zu testenden Person im Vergleich zu den Leistungen seiner Altersgruppe an (vgl. Suhrweier 1999, S.31.).
Eine Person ist durchschnittlich intelligent, wenn ihr IQ bei 100 Punkten liegt.
Eine Person wird dann als Mensch mit geistiger Behinderung eingestuft, wenn ihr IQ unter 70 liegt (vgl. Fornefeld 2000, S. 58). Circa 95 Prozent aller Menschen liegen mit ihrem IQ- Wert zwischen 70 und 130. Von dieser Menge haben 68 Prozent einen IQ zwischen 85 und 115. Werte, die unter 85 oder über 115 liegen zeigen entweder eine unter- oder überdurchschnittliche Intelligenz. Menschen mit einer geistigen Behinderung haben einen geringeren IQ als 70 und machen damit ca. zwei Prozent der Bevölkerung aus (vgl. ebd.).
Folgende Tabelle zeigt die Einstufungskriterien für die Grade einer Behinderung, die die AAMD von ALFRED BINET und DAVID WECHSLER übernommen hat. Der Grad einer Behinderung fängt bei „leicht“ an und hört bei „schwerst“ auf. Die IQ-Werte sind dementsprechend zugeordnet.
Tab.2 AAMD-Klassifikation nach IQ-Werten
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Speck 2005, S. 59, Tab. 2
Zum besseren Verständnis der Standardabweichung sei gesagt, dass ein IQ zwischen 85 und 115 eine Abweichung von -1 bis +1 und ein IQ zwischen 70 und 130 eine Standardabweichung von -2 bis +2 ausmacht. Somit ergeben sich die in der Tabelle dargestellten Abweichungen. Eine geistige Behinderung liegt also dann vor, wenn eine Person mit „2 X 15 IQ-Werten (= 2 Standardabweichungen) mit diesem Mittelwert abweicht.“ (Fornefeld, 2000, S. 58).
Nach einigen folgenden Erläuterungen wird eine Klassifikationstabelle der WHO (ICD= „International Classification of Diseases“) eingebracht, um noch eine weitere Ansicht aufzuzeigen. Diese Klassifikation ist international am weitesten verbreitet. Nach der „Internationalen Klassifikation psychischer Störungen“ aus dem Jahr 2000 wird eine geistige Behinderung ebenfalls als Intelligenzminderung bezeichnet (vgl. Speck 2005, S. 56).
Von „Psychischen Störungen“ ist in Zusammenhang mit der Klassifikationstabelle zur geistigen Behinderung die Rede, da zu einer geistigen Behinderung in den meisten Fällen auch Verhaltensstörungen, also psychische Störungen, hinzukommen. Somit weisen Personen mit einer geminderten Intelligenz drei- bis viermal so häufig zusätzliche Störungen auf wie die Gesamtbevölkerung (vgl. ebd.).
Diese Störungen entstehen durch Wahrnehmungs- und Kommunikationsbeeinträch- tigungen, die durch eine Behinderung hervorgerufen werden. Genannte Beeinträch- tigungen erhöhen das Risiko einer psychiatrischen Störung (vgl. Fornefeld 2000, S. 54 f.). Zu diesen Störungen zählen der Autismus, Psychosen (psychische Desintegration mit emotionalen Störungen), Hyperaktivität und Aufmerksamkeits- störungen. Des Weiteren kann eine psychiatrische Störung in Form einer Stereotypie (wiederkehrende gleichförmige Aufeinanderfolge von Körperbewegungen) oder einer Automutilation (Autoaggression: Handlungen gegen den eigenen Körper mit Folge von Verletzungen) auftreten. Auch das Einnässen (Enuresis), Einkoten (Enkopresis) oder Essstörungen können als psychiatrische Störungen in Folge einer Behinderung auftreten (vgl. ebd.).
Die unten dargestellte Klassifikationstabelle lässt deutlich werden, dass die WHO den Zusammenhang zwischen dem IQ einer Person und dem Schweregrad ihrer Behinderung ähnlich darstellt und ähnliche Zahlen verwendet wie die AAMD bzw. DAVID WECHSLER und ALFRED BINET.
Auch wenn bei der Entwicklung der Intelligenz soziale und kulturelle Bedingungen von Bedeutung sind (vgl. Spreen 1978, S. 18), gilt laut OTTO SPECK trotzdem eine Konstanz des IQ über die verschiedenen Entwicklungsstufen hinweg als erwiesen (vgl. Speck, S. 57).
Tab.3 Internationale Klassifikation psychischer Störungen (WHO 2000)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Quelle: Speck 2005, S. 56, Tab. 1)
In der eben dargestellten Tabelle erscheint der Begriff „Oligophrenie“ (Schwachsinn): „Als solche gilt eine sich in der Entwicklung manifestierende, stehen gebliebene oder unvollständige Entwicklung der geistigen Fähigkeiten.“ (Speck 2005, S. 254).
Zusätzlich hat BARBARA FORNEFELD in einer modifizierten Tabelle den jeweiligen Anteil der Menschen mit verschiedenen Intelligenzminderungen in Prozent dargestellt. Somit haben 80 Prozent eine leichte, 12 Prozent eine mittelgradige, sieben Prozent eine schwere und ein Prozent eine schwerste geistige Behinderung (vgl. Fornefeld 2000, Tab. 2 S. 58).
Wenn Intelligenz ermittelt werden soll, kann, wie DAVID WECHSLER es ausdrückt, nicht nur von einer Gesamtintelligenz die Rede sein. In dem von ihm entwickelten Test ermöglichte er neben der Ermittlung der Gesamtintelligenz die Ermittlung des Verbal- IQs und des Handlungs-IQs durch Untertests (vgl. Zimbardo 2004, S. 409). Die Tests werden dabei dem Alter der Personen angepasst. Sämtliche Tests wurden bereits mehrfach verändert und verbessert.
Oft ist auch von multiplen Intelligenzen die Rede. So hebt OTTO SPECK die Theorie HOWARD GARDNERS hervor, der von acht getrennten Intelligenzen ausgeht (vgl. Speck 2005, S. 60). Letzterer nennt die linguistische, die naturalistische, die musikalische, die logisch-mathematische, die räumliche, die körperlich-kinästhetische, die intrapersonale und letztendlich die interpersonale Intelligenz (Zimbardo 2004, S. 416 f.). Auch gibt es laut ihm die emotionale Intelligenz, die mit der intra- und interpersonalen Intelligenz verwandt ist (vgl. ebd.). Personen, die in einem Bereich dieser multiplen Intelligenzen schlecht abschneiden, können trotzdem in einem anderen Bereich besonders gut sein (vgl. Speck 2005, S. 60).
Die Intelligenzmessung hat sich im Lauf der Geschichte oft verändert und es gibt verschiedene Vorgehensweisen.
Kritik an der Intelligenzdiagnostik
Es wird zunehmend Kritik an der Intelligenzdiagnostik geäußert. Der Vergleich der Intelligenz eines Menschen mit geistiger Behinderung mit der Durchschnittsintelligenz ist nach der Meinung von BARBARA FORNEFELD nicht tragbar, da sich der Mensch nach individuellen und ihm gegebenen Möglichkeiten entwickelt. Kinder mit einer geistigen Behinderung haben demnach andere Start- und Entwicklungsmöglichkeiten als Kinder ohne Behinderung. Auch der Kontext des kulturellen und sozialen Umfeldes ist, wie erwähnt, bei der Entwicklung und somit auch bei der Intelligenzentwicklung wichtig (vgl. Fornefeld 2000, S. 59).
2.3.6 Verschiedene Sichtweisen – Schlussbetrachtung
Wie durch aktuelle Diskussionen deutlich wird, ist die Beschreibung und das Definieren einer geistigen Behinderung oder der Menschen mit geistiger Behinderung weitaus schwieriger als es im üblichen Umgang mit ihnen oft erscheint. Man muss diese Thematik aus den verschieden dargestellten Sichtweisen betrachten. Eine einheitliche, alle Sichtweisen umfassende Definition der „Geistigen Behinderung“ ist nicht so einfach möglich.
Wie bereits in Punkt 2.3 (Definitionen und Ansätze aus verschiedenen Sichtweisen) der Ansatz von OTTO SPECK hervorgehoben hat, wird nur durch die „gegenseitige Kenntnisnahme […]“ der verschiedenen Ansichten, (..) letztendlich „so etwas wie ein Gesamtbild […] ermöglicht.“ (Otto Speck 2005, S.53).
2.4 Einstellungswandel gegenüber Menschen mit geistiger Behinderung
Da im nächsten Kapitel die aktuellen Leitideen der Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung vorgestellt werden, soll – noch in engem Zusammenhang stehend mit dem vorliegenden Kapitel – ein Exkurs in die Vergangenheit der Geschichte von Menschen mit geistiger Behinderung stattfinden.
Denn um zu verstehen, wie die aktuellen Leitideen entstanden sind, muss ein Blick auf frühere Gegebenheiten geworfen werden. Welche Ideologien waren bezüglich Menschen mit geistiger Behinderung in der Gesellschaft vertreten und wie wurden die Menschen dementsprechend behandelt? Im Folgenden wird hierzu ein Einblick gegeben.
Wie Menschen mit geistiger Behinderung gesehen und behandelt wurden, war im Verlauf der Geschichte abhängig vom „jeweiligen Menschen achtenden oder verachtenden Zeitgeist, von sozialökonomischen und gesellschaftspolitischen Bedingungen, von staatlichen Machtstrukturen [...] und von Staats- und Gesellschaftsideologien (…).“ (Fornefeld 2000, S. 26).
Wichtig zu erwähnen ist auch, dass frühere Sichtweisen und Einstellungen bis in die heutige Zeit prägend für das Verständnis von geistiger Behinderung sind (vgl. ebd.).
WALTER THIMM hat in folgender Tabelle die Modelle von EMIL E. KOBI und FRANK J. MENOLASCINO aus dem Jahr 1977 dargestellt. Diese zeigen auf, als was der Mensch mit geistiger Behinderung im Lauf der Zeit gesehen wurde.
Tab. 4 Historische Modelle der Behindertenhilfe
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Kobi 1977 und Menolascino 1977 zit. n. Thimm 1994, S.12
Wie WALTHER THIMM betont, haben sich die einzelnen Modelle nicht im historischen Verlauf gegenseitig vollkommen abgelöst. Seiner Meinung nach bestehen bis in die heutige Zeit Restvorstellungen aller Modelle sowohl im laienhaften als auch im professionellen Umgang mit Menschen mit geistiger Behinderung (vgl. ebd.).
Der nächste Punkt soll verdeutlichen, welches Verhalten aus den jeweiligen Vorstellungen der Gesellschaft – beginnend bei dem Anfang der Menschheitsgeschichte – resultierte:
2.5 Verhalten der Bevölkerung im Laufe der Geschichte
Anfang der Menschheitsgeschichte
Wie kranke oder behinderte Menschen in den Anfängen der Menschheitsgeschichte behandelt wurden, weiß man nicht genau. Es wird aber angenommen, dass wenig Rücksicht auf diese genommen und kaum Unterstützung geleistet wurde.
Stein- und Bronzezeit
Auch wenn in der jüngeren Stein- und Bronzezeit durch das Sesshaftwerden der Menschen eine Betreuung von Menschen mit geistiger Behinderung an sich möglich wurde, wird davon ausgegangen, dass eine Zuwendung diesen gegenüber nicht bestand.
Damals hing der Umgang mit dem Personenkreis der Menschen mit geistiger Behinderung „von den magischen, mythologischen und normativen Vorstellungen der jeweiligen Gruppe oder Gesellschaft ab.“ (Mühl 1999, S. 9 zit. n. Fornefeld 2000, S. 28). Als Ursache für die Behinderungen der Menschen wurden Dämonen verantwortlich gemacht oder man sah sie als Strafe Gottes. Menschen mit geistiger Behinderung wurden in der Regel ausgegrenzt. Die Gesellschaft sprach ihnen kein Recht auf ein normales Leben zu und ihre Menschenwürde wurde ihnen aberkannt. Verstoßung oder Tötung waren die Folge (vgl. ebd.).
Mittelalter
Auch im Mittelalter wurde aufgrund des Mangels an medizinischem Wissen die Behinderung eines Menschen als magisch und durch den Teufel verursacht gesehen (vgl. Bundesminister für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit 1990, S. 11). Von Werken des Teufels, also vor Behinderungen, hielten sich die Menschen fern. Insbesondere Schwangere sollten sich vor dem Anblick von Menschen mit Behinderungen schützen, damit sie keine Kinder mit Behinderungen auf die Welt brachten (vgl. ebd.).
Von der Neuzeit bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts
In dieser Zeit hat sich die gesellschaftliche Einstellung bis auf wenige Ausnahmen kaum geändert. Menschen mit geistiger Behinderung waren in Armenhäusern, Irrenanstalten oder anderen abgeschiedenen Orten untergebracht. Sie wurden dort unter unmenschlichen Bedingungen verwahrt und von der Öffentlichkeit abgeschirmt. Die Gesellschaft sollte vor deren Anblick geschützt werden. Ziel war weder ihr Schutz noch ihre Förderung (vgl. Fornefeld 2000, S. 28 ff.).
Vom 19. Jahrhundert bis zum Anfang des 20. Jahrhundert
Der Schutz der Menschen mit geistiger Behinderung, ihr Recht auf Bildung und der Zuspruch ihrer Menschenwürde wurden erst im 19. Jahrhundert zum Thema.
Die Menschen sollten zunächst aus ihren menschenunwürdigen Verwahrungsorten befreit und stattdessen ordentlich versorgt und gepflegt werden. Dies geschah in der Regel in privat initiierten Anstalten (vgl. ebd.). Besonderes Interesse galt nun auch der Erziehung und Förderung von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung. Somit entstanden Bildungs- als auch Heil- und Pflegeanstalten (vgl. Mühl 2000, S. 17 f.).
BARBARA FORNEFELD hebt hervor, dass es in dieser Zeit für die Zuwendung gegenüber Menschen mit geistiger Behinderung drei Gründe gab. Diese sei aus „medizinischem, pädagogisch-sozialem oder religiös-karitativem Interesse“ (Fornefeld 2000, S. 32) entstanden. Zudem habe ein optimistisch - aufklärerischer Zeitgeist geherrscht (vgl. ebd.).
In den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts wurden die ersten Hilfsschulen gegründet, deren Anzahl sich bis Anfang des 20. Jahrhunderts stark erhöhte. Das System und die Organisation dieser Schulen veränderte sich ständig, da man versuchte, sowohl den Kindern und Jugendlichen mit leichter als auch denen mit schwerer geistiger Behinderung eine bestmögliche Förderung zu gewährleisten (vgl. Mühl 2000, S. 22).
Zweiter Weltkrieg: Nationalsozialismus
Ein wichtiges Kapitel in Bezug auf Menschen mit geistiger Behinderung und deren Behandlung ist die Ära der Nationalsozialisten. Wie HEINZ MÜHL es passend ausdrückt, herrschte eine „Ideologie und Praxis der Diskriminierung“ (Mühl 2000, S. 23). Er spricht außerdem von einer „Vernichtung lebensunwerten Lebens“ (ebd.), wobei hier ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass damit nicht seine eigene Meinung, sondern die der Nationalsozialisten dargestellt wird. Menschen mit geistiger Behinderung waren es also nach deren Meinung nicht wert, zu leben. Auch die Einstellung der damaligen Gesellschaft wurde über Jahre hinweg, bereits vor Beginn des zweiten Weltkrieges, vorbereitet.
Menschen mit geistiger Behinderung wurden als „unheilbar Blödsinnige“ und daher als „Ballastexistenzen“ gesehen (vgl. Mühl 2000, S. 23). Es erfolgten darüber hinaus oft eine Einstufung dieser als schul- und bildungsunfähig und eine Aberkennung der bürgerlichen Rechte. Eine Folge war der Ausschluss vom Schulunterricht. Im Weiteren ordnete man Zwangssterilisationen für die damals als „Schwachsinnige“ bezeichneten Menschen an. Letztendlich wurden sowohl Neugeborene, als auch Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit geistiger Behinderung umgebracht (vgl. ebd.).
Diese Tötungen liefen unter dem Deckmantel des „Gnadentods“ (Euthanasie) für „unheilbar Kranke“. (vgl. Hähner 2006 a, S. 25).
Die Geschehnisse aus der Zeit während des zweiten Weltkrieges führten zu nachhaltigen Vorurteilen gegenüber Menschen mit geistiger Behinderung in der Bevölkerung (vgl. Fornefeld 2000, S. 40).
1945 bis zur Zeit der Normalisierung und Selbstbestimmung
Die folgende Tabelle von ULRICH HÄHNER stellt weitere Entwicklungen bezüglich Menschen mit geistiger Behinderung nach dem zweiten Weltkrieg dar.
Tab.5 Von der Verwahrung über die Förderung zur Selbstbestimmung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Hähner 2006 a, S. 45
Deutlich wird, dass sich nach 1945 bis heute die Einstellung bezüglich der Menschen mit geistiger Behinderung und das Leitbild bezüglich dieser noch oft verändert haben. Im direkten Anschluss an den Krieg bis teils in die 70ger Jahre wurden sie noch als Kranke eingestuft und die Hauptaufgabe wurde in der Pflege und der Verwahrung gesehen. Unbedingt bezüglich dieses Zeitabschnittes zu erwähnen ist auch die Entstehung der Bundesvereinigung Lebenshilfe, die von Elternverbänden zunächst für Kinder mit geistigen Behinderungen im Jahr 1958 gegründet wurde. Es folgte eine Erweiterung für Jugendliche und Erwachsene (vgl. Bundesvereinigung Lebenshilfe 2008 a, o. S.). Die Gründung und das Wirken der Lebenshilfe werden hervorgehoben, da diese bis heute viele positive Veränderungen für Menschen mit geistiger Behinderung bewirkt hat.
In den 60gern kam bereits die Forderung auf, dass Menschen mit geistiger Behinderung gefördert und therapiert werden sollen. Aus diesem Grund begann Mitte der 70ger Jahre die so genannte Entpsychiatrisierung, in deren Folge Menschen mit geistiger Behinderung aus psychiatrischen Krankenhäusern in Sondereinrichtungen verlegt wurden (vgl. Hähner 2006 a, S. 27). Die Lebenshilfe nennt diesen Vorgang „Enthospitalisierung“ und sieht die 70ger Jahre als das Jahrzehnt, in der das Konzept „Rehabilitation statt Verwahrung“ (Bundesvereinigung Lebenshilfe 2008 b, o. S.) größte Beachtung findet. Auf dieser Grundlage wurde damals in den westlichen Bundesländern die Schulpflicht für Kinder mit geistiger Behinderung gesetzlich verankert (vgl. Fornefeld 2000, S. 42).
Seit den 80ger Jahren steht die Normalisierung im Vordergrund. Aus diesem Leitbild entwickelte sich besonders in den 90ger Jahren die Forderung nach Selbstbestimmung für Menschen mit geistiger Behinderung.
Aufschluss über die Leitbilder der Normalisierung, der Selbstbestimmung und der Inklusion soll das nächste Kapitel geben.
2.6 Zusammenfassung
Der Gegenstand des Kapitels ist die Darstellung des Personenkreises der Menschen mit geistiger Behinderung. Es werden vergangene und aktuelle Begrifflichkeiten und Bezeichnungen genannt und des Weiteren die Definitionen und Sichtweisen einzelner Wissenschaften dargelegt. Auch die Geschichte der Menschen mit geistiger Behinderung und der Einstellungswandel ihnen gegenüber in der Gesellschaft wird verdeutlicht.
Nachdem zuvor Bezeichnungen für Menschen mit geistiger Behinderung geläufig waren, die inzwischen als abwertend und beleidigend gelten, wurde im Jahr 1996 nach dem zuvor verwendeten Terminus des „geistig Behinderten“ die Bezeichnung „Menschen mit geistiger Behinderung“ eingeführt, die bis heute verwendet wird.
Bis heute existiert jedoch keine einheitliche Definition darüber, was es bedeutet, wenn von einem „Menschen mit geistiger Behinderung“ die Rede ist. Es kann nur aus jeder einzelnen Perspektive ein Ansatz oder eine Definition genannt werden.
Aus rechtlicher Sicht ist ein Mensch behindert, wenn seine geistige, körperliche oder seelische Gesundheit von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher seine Teilhabe an gesellschaftlichen Tätigkeiten, insbesondere am Arbeitsleben, nur eingeschränkt möglich ist.
Die medizinische Sichtweise untersucht hauptsächlich die Ursachen der Behinderung und hebt daher hirnorganische Schädigungen, Fehlbildungen oder Fehlfunktionen hervor. Das gemeinsame Auftreten von verschiedenen Symptomen wird als klinisches Syndrom bezeichnet. Diese klinischen Syndrome werden nach dem Zeitpunkt ihrer Entstehung eingeteilt. Unterschieden wird zwischen Syndromen, die vor, während oder nach der Geburt entstanden sind.
Aus psychologischer Sicht wird eine geistige Behinderung als unterdurchschnittliche Allgemeinintelligenz definiert, die zu einer Beeinträchtigung des Anpassungsverhaltens führt. In Zusammenhang damit werden auch die Intelligenzmessung und Tabellen zur Einstufung der Intelligenz vorgestellt.
Soziologisch betrachtet ist eine Behinderung keine an der Person fest gemachte Eigenschaft, sondern eine soziale Kategorie in der Interaktion mit der Gesellschaft. Durch soziale Deprivation kann eine geistige Behinderung hervorgerufen werden.
Letztendlich werden in dem Kapitel die Geschichte und der Wandel der gesellschaftlichen Einstellung gegenüber Menschen mit geistiger Behinderung dargestellt.In diesem Zusammenhang werden Modelle der Behindertenhilfe tabellarisch aufgeführt.
3 Aktuelle Leitideen in der Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung
Gegenstand dieses Kapitels ist es, die Leitbilder unserer Zeit vorzustellen. Diese sind zum einen das Normalisierungsprinzip, die Selbstbestimmung und letztendlich die aktuellste Idealvorstellung der Inklusion.
3.1 Das Normalisierungsprinzip
Vereinfacht ausgedrückt sagt das Normalisierungsprinzip aus: Auch Menschen mit einer geistigen Behinderung sollen ein Leben führen können, das so normal wie möglich ist (vgl. Bundesvereinigung Lebenshilfe 2008c, o. S.). Der Mensch mit geistiger Behin- derung sollte ein Mitbürger mit uneingeschränkten Rechten auf ein normales Leben in der Gesellschaft sein (vgl. ebd.).
Ziel des Prinzips ist die Integration von Menschen mit geistiger Behinderung in die Schul- und Arbeitswelt. Auch soll den Menschen mit geistiger Behinderung die Möglichkeit gegeben werden, ihr Leben – sei es im Bereich Kultur, Sport, Religiosität oder Freizeit – nach ihren Vorstellungen zu gestalten (vgl. ebd.).
WALTER THIMM erwähnt bezüglich des Normalisierungsprinzips, dass man ursprünglich eine „Philosophie“ suchte, nach welcher Erzieher, Betreuer, Lehrer – und andere Personen aus dem Betreuungswesen für Menschen mit geistiger Behinderung – ihre Arbeit ausrichten konnten (vgl. Thimm 1994, S. 3).
3.1.1 Entstehung des Normalisierungsgedankens
Die Anfänge des Normalisierungsprinzips können in Schweden bereits in die 40ger Jahren datiert werden. Man nennt damals den sozialpolitischen Gedanken und das Bestreben des Regierungsausschusses, auch behinderten Menschen das Arbeiten zu ermöglichen, das „Normalisierungsprinzip“ (vgl. Ericsson 1986, S. 33). Grund für das Aufkommen dieses Bestrebens ist die kritische Haltung des Ausschusses gegenüber der bisherigen – ihrer Meinung nach – unzureichenden Hilfen, die für Menschen mit Behinderungen bis dahin geleistet wurden.
Zur selben Zeit wächst auch das Interesse an der Entwicklung eines Wohlfahrtsstaates, welcher nur durch das Bestehen eines Sozial- und Gesundheitswesens in der Gesellschaft möglich ist (vgl. ebd.).
Bezüglich der Menschen mit Behinderung spricht man zu dieser Zeit in dem Ausschuss von der „Normalisierung der Lebensbedingungen“. Man sieht außerdem in der Arbeitsbeschaffung für Menschen mit geistiger Behinderung einen positiven psychologischen Effekt für diese, da sie in der Gesellschaft selbst ihr Geld verdienen und somit ein relativ normales Leben unter dieser führen können. Für die Gesellschaft auf der anderen Seite ergab sich damit der positive Aspekt, dass auch Menschen mit Behinderungen einen Beitrag auf dem Arbeitsmarkt leisten können (vgl. Ericsson 1986, S. 34).
Das Wesen der Fürsorge in Skandinavien gilt in Hinblick auf Behinderte generell als vorbildlich (vgl. Thimm 1994, S. 17). Die erste feststehende Formulierung des Normalisierungsprinzips kommt in Dänemark zustande. Sie wird durch den Juristen und Verwaltungsbeamten NIELS ERIK BANK-MIKKELSEN geprägt (vgl. ebd.).
3.1.1.1 Normalisierung nach Nils Erik Bank-Mikkelsen
Normalisierung bedeutet bei ihm, „den geistig Behinderten ein so normales Leben wie möglich zu gestatten“ (Thimm 1994, S. 4).
Eben genannte Fassung wird 1959 ins Dänische Fürsorgegesetz übernommen.
In ausführlicheren Worten definiert NILS ERIK BANK- MIKKELSEN Normalisierung wie folgt: „Der geistig behinderte Mensch ist an erster Stelle ein Mitmensch, und daher muss er vom Standpunkt der Gleichberechtigung die gleichen Rechte wie seine Mitbürger haben.“ (Ericsson 1986, S. 35).
Er hebt des Weiteren hervor, welche Folgen es haben könnte, wenn das Prinzip der Normalisierung nicht anerkannt werden würde. Es würde die Gefahr bestehen, dass den Menschen mit geistiger Behinderung lediglich Mitleid und übertriebener Schutz entgegengebracht wird. Zum anderen könnte durch die Sicht der Menschen mit Behinderung als besondere Gruppe wieder die Diskriminierung dieser eine verheerende Folge sein (vgl. ebd.).
Die Weiterentwicklung des Normalisierungsprinzips findet in Schweden statt.
3.1.2.2 Normalisierung nach Bengt Nirje
BENGT NIRJE ist in den 60ger Jahren im schwedischen Elternbeirat vertreten und wirkt bei den Vorbereitungen für ein Gesetz von 1967 mit, welches die Hilfen für Menschen mit geistiger Behinderung regeln soll.
Er sieht „das Normalisierungsprinzip als ein Mittel an, das dem geistig Behinderten gestattet, Errungenschaften und Bedingungen des täglichen Lebens, so wie sie der Masse der übrigen Bevölkerung zur Verfügung stehen, weitgehend zu nutzen.“ (Thimm 2005, S. 20 f.).
Den Menschen mit geistiger Behinderung sollen folglich Bedingungen und Formen des alltäglichen Lebens genauso zustehen wie Menschen ohne Behinderungen. Wie dies möglich werden könnte, hat er in einer systematisch ausdifferenzierten Darstellung deutlich gemacht. BENGT NIRJE hat acht Bereiche genannt, die die Bestandteile des Normalisierungsprinzips darstellen und verdeutlicht auch, wie das Prinzip im täglichen Leben verwirklicht werden müsste.
1. Ein normaler Tagesablauf
Der Mensch mit geistiger Behinderung soll wie ein Mensch ohne Behinderung einen normalen Tagesablauf haben können. Dazu gehören das Schlafen, das Aufstehen, das Anziehen und das Einnehmen der einzelnen Mahlzeiten. Dieser Ablauf soll unabhängig vom Schweregrad der Behinderung stattfinden. Auch das Arbeiten und das Erleben von Freizeit ist hier mit inbegriffen.
2. Die Trennung von Arbeit/ Freizeit/ Wohnen
In unserer Gesellschaft werden diese Bereiche meistens von einander getrennt. So soll es auch bei Menschen mit geistiger Behinderung sein. Somit sollen sowohl Ortswechsel als auch ein Wechsel der Kontaktpersonen gegeben sein. Die Arbeit soll somit auch ein fester Bestandteil des Tages werden und nicht nur einmal wöchentlich als Therapie gelten.
3. Ein normaler Jahresrhythmus
Dies bedeutet, dass Feiertage, Ferien und andere Ereignisse stattfinden, welche die regelmäßigen Tätigkeiten unterbrechen. Dazu gehören auch Familienfeiern und der Urlaub.
4. Ein normaler Lebenslauf
Sämtliche Abläufe im Leben der Menschen mit geistiger Behinderung sollen auf das jeweilige Alter der Person abgestimmt sein. Die Lebensphasen Kindheit, Jugend und Erwachsensein sollen berücksichtigt werden. Dementsprechend müssen Angebote und das Verhalten ihnen gegenüber angepasst werden.
5. Die Respektierung von Bedürfnissen
Bei der Bedürfnisermittlung des Menschen mit geistiger Behinderung soll dieser selbst so gut wie möglich mit einbezogen werden. Dabei ist wichtig, dass die Wünsche und Entscheidungen dieser respektiert und berücksichtigt werden.
6. Der Kontakt zwischen den Geschlechtern
Die Möglichkeit des Geschlechterkontakts zwischen Jungen und Mädchen bzw. Frauen und Männern mit geistiger Behinderung muss gegeben sein.
7. Ein normaler wirtschaftlicher Standard
Die soziale Gesetzgebung gibt hierzu einen Rahmen vor, der zu gewährleisten ist.
8. Die Standards von Einrichtungen
Die Größe, die Lage, die Ausstattung und andere Gegebenheiten in Einrichtungen für Menschen mit geistiger Behinderung sollen an dem Maßstab gemessen werden, der auch für Menschen ohne Behinderungen gilt (vgl. Nirje 1967 zit. n. Thimm 1994, S. 19 f.).
Vergleicht man die Ansprüche der Normalisierung mit dem früheren Verständnis der Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung in Deutschland, wird ein völlig anderer Grundgedanke deutlich. Im Gegensatz zu dem Leitbild der Verwahrung und Pflege sollen unter dem Gesichtspunkt der Normalisierung die Perspektiven der Betroffenen mit einbezogen und ihre eigene Vorstellung berücksichtigt werden (vgl. Thimm 1991, S. 513 zit. n. Neumann 1999, S. 9).
Ziel des Normalisierungsprinzips ist laut BENGT NIRJE neben der Humanisierung der Lebensbedingungen vor allem auch die Integration. Da Menschen mit geistiger Behinderung über einen langen Zeitraum isoliert wurden, ist es besonders wichtig, dass diese nun wieder in die Gesellschaft integriert werden.
Bezüglich der Integration müssen verschiedene Ebenen berücksichtigt werden:
„Räumliche Integration:
Wohneinrichtungen sind in normalen Wohngegenden anzusiedeln.
Funktionale Integration:
Menschen mit geistiger Behinderung sollen allgemeine Dienstleistungen (z.B. öffentliche Verkehrsmittel oder andere öffentliche Einrichtungen, Restaurants (etc.)) in Anspruch nehmen können.
Soziale Integration:
Soziale Beziehungen in der Nachbarschaft sollen durch gegenseitige Achtung und Respekt getragen sein.
Personale Integration:
Das Privatleben wird durch dem Lebensalter entsprechende persönliche Beziehungen zu nahe stehenden Menschen als emotional befriedigend erlebt. Im Erwachsenenalter beinhaltet dies ein möglichst selbst bestimmtes Leben außerhalb des Elternhauses.
Gesellschaftliche Integration:
Menschen mit geistiger Behinderung werden in Bezug auf gesetzliche Ansprüche als Mitbürger akzeptiert. Sie können bei Entscheidungen, die ihr Leben und Alltag betreffen, mitbestimmen sowohl als Einzelperson als auch als Mitglied von Selbsthilfegruppen.
Organisatorische Integration:
Die Strukturen einer Gemeinde sind so zu ändern, dass sie der Integration von Menschen mit geistiger Behinderung dienen.“ (Fornefeld 2000, S. 137).
Man sieht, dass selbst die Integration der Menschen mit Behinderung nicht allgemein gesehen werden kann, sondern auch hier eine klare Differenzierung bei der Umsetzung nötig ist.
Da der Gedanke der Normalisierung nicht nur in Skandinavien Einzug hielt, wird im Folgenden auf die weiteren Entwicklungen in Nordamerika eingegangen.
3.1.3.3 Normalisierung nach Wolf Wolfenberger
Für WOLF WOLFENBERGER steht die soziale Rolle des Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft im Vordergrund (vgl. Fornefeld 2000, S. 137).
In seinem Systematisierungsversuch von 1972 erwähnt er eine mögliche Neuformulierung des Normalisierungsprinzips, die übersetzt bedeutet:
„Anwendung von Mitteln, die der kulturellen Norm so weit wie möglich entsprechen, mit der Absicht, persönliche Verhaltensweisen und Merkmale zu entwickeln bzw. zu erhalten, die den kulturellen Normen so weit wie möglich entsprechen.“ (Thimm 2005, S. 24).
Der Normalisierungsgedanke soll sich neben der Förderung und Betreuung von Menschen mit geistiger Behinderung also auch auf deren Erscheinungsbild und ihre Verhaltensweisen beziehen (vgl. Thimm 2005, S. 25).
Für WOLF WOLFENSBERGER steht im Vordergrund, dass die soziale Rolle des Menschen mit geistiger Behinderung aufgewertet wird (vgl. Wolfenberger 1986, S. 49). Er ersetzt den Begriff der Normalisierung daher durch die „Aufwertung (Valorisation) der sozialen Rolle.“ (ebd.).
Des Weiteren ändert er nicht nur den Begriff der Normalisierung, sondern gibt auch eine weitere neue formale Definition und somit auch ein verändertes Konzept des Normalisierungsprinzips bekannt:
„Der weitest mögliche Einsatz kulturell positiv bewerteter Mittel mit dem Ziel, Menschen eine positiv bewertete Rolle zu ermöglichen, sie zu entwickeln, zu verbessern und /oder zu erhalten.“ (Wolfenberger 1986, S. 49). Die Veränderung der Rolle der Menschen mit geistiger Behinderung ist laut ihm durch die Aufwertung des Images und der Kompetenz möglich. Die Aufwertung dieser beiden Komponenten ist nach ihm durch Aktionen auf vier Ebenen umzusetzen.
Zum einen geschieht dies durch Aktionen auf der Ebene der betreffenden Person, also des Individuums selbst. Ein Beispiel ist die Person als Empfänger von institutionellen Hilfen.
Gleichermaßen müssen Aktionen auf der Ebene des primären und des sekundären sozialen Systems der jeweiligen Person stattfinden. Das primäre soziale System beschreibt dabei die Familie und den engeren Umkreis, das sekundäre soziale System meint beispielsweise Nachbarn oder Fördereinrichtungen.
Letztendlich ist noch die gesellschaftliche Ebene zu nennen. Sie meint die Gesellschaft als Ganzes, wozu beispielsweise die Wertmaßstäbe dieser oder ihre Gesetze zählen.
Noch kurz zu nennen sind WOLF WOLFENSBERGERs Verfahren mit der Bezeichnung PASS[4] und PASSING[5]. mit welchen er die Möglichkeit schafft, „die Qualität der sozialen Dienstleistungssysteme kritisch, multidimensional und auf die wirklich entscheidenden Merkmale hin zu analysieren.“ (Wolfenberger 1986, S. 52).
3.1.2 Zusammenfassung der Forderungen des Normalisierungprinzips
Für die genannten Verfasser BENGT NIRJE, WOLF WOLFENSBERGER und NILS ERIK BANK-MIKKELSEN sollten im Zuge der Normalisierung verschiedene Ziele für Menschen mit geistiger Behinderung verfolgt werden. Diese werden nachfolgend zur besseren Übersicht stichpunktartig zusammengefasst:
- Ein Leben so normal wie möglich: z.B. normaler Tages-, Jahres- und Lebensablauf
- Die Integration in die Gesellschaft: z. B. durch die Möglichkeit, arbeiten zu gehen
- Die Verbesserung der Lebensqualität und der Wohnverhältnisse: z. B. durch die
- Auflösung von Großeinrichtungen
- Die Akzeptanz der Menschen mit Behinderung als vollwertige Mitbürger
- Respektierung der Bedürfnisse: durch Mitspracherecht der Betroffenen
- Gleichberechtigung: beispielsweise durch gesetzliche Rahmenbedingungen
- Aufwertung der sozialen Rolle der Person: durch Aufwertung des Images und der Kompetenz der Person auf verschiedenen Ebenen
3.1.3 Das Normalisierungsprinzip in Deutschland
Der Normalisierungsgedanke ist in Skandinavien entstanden und seine Verbreitung nahm in den USA seinen Lauf. Seit wann aber ist diese Leitidee auch in Deutschland vertreten?
Der Gedanke der Normalisierung erhält seit den 70ger Jahren Einfluss auf das deutsche Behindertenwesen und wird zum Leitgedanken der Heil- und Sonderpädagogik. Dadurch wird die Grundlage für Veränderungen auf sozial-politischer Ebene, womit beispielsweise Gesetzesänderungen gemeint sind, geschaffen. Durch diese Änderungen wird den Menschen mit geistiger Behinderung der Zugang zu Schulen und auch Behindertenwerkstätten ermöglicht (vgl. Fornefeld 2000, S. 138). Auch steht in Deutschland mit dem Prinzip der Normalisierung die Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen mit geistiger Behinderung im Vordergrund. Es sollen daher differenzierte Angebote für das Wohnen, die Beschäftigung und die Freizeit dieser vorhanden sein. Des Weiteren sollte für die Erfüllung des Prinzips eine Reform der Betreuungskonzepte stattfinden. Zum Bereich der Betreuung zählt die Unterstützung und Hilfe in der Lebensgestaltung und außerdem die Förderung und Bildung der Menschen mit geistiger Behinderung. Letztendlich erstreckt sich das Prinzip der menschenwürdigen Gestaltung ihres Lebens auch auf den bereits genannten sozial- politischen Bereich. Dieser schließt rechtliche, finanzielle und administrative Reformbemühungen ein (vgl. Fornefeld 2000, S. 38 f.).
Die Lebenshilfe Marburg setzt sich seit den 80ger Jahren besonders engagiert für die Normalisierung und Integration von Menschen mit geistiger Behinderung ein. Somit findet 1985 der erste europäische Kongress zum Thema Normalisierung statt, der von der Bundesvereinigung Lebenshilfe ausgerichtet wird (vgl. Bundesvereinigung Lebens- hilfe 2008 c, o. S.).
3.1.4 Aktuelle Entwicklungen
An dieser Stelle wird bereits kurz auf das Thema „Wohnen“ eingegangen.
In Deutschland haben sich in den letzten dreißig Jahren aufgrund des Normalisierungsgedankens viele kleine und in die Gemeinde integrierte Wohnein- richtungen für Menschen mit geistiger Behinderung entwickelt. Als flächendeckend kann diese Entwicklung aber noch nicht bezeichnet werden (vgl. Fornefeld 2000, S. 139).
Auch MARTIN THOMAS HAHN berichtet von Veränderungen. Anstalten hätten sich nach innen und durch die Schaffung kleinerer Wohneinheiten nach außen verändert (vgl. Hahn 1999, S. 4 ).
Einschränkungen bei der Realisierung
Auf der anderen Seite gäbe es aber auch, so THOMAS HAHN, noch viele Großwohnheime, in denen der Aufruf, sich an die Forderungen des Normalisierungsprinzips anzulehnen, nicht oder kaum befolgt wird (vgl. Hahn 1999, S. 5).
Wie WALTER THIMM im Jahr 1999 kritisiert, gibt es noch immer Schlafsäle mit Krankenhausbetten in diesen Großeinrichtungen, in denen keinerlei individuelle Gestaltungsmöglichkeiten zu realisieren sind.
Es werden außerdem sehr frühe Schlafenszeiten vorgegeben und nur wenige Aktivierungsangebote – wie etwa die Beschäftigungs- oder Arbeitstherapie – gemacht. Des Weiteren sei auch in den viel zu großen Gruppen die persönliche Gestaltung sehr begrenzt.
Die größte Kritik er wird an der bestehenden altersspezifischen Behandlung der Menschen mit Behinderung ausgeübt. Wie BENGT NIRJE es in seinem Punkt „Ein normaler Lebenslauf“ beschreibt, heißt es, dass sämtliche Abläufe im Leben des Menschen mit geistiger Behinderung auf dessen Alter abgestimmt sein sollen, die Lebensphasen berücksichtigt werden sollen und somit auch die Behandlung und die Angebote abgestimmt werden müssen. Dieses Merkmal des Normalisierungsprinzips wird laut WALTER THIMM besonders oft missachtet. Erwachsene würden bis ins hohe Alter wie Kinder behandelt werden. Er hebt außerdem hervor, dass der Kontakt zwischen den Geschlechtern nicht gefördert werden würde, sondern – im Gegenteil – Männer und Frauen in verschiedenen Häusern oder Stationen untergebracht werden (vgl. Thimm 1999, S. 22).
Einschränkungen in der Realisierung des Normalisierungsprinzips liegen generell im Umgang mit Menschen mit schwerer geistiger Behinderung noch zu häufig vor.
Im Weiteren folgt die Darstellung des Paradigmas der Selbstbestimmung. Dieses Denkmuster ist aus dem Normalisierungsprinzip heraus entstanden.
Da die Leitideen der Normalisierung und der Selbstbestimmung eng beieinander liegen und nicht als unabhängige Paradigmen verstanden werden können, wird zunächst der bestehende Zusammenhang geschildert.
3.1.5 Der Zusammenhang von Normalisierung und Selbstbestimmung
Zeitlich gesehen kam der Gedanke der Selbstbestimmung nach dem der Normalisierung auf. Es kann aber nicht von einer Ablösung des einen Zeitalters durch das andere die Rede sein (vgl. Sack 2006, S. 105). So betont RUDI SACK, dass die Forderungen des Normalisierungsprinzips durch das entstandene Paradigma der Selbstbestimmung nicht an Bedeutung verlieren. Es habe eher „eine Präzisierung des Normalisierungsgedankens in einem speziellen Aspekt“ (ebd.) stattgefunden. Die Rede ist von der Normalisierung der Beziehungen zwischen Menschen mit geistiger Behinderung und ihren Begleitern (vgl. ebd.). Neben der Selbstbestimmung sind auch die Leitbilder der Integration, der Teilhabe und der Inklusion aus der Idee der Normalisierung entstanden.
3.2 Das Paradigma der Selbstbestimmung
Unter dem Titel „Ich weiß doch selbst, was ich will“ läuft 1994 ein Kongress der Bundesvereinigung Lebenshilfe, der dem Begriff der Selbstbestimmung in der Gesellschaft zum Durchbruch verhilft (vgl. Bundesvereinigung Lebenshilfe 2008 d, o. S.).
Im Folgenden wird zunächst die Bedeutung des Selbstbestimmungsbegriff aufgegriffen, woraufhin die Darstellung der Entstehungsgeschichte folgt. Letztendlich wird speziell auf die Selbstbestimmung von Menschen mit geistiger Behinderung eingegangen. Es werden neue Konzepte der Heil- und Sonderpädagogik erläutert, die zur Verwirklichung der Selbstbestimmung der Menschen mit geistiger Behinderung beitragen sollen.
3.2.1 Der Begriff der Selbstbestimmung
Selbstbestimmung bedeutet, dass einem Individuum die Möglichkeit und Fähigkeit gegeben ist, frei und dem eigenen Willen entsprechend zu handeln (vgl. Brockhaus 1993, S. 87). Der Wille eines Menschen bezeichnet die Fähigkeit, sich auf eine Weise bewusst zu verhalten und dabei ein Ziel anzustreben. Selbstbestimmung ist an kognitive Fähigkeiten gebunden (vgl. Wagner 2001 a, o. S.).
Begriffe die in Zusammenhang mit dem der Selbstbestimmung häufig diskutiert werden, sind die der Freiheit, Mündigkeit und Selbstständigkeit (vgl. Klauß 2003, S. 87).
ANDREAS WAGNER fasst den Begriff der Selbstbestimmung wie folgt zusammen: „Unter Selbstbestimmung ist die Möglichkeit und die kognitive Fähigkeit eines Menschen zu verstehen, selbst Entscheidungen über sein Handeln, Verhalten und seinen Körper zu treffen.“ (Wagner 2001 a, o.S.).
Selbstbestimmung ist nicht gleichzusetzen oder zu verwechseln mit dem Begriff der Selbstständigkeit. Selbstständigkeit würde bedeuten, dass ein Mensch mit Behinderung jede Tätigkeit selbst erledigen kann. Dies ist meist aber, vor allem bei einer körperlichen Behinderung, nicht möglich. Das bedeutet, dass der Mensch mit Behinderung zwar beispielsweise Hilfe beim Anziehen von Kleidung benötigt, aber trotzdem selbst entscheiden kann, was er gerne tragen würde (vgl. Klauß 2003, S. 91). Somit kann dieser Mensch trotz seiner Unselbstständigkeit selbst bestimmt leben.
Selbstständigkeit ist dementsprechend keine zwingende Bedingung für die Selbstbestimmung eines Menschen, auch wenn es für einen selbstständigen Menschen leichter ist, selbst bestimmt zu leben (vgl. ebd.).
Laut THEO KLAUß gibt es zwei Formen der Selbstbestimmung. Zum einen gibt es die Selbstbestimmung, bei der eine Person seinen Bedürfnissen unabhängig von anderen Menschen nachkommen kann. Hier fallen Selbstbestimmung und Selbstständigkeit zusammen. Zum anderen gibt es die Selbstbestimmung, bei der die Befriedigung einer Person von anderen Menschen abhängig ist. Bei dieser Art der Selbstbestimmung ist die Voraussetzung, dass zunächst Kommunikation stattfindet und somit die Bedürfnisse mitgeteilt und vom Gegenüber verstanden werden. Als nächstes ist dann die Bereitschaft und Fähigkeit anderer Menschen notwendig, darauf einzugehen und als Assistent bei der Befriedigung der Bedürfnisse helfend einzugreifen (vgl. ebd.).
Bei Menschen mit geistiger und/oder körperlicher Behinderung gilt meistens die zweite Form der Selbstbestimmung. Daher bezeichnet RUDI SACK die Selbstbestimmung auch als Normalisierung der Beziehungen zwischen Menschen mit geistiger Behinderung und dem jeweiligen Begleiter (vgl. Sack 2006, S. 105). Denn nur, wenn das Bedürfnis des Menschen mit Behinderung verstanden wird und der Wille bei den Betreuern vorhanden ist, diesen zu helfen, kann Selbstbestimmung funktionieren. Im Punkt 4.5.1.5 (Veränderung der Beziehung zwischen Bewohnern und Betreuern) wird erläutert, auf welche Weise sich die Beziehung zwischen Bewohnern und Betreuern in einem Wohnheim zugunsten der Selbstbestimmung verändern muss.
An dieser Stelle wird nun die Entstehungsgeschichte der Selbstbestimmung folgen.
3.2.2 Entstehungsgeschichte der Selbstbestimmung
3.2.2.1 Independent – Living - Bewegung
In den USA findet am Ende der 60ger und Anfang der 70ger Jahre die so genannte Independent – Living - Bewegung (Selbst – bestimmt – Leben - Bewegung) statt. Die Ursprünge dieser Bewegung liegen in zwei Ereignissen. Zum einen zogen 1962 vier behinderte Studenten aus einer Privatklinik in eigene Wohnungen auf den Campus der „University of Illinois“. Das zweite ausschlaggebende Ereignis ist auf den gelähmten Ed Roberts zurückzuführen, der sich den Zugang zur „University of California“ erkämpfte.
Die Bewegung wird hauptsächlich von Menschen mit körperlicher Behinderung getragen und ist Bestandteil der gesamten Bürgerbewegung in den USA, welche für mehr Demokratie, gegen den Rassismus und für die Emanzipation der Frauen kämpft (vgl. Hähner 2006, S. 35).
Die US-amerikanische Definition von „Independent Living“ lautet damals wie folgt:
„Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen bedeutet, „die Kontrolle über das eigene Leben, die auf der Wahl von akzeptablen Möglichkeiten basiert (und) die das Angewiesensein auf andere beim Treffen von Entscheidungen und der Ausübung von alltäglichen Tätigkeiten minimieren.“ (Frieden u. a. 1979 in Miles-Paul 1992, S. 122 zit. n. Osbahr 2000, S. 121).
Das Anliegen der Menschen mit körperlicher Behinderung stellt STEFAN OSBAHR folgendermaßen dar: Sie fordern das ihnen zustehende Recht, selbst Entscheidungen zu treffen und über ihre Angelegenheiten selbst bestimmen zu dürfen. Sie verlangen außerdem den Abbau gesellschaftlicher Diskriminierungen gegenüber behinderten Menschen. Des Weiteren soll die Unterstützung von Betroffenen nicht nur durch Fachleute, sondern auch durch andere Betroffene geschehen. Es soll deutlich werden, dass sie mit ihren Anliegen für etwas Selbstverständliches eintreten (vgl. Osbahr 2000, S. 121).
Aus der Independent-Living-Bewegung ist in den USA bis zum heutigen Tag ein Netz an Independent-Living-Centers entstanden. In diesen managen und beraten sich vorwiegend Menschen mit Körper- und Sinnesbehinderungen eigenverantwortlich. Das Angebot dieser Zentren schließt unter anderem die Beratung, das Peer Counseling (Beratung von Menschen mit Behinderung durch Menschen mit Behinderung), Schulungen und Fortbildungen, Vermittlungen von Wohnungen oder Helfern und Reparaturen von Rollstühlen und anderen Hilfsmitteln ein.
In Deutschland werden 1982 auf dem internationalen Kongress „Leben, Lernen, Arbeiten in der Gemeinschaft“ in München viele Grundsätze der Independent-Living-Bewegung übernommen. Im Jahr 1986 entsteht in Bremen das erste Zentrum für selbst bestimmtes Leben von Menschen mit Behinderung in Deutschland.
3.2.2.2 Self-Advocacy-Bewegung
Aus der Independent-Living-Bewegung heraus und auch schon parallel dazu bildeten sich zunächst in Kanada auf Seiten der Menschen mit geistiger Behinderung die „People-First“- (People-First = zuerst wir Menschen) und die Self-Advocacy-Gruppen (vgl. Hähner 2006, S. 35). In diesen Gruppen schlossen sich erstmals in den 70ger Jahren Menschen mit geistigen Behinderungen zusammen, um Erfahrungen auszutauschen und um ihre Interessen selbst zu vertreten.
Wie EVEMARIE KNUST-POTTER es ausdrückt ist „Self-Advocacy (..) eine Bewegung, in der Betroffene selbst existierende Dienstleistungsangebote und Lebensbedingungen in Frage stellen“ (Knust-Potter 1997, S. 521) und die Kontrolle über ihr Leben erhalten wollen (vgl. Knust-Potter 2006, S. 519). Sie wollen ihre Interessen selber vertreten und wie Erwachsene und gleichberechtigte Bürger behandelt werden (vgl. Rock 2001, S. 22).
Daher kann „Self-Advocacy“ ins Deutsche mit „für sich selbst sprechen“ übersetzt werden (Hähner 2006, S. 35). Das Prinzip des „Für-sich-selbst-Sprechens“ können sowohl einzelne Personen als auch Gruppen für sich geltend machen. Self-Advocacy bezeichnet im Grunde jede Aktivität, die Selbstbestimmung oder Selbstvertretung beinhaltet (vgl. Knust-Potter 1997, S. 519).
Hier nennt EVEMARIE KNUST-POTTER als einfachste Beispiele solche Aktivitäten wie die Auswahl von Getränken oder Speisen, insbesondere das Annehmen und Ablehnen dieser oder die Entscheidung über den Zeitpunkt des Schlafengehens.
Wie bereits erwähnt, ist die Selbstbestimmung bei Menschen mit geistiger Behinderung besonders abhängig von der Umwelt. EVEMARIE KNUST-POTTER spricht hier von den „gegebenen Möglichkeiten und Chancen, die von der unmittelbaren und der mittelbaren Umwelt (den unmittelbaren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Assistentinnen und Assistenten, Eltern, Dienstleistungsträgern, Sozialbehörden, Entscheidungsträgern in Forschung und Lehre und der Öffentlichkeit) eingeräumt werden.“ (Knust-Potter 1997, S. 519).
Die Self-Advocacy-Bewegung hat zur Voraussetzung, das Recht auf Selbstbestimmung von Menschen mit geistiger Behinderung zu akzeptieren. Ihr Recht ist bei diesen Menschen trotzdem abhängig von Hilfe und Assistenz durch andere. Daher betont auch EVEMARIE KNUST-POTTER (wie bereits THEO KLAUß in Punkt 3.2.1), dass Selbstbestimmung nicht grundsätzlich mit der Selbstständigkeit verwechselt werden darf, da dieser Begriff die Notwendigkeit von Unterstützung ausschließt.
Die Gründer der Self-Advocacy sehen in dem Unterstützer des Menschen mit geistiger Behinderung keinen bevormundenen Beschützer, sondern eine gleichberechtigte Person, die der behinderten Person zu einer Kompensation von ungleichen Lebenschancen verhilft (vgl. Knust-Potter 1997, S. 521).
Neben der Forderung nach Selbstbestimmung und Kontrolle, versteht sich die Self-Advocacy vor allem als Selbst-Aktiv-Werden und als Zusammenschluss von Menschen mit Behinderungen in selbst organisierten Gruppen, um Veränderungen zu erzielen, ohne zu warten, bis andere es tun.
Auch in vielen anderen Ländern wurden die Menschen mit geistiger Behinderung durch vorherige Ereignisse, wie die eben vorgestellte Bewegung, ermutigt, ihre Interessen vehement zu vertreten (vgl. Fornefeld 2000, S. 148).
Hier sorgte die Bundesvereinigung Lebenshilfe 1994 durch einen Kongress mit dem Titel „Ich weiß doch selbst, was ich will“ für die sichere Einbettung der Forderung nach Selbstbestimmung in der Geistigbehindertenpädagogik Deutschlands (vgl. Bundesver- einigung Lebenshilfe 2008 d, o. S.).
3.2.3 Selbstbestimmung bei Menschen mit geistiger Behinderung
Der Begriff Selbstbestimmung steht im Gegensatz zu dem der Fremdbestimmung. Das Leben der Menschen mit geistiger Behinderung war lange Zeit zum größten Teil fremdbestimmt. Diese Fremdbestimmung und die soziale Abhängigkeit des genannten Personenkreises intensivierte sich dabei je nach Schwere der Behinderung. Auf „das Mehr an sozialer Abhängigkeit“ (Klauß 2003, S. 88) als Kennzeichnung für das Leben von Menschen mit geistiger Behinderung weist auch THEO KLAUß hin. Den Menschen mit körperlicher oder geistiger Behinderung wurde die Selbstbestimmung auch aufgrund des bestehenden Menschenbildes der Gesellschaft aberkannt. Sie wurden und werden oft immer noch für nicht fähig empfunden, selbst Entscheidungen zu treffen, erwachsen zu handeln und Verantwortung zu übernehmen.
Diese Tatsache soll sich mit der Epoche der Selbstbestimmung ändern.
Jeder Mensch, auch derjenige ohne Behinderung, ist an Regeln und Gesetze gebunden. Niemand kann stets so handeln, wie es ihm gefällt. Aber solange sich die Menschen als Teil der Gesellschaft im gesetzlichen Rahmen bewegen, können sie sich im Grunde frei entfalten und ihr Leben auf die Befriedigung ihrer Bedürfnisse und Wünsche ausgerichtet führen.
Menschen mit geistiger Behinderung dagegen sind im höheren Maße von der Gesellschaft abhängig. Die Einstellung der Bevölkerung bestimmt, wie sie letztendlich behandelt werden. Diese Tatsache zeigte beispielsweise die (in Punkt 2.5) dargestellte Tabelle 5. Sie macht deutlich, wie sich mit dem Bestehen von verschiedenen Leitbildern der Verwahrung, Förderung und schließlich der Selbstbestimmung auch der Umgang der Gesellschaft mit den Menschen mit geistiger Behinderung änderte. Auch im Zeitalter der Selbstbestimmung sind die Betroffenen abhängig von ihrem Umfeld. Neben der Abhängigkeit von Gesetzen und Regelungen durch den Staat, ist an dieser Stelle insbesondere das Verhalten der betreuenden Personen gemeint. An erster Stelle können hier Eltern und Familie und zum anderen das im Wohnheim angestellte Personal als Betreuer von Menschen mit geistiger Behinderung genannt werden.
Die Meinung, dass Menschen mit geistiger Behinderung im höchsten Maße hilfebedürftig sind, herrscht zum großen Teil noch vor. Viele daraus entstehende Handlungen wirken der Selbstbestimmung der Betroffenen aber vielmehr entgegen als dass sie hilfreich wären. Soll einem Menschen mit Behinderung zur Selbstbestimmung verholfen werden, muss dieser dementsprechend behandelt, aufgefordert und auch bestärkt werden, selbstständig zu handeln.
Im Folgenden wird geschildert, welche Änderungen zur Realisierung des Paradigmas der Selbstbestimmung angestrebt werden.
Es erfordert, wie BARBARA FORNEFELD von MONIKA SEIFERT zitiert, „sowohl eine Veränderung der gegenwärtigen Versorgungsstruktur als auch eine Neugestaltung der Rolle des Betreuers, assistierende Hilfe statt Befürsorgung.“ (Seifert 1997, S. 46 zit. n. Barbara Fornefeld 2002, S. 150). Welche Konzepte hierzu Anwendung finden können, wird nun erläutert.
3.2.3.1 Die neue Rolle des Helfenden
Um Menschen mit geistiger Behinderung selbst bestimmte Lebensformen ermöglichen zu können, ist „ein umfassendes System individueller, ambulanter und bedarfsgerechter Hilfen“ (Rock 2001, S. 7) notwendig.
Das Selbstbestimmt-Leben-Konzept setzt unabdingbar die Neugestaltung der Betreuerrolle voraus.
Der professionelle Helfer muss aus seiner bisherigen Rolle heraustreten und zum Begleiter und Unterstützer werden. Er sollte nicht länger seine eigenen Vorstellungen zuvorderst einbringen oder durchsetzen, es sei denn er wird dazu aufgefordert (vgl. Hähner 2006 b, S. 130).
Als besonders sinnvoll wird das Konzept der persönlichen Assistenz angesehen, wel- ches aus dem Konzept des Empowerments entstanden ist. Beide Konzepte werden nun erläutert. Dann wird noch kurz auf das so genannte Kundenmodell eingegangen.
Inwieweit die Konzepte bei Menschen mit geistiger Behinderung sinnvolle Anwendung finden, wird jeweils im Anschluss an das vorgestellte Konzept erläutert.
3.2.3.2 Vorstellung neuer Konzepte
3.2.3.2.1 Das Konzept des Empowerments
Der Begriff „Empowerment“ stammt aus den USA und bedeutet ins Deutsche übersetzt soviel wie „Selbst-Ermächtigung“. Es ist dabei von der Ermächtigung von Menschen die Rede. Der Gedanke des Empowerments entwickelte sich aus den Protestaktionen und den Erfahrungen von Selbsthilfeinitiativen sozial benachteiligter Menschen (vgl. Wagner 2001 b, o. S.)
Ihr Ziel war es, soziale Ungerechtigkeiten und Benachteiligungen zu überwinden. Des Weiteren sollte durch Empowerment eine größtmögliche Kontrolle über das eigene Leben durchgesetzt werden.
Eine ausführliche Definition zu dem Begriff liefert die Bundesvereinigung Lebenshilfe:
„Empowerment meint alle Möglichkeiten und Hilfen, die es Menschen in einer eher machtlosen Situation ermöglichen, Kontrolle über ihr Leben zu gewinnen, indem sie eigene Stärken im Austausch mit anderen erkennen und sich gegenseitig ermutigen, ihr eigenes Leben und ihre soziale Umwelt zu gestalten.“ (Bundesvereinigung Lebenshilfe 1994, S. 4 f. zit. n. Wagner 2001 b, o. S.).
Menschen in machtlosen Situationen sollen durch das Empowermentkonzept gestärkt werden. Unter Stärkung ist nach ANDREAS WAGNER „das Entdecken, Bewusst- werden und Entwickeln von eigenen Ressourcen gemeint (…), heißt aber auch solche Bedingungen zu fördern, die es Menschen ermöglichen, selbst über das eigene Leben bestimmen zu können.“ (Wagner 2001 b, o. S.).
Der Gedanke des Empowerments setzt voraus, dass zwar jeder über individuelle Ressourcen, also Fähigkeiten und Potentiale verfügt, diese sich aber nur entfalten können, wenn sie ihm zugetraut werden (vgl. ebd.). Genau so wichtig ist auch, dass die Betroffenen darin unterstützt werden, sich selber das Bestehen ihrer persönlichen Ressourcen bewusst zu machen und an sich zu glauben (vgl. Theunissen&Plaute 2002, S. 12).
Wie ANDREAS WAGNER es beschreibt, spielt sich Empowerment auf verschiedenen Ebenen ab .Die individuelle Ebene meint die Situation, wenn Menschen anfangen, ihr Leben wieder selbst zu regeln.
Prozesse des Empowerments auf der gruppenbezogenen Ebene sind durch die Möglichkeit gekennzeichnet, neue Fähigkeiten durch die Mitarbeit in einer Organisation auszubilden. Wichtig ist dabei auch der gegenseitige Austausch von Meinungen und Kompetenzen.
Als letzte ist die strukturelle Ebene zu benennen. Diese bezeichnet das erfolgreiche Zusammenspiel von Individuen, organisatorischen Zusammenschlüssen und strukturellen Rahmenbedingungen.
Die Ebenen stehen in wechselseitigem Zusammenhang (vgl. Wagner 2001 b, o. S.).
Damit das Konzept des Empowerments funktionieren kann, sollten folgende Voraussetzungen bestehen:
- Betroffene müssen sich ihrer Situation bewusst werden und soziale Unter- stützung erhalten
- Kooperation unter den Betroffenen und ihre Beteiligung ist sehr wichtig
- Professionelle Helfer müssen sich von ihrer Defizit orientierten Sichtweise verabschieden und solche Bedingungen schaffen, durch welche die Betroffenen auf Ressourcen und Fähigkeiten zurückgreifen und neue entdecken können (vgl. Wagner 2001 b, o. S.)
Empowerment bei Menschen mit geistiger Behinderung
Auch dem Menschen mit geistiger Behinderung muss es möglich sein, Wünsche und Bedürfnisse umzusetzen.
Empowerment heißt, den Menschen zu ermutigen und ihn dabei zu unterstützen, diese Bedürfnisse zu artikulieren und zu befriedigen (vgl. Hähner 2006 b, S. 130). ULRICH HÄHNER betont, dass dabei die Grenzen anderer Menschen nicht verletzt werden dürfen.
Der Prozess des Empowerments ist bei Menschen mit geistiger Behinderung ein langer Hergang. Denn diese sind es aus der vorangegangenen Behandlung oft nicht gewöhnt, sich zu artikulieren und ihre Wünsche zu äußern. Daher haben viele den Kontakt zu sich selbst und zu ihren Bedürfnissen verloren.
Der Prozess des Empowerments bei Menschen mit geistiger Behinderung ist lang und überdauernd. Diese Menschen wurden über einen sehr langen Zeitraum bevormundet und jeglicher Selbstbestimmung entzogen, dass sie sich nicht von einem auf den anderen Tag zu selbstbewussten Persönlichkeiten entwickeln können (vgl. ebd.).
Bei der Auswahl von Maßnahmen zur Förderung und den angestrebten Zielen müssen die Betroffenen mit einbezogen werden.
Der Prozessverlauf des Empowerments ist bei Menschen mit geistiger Behinderung ein anderer als beispielsweise bei Menschen mit körperlicher Behinderung. Er muss für sie spezifiziert werden, basiert jedoch auf den gleichen Grundaussagen des Empowerment- konzepts.
[...]
[1] Bundesvereinigung Lebenshilfe: Im Jahr 1958 gegründete Organisation. Ziel dieser Organisation ist das Wohl von Menschen mit geistiger Behinderung und ihrer Familien.
[2] WHO= Worth Health Organization: Sonderorganisation der vereinten Nationen, Sitz in Genf.
[3] Otto Speck nennt hier Auszüge aus den Ergebnissen der Untersuchungen von Eggert (1969), Kushlick& Blunden (1974) und Carr (1974) u. a.
[4] PASS = Program Analysis of Service Systems (vgl. Wolfenberger 1986, S. 48)
[5] PASSING (neuere Methode) = Program Analysis of Service Systems Implemantation of Normalization Goals (vgl. Wolfenberger 1986, S. 51)
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2010
- ISBN (eBook)
- 9783836648646
- DOI
- 10.3239/9783836648646
- Dateigröße
- 1.3 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Justus-Liebig-Universität Gießen – Sozial- und Kulturwissenschaften, Studiengang Diplom-Pädagogik
- Erscheinungsdatum
- 2010 (Juli)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- selbstbestimmung behinderung wohnheim erhebung interviews
- Produktsicherheit
- Diplom.de