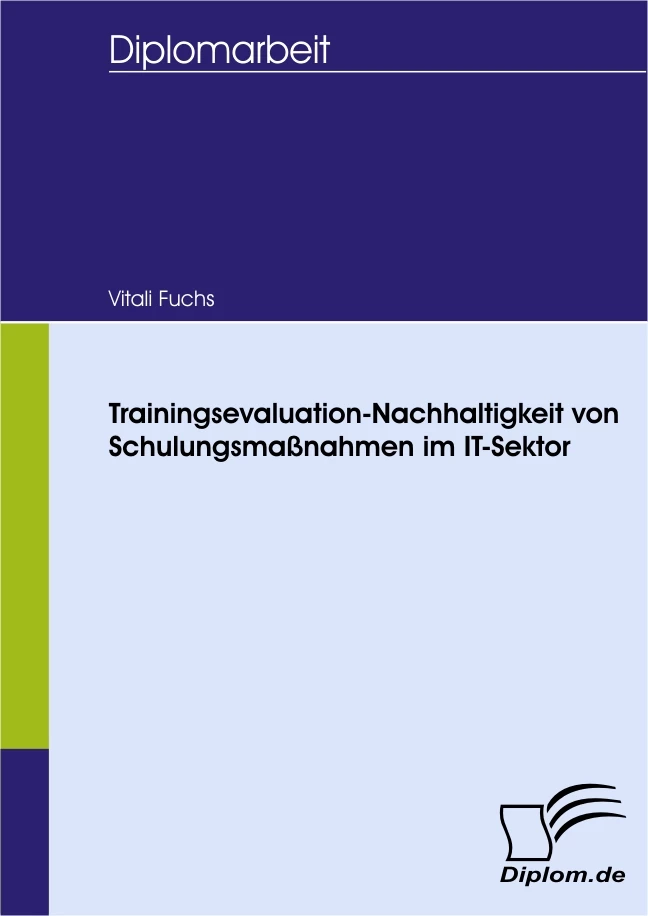Trainingsevaluation-Nachhaltigkeit von Schulungsmaßnahmen im IT-Sektor
©2010
Diplomarbeit
193 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
In heutiger Zeit ist die computergestützte Datenverarbeitung aus keinem Unternehmen mehr wegzudenken. In Deutschland prägen moderne Informations- und Kommunikations-Technologien, allen voran Computer und Internet, immer mehr das Berufs- und Privatleben vieler Menschen. Dies geht aus den aktuellen Ergebnissen der Erhebungen des Statistischen Bundesamtes zur Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in Unternehmen und privaten Haushalten hervor. Angefangen mit einfacher Brieferstellung über Terminplanung bis hin zu komplexen Businesscase-Lösungen läuft alles fast nur noch digital. Der Anteil der Beschäftigten, die regelmäßig während ihrer Arbeitszeit einen Computer nutzen, ist seit Januar 2003 um 14 Prozentpunkte auf rund 60% im Januar 2008 gestiegen. Im privaten Bereich ist der Anteil der Personen ab zehn Jahren, die einen Computer im ersten Quartal des Jahres nutzten, im Jahr 2008 auf 76% gestiegen (2003: 64%). Die Nutzungsintensität des Computers hat im gleichen Zeitraum in privaten Haushalten ebenfalls zugenommen: verwendeten im Jahr 2003 62% der privaten Computernutzer den PC jeden Tag oder fast jeden Tag, so stieg der Anteil dieser regelmäßigen Nutzer 2008 auf 75%. Im Berufsleben erfordert der zunehmende Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien von Seiten der Beschäftigten immer mehr die Bereitschaft, sich die erforderlichen Kenntnisse für den Umgang mit Computern und dem Internet anzueignen.
Nur solche Unternehmen können im Innovationswettbewerb bestehen, die kompetente Fach- und Führungskräfte in ihren Unternehmen ausbilden, an das Unternehmen binden und ständig weiterqualifizieren. Die Mitarbeiter müssen stets in der Lage sein, die von Ihnen geforderten Leistungen und das Können, höchst komplexe Sachverhalte und Probleme zu lösen, zu 100% zu erbringen. Weiterbildung, also die Entwicklung der Fähigkeiten der Mitarbeiter, dient als Grundstein der erfolgreichen Unternehmensentwicklung und gewinnt immer mehr an Bedeutung.
Die Erbringung einer hochqualitativen Arbeit ist jedoch nur dann möglich, wenn die Arbeitnehmer entsprechende Qualifikationen aufweisen können. Solche Qualifikationen sind aber nur selten durch die Erstausbildung gegeben. Um einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil zu sichern und das nur schwer imitierbare implizite Wissen zu erlangen werden die Unternehmen ihre Mitarbeiter weiterbilden müssen, wenn sie in einem strengen Konkurrenzkampf für sich eine solide […]
In heutiger Zeit ist die computergestützte Datenverarbeitung aus keinem Unternehmen mehr wegzudenken. In Deutschland prägen moderne Informations- und Kommunikations-Technologien, allen voran Computer und Internet, immer mehr das Berufs- und Privatleben vieler Menschen. Dies geht aus den aktuellen Ergebnissen der Erhebungen des Statistischen Bundesamtes zur Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in Unternehmen und privaten Haushalten hervor. Angefangen mit einfacher Brieferstellung über Terminplanung bis hin zu komplexen Businesscase-Lösungen läuft alles fast nur noch digital. Der Anteil der Beschäftigten, die regelmäßig während ihrer Arbeitszeit einen Computer nutzen, ist seit Januar 2003 um 14 Prozentpunkte auf rund 60% im Januar 2008 gestiegen. Im privaten Bereich ist der Anteil der Personen ab zehn Jahren, die einen Computer im ersten Quartal des Jahres nutzten, im Jahr 2008 auf 76% gestiegen (2003: 64%). Die Nutzungsintensität des Computers hat im gleichen Zeitraum in privaten Haushalten ebenfalls zugenommen: verwendeten im Jahr 2003 62% der privaten Computernutzer den PC jeden Tag oder fast jeden Tag, so stieg der Anteil dieser regelmäßigen Nutzer 2008 auf 75%. Im Berufsleben erfordert der zunehmende Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien von Seiten der Beschäftigten immer mehr die Bereitschaft, sich die erforderlichen Kenntnisse für den Umgang mit Computern und dem Internet anzueignen.
Nur solche Unternehmen können im Innovationswettbewerb bestehen, die kompetente Fach- und Führungskräfte in ihren Unternehmen ausbilden, an das Unternehmen binden und ständig weiterqualifizieren. Die Mitarbeiter müssen stets in der Lage sein, die von Ihnen geforderten Leistungen und das Können, höchst komplexe Sachverhalte und Probleme zu lösen, zu 100% zu erbringen. Weiterbildung, also die Entwicklung der Fähigkeiten der Mitarbeiter, dient als Grundstein der erfolgreichen Unternehmensentwicklung und gewinnt immer mehr an Bedeutung.
Die Erbringung einer hochqualitativen Arbeit ist jedoch nur dann möglich, wenn die Arbeitnehmer entsprechende Qualifikationen aufweisen können. Solche Qualifikationen sind aber nur selten durch die Erstausbildung gegeben. Um einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil zu sichern und das nur schwer imitierbare implizite Wissen zu erlangen werden die Unternehmen ihre Mitarbeiter weiterbilden müssen, wenn sie in einem strengen Konkurrenzkampf für sich eine solide […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Vitali Fuchs
Trainingsevaluation-Nachhaltigkeit von Schulungsmaßnahmen im IT-Sektor
ISBN: 978-3-8366-4754-0
Herstellung: Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2010
Zugl. Universität Hamburg, Hamburg, Deutschland, Diplomarbeit, 2010
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und der Verlag, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplomica.de, Hamburg 2010
I
Inhaltsverzeichnis
A
BBILDUNGSVERZEICHNIS
___________________________________________________ VI
D
IAGRAMMVERZEICHNIS
___________________________________________________ VII
T
ABELLENVERZEICHNIS
___________________________________________________ VIII
A
BKÜRZUNGSVERZEICHNIS
___________________________________________________ IX
1 EINLEITUNG ______________________________________________________________ 1
1.1 P
ROBLEMSTELLUNG UND PERSÖNLICHE
M
OTIVATION
__________________________________ 1
1.2 G
ANG DER
U
NTERSUCHUNG
___________________________________________________ 4
TEIL A: THEORETISCHE GRUNDLAGEN ____________________________________________ 6
2 BILDUNGSCONTROLLING ___________________________________________________ 6
2.1 B
EGRIFF DES
B
ILDUNGSCONTROLLINGS
____________________________________________ 6
2.2 F
ORMEN UND
Z
IELE DES
B
ILDUNGSCONTROLLINGS
____________________________________ 9
2.3 P
ROBLEME UND
H
ERAUSFORDERUNGEN DES
B
ILDUNGSCONTROLLINGS
____________________ 13
3 PROZESS DES (WEITER-) BILDUNGSCONTROLLINGS _____________________________ 15
3.1 Z
IELDEFINITION
:
U
NTERNEHMENS
-
UND
I
NDIVIDUALZIELE
______________________________ 18
3.2 B
ILDUNGS
-/
Q
UALIFIKATIONSBEDARFSANALYSE
____________________________________ 19
3.2.1 A
DRESSATEN UND BETEILIGTE
A
KTEURE DER
B
EDARFSANALYSE
__________________________ 21
3.2.2 M
ETHODEN DER
Q
UALIFIKATIONSBEDARFSANALYSE
_________________________________ 23
3.2.2.1 Indirekte Methoden __________________________________________________ 24
3.2.2.2 Direkte Methoden____________________________________________________ 25
3.3 P
LANUNG UND
D
URCHFÜHRUNG VON
W
EITERBILDUNGSMAßNAHMEN
____________________ 27
3.4 E
XTERNE
W
EITERBILDUNGSMAßNAHMEN
_________________________________________ 29
3.4.1 R
OLLE DER
B
ILDUNGSEINRICHTUNG IM
B
ILDUNGS
(
CONTROLLING
)
PROZESS
_________________ 30
3.4.2 R
OLLE DER
T
RAINER IM
B
ILDUNGSPROZESS
_______________________________________ 32
3.4.3 V
OR
-
UND
N
ACHTEILE EXTERNER
W
EITERBILDUNGSMAßNAHMEN
_______________________ 34
3.5 L
ERNTRANSFER
(-P
ROZESS
),
F
EEDBACK UND
L
ERNERFOLG
______________________________ 36
3.6 I
NVESTITIONSERFOLG EINER
W
EITERBILDUNGSMAßNAHME ERMITTELN
_____________________ 39
3.7 Z
USAMMENFASSUNG
______________________________________________________ 40
II
TEIL B: TRAININGSEVALUATION ________________________________________________ 42
4 EVALUATION ____________________________________________________________ 42
4.1 B
EGRIFF DER
E
VALUATION
___________________________________________________ 42
4.2 V
ON
E
VALUATION ZUR
T
RAININGSEVALUATION
_____________________________________ 45
4.3 G
EGENÜBERSTELLUNG VON
B
ILDUNGSCONTROLLING UND
T
RAININGSEVALUATION
_____________ 47
4.4 M
ÖGLICHKEITEN ZUR
T
RAININGSEVALUATION
______________________________________ 50
5 MODELLE DER TRAININGSEVALUATION _______________________________________ 52
5.1 V
IER
-E
BENEN
-M
ODELL NACH
D
ONALD
L.
K
IRKPATRICK
_______________________________ 52
5.1.1 L
EVEL
1:
R
EACTION
_______________________________________________________ 53
5.1.2 L
EVEL
2:
L
EARNING
_______________________________________________________ 53
5.1.3 L
EVEL
3:
B
EHAVIOUR
______________________________________________________ 54
5.1.4 L
EVEL
4:
R
ESULTS
________________________________________________________ 56
5.1.5 K
RITISCHE
W
ÜRDIGUNG
____________________________________________________ 57
5.2 R
ETURN ON
I
NVESTMENT IN DER
P
ERSONALENTWICKLUNG
(J
ACK
J.
P
HILLIPS
) ________________ 58
5.2.1 D
ER
5-S
TUFEN
E
VALUATIONSPROZESS NACH
J
ACK
J.
P
HILLIPS
___________________________ 58
5.2.2 D
ER
ROI-P
ROZESS
_______________________________________________________ 62
5.2.2.1 Evaluationsplanung ___________________________________________________ 62
5.2.2.2 Datenerfassung ______________________________________________________ 63
5.2.2.3 Isolierung der Effekte _________________________________________________ 66
5.2.2.4 Finanzielle Bewertung _________________________________________________ 68
5.2.2.5 Immaterielle Werte ___________________________________________________ 70
5.2.2.6 Kosten _____________________________________________________________ 71
5.2.2.7 Den Return on Investment berechnen ____________________________________ 72
5.2.2.8 Der Ergebnisbericht ___________________________________________________ 74
5.2.3 K
RITISCHE
W
ÜRDIGUNG DES
5-S
TUFEN
E
VALUATIONSPROZESSES
________________________ 75
5.3 V
OM
R
ETURN ON
I
NVESTMENT ZUM
V
ALUE OF
I
NVESTMENT
(H
ERBERT
J.
K
ELLNER
) ____________ 77
5.3.1 D
AS
VOI-S
YSTEM VON
H
ERBERT
J.
K
ELLNER
______________________________________ 78
5.3.1.1 Phase 1: GoalNavigator ________________________________________________ 79
5.3.1.2 Phase 2: QuickCheck __________________________________________________ 79
5.3.1.3 Phase 3: Der ValueFinder ______________________________________________ 80
5.3.1.4 Phase 4: ProjectMapping_______________________________________________ 81
5.3.1.5 Phase 5: PrecisionTraining______________________________________________ 81
5.3.1.6 Phase 6: ResultTracker ________________________________________________ 82
5.3.2 K
RITISCHE
W
ÜRDIGUNG
____________________________________________________ 83
III
TEIL C: EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG __________________________________________ 86
6 EINLEITUNG _____________________________________________________________ 86
6.1 V
ORÜBERLEGUNGEN UND PERSÖNLICHE
M
OTIVATION
________________________________ 86
6.2 G
ANG DER EMPIRISCHEN
U
NTERSUCHUNG
________________________________________ 88
6.2.1 F
ELDSTUDIE
____________________________________________________________ 88
6.2.2 I
NTERVIEWS
____________________________________________________________ 88
6.2.3 T
EILNEHMERBEFRAGUNG
___________________________________________________ 89
6.2.4 H
YPOTHESEN AUFSTELLEN
__________________________________________________ 89
6.2.5 P
RÄSENTATION DER
E
RGEBNISSE
______________________________________________ 89
6.2.6 A
BSCHLIEßENDES
E
XPERTEN
-I
NTERVIEW
_________________________________________ 90
6.2.7 S
CHLUSSFOLGERUNG UND
Z
USAMMENFASSUNG VORLIEGENDER
E
RGEBNISSE
________________ 90
7 FELDSTUDIE _____________________________________________________________ 90
7.1 A
USGANGSSITUATION
______________________________________________________ 91
7.2 A
UFBAU UND
D
URCHFÜHRUNG DER
T
RAININGSMAßNAHME
____________________________ 93
7.3 U
NTERSUCHUNGSERGEBNIS
__________________________________________________ 94
7.4 Z
USAMMENFASSUNG UND
S
CHLUSSFOLGERUNG FÜR DIE EMPIRISCHE
U
NTERSUCHUNG
_________ 97
8 VORSTELLUNG DES UNTERNEHMENS NEW HORIZONS HAMBURG GMBH____________ 98
9 EXPERTEN-INTERVIEWS ____________________________________________________ 99
9.1 I
NTERVIEW MIT
J
ÖRG
S
IEVERS
_________________________________________________ 99
9.2 I
NTERVIEW MIT
L
UTZ
W
EIGELT
_______________________________________________ 103
9.3 I
NTERVIEW MIT
J
ÖRN
O
ELZE
_________________________________________________ 105
9.4 Z
USAMMENFASSUNG UND
S
CHLUSSFOLGERUNG IM
H
INBLICK AUF DIE EMPIRISCHE
S
TUDIE
______ 106
10 EMPIRISCHE STUDIE ____________________________________________________ 108
10.1 U
NTERSUCHUNGSDESIGN
__________________________________________________ 110
10.2 A
UFBAU UND
I
NHALT DES
F
RAGEBOGENS
_______________________________________ 111
10.3 D
ER
S
EMINARERWARTUNGSBOGEN
___________________________________________ 113
10.3.1 K
ONSTRUKTION DES
S
EMINARERWARTUNGSBOGENS
______________________________ 113
10.3.2 E
INLEITUNG IN DAS
T
HEMA
_______________________________________________ 113
10.3.3 A
USWAHL DER
F
RAGEN
__________________________________________________ 114
10.3.4 F
ORMULIERUNG DER
F
RAGEN
______________________________________________ 115
10.3.5 K
ÜRZE DES
F
RAGEBOGENS
________________________________________________ 116
10.3.6 G
ESTALTUNG DES
F
RAGEBOGENS
___________________________________________ 117
IV
10.3.7 A
UFBAU UND
I
NHALT DES
S
EMINARERWARTUNGSBOGENS
___________________________ 117
10.3.8 F
RAGEN ZUR
P
ERSON
____________________________________________________ 119
10.3.9 P
ERSÖNLICHE
M
OTIVATION
_______________________________________________ 121
10.3.10 P
ERSÖNLICHE
E
RWARTUNGSHALTUNG AN DEN
K
URS
_____________________________ 122
10.3.11 G
EWÜNSCHTER
L
ERNERFOLG
_____________________________________________ 124
10.4 D
ER
S
EMINARBEWERTUNGSBOGEN
___________________________________________ 125
10.4.1 K
ONSTRUKTION DES
S
EMINARBEWERTUNGSBOGENS
_______________________________ 125
10.4.2 A
UFBAU UND
I
NHALT DES
S
EMINARBEWERTUNGSBOGENS
___________________________ 126
10.4.2.1 Kursleiter _________________________________________________________ 127
10.4.2.2 Allgemeine Zufriedenheit ____________________________________________ 128
10.4.2.3 Lernerfolg ________________________________________________________ 129
10.4.2.4 Auswirkungen der Kursteilnahme ______________________________________ 130
10.5 A
BLAUF DER EMPIRISCHEN
U
NTERSUCHUNG
_____________________________________ 131
10.6 D
ATENERHEBUNG
_______________________________________________________ 134
10.7 A
UFSTELLUNG DER
H
YPOTHESEN
_____________________________________________ 137
10.8 A
USWERTUNG DER
F
RAGEBÖGEN
____________________________________________ 140
10.8.1 M
ETHODISCHES
V
ORGEHEN BEI DER
F
RAGEBOGENAUSWERTUNG
______________________ 140
10.8.2 G
RUNDLAGEN ANGEWANDTER STATISTISCHER
V
ERFAHREN
__________________________ 140
10.9 P
RÄSENTATION UND
I
NTERPRETATION DER
U
NTERSUCHUNGSERGEBNISSE
_________________ 145
10.9.1 A
USPRÄGUNGEN UND
E
IGENSCHAFTEN DER
S
TICHPROBEN
___________________________ 145
10.9.2 H
YPOTHESENPRÜFUNG
__________________________________________________ 150
10.9.3 E
RGEBNISSE MIT EINEM
B
EZUG ZUR
N
ACHHALTIGKEIT DER
IT-T
RAININGS
_________________ 159
11 ABSCHLIEßENDES EXPERTEN-INTERVIEW ____________________________________ 164
11.1 V
ORBEMERKUNGEN ZUM
I
NHALT UND
A
BLAUF DES
I
NTERVIEWS
_______________________ 164
11.2 E
RGEBNISBESPRECHUNG UND ABSCHLIEßENDES
E
XPERTEN
-I
NTERVIEW MIT
L
UTZ
W
EIGELT
_____ 164
12 ZUSAMMENFASSUNG UND KRITISCHE WÜRDIGUNG DER GESAMTEN ARBEIT ______ 169
L
ITERATURVERZEICHNIS
_____________________________________________________ X
V
Abbildungsverzeichnis
A
BBILDUNG
1:
"P
ROZESS DES
B
ILDUNGSCONTROLLINGS
" ______________________________ 15
A
BBILDUNG
2:
(W
EITER
-)
B
ILDUNGSCONTROLLING ALS ZYKLISCHER
P
ROZESS
_________________ 18
A
BBILDUNG
3:
Q
UALIFIKATIONSBEDARFSERMITTLUNG
________________________________ 20
A
BBILDUNG
4:
"D
IE AN DER
Q
UALIFIKATIONSBEDARFSANALYSE BETEILIGTEN
P
ERSONENGRUPPEN
" __ 21
A
BBILDUNG
5:
S
CHEMA DER INDIREKTEN
E
RMITTLUNGSMETHODEN DES
Q
UALIFIKATIONSBEDARFS
___ 25
A
BBILDUNG
6:
S
CHEMA DER DIREKTEN
E
RMITTLUNGSMETHODEN DES
Q
UALIFIKATIONSBEDARFS
____ 26
A
BBILDUNG
7:
I
NFORMATIONSDEFIZITE ANHAND DER
5
E
VALUATIONSSTUFEN
________________ 61
A
BBILDUNG
8:
D
ER
ROI-P
ROZESS
_____________________________________________ 62
A
BBILDUNG
9:
R
ETURN ON
I
NVESTMENT
(ROI)
-
B
EISPIELE
,
WAS GEMESSEN WIRD
_____________ 84
A
BBILDUNG
10:
V
ALUE OF
I
NVESTMENT
(VOI)
-
B
EISPIELE
,
WAS GEMESSEN WIRD
_____________ 84
A
BBILDUNG
11:
E
NTSCHEIDUNGSKETTE BEI DER
D
URCHFÜHRUNG VON
IT-T
RAININGSMAßNAHMEN
_ 102
A
BBILDUNG
12:
D
ARSTELLUNG DER DESKRIPTIVEN
S
TATISTIKEN DER
PASW-A
USGABE FÜR GEPAARTE
S
TICHPROBEN
_______________________________________________ 151
A
BBILDUNG
13:
D
ARSTELLUNG DER
K
ORRELATIONEN ZWISCHEN DEN
M
ESSWERTREIHEN DER
PASW-
A
USGABE FÜR GEPAARTE
S
TICHPROBEN
______________________________ 151
A
BBILDUNG
14:
D
ARSTELLUNG DER
S
IGNIFIKANZ UND DER T
-W
ERTE DER
PASW-A
USGABE FÜR
GEPAARTE
S
TICHPROBEN
________________________________________ 152
A
BBILDUNG
15:
H
YPOTHESE
3.
D
ARSTELLUNG DER DESKRIPTIVEN
S
TATISTIKEN DER
PASW-A
USGABE FÜR
GEPAARTE
S
TICHPROBEN
________________________________________ 157
A
BBILDUNG
16:
H
YPOTHESE
3:
D
ARSTELLUNG DER
K
ORRELATIONEN ZWISCHEN DEN
M
ESSWERTREIHEN
DER
PASW-A
USGABE FÜR GEPAARTE
S
TICHPROBEN
_____________________ 158
A
BBILDUNG
17:
H
YPOTHESE
3:
D
ARSTELLUNG DER
S
IGNIFIKANZ UND DER T
-W
ERTE DER
PASW-
A
USGABE FÜR GEPAARTE
S
TICHPROBEN
______________________________ 158
VI
Diagrammverzeichnis
D
IAGRAMM
1:
Z
UFRIEDENHEIT NACH
S
EMINARLEVEL
________________________________ 156
D
IAGRAMM
2:
E
RWARTETE UND GESCHÄTZTE
E
RGEBNISSE BEZÜGLICH DES
W
ISSENSTRANSFERS IN DIE
P
RAXIS
____________________________________________________ 160
VII
Tabellenverzeichnis
T
ABELLE
1:
G
EGENÜBERSTELLUNG WICHTIGER
M
ERKMALE VON
B
ILDUNGSCONTROLLING UND
T
RAININGSEVALUATION
____________________________________________ 48
T
ABELLE
2:
5
E
VALUATIONSSTUFEN UND DEREN
Z
USAMMENHANG
_______________________ 60
T
ABELLE
3:
M
ETHODEN ZUR
D
ATENERFASSUNG
____________________________________ 64
T
ABELLE
4:
V
IERSTUFIGER
T
EST ZUR
K
ONVERTIERUNG VON
D
ATEN IN MONETÄRE
W
ERTE
_________ 70
T
ABELLE
5:
K
OSTENKATEGORIEN BEI
T
RAININGPROGRAMMEN
___________________________ 72
T
ABELLE
6:
E
VALUATIONSZIEL JE
S
TUFE
__________________________________________ 73
T
ABELLE
7:
E
NTSCHEIDUNGSMÖGLICHKEITEN BEIM
A
LTERNATIVTEST
_____________________ 142
T
ABELLE
8:
B
ILDUNGSGRAD
________________________________________________ 145
T
ABELLE
9:
P
ERSÖNLICHE
E
RFAHRUNG
_________________________________________ 147
T
ABELLE
10:
B
ILDUNGSGRAD UND PERSÖNLICHE
E
RFAHRUNG
__________________________ 148
T
ABELLE
11:
P
ERSÖNLICHE
M
OTIVATION
_______________________________________ 149
T
ABELLE
13:
C
HI
-Q
UADRAT
-T
EST
,
E
RWARTETE UND BERECHNETE
W
ERTE
__________________ 153
T
ABELLE
14:
C
HI
-Q
UADRAT
-T
EST
,
C
HI
-Q
UADRAT
-T
ESTS
_____________________________ 154
T
ABELLE
15:
C
HI
-Q
UADRAT
-T
EST
,
S
YMMETRISCHE
M
AßE
____________________________ 154
T
ABELLE
16:
A
LLGEMEINE
E
RWARTUNGSHALTUNG VOR DEM
IT-T
RAINING
_________________ 162
T
ABELLE
17:
A
LLGEMEINE
E
RWARTUNGSHALTUNG NACH DEM
IT-T
RAINING
________________ 163
VIII
Abkürzungsverzeichnis
Abb.
Abbildung
Abs.
Absatz
Aufl.
Auflage
Bd.
Band
BC
Bildungscontrolling
bspw. Beispielsweise
Bsp.
Beispiel
bzw.
Beziehungsweise
ca.
circa
d.h.
das heißt
etc.
et cetera
evtl.
eventuell
f.
folgende
ff.
fortfolgende
gem.
gemäß
ggf.
gegebenfalls
ggü.
gegenüber
grds.
grundsätzlich
hrsg.
herausgegeben
Hrsg.
Herausgeber
i.A.a.
in Anlehnung an
i.d.R.
in der Regel
i.d.S.
in diesem Sinne
insb.
insbesondere
IX
MTM
Metrics that Matter
ROI
Return on Investment
S.
Seite
s.
siehe
s.a.
siehe auch
s.o.
siehe oben
sog.
so genannte
s.u.
siehe unten
SEB
Seminarerwartungsbogen
SBB
Seminarbewertungsbogen
u.a.
unter anderem
usw.
und so weiter
Vgl.
Vergleiche
VOI
Value of Investment
z.B.
zum Beispiel
z.T.
zum Teil
1
1
Einleitung
1.1
Problemstellung und persönliche Motivation
In heutiger Zeit ist die computergestützte Datenverarbeitung aus keinem
Unternehmen mehr wegzudenken. In Deutschland prägen moderne Informations- und
Kommunikations-Technologien, allen voran Computer und Internet, immer mehr das
Berufs- und Privatleben vieler Menschen. Dies geht aus den aktuellen Ergebnissen der
Erhebungen des Statistischen Bundesamtes zur Nutzung von Informations- und
Kommunikationstechnologien (IKT) in Unternehmen und privaten Haushalten hervor.
1
Angefangen mit ,,einfacher" Brieferstellung über Terminplanung bis hin zu komplexen
Businesscase-Lösungen läuft alles fast nur noch digital. Der Anteil der Beschäftigten,
die regelmäßig während ihrer Arbeitszeit einen Computer nutzen, ist seit Januar 2003
um 14 Prozentpunkte auf rund 60% im Januar 2008 gestiegen. Im privaten Bereich ist
der Anteil der Personen ab zehn Jahren, die einen Computer im ersten Quartal des
Jahres nutzten, im Jahr 2008 auf 76% gestiegen (2003: 64%). Die Nutzungsintensität
des Computers hat im gleichen Zeitraum in privaten Haushalten ebenfalls
zugenommen: verwendeten im Jahr 2003 62% der privaten Computernutzer den PC
jeden Tag oder fast jeden Tag, so stieg der Anteil dieser regelmäßigen Nutzer 2008 auf
75%.
2
Im Berufsleben erfordert der zunehmende Einsatz von Informations- und
Kommunikationstechnologien von Seiten der Beschäftigten immer mehr die
Bereitschaft, sich die erforderlichen Kenntnisse für den Umgang mit Computern und
dem Internet anzueignen.
Nur solche Unternehmen können im Innovationswettbewerb bestehen, die
kompetente Fach- und Führungskräfte in ihren Unternehmen ausbilden, an das
Unternehmen binden und ständig weiterqualifizieren. Die Mitarbeiter müssen stets in
der Lage sein, die von Ihnen geforderten Leistungen und das Können, höchst komplexe
Sachverhalte und Probleme zu lösen, zu 100% zu erbringen. Weiterbildung, also die
1
http://www.destatis.de, Abrufdatum:07.01.2009
2
http://www.destatis.de, Abrufdatum:07.01.2009
2
Entwicklung der Fähigkeiten der Mitarbeiter, dient als Grundstein der erfolgreichen
Unternehmensentwicklung und gewinnt immer mehr an Bedeutung.
Die Erbringung einer hochqualitativen Arbeit ist jedoch nur dann möglich, wenn die
Arbeitnehmer
entsprechende
Qualifikationen
aufweisen
können.
Solche
Qualifikationen sind aber nur selten durch die Erstausbildung gegeben. Um einen
nachhaltigen Wettbewerbsvorteil zu sichern und das nur schwer imitierbare implizite
Wissen zu erlangen werden die Unternehmen ihre Mitarbeiter weiterbilden müssen,
wenn sie in einem strengen Konkurrenzkampf für sich eine solide Marktposition
sichern wollen.
Doch die Praxis sieht meist anders aus. Vielerorts bleiben die Potenziale strategisch
zielorientierter Weiterbildung im EDV-Sektor unerkannt und ungenutzt. In der Zeit der
,,knappen Kassen" wollen deshalb viele Unternehmen erst dann in die Weiterbildung
der eigenen Mitarbeiter investieren, wenn der Nutzen und der daraus resultierende
Gewinn für das Unternehmen einer Weiterbildungsmaßnahme im EDV-Sektor bekannt
sind.
Die große gesellschaftliche, wirtschaftliche und individuelle Bedeutung der
Weiterbildung macht es notwendig, Instrumente zur Messung und Verbesserung der
Leistungsqualität zu entwickeln. Das Thema ,,Bildungscontrolling" spielt in diesem
Zusammenhang eine zentrale Rolle. In vielen Fällen wollen die Unternehmen keinen
externen Vergleich mit der Konkurrenz. Sie brauchen ein (Kennzahlen)System, mit dem
sie die Investition im Vergleich zu dem Output einer Weiterbildungsmaßnahme
vergleichen können, um aussagekräftige Kennzahlen
3
zu bekommen. Die Unternehmen
sind daran interessiert, die ,,Softskills", die so genannten weichen Faktoren einer
Weiterbildungsmaßnahme zu messen. In den meisten Unternehmen werden die
Feedbackbögen nach einem Seminar als Standardinstrument zur Abfrage der
Teilnehmerzufriedenheit verwendet. Leider endet aber häufig hier der
3
,,Unter Kennzahlen versteht man absolute Zahlen oder Verhältniszahlen. Während absolute Zahlen
auf Mengen- oder Wertgrößen basieren können, werden bei Verhältniszahlen
untersuchungsrelevante Größen zueinander in Beziehung gebracht."
3
Controllingansatz zur Bewertung der Weiterbildungsmaßnahme, weil weiterführende
Instrumente des Weiterbildungscontrollings nicht vorhanden sind.
Wie sollen die Unternehmen eine Weiterbildungsmaßnahme quantifizieren und
zahlenmäßig erfassen, wenn der theoretische Hintergrund des Bildungscontrollings
zwar in vielen Unternehmen bekannt ist, aber die Implementierung der einzelnen
Ebenen häufig an mangelnden zeitlichen und personellen Ressourcen innerhalb der
Unternehmen scheitert.
4
Das altbewährte und neu wiederentdeckte System nach Grundsätzen des Return on
Investment
(ROI)
kann
bei
der
Wirtschaftlichkeitsanalyse
einer
Weiterbildungsmaßnahme Abhilfe schaffen. Der erste rudimentäre ROI-Prozess wurde
bereits vor 20 Jahren entwickelt. Er basiert auf den vier Evaluationsstufen nach Donald
Kirkpatrick und wurde durch die 5. Stufe ergänzt den ROI.
5
Return on Investment
kann das Kosten/Nutzen-Verhältnis einer Personalentwicklungsmaßnahme berechnen,
um die Kostenvorteile darzustellen. Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn die
Gefahr besteht, dass in ,,schwierigen Zeiten" schnell das Budget gekürzt oder ganz
gestrichen werden kann. Was wiederum zur Folge hat, dass die Qualität der
Arbeitsleitung mit der Zeit abnehmen und das Unternehmen seine gute Marktstellung
evtl. verlieren kann.
Es gilt also den Nutzen einer Weiterbildungsmaßnahme aufzuzeigen und zu beweisen,
dass die Weiterbildungsmaßnahmen für die Unternehmen von strategischer
Bedeutung sind. Die Qualität der Arbeitsleistung und die Motivation der einzelnen
Mitarbeiter kann durch gezielte Weiterbildungsmaßnahmen gesteigert werden. Die
mit mangelnden Kenntnissen der Mitarbeiter verbundenen Ineffizienzen und
Fehlerquellen könnten ebenso durch gezielte Weiterbildungsmaßnahmen reduziert
oder gar beseitigt werden. Schließlich können die Unternehmen mit einem
4
Vgl. Albers 2007, S. 17; s. Hummel 1999
5
s. Schirmer 2006
4
Hochqualifizierten Team eigene, unternehmensinterne Ziele besser erreichen und so
im Konkurrenzkampf bestehen.
1.2
Gang der Untersuchung
Im ersten Teil der vorliegenden Arbeit beschäftigt sich der Autor mit den theoretischen
Grundlagen des Bildungscontrollings. Da das Thema ,,Trainingsevaluation-
Nachhaltigkeit von Schulungsmaßnahmen im IT-Sektor" weitestgehend das
Bildungscontrolling als Wissensgrundlage voraussetzt ist es besonders wichtig dem
Leser die Grundlagen des Bildungscontrollings näher zu bringen. So können später, im
Laufe der Arbeit viele Fachspezifische Begriffe bedenkenlos eingeführt und verwendet
haben.
Bevor der Kern der vorliegenden Arbeit - empirische Untersuchung, vorgestellt werden
kann, wird im zweiten Teil der Arbeit konkret auf die Trainingsevaluation eingegangen.
Wichtig ist sowohl die theoretische Darstellung dieses komplexen Themas als auch die
Darstellung anerkannter Modelle zur Trainingsevaluation. Die Modelle werden so
gewählt, dass der Leser einen breiten Horizont an Möglichkeiten kennen lernt, wie die
weiterbildungsmaßnahmen im IT-Sektor evaluiert werden können.
Im dritten Teil der Arbeit wird eine empirische Untersuchung durchgeführt, um den
Nachhaltigkeitseffekt einer Trainingsmaßnahme im IT-Sektor zu untersuchen. Dazu
sind einige Vorbereitungen notwendig. Zum einen wird eine Feldstudie mit den
Studenten der Universität Hamburg durchgeführt, um feststellen zu können, ob der
Erfolg einer IT-Trainingsmaßnahme ermittelt werden kann. Diese Feldstudie wird als
Ausgangspunkt die Untersuchungsschwerpunkte und die Richtung der empirischen
Studie maßgeblich beeinflussen. Zum anderen werden vor der Durchführung der
empirischen Studie, die in Zusammenarbeit mit New Horizons Computerlearning
Centers GmbH durchgeführt wird
6
, Experteninterviews mit den Gesellschaftern und
6
New Horizons ist ein auf IT-Training spezialisiertes Unternehmen. Qualität, Sicherheit, Service und
Flexibilität sind für das Unternehmen keine Lippenbekenntnisse, sondern das echte Bestreben bei
jeder Trainingseinheit. New Horizons ist in mehr als 56 Ländern mit mehr als 280 Trainingscentern
vertreten. Damit gehört das Unternehmen zu den größten IT-Trainingsanbietern weltweit. Mehrere
5
Geschäftsführern von New Horizons gemacht. Die Experteninterviews sollen mehr
Aufschluss darüber geben, wie die Trainingsevaluation im IT-Sektor zur Zeit (Frühjahr
2009) aussieht und welche Herausforderungen es in der Praxis zu bewältigen gilt, um
die Trainingsevaluation effizienter zu machen. Da New Horizons weltweit ihre
Teilnehmer nach Seminarende befragt und alle Bewertungen in einer zentralen
Datenbank speichert, können diese später für Untersuchungszwecke jederzeit
abgerufen und genutzt werde. Diese Daten stellt New Horizons dem Autor zur
Verfügung, um qualitativ und quantitativ hochwertige Ergebnisse zu erzielen. Durch
die Bereitstellung der Daten und ihrer Analyse soll eine Brücke zwischen Theorie,
Kennzahlensystem zur Bewertung und Quantifizierung der Weiterbildungsmaßnahmen
und der Praxis hergestellt werden.
Zum Schluss soll eine Zusammenfassung sowie kritische Würdigung der gesamten
Arbeit die Untersuchungsergebnisse mit der Theorie verbinden und dem Leser eine
Möglichkeit bieten sich mit dem Thema der Trainingsevaluation weiter zu
beschäftigen.
zehntausend Teilnehmer lassen sich in Deutschland haben sich 2006 bei New Horizons schulen
lassen und die Trainingsleistung anschließend mittels "MTM" Metrics that MatterTM bewertet.
6
Teil A: Theoretische Grundlagen
2
Bildungscontrolling
Bildung ist eine Investition in die Zukunft, die systematisch geplant, durchgeführt und
überprüft werden muss. Das Thema ,,Bildungscontrolling" genießt insbesondere im
Hinblick auf betriebliche Weiterbildung in der Theorie und Praxis aktuell eine große
Aufmerksamkeit.
7
In diesem Kapitel wird der Begriff des Bildungscontrollings in seinen
wichtigsten Zügen erläutert und es wird auf die Ziele, Probleme sowie
Herausforderungen vor denen das Bildungscontrolling in der Praxis steht eingegangen.
2.1
Begriff des Bildungscontrollings
Bildungscontrolling ist eine spezielle Form des Controllings von Bildungsaktivitäten wie
z.B. Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen.
8
Die berufliche oder betriebliche Fortbildung wird als Fortsetzung der fachlichen
Ausbildung während der Berufsausübung verstanden. Sie hat zum Ziel, die Kenntnisse
und Fertigkeiten der Mitarbeiter ständig zu aktualisieren und Qualifikationsdefizite
aufgrund sich veränderter Anforderungen des Arbeitsplatzes auszugleichen.
9
Damit ist
die Fortbildung die Gesamtheit aller ,,Maßnahmen zur Verbesserung der Qualifikation
von Mitarbeitern am vorhandenen Arbeitsplatz".
10
Im Gegensatz zur Fortbildung wird unter dem Begriff Weiterbildung die Gesamtheit
nicht arbeitsplatzbezogener Bildungsmaßnahmen nach Abschluss einer unterschiedlich
ausgedehnten ersten Bildungsphase zur beruflichen Kompetenzentwicklung
bezeichnet.
11
Die betriebliche Weiterbildung geht über die Vermittlung rein fachlicher
7
Vgl. Meier/Kraemer/Sprenger 2006, S. 190f.
8
s. Krekel/von Bardeleben 2001
9
s. Hummel 1999, S.12
10
s. Brauwer/Rumpel 2008, S. 23
11
Vgl. Schiersmann 2008, S. 40; Brauwer/Rumpel 2008, S. 23
7
Qualifikationen zur Ausübung der derzeitigen Arbeitsaufgabe hinaus und versucht,
auch allgemeine Kenntnisse und Fertigkeiten zu vertiefen oder zu erweitern.
12
In diesem Zusammenhang kann der Begriff des Bildungscontrollings in vielerlei Hinsicht
interpretiert werden, dies wird auch aus der Vielzahl von Ansätzen deutlich, die unter
dem
Begriff
Bildungscontrolling
subsumiert
werden,
z.
B.
Personalentwicklungscontrolling,
Weiterbildungscontrolling
oder
Lernerfolgscontrolling. Becker umschreibt das Bildungscontrolling folgendermaßen:
,,Bildungscontrolling
soll
als
ganzheitlich-integratives
Instrument
der
Unternehmensführung den erreichten und/oder erwarteten Bildungsnutzen in
Relation zu den vorgegebenen Bildungszielen und den eingesetzten Ressourcen
evaluieren. Das Bildungsgeschehen soll dabei mit den Unternehmens- und
Mitarbeiterzielen verbunden werden."
13
Damit ist Bildungscontrolling ein Verfahren,
"mit dem Unternehmen versuchen, ihre betrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen auf
die Unternehmensziele auszurichten, um frühzeitige Qualifikationen auszubilden (die
der Betrieb für seine künftigen Arbeitsabläufe in Produktion und Dienstleistung
benötigt) und günstige Kosten-Nutzen-Relationen herzustellen."
14
Betriebliches
Weiterbildungscontrolling ist folglich ein Instrument zur ziel- und ergebnisorientierten
Planung, Gestaltung und Steuerung der betrieblichen Weiterbildung. Somit bedeutet
das Bildungscontrolling nicht nur das Herstellen von Transparenz zu Kosten und
Ergebnissen im Verlauf des Bildungsprozesses, sondern wird im umfassenderen Sinn
als Entscheidungsunterstützung und Erfolgssteuerung verstanden.
15
Die Aufgabe, die
das Bildungscontrolling dabei übernimmt lautet: Prozesse und Ergebnisse zielgerichtet
zu steuern und korrigierend einzugreifen.
12
s. Hummel 1999, S.12
13
Becker 1993, S. 127
14
Krekel/Gnahs 2000, S 11
15
Vgl. Meier/Kraemer/Spengler 2006, S. 191
8
Die Möglichkeiten von Bildungscontrolling können durch vier Funktionsfelder
beschrieben werden:
16
Die Informationsfunktion betrifft die Erfassung, Aufbereitung und Analyse von Daten
zur Messung von In- und Outputparametern, etwa die Ziele der Seminarteilnehmer
und die Ergebnisse von Feedbackbögen. Notwendig dazu sind geeignete Kennzahlen.
Die Planungsfunktion des Bildungscontrollings umfasst die Kalkulation des zu
erwartenden finanziellen Aufwands, z.B. Ausfall der Mitarbeiter, Schulungsräume,
Verpflegung und Trainer sowie die Formulierung von Zielvorgaben für Leistungen und
Prozesse.
Durch seine Kontrollfunktion hilft das Bildungscontrolling, den Erfolg von
Weiterbildungsmaßnahmen zu überprüfen. Aufgrund von Kennzahlen können Sie den
Erfolg bewerten und bei Abweichungen die Ursachen ermitteln.
Mit Hilfe der Steuerungsfunktion ist es möglich die Leistungsprozesse zu optimieren
und die Qualität der Bildungsarbeit zu verbessern.
Bildungscontrolling umfasst damit alle Aktivitäten zur Planung, Steuerung und
Bewertung von Bildungsprozessen und ist funktional betrachtet ein Subsystem des
Personalcontrollings.
17
Es unterstützt damit auch Personalentwicklung und
Personalmanagement innerhalb des Unternehmens. Um Bildungsaktivitäten
durchführen zu können, muss ein effizientes Informationssystem zur Verfügung
stehen.
18
Durch das Bildungscontrolling sollen solche Informationen bereitgestellt
werden, mit deren Hilfe die vorhandenen Qualifikationsdefizite beim Personal erkannt
und mittels geeigneter Maßnahmen beseitigt werden können.
19
16
s. Meier 2008, S. 13 f.
17
Vgl. Hummel 1999, S 19
18
Vgl. Schulze 2007, S. 5
19
s. Albers 2007, S. 17
9
2.2
Formen und Ziele des Bildungscontrollings
Man unterscheidet zwei Formen des Bildungscontrollings. Dies sind zum einen das
quantitative und zum anderen das qualitative Bildungscontrolling.
20
Quantitatives Bildungscontrolling stellt Sachverhalte dar, die zahlenmäßig eindeutig
erfassbar sind. In dieser Hinsicht geht es um Kosten-, Erfolgs- und
Rentabilitätskontrollen und betriebswirtschaftliche Datenanalysen.
21
Beispiele hierfür
sind Bildungsinvestitionen im Rahmen der Budgetierung, das Volumen des
Weiterbildungsbedarfs und die Frequentierung verschiedener Maßnahmen. Die
Controllingaufgaben umfassen dabei im wesentlichen die Erstellung von abteilungs-
und mitarbeiterbezogenen sowie bedarfsorientierten Bildungsplänen, den Abgleich
der Bildungsmaßnahmen mit der strategischen Planung, die Zuordnung der
Gesamtkosten einer Weiterbildungsmaßnahme zu den einzelnen Teilprozessen der
Wertschöpfungskette und die Kontrolle der gesamten Weiterbildungskosten eines
Unternehmens.
22
Qualitatives Bildungscontrolling betrachtet die nicht objektiv messbaren Zielgrößen
des Bildungswesens und ist daher den subjektiven Kriterien unterlegen. Beispiele
hierzu sind die Einstellung der Mitarbeiter zu Bildungsmaßnahmen, Leistungs- und
Potentialbeurteilungen, qualitative Trends und das Organisationsklima. Darüber hinaus
werden
vom
qualitativen
Bildungscontrolling
folgende
Aspekte
umfasst:
Kommunikationsverbesserung,
Kooperation,
Teamfähigkeit,
Kreativität,
Arbeitszufriedenheit etc. Zu den Aufgaben des qualitativen Bildungscontrollings zählt
die Evaluation
23
von Bildungsmaßnahmen. Controllingobjekte sind zum Beispiel die
20
Vgl. Landsberg 1995, S. 13-15
21
Vgl. Edler/Kailer 1995, S 270
22
Vgl. Hummel 1999, S 19
23
Als Fachbegriff im Bildungsbereich bedeutet Evaluation gemäß der Definition von J. Reischmann
"das Erfassen und Bewerten von Prozessen und Ergebnissen zur Wirkungskontrolle, Steuerung und
Reflexion im Bildungsbereich." (Reischmann 2006, S. 18)
10
Überprüfung der dargebotenen Inhalte, Trainerkompetenzen und didaktische
Vorgehensweise, Seminarbeurteilungsbögen und Transferkontrolle.
24
Weiterhin hat sich in der Praxis die Unterscheidung zwischen strategischem und
operativem Bildungscontrolling eingebürgert.
Vom strategischen Bildungscontrolling spricht man, wenn geprüft werden soll, ob die
Ziele und Schwerpunkte der Bildungsarbeit auch richtig gesetzt wurden, d.h. auf die
strategischen Unternehmensziele abgestimmt sind. Zu strategischen Zielen eines
Unternehmens im Bereich der Bildungsarbeit können bspw. der Ausbau und Erhalt von
strategischen Wettbewerbsvorteilen durch qualifizierte Human-Ressourcen stehen.
Aus diesem Grund sind die Maßnahmen im strategischen Bildungscontrolling durch
eine langfristige Perspektive von fünf bis zehn Jahren ausgelegt.
25
,,Strategisches
Bildungscontrolling
befasst
sich
also
mit
den
Umfeldeinflüssen
auf
Bildungsmaßnahmen und umgekehrt mit dem Beitrag der Bildung zur Lösung von
Problemen im Umfeld (Unternehmen, Märkte, Politik usw.)."
26
Während der Analyse
solcher Wechselwirkungen werden Ansatzpunkte für ihre Optimierung identifiziert.
Der Fokus des Bildungscontrollings kann dabei auf der Erfüllung gegebener Strategien
oder auf Gestaltung neuer Strategien liegen. Beim Fokus ,,Strategieerfüllung" werden
Bildungsprozesse daraufhin überprüft, ob sie zur Umsetzung von vorgegebenen
Systemzielen Unternehmenszielen, arbeitsmarktpolitischen Zielen usw. optimal
beitragen. Beim Fokus ,,Strategiegestaltung" steht die Frage im Vordergrund, welche
beruflichen Schlüsselqualifikationen vorausschauend zu fördern sind, um neue
strategische Aktionsmöglichkeiten der Organisation, neue Entwicklungspfade für die
Branche, die Region oder den Arbeitsmarkt zu unterstützen.
27
Geht es vornehmlich darum, betrieblich erforderliche Bildungsarbeit möglichst
effizient zu gestalten, so spricht man vom operativen Bildungscontrolling. Das
24
Vgl. Hummel 1999, S 22
25
Vgl. Dillerup /Hannuss 2004, S. 5 ff; Vgl. Meier 2008, S 15
26
Schöni 2006, S. 40
27
Vgl. Einsiedler et al. 2003, S. 14 f; Schöni 2001, S 38 f
11
operative Bildungscontrolling ergänzt das strategische Bildungscontrolling, wenn es
darum geht die wirtschaftliche Rechtfertigung einer Weiterbildungsmaßnahme zu
begründen. ,,Operatives Bildungscontrolling fragt nach der Effizienz, der
Wirtschaftlichkeit von Bildungsmaßnahmen"
28
und wird eher als kurzfristiger
Steuerungsprozess verstanden. Sein Zeithorizont orientiert sich am Jahresablauf, seine
Bezugsgrößen sind kurz- bis mittelfristig beeinflussbar.
29
Zur genauen Beschreibung
von Bildungsprozessen werden durch das operative Controlling Schlüsselgrößen
(Parameter) definiert. Zu den Schlüsselgrößen, mit denen sich Bildungsprozesse
beschreiben, beurteilen oder steuern lassen, gehören:
30
Input-Parameter: verfügbare Ressourcen der Bildungsarbeit,
Output-Parameter: Effekte der Bildungsarbeit,
Ist-Qualifikation: vorhandenes Nivea der Ausbildung, vorhandenes Know-how,
Soll-Qualifikation: angestrebtes oder vorgeschriebenes Niveau der Ausbildung.
Hier stehen Instrumente wie z.B. die Qualifikationsbedarfsanalyse, die Kostenanalyse
oder Kennzahlenanalyse im Vordergrund. Mit solcher Methodik können die
Zielvorgaben für die Bildungsprozesse formuliert und die Erreichung der Zielvorgaben
überprüft werden. Die Schlüsselgrößen (bzw. Parameter) können qualitative oder
quantitative Ausprägungen aufweisen. Entscheidend ist, dass diese so operationalisiert
werden, dass sie für die beteiligten Akteure nachvollziehbar sind. So lässt sich der
Input-Parameter ,,Know-how der Bildungseinrichtung" durch die Anzahl der
zertifizierten Trainer und Trainerinnen im Unternehmen beschreiben. Der Output-
Parameter ,,Erfolg des Schulungsprogramms" kann personenbezogen als Ausmaß
individuellen Lernfortschritts oder als Zufriedenheitsquote der befragten Kunden
definiert sein.
31
28
Meier 2008, S 15
29
s. Einsiedler et al. 2003, S. 235 f.; Wunderer & Schlagenhaufer 1994, S. 9
30
s. Schöni 2006, S 39
31
Vgl. Schöni 2006, S. 39
12
Zusammenfassend können wir sagen, dass das strategische Controlling nach den Zielen
fragt und damit nach der Effektivität, d.h. ,,Tun wir die Richtigen Dinge?". Das
operative Controlling beschäftigt sich mit den Prozessen und mit der Frage nach der
Effizienz, d.h. ,,Tun wir die Dinge richtig?"
32
Von der Planung über die Durchführung bis hin zur Kontrolle überprüft das
Bildungscontrolling mit geeigneten Messgrößen und Kriterien, ob die Bildungsarbeit
methodisch effektiv und wirtschaftlich effizient ist.
33
Oberstes Ziel des
Bildungscontrollings ist dabei, durch die adäquate Qualifikation der Mitarbeiter
strategische Wettbewerbsvorteile gegenüber den Mitbewerbern zu erlangen und
langfristig zu sichern.
34
Weiterhin möchte das Bildungscontrolling die ziel- und
ergebnisorientierte
Planung,
Gestaltung
und
Steuerung
von
Fort-
und
Weiterbildungsmaßnahmen in Betrieben und Unternehmen gezielt unterstützen. Ziel
ist hier die Herstellung von Transparenz, Effektivität und Effizienz des betrieblichen
Bildungsgeschehens. Weitere Ziele des Bildungscontrollings können wie folgt
zusammengefasst werden:
die verbesserte Koordination von Bildungszielen,
die verbesserte inhaltliche Steuerung von Bildungsaktivitäten und
die Steigerung der Leistungsfähigkeit der betrieblichen Weiterbildung insgesamt.
35
Dabei müssen sich die Ziele des Bildungscontrollings stets an den Unternehmenszielen
ausrichten. Die Beliebigkeit der Bildungsdienstleistungen fällt damit weg. Es kann und
darf somit keine Weiterbildungsmaßnahmen mehr geben, bei denen es nicht klar ist,
welches Ziel sie haben und welchem Zweck sie bei der Weiterentwicklung des
Unternehmens dienen.
36
32
Vgl. Meier 2008, S. 15
33
Vgl. Meier 2008, S. 13
34
Vgl. Hummel 1999, S 28
35
Vgl. Meier/Kraemer/Sprenger 2006, S. 191 f.
36
Vgl. Hummel 1999, S 28
13
2.3
Probleme und Herausforderungen des Bildungscontrollings
Im vorherigen Kapitel wurde gezeigt, dass die Abstimmung der in einem Unternehmen
angebotenen Weiterbildungsmaßnahmen auf die Unternehmensstrategie und damit
verfolgten Unternehmensziele ein wesentliches Ziel des Bildungscontrollings ist.
Basierend auf diesen Unternehmenszielen müssen Abteilungs- und Individualziele
vereinbart werden. Die Abstimmung der Unternehmensziele auf die individuellen Ziele
der Mitarbeiter ist unabdingbar. Ohne das Einbeziehen der Mitarbeiterziele kann es zu
einer mangelhaften Motivation der Mitarbeiter kommen, was sich häufig negativ auf
den Erfolg der Weiterbildungsmaßnahme auswirkt. Im Allgemeinen gilt: ,,Maßnahmen,
die nicht halten, was sie versprechen, hinterlassen frustrierte Teilnehmer, die mit der
Zeit Seminarmüde werden und vielleicht ihre weiteren Projekte boykottieren".
37
Die meisten Betriebe schätzen das Bildungscontrolling als eine permanente Aufgabe im
betrieblichen Bildungsprozess ein. Sie gehen davon aus, dass Bildungscontrolling ein
wichtiges Steuerungsinstrument für die Bereitstellung künftiger Qualifikationen ist und
in Zukunft an Bedeutung gewinnen wird. Konkret steht dem gegenüber, dass das
Bildungscontrolling bisher nur in wenigen Unternehmen tatsächlich Anwendung
findet.
38
Obwohl in den Weiterbildungsabteilungen von Großunternehmen die
Bedeutung des Bildungscontrollings allgemein erkannt wurde, klafft nach wie vor eine
große Lücke zwischen Konzepten in der Theorie und deren Einsatz in der Praxis. In
einer Studie zum Thema ,,Effektivität der betrieblichen Weiterbildung, Einsatz von
Controllingelementen"
39
, die vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) in Auftrag
gegeben wurde, wurde gezeigt, dass es einen sehr engen Zusammenhang zwischen
dem Einsatz von Elementen des Bildungscontrollings und der Unternehmensgröße
gibt. Aus der Studie geht hervor, dass bei 56% aller Kleinunternehmen (1-49
Mitarbeiter) in Deutschland kein Einsatz von Bildungscontrolling existiert, bei Mittleren
Unternehmen (50-499 Mitarbeiter) sind es 51% und bei den großen Unternehmen
37
Kellner 2006, S 68
38
Vgl. Faulstich 2005, S. 5
39
Beicht & Krekel 1999
14
(mehr als 500 Mitarbeiter) waren es 37%, die kein Bildungscontrolling einsetzen.
40
Schöni geht davon aus, dass dieser Größeneffekt damit zusammenhängt, dass ,,die
Erzeugung von Controlling-Informationen einen minimalen Grad der Strukturierung
und Formalisierung von Prozessen der Bildungsarbeit erfordert, der erst in
Mittelgroßen und großen Unternehmen gegeben ist".
41
Ehlers und Schenkel kritisieren,
dass die praktische Anwendung der theoretischen Ansätze sich oftmals als zu sehr
ausgereift und praxisfern erweist.
42
Bei der Rentabilitätskontrolle und der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung einer
Weiterbildungsmaßnahme gibt es aus der Kostensicht weniger Probleme, als aus der
Nutzensicht. Die verschiedenen Kostenarten und deren Umfang können ziemlich
genau ermittelt werden. Im Gegensatz zu den Kosten ist der Nutzen und damit
verbundener Erfolg einer Weiterbildungsmaßnahme nur schwer feststellbar. Die
Zurechenbarkeit des Erfolgs zu einzelnen Maßnahmen ist aufgrund der Vielzahl in der
Organisation verknüpfter Variablen kaum gegeben.
43
Aus diesem Grund ist ein
unmittelbarer
Kausalzusammenhang
zwischen
Bildung/Weiterbildung
und
Unternehmenserfolg nicht herzustellen. Schelten sieht noch ein weiteres Problem in
der Zurechnung des Erfolgs von Weiterbildungsmaßnahmen. Seiner Meinung nach
kann ,,*...+ später Erfolg ehemaliger Weiterbildungsteilnehmer nur teilweise wenn
überhaupt auf eine bestimmte Bildungsmaßnahme zurückgeführt werden."
44
Diese prinzipielle Asymmetrie von Kosten und Nutzen folgt daraus, dass die Kosten
eher kurzfristig anfallen und ,,hart" monetär ermittelbar sind. Der Nutzen tritt jedoch
langfristig auf und könnte mit ,,weichen" sozialen Indikatoren belegt werden.
45
Insofern besteht die Gefahr, dass das Bildungscontrolling eine ,,Kurzfrist-Ökonomie"
unterstützt, bei der nur noch finanziert wird, was nach kurzer Zeit monetären Nutzen
abwirft.
40
Beich & Kerkel 1999, S 46
41
Schöni 2006, S. 22
42
Ehlers/Schenkel 2005, S. 5
43
Vgl. Faulstich 2005, S. 7
44
Vgl. Schelten 2007, S. 105
45
Vgl. Pichler 2005, S. 35; Vgl. Faulstich 2005, S. 7
15
3
Prozess des (Weiter-) Bildungscontrollings
Im Rahmen dieser Arbeit wird der Begriff des Weiter-Bildungscontrollings als eine
spezielle Form des betrieblichen Bildungscontrollings mit dem Schwerpunkt in der
Planung, Durchführung und Evaluation von Weiterbildung verwendet.
Abbildung 1: "Prozess des Bildungscontrollings"
46
Planung, Durchführung und Evaluation von Weiterbildung erfordert eine Bewertung
der
Ausgangssituation,
der
Prozesse
sowie
der
Ergebnisse.
Das
Weiterbildungscontrolling ist in diesem Zusammenhang kein in sich abgeschlossener
Prozess, sondern muss als dynamische und zyklische Aufgabe verstanden
werden.
47
Damit
wirkt
sich
das
Weiterbildungscontrolling
aus
einer
Weiterbildungsmaßnahme auf die nächste Maßnahme aus.
46
Eigene Darstellung in Anlehnung an Meier
47
Albers 2007, S. 18
Planung
Durchführung
Evaluation
16
Da das Weiterbildungscontrolling kein abgeschlossener Prozess ist, kann dieses in
folgende Phasen gegliedert werden:
48
Zieldefinition: Unternehmens und Individualziele
Ermittlung der Adressaten einer Weiterbildungsmaßnahme in Anlehnung an
Unternehmens- und Individualziele ist der Grundstein jeder erfolgreichen Personalfort-
und
Weiterbildungsmaßnahme.
Damit
dem
Erfolg
solcher
Fort-
und
Weiterbildungsmaßnahmen
nichts
mehr
im
Wege
steht,
müssen
die
Unternehmensziele und Abteilungs- sowie Individualziele aufeinander abgestimmt
sein.
Bildungsbedarfsanalyse
Bildungsbedarfsanalyse
soll
dazu
genutzt
werden
den
notwendigen
Qualifikationsbedarf einer Weiterbildungsmaßnahme zu ermitteln. Hier ist es
besonders wichtig, dass die Unternehmen entsprechende Methoden zur Ermittlung
der Bildungsbedarfsanalyse entwickeln.
Planung und Durchführung einer Weiterbildungsmaßnahme
Bei der Planung einer Weiterbildungsmaßnahme müssen die Lerninhalte stets in
Einklang mit den Unternehmenszielen stehen. Wichtig ist, dass die Durchführung der
Weiterbildungsmaßnahme sowohl effektiv als auch effizient ist und damit eine positive
Kosten-Nutzen-Relation darstellt.
Lerntransfer, Feedback und Lernerfolg
,,Unter dem Lerntransfer wird die Fähigkeit verstanden das Gelernte am Arbeitsplatz
um- und einzusetzen."
49
Der Lernerfolg einer Weiterbildungsmaßnahme ist dann zu
verzeichnen, wenn die Maßnahme zu einer Verhaltensänderung des Teilnehmers
48
Alle Protzesschritte sind eigene Darstellung in Anlehnung an Albers; Phillips/Schirmer und
Fredersdorf /Lehner
49
Albers 2007, S. 20
17
führt. Mit Hilfe spezieller Feedback-Bögen kann nach ca. 6-8 Wochen festgestellt
werden inwieweit ein Lerntransfer stattgefunden hat. Der Lerntransfer ist, wie auch
das gesamte Bildungscontrolling, ein Prozess
50
, der kontinuierlich begleitet werden
muss, um den Erfolg einer Maßnahme zu sichern.
Investitionserfolg einer Weiterbildungsmaßnahme ermitteln
Mit den Investitionen in die Weiterbildungsmaßnahmen wollen die Unternehmen
natürlich einen möglichst großen wirtschaftlichen Nutzen im Sinne des ,,Return on
Investment" erreichen. Dabei reicht das ,,einfache" Kostencontrolling oft nicht aus,
weil die reine Kostenbetrachtung keine vollständige Aussage über die Qualität der
Weiterbildungsmaßnahme zulässt. In der Praxis existiert eine Vielzahl renommierter
und anerkannter Modelle und Methoden mit denen sich der betriebswirtschaftliche
Erfolg von Bildungsinvestitionen nachweisen lässt. Das ,,Vier-Ebenen-Modell" nach
Donald L. Kirkpatrick zur Bewertung von Weiterbildungsmaßnahmen oder der ,,5-
Stufen-Evaluationsprozess" von Jack J. Phillips und Frank C Schirmer zur Ermittlung des
ROI in der Personalentwicklung sind gute Beispiele dafür.
50
zu den Einflussfaktoren und dem gesamten Lerntransferprozess siehe weiter unten Kapitel 3.6
,,Lerntransfer(-Prozess), Feedback und Lernerfolg"
18
Alle Prozessschritte können grafisch wie folgt dargestellt werden:
Abbildung 2: (Weiter-) Bildungscontrolling als zyklischer Prozess
51
Für den späteren Verlauf dieser Arbeit ist es sinnvoll die Komplexität und die
Interdependenz einzelner Phasen im Bildungscontrollingprozess detaillierter zu
betrachten, um deren Wichtigkeit für den Erfolg von Weiterbildungsmaßnahmen zu
verdeutlichen. In nachfolgenden Kapiteln werden daher die einzelnen Schritte des
prozessorientierten Weiterbildungscontrollings näher erläutert.
3.1
Zieldefinition: Unternehmens- und Individualziele
In einer Zeit der ,,knappen" Kassen und enormen Innovations- und Konkurrenzdruck,
dem viele Unternehmen ausgesetzt sind, ist es für die Unternehmen wichtiger denn je
die Weiterbildungsmaßnahmen ergebnisorientiert zu gestalten. Grundlage jeglichen
51
Eigene Darstellung in Anlehnung an: Hummel 1999 und Albers 2007
Zieldefinition:
Unternehmens- und
Individualziele
Bildungsbedarfsanalyse
Planung und
Durchführung einer
Weiterbildungsmaß-
nahme
Lerntransfer, Feedback
und Lernerfolg
Investitionserfolg von
Weiterbildungsmaß-
nahmen ermitteln
19
Handelns der Personalabteilung müssen die Unternehmensziele sein. Sämtliche
Vorgänge müssen nicht nur in Einklang mit diesen Zielen stehen sondern die
Zielerreichung
vorantreiben.
52
Die
Einbeziehung
der
individuellen
Entwicklungsbedürfnisse des einzelnen Mitarbeiters hat einen wesentlichen Einfluss
auf die Wirksamkeit dieser Prozessphase, da die ansonsten ausschließlich
fremdbestimmte Vorgehensweise zu Problemen führen kann.
53
Von den individuellen
Zielen,
ausgehend
aus
Personalgesprächen,
bis
hin
zum
Leitbild
des
Gesamtunternehmens, sollte ein Zielsystem aufgebaut werden das in sich schlüssig
ist.
54
Vorbei sind die Zeiten, in denen nach dem Supermarktprinzip verfahren wurde:
Die Weiterbildungsabteilung offerierte möglichst viele Programme und ließ die
Teilnehmer auswählen, was sie zu benötigen glaubten. Diese ,,Streufeueraktionen"
sind nicht nur die teuerste Methode überhaupt, sondern auch die unproduktivste und
uneffektivste, da sie häufig am wirklichen Bedarf vorbei geht.
55
Umso wichtiger ist es
für die Unternehmen die Maßnahmen in Anlehnung an die strategische
Unternehmensziele
56
zu binden, um die Effizienz und die Effektivität eines
Arbeitsprozesses zu sichern.
57
Nur so werden die Unternehmen in der Lage sein aus
kollektiven Lernprozessen handlungsrelevantes Wissen zu generieren, um einen
schwer imitierbaren Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz zu erreichen.
58
3.2
Bildungs-/ Qualifikationsbedarfsanalyse
Das
primäre
Ziel
der
Bildungsbedarfsanalyse
ist
die
Ermittlung
von
Qualifikationsbedarfen innerhalb eines Unternehmens. Dabei beschreibt der IST-
52
Vgl. Albers 2007, S. 18
53
ebd. Kapitel 2.3
54
Vgl. Meier 2005, S. 22
55
Vgl. Kellner 2005, S. 32
56
Gerade in den Zeiten der Wirtschaftskrise, wie sie im Jahr 2001 war ist es für die Unternehmen
besonders wichtig hochqualifizierte Arbeitskräfte mit großem Innovationspotential zu haben. Eine
der wichtigsten Strategien kann in diesem Zusammenhang eine langfristige Mitarbeiterbindung
durch Qualifizierungsmaßnahmen sein. Eine aktuelle Studie von Kienbaum Consultants International
GmbH zeigt, dass ,,*...+Unternehmen jetzt verstärkt in die Weiterbildung der eigenen Mitarbeiter
investieren. Knapp zwei Drittel planen, sich im kommenden Jahr ressourcenorientiert zu verhalten
und ihre Mitarbeiter zu entwickeln, um sie an das Unternehmen zu binden." ,,Dies ist eine Lehre aus
der Krise von 2001", so Cornelia Zinn-Zinnenburg, Geschäftsführerin von Kienbaum Wien.
57
ebd. Kapitel 1.1
58
s. Osterloh/Frost 1998, S. 185-235
20
Zustand die vorhandenen Qualifikationen und den tatsächlichen Informationsstand der
Mitarbeiter. Der erwartete oder gewünschte SOLL-Zustand beschreibt hingegen die
notwendigen
Qualifikationen
für
die
Aufgabenerstellung
und
die
Arbeitsplatzanforderungen des jeweiligen Mitarbeiters.
59
Der Qualifikationsbedarf ist
demzufolge die Differenz zwischen dem geforderten SOLL und dem tatsächlich
festgestellten IST.
Abbildung 3: Qualifikationsbedarfsermittlung
60
Qualifikationsbedarf kann aus unterschiedlichen Gründen auftreten. Einerseits können
sich durch externe Einflussfaktoren, wie Marktveränderungen oder technologischer
Wandel, die Anforderungen an das Unternehmen ändern.
61
Zum anderen können sich,
durch interne Umstrukturierungsmaßnahmen wie z.B. Business Prozess Reingeneering,
die Aufgabengebiete und Anforderungsprofile der einzelnen Mitarbeiter ändern und
eine Umqualifizierung der Mitarbeiter nach sich ziehen. Und schließlich können die
Mitarbeiter von sich aus das Bedürfnis nach Weiterbildung äußern.
62
Bei den
individuellen Wünschen der Mitarbeiter nach einer Weiterbildungsmaßnahme ist
allerdings zu bedenken, dass sich dadurch der Soll-Zustand in den meisten Fällen nicht
ändert. Weiterhin ist zu beachten, dass nicht jede Differenz zwischen den
Arbeitsplatzanforderungen (Soll-Qualifikation) und der IST-Qualifikation der
Mitarbeiter zu einem Bildungsbedarf führt. Wichtig ist die Frage, ob die aufgedeckten
Schwächen eine strategische Bedeutung für das Unternehmen haben und durch die
Weiterbildungsmaßnahmen ausgeglichen werden können.
59
Vgl. Albers 2007, S. 18; Hummel 1999, S 51
60
Ermittlung des Qualifikationsbedarfs, eigene Darstellung
61
Vgl. Hummel 1999, S 51
62
Vgl. Albers 2007, S. 18
IST-SOL L =Qualifikationsbedarf
21
3.2.1
Adressaten und beteiligte Akteure der Bedarfsanalyse
Die Vorbereitung und Durchführung einer Qualifikationsbedarfsanalyse sind Aufgaben,
die nicht allein von der Weiterbildungsabteilung durchgeführt werden können, auch
wenn diese in der Regel der Hauptakteur ist.
63
An der Qualifikationsbedarfsanalyse ist
eine Reihe unterschiedlicher Personengruppen beteiligt, die innerhalb der
Qualifikationsbedarfsanalyse verschiedene Aufgaben, Interessen und unterschiedliche
Möglichkeiten
haben,
Einfluss
auf
die
Bildungsbedarfs-
bzw.
Qualifikationsbedarfsanalyse auszuüben.
Menzel stellt das Zusammenwirken der beteiligten Personen wie folgt dar:
Abbildung 4: "Die an der Qualifikationsbedarfsanalyse beteiligten Personengruppen"
Die beteiligten Akteure können die Qualifikationsbedarfsanalyse entweder fördern
oder
hindern.
Die
Zielsetzungen
aller
beteiligten
Akteure
an
der
Qualifikationsbedarfsanalyse sind nur in den seltensten Fällen deckungsgleich. Das
63
s. Hummel 1999, S 52
Qualitätsbe-
darfsanalyse
Bildungs-
personal
Unterneh-
mensleitung
Betriebsrat
Führungs-
kräfte
Mitarbeiter
22
primäre Ziel des Unternehmens in Bezug auf die Qualifikationsbedarfsanalyse ist, dass
möglichst alle beteiligten Akteure die Qualifikationsbedarfsanalyse unterstützen.
64
Daher ist die Aufgabe der Personalabteilung, nicht nur die Entwicklungen des
Unternehmens auf kurz- und langfristiger Basis zu berücksichtigen, sondern auch das
Entwicklungspotential der Mitarbeiter in die Bedarfsanalyse einzubeziehen, um die
möglicher weise große Diskrepanz zwischen unternehmerischen und individuellen
Zielen auszugleichen.
65
Damit ist die genaue Adressatenanalyse (in diesem Fall die der
beteiligten Akteure) ein wesentlicher Erfolgsfaktor jeder Weiterbildungsmaßnahme.
Sie
hilft
die
unterschiedlichen
Interessenstrukturen,
den
individuellen
Erfahrungshorizont sowie die unterschiedlichen Kompetenzgrade zu ermitteln.
66
Eine weitere und nicht zu unterschätzende Personengruppe, die unbedingt an der
Qualifikationsbedarfsanalyse und der damit verbundenen Adressatenanalyse beteiligt
werden muss, sind die Trainer und die Seminarleiter bzw. Schulungsunternehmen.
Bevor der Trainer ein Programm für das erfolgreiche Training entwickelt, eine
Präsentation konzipiert oder ein Seminar durchführt, sollte er sich klar darüber sein
wen er vor sich hat.
67
Laut einer Kompetenzstudie des ITD (Institute of Training &
Development) Forschungsteams verlangen 54% der Firmen von den Trainern eine
genaue Adressatenanalyse und unterstützen die Trainer in ihren Bemühungen.
Weitere 30% stellten zwar einen Teil der Informationen zur Verfügung, waren jedoch
nicht bereit, eine umfassende Adressatenanalyse durchführen zu lassen. Und die
verbleibenden 16% legten überhaupt keinen Wert auf eine Adressatenanalyse, so Prof.
Dr. H. J. Kellner in seinem Buch ,,Was Trainer können sollten. Das neue
Kompetenzprofil des modernen Trainers." Diese Zahlen verdeutlichen, dass es in nur
rund der Hälfte aller Fälle gelingt teilnehmerspezifische Informationen, wie z.B.
Interessen und Wertesystem, Erfahrungshorizont und Erwartungen oder
Lernbereitschaft und Lernmöglichkeiten zusammenzutragen.
68
Im Interview mit Jörg
64
Vgl. Hummel 1999, S 52
65
s. Albers 2007, S. 18; Hummel 1999, S 63
66
Vgl. Kellner 2005, S. 32
67
Vgl. Kellner 2005, S. 33
68
Vgl. Kellner 2005, S. 34 ff
23
Sievers (General Manager von New Horizons Computer Learning Centers GmbH
Hamburg) wurde diese Aussage bekräftigt. Sievers bedauert, dass New Horizons, als
externer Bildungsträger, von den Kunden viel zu spät in den Prozess der
Qualifikationsbedarfsermittlung
einberufen
wird,
obwohl
das
IT-Schulungsunternehmen in einem großen Umfang für den Erfolg der
IT-Trainingsmaßnahmen verantwortlich ist.
69
Die Themenwahl, die Schwerpunkte der
Schulung und die richtigen Adressaten der Inhalte zusammen bilden eine Grundlage
für ein erfolgreiches Seminar. Die Praxis zeigt leider, dass gerade diese Faktoren oft
vernachlässigt werden.
3.2.2
Methoden der Qualifikationsbedarfsanalyse
Die Qualifikationsbedarfsanalyse ist, wie im vorherigen Kapitel gezeigt wurde, die
Grundlage jeder Weiterbildungsmaßnahme, denn nur durch sie ist der hohe finanzielle
Aufwand für die Weiterbildungsmaßnahmen zu rechtfertigen. Der Bedarf an
Weiterbildungsmaßnahmen kann im Allgemeinen aus zwei Gründen,
70
Veränderung
am Arbeitsplatz bedingt bspw. durch den technologischen Wandel und Wechsel des
Arbeitsplatzes als Folge des Business Prozess Reingeneerings oder z.B. des
persönlichen Aufstieges in der Unternehmenshirarchie, entstehen.
71
Mit Hilfe der
Qualifikationsbedarfsanalyse soll dann der notwendige Qualifikationsbedarf einer
Weiterbildungsmaßnahme
ermittelt
werden.
72
Zur
Ermittlung
des
Qualifikationsbedarfes stehen den Unternehmen verschiedene Methoden zur
Verfügung, die sich hauptsächlich in zwei Kategorien einordnen lassen:
indirekte Methoden und
direkte Methoden.
73
69
s. Kapitel 9
70
s. Kapitel 3.2 ,,Bildungsbedarfsanalyse", S. 17f
71
Vgl. Husemann 1999, S. 120; ebd. S. 17f
72
ebd. Kapitel 3.2
73
s. Hummel 1999, S. 60
24
3.2.2.1
Indirekte Methoden
Die indirekte Methode der Qualifikationsbedarfsanalyse ist prozessorientiert und auf
die zukünftige Entwicklung des Unternehmens ausgerichtet. Durch die Analyse der
internen und externen Prozesse soll der aktuelle und künftige Qualifikationsbedarf
ermittelt werden. Die Beteiligten können zusätzliche Informationen für mittelbare
Aussagen zur Entwicklung des Qualifikationsbedarfs für das Unternehmen mit Hilfe
interner Statistiken, Revisionsberichte, betrieblicher Kennzahlen, gesetzlicher
Bestimmungen usw. erhalten.
74
Die mittelbaren Aussagen zu Entwicklungen des Qualifikationsbedarfs helfen die Frage
nach ,,Wofür?" (nach betrieblichen Zielen) und ,,Wann?" (nach der zeitlichen Lage) zu
beantworten. Es wird allerdings nicht deutlich ,,Wer?" die Weiterbildungsmaßnahmen
in Anspruch nehmen sollte.
74
Vgl. Hummel 1999, S.60
25
Folgende Abbildung veranschaulicht den Prozess der indirekten Methode.
Abbildung 5: Schema der indirekten Ermittlungsmethoden des Qualifikationsbedarfs
75
Abschließend kann über die indirekte Methode der Qualifikationsbedarfsanalyse
gesagt werden, dass sie zwar die Möglichkeit einer kurzfristigen und kostengünstigen
Ermittlung
von
Qualifikationstrends
unter
Berücksichtigung
betrieblicher
Problemstellungen bietet, führt aber nicht zu einer strukturierten Aussage zum
Qualifizierungsbedarf
und
damit
nicht
zur
direkten
Umsetzung
in
Qualifizierungsmaßnahmen.
76
3.2.2.2
Direkte Methoden
Das Ziel der direkten Methode der Qualifikationsbedarfsanalyse ist laut Hummel, die
Erfassung und die Auswertung umfassender Informationen über den derzeitigen und
zukünftigen Qualifikationsbedarf. Dabei werden verschiedene Instrumente, wie
Arbeitsplatzanalyse,
Anforderungsprofile,
Mitarbeiterbeurteilungen
und
75
Hummel 1999, S. 61
76
Vgl. Hummel 1999, S.60
26
Qualifikationspotentiale genutzt, um eine detaillierte Qualifikationsplanung und deren
Umsetzung zu gewährleisten.
77
Die direkte Methode der Qualifikationsbedarfsanalyse ,,...erlaubt die Beantwortung der
Fragen nach der betroffenen Zielgruppe (,,Wer?"), nach den betrieblichen Zielen
(,,Wofür"?) sowie nach den Inhalten (,,Was?") und der zeitlichen Lage (,,Wann?") der
erforderlichen Qualifizierung."
78
Die Beantwortung dieser Fragen kann die Grundlage
für eine detaillierte Qualifizierungsplanung und ihre direkte Umsetzung in
wirtschaftlich sinnvolle Qualifizierungsmaßnahmen sein. Dies ist jedoch mit einem
erheblichen Aufwand und hohen Kosten verbunden.
Die
nachfolgende
Abbildung
veranschaulicht
den
Prozess
der
direkten
Ermittlungsmethoden des Qualifikationsbedarfs.
Abbildung 6: Schema der direkten Ermittlungsmethoden des Qualifikationsbedarfs
79
77
Vgl. Hummel 1999, S. 61-62
78
Hummel 1999, S. 62
79
Hummel 1999, S. 62
27
Direkte Methoden der Qualifikationsbedarfsermittlung scheinen sowohl die
unternehmerischen als auch die personellen Qualifikationsbedarfe zu berücksichtigen
und in die Bedarfsplanung einzubeziehen. In der Praxis wird jedoch häufig kritisiert,
dass in vielen Unternehmen nur solche Methoden zum Einsatz kommen, die zum einen
die Interessenperspektiven der Arbeitnehmer außen vor lassen und zum anderen den
Qualifikationsbedarf aus der gegenwartsbezogenen Problematiken ermitteln.
80
Damit
versuchen die Unternehmen die Frage nach dem Qualifikationsbedarf mit den
geringen finanziellen und organisatorischen Mitteln zu lösen.
3.3
Planung und Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen
Bei der Planung von Weiterbildungsmaßnahmen müssen die Lerninhalte mit den
unternehmenspolitischen und persönlichen Zielen der Arbeitnehmer in Einklang
gebracht werden. Dabei übernehmen die Vorgesetzten bzw. die Führungskräfte
81
im
Unternehmen die entscheidende Rolle. Weil sie als Bindeglied zwischen der
Unternehmensführung, den Arbeitnehmern und der Weiterbildungsabteilung stehen,
sind die Führungskräfte in einem Unternehmen in hohem Maße für den Erfolg einer
Weiterbildungsmaßnahme mitverantwortlich.
Um eine Zielgerichtete Qualifikationsbedarfsanalyse zu ermöglichen muss
gewährleistet sein, dass die Führungskräfte von der Unternehmensleitung rechtzeitig
die notwendigen Informationen erhalten. So können die Führungskräfte die
Zusammenhänge im Unternehmen besser verstehen und die notwendigen
Weiterbildungsmaßnahmen einleiten.
82
Die wichtigste Aufgabe der Führungskräfte ist
jedoch die Einleitung der erforderlichen Qualifizierungsschritte der Mitarbeiter sowie
die Unterstützung ihrer Mitarbeiter in der Weiterqualifizierung. Dabei setzt die
Mitwirkung der Führungskräfte bei der Gestaltung und Durchführung von
80
Vgl. Husemann 1999, S 119-132
81
Im Allgemeinen werden die Mitarbeiter eines Unternehmens als Führungskraft bezeichnet, die in
Ihrem Unternehmen eine leitende Position haben und über anderen Mitarbeitern
Personalverantwortung tragen, z.B. Teamleiter, Abteilungsleiter oder Bereichsleiter. (Quelle:
Lexikon, Arbeitsreitgeber)
82
Vgl. Lang 2000, S. 56
28
Weiterbildungsmaßnahmen voraus, dass sie über die Stärken und Schwächen ihrer
Mitarbeiter gut informiert werden, um den daraus resultierenden Qualifikationsbedarf
abzuleiten.
83
So soll sichergestellt werden, dass die Weiterbildungsmaßnahmen:
das Erreichen der Unternehmensziele unterstützt,
zur Deckung des Qualifikationsbedarfs beiträgt und
zu einer Verhaltensänderung bei den Mitarbeitern führt.
84
Aus dem ermittelten und notwendigen Qualifikationsbedarf werden dann die Lernziele
sowie das Konzept für die Weiterbildungsmaßnahme von den Führungskräften
abgeleitet und an die Weiterbildungsabteilung weiter gegeben damit diese die
notwendigen Seminare organisieren kann. Da die Weiterbildungsabteilung in der Regel
nicht die fachspezifischen Kompetenzen der einzelnen Bereiche besitzt, ist es umso
wichtiger, dass die Führungskräfte und die Weiterbildungsverantwortlichen in den
Fachbereichen den Qualifikationsbedarf und die Weiterbildungsinhalte im Detail und
mit inhaltlicher Differenzierung ausarbeiten. Wird diese Arbeit vernachlässigt oder gar
die inhaltliche Planung der Seminare der Weiterbildungsabteilung komplett
überlassen, besteht die Gefahr, dass bei der Gestaltung und späteren Durchführung
der Maßnahmen inhaltliche Defizite auftreten und die vermittelten Inhalte nur in
einem sehr stark eingeschränktem Maße auf den notwendigen Qualifikationsbedarf
zutreffen und damit den Lernerfolg (ver)hindern.
85
Sind der notwendige Qualifikationsbedarf und die Inhalte ermittelt bzw. bekannt, dann
kann eine Schulung geplant und organisiert werden. Für Deckung des vorhandenen
Qualifikationsbedarfs existieren in der Praxis unterschiedliche Weiterbildungsarten,
wie z.B.:
E-Learning
Selbststudium
83
Vgl. Olesch 1998, S. 326
84
Vgl. Albers 2007, S. 18
85
Vgl. Olesch 1998, S. 326
29
interne Seminare/Workshops
externe Seminare/Workshops
die jeweils ihre eigenen Vor- und Nachteile haben.
Im Rahmen dieser Arbeit sollen im folgenden Kapiteln die externen
Seminare/Workshops sowie die Rolle der Bildungseinrichtungen und Trainer, die sie in
dem Zusammenhang mit der Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen im IT-
Sektor einnehmen, näher betrachtet werden, weil sie später im Mittelpunkt der
empirischen Untersuchung stehen werden.
3.4
Externe Weiterbildungsmaßnahmen
Die Weiterbildungsmaßnahmen sind kein Selbstzweck an sich. Sie dienen, wie bereits
in den vorherigen Kapiteln beschrieben, dem übergeordneten betrieblichen Ziel und
Zweck eines Unternehmens.
86
Dabei kann die Weiterbildungsmaßnahme z.B. auf die
Vermittlung neuer arbeitsplatzrelevanter Kenntnisse und Fähigkeiten oder auf die
Behebung vorhandener Qualifikationsdefizite der Mitarbeiter abzielen.
87
Mit hohem
Wettbewerbsdruck steigt die Bedeutung von Veränderungsprozessen in den
Unternehmen. Initiiert und durchgeführt werden können diese Prozesse nur durch
qualifizierte und motivierte Mitarbeiter. In diesem Umfeld ist somit der Erfolg eines
Unternehmens in einem hohen Maße vom Qualifizierungsstand der Mitarbeiter
abhängig. Sehr gut ausgebildete und auch motivierte Mitarbeiter werden dabei zu
einem entscheidenden Erfolgsfaktor auf den nationalen wie internationalen Märkten.
Bildung, insbesondere berufliche Aus- und Weiterbildung, findet in der Bundesrepublik
Deutschland überwiegend im Rahmen von (externen) Bildungseinrichtungen statt.
88
Die Personalentwickler bedienen sich gerne der Angebote der Bildungseinrichtungen,
die ihre Leistungen in einem großen Umfang auf dem freien Markt anbieten. Laut
OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) sind
86
Vgl. Becker/Meißner/Werning 2008, S. 4
87
Vgl. Kapitel XXX
88
s. OECD 2002, S. 396 ff.; Krekel/Bardeleben
30
Bildungseinrichtungen definiert als ,,*...+ eine Einheit, die Einzelpersonen
Unterrichtsleistungen bzw. einzelnen und anderen Einrichtungen bildungsbezogene
Dienstleistungen anbietet *...+."
89
Damit erbringen Bildungseinrichtungen Leistungen
für Lernende, für Auftrag gebende Unternehmen und schließlich im weiten Sinne für
Wirtschaft und Gesellschaft.
90
Die Unternehmen sind häufig ,,gezwungen" die Leistungen externer Schulungsanbieter
in Anspruch zu nehmen weil in den Unternehmen die intern eingesetzten Referenten
oft nicht professionell genug sind. Gerade im IT-Sektor ist es unabdinglich, dass der
Referent(in)/IT-Trainer(in) über umfangreiche Erfahrungen verfügt, technisch perfekt
ausgebildet ist und didaktisch in der Lage ist technische Kenntnisse und eigene
Erfahrungen auf dem Gebiet pädagogisch sinnvoll aufzubereiten und den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu erklären. Darüber hinaus kann sich bei internen
Referenten/IT-Trainern und Schulungsmaßnahmen eine gewisse ,,Betriebsblindheit"
entwickeln, die für den Innovationsprozess oft hinderlich ist.
91
Durch den Besuch einer
Weiterbildungsmaßnahme
beim
externen
Schulungsanbieter
kann
der
Innovationsprozess der einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch den
Erfahrungsaustausch mit anderen Seminarteilnehmerinnen und Teilnehmern angeregt
werden.
Ein weiterer Grund dafür, dass die Unternehmen sich für externe Schulungsanbieter
entscheiden, ist die Tatsache, dass es in vielen Unternehmen schlicht die
Möglichkeiten für die Durchführung von IT-Weiterbildungsmaßnahmen fehlen.
Beispiele dafür sind die technische Ausstattung oder große und speziell für die IT-
Seminare erbaute Räumlichkeiten.
3.4.1
Rolle der Bildungseinrichtung im Bildungs(controlling)prozess
Um Leistungen möglichst effektiv bereitstellen zu können, braucht eine
Bildungseinrichtung zum einen ein starkes und wirksames Bildungsmanagement. Das
89
OECD 2002, S. 404
90
Vgl. Schöni 2006, S. 34 f.
91
Vgl. Albers 2007, S. 19
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2010
- ISBN (eBook)
- 9783836647540
- DOI
- 10.3239/9783836647540
- Dateigröße
- 2.3 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Hamburg – Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Betriebswirtschaft
- Erscheinungsdatum
- 2010 (Juni)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- bildungscontrolling lerntransfer evaluationsprozess weiterbildung personalentwicklung
- Produktsicherheit
- Diplom.de