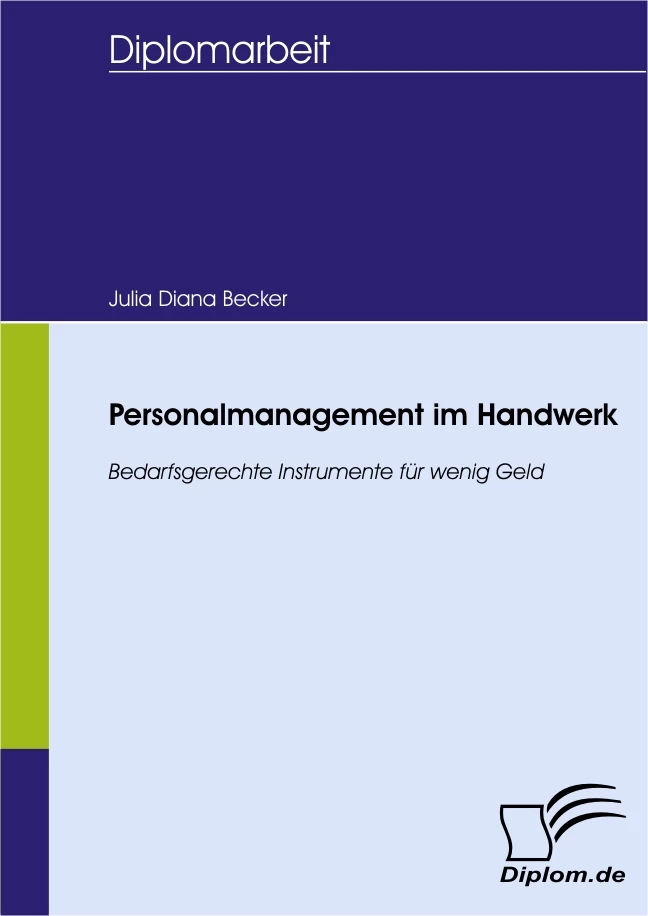Personalmanagement im Handwerk
Bedarfsgerechte Instrumente für wenig Geld
©2010
Diplomarbeit
79 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Die Vielseitigkeit der deutschen Berufslandschaft beruht auch auf der ständischen Tradition des deutschen Handwerks. Im Jahr 1908 - 8 Jahre nach Gründung der ersten Handwerkskammer unter Kaiser Wilhelm II im Jahr 1900 - wird die Einführung des Befähigungsnachweises erlassen, die bis heute mit der Meisterprüfung die Grundvoraussetzung ist, auszubilden und einen Handwerksbetrieb zu führen. Mehr als ein Jahrhundert später entwickelten sich hieraus über 95 anerkannte Ausbildungsberufe und über 50 handwerks(-ähnliche) Gewerbe. Kleine, mittlere und große Betriebe formen heute zusammen diesen tragenden Wirtschaftszweig Deutschlands.
Annähernd 1 Millionen handwerkliche Betriebe bieten über 4, 8 Millionen Menschen einen Arbeitsplatz. Das weltweit einzigartige duale Ausbildungssystem begleitet nahezu 580.000 Lehrlinge zu einer qualifizierten Berufsausbildung. Damit ist das deutsche Handwerk Arbeitgeber für 12 Prozent aller Erwerbstätigen und 29,3 Prozent aller Auszubildenden in Deutschland. Mit einem Umsatz von 511 Milliarden Euro (inkl. MwSt) kann sich das deutsche Handwerk auch als wichtige Säule der deutschen Wirtschaft behaupten. Europaweit sind sogar ca. 60% aller Unternehmen Klein- und Mittelbetriebe im Handwerk, was die Bedeutung noch unterstreicht.
In den nächsten Jahren werden jedoch auch die zunehmenden Zentrifugalkräfte einer globalisierten Wettbewerbsstruktur auf der einen Seite wie auch andererseits stetig weiterentwickelte maschinelle Fertigungsprozesse das Handwerk vor große Herausforderungen stellen. Gleichwohl sind es gerade gut ausgebildete Fachkräfte handwerklicher Berufe, die im In- und Ausland vermehrt gesucht werden. Denn sie sind Basis jener Kreativität und jener Hochwertigkeit an Dienstleistung und Ware, die als Alleinstellungsmerkmal die Zukunftsfähigkeit des Handwerks auch in einer globalisierten und technisierten Welt ermöglicht.
Handwerksbetriebe sichern ihre Marktstellung in Zukunft vor allem durch ihre qualifizierten und hoch motivierten Mitarbeiter als Garanten hochwertiger Produkte. Mit durchschnittlich 12 Mitarbeitern ist der direkte Kontakt zum Chef oder der Chefin im Handwerk um ein Vielfaches persönlicher, als in Großunternehmen. Dieser vermeintliche Vorteil birgt jedoch auch Risiken. Deshalb ist der Blick auf die Einführung von Personalmanagement auch oder gerade in kleinen Handwerksbetrieben die Voraussetzung für ein anhaltendes Niveau von Qualität und Leistungsfähigkeit.
Viele […]
Die Vielseitigkeit der deutschen Berufslandschaft beruht auch auf der ständischen Tradition des deutschen Handwerks. Im Jahr 1908 - 8 Jahre nach Gründung der ersten Handwerkskammer unter Kaiser Wilhelm II im Jahr 1900 - wird die Einführung des Befähigungsnachweises erlassen, die bis heute mit der Meisterprüfung die Grundvoraussetzung ist, auszubilden und einen Handwerksbetrieb zu führen. Mehr als ein Jahrhundert später entwickelten sich hieraus über 95 anerkannte Ausbildungsberufe und über 50 handwerks(-ähnliche) Gewerbe. Kleine, mittlere und große Betriebe formen heute zusammen diesen tragenden Wirtschaftszweig Deutschlands.
Annähernd 1 Millionen handwerkliche Betriebe bieten über 4, 8 Millionen Menschen einen Arbeitsplatz. Das weltweit einzigartige duale Ausbildungssystem begleitet nahezu 580.000 Lehrlinge zu einer qualifizierten Berufsausbildung. Damit ist das deutsche Handwerk Arbeitgeber für 12 Prozent aller Erwerbstätigen und 29,3 Prozent aller Auszubildenden in Deutschland. Mit einem Umsatz von 511 Milliarden Euro (inkl. MwSt) kann sich das deutsche Handwerk auch als wichtige Säule der deutschen Wirtschaft behaupten. Europaweit sind sogar ca. 60% aller Unternehmen Klein- und Mittelbetriebe im Handwerk, was die Bedeutung noch unterstreicht.
In den nächsten Jahren werden jedoch auch die zunehmenden Zentrifugalkräfte einer globalisierten Wettbewerbsstruktur auf der einen Seite wie auch andererseits stetig weiterentwickelte maschinelle Fertigungsprozesse das Handwerk vor große Herausforderungen stellen. Gleichwohl sind es gerade gut ausgebildete Fachkräfte handwerklicher Berufe, die im In- und Ausland vermehrt gesucht werden. Denn sie sind Basis jener Kreativität und jener Hochwertigkeit an Dienstleistung und Ware, die als Alleinstellungsmerkmal die Zukunftsfähigkeit des Handwerks auch in einer globalisierten und technisierten Welt ermöglicht.
Handwerksbetriebe sichern ihre Marktstellung in Zukunft vor allem durch ihre qualifizierten und hoch motivierten Mitarbeiter als Garanten hochwertiger Produkte. Mit durchschnittlich 12 Mitarbeitern ist der direkte Kontakt zum Chef oder der Chefin im Handwerk um ein Vielfaches persönlicher, als in Großunternehmen. Dieser vermeintliche Vorteil birgt jedoch auch Risiken. Deshalb ist der Blick auf die Einführung von Personalmanagement auch oder gerade in kleinen Handwerksbetrieben die Voraussetzung für ein anhaltendes Niveau von Qualität und Leistungsfähigkeit.
Viele […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Julia Diana Becker
Personalmanagement im Handwerk
Bedarfsgerechte Instrumente für wenig Geld
ISBN: 978-3-8366-4586-7
Herstellung: Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2010
Zugl. Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie Wiesbaden e.V., Wiesbaden, Deutschland,
Diplomarbeit, 2010
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und der Verlag, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplomica.de, Hamburg 2010
Inhaltsverzeichnis
I
Inhaltsverzeichnis
Seite
Abbildungsverzeichnis ...III
Abkürzungsverzeichnis ...IV
Quellen aus dem Internet...V
Quellen auf Papier ...VI
1 Personalmanagement im deutschen Handwerk ...1
1.1 Allgemeine
Einführungen ...1
1.2 Abgrenzung von Personalmanagement im Mittelstand und Großunternehmen .3
1.3 Zielsetzung
der
Erarbeitungen ...6
1.4 Aufbau der Arbeit ...7
2 Erarbeitung der IST Situation ...7
2.1 Das deutsche Bäckerhandwerk ...7
2.2 Durchführung
eines
teilstrukturierten Interviews im Handwerksbetrieb
Bäckerei Wittlich...9
2.2.1 Erläuterung des Instrumentes teilstrukturiertes Interview...9
2.2.2 Vorgehensweise und Aufbau des teilstrukturierten Interviews...10
2.2.3 Fragestellungen ...11
2.3 Ergebnisse des teilstrukturierten Interviews ...12
2.3.1 Personalbeschaffung...13
2.3.2 Personalführung...15
2.3.3 Personalmotivation...16
2.3.4 Personalentwicklung ...17
2.3.5 Personaleinsatz/
-administration...19
3 Erarbeitung der SOLL Situation...20
3.1 Personalbeschaffung ...20
3.1.1 Personalbedarfsplanung...28
3.1.2 Personalmarketing...35
3.1.3 Innerbetriebliche
Personalbeschaffung ...37
3.1.4 Außerbetriebliche
Personalbeschaffung...38
3.2 Personalführung ...42
3.2.1 Strukturale
Führung...43
3.2.2 Personale
Führung...45
3.2.3 Delegation ...48
3.3 Personalmotivation...50
Inhaltsverzeichnis
II
Seite
3.3.1 Extrinsische
Motivation ...51
3.3.2 Intrinsische
Motivation...53
3.4 Personalentwicklung anhand des Funktionszyklus...53
3.4.1 Bedarfsanalyse...55
3.4.2 Ziele
setzen...57
3.4.3 Planen
und
Gestalten ...58
3.4.4 Durchführung ...60
3.4.5 Erfolgskontrolle...60
3.4.6 Transfersicherung...61
3.5 Personaleinsatz/
-administration ...62
3.5.1 Arbeitszeitgestaltung ...63
3.5.2 Arbeitsgestaltung...64
3.5.3 Personal(ein-)führung...65
4 Fazit ...66
Literaturverzeichnis... VII
Abbildungsverzeichnis
III
Abbildungsverzeichnis
Seite
Abb. 1:
Prozentuale Verteilung der Betriebe in Anlage A auf die Handwerksgruppen
(lt. Alter HwO) 1. Halbjahr 2009 ...2
Abb. 2:
Perspektiven der quantitativen Personalbedarfsplanung, Vgl. M. Kolb,
Personalmanagement, Gabler Verlag, 1.Auflage 2008, S. 584...29
Abb. 3:
Morphologische Analyse Ausarbeitung für die Bäckerei Wittlich ...31
Abb. 4:
Morphologische Analyse für einen Bäckermeister der Bäckerei Wittlich...31
Abb. 5:
Übersicht Teilarbeitsmärkte ...40
Abb. 6:
Inhalte des strukturierten Mitarbeitergesprächs ...47
Abb. 7:
Reifegradmodell ...49
Abb. 8:
Bedürfnispyramide nach Maslow...50
Abb. 9:
Inhalte der Personalentwicklung ...54
Abb. 10:
Funktionszyklus der Personalentwicklung...55
Abb. 11:
Evaluierungsbestandteile der Personalentwicklung ...61
Abkürzungsverzeichnis
IV
Abkürzungsverzeichnis
ZDH...Zentralverband des deutschen Handwerks
TZ ...Teilzeit
VZ...Vollzeit
PE ... Personalentwicklung
PM ...Pressemitteilung
USP...Unique Selling Proposition: das Alleinstellungsmerkmal
Quellen aus dem Internet
V
Quellen aus dem Internet
www.manalex.de
www.zdh.de
www.personal-wirtschaft.de
www.baeckerhandwerk.de
www.bundesfinanzministerium.de
www.bundesregierung.de
www.destatis.de
www.gfk-geomarketing.de
www.keimkraft.at
www.personal-wirtschaft.de
www.hwk-wiesbaden.de/44,246,288.html
www.nexxt-change.de
www.backjournal.de
www.baeko-magazin.de
www.jobstarter.de
www.leadion.de
www.akademie-weinheim.de
www.wirtschaftslexikon.gabler.de
Quellen auf Papier
VI
Quellen auf Papier
Prof Becker M., Becker A., Skript Personalmanagement II, Mainz, 2009
o.V., Studie der Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, 02. Februar 2007, Frankfurt
o.V., Unternehmen, Zeit ist Geld', Archiv des Magazin ,Focus Money', Ausgabe Nr.
40, 2004
o.V., Stiftung Familienunternehmen und dem Zentrum für Europäische
Wirtschaftsforschung, (Hrsg.), Die volkswirtschaftliche Bedeutung von
Familienunternehmen, Studie, Stuttgart, November 2009
o.V., Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) (Hrsg.), Konjunkturbereich
1/2009,
o.V., Zentralverband des deutschen Handwerks (Hrsg.), das Handwerk im 20.
Jahrhundert, Berlin, 2009
o.V., Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks e.V (Hrsg.)., Zahlen, Fakten
2009
o.V., Die volkswirtschaftliche Bedeutung von Familienunternehmen, Stiftung
Familienunternehmen in Zusammenarbeit mit der europäischen Wirtschaftsforschung,
Stuttgart, November 2009
o.V., Zukunftsreport demographischer Wandel, Bundesministerium für Bildung und
Forschung, Bonn 2000
o.V., Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung (Hrsg),
Förderprogramme für die gewerbliche Wirtschaft und freie Berufe in Hessen, Stand
Oktober2008
1 Personalmanagement
im deutschen Handwerk
1
1
Personalmanagement im deutschen Handwerk
1.1
Allgemeine Einführungen
Die Vielseitigkeit der deutschen Berufslandschaft beruht auch auf der ständischen
Tradition des deutschen Handwerks. Im Jahr 1908 - 8 Jahre nach Gründung der ersten
Handwerkskammer unter Kaiser Wilhelm II im Jahr 1900 - wird die Einführung des
Befähigungsnachweises erlassen, die bis heute mit der Meisterprüfung die
Grundvoraussetzung ist, auszubilden und einen Handwerksbetrieb zu führen. Mehr als
ein Jahrhundert später entwickelten sich hieraus über 95 anerkannte Ausbildungsberufe
und über 50 handwerks(-ähnliche) Gewerbe. Kleine, mittlere und große Betriebe
formen heute zusammen diesen tragenden Wirtschaftszweig Deutschlands.
Annähernd 1 Millionen handwerkliche Betriebe bieten über 4, 8 Millionen Menschen
einen Arbeitsplatz. Das weltweit einzigartige duale Ausbildungssystem begleitet nahezu
580.000 Lehrlinge zu einer qualifizierten Berufsausbildung. Damit ist das deutsche
Handwerk Arbeitgeber für 12 Prozent aller Erwerbstätigen und 29,3 Prozent aller
Auszubildenden in Deutschland. Mit einem Umsatz von 511 Milliarden Euro (inkl.
MwSt) kann sich das deutsche Handwerk auch als wichtige Säule der deutschen
Wirtschaft behaupten. Europaweit sind sogar ca. 60% aller Unternehmen Klein- und
Mittelbetriebe im Handwerk, was die Bedeutung noch unterstreicht.
1
In den nächsten Jahren werden jedoch auch die zunehmenden Zentrifugalkräfte einer
globalisierten Wettbewerbsstruktur auf der einen Seite wie auch andererseits stetig
weiterentwickelte maschinelle Fertigungsprozesse das Handwerk vor große
Herausforderungen stellen. Gleichwohl sind es gerade gut ausgebildete Fachkräfte
handwerklicher Berufe, die im In- und Ausland vermehrt gesucht werden. Denn sie sind
Basis jener Kreativität und jener Hochwertigkeit an Dienstleistung und Ware, die als
Alleinstellungsmerkmal die Zukunftsfähigkeit des Handwerks auch in einer
globalisierten und technisierten Welt ermöglicht.
1 Vlg Zentralverband des deutschen Handwerks (Hrsg.), das Handwerk im 20. Jahrhundert, Berlin, 2009
1 Personalmanagement
im deutschen Handwerk
2
Abb. 1: Prozentuale Verteilung der Betriebe auf die
Handwerksgruppen (lt. Alter HwO) 1. Halbjahr 2009
Handwerksbetriebe sichern ihre Marktstellung in Zukunft vor allem durch ihre
qualifizierten und hoch motivierten Mitarbeiter als Garanten hochwertiger Produkte.
Mit durchschnittlich 12 Mitarbeitern ist der direkte Kontakt zum Chef oder der Chefin
im Handwerk um ein Vielfaches persönlicher, als in Großunternehmen. Dieser
vermeintliche Vorteil birgt jedoch auch Risiken. Deshalb ist der Blick auf die
Einführung von Personalmanagement auch oder gerade in kleinen
Handwerksbetrieben die Voraussetzung für ein anhaltendes Niveau von Qualität und
Leistungsfähigkeit.
Viele Instrumente des Personalmanagement, die in Mittel- und Großunternehmen
Anwendung finden, können auch in kleinsten Handwerksbetrieben eingesetzt werden.
Ob die Beschaffung, Führung und Weiterbildung von Fach- und Führungskräften, die
Motivation und Bindung der Mitarbeiter, sowie natürlich auch die gelungene
Vorbereitung von Unternehmensnachfolgen sichern die Zukunft der
Handwerksbetriebe.
Durch kaum vorhandene Hierarchieebenen, geringe (Aus-)Bildung im
Personalmanagement und die komplette Einbindung des Inhabers in den Arbeitsablauf
fehlt oft der Mut mit der Auseinandersetzung mit den Mitarbeitern. Auch muss das
Management der Mitarbeiter nicht zwangsläufig Geld kosten und oft sind es kleine
alltägliche Maßnahmen, die wirkungsvoll in den Alltag integriert werden können.
1 Personalmanagement
im deutschen Handwerk
3
1.2
Abgrenzung von Personalmanagement im Mittelstand und Großunternehmen
Man nennt es in unterschiedlichen Unternehmen und in der Literatur immer wieder
anders: Personalmanagement, Personalpolitik, Corporate Governance, Human
Ressources Management oder ungewohnt deutsch: die Mitarbeiterführung. Eines haben
jedoch all diese Begriffe gemeinsam: Die Strategien und Maßnahmen die unter diesen
Begriffen erarbeitet werden dienen immer und jederzeit der Erreichung der
betrieblichen Ziele, wie auch immer diese definiert sind und durch welche Kennzahlen
der Erfolg auch gemessen wird.
In großen aktiendotierten Unternehmen ist eines der wichtigsten Messkriterien das
Shareholder Value. Dies ist der Unternehmenswert der sich in Marktanteile (Aktien)
ausdrückt.
2
Hier erfährt man den ersten wesentlichen Unterschied zwischen großen Unternehmen
und kleinen Handwerksbetrieben. Die Unternehmensführung und die Zielformulierung
in Handwerksbetrieben sind um ein vielfaches einfacher, kurzfristiger und
entscheidungsfähiger, alleine durch nicht vorhandene Gremien, wie z.B. dem
Aufsichtsrat einer AG. Im Handwerksbetrieb wird eine Entscheidung meist vom
Inhaber getroffen und dann auch bald umgesetzt.
Ebenso wichtig ist das Stakeholder Value. Hierunter versteht man den Nutzen für alle
Menschen und Gruppen, die am Wert des Unternehmens partizipieren. Gemeint sind
hiermit das Management, die Aktionäre, Gewerkschaften, Kunden, Lieferanten, die
Bevölkerung und im Besonderen die Mitarbeiter.
3
Und hier setzt spätestens das Personalmanagement an. Reguliert und beeinflusst von
externen Rahmenbedingungen wie dem Arbeitsgesetz, dem Kündigungsschutzgesetz,
dem Betriebsverfassungsgesetz und natürlich auch den Bedingungen der
Gewerkschaften, entwickelt und erarbeitet ein Unternehmen seine eigene
Personalpolitik. Hieran verdeutlicht sich auch der zweite große Unterschied zum
Personalmanagement in kleinen Handwerksbetrieben. Diese müssen sich meist gar nicht
mit diesen externen Bedingungen befassen, da sie durch ihre geringe Mitarbeiteranzahl
die gesetzlichen Bestimmungen wie z.B. die Gründung eines Betriebsrates nicht
erfüllen müssen. Ebenso wenig sind kleine Handwerksbetriebe gewerkschaftlich
organisiert.
In allen Unternehmen, die hingegen eine eigene Abteilung oder Mitarbeiter im Bereich
Personal hat, befasst sich das Personalmanagement im Wesentlichen mit den Bereichen
2 Vgl online im Internet: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/9868/shareholder-value-v6.html
3 Vgl online im Internet: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/14157/stakeholder-value-v6.html
1 Personalmanagement
im deutschen Handwerk
4
Personalbeschaffung, Personalführung, Personalentwicklung, Personalmotivation und
Personaleinsatz/ -administration. Selbstverständlich gibt es je nach Größe, Struktur und
Bedarf noch weitere Bereiche. Im Folgenden soll sich jedoch auf diese konzentriert
werden, um im angelegten Analyserahmen eine Abgrenzung zu verdeutlichen.
Personalbeschaffung
In mittleren und großen Unternehmen ist die Personalbeschaffung einer der
wesentlichen und kostspieligsten Bereiche im Personalmanagement. Die Erarbeitung
des Personalbedarfes, die Rekrutierung und die dadurch bedingte Planung der
Personalkosten sind eng an die Unternehmensplanung gebunden. Dem entgegen ist in
Handwerksbetrieben die Personalbeschaffung im Wesentlichen beim Inhaber
angesiedelt, dessen Eingebundenheit in die täglichen Arbeitsabläufe jedoch eine
gewissenhafte strategische Planung zeitlich erschwert. Daneben ist in kleinen
Handwerksbetrieben ein entsprechendes Budget für ein Auswahlverfahren meist nicht
vorhanden.
Personalführung
Das Management und die Führungskräfte eines Unternehmens sind eine maßgebliche
Voraussetzung dafür, dass ein Unternehmen wertschöpfend und strategisch arbeitet.
Durch die hohe Fluktuation an Führungskräften ist dies sehr schwer zu gewährleisten.
Im Jahr 2007 lag die Fluktuation des Topmanagements der 500 umsatzstärksten
Unternehmen bei ca. 20% in deutschen Unternehmen und ca. 15% in internationalen
Unternehmen.
4
Diese Fluktuation gibt es im Handwerk nicht. Der Grund ist scheinbar
banal: es sind meist inhabergeführte Unternehmen, teilweise über Generationen hinaus.
Das bedeutet, dass die Führung in Handwerksbetrieben wesentlich persönlicher und
unmittelbarer ohne zeitliche Verzögerungen durch Prozesse oder die Einbindung
verschiedener Entscheidungsebenen bzw. -personen erfolgt.
Personalentwicklung
Der Produktionsprozess in einem Unternehmen ist durch verschiedene
Produktionsfaktoren bedingt. Als Produktionsfaktoren werden die Sachgüter und
Dienstleistungen bezeichnet, die in Betrieben eingesetzt werden, um wiederum Güter
und Dienstleistungen hervorzubringen, die der Befriedigung des von außen
herangetragenen Bedarf dienen und die die Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft
gewährleisten.
5
Zum Beispiel im DAX Unternehmen SAP betrug der
Personalkostenanteil im Jahr 2004 24%, bei der Deutschen Bank sogar über 50%.6. Je
4 Vgl Studie der Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt, vom 02. Februar 2007
5 Vgl www.manalex.de das große Management Lexikon, Suchbegriff ,Produktionsfaktor'
6 Vgl Unternehmen, Zeit ist Geld', Archiv des Magazin ,Focus Money', Ausgabe Nr. 40, 2004
1 Personalmanagement
im deutschen Handwerk
5
qualifizierter der Arbeitnehmer ist, desto wertvoller und auch teurer ist er. Je mehr
Humanvermögenskapital ein Mitarbeiter besitzt, desto schwerer ist er als Mitarbeiter zu
gewinnen und zu halten. Mitarbeiter mit hohem Humanvermögenskapital sind
leistungs- und verhandlungsstarke Menschen mit hoher Kernkompetenz.
7
Ebenso ist der
Arbeitnehmer im Besitz einer wichtigen Ressource im Unternehmen: Wissen und
Erfahrung. Diese nicht wirklich messbaren Faktoren sind für jedes Unternehmen absolut
schützenswert. Eine Steigerung dieser Wertschöpfung erfolgt nur mit der Entwicklung
des Mitarbeiters, insbesondere damit dieser das Unternehmen nicht verlässt: ,,Staff
should be able to leave, but happy to stay."
8
Das Handwerk - insbesondere das produzierende Handwerk wie bspw. Bäcker und
Metzger - werden im Wesentlichen von den Mitarbeitern getragen. Gerade durch eng
verwobenen Abläufe und notwendige Verlässlichkeit untereinander ist es essentiell,
dass kein Mitarbeiter ausfällt und die Fluktuation so niedrig wie möglich gehalten wird.
Auch für die wichtige und schwierige Abgrenzung zu Konkurrenten sowie eine
erfolgreiche Kundenbindung ist es wichtig, dass die Mitarbeiter sich mitentwickeln und
mit ihren Ideen und Erfahrungen dem Unternehmen dienen und helfen, einen stetigen
Innovationsprozess zu generieren.
Personalmotivation
Zufriedene Mitarbeiter sind die Leistungsträger eines Unternehmens. Mitarbeiter, die
auch langfristig in einem Unternehmen arbeiten sollen, müssen in ihrer Tätigkeit
begleitet und immer wieder begeistert werden. Hier setzt die Personalmotivation an. Es
gibt zwei Arten der Motivation. Die intrinsische Motivation, die aus dem Menschen
selbst herauskommt und in der Tätigkeit selbst liegt9, z.B. die eigene Neugier,
Wissbegierigkeit, Freude an der Ausübung oder Beschäftigung mit einer Sache. Hier
kann der Mitarbeiter nur bedingt vom Arbeitgeber berührt werden.
Die extrinsische Motivation bezieht sich auf einen Zustand, bei dem wegen äußerer
Gründe [...] gehandelt wird
10,
so z.B. vom Arbeitgeber unmittelbar beeinflussbare
Faktoren wie Geld, Beförderung, Anerkennung und Stellung innerhalb des Betriebes.
Hier kann man mit geeigneten Maßnahmen den Mitarbeiter analysieren und dort
ermuntern und unterstützen, wo es im Endergebnis dem Unternehmen dient.
Dies ist in kleinen Handwerksbetrieben nur bedingt möglich, da weniger zeitliche
Freiräume bestehen, um Mitarbeiter, die z.B. an einer Weiterbildung oder einem
7 Gabler Wirtschaftslexikon, Gabler Verlag , Wiesbaden 2008
8 Norbert Thon: Moderne Personalentwicklung, Gabler Verlag, 3. Auflage, Wiesbaden 2008
9 Vgl Prof. Dr. Günter W. Maier: Gabler Wirtschaftslexikon, Gabler Verlag, Wiesbaden 2008
10 Vgl Prof Dr. Günter W. Maier: Gabler Wirtschaftslexikon, Gabler Verlag, Wiesbaden, 2008
1 Personalmanagement
im deutschen Handwerk
6
Incentive teilnehmen, zu ersetzen. Selbstverständlich ist auch das Budget für manche
Maßnahmen überhaupt nicht vorhanden.
Personaleinsatz bzw. -administration
Begleitet von externen Rahmenbedingungen, wie dem Arbeitsgesetz, dem
Bundesurlaubsgesetz, etc. werden die Mitarbeiter in jeder Unternehmensgröße
eingesetzt. Verschiedene Arbeitsmodelle, wie Voll- und Teilzeitarbeit,
Zeitarbeitsmitarbeiter, freie Mitarbeiter und viele mehr, ermöglichen die Planung der
Mitarbeiter nach dem Bedarf des Unternehmens. Gerade in großen Unternehmen kann
man sehr flexibel agieren. Hier unterstützen unter anderem Arbeitszeitregelungen, wie
Gleitzeitarbeit. Ebenso kann in großen Unternehmen ein Ausfall durch Krankheit oder
Mutterschutz durch die größere Gesamtmitarbeiterzahl leichter abgefangen werden. In
kleinen Handwerksbetrieben lässt sich ein Ausfall nicht so einfach abfangen. Ebenso
müssen unerwartete große Auftragslagen durch das Stammteam abgearbeitet werden, da
man weder so schnell zusätzliches, qualifiziertes Personal findet, noch es bezahlen
kann. Bereits hier lassen sich die Problemfelder erkennen, die man beim Personaleinsatz
bzw. administration in kleinen Handwerksbetrieben einer Lösung zuführen müsste.
1.3
Zielsetzung der Erarbeitungen
Diese Arbeit soll darstellen, welches Potential Maßnahmen des Personalmanagements
in Handwerksbetrieben freisetzen können. Es soll erarbeitet werden, dass
Handwerksbetriebe jeder Größe und Art für sich geeignete Strategien entwickeln
können, um ihre Mitarbeiter zu fördern und dadurch im zweiten Schritt ihren Umsatz zu
steigern bzw. ihre Marktposition zu sichern. Der dieser Diplomarbeit zugrundegelegte
Analyserahmen richtet sich an den oben eingeführten Bezugspunkten des
Personalmanagements. So soll eine Analyse am Beispiel der Bäckerei Wittlich
erarbeitet werden, die Inhabern ermutigt, sich mit diesen Themen auseinander zu setzen.
Es soll aufgezeigt werden, dass gerade der Alltag und die Nähe zu den Mitarbeitern eine
große Chance bildet, die unterschiedlichen Bereiche der Mitarbeiterführung zu
bedienen. Selbstverständlich wird auch darauf eingegangen, dass Handwerksbetriebe
vor anderen Herausforderungen stehen, als mittelständische und große Unternehmen.
Die finanziellen Mittel sind wesentlich geringer und die alltäglichen Spielräume durch
den Arbeitsprozess und die vorhandenen Arbeitskräfte begrenzt. Es soll vielmehr
aufgezeigt werden, dass sich auch kleine, angepasste Veränderungen und neue Schritte
sehr schnell bemerkbar machen können. Das Ziel der Diplomarbeit ist somit die
Erstellung eines Einführungswerkes in das Personalmanagement im Handwerksbetrieb,
das Inhaber und Führungskräfte von Handwerksbetrieben einen ersten Einblick in die
theoretischen Grundlagen sowie in die praktische Umsetzbarkeit von Instrumenten des
2 Erarbeitung
der IST Situation
7
Personalmanagements in ihrem Betriebsalltag ermöglicht und sie zudem dafür
sensibilisieren sollte, sich des Themas Personalmanagement verstärkt zuzuwenden.
1.4
Aufbau der Arbeit
Nach einer Einführung im ersten Kapitel, die dem Leser einen Überblick über die
Marktposition und Herausforderungen des Handwerks gibt und Unterschiede von Groß-
und Mittelstandsunternehmen zu kleinen Handwerksbetrieben erläutert, verdeutlicht das
zweite Kapitel zunächst allgemein die Besonderheiten des Bäckerhandwerks anhand der
Geschichte und Entwicklung bis hin zur aktuellen Situation. Der Hauptteil des 2.
Kapitels dient der Erfassung des IST Zustandes im Beispielbetrieb Bäckerei Wittlich.
Mit Hilfe eines teilstrukturierten Mitarbeiterinterviews werden die zu bearbeiteten
Felder des Personalmanagements in der Bäckerei Wittlich eruiert. Durch konkrete
Fragestellungen kann hiermit ein empirischer Ausgangsbefund herausgearbeitet werden.
Im Kapitel drei werden sodann aus diesen empirischen Befunden mit Hilfe der
relevanten wissenschaftlichen Theorien praxisnahen Maßnahmen und Lösungswege für
ein wirkungsvolles und angepasstes Personalmanagement der Bäckerei Wittlich
herausgearbeitet. Hier bezieht sich die Verfasserin auf die eruierten Teilbereiche aus
Kapitel 2 und konzipiert konkrete Vorschläge. Im abschließenden vierten Kapitel
werden die erarbeiteten Ergebnisse und Lösungsvorschläge als Fazit nochmals
zusammengefasst und eine Einordnung vor dem Hintergrund ihrer allgemeinen
Übertragbarkeit vorgenommen.
2
Erarbeitung der IST Situation
2.1
Das deutsche Bäckerhandwerk
Brot ist eines der ältesten Nahrungsmittel der Welt. Schon die alten Ägypter (2650 -
2000 v. Christus) haben die Anmischung von Hirse zu Sauerteig als
Grundnahrungsmittel erfunden.
11
Im heutigen Deutschland ist der Beruf des Bäckers
erstmalig um die Zeit Karl des Großen (768 814 n. Chr.
12
) benannt. Durch die
Ansiedlung von Menschen in Städten und Dörfern in den folgenden Jahrhunderten
behauptete sich der Beruf des Bäckers.
Das deutsche Bäckerhandwerk besteht 2009 aus ca. 15.300 Bäckereien und erarbeitet
im Jahr einen beeindruckenden Gewinn von 13 Mrd Euro. Diese Betriebe beschäftigen
288.000 Arbeitnehmer
13
und sind mit einer jährlich ansteigenden Zahl die größte
11 Online im Internet: http://www.baeckerhandwerk.de/Geschichte
12 Online im Internet: http://www.baeckerhandwerk.de/Geschichte
13
Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks e.V (Hrsg.)., Zahlen, Fakten 2009
2 Erarbeitung
der IST Situation
8
Handwerksberufsgruppe Deutschlands. Allerdings ist in der Literatur nicht
ausgewiesen, ob diese Zahl sich nur auf Handwerksbetriebe zurückführen läßt oder ob
auch alle Filialisten und Großbäcker, die oft nichts mehr mit dem Handwerk des
Bäckers gemein haben, erfasst wurden. In größeren Betrieben werden mittlerweile
vermehrt Maschinen und Verarbeitungshilfen eingesetzt.
Viele wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stellen Inhaber kleiner
Handwerksbäckereien vor komplexe Probleme. Die vielen Arbeitsschritte, die ein
Bäckerprodukt benötigt, sind in der schnelllebigen Zeit der Discounter oft dem
Endkunden nicht mehr anhand eines amortisierenden Preises zu vermitteln. Zusätzlich
werden auch von Kammern und Behörden immer mehr Vorschriften zu Hygiene,
Lebensmittelverarbeitung, Kennzeichnung uvm auferlegt, die ein kleiner Betrieb
umsetzen muss. Jedoch gibt es seitens der 304 Bäckerinnungen in Deutschland viel
Unterstützung und Beratung zu Themen, wie z.B. der Alterversorgung, sowie
Seminarangebote und Einkaufssynergien, die die Bäckereien nutzen können.
Deutschland gibt mit einem konstanten pro Kopf Konsum von ca. 45kg Teigware/
Jahr
14
einen scheinbar unerschöpflichen Markt her. Von klassischen Brotwaren, über
Kuchen, Plätzchen oder Convenience Produkten wie dem belegtenSandwich wirkt das
Angebot unerschöpflich und erfindet sich täglich neu. Die Herausforderung ist es
somit, die Vielfalt der Angebote in rentable Wertschöpfungen zu verwandeln. Und zu
erfahren, was an welchem Standort von welchem Kunden gewünscht ist.
Diese Anforderungen erlernen die Mitarbeiter der Bäckereibetriebe in unterschiedlichen
Berufen. Der klassische Werdegang beginnt mit der staatlich anerkannten 3- jährigen
Ausbildung zum Bäckergesellen. Das duale System ermöglicht den Einblick in Theorie
und Praxis und schließt mit der erfolgreichen Prüfung ab. Aufbauend auf diese
Qualifikation schließt sich nun eventuell die Meisterprüfung oder die Prüfung zur
Verkaufsleiterin im Handwerk an. Diese hoch qualifizierte und breitgefächerte
Ausbildung ist die Voraussetzung für das Führen eines Bäckereibetriebes.
Empfehlenswert für die Leitung oder Übernahme eines Bäckereibetriebes, gerade wenn
es ein größeres Unternehmen oder gar ein Filialsystem ist, ist die Ausbildung zum
,Betriebswirt des Handwerks'. Hier werden Kenntnisse im Bereich Organisation,
Marketing, Finanzen, Rechnungswesen und auch dem Personalwesen vermittelt.
Die Aufstiegschancen sind im Handwerk begrenzt. Das Ziel der meisten Absolventen
der letzten beiden benannten Ebenen ist meist die Selbständigkeit oder die Tätigkeit in
großen Hotels oder Restaurants. In den letzten Jahren erhält die weltweit einzigartige
Ausbildung im Bäckereihandwerk aus dem Ausland großes Interesse und viele jungen
Bäcker suchen ihre Herausforderung dort.
14 Online im Internet: http://www.baeckerhandwerk.de/Marktsituation
2 Erarbeitung
der IST Situation
9
2.2
Durchführung eines teilstrukturierten Interviews im Handwerksbetrieb
Bäckerei Wittlich
Die Erarbeitung der IST Situation und die Analyse der einzelnen Bereiche des
Personalmanagement im Handwerksbetrieb Bäckerei Wittlich sollen mit der
Durchführung eines teilstrukturierten Interviews erarbeitet werden. Diese
Mitarbeiterbefragung ermöglicht das Herausarbeiten eines nahezu unverfälschten
Bildes. Alle Mitarbeiter werden hier zur Befragung gebeten, um anschließend eine
vollständige Bewertungsgrundlage für die in Kapitel 3 nachfolgende Konzeption zu
erarbeiten.
2.2.1
Erläuterung des Instrumentes teilstrukturiertes Interview
Mit dem teilstrukturierten Interview erhält ein trainierter Interviewer die größtmögliche
Information, die ein Interview ausgeben kann. Dies ermöglicht die offene Fragestellung,
die sich aber an einem professionell vorbereiteten und zielorientierten Leitfaden
ausrichtet. Die Auswahl der Fragen ist klar formuliert und kann aber durch Zusatzfragen
im Verlauf der Befragung erweitert und auch vertieft werden. Es gibt in der Literatur
kaum abschließende Richtlinien über diese Art des Interviews. Er wird vielfältig in
Assessment Centern eingesetzt und auch bei Einstellungsgesprächen und
Mitarbeiterbefragungen dient es dem Personalmanager.
Die offene Fragestellung verführt sicherlich zu spontanen Erweiterungen der
Befragung, was aber vermieden werden sollte. Die klare Zielerfüllung und die dadurch
bedingte Abarbeitung der Fragen sollten dem Interviewer jederzeit präsent sein. Es
handelt sich um eine mündliche und persönliche Interviewsituation.
Das teilstrukturierte Interview ist schwierig in der Auswertung, da es keine
abschließenden Fragestellungen (ja/nein) gibt, sondern der Befragte meist frei und nach
seiner Art erzählen kann. Die Schwierigkeit wird noch dadurch verstärkt, dass durch die
offene Fragestellung keine Vergleichbarkeit der Ergebnisse verschiedener Befragungen
vorliegt. Die Erarbeitung der Essenz ist nach Abschluss der Befragung sicherlich die
größere Herausforderung an den Interviewer. Empfehlenswert ist eine
Tonbandaufnahme, um keine Information zu verlieren und die Bearbeitungszeit im
Anschluss in Grenzen zu halten.
2 Erarbeitung
der IST Situation
10
2.2.2
Vorgehensweise und Aufbau des teilstrukturierten Interviews
Die wichtigste Aufgabe ist die Formulierung der Zielsetzung des Interviews. Darauf
baut die ganze Erarbeitung auf. Man sollte sich bei der Konzeption der Fragen auch auf
die Personen besinnen, die mit diesen Fragen konfrontiert werden. Hier spielen
Bildungsstand, Charakter, soziale Kompetenz eine große Rolle. Aber wesentlich ist
auch die Situation am Arbeitsplatz. Ist zum Beispiel in der Firma der Befragten kurz vor
Beginn des Interviews eine Kündigungswelle angekündigt worden, werden alle
Befragten gemäß der sozialen Erwünschtheit zurückhaltend und im Zweifel sogar falsch
auf die Fragen antworten. Man sollte einen schriftlichen Fragebogen erstellen um alle
Themen jederzeit vor Augen zu haben, die abgehandelt werden sollen. Die Zielführung
des Interviews wird nur durch die Vollständigkeit erreicht.
Die Fragen sollen kurz und verständlich formuliert werden sowie suggestive
Fragestellung oder wertende Formulierung umgangen werden.
15
Der Ablauf der
Fragestellung sollte sinnvoll und für den Mitarbeiter nachvollziehbar sein. Um
Vertrauen zu gewinnen, kann man mit persönlichen Fragen beginnen, die einfach und
schnell zu beantworten sind, z.B. ,Wie lange sind Sie schon im Unternehmen tätig?'
oder ,Wie ist Ihre genaue Tätigkeitsbeschreibung?'. Gezielt kann man auch auf die
Stellenbeschreibung und Kompetenz des Mitarbeiters eingehen, gefolgt von seinen
Wünschen und Vorstellungen. Selbstverständlich müssen im Falle dieser Erarbeitungen
auch Fragen gestellt werden, die den Vorgesetzten und die Kollegen betreffen. Der
Abschluss der Fragestellung kann eine offenen und auffordernde Frage sein, z.B.
,Haben Sie noch Punkte, die Sie gerne ansprechen möchten?'.
Der Interviewer muss jederzeit ausstrahlen, dass er neutral und unvoreingenommen alle
Antworten aufnimmt. Das Interview sollte für den Befragten in einer mindestens
angenehmen, wenn nicht neutralen Umgebung stattfinden, unbeobachtet und ohne
Zeitdruck. Das Interview und auch die Zielsetzung sollten einige Zeit vorab
angekündigt werden, damit der Befragte sich damit auseinander setzen kann und nicht
überrascht wird. Das würde die befreite Beantwortung und damit Zielsetzung des
Interviews gefährden. Man empfiehlt die Ankündigung ungefähr eine Woche vorab
16
.
Nachdem die Befragung bei allen auserwählten Mitarbeitern durchgeführt wurde,
erfolgt die Auswertung der Ergebnisse. Da es durch die offene Fragestellung kein
System gibt (z.B. 4 x Ja und 8 x Nein oder Skalen von 1-5) muss für die Auswertung
Zeit und Auseinandersetzung eingeplant werden. Hier ist es wichtig, durch wen und bis
15 Vgl Thomas Freiling; Mario Gottwald: Qualitative Methoden Auswertung von Interviews mit
MaxQDA, Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) gGmbH, Nürnberg 2008
16 Vgl Thomas Freiling; Mario Gottwald: Qualitative Methoden Auswertung von Interviews mit
MaxQDA, Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) gGmbH, Nürnberg 2008
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2010
- ISBN (eBook)
- 9783836645867
- DOI
- 10.3239/9783836645867
- Dateigröße
- 1.8 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie Wiesbaden e.V. – Betriebswirtschaftslehre
- Erscheinungsdatum
- 2010 (April)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- handwerk personalentwicklung personalmarketing motivation
- Produktsicherheit
- Diplom.de