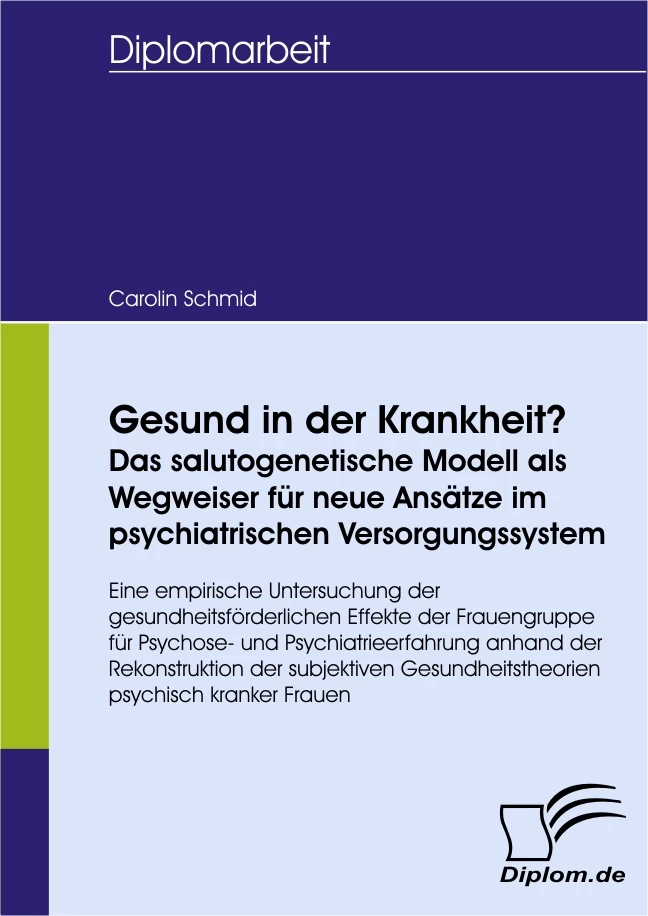Gesund in der Krankheit? Das salutogenetische Modell als Wegweiser für neue Ansätze im psychiatrischen Versorgungssystem
Eine empirische Untersuchung der gesundheitsförderlichen Effekte der Frauengruppe für Psychose- und Psychiatrieerfahrung anhand der Rekonstruktion der subjektiven Gesundheitstheorien psychisch kranker Frauen
Zusammenfassung
Gesundheit ?
für mich? mhh (..) alles (alles) alles heißt das für mich (int M_420).
mh, ich fühle das. das fühlt sich anders an als wie ich mich jetzt fühle (int H_1140).
(schnaufen) gesund zu sein ist eigentlich für mich, etwas uneingeschränkt tun zu müssen, oder tun zu können. ohne Beeinträchtigung (int L_962).
Die Frage nach den eigenen Vorstellungen von Gesundheit ist nicht leicht zu beantworten. Neben unserer aktuellen Befindlichkeit werden unsere Annahmen wesentlich davon abhängen, was uns im Lauf unseres Lebens über Gesundheit vermittelt wurde, welchen Wert wir der eigenen Gesundheit beimessen und welche Erfahrungen wir bislang, nicht nur mit Gesundheit und Krankheit, sondern als Träger einer Vielzahl sozialer Rollen in verschiedenen sozialen Bezügen gemacht haben. Gesundheitsvorstellungen stellen damit soziale Repräsentationen (Herzlich 1993) dar, die sich durch die gesellschaftlichen und lebensweltlichen Bezüge eines Individuums und deren Wechselverhältnis konstruieren. Die meisten Menschen verfügen über ein breites Repertoire an Aussagen über Gesundheit, die sich z.B. auf die Fähigkeit beziehen, Herausforderungen zu bewältigen, leistungs- und handlungsfähig zu sein, sich geistig und körperlich im Einklang zu fühlen oder das Gefühl umschreiben, über Energie und Potential zu verfügen und dieses nutzen zu können. Nur in wenigen Fällen wird Gesundheit allein als Fehlen von Krankheit definiert.
Das Auftreten einer psychischen Störung in der eigenen Lebensgeschichte hat in dieser Hinsicht weitreichende Konsequenzen. Die Betroffenen werden mit einer anderen Seite oder Möglichkeit menschlicher Existenz konfrontiert, die die eigene Wahrnehmung, das Denken oder Erleben irritieren und beängstigen. Die Person entfremdet sich von sich selbst und der Selbstverständlichkeit gesundheitlicher Normativität. Der Verrückte. steht damit mitunter vor der Aufgabe, die Erfahrungen und Veränderungen, die sich durch die Erkrankung ergeben, in neue Sinnstrukturen einzubetten und Autonomie in der eigenen Lebenswelt wiederherzustellen. Annahmen über Gesundheit müssen vor diesem Hintergrund reinterpretiert und Gedanken über die eigene Gesundwerdung und Gesunderhaltung auf eine neue Basis gestellt werden.
Den Zugang zu meinem Forschungsthema fand ich im Rahmen meines Hauptpraktikums in einer Psychiatrischen Klinik. Dort machte ich Bekanntschaft mit engagierten Pädagoginnen, die außerhalb ihres regulären Aufgabenfeldes neue […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltverzeichnis
Einleitung
Zum Aufbau der Arbeit
A Thematisch-theoretische Einführung
1. Die gesundheitliche Lage in Deutschland
1.1 Die Veränderung des Krankheitsspektrums
1.2 Geschlecht und Gesundheit
1.2.1 Geschlechterbezogene Differenzen im Umgang mit Gesundheit und Krankheit
1.3 Psychische Erkrankungen
1.3.1 Erklärungsansätze geschlechterdifferenter psychischer Störungen
Die Familie als protektiver und pathogener Faktor
Die Doppelbelastung der Frau als Charakteristikum der modernen Frauenrolle
1.4 Zusammenfassung
2. Krankheit und Gesundheit im wissenschaftlichen Diskurs: von der Pathogenese zur Salutogenese
2.1 Gesundheit - eine erste begriffliche Annäherung
2.1.1 Disziplingebundene Definitionen
Gesundheit als Abwesenheit von Krankheit - die Einseitigkeit biomedizinischen Denkens
Krankheit als regelwidriger Zustand mit Konsequenzen - das Verständnis der Jurisprudenz
Gesundheit als bestimmendes Moment für den Erhalt der Gesellschaft - die soziale Dimension der Gesundheit
2.1.2 Mehrperspektivische Definitionen
Gesundheit als Homöostase des Individuums - Bestimmungsmerkmale aus psychologischer Perspektive
Gesundheit als körperliches, soziales und psychisches Wohlbefinden - das Leitbild der WHO
2.1.3 Zusammenfassung
2.2 Orientierung an Krankheit oder Gesundheit?
2.2.1 Das biomedizinische Krankheitsmodell
2.2.2 Die Begründung eines biopsychosozialen Modells
2.2.3 Das salutogenetische Modell als Orientierungsrahmen
2.2.5 Zusammenfassung
2.3 Das Gesundheitsparadigma in der subjektwissenschaftlichen Forschung
2.3.1 Grundannahmen und begriffliche Klärung
2.3.2 Subjektive Konzepte von Gesundheit
Claudine Herzlich: Soziale Repräsentationen
Dimensionen von Gesundheit
Gesundheitsvorstellungen von Frauen
2.3.3 Subjektive Theorien von Gesundheit
2.3.4 Zusammenfassung
3. Prävention und Gesundheitsförderung
3.1 Krankheitsprävention
3.1.1 Strategien der Prävention
Stadienmodell der Krankheitsprävention: Primäre, Sekundäre und Tertiäre Prävention
Universelle vs. Zielgruppenspezifische Ansätze
Verhaltensprävention vs. Verhältnisprävention
3.1.2 Methoden der Prävention
3.2 Gesundheitsförderung
3.2.1 Strategien der Gesundheitsförderung
3.2.2 Stadienmodell der Gesundheitsförderung
3.3 Zusammenfassung
4. Die Psychiatrie - Grenzen und Möglichkeiten für Ansätze der Gesundheitsförderung
4.1 Die Psychiatrie als Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit
4.1.1 Zum Verständnis von Psychiatrie
4.1.2 Empowerment
4.1.3 Lebensweltorientierung
4.1.4 Zusammenfassung
4.2 Rahmenbedingungen sozialpädagogisch-psychiatrischer Arbeit
4.2.1 Medizinische Klassifikationen
4.2.2 Finanzierung und rechtliche Grundlagen
4.3 Strukturen psychiatrischer Versorgung
4.3.1 Geschlechtergerechte Gesundheitsversorgung ?
4.4 Gesundheitsförderung und Salutogenese in der Psychiatrie ?
B Methodische Vorgehensweise
5. Forschungsansatz und methodische Herangehensweise
5.1 Das Subjekt als Gegenstand qualitativer Sozialforschung
5.2 Erkenntnisinteresse
5.3 Theoretische und methodologische Perspektive
5.3.1 Biographieanalyse nach Fritz Schütze
Erzähltheoretische Grundlagen des biographisch-narrativen Interviews
Prozessstrukturen des Lebenslaufs
Das Konzept der Verlaufskurve
5.3.2 Das Experteninterview - Kontextwissen
5.4 Forschungsfeld und Feldzugang
5.4.1 Die Frauengruppe
5.4.2 Feldzugang und Sample
5.5 Der Forschungsprozess
5.5.1 Vorbereitungen für die Datenerhebung
5.5.2 Ablauf der narrativen Interviews
5.5.3 Schwierigkeiten bei der Datenerhebung
5.5.4 Datenanalyse
5.5.5 Grenzen der Untersuchung
C Empirische Analyse und Ergebnisse
6. Fallanalysen
6.1 Fr. Lehmann
6.1.1 Vorstellung
6.1.2 Biographie
6.1.3 Das Kernkonstrukt in der Biographie
6.1.4 Der Beitrag der Frauengruppe zur Stabilisierung der Gesundheit
6.2 Fr. Hummel
6.2.1 Vorstellung
6.2.2 Biographie
6.2.3 Das Kernkonstrukt in der Biographie
6.2.4 Der Beitrag der Frauengruppe zur Stabilisierung der Gesundheit
6.3 Fr. Mircovic
6.3.1 Vorstellung
6.3.2 Biographie
6.1.3 Das Kernkonstrukt in der Biographie
6.3.4 Der Beitrag der Frauengruppe zur Stabilisierung der Gesundheit
7. Ergebnisdarstellung
7.1 Fallübergreifender Vergleich
7.1.1 Subjektive Vorstellungen von Gesundheit
7.1.2 Umgang mit Gesundheit und Krankheit
7.1.3 Die Bedeutung der Frauengruppe
7.2 Betrachtungen aus der Perspektive der Expertinnen
7.2.1 Die Frauengruppe als Antwort auf Mängel im psychiatrischen Versorgungssystem
7.2.2 Zentrale Aspekte der Frauengruppe
8. Abschließende Betrachtung
8.1 Das Zusammenspiel der Kategorien Gesundheit, Krankheit und Geschlecht
8.2 Die Frauengruppe als Modell gesundheitsfördernder Ansätze im psychiatrischen Versorgungssystem
Zu 1.: Kann das Konzept Gesundheitsförderung bei Personen Anwendung finden, die nach medizinischen Kriterien als krank eingestuft werden?
Zu 2.: Kann Gesundheitsförderung im psychiatrischen Versorgungssystem im Sinne des Mehr-Ebenen-Modells Veränderungen bewirken?
Zu 3.: Inwieweit kann die Frauengruppe einen Beitrag zur Gesundheitsförderung psychisch kranker Frauen leisten?
Literatur
Einleitung
… Gesundheit ?
„für mich? mhh (..) alles @(alles)@ alles heißt das für mich (int M_420)
„mh, ich fühle das. das fühlt sich anders an als wie ich mich jetzt fühle“ (int H_1140)
„((schnaufen)) gesund zu sein ist eigentlich für mich, etwas uneingeschränkt tun zu müssen, oder tun zu können. ohne Beeinträchtigung“ (int L_962)
Die Frage nach den eigenen Vorstellungen von Gesundheit ist nicht leicht zu beantworten. Neben unserer aktuellen Befindlichkeit werden unsere Annahmen wesentlich davon abhängen, was uns im Lauf unseres Lebens über Gesundheit vermittelt wurde, welchen Wert wir der eigenen Gesundheit beimessen und welche Erfahrungen wir bislang, nicht nur mit Gesundheit und Krankheit, sondern als Träger einer Vielzahl sozialer Rollen in verschiedenen sozialen Bezügen gemacht haben. Gesundheitsvorstellungen stellen damit „soziale Repräsentationen“ (Herzlich 1993) dar, die sich durch die gesellschaftlichen und lebenswelt-lichen Bezüge eines Individuums und deren Wechselverhältnis konstruieren. Die meisten Menschen verfügen über ein breites Repertoire an Aussagen über Gesundheit, die sich z.B. auf die Fähigkeit beziehen, Herausforderungen zu bewältigen, leistungs- und handlungsfähig zu sein, sich geistig und körperlich im Einklang zu fühlen oder das Gefühl umschreiben, über Energie und Potential zu verfügen und dieses nutzen zu können. Nur in wenigen Fällen wird Gesundheit allein als Fehlen von Krankheit definiert (vgl. Faltermaier 2005).
Das Auftreten einer psychischen Störung in der eigenen Lebensgeschichte hat in dieser Hinsicht weitreichende Konsequenzen. Die Betroffenen werden mit einer „anderen Seite oder Möglichkeit menschlicher Existenz“ (von Kardoff 2005, 1434) konfrontiert, die die eigene Wahrnehmung, das Denken oder Erleben irritieren und beängstigen. Die Person entfremdet sich von sich selbst und der Selbstverständlichkeit gesundheitlicher Normativität. Der „Ver-rückte“ (ebd.) steht damit mitunter vor der Aufgabe, die Erfahrungen und Veränderungen, die sich durch die Erkrankung ergeben, in neue Sinnstrukturen einzubetten und Autonomie in der eigenen Lebenswelt wiederherzustellen. Annahmen über Gesundheit müssen vor diesem Hintergrund reinterpretiert und Gedanken über die eigene Gesundwerdung und Gesund-erhaltung auf eine neue Basis gestellt werden.
Den Zugang zu meinem Forschungsthema fand ich im Rahmen meines Hauptpraktikums in einer Psychiatrischen Klinik. Dort machte ich Bekanntschaft mit engagierten Pädagoginnen, die außerhalb ihres regulären Aufgabenfeldes neue Wege im Umgang mit Gesundheit und Krankheit in Form einer offenen Frauengruppe für Frauen mit Psychose- und Psychiatrie-erfahrung erproben. Im Vergleich zu anderen Angeboten im stationären, ambulanten und komplementären Versorgungsbereich, erwies sich die Frauengruppe in ihrer salutogenetischen und ganzheitlichen Ausrichtung als einzigartig. In den letzten Jahren etablierte sie sich in einer Lücke des psychiatrischen Versorgungssystems als niederschwelliges frauenspezifisches Angebot mit herausragender Bedeutung für die Teilnehmerinnen. Aufgrund dieser Beobachtung gilt mein besonderes Interesse der Frage, welchen Beitrag die Frauengruppe als integratives Modell der Versorgung für die Wiederherstellung bzw. den Ausbau der eigenen Gesundheit aus subjektiver Sicht der Teilnehmerinnen leisten kann.
Das skizzierte Forschungsinteresse verweist auf die Notwendigkeit, die theoretische Auseinandersetzung um Normalität und Abweichung mit ihren wichtigsten Implikationen aufzugreifen. Nicht nur die Konstrukte Gesundheit und Krankheit unter dem Blickwinkel verschiedener Disziplinen sind hierfür von Bedeutung, sondern auch die theoretische Auseinandersetzung der Vorstellungen über Prozesse der Entstehung von Gesundheit und Krankheit sowie Strategien der Prävention und Gesundheitsförderung die bis heute grundlegend für unser psychiatrisches Versorgungssystem sind. In dieser Hinsicht wird das biomedizinische Krankheitsmodell und das salutogenetische Modell auf ihre Anwendbarkeit und Gültigkeit für einen ganzheitlichen sozialpädagogischen Zugang zum Thema Gesundheitsförderung in der Psychiatrie untersucht. In der fachlichen Diskussion wird die Kehrtwende von der Pathogenese, dem Prozess der Krankheitsentstehung, zu einer Ausrichtung an der Salutogenese, dem Entstehungsprozess von Gesundheit, als durchgreifende und langfristige Leitperspektive Sozialer Arbeit postuliert, die einen wesentlichen Beitrag zur gesellschaftlichen De-konstruktion von Normalität und Abweichung leistet.
Des Weiteren wird dem Zusammenhang von Geschlecht und Gesundheit sowohl in den theoretischen als auch empirischen Beiträgen dieser Arbeit nachgegangen. In der Phase des mittleren Erwachsenenalters stellt eine psychische Störung das eigene Identitätskonzept in Frage, die eigene Gesundheit als Bestandteil der Identität muss vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit der Krankheit neu definiert werden. Dies erfordert von dem nahen sozialen Umfeld, der Familie wie von der betroffenen Person selbst erhebliche Bewältigungs-kompetenzen und Anpassungsleistungen. Der Frage der Herstellung von Identität als Rahmenkonzept, innerhalb dessen Erfahrungen interpretiert und in sinnvolle Zusammenhänge gebracht werden (vgl. Keupp u.a. 2006), kommt dabei besondere Bedeutung zu (vgl. Faltermaier 2005, 51).
Dem dynamischen Konstrukt der Gesundheit wird methodisch durch die biografische Herangehensweise Rechnung getragen. Qualitative Forschungsmethoden stehen damit im Mittelpunkt der empirischen Arbeit. Seit der Psychiatrieenquete konnten zwar wesentliche Veränderungen im psychiatrischen Versorgungssystem eine Verbesserung der Situation erzielen (vgl. Aktion Psychisch Kranke 2001), die stark ausdifferenzierten Segmente des Versorgungssystems konzentrieren sich jedoch nach wie vor primär auf einen Bereich der Lebenswelt, sei es Arbeit oder Wohnen, ohne die Ganzheitlichkeit des Menschen in seinen lebensweltlichen und biographischen Bezügen ausreichend zu berücksichtigen. Dabei wird oftmals vergessen, dass auch die für viele selbstverständlichen Wahrnehmungen der eigenen Körperlichkeit, das In-Bezug setzen zur sozialen Umwelt und Auseinandersetzen mit den eigenen Fähigkeiten sowie das Erleben emotionaler Unterstützung gerade für Frauen auf dem Weg zur Gesundheit wichtige Erfahrungen darstellen, die neue Sinnbezüge, Verstehens-prozesse und Handlungsmöglichkeiten anregen und die wesentliche Ausgangslage für Empowermentprozesse erst konstituieren.
Mit dieser Arbeit wird der Versuch unternommen, den Paradigmenwechsel von der Pathogenese zur Salutogenese auf das von Medizinern dominierte Arbeitsfeld der Psychiatrie ansatzweise zu übertragen und subjektorientierte Wege der geschlechterbezogenen Gesundheitsförderung am Beispiel der Frauengruppe zu skizzieren. Der dieser Arbeit zugrunde liegende Widerspruch, ein für gesunde Menschen konzipiertes Modell auf die Versorgung chronisch kranker bzw. ehemals erkrankter Menschen anzuwenden, ist mir durchaus bewusst und ist Bestandteil der theoretischen Auseinandersetzung. Erste Anhaltspunkte, die meine Intention untermauern, konnten in der Literatur ausfindig gemacht werden (vgl. Hurrelmann/Laaser 2006).
Der subjektorientierte Ansatz dieser Arbeit soll einen Beitrag zum Abbau gesellschaftlicher Stereotype von Menschen mit Psychiatrieerfahrung leisten und der Notwendigkeit einer kritischen Thematisierung der Zusammenhänge von Gesundheit und Geschlecht in der Postmoderne Rechnung tragen.
Zum Aufbau der Arbeit
Die vorliegende Arbeit gliedert sich in drei Abschnitte.
Der erste, relativ lange Abschnitt A (Kap. 1-4) dient der thematischen Einführung in die umfassende theoretische Auseinandersetzung mit Gesundheit und Krankheit und einer Verortung der zentralen Begrifflichkeiten und Zusammenhänge.
Im ersten Kapitel wird die gesundheitliche Lage in Deutschland auf Grundlage der aktuellen Gesundheitsberichterstattung des Bundes dargestellt. Bedeutende Veränderungen und Charakteristika werden vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen Wandels im Hinblick auf die Frage nach Implikationen für eine zukunftsfähige Gestaltung des Gesundheitssystems erörtert.
Im zweiten Kapitel wird der Fokus auf die wissenschaftliche Diskussion um Gesundheit und Krankheit gelegt. Das „Problem der Normativität“ (Helfferich 1993, 39), d.h. die kritische Auseinandersetzung mit der Monopolstellung der Medizin für die Krankheitsdiagnostik und die Diskrepanz zwischen objektiven und subjektiven Vorstellungen von Gesundheit und Krankheit, stellt den Rahmen der theoretischen Aufarbeitung in allen drei Unterkapiteln dar. In Kapitel 2.1 findet eine erste begriffliche Annäherung an die Konstrukte Gesundheit und Krankheit statt, wobei die Suche nach einer tragfähigen Definition von Gesundheit im Vordergrund steht. Kapitel 2.2 umreißt die Entwicklung und Grundannahmen des biomedizinischen und biopsychosozialen Modells, welche die Grundlage unseres Versorgungssystems darstellen und schließt mit der Gegenüberstellung eines innovativen und dynamischen Modells von Gesundheit und Krankheit - dem salutogenetischen Modell von A. Antonovsky - ab. Unter einer salutogenetischen Perspektive rückt die Bedeutung der subjektiven Perspektive auf Gesundheit und Krankheit in Kapitel 2.3 in den Vordergrund. Nach der Darstellung der Grundannahmen einer am Gesundheitsparadigma orientierten subjektwissenschaftlicher Forschung, werden die zentralen Termini „subjektives Konzept von Gesundheit“ und „subjektive Vorstellungen von Gesundheit“ definitorisch festgelegt und die wichtigsten Forschungsergebnisse aus diesen Bereichen angeführt.
Das dritte Kapitel lenkt den Blick auf die Praxis gesundheitlicher Versorgung und stellt die Konzepte der Krankheitsprävention und Gesundheitsförderung vor. Neben den differenten Grundannahmen der Konzepte werden die Anwendungs- und Integrationsmöglichkeiten in der psychiatrischen Versorgung in die Darstellung mit einbezogen.
Das vierte Kapitel stellt die Psychiatrie als Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit mit den Arbeitsprinzipien des Empowerment und der Lebensweltorientierung vor (Kap. 4.1). Des Weiteren werden die Rahmenbedingungen sozialpädagogischer Arbeit im psychiatrischen Kontext und die aktuellen Strukturen des psychiatrischen Versorgungssystems, insbesondere in Bezug auf die Frage einer geschlechtergerechten Gesundheitsversorgung dargelegt und erörtert (Kap. 4.2 bis 4.4).
Der zweite Abschnitt B (Kap. 5) ist kürzer gehalten und behandelt die Darstellung der empirischen Untersuchung im Rahmen dieser Diplomarbeit.
Im fünften Kapitel wird der empirische Teil der Arbeit zunächst unter theoretischen und methodologischen Aspekten eingeführt und die Bedeutung eines qualitativen Vorgehens im Hinblick auf mein Erkenntnisinteresse begründet (Kap. 5.1 und 5.2). Daran anschließend wird die Biographieanalyse nach F. Schütze als zentrale Erhebungs- und Auswertungsmethode sowie das Experteninterview als inhaltliche Ergänzung vorgestellt (Kap. 5.3). Die Beschreibung des Forschungsfeldes und des Feldzugangs werden erläutert (Kap. 5.4) und leiten in die ausführliche Darstellung des Forschungsprozesses über, einschließlich der Schwierigkeiten und der Grenzen während der Durchführung der Untersuchung (Kapitel 5.5).
Der dritte Abschnitt C (Kap. 6-8) stellt die Ergebnisse der Analyse vor.
Im sechsten Kapitel werden die Ergebnisse der Biographieanalyse und weitergehender Analysen, die sich an der salutogenetischen Perspektive orientieren, anhand dreier Fallanalysen präsentiert.
Im siebten Kapitel greift ein abschließender Vergleich die wesentlichen Ergebnisse auf und kontrastiert sie mit zentralen Annahmen von Seite der Expertinnen.
Abschließend werden im achten Kapitel die Ergebnisse bezüglich der in der empirischen Arbeit hervorgetretenen Implikationen für die Frage nach dem Beitrag der Frauengruppe zur Gesundheitsförderung psychisch kranker Frauen und den Anwendungsmöglichkeiten des Konzeptes Gesundheitsförderung im psychiatrischen Versorgungssystem erörtert. In diesem Rahmen werden die zentralen Widersprüche des Versuches, Gesundheitsförderung in diesem Kontext als Aufgabe der Sozialen Arbeit zu etablieren, nochmals aufgegriffen und diskutiert.
A Thematisch-theoretische Einführung
1. Die gesundheitliche Lage in Deutschland
In den letzten zehn Jahren hat sich die Gesundheit der Deutschen und in Deutschland Lebenden insgesamt verbessert. Die Lebenserwartung ist weiter gestiegen und die Sterblichkeit zurückgegangen, entsprechend einem seit den 1970 er Jahren zu beobachtenden Trend. Die Lebenserwartung für Frauen in Deutschland liegt derzeit bei 81,6 Jahren, die der Männer bei 76,0 Jahren, womit sie sich dem europäischen Durchschnitt annähern (Gesundheitsberichterstattung 2006, 15).
Unter Berücksichtigung der historischen Veränderungen werden im Folgenden anhand der Kategorien Psychische Störungen und Geschlecht, die zentralen Merkmale der gesundheitlichen Lage in Deutschland dargestellt, um die Relevanz des Forschungsthemas hervorzuheben und eine Basis für die weitere Auseinandersetzung zu schaffen.
1.1 Die Veränderung des Krankheitsspektrums
Im Zuge der positiven Entwicklung einer kontinuierlich steigenden Lebenserwartung hat sich das Krankheitsspektrum im Verlauf des 20. Jahrhunderts von Infektionskrankheiten wie Tuberkulose, Diphtherie und Meningitis zu chronischen und degenerativen Krankheiten verschoben (vgl. Faltermaier 1994, 10)[1]. Die in modernen Industriegesellschaften unter dem Terminus „Zivilisationskrankheiten“ (Siegrist 2007, 6) verhandelten chronischen Krankheiten umfassen Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, Krebserkrankungen, Krankheiten der Atemwege und des Verdauungssystems sowie psychische Störungen (vgl. Hurrelmann/Laaser 2006, 749)[2]. In Deutschland leidet bereits ein Drittel der Kranken im Alter zwischen 15 bis 40 Jahren unter einer chronischen Erkrankung, bei den über 65-jährigen steigt dieser Anteil auf 90 % (vgl. Bäcker ua. 2008, 97). Chronische Krankheiten entwickeln sich über einen längeren Zeitraum aus einem multifaktoriellen Bedingungsgefüge und können ab einem bestimmten Stadium nicht mehr geheilt, sondern höchstens in ihren Symptomen gelindert werden. In den meisten Fällen sind die Betroffenen auf eine lebenslange Inanspruchnahme sozialer Sicherungs- und gesundheitlicher Versorgungssysteme angewiesen. Neben somatischen Erkrankungen spielen psychische Erkrankungen dabei eine immer bedeutendere Rolle. Ein allein auf Kuration ausgerichtetes Versorgungssystem kann diesen Anforderungen auf lange Sicht nicht gerecht werden. Angesichts der Verschiebung des Krankheitsspektrums müssen sich zukünftige Versorgungsmodelle stärker an den Bedürfnissen der Betroffenen orientieren (vgl. Hurrelmann/Laaser 2006, 749).
1.2 Geschlecht und Gesundheit
1996 lebten in Deutschland rund 82 Mio. Menschen, davon waren 51,3 % Frauen (vgl. bmfsfj 1999, 57). Auf Initiative der WHO wurde 1999 der erste „Bericht zur gesundheitlichen Situation von Frauen in Deutschland“ fertig gestellt, um die erheblichen Defizite in der Erforschung geschlechterbezogener Gesundheit aufzuarbeiten (vgl. Hurrelmann/Kolip 2002, 15). Männer und Frauen weisen in ihren Krankheitsbildern und ihrem Gesundheits- und Krankheitsverhalten unterschiedliche Ausprägungen auf (vgl. ebd., 14). Generell kann festgehalten werden, dass Männer ab dem mittleren Erwachsenenalter eher an Krankheiten leiden, die zum Tode führen, während Frauen überwiegend chronische Krankheiten und Beeinträchtigungen im psychischen und psychosomatischen Bereich aufweisen (vgl. Brähler/Felder 1999, 23; Hurrelmann/Kolip 2002, 19; Kolip 2003, 643).
1.2.1 Geschlechterbezogene Differenzen im Umgang mit Gesundheit und Krankheit
Fasst man die Ergebnisse epidemiologischer Studien in Kürze zusammen, zeigen sich deutliche Differenzen in den Bereichen Inanspruchnahme von Hilfe, Körperkonzept, gesundheitsbezogenes Verhalten und Alltagswissen über Gesundheit und Krankheit:
Frauen klagen häufiger über gesundheitliche Beschwerden und nehmen mehr therapeutische Hilfe in Anspruch. Sie werden häufiger mit Medikamenten und Psychopharmaka behandelt und weisen eine höhere Frequentierung psychiatrischer und psychotherapeutischer Institutionen auf (vgl. Sieverding 1999, 32; vgl. Maschewsky-Schneider 1997, 183)[3]. Heute wird von einer „Pathologisierung des Frauenbildes“ (Maschewsky-Schneider/Sonntag/Klesse 1999, 98) gesprochen, d.h. der Frau wird die Rolle der Leidenden, Kranken zugeschrieben und von Seite der Medizin in dieser Rolle verstärkt. Damit einher geht die „Psychologisierung der weiblichen Gesundheit“, die gesundheitliche Beschwerden und Klagen von Frauen in erster Linie auf psychosomatische und seelische Ursachen zurückführt (vgl. ebd.). Die „Medikalisierung“ von Lebensphasen erscheint als weiteres schwerwiegendes Problem in der medizinischen Versorgung von Frauen (vgl. Helfferich 2000, 1). Männer fühlen sich im Vergleich zu Frauen gesünder und suchen sich ärztliche, therapeutische oder soziale Unterstützung nur in Situationen absoluter Hilflosigkeit oder schwerer Krankheit (vgl. Hurrelmann/Kolip 2002, 20).
Betrachtet man den Umgang mit dem Körper etwas genauer, zeigen sich „geschlechts-spezifische somatische Kulturen und Lebensentwürfe von Frauen und Männern“ (ebd., 22). Die Grundmuster im Umgang mit dem eigenen Körper und den verfügbaren Ressourcen prägen das gesamte Verhalten und konstruieren für Frauen und Männer charakteristische Verhaltensweisen. Frauen verbinden Gesundheit mit Wohlbefinden und weisen ein reflexives Verhältnis zu ihrem Körper auf. Dies zeigt sich in einem ausgeprägten Empfinden für den eigenen Körper, der sensiblen Wahrnehmung von Störungen und der positiven Einstellung gegenüber Gesundheitspraktiken sowie der Bereitschaft, gesundheitsförderliche Verhaltens-weisen aktiv umzusetzen (vgl. Hurrelmann/Kolip 2002, 21). Bei Männern herrscht ein eher funktionalistischer Umgang mit dem eigenen Körper und den eigenen Ressourcen vor.
Neben dem unterschiedlichen „Körpermanagement“[4] (ebd., 22) zeigen sich weitere gravierende Unterschiede im Umgang mit Risiken. Männer tendieren zu einer riskanteren Lebensweise und räumen präventiven Maßnahmen wenig Platz ein[5], während Frauen ihren Körper mitunter als Medium ihrer Persönlichkeit nutzen und einen stärkeren Bezug zu gesundheitlichen Themen aufweisen. Frauen wird mit der Vorstellung differenzierter Aufgabenbereiche von Mann und Frau, die Zuständigkeit für die Pflege und Fürsorge der Familie zugewiesen. Nicht zuletzt aus diesem Grund verfügen sie bis heute über ein breiteres Alltagswissen über Gesundheit und Krankheit und fungieren in vielen Fällen als „Laienmedizinerinnen“ (Hurrelmann/Kolip 2002, 20; vgl. Faltermaier 1994, 152). Demgegenüber steht allerdings der „Androzentrismus des Medizinsystems“ (Schmerl 2002, 45), welcher für Frauen nahezu ausschließlich pflegende Berufe bereitstellt (vgl. Hurrelmann/Kolip 2002, 22).
Die Ursachen der geschlechtsspezifischen Differenzen in den Krankheitsbildern konnten bislang anhand der vorliegenden Studien und Erklärungsmodelle nicht abschließend herausgearbeitet werden (vgl. Sieverding 1999, 32; Kolip 2003, 649)[6]. In Bezug auf das Thema Geschlecht und Gesundheit kann anhand bisheriger Daten abschließend lediglich belegt werden, dass Frauen und Männer anders krank sind und dies neben der zugrundeliegenden biologischen Differenzen auf die Bedeutung der sozialen und kulturellen Konstruktion von Geschlecht zurückgeführt werden kann (vgl. Maschewsky-Schneider 1997, 196; Hurrelmann 2006, 59).
1.3 Psychische Erkrankungen
Die Bedeutung psychischer Krankheiten wurde lange Zeit unterschätzt. Erst seit den 1990er Jahren bieten methodisch fundierte nationale und internationale Studien Angaben zur Verbreitung psychischer Störungen. Laut Ergebnissen von internationalen Studien in den USA, Australien und Kanada leidet im Verlauf eines Jahres nahezu ein Drittel der Gesamtbevölkerung an einer psychischen Erkrankung, die mit erheblichen Einschränkungen im psychosozialen Bereich, insbesondere der Lebensgestaltung und der Arbeitsproduktivität verbunden ist (vgl. Merbach ua. 2002, 258). Die im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation und der Weltbank durchgeführte Studie „Global Burden of Disease Study 2000“ konstatiert eine seelische Erkrankung bei 20% der in Europa lebenden Personen und etwa 12% der Bevölkerung weltweit (vgl. Gesundheitsberichterstattung 2006, 29). Da eine empirische Erfassung äußerst schwierig ist, muss man des Weiteren von einer hohen Dunkelziffer ausgehen (vgl. Bäcker 2008, 97).
In Deutschland fand 1998 im Rahmen des Bundesgesundheitssurvey eine erste Erhebung in Form des Zusatzsurvey „Psychische Störungen“ statt. Ausgehend von dem Datensatz des Gesundheitssurveys wurde dabei eine kleinere Stichprobe auf die Prävalenz von affektiven, somatoformen und Angststörungen untersucht[7] und nach Alter, Geschlecht sowie nach Auswirkungen auf die Arbeitsproduktivität ausgewertet. Es zeigte sich, dass diese mit 17,3 % der Störungen in Deutschland weit verbreitet sind und zu den „besonders häufigen, kostenintensiven und sehr stark und oft dauerhaft die Lebensführung Betroffener einschränkenden Formen von Erkrankungen gehören“ (Wittchen ua., 1999). In allen Altersgruppen traten Angststörungen (9%) am häufigsten auf, gefolgt von somatoformen (7,5%) und affektiven Störungen (6%). Frauen sind mit 23,3% in jeder Altersgruppe häufiger betroffen als Männer mit 11,7% (vgl. Kolip 2003, 647; bmfsfj 2001, 9), wobei sich geschlechtstypische Ausprägungen in den Prävalenzraten einzelner Störungen zeigen.
Frauen weisen tendenziell höhere Raten psychischer Störungen auf als Männer, wobei auffallend ist, dass die Art des psychischen Leidens bei beiden Geschlechtern unterschiedlich ausfällt (vgl. Sieverding 1999). Frauen erkranken überwiegend an Psychoneurosen, Depressionen, psychosomatischen Erkrankungen und Essstörungen. Bei Männern zeigt sich hingegen eine größere Prävalenz von Persönlichkeitsstörungen, Delinquenz und aggressivem Verhalten, motorischen Störungen, sexuellen Abweichungen und Abhängigkeitserkrankungen (vgl. Brähler/Felder 1999, 24)[8].
Die gesundheitsökonomische Bedeutung psychischer Erkrankungen wird anhand der Befunde zur Arbeitsproduktivität und Daten zur Verweildauer in vollstationärer Behandlung deutlich. Mit 4,1% der Arbeitsunfähigkeitsfälle verweisen die Gesetzlichen Krankenkassen auf eine deutliche Zunahme psychischer Erkrankungen seit 1980 (vgl. Bäcker ua. 2008, 97)[9]. Betriebliche Rationalisierungsprozesse sowie zunehmende psychische Belastungen am Arbeitsplatz wie Monotonie, Zeitdruck und geringe Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten werden als wesentliche Ursachen für psychische Erkrankungen gesehen (vgl. Marzinzik 2007, 24). Nach Hochrechnungen der WHO werden 2020 depressive Erkrankungen den zweithöchsten Rang unter den Krankheitsformen einnehmen, die mit den meisten Belastungen verbunden sind (vgl. Wittchen 1999, 217; vgl. Merbach ua. 2002, 258).
1.3.1 Erklärungsansätze geschlechterdifferenter psychischer Störungen
In der psychiatrischen Forschung stoßen frauenspezifische Fragestellungen bislang auf wenig Interesse. Eine deutsche epidemiologische Studie über die Zusammenhänge bei der Entstehung, dem Verlauf und der Therapie psychischer Erkrankungen von Frauen liegt bislang noch nicht vor (vgl. bmfsfj 2001, 577).
Aktuelle Erklärungsmodelle stimmen darin überein, dass eine einseitig bio-medizinische Betrachtungsweise (die sich auf genetische oder hormonelle Faktoren als verursachende Kraft bezieht) weder die Pathogenese psychischer Störungen von Frauen, noch die Unterschiede der Krankheitsbilder bei Frauen und Männern erklären kann. Bereits seit einiger Zeit werden soziale und gesellschaftliche Aspekte als Bedingungskontext fokussiert. Laut eines Berichtes der WHO zu „Psychosocial and Mental Health Aspects of Women`s Health“ steht die erhöhte Vulnerabilität von Frauen in Verbindung mit der Konstellation von Familienstand, Arbeit und gesellschaftlicher Rolle der Frau (vgl. bmfsfj 1999, 576). Die unterschiedlichen Erfahrungen, die das Erwachsenenleben für beide Geschlechter bereitstellt, werden dabei als Ausgangspunkt der geschlechtstypischen Ausprägungen psychischer Störungen gesehen und werden im Folgenden näher betrachtet.
Die Frage, welche Handlungsspielräume, Zuständigkeiten und Kontexte mit den „normalen“ Rollen erwachsener Frauen und Männer verbunden sind, führte bereits zu wesentlichen Erkenntnissen über das Auftreten von psychischen Störungen bei Frauen und lieferte gleichzeitig wichtige Erkenntnisse über die Bedeutung des Geschlechterverhältnisses für die Entstehung verschiedener psychischer Krankheiten bei Frauen und Männern (vgl. Schmerl 2002, 41). Der Einfluss gesellschaftlicher Geschlechtsbilder auf Gesundheitsvorstellungen konnte bereits in den 70er Jahren belegt werden[10] und setzt sich insbesondere im Umgang mit gesundheitlichen Beschwerden von Frauen bis heute fort (vgl. Kap. 1.3.1 „Psychologisierung der weiblichen Gesundheit“).
Ein Ansatz der New-Public-Health Forschung, der die Geschlechterverhältnisse fokussiert, vertritt die Annahme, dass „die Interaktion zwischen Männern und Frauen und die Umstände, unter denen sie interagieren, in bedeutsamer Weise zu den Chancen und Einschränkungen der Gesundheit beitragen“ (Schofield u.a. 2002, 73). Dabei werden der Arbeitsplatz und die Familie als die wichtigsten Interaktionsfelder betrachtet, in denen sich die Interdependenz des sozialen Geschlechts im Alltag vollzieht und gesundheitliche Konsequenzen mit produziert (vgl. ebd., 74).
Die Familie als protektiver und pathogener Faktor
Vergleicht man die Gesundheit unverheirateter Frauen und Männer mit verheirateten Partnern, erweist sich die Ehe als protektiver Faktor für Männer während verheiratete Frauen, insbesondere junge Frauen mit Kleinkindern, die schlechteste psychische Verfassung aufweisen (vgl. Erhart ua. 2008, 428). Körperliche oder sexuelle Gewalt in der Familie stellt für zahlreiche Frauen einen weiteren pathogenen Faktor dar. Innerfamiliäre Gewalt richtet sich deutlich häufiger gegen Frauen als gegen Männer[11] und führt in vielen Fällen zu manifesten internalisierenden Störungen wie Depressionen oder Angststörungen bei den Betroffenen (vgl. Merbach ua. 2002, 268). In der Versorgungspraxis und der öffentlichen Diskussion wird dieses Thema jedoch in seiner Bedeutung für den gesundheitlichen Verlauf nicht anerkannt und all zu schnell als Privatangelegenheit abgehandelt (vgl. bmfsfj 2001, 580; Helfferich 2000, 1).
Die Doppelbelastung der Frau als Charakteristikum der modernen Frauenrolle
Nach wie vor ist die Rolle der Frau von der traditionellen Rollenverteilung zwischen den Geschlechtern geprägt, die den Aktionsradius der Männer in der Arbeitswelt verankert während die Zuständigkeiten der Frauen sich überwiegend auf den privaten Bereich beschränken. In der Arbeitswelt lässt sich zwar ein deutlicher Anstieg der Anzahl an erwerbstätigen Frauen verzeichnen, in der Haus- und Familienarbeit finden allerdings kaum Veränderungen statt - die männliche Berufsrolle scheint unantastbar. Das Dilemma der Frauen liegt somit in der doppelten Belastung durch Arbeit und Familie (vgl. Sieverding 1999, 34; Kolip 2003, 652). Im Durchschnitt sind ihre „beruflichen Möglichkeiten mit weniger Autonomie, mehr Monotonie, weniger Aufstiegschancen und schlechterer Entlohnung verbunden“ (Schmerl 2002, 40).
Im privaten Bereich sind sie für die „Gefühlsqualität familiärer Bindungen“ (Schmerl 2002, 38) und die Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen verantwortlich. Handlungsspielräume sind eher begrenzt, die Anforderungen beziehen sich überwiegend auf den sozial-emotionalen Bereich und versprechen kaum Anerkennung. In vielen Fällen ergeben sich daraus unvereinbare Erwartungen, auf die Frauen mit „internalisierenden“ Symptomen, d.h. persönlichen Schuld- und Ohnmachtsgefühlen reagieren (vgl. ebd.).
Neuere Studien aus den USA und Australien im Rahmen der New-Public-Health Forschung machen jedoch darauf aufmerksam, dass ein höheres Maß an Verantwortung für die Familie und den Haushalt für Frauen mit gesundheitlichen Vorteilen verbunden sein kann, wenn sie parallel dazu einer bezahlten Teilzeitarbeit nachgehen. Hingegen ergeben sich aus der Kombination einer vollen Verantwortung für die Familie und einer schlecht bezahlten Erwerbsarbeit zusätzliche Belastungen für die Gesundheit von Frauen (vgl. Schofield 2002, 74). Die Beziehung zwischen den Geschlechtern und die Inanspruchnahme einer möglichen Rollenvielfalt birgt für beide Geschlechter die Möglichkeit ihre Gesundheit positiv zu beeinflussen.
1.4 Zusammenfassung
Aus der Epidemiologie ist heute hinreichend bekannt, dass soziale Ungleichheit, Geschlechtszugehörigkeit, das soziale und kulturelle Umfeld sowie gesundheitsschädigende Verhaltensweisen die wichtigsten Risikofaktoren für die in den Industriegesellschaften typischen Krankheitsbilder darstellen (vgl. Erhart ua. 2008, 426).
Das Krankheitsspektrum umfasst heute überwiegend chronisch-degenerative Erkrankungen und Krankheiten, die mit der gesamten Lebensweise der Moderne verflochten sind und aus veränderten psychischen, physischen, ökologischen und sozialen Belastungen resultieren (vgl. Sting/Zurhorst 2000, 9). Der Anteil psychischer Erkrankungen nimmt bei gleichzeitig fortschreitender Lebenserwartung dabei stetig zu. Frauen sind davon in höherem Maße betroffen als Männer (vgl. Hurrelmann/Kolip 2002; Kolip 2003). Gesundheit und Krankheit sind keine objektiven oder natürlichen Kategorien, sondern immer abhängig vom historischen, kulturellen und sozialen Kontext und der gesellschaftlichen Umgangsweise mit Gesunden und Kranken (vgl. Sting/Zurhorst 2000, 9). Geschlechterbezogene Differenzen in der Ätiologie und im Verlauf psychischer Störungen erscheinen als Konsequenz der konfligierenden Erwartungen und individuellen und gesellschaftlichen Normvorstellungen, auf die von medizinischer Seite bislang größtenteils unzureichend und vordergründig klassifizierend reagiert wird.
Hinsichtlich der Frage nach geschlechtergerechten Versorgungsmodellen scheint die theoretische Auseinandersetzung und Abgrenzung der Begriffe Gesundheit und Krankheit vor diesem Hintergrund notwendig.
2. Krankheit und Gesundheit im wissenschaftlichen Diskurs: von der Pathogenese zur Salutogenese
2.1 Gesundheit - eine erste begriffliche Annäherung
Auf der Suche nach einer wissenschaftlichen Definition von Gesundheit begegnet man einer Vielzahl verschiedener Vorstellungen, die je nach Fachgebiet eigene Schwerpunkte aufweisen und als dynamisches Konstrukt dem Wandel der Zeit und den Gesellschaftsverhältnissen unterworfen sind. Die Bedeutung der wissenschaftlichen Definitionen für meine Frage liegt in der Tatsache begründet, dass sie wesentlichen Einfluss auf die Gestaltung präventiver und gesundheitsfördernder Maßnahmen haben.
„Welche Ansicht verwendet wird, hat wesentliche Bedeutung für die Beurteilung der Gründe der Gesundheit, für die Ermittlung von Gesundheitsbedürfnissen und -prioritäten und für die Bestimmung von technischen, professionellen, sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und umweltmäßigen Ressourcen, die für die Gesundheitsförderung geeignet sind“ (Anderson 1984, 63 f.).
Im Wesentlichen lassen sich vier Perspektiven unterscheiden, von denen aus die Phänomene Gesundheit und Krankheit analysiert werden können; einer naturwissenschaftlich-somatischen, einer soziologischen, einer psychologischen sowie einer juristischen Perspektive (vgl. Becker 1982, 4). Die Ermittlung der verschiedenen Dimensionen der Termini Gesundheit und Krankheit erfolgt nachstehend in Anlehnung an die von Klaus Hurrelmann (2006) und Heiko Waller (2006)[12] vorgenommene Unterscheidung zwischen disziplin-gebundenen bzw. monodisziplinären und mehrperspektivischen bzw. interdisziplinären Definitionen.
2.1.1 Disziplingebundene Definitionen
Gesundheit als Abwesenheit von Krankheit - die Einseitigkeit biomedizinischen Denkens
Das medizinische Verständnis von Gesundheit basiert auf dem biomedizinischen Krankheitsmodell und fokussiert die Funktionsfähigkeit des Körpers als bestimmendes Moment.
Im klinischen Wörterbuch Pschyrembel wird Krankheit beschrieben als „Störung der Lebensvorgänge in Organen oder im gesamten Körper mit der Folge von subjektiv empfundenen bzw. objektiv feststellbaren körperlichen, geistigen bzw. seelischen Veränderungen“ (Pschyrembel 2002, 904). Der Begriff Krankheit steht dabei „für eine definierbare Einheit typischer ätiologisch, morphologisch, symptomatisch und nosologisch beschreibbarer Erscheinungen, die als eine bestimmte Erkrankung verstanden wird“ (ebd.). Der Versuch einer inhaltlichen Zustandsbeschreibung findet sich nur in der Bestimmung von Krankheit.
Gesundheit wird im Gegensatz dazu lediglich negativ, als Abwesenheit von Krankheit verstanden und definiert als „das subjektive Empfinden des Fehlens körperlicher, geistiger und seelischer Störungen oder Veränderungen bzw. ein Zustand, in dem Erkrankungen und pathologische Veränderungen nicht nachgewiesen werden können“ (ebd., 594). Im weiten Sinn bezieht sich das medizinische Verständnis von Gesundheit auf die von der WHO festgelegte Definition (s.u.). Eine rein biomedizinische Perspektive auf Gesundheit zeigt deutlich, dass wichtige Dimensionen von Gesundheit wie z.B. Lebenszufriedenheit oder Selbstverwirklichung vernachlässigt werden (vgl. BzgA 1998, 16).
Krankheit als regelwidriger Zustand mit Konsequenzen - das Verständnis der Jurisprudenz
In der Sozialrechtsprechung wird seit 1972 eine rechtswissenschaftliche Definition von Krankheit mit hoher Praxisrelevanz verwendet. Demnach ist unter Krankheit „ein regelwidriger körperlicher oder geistiger Zustand zu verstehen, der entweder lediglich die Notwendigkeit ärztlicher Behandlung oder zugleich (in Ausnahmefällen auch allein) Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat“ (Bäcker 2008, 92). Vor dem Hintergrund der Steuerungsfunktion für die Verteilung und berechtigte Inanspruchnahme sozialer Leistungen wie z.B. den Erhalt von Krankengeld oder die Erstattung ärztlicher Behandlungskosten lehnt sich der Krankheitsbegriff dabei an die biologisch-medizinisch geprägte inhaltliche Bestimmung an. Die subjektive Perspektive findet keine Berücksichtigung. Der ärztlichen Behandlung sowie der Arbeitsfähigkeit werden besondere Bedeutung eingeräumt, gleichzeitig ermöglicht die relative Offenheit der Definition die Integration weiterer Krankheitsbilder. Die sozialgerichtliche Rechtsprechung erkennt heute z.B. psychosomatische Erkrankungen, Neurosen und Alkoholismus als Krankheiten an, so dass die Betroffenen durch die Übernahme der erforderlichen Behandlungskosten von Seite der Gesetzlichen Krankenkassen unterstützt werden (vgl. Bäcker 2008, 92 f).
Gesundheit als bestimmendes Moment für den Erhalt der Gesellschaft - die soziale Dimension der Gesundheit
Auseinandersetzungen zur Bestimmung von Gesundheit und Krankheit unter soziologischer Perspektive gehen auf die rollen- und systemtheoretischen Ansätze von Talcott Parsons zurück, welcher einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung der Medizinsoziologie[13] als eigenständiger Disziplin geleistet hat (vgl. Faltermaier 1994, 28) und großen Einfluss auf soziologische Analysen ausübte (vgl. Becker 1982, 6).
Im Rahmen seiner Analyse von der „Struktur und Funktion der modernen Medizin“ (1958) beschreibt Parsons Gesundheit und Krankheit in ihrer Bedeutung für das Funktionieren der Gesellschaft und erweitert damit das medizinische Verständnis um eine soziale Dimension.
Gesundheit ist demnach „eine der funktionalen Vorbedingungen eines jeden sozialen Systems“ (Parsons 1958, 10). Gesunde Menschen sind in der Lage, die an sie gerichteten Anforderungen der Gesellschaft zu erfüllen und in Einklang mit den „biologisch-organischen und psychisch-seelischen Grundstrukturen der Persönlichkeit“ (Hurrelmann 2006, 90) zu bringen. In der Übernahme und Erfüllung sozialer Rollen, welche Parsons als „die Summe der Erwartungen, die dem Inhaber einer gesellschaftlichen Position über sein Verhalten entgegengebracht werden“ (ebd.) definiert, liegt das entscheidende Kriterium für die Klassifizierung eines Individuums als gesund oder krank. Kann das Auftreten von Krankheit nicht durch einen ausreichenden Anteil an gesunden Individuen ausgeglichen werden, wirkt sich dies „dysfunktional“ auf das System aus - „weil Krankheit die Erfüllung sozialer Rollen unmöglich macht“ (Parsons 1958, 10).
Krankheit umfasst eine biologische und eine soziale Dimension und wird als „Störung des normalen Funktionierens des Menschen“ bezeichnet, was „den Zustand des Organismus als biologisches System als auch was seine individuellen und sozialen Anpassungen angeht“ (Parsons 1958, 12). Krankheit entspricht demnach einer Form abweichenden Verhaltens, dem das Systems mit institutionalisierten Kontrollmechanismen begegnet. Die Rolle des Arztes erhält durch die Einbindung in die in hohem Maße institutionalisierte Medizin der heutigen Gesellschaft ihre Bedeutung als ein „Mechanismus der sozialen Kontrolle“ (ebd., 52), dessen Aufgabe in der Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit des Patienten besteht. Ein weiterer Kontrollmechanismus liegt in der sozialen Konstruktion einer spezifischen Rolle des Kranken, welche in vier Aspekten die institutionalisierten Erwartungen sowie entsprechende Emotionen und Sanktionen bündelt[14].
Aus rollen- und systemtheoretischer Perspektive leiten sich sowohl die Definitionen von Gesundheit und Krankheit als auch die Erwartungen an die Rolle des Kranken aus dem Funktionieren einer Gesellschaft ab. Parsons formuliert im Rahmen seiner Überlegungen den „Prototyp“ (Franke 1993, 24) der soziologischen Definition von Gesundheit als Rollenerfüllung, der heute sowohl in der Rechtsprechung als auch im Versicherungswesen verwendet wird und die Diskussion um geschlechtsspezifische Rollenbilder und soziale Stereotype nachhaltig prägt.
2.1.2 Mehrperspektivische Definitionen
Gesundheit als Homöostase des Individuums - Bestimmungsmerkmale aus psychologischer Perspektive
In der Psychologie wird die Komplexität der Begriffe Gesundheit und Krankheit anhand der Einbeziehung der physischen und psychischen Dimension ersichtlich.
Krankheit entspricht demnach der „Beeinträchtigung des physischen oder psychischen Gleichgewichts und somit [einer] Störung der normalen Funktionen der Organe und Organsysteme“ (Dorsch 2004, 516; Einfügung: C.S.). Die Abweichung von der Norm verweist auf das Vorliegen einer Krankheit. Durch die Anmerkung, dass eine „scharfe Grenzziehung“ (Dorsch 2004, 516) zwischen Krankheit und Gesundheit als normkonformem Zustand nicht möglich ist, wird die Einstufung von abweichendem Verhalten als Krankheit jedoch relativiert. Statt der normierten Festlegung auf einen bestimmten Erlebens- und Verhaltenskomplex wird die Annahme einer Homöostase zum Bezugspunkt für die Diagnose.
Die Definition von Gesundheit erfolgt in Anlehnung an Peter Becker (1982)[15] als psychische Gesundheit und wird bestimmt durch das „Überwiegen der protektiven, kompensatorischen Anteile und der Umweltstabilisierungen im individuellen System einer Persönlichkeit gegenüber den konstitutionellen Vulnerabilitäten und den Umweltbelastungen“ (Dorsch 2004, 366). Dabei sind die drei inhaltlichen Komponenten Regulationskompetenz, Selbst-aktualisierung sowie Sinnfindung, welche Becker aus der Analyse bestehender Modelle zur seelischen Gesundheit[16] als zentrale Kriterien einstufte, besonders relevant (vgl. Becker 1982, 282).
Regulationskompetenz bezieht sich in diesem Zusammenhang auf die Fähigkeit der internen und externen Anpassungsleistungen, die ein Individuum im Zustand seelischer Gesundheit vollziehen kann. Diese Komponente begegnet uns unter anderem in den rollen- und systemtheoretischen Überlegungen Parsons als Rollenkompetenz (ebd., 283 f.).
Das Kriterium der Selbstaktualisierung, welches auch unter dem äquivalenten Begriff Selbstverwirklichung verwendet wird, bezieht sich auf die freie Entfaltung der individuellen Anlagen einer Person in Auseinandersetzung mit der Umwelt sowie der Befriedigung der „wahren“ Bedürfnisse und Interessen. Grundlage der Komponente der Selbstaktualisierung stellen die empirisch gesicherten Erkenntnisse dar, dass sich Menschen in ihren genetisch determinierten und sozialisatorisch erworbenen Eigenschaften unterscheiden und aus diesem Grund verschiedene Wege der Selbstverwirklichung - im Rahmen der jeweils individuell begrenzten Anpassungsfähigkeit - suchen. „Der Wunsch des Menschen nach individueller Freiheit ist offenbar tief verwurzelt, und das Verfolgen persönlicher Ziele und Interessen sowie die Weiterentwicklung eigener Fähigkeiten werden als befriedigend erlebt“ (Becker 1982, 285).
Das dritte Kriterium seelischer Gesundheit, die Sinnfindung, leitet Becker aus der häufig bestätigten Korrelation von Sinnverlust und psychischer Erkrankung ab. Aus handlungs-theoretischer Perspektive argumentiert er, dass „die Bejahung bestimmter Ziele und Werte sowie das Zur-Verfügung-Stehen eines kohärenten Bezugs- und Orientierungssystems neben ausreichenden instrumentellen Fähigkeiten die Voraussetzungen jeglichen planvollen und erfolgreichen Handelns bilden“ (ebd., 286). Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, verkleinert sich das persönliche Handlungsfeld zunehmend und begünstigt damit die Genese psychischer Erkrankungen. Eine weitere Begründung vertritt er in der Hypothese, dass die Suche nach Sinn der Natur des Menschen innewohnt (vgl. ebd.).
Gesundheit als körperliches, soziales und psychisches Wohlbefinden - das Leitbild der WHO
Der erste Versuch, eine konsensfähige Definition für den wissenschaftlichen und sozialpolitischen Umgang mit Gesundheit und Krankheit festzulegen, basiert auf der Initiative der Weltgesundheitsorganisation WHO. Die Gründungsakte von 1946 enthält bereits folgende Definition, die als Fundament für die Entwicklung von konkreten Zielsetzungen einer weltweiten Gesundheitsförderung bis heute wirksam ist (vgl. Schmidt/Kolip 2007): „health is a state of complete physical, social and mental well-being, and not merely the absence of disease or infirmity“ (WHO 1946).
Die Vorteile der Definition liegen zum einen in der positiven Darstellung von Gesundheit als Zustand, der eine soziale, körperliche und geistig-seelische Dimension umfasst und dem subjektiven Empfinden eine herausragende Bedeutung zuweist (vgl. Trojan 2002, 195). Darüber hinaus wird Gesundheit mehrdimensional bestimmt und eröffnet damit einen interdisziplinären Zugang. Die Bezugnahme auf das subjektive Empfinden von Gesundheit drückt sich in der begrifflichen Festlegung auf „Wohlbefinden“ im umfassenden Sinne aus und weist damit die Fremdeinschätzung von professioneller Seite in ihrer Bedeutung zurück. Hurrelmann (2006) merkt jedoch kritisch an, dass Gesundheit in dieser Definition als utopischer Zustand eines „völligen“ körperlichen, psychischen und sozialen Wohlbefindens beschrieben wird, der in dieser Idealform kaum zu erreichen ist (vgl. Franke 1993, 17). Gesundheit und Krankheit scheinen einander völlig entgegengesetzt positioniert zu sein. Das genaue Verhältnis kann aus der Definition nicht abgeleitet werden (vgl. Hurrelmann 2006, 117)[17]. Daneben muss der Entwicklungsstand der verschiedenen Länder berücksichtigt werden, vor dessen Hintergrund sich Gesundheit als dynamischer Prozess konstruiert. Eine Gleichsetzung der Lebensumstände der Menschen aus Dritte-Welt-Ländern mit den Lebensumständen dem Menschen in Industrieländern erscheint im Hinblick auf die daraus abgeleitete Vorstellung eines vollkommenen Wohlbefindens zynisch und „transzendiere die Grenzen dessen, was sinnvollerweise unter Gesundheit zu verstehen sei“ (Franke 1993, 17).
Die positive inhaltliche Bestimmung der WHO setzte den Ausgangspunkt einer konstruktiven interdisziplinären Diskussion. Trotz kritischer Einwände liegt ihr wesentlicher Verdienst unbestritten in der Bereicherung der Vorstellungen von Gesundheit um rechtliche, politische und soziale Dimensionen die grundlegend für aktuelle Bemühungen einer adäquaten Gesundheitsförderung sind. Gesundheit wird nicht als Zustand, sondern als Ziel proklamiert, das jedem Menschen als grundlegendes Recht zusteht und von staatlicher Seite zu fördern ist. In Anlehnung an das psychologische Verständnis von Gesundheit geht man mittlerweile davon aus, dass Menschen dann gesund sind, „wenn sie sich mit ihren körperlichen, psychischen und sozialen Eigenschaften in Einklang mit der eigenen Entwicklung, den eigenen Möglichkeiten und Zielvorstellungen befinden“ (Bäcker 2008, 93). Dementsprechend weisen Anforderungen, die nicht bewältigt werden können, auf das Vorliegen einer Störung oder Erkrankung hin. Gesundheit und Krankheit sind als zwei Pole eines Kontinuums zu verstehen zwischen denen sich keine scharfe Grenzlinie befindet. Sowohl die Gesundheits-wissenschaften als auch die Gesundheitspolitik orientieren sich in Theorie und Praxis derzeit an der salutogenetischen Ausrichtung der WHO-Definition (vgl. Bäcker 2008, 93).
2.1.3 Zusammenfassung
„Gesundheit ist also kein eindeutig definierbares Konstrukt; sie ist schwer fassbar und nur schwer zu beschreiben“ (BzgA 1998, 16). Die Annäherung an eine begriffliche Bestimmung von Gesundheit aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Perspektiven verdeutlicht die Komplexität des Konstruktes Gesundheit.
Die multiperspektivischen Vorstellungen darüber, was Gesundheit kennzeichnet, setzen sich mit Schwerpunkten auf individueller oder gesellschaftlicher Ebene mit dem Verhältnis von Anforderungen und Ressourcen auseinander, die weit über die monodisziplinäre Betrachtung der Medizin hinausgehen. Sie stellen die Basis für neue integrative Modelle (z.B. das salutogenetische Modell von Antonovsky, das Sozialisationsmodell von Hurrelmann) in der Gesundheitsforschung dar. Das salutogenetische Modell wird im nächsten Kapitel genauer betrachtet. Daneben richten sich unter Federführung der WHO weltweite politische Bemühungen zur gesundheitsgerechten Gestaltung aller Lebensbereiche an der proklamierten Idealnorm von Gesundheit aus.
Dennoch bieten auch die monodisziplinären Überlegungen Parsons als auch die Weiter-entwicklungen system- und interaktionstheoretischer Ansätze wichtige Hinweise auf gesellschaftliche Definitions- und Machtverhältnisse, die über die Festlegung normativer Vorstellungen und Verhaltensweisen wesentlichen Einfluss auf Wahrnehmungs- und Verarbeitungsprozesse der Betroffenen und der gesellschaftlichen Konstruktion von Gesundheit und Krankheit haben. Gerade im psychiatrischen Versorgungssystem müssen derartige Zusammenhänge präsent sein um einen differenzierteren Blick auf Normalität und Abweichung zu erlangen und Sinn und Zweck von Prävention und Gesundheitsförderung kritisch hinterfragen zu können.
Abschließend soll in Anlehnung an die Expertise von Bengel, Strittmatter und Willmann (1998) festgehalten werden, ob die Auseinandersetzung mit dem Konstrukt Gesundheit zu einem tragbaren Konsens in den Wissenschaften geführt hat. Der Inhalt des folgenden Zitats stellt gleichzeitig den Rahmen dar, in dem Fragen zur Gesundheit und Gesundheitsförderung in dieser Arbeit verhandelt werden:
„Heute besteht in den Sozialwissenschaften und der Medizin Einigkeit darüber, daß Gesundheit mehrdimensional betrachtet werden muß: Neben körperlichem Wohlbefinden (z.B. positives Körpergefühl, Fehlen von Beschwerden und Krankheitsanzeichen) und psychischem Wohlbefinden (z.B. Freude, Glück, Lebenszufriedenheit) gehören auch Leistungsfähigkeit, Selbstverwirklichung und Sinnfindung dazu. Gesundheit hängt ab vom Vorhandensein, von der Wahrnehmung und dem Umgang mit Belastungen, von Risiken und Gefährdungen durch die soziale und ökologische Umwelt sowie vom Vorhandensein, von der Wahrnehmung, Erschließung und Inanspruchnahme von Ressourcen“ (BzgA 1998, 16).
2.2 Orientierung an Krankheit oder Gesundheit?
Fragen der Krankheitsverhütung und Gesundheitsförderung werden im wissenschaftlichen Diskurs abhängig von den vorherrschenden Krankheitsbildern und Gesellschaftsstrukturen historisch unterschiedlich beantwortet. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts manifestiert sich jedoch ein medizinisches Denkmodell, das bis heute die Grundlage unseres Gesundheitswesens darstellt - unberücksichtigt dessen, dass im 20. Jahrhundert neue, integrative Modelle auftreten, die den Blick auf Krankheit wesentlich erweitern. Anstoß für eine erneute Diskussion um den Stellenwert von gesundheitlicher Versorgung liefert in den 80er Jahren das salutogentische Modell von A. Antonovsky. Dessen Bedeutung liegt insbesondere in einem grundlegenden Perspektivenwechsel, der nicht Krankheit, sondern Gesundheit als Ausgangspunkt jeglicher Diskussion um Möglichkeiten des Erhalts und der Förderung von Gesundheit postuliert.
Im Folgenden werden die drei Krankheitsmodelle, das biomedizinische, das biopsychosoziale und das salutogenetische Modell vorgestellt, wobei der Schwerpunkt auf der Darstellung des letzten liegt.
2.2.1 Das biomedizinische Krankheitsmodell
Das biomedizinische Krankheitsmodell stellt trotz anhaltender Kritik an der reduktionistischen Sicht auf den Menschen auch heute noch die Grundlage unseres Gesundheitswesens, der Schulmedizin und der Prävention dar (vgl. BzgA 1998, 18). Nach einem kurzen Rückblick auf die Entstehungsbedingungen des biomedizinischen Modells werden die wesentlichen Merkmale dargestellt und in Anlehnung an die Beiträge des amerikanischen Sozialmediziner George L. Engel (1979) und des deutschen Psychologen Toni Faltermaier (1994) einer kritischen Betrachtung unterzogen.
Der „Siegeszug“ dieses naturwissenschaftlich fundierten Denk- und Praxismodells lässt sich auf die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts zurückdatieren, eine Zeit in der die Medizin erste Erfolge in der Bekämpfung der weit verbreiteten Infektionskrankheiten verbuchen konnte (vgl. Faltermaier 1994, 15)[18]. Da Gesundheit zur Zeit der Industrialisierung in erster Linie unter ökonomischer Perspektive als „öffentliches Gut“ bzw. „individuelles Kapital“ verstanden wird, kommt der Expertenschaft der Ärzte mit diesem Verdienst eine herausragende Bedeutung zu - Rudolf Virchow, einer der bedeutendsten Vertreter der medizinischen Reformbewegung, spricht von „Hohenpriester der Natur in der humanen Gesellschaft“ (zit. nach Haug 1990, 129). Gesundheit und Krankheit werden nicht in Verbindung zum Individuum gesehen, sondern einer mikroorganisch-medizinischen Betrachtungsweise untergeordnet. Mit naturwissenschaftlichen Messverfahren konzentriert sich das Interesse der Medizin auf Wirkungszusammenhänge des Organismus, die in der Lage sind, die Pathogenese und den Krankheitsverlauf auf der Grundlage naturwissenschaftlicher Gesetze zu erklären - gemäß der Annahme, dass allein die Kenntnis über die Funktionsweise des Körpers die Beseitigung der Störungen der normalen Funktionen des Organismus und seiner Organsysteme ermöglicht. Der Mensch wird zum passiven Träger einer organisch bedingten Krankheit und zum Objekt der ärztlichen Behandlung (vgl. Faltermaier 1994, 21). Soziale, psychologische und verhaltensmäßige Dimensionen von Krankheit werden weder zur Erklärung der Pathogenese noch für den Erfolg einer Behandlung als beeinflussende Variablen berücksichtigt. Der von Descartes vertretene Leib-Seele-Dualismus findet damit seine Fortführung in der reduktionistischen Betrachtung des Menschen und seiner Störungen (vgl. Engel 1979, 66).
In den 60ern des 20. Jahrhunderts erheben sich kritische Stimmen in verschiedenen Fachdisziplinen, wobei die Diskussionen vorrangig um die Frage kreisen, inwieweit das biomedizinische Modell im Umgang mit psychischen Krankheiten - verstanden als Störungen von Denken, Erleben und Verhalten - Anwendung finden kann. Der amerikanische Psychiater Thomas Szasz leitet die Diskussion um den Terminus der psychischen Krankheit programmatisch ein[19] und stellt ihm den Terminus „Devianz“ gegenüber. Die Psychiatrie wird als „Ordnungsmacht entlarvt, die unter Verwendung normativer Kategorien eine Institution sozialer Kontrolle für abweichendes Verhalten“ (Dörr 2005, 19) darstellt. Im Zuge dessen formiert sich die Anti-Psychiatrie mit dem Ziel der „Befreiung des psychiatrisierten Menschen“ (Keupp 1979, 5). Sozialwissenschaftler und Psychologen betonen die Unvereinbarkeit ihrer Auffassung von psychischer Erkrankung und der Interpretation epidemiologischer Befunde mit den naturwissenschaftlichen Paradigmen des medizinischen Modells.
„Weder eine auf die Suche nach organischen Ursachen allein gerichtete Orientierung noch eine daran auch nur metaphorisch gebundene Perspektive könnten die vielfältigen Einsichten in systematische Zusammenhänge von sozialer Lebenssituation und psychischen Störungen integrieren“ (Keupp 1979, 4).
2.2.2 Die Begründung eines biopsychosozialen Modells
In den 70er Jahren bündelt George Engel (1979) die wesentlichen Kritikpunkte, die sich gegen den Reduktionismus des medizinischen Modells richten und stellt ein Gegenmodell auf, das soziale, psychologische und verhaltensmäßige Dimensionen in die Analyse von Krankheiten mit einbezieht. Die subjektive Perspektive der Betroffenen, der Einfluss der Lebensumstände sowie die Rolle des Arztes und die Beziehung zwischen Arzt und Patient müssen demnach mit Hilfe wissenschaftlicher Methoden erschlossen und in die Behandlung integriert werden (vgl. Engel 1979).
„Um eine Grundlage für das Verständnis der Krankheitsdeterminanten und für die Einführung zweckmäßiger Formen der Behandlung und der Gesundheitsversorgung abzugeben, muß ein medizinisches Modell auch den Patienten, den sozialen Zusammenhang, in dem er lebt, und das Komplementärsystem miteinbeziehen, das die Gesellschaft ersonnen hat, damit es sich mit den zersetzenden Effekten von Krankheit befasst, d.h. mit der Arztrolle und dem System der Gesundheitsversorgung“ (Engel 1979, 74).
Bestätigt wurde die Kritik durch die Ergebnisse epidemiologischer, sozialwissenschaftlicher und psychologischer Studien in den 70er und 80er Jahren, die belegen, dass soziale und psychische Faktoren bei der Entstehung und dem Verlauf von Krankheiten eine bedeutende Rolle spielen (vgl. BzgA 1998, 17; Bosshard/Ebert/Lazarus 2007, 23). Umso erstaunlicher ist es, dass sich weder die kritische Auseinandersetzung noch die vorgebrachten und replizierten Ergebnisse aus Sozialwissenschaften und Epidemiologie auf die Monopolstellung des biomedizinischen Modells auswirken konnten[20] (vgl. Filsinger/Homfeldt 2005, 708). Bis heute sichern gesetzliche Regelungen und Finanzierungsvoraussetzungen der Krankheitsbehandlung und -versorgung diese Position ab (vgl. Dörr 2007, 20).
[...]
[1] Im Hinblick auf die Ausweitung des internationalen Tourismus und riskanter Verhaltensweisen wie z.B. dem rückläufigen Gebrauch von Kondomen gewinnen heute allerdings auch Infektionskrankheiten wieder an Bedeutung (vgl. Gesundheitsberichterstattung 2006, 13).
[2] Trotz des zu vermerkenden Rückgangs im Anteil der Gesamtsterblichkeit zählen Herz-Kreislauferkrankungen immer noch zu den häufigsten Todesursachen. Gemeinsam mit den aufgrund der Altersstruktur vermehrt auftretenden Krebserkrankungen verursachen sie 70 % aller Todesfälle (vgl. Gesundheitsberichterstattung 2006, 69).
[3] Bei der Inanspruchnahme von Leistungen des Gesundheitssystems spielt die reproduktive Phase der Frauen und deren zunehmende Medikalisierung allerdings eine wesentliche Rolle. Historisch betrachtet wird die soziale Rolle der Frau schon seit Jahrhunderten mit gesundheitlichen Beschwerden gleichgesetzt. Bedingt durch die reproduktive Phase, in der Menstruation, Schwangerschaften und Klimakterium häufig die Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe erfordern, festigte sich im Lauf der Zeit das Bild von Frauen als „die perfekten Konsumentinnen der Medizin“ (Hurrelmann/Kolip 2002, 19).
[4] Als Körpermanagement bezeichnen Hurrelmann/Kolip „alle Aktivitäten der Gestaltung, Pflege und Nutzung des Körpers und des Erhalts seiner Leistungsfähigkeit“ (ebd. 2002, 22).
[5] Männer tendieren zu Risikoverhaltensweisen, die sie oftmals aus der Jugendphase beibehalten, und arbeiten häufig unter belastenden Bedingungen, wie sie in männlich dominierten Berufsfeldern zu finden sind. Männer ernähren sich ungesünder, konsumieren in größerem Ausmaß die Suchtmittel Tabak und Alkohol und haben im Gegensatz zu Frauen weniger Bezug zu ihrem Körper (vgl. Hurrelmann 2006, 58 f).
[6] Für eine Auseinandersetzung mit den verschiedenen Ansätzen zur Erklärung geschlechtstypischer Krankheits-manifestation sei auf die Beiträge von Elmar Brähler/Hildegard Felder (1999), Monika Sieverding (1999), Martin Merbach ua. (2002) und Klaus Hurrelmann (2006) verwiesen.
[7] In einem 2-Stufen-Design wurden zunächst alle Probanden des Bundesgesundheitssurveys (n=6159 im Alter von 18-65 Jahren) mit einem Screening-Fragebogen und im Anschluss n=4181 Probanden (alle Screen-Postiven und 50% Zufallsauswahl der Screen-Negativen) mit dem Composite International Diagnostic Interview in einem klinisch-psychiatrischen Gespräch untersucht.
Die 4-Wochen-Querschnitts-Prävalenz wurde für die drei Hauptstörungsgruppen nach Klassifikation des International Classification of Diseases (ICD-10) der affektiven Störungen (F30-F33, F34.1 incl. aller Subtypen), der Angststörungen (F40.0-F40.2, F40.8, F41.0, F41.1, F42.0) sowie der somatoformen Störungen (F45.0-F45.2, F45.4) ausgewertet.
[8] Schepanek (1999) bestätigt diese Ergebnisse im Rahmen seiner Studie „Mannheimer Kohortenprojekt“. Auf der Suche nach Manifestationen und Verlauf psychischer Erkrankungen bei einer Zufallsstichprobe aus 600 Personen der Jahrgänge 1935, 1945, 1955 zeigte sich eine Punktprävalenz von 26% aller Fälle, die in einer zweiten Erhebung derselben Stichprobe reproduziert werden konnte. Frauen waren dabei signifikant häufiger von einer psychischen Erkrankung betroffen als Männer (34%:18%) und zeigten eine deutliche Ausprägung in Psychoneurosen (va. Depressionen), psychosomatischen Störungen (z.B. Kopfschmerzen) und Schlafstörungen. Daneben zeigte sich, dass Personen aus der Unterschicht mit 50% der Fälle deutlich stärker betroffen sind (vgl. Schepanek 1999, 161 f).
Bislang konnten epidemiologische Untersuchungen keine Aussagen über geschlechtstypische Unterschiede in der Prävalenz aller psychischen Störungen machen. Allerdings konnte für einzelne Störungen eine Geschlechterdifferenz nachgewiesen werden (vgl. Merbach ua. 2002, 258).
[9] 23,7% der krankheitsbedingten Frühverrentung bei Frauen beruhen auf psychischen Erkrankungen, bei Männern liegt dieser Anteil bei 14% (vgl. bmfsfj 2001, 9). Im Rahmen des Zusatzsurvey „Psychische Störungen“ gaben die Probanden mit affektiven Störungen eine vollständige Arbeitsunfähigkeit von durchschnittlich 1,3 Tagen sowie eine eingeschränkte Arbeitsproduktivität von 7,2 Tagen im Monat an (vgl. Wittchen 1999, 221).
[10] 1970 konnte die Psychologin Brovermann aufzeigen, dass es einen differenten Gesundheitsstandard für Männer und Frauen gibt. Drei Gruppen von Experten wurde die Aufgabe gestellt, einen gesunden Mann, eine gesunde Frau und eine gesunde geschlechtsneutrale Person zu beschreiben. Es zeigte sich, dass die Beschreibung eines gesunden Mannes und einer gesunden geschlechtsneutralen Person sehr ähnlich ausfiel und sich deutlich von der Beschreibung einer gesunden Frau unterschied. Ein gesunder Mann entsprach damit der Norm, eine gesunde Frau erscheint im Vergleich dazu als weniger gesund (Maschewsky-Schneider/Sonntag/Klesse 1999, 105).
[11] Die meisten Untersuchungen gehen davon aus, dass 14 - 25% der Frauen mindestens einmal in ihrem Leben Opfer einer Vergewaltigung waren (vgl. Merbach ua. 2002, 267 f).
[12] Klaus Hurrelmann, Professor für Sozial- und Gesundheitswissenschaften, hat die Gesundheitsforschung in Deutschland wesentlich voran getrieben. Heiko Waller, Professor für Sozialmedizin, setzt sich im Bereich der Gesundheitssoziologie und Sozialmedizin intensiv mit der Thematik auseinander.
[13] Arbeitsschwerpunkt der Medizinsoziologie ist die Analyse des Krankenversorgungssystems, seiner Strukturen und Funktionen (Hurrelmann 2006, 13).
[14] Erstens liefert Krankheit demnach die Legitimationsbasis für die Befreiung des Kranken aus seinen sozialen Aufgaben und Rollenverpflichtungen. Krankheit widerfährt einer Person und kann durch einen reinen Willensakt nicht überwunden werden. Der Kranke trägt damit keine Verantwortung für die Unfähigkeit seine Pflichten wahrzunehmen, worin gleichzeitig der Ansatzpunkt für die Inanspruchnahme von Hilfeleistungen liegt. Diese zwei Aspekte stellen die Legitimationsbasis der Krankenrolle dar, sind allerdings in Anbetracht der Unerwünschtheit von Krankheit im oben genannten Sinn an eine wesentliche Bedingung geknüpft: der Kranke muss sich um seine Genesung bemühen, den Willen zeigen gesund zu werden. Damit verbunden besteht der vierte Aspekt in der Verpflichtung, kompetente Hilfe in Anspruch zu nehmen und mit dem professionellen System zu kooperieren (vgl. Parsons 1958, 16 f).
[15] Prof. Dr. Peter Becker, Univ.-Prof. für Psychologe in Trier, Forschungsschwerpunkt seelische und körperliche Gesundheit, Wohlbefinden, Psychische Störungen ua.
[16] Becker (1982) untersuchte Regulationskompetenz-Modelle (Freud, Erikson, Menninger), Selbstaktualisierungs-Modelle (Rogers, Maslow, Jourard) und Sinnfindungs-Modellen (Frankl, Allport, Fromm) auf gemeinsame Kriterien für seelische Gesundheit und entwickelte auf Grundlage der Theorien von Parsons (1967) und insbesondere Antonovsky (1979) die noch heute verwendete Definition psychischer Gesundheit.
[17] Die mehrdimensionale Ausrichtung von Gesundheit setzt zwar wesentliche Impulse für die interdisziplinäre Ausrichtung einer Gesundheitsförderung, spart jedoch eine exakte inhaltliche Bestimmung der einzelnen Dimensionen aus. Umstritten ist insbesondere die verwendete soziale Dimension von Gesundheit, die in aktuellen Theorien vielmehr unter dem Schlagwort „gesellschaftliche Rahmenbedingungen“ verhandelt wird. Die Akzentuierung der subjektiven Perspektive erscheint als zu einseitig und variabel. Eine eindeutige Bestimmung des Gesundheitszustandes erfordert neben der Selbsteinschätzung eine professionelle Fremdeinschätzung. Neben den oben angesprochenen Kritikpunkten bezüglich der utopischen Vorstellung eines allumfassenden Wohlbefindens und den Versäumnissen einer genauen Darstellung des Verhältnisses von Gesundheit und Krankheit kann abschliessend festgehalten werden, dass aktuelle Konzepte einzelne Komponenten der Definition aufgreifen, eine Verwendung der vollständigen Definition dem erreichten Forschungsstand jedoch nicht mehr entsprechen kann (vgl. Hurrelmann 2006, 118 f).
[18] Zeitgleich wird eine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung in den Gesundheitsberufen vorgenommen. Während die Heilkunde lange Zeit von Frauen praktiziert wurde, etabliert sich die naturwissenschaftlich Medizin gegen Ende des 19.Jahrhunderts als männlichen Domäne. Die analytische Betrachtung einzelner organischer Funktionsstörungen bedarf allerdings einer Ergänzung durch eine ganzheitliche Betrachtung des Kranken im emotionalen Bereich - einem Bereich der den Frauen in Form der Krankenpflege zugeordnet wird. Die klassische geschlechtsspezifische Arbeitsteilung zwischen Medizin und Pflege ist bis heute ein Kennzeichen unseres Gesundheitssystems (vgl. Faltermaier 1994, 15).
[19] Psychische Krankheit bezeichne lediglich die Tatsache, dass jemand die soziale Rolle des Patienten übernimmt, nicht aber, dass jemand nachweislich krank sei. Daneben sei der Terminus nicht deskriptiv, sondern präskriptiv zu verstehen. „In ihn gehen Normen für das ein, was als richtig und falsch zu gelten hat, was akzeptiert ist und was nicht mehr toleriert werden kann“ (Keupp 1979, 4).
[20] Engel (1979) konstatiert aus dieser Tatsache, dass das medizinische Modell bereits den „Status eines Dogmas“ erreicht habe, weil es empirische Befunde nicht mehr zur Legitimation heranziehen muss und in den westlichen Industrieländern zu dem dominierenden Modell von Krankheit avancierte (vgl. Faltermaier 1994, 24).
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2009
- ISBN (eBook)
- 9783836645836
- DOI
- 10.3239/9783836645836
- Dateigröße
- 1.2 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Eberhard-Karls-Universität Tübingen – Erziehungswissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2010 (April)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- psychiatrie salutogenese gender gesundheit selbsthilfe
- Produktsicherheit
- Diplom.de