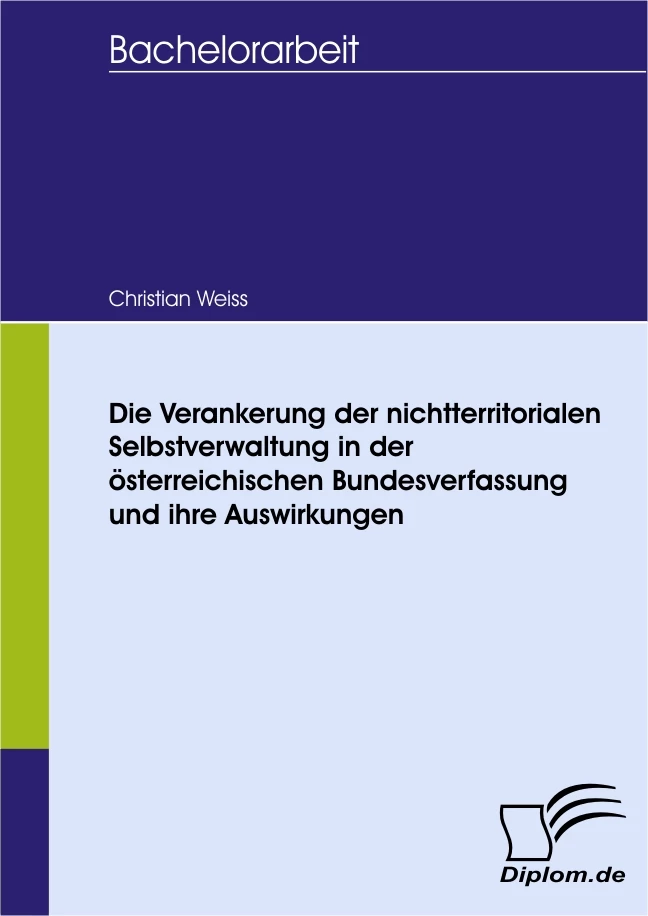Die Verankerung der nichtterritorialen Selbstverwaltung in der österreichischen Bundesverfassung und ihre Auswirkungen
©2010
Bachelorarbeit
53 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Um die vorliegende Bachelorarbeit und die darin bearbeitete Thematik besser verständlich zu machen, sollen die folgenden, einleitenden Worte einen grundlegenden Überblick zur Ausgangssituation und Problemstellung darstellen.
In den vergangenen zwei Jahrzehnten kam es zu wiederholten Versuchen die österreichische Bundesverfassung an die geänderten Anforderungen, wie etwa durch den Beitritt zur Europäischen Union, anzupassen beziehungsweise auch bestehendem Reformbedarf Rechnung zu tragen.
Als Beispiel kann hier die als Strukturreformkommission bezeichnete Expertengruppe für Fragen der Neuordnung der bundesstaatlichen Kompetenzverteilung genannt werden, welche im Jahr 1989 eingesetzt wurde. Im Jahr 1992 wurde eine Vereinbarung getroffen, mit der die wichtigsten verfassungspolitischen Leitlinien für eine weit reichende Änderung des B-VG fixiert wurden. Für die Mehrzahl der strittigen Fragen konnten einvernehmliche Standpunkte formuliert und ein Entwurf einer B-VG-Novelle ausgearbeitet werden. Zu einer Umsetzung dieser Verfassungsreform ist es letztlich aber nicht gekommen.
Der Europäische Konvent zur Erarbeitung eines Vertrags über eine Verfassung für Europa hat der österreichischen Verfassungsreformdiskussion wichtige Impulse und wieder Auftrieb gegeben. Unter dem Vorsitz des damaligen Präsidenten des Rechnungshofes, Dr. Franz Fiedler, ist am 30. Juni 2003 der Österreich-Konvent zu seiner ersten Sitzung zusammengetreten. Dieser Konvent sollte gemäß den formulierten Grundsätzen seines Gründungskomitees Vorschläge für eine grundlegende Staats- und Verfassungsreform erarbeiten, welche eine zukunftsorientierte, kostengünstige, transparente und bürgernahe Erfüllung der Staatsaufgaben ermöglichen sollte. Ziel war es, einen neuen, knappen aber sämtliche Verfassungsbestimmungen enthaltenden Verfassungstext unter Aufrechterhaltung der geltenden Baugesetze der österreichischen Bundesverfassung zu schaffen. Der Österreich-Konvent tagte knapp über 1,5 Jahre, in denen die aufgegebenen Themen umfassend beraten wurden. Es kam zu zahlreichen Textvorschlägen, eine Einigung über einen Gesamtentwurf einer neuen Verfassung konnte aber nicht erreicht werden, wobei allerdings in einer Vielzahl von Einzelbereichen Konsens erzielt werden konnte.
Der Bericht des Österreich-Konvents wurde - nach Kenntnisnahme durch die Bundesregierung - vom Bundeskanzler dem Nationalrat zur geschäftsordnungsgemäßen Behandlung vorgelegt. Im Nationalrat wurde […]
Um die vorliegende Bachelorarbeit und die darin bearbeitete Thematik besser verständlich zu machen, sollen die folgenden, einleitenden Worte einen grundlegenden Überblick zur Ausgangssituation und Problemstellung darstellen.
In den vergangenen zwei Jahrzehnten kam es zu wiederholten Versuchen die österreichische Bundesverfassung an die geänderten Anforderungen, wie etwa durch den Beitritt zur Europäischen Union, anzupassen beziehungsweise auch bestehendem Reformbedarf Rechnung zu tragen.
Als Beispiel kann hier die als Strukturreformkommission bezeichnete Expertengruppe für Fragen der Neuordnung der bundesstaatlichen Kompetenzverteilung genannt werden, welche im Jahr 1989 eingesetzt wurde. Im Jahr 1992 wurde eine Vereinbarung getroffen, mit der die wichtigsten verfassungspolitischen Leitlinien für eine weit reichende Änderung des B-VG fixiert wurden. Für die Mehrzahl der strittigen Fragen konnten einvernehmliche Standpunkte formuliert und ein Entwurf einer B-VG-Novelle ausgearbeitet werden. Zu einer Umsetzung dieser Verfassungsreform ist es letztlich aber nicht gekommen.
Der Europäische Konvent zur Erarbeitung eines Vertrags über eine Verfassung für Europa hat der österreichischen Verfassungsreformdiskussion wichtige Impulse und wieder Auftrieb gegeben. Unter dem Vorsitz des damaligen Präsidenten des Rechnungshofes, Dr. Franz Fiedler, ist am 30. Juni 2003 der Österreich-Konvent zu seiner ersten Sitzung zusammengetreten. Dieser Konvent sollte gemäß den formulierten Grundsätzen seines Gründungskomitees Vorschläge für eine grundlegende Staats- und Verfassungsreform erarbeiten, welche eine zukunftsorientierte, kostengünstige, transparente und bürgernahe Erfüllung der Staatsaufgaben ermöglichen sollte. Ziel war es, einen neuen, knappen aber sämtliche Verfassungsbestimmungen enthaltenden Verfassungstext unter Aufrechterhaltung der geltenden Baugesetze der österreichischen Bundesverfassung zu schaffen. Der Österreich-Konvent tagte knapp über 1,5 Jahre, in denen die aufgegebenen Themen umfassend beraten wurden. Es kam zu zahlreichen Textvorschlägen, eine Einigung über einen Gesamtentwurf einer neuen Verfassung konnte aber nicht erreicht werden, wobei allerdings in einer Vielzahl von Einzelbereichen Konsens erzielt werden konnte.
Der Bericht des Österreich-Konvents wurde - nach Kenntnisnahme durch die Bundesregierung - vom Bundeskanzler dem Nationalrat zur geschäftsordnungsgemäßen Behandlung vorgelegt. Im Nationalrat wurde […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Christian Weiss
Die Verankerung der nichtterritorialen Selbstverwaltung in der österreichischen
Bundesverfassung und ihre Auswirkungen
ISBN: 978-3-8366-4577-5
Herstellung: Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2010
Zugl. Wirtschaftsuniversität Wien, Wien, Österreich, Bachelorarbeit, 2010
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und der Verlag, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplomica.de, Hamburg 2010
2
I. Inhaltsverzeichnis
I.
INHALTSVERZEICHNIS
2
II.
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
3
III. VORBEMERKUNG
5
IV. DEFINITION DER NICHTTERRITORIALEN SELBSTVERWALTUNG
8
V.
DIE VERFASSUNGSRECHTLICHEN GRUNDLAGEN DER SELBSTVERWALTUNG
VOR DER B-VG NOVELLE BGBL I 2008/2
11
VI. DIE B-VG NOVELLE BGBL I 2008/2
15
1. A
RT
120
A
A
BS
1 E
INRICHTUNG VON
S
ELBSTVERWALTUNGSKÖRPERN UND DEREN
P
FLICHTMITGLIEDSCHAFT
15
2. A
RT
120
A
A
BS
2 - V
ERANKERUNG DER
S
OZIALPARTNERSCHAFT
17
2.1. B
UNDESVERFASSUNGSRECHTLICHE
G
ARANTIE FÜR BERUFLICHE
S
ELBSTVERWALTUNGSKÖRPER
?
18
2.2. D
IE
A
NERKENNUNG DER
R
OLLE DER
S
OZIALPARTNER
19
3. A
RT
120
B
A
BS
1 W
EISUNGSFREIHEIT
,
GESETZESERGÄNZENDES
V
ERORDNUNGSRECHT
UND
R
ECHTSAUFSICHT
22
3.1. G
ESETZESERGÄNZENDES
V
ERORDNUNGSRECHT UND
W
EISUNGSFREIHEIT
22
3.2. R
ECHTSAUFSICHT
25
4. A
RT
120
B
A
BS
2 E
IGENER UND ÜBERTRAGENER
W
IRKUNGSBEREICH
27
5. A
RT
120
B
A
BS
3 M
ITWIRKUNG AN STAATLICHER
V
OLLZIEHUNG
31
6. A
RT
120
C
A
BS
1 D
EMOKRATISCHE
L
EGITIMATION DER
O
RGANE
33
7. A
RT
120
C
A
BS
2 - F
INANZIERUNG
36
8. A
RT
120
C
A
BS
3 S
ELBSTVERWALTUNGSKÖRPER ALS SELBSTÄNDIGE
W
IRTSCHAFTSKÖRPER
38
VII. ZUSAMMENFASSUNG
39
VIII. INTERVIEW ZUR B-VG NOVELLE BGBL I 2008/2
41
IX. LITERATURVERZEICHNIS
49
3
II. Abkürzungsverzeichnis
AB
Ausschussbericht
Abs
Absatz
AEUV
Vertrag über die Arbeitsweise der
Europäischen Union
AK
Arbeiterkammer
ArbVG
Arbeitsverfassungsgesetz
Art
Artikel
ÄrzteG
Ärztegesetz
B
Burgenland
BGBl
Bundesgesetzblatt
BlgNR
Beilage(-n) zu den Stenographischen
Protokollen des Nationalrates
B-VG
Bundes-Verfassungsgesetz
bzw
beziehungsweise
bzgl
bezüglich
dB
der Beilage(-n)
dh
das heißt
EGV
Vertrag über die Europäische Gemeinschaft
EU
Europäische Union
f, ff
folgende
gem
gemäß
GP
Gesetzgebungsperiode
Hrsg
Herausgeber
HSG
Hochschülerinnen und
Hochschülerschaftsgesetz
idF
in der Fassung
ieS
im engeren Sinn
iSd
im Sinne des/der
iVm
in Verbindung mit
JRP
Journal für Rechtspolitik
K
Kärnten
ME
Ministerialentwurf
4
NÖ
Niederösterreich
NR
Nationalrat
OÖ
Oberösterreich
ÖH
Österreichische Hochschülerschaft
Sbg
Salzburg
Stmk
Steiermark
RdA
Recht der Arbeit
Rz
Randzahl
T
Tirol
ua
unter anderem
UOG
Universitäts-Organisationsgesetz
usw
und so weiter
va
vor allem
VfGH
Verfassungsgerichtshof
VfSlg
Sammlung der Erkenntnisse und wichtigsten
Beschlüsse des Verfassungsgerichtshofes
vgl
vergleiche
VwGH
Verwaltungsgerichtshof
W
Wien
WKG
Wirtschaftskammergesetz
WKO
Wirtschaftskammer Österreich
Z
Ziffer
zB
zum Beispiel
ZfV
Zeitschrift für Verwaltung
5
III. Vorbemerkung
Um die vorliegende Bachelorarbeit und die darin bearbeitete Thematik besser
verständlich zu machen, sollen die folgenden, einleitenden Worte einen
grundlegenden Überblick zur Ausgangssituation und Problemstellung darstellen.
In den vergangenen zwei Jahrzehnten kam es zu wiederholten Versuchen die
österreichische Bundesverfassung an die geänderten Anforderungen, wie etwa durch
den Beitritt zur Europäischen Union, anzupassen beziehungsweise auch
bestehendem Reformbedarf Rechnung zu tragen.
Als Beispiel kann hier die als
,,Strukturreformkommission" bezeichnete
Expertengruppe
für
Fragen
der
Neuordnung
der
bundesstaatlichen
Kompetenzverteilung genannt werden, welche im Jahr 1989 eingesetzt wurde. Im
Jahr 1992 wurde eine Vereinbarung getroffen, mit der die wichtigsten
verfassungspolitischen Leitlinien für eine weit reichende Änderung des B-VG fixiert
wurden. Für die Mehrzahl der strittigen Fragen konnten einvernehmliche
Standpunkte formuliert und ein Entwurf einer B-VG-Novelle ausgearbeitet werden. Zu
einer Umsetzung dieser Verfassungsreform ist es letztlich aber nicht gekommen.
1
Der Europäische Konvent zur Erarbeitung eines Vertrags über eine Verfassung für
Europa hat der österreichischen Verfassungsreformdiskussion wichtige Impulse und
wieder Auftrieb gegeben. Unter dem Vorsitz des damaligen Präsidenten des
Rechnungshofes, Dr. Franz Fiedler, ist am 30. Juni 2003 der Österreich-Konvent zu
seiner ersten Sitzung zusammengetreten. Dieser Konvent sollte gemäß den
formulierten Grundsätzen seines Gründungskomitees Vorschläge für eine
grundlegende
Staats-
und
Verfassungsreform
erarbeiten,
welche
eine
zukunftsorientierte, kostengünstige, transparente und bürgernahe Erfüllung der
Staatsaufgaben ermöglichen sollte. Ziel war es, einen neuen, knappen aber
sämtliche
Verfassungsbestimmungen
enthaltenden
Verfassungstext
unter
Aufrechterhaltung der geltenden Baugesetze der österreichischen Bundesverfassung
zu schaffen. Der Österreich-Konvent tagte knapp über 1,5 Jahre, in denen die
aufgegebenen Themen umfassend beraten wurden. Es kam zu zahlreichen
1
Vgl 94/ME XXIII. GP Ministerialentwurf Materialien Vorblatt und Erläuterungen S. 2.
6
Textvorschlägen, eine Einigung über einen Gesamtentwurf einer neuen Verfassung
konnte aber nicht erreicht werden, wobei allerdings in einer Vielzahl von
Einzelbereichen Konsens erzielt werden konnte.
2
Der Bericht des Österreich-Konvents wurde - nach Kenntnisnahme durch die
Bundesregierung
-
vom
Bundeskanzler
dem
Nationalrat
zur
geschäftsordnungsgemäßen Behandlung vorgelegt. Im Nationalrat wurde unter dem
Vorsitz seines damaligen Präsidenten, Univ.-Prof. Dr. Andreas Khol, ein Besonderer
Ausschuss zur Vorberatung des Berichts des Österreich-Konvents eingesetzt, in dem
die
Beratungen
fortgesetzt,
weitere
Textvorschläge
ausgearbeitet
und
Gegenüberstellungen der vorliegenden Vorschläge erarbeitet worden sind. Der
Bericht des Besonderen Ausschusses (1584 dB XXII.GP) ist vom Nationalrat
einstimmig zur Kenntnis genommen worden. In einer Entschließung hat sich der
Nationalrat für die Fortsetzung der Arbeiten an einer umfassenden Reform der
österreichischen Bundesverfassung ausgesprochen und die Bundesregierung
aufgefordert, die Arbeiten an einer zukünftigen modernen Bundesverfassung auf der
Grundlage der Ergebnisse des Österreich-Konvents und des Besonderen
Ausschusses voranzutreiben (209/E XXII.GP).
3
Im Regierungsprogramm für die XXIII. Gesetzgebungsperiode wurde unter dem
Kapitel Staats- und Verwaltungsreform vorgesehen, dass auf der Grundlage der
Arbeiten des Österreich-Konvents und des
diesbezüglichen Besonderen
Ausschusses eine Verfassungsreform vorzubereiten ist. Daraufhin wurde zu diesem
Thema beim Bundeskanzleramt eine Expertengruppe eingerichtet. Diesem Gremium
gehörten Dr. Franz Fiedler, Univ.-Prof. Dr. Andreas Khol, Dr. Peter Kostelka und
Univ.-Prof. Dr. Theo Öhlinger sowie zwei Vertreter der Länder an. Von Seiten der
Länder wurden in weiterer Folge Landeshauptfrau Mag. Gabi Burgstaller und
Landeshauptmann Dr. Herbert Sausgruber entsendet, die jedoch von
Univ.-Prof. Dr. Ewald Wiederin (für Landeshauptfrau Mag. Gabi Burgstaller) sowie
Vizepräsident des Bundesrates Jürgen Weiss (für Landeshauptmann Dr. Herbert
Sausgruber) vertreten wurden. Darüber hinaus
wurde der Leiter des
Verfassungsdienstes im Bundeskanzleramt, Univ.-Prof. Dr. Georg Lienbacher, von
Bundeskanzler Dr. Alfred Gusenbauer mit der Vorsitzführung in der Expertengruppe
2
Vgl 94/ME XXIII. GP Ministerialentwurf Materialien Vorblatt und Erläuterungen S. 2.
3
Vgl 94/ME XXIII. GP Ministerialentwurf Materialien Vorblatt und Erläuterungen S. 2.
7
betraut und ersucht, die Betreuung der Arbeit der Expertengruppe durch den
Verfassungsdienst sicherzustellen. Zur Unterstützung in der Expertengruppe wirkten
von Seiten des Verfassungsdienstes neben dem Vorsitzenden der stellvertretende
Leiter Dr. Harald Dossi und Dr. Clemens Mayr mit. Die Expertengruppe ist am
9. Februar 2007 zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammengetreten und hat bis
zum 10. Juli 2007 insgesamt 15 Sitzungen abgehalten.
4
Mit Ausnahme des Vorsitzenden waren alle Mitglieder der Expertengruppe bereits
Mitglieder
des
Österreich-Konvents.
Drei
davon
(Dr.
Franz
Fiedler,
Univ.-Prof. Dr. Andreas Khol sowie Dr. Peter Kostelka) waren sogar Mitglieder des
Präsidiums des Österreich-Konvents. Univ.-Prof. Dr. Andreas Khol war darüber
hinaus Vorsitzender des Besonderen Ausschusses zur Vorberatung des Berichts des
Österreich-Konvents. Durch die Zusammensetzung der Expertengruppe wurde somit
in hohem Ausmaß eine Kontinuität zwischen Österreich-Konvent, ,,Besonderer
Ausschuss des Nationalrates" und nunmehr Expertengruppe sichergestellt und man
verfügte dadurch auch über einen großen Erfahrungsschatz sowie zahlreiche
Textvorschläge und Unterlagen aus den vorangegangen Gremien.
5
Durch das Regierungsprogramm 2007 wurde der Expertengruppe zur Staats- und
Verwaltungsreform eine Vielzahl von Beratungsthemen zur Behandlung übertragen.
Der erste Entwurf beziehungsweise der erste Teil der Verfassungsreform basiert auf
den diesbezüglichen Beratungsergebnissen der Expertengruppe. Darin enthalten ist
unter anderem der Bereich der nichtterritorialen Selbstverwaltung samt ihren
wesentlichen Strukturelementen, mit dem sich diese Arbeit auch näher beschäftigen
wird.
4
Vgl 94/ME XXIII. GP Ministerialentwurf Materialien Vorblatt und Erläuterungen S. 2.
5
Vgl 94/ME XXIII. GP Ministerialentwurf Materialien Vorblatt und Erläuterungen S. 3.
8
IV. Definition der nichtterritorialen Selbstverwaltung
Bevor näher auf die Neuregelung beziehungsweise Änderung im Bereich der
nichtterritorialen Selbstverwaltung eingegangen wird, soll nun zunächst ganz
allgemein der Begriff der Selbstverwaltung erläutert werden.
Selbstverwaltung wird bei Kahl/Weber
6
und Stolzlechner
7
als ,,eine Form
dezentralisierter, demokratisch legitimierter und relativ unabhängiger öffentlicher
Verwaltung, die von eigenen Rechtsträgern besorgt wird" definiert. Stolzlechner
8
beschreibt den Begriff ,,Selbstverwaltung" dahingehend, dass ,,öffentliche Aufgaben
mit
engem
Sachbezug
zum
in
der
Selbstverwaltungskörperschaft
zusammengefassten Personenkreis von Organen des Selbstverwaltungsträgers
eigenverantwortlich besorgt werden (,,eigener Wirkungsbereich")." Wesentlich für die
Selbstverwaltung ist also die weisungsfreie Besorgung ihrer Aufgaben durch eigene
Rechtsträger. Die weisungsfreie Besorgung der Aufgaben wird im eigenen
(selbstständigen)
Wirkungsbereich
vollzogen.
Innerhalb
des
jeweiligen
Selbstverwaltungskörpers gilt jedoch der Grundsatz der Weisungsgebundenheit.
9
Darüber hinaus werden Selbstverwaltungskörper meist auch durch Gesetz mit der
Besorgung von (Staats-)Aufgaben anderer Rechtsträger betraut. In diesem Bereich
handeln die Selbstverwaltungskörper im übertragenen Wirkungsbereich, werden
funktionell als Bundes- oder Landesorgane tätig und sind den übergeordneten
staatlichen Verwaltungsorganen gegenüber auch weisungsgebunden. Weiters
besteht hier auch in der Regel ein Instanzenzug an die Staatsorgane.
10
Die wesentlichen juristischen Merkmale der Selbstverwaltung sind also:
11
·
Träger ist eine eigene juristische Person (Rechtsträger), eine Körperschaft
öffentlichen Rechts.
·
Der Träger der Selbstverwaltung besitzt einen eigenen Wirkungsbereich, in
dem er weisungsfrei ist, allerdings der staatlichen Aufsicht unterliegt. In der
6
Vgl Kahl/Weber 2007, S. 80f.
7
Vgl Stolzlechner 2007, S. 296.
8
Vgl Stolzlechner 2007, S. 296.
9
Vgl VfSlg 13304/1992.
10
Vgl Walter/Mayer/Kucsko-Stadlmayer 2007, S. 411.
11
Vgl Öhlinger 2007, S. 237.
9
Regel ist auch ein Instanzenzug an staatliche Behörden ausgeschlossen. Ein
solcher besteht nur, wenn er ausdrücklich angeordnet ist.
12
Innerhalb der Selbstverwaltung kann man nach der österreichischen
Bundesverfassung zwischen territorialer Selbstverwaltung (Gemeindeverwaltung)
und eben nichtterritorialer oder funktionaler Selbstverwaltung unterscheiden.
Die funktionale Selbstverwaltung umfasst:
13
·
die wirtschaftliche Selbstverwaltung der Berufsgruppen in ,,Kammern"
(zB Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer, Landwirtschaftskammer). Zur
wirtschaftlichen Selbstverwaltung gehören aber auch zB die durch Gesetz
eingerichteten regionalen Fremdenverkehrsverbände.
·
die
kulturelle/wissenschaftliche
Selbstverwaltung
(Österreichische
Hochschülerschaft und Akademie der Wissenschaften)
·
die soziale Selbstverwaltung (Anstalten der Sozialversicherung als
gemeinsame Selbstverwaltung der wirtschaftlichen Selbstverwaltungskörper,
also Gebietskrankenkassen, Pensionsversicherungsanstalten sowie die
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt)
·
die sonstige Selbstverwaltung (personen- und sachbezogene Zweckverbände)
wie z.B. die Landesjagdverbände, die Landes-Feuerwehrverbände,
Wasserverbände und genossenschaften, Agrargemeinschaften usw
Sowohl für territoriale, wie auch für nichtterritoriale Selbstverwaltung bestehen nach
Kahl/Weber
14
neben bereits genannten auch noch weitere strukturelle Merkmale, die
sie
kennzeichnen,
jedoch
in
unterschiedlichem
Ausmaß
vorkommen
beziehungsweise ausgeprägt sind. Sie müssen aber trotzdem alle vorhanden sein,
um einen Organisationstypen als Selbstverwaltungskörper bezeichnen zu können.
12
Vgl VwGH 21.12.2005, 2002/08/0253.
13
Vgl Stolzlechner 2007, S. 297f; <wko.at>.
14
Vgl Kahl/Weber 2007, S. 81.
10
Präsident Universitätsprofessor Dr. Korinek hat dazu acht typische organisatorische
Merkmale herausgearbeitet:
15
·
Errichtung als juristische Person (Körperschaft öffentlichen Rechts) mit
personalem Substrat
Die
Selbstverwaltungskörper(schaften)
sind
mitgliedschaftlich
(personelles Substrat) organisiert, sie bestehen aus einzelnen
natürlichen
oder
juristischen
Personen.
Der
Bestand
der
Körperschaften ist unabhängig vom Wechsel ihrer konkreten Mitglieder.
·
Einrichtung durch Gesetz oder einen anderen Hoheitsakt
Für
jeden
Selbstverwaltungskörper
besteht
ein
eigenes
Organisationsgesetz, das die demokratische Struktur, die Aufgaben (in
sehr allgemeiner Form), die Finanzierung, die Rechte und Pflichten
gegenüber dem Staat (Begutachtungs- und Mitwirkungsrechte bzw
pflichten) festlegt. Im Rahmen der durch das Gesetz festgelegten
allgemeinen Aufgabenerstellung ist der Selbstverwaltungskörper frei
von jeder Einflussnahme von außen, insbesondere durch den Staat.
·
Staatsaufsicht
Die Aufsicht besteht hier hinsichtlich der gesetzmäßigen Führung der
Aufgaben
des
eigenen
Wirkungsbereiches
(zB
Aufhebung
rechtswidriger Entscheidungen von Selbstverwaltungsorganen).
·
Obligatorische Mitgliedschaft
Um die Verfolgung des Gruppeninteresses und insbesondere den
Interessenausgleich zu ermöglichen, besteht Pflichtmitgliedschaft aller
funktional einer Gruppe zuzurechnenden natürlichen oder juristischen
Personen.
15
Vgl Korinek 1970, Kahl/Weber 2007, S. 81.
11
·
Besorgung der im Verbandsinteresse gelegenen eigenen Angelegenheiten in
weisungsfreier Eigenverantwortlichkeit
Das beinhaltet die Weisungsfreiheit der Selbstverwaltungsorgane
gegenüber Staatsorganen.
·
Mitbestimmung, insbesondere Bestellung der Organe aus der Mitte der
Verbandsangehörigen durch die Verbandsangehörigen
Um das Fehlen der individuellen Austrittsmöglichkeit zu kompensieren,
legt das jeweils konstituierende Gesetz umfangreiche demokratische
Mitbestimmungsmöglichkeiten und Kontrollmöglichkeiten fest. In
regelmäßigen Abständen haben Wahlen zur Besetzung der
Entscheidungsgremien stattzufinden. Die Kandidaten werden von
,,wahlwerbenden Gruppen" vorgeschlagen, die um die Kontrolle über
den jeweiligen Selbstverwaltungskörper konkurrieren.
·
Finanzielle Selbständigkeit (Budgethoheit)
Selbstverwaltungskörper
werden
regelmäßig
finanziert
durch
Mitgliedsbeiträge (nach der Leistungsfähigkeit gestaffelt) der
Gruppenmitglieder,
durch
eigene
wirtschaftliche
Tätigkeit
beziehungsweise auch durch (gesetzlich fixierte) staatliche Mittel.
·
Befehls- und Zwangsgewalt gegenüber den Mitgliedern
V. Die verfassungsrechtlichen Grundlagen der
Selbstverwaltung vor der B-VG Novelle BGBl I 2008/2
Die Selbstverwaltung der Gemeinde ist schon länger verfassungsrechtlich fest
verankert (vgl Art 115ff B-VG). Bei der nichtterritorialen Selbstverwaltung war dies bis
zur B-VG Novelle I 2008/2 nicht der Fall, sie fand davor keine explizite Grundlage in
der österreichischen Bundesverfassung. Deren verfassungsrechtliche Zulässigkeit
war zunächst umstritten und wurde später von der herrschenden Lehre
16
und
16
Vgl Berka 2005, Rz 765.
12
ständigen Rechtsprechung des VfGH an die Einhaltung bestimmter Typusmerkmale
(wirtschaftliche Selbständigkeit, staatliche Aufsicht, Pflichtmitgliedschaft und
besonders demokratische Organisation und Organkreation) gebunden.
17
Bereits in den 1950er und 1960er Jahren wurden die Grundsteine gelegt, die
schließlich zur Judikatur des VfGH
18
zur ,,Salzburger Jägerschaft" geführt hat. Der
VfGH hat dabei unter Bruch mit seiner bis dahin auf dem Boden der herrschenden
Dogmatik basierenden Judikatur
19
entschieden, dass die Einrichtung von
Selbstverwaltungskörperschaften im Rahmen des Organisationsplanes der
Bundesverfassung liegt und daher auch durch einfaches Gesetz allgemein zulässig
ist, und dem Gesetzgeber zugleich gewisse materielle verfassungsrechtliche
Kriterien vorgegeben.
20
Konkret begründet der VfGH die verfassungsrechtliche
Zulässigkeit wie folgt (VfSlg 8215/1977): ,,...der Verfassungsgesetzgeber des Jahres
1920 (hat) Selbstverwaltung als Organisationstechnik nicht bloß gekannt, sondern -
als dem Art 20 B-VG nicht entgegenstehend - auch vorausgesetzt und anerkannt.
Die Schaffung von Selbstverwaltungskörpern und damit von Organen, die gegenüber
staatlichen Organen weisungsfrei sind, ist somit im Rahmen des Organisationsplanes
der Bundesverfassung gelegen. Die Einrichtung von Selbstverwaltung durch den
einfachen Bundes- und Landesgesetzgeber ist sohin verfassungsrechtlich
zulässig."
21
Für die Einrichtung von Selbstverwaltungskörpern war hierfür eine im Lichte des
Gleichheitssatzes (Art 7 Abs 1 B-VG) sachgerechte Abgrenzung des zum
Selbstverwaltungskörper zusammengefassten Personenkreises, sowie auch eine
sachliche Abgrenzung jenes Aufgabenkreises erforderlich, der im weisungsfreien
eigenen Wirkungsbereich vollzogen wird, im Sinne von Interesse und Eignung
(vgl Art 118 Abs 2 B-VG). Weiters war die Einrichtung eines staatlichen
Aufsichtsrechts als Substitut der Weisungsbindung und die binnendemokratische
Organisation, im Besonderen durch Wahlen der leitenden oder mit wesentlichen
Aufgaben betrauten Organe, erforderlich. Zu den verfassungsrechtlichen Schranken,
die der einfache Gesetzgeber bei der Einrichtung von Selbstverwaltungskörpern zu
17
Vgl Kneihs 2008, S. 148f.
18
Vgl VfSlg 8215/1977.
19
Vgl Walter/Mayer/Kucsko-Stadlmayer 2007, S. 412.
20
Vgl Stolzlechner 1995, S. 370ff.
21
Vgl Öhlinger 2008, S. 187.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2010
- ISBN (eBook)
- 9783836645775
- DOI
- 10.3239/9783836645775
- Dateigröße
- 465 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Wirtschaftsuniversität Wien – Öffentliches Recht, Wirtschaftsrecht
- Erscheinungsdatum
- 2010 (April)
- Note
- 2,0
- Schlagworte
- reform kammer sozialpartner finanzierung selbstverwaltung
- Produktsicherheit
- Diplom.de