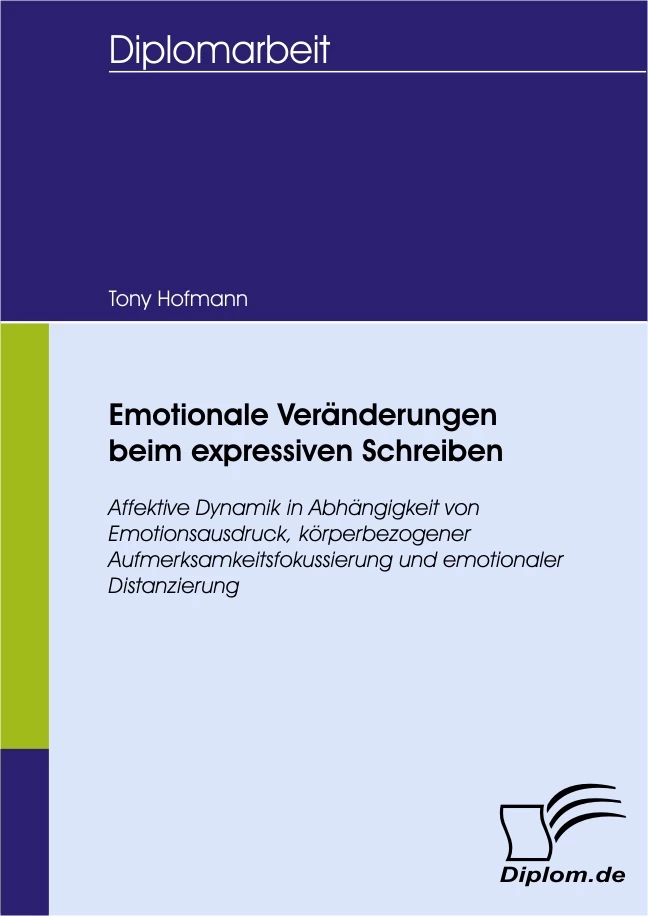Emotionale Veränderungen beim expressiven Schreiben
Affektive Dynamik in Abhängigkeit von Emotionsausdruck, körperbezogener Aufmerksamkeitsfokussierung und emotionaler Distanzierung
Zusammenfassung
Das Ziel dieser Diplomarbeit ist es, Theorien und praktische Ansätze miteinander zu verknüpfen, die in unterschiedlichen Feldern der Psychologie und Psychotherapie jeweils etabliert und anerkannt, jedoch relativ unabhängig voneinander entstanden sind, und die bisher vorrangig in ihren eigenen Theoriebildungen weiterentwickelt wurden. In der reinen Psychotherapieforschung werden vor allem Studien im (kontrollierten) Prä-Post-Design durchgeführt, welche, um unter anderem auch Finanzierungsfragen zu untermauern, nur auf die reine Effektivität der untersuchten Verfahren rekurrieren. Die zugrunde liegenden psychologischen Mechanismen werden jedoch nur selten im Detail operationalisiert und grundlagentheoretisch abgesichert. Zwischen in der allgemein- und sozialpsychologischen Forschung diskutierten Grundlagenmodellen und den in der psychotherapeutischem Praxis angenommenen Wirkmechanismen fehlt dadurch bislang eine empirisch fundierte Verlinkung: Die tatsächlichen Zusammenhänge zwischen Emotionen, Kognitionen und somatischen Prozessen sind immer noch ungeklärt.
Es soll deshalb in dieser Arbeit ein Entwurf vorgelegt werden, der am Beispiel der Affektregulation versucht, innerhalb der Konzepte der humanistischen Psychotherapie, des Paradigmas des emotionalen Schreibens, der Forschung zur Wirkung der Expression von Emotionen auf die psychische Gesundheit und der aktuellen allgemein- und sozialpsychologischen Forschung Überlappungen zu finden. Ein Verständnis der Zusammenhänge zwischen körperlichen Prozessen, Emotionen und Kognitionen könnte dabei helfen, die Mechanismen besser zu erfassen, die in der Psychotherapie (und auch, ganz allgemein gesehen, im Alltag) emotionalen Veränderungsprozessen zu Grunde liegen.
Hierzu soll zunächst detailliert auf ein theoretisches Rahmenmodell der sozialkognitven Forschung eingegangen werden. Darauf aufbauend werden theoretische Ansätze zu Emotion, Intuition, Körper und Neurologie beschrieben, die die Vorhersagen des RIM differenzieren und erweitern. Einige der Methoden, Interventionsansätze und Ergebnisse der humanistischen Psychotherapie, des emotionalen Schreibparadigmas und der Traumatherapie sollen schließlich anhand dieses Grundgerüsts integriert und interpretiert werden. Auf Basis dieser Überlegungen werden konkrete Hypothesen über Einflussfaktoren auf affektive Veränderungsprozesse abgeleitet.
In einer empirischen Untersuchung wurden die Hypothesen überprüft; die Methodik und die […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
0. Abstract
1. Einleitung
2. Literaturüberblick
2.1. Das Reflektiv- Impulsiv Modell
2.2. Die Rolle des Affekts
2.3. Die Rolle des Körpers
2.4. Neurologische Modelle
2.5. Veränderung affektiver Zustände
2.6. Zwischen-Fazit
2.7. Kognitive Integration im Paradigma des „emotionalen Schreibens“
2.8. Kognitive Integration in der Traumatherapie
2.9. Kognitive Integration in den humanistischen Psychotherapieverfahren
2.10. Schlussfolgerungen
3. Methoden
3.1. Rekrutierung der Teilnehmer
3.2. Versuchsdesign
3.3. Operationalisierung der abhängigen Variablen
3.4. Versuchsablauf und Operationalisierung der unabhängigen Variablen
3.5. Datenaufbereitung und –analyse
4. Ergebnisse
4.1. Manipulationschecks
4.2. Auswirkungen des Schreibens auf den affektiven Zustand: Gruppenunterschiede
4.3. Moderatoreffekte von „Genauigkeit“ und „Vollständigkeit“
4.4. Auswirkungen des Schreibens auf den affektiven Zustand: Unterschiede
anhand des Textinhalts (Rating)
4.5. Einfluss von Persönlichkeitseigenschaften auf die affektive Dynamik
4.6. Zusammenhang von aggressivem Verhalten („Bestrafung“) und Änderungen im nachfolgend gemessenen Ärger
5. Diskussion
5.1. Einzelergebnisse
5.2. Entscheidungen über Hypothesen
5.3. Implikationen für die therapeutische Praxis
5.4. Grenzen dieser Untersuchung und Implikationen für weitere Forschung
5.5. Ausblick
5.6. Zusammenfassung
Anhang .
Literaturverzeichnis
Eidesstattliche Erklärung
0. Abstract
Die vorliegende Arbeit untersucht unter Bezugnahme auf das RIM (Strack & Deutsch, 2004) als Rahmenmodell Faktoren, die die kognitive Integration impulsiver Inhalte in reflektive Prozesse moderieren, und als Folge davon eine Veränderung affektiver Zustände bewirken. Als mögliche Faktoren werden (1) die Expression affektiver Zustände, (2) der Aufmerksamkeitsfokus auf Körpersensationen und (3) die emotionale Distanz, in der sich ein Individuum zu den prozessierten Inhalten befindet, diskutiert. Um die Rolle dieser Faktoren zu untersuchen, wurde in N = 92 Probanden moderater Ärger induziert und darauf folgend verschiedene Bewältigungsstrategien im Umgang mit diesem Ärger experimentell induziert, in denen die obigen Faktoren (teilweise orthogonal) manipuliert wurden. Folgende Ergebnisse wurden dabei gefunden. Expression: Probanden, die ihre Emotionen entsprechend des klassischen Pennebaker-Paradigmas ausdrückten, zeigten eine stärkere Verringerung im selbstberichteten Ärger und im Ärgerverhalten im Vergleich zur nicht-expressiven Kontrollgruppe. Körperbezug: Im Ärgerverhalten (Verhaltensmaß II) zeigte sich ein Haupteffekt des Körperbezugs. Probanden, die während des Schreibens auf ihren Körper fokussierten, verhielten sich im Nachhinein aggressiver, als Probanden, die nicht auf ihren Körper fokussierten. Körperbezug und Distanzierung: Es zeigte sich eine Interaktion zwischen Körperbezug und Distanzierung. Probanden, die beim Schreiben auf ihre Körperempfindungen fokussiert und sich dabei nicht emotional distanziert hatten, lagen im Ärgerverhalten (Verhaltensmaß I) deutlich höher als die Gruppen, die nicht auf Körperempfindungen fokussiert oder sich emotional distanziert hatten. Darüber hinaus wurde ein positiver Zusammenhang zwischen der Stärke der Bestrafung in den beiden Verhaltensmaßen und dem Absinken des selbstberichteten Ärgers nach einer halben Stunde ärger-irrelevanter Tätigkeiten gefunden. Implikationen für die psychotherapeutische Praxis (z.B. „emotion focused therapy“, Greenberg, 2006) und für die Grundlagenforschung (z.B. Rahmenbedingungen für Katharsis) werden diskutiert.
Jeder kann wütend werden; das ist einfach. Aber wütend auf den Richtigen zu sein, im richtigen Maß, zur richtigen Zeit, zum richtigen Zweck und auf die richtige Art, das ist schwer.
Aristoteles (384 - 322 v. Chr.)
1. Einleitung
Das Ziel dieser Diplomarbeit ist es, Theorien und praktische Ansätze miteinander zu verknüpfen, die in unterschiedlichen Feldern der Psychologie und Psychotherapie jeweils etabliert und anerkannt, jedoch relativ unabhängig voneinander entstanden sind, und die bisher vorrangig in ihren eigenen Theoriebildungen weiterentwickelt wurden. In der reinen Psychotherapieforschung werden vor allem Studien im (kontrollierten) Prä-Post-Design durchgeführt, welche, um unter anderem auch Finanzierungsfragen zu untermauern, nur auf die reine Effektivität der untersuchten Verfahren rekurrieren (vgl. z.B. Richtlinien des wissenschaftlichen Beirats Psychotherapie, Schulte & Rudolf, 2007). Die zugrunde liegenden psychologischen Mechanismen werden jedoch nur selten im Detail operationalisiert und grundlagentheoretisch abgesichert. Zwischen in der allgemein- und sozialpsychologischen Forschung diskutierten Grundlagenmodellen und den in der psychotherapeutischem Praxis angenommenen Wirkmechanismen fehlt dadurch bislang eine empirisch fundierte Verlinkung: „Die tatsächlichen Zusammenhänge zwischen Emotionen, Kognitionen und somatischen Prozessen sind immer noch ungeklärt“ (Greenberg, 2006, S. 27).
Es soll deshalb in dieser Arbeit ein Entwurf vorgelegt werden, der am Beispiel der Affektregulation versucht, innerhalb der Konzepte der humanistischen Psychotherapie, des Paradigmas des „emotionalen Schreibens“, der Forschung zur Wirkung der Expression von Emotionen auf die psychische Gesundheit und der aktuellen allgemein- und sozialpsychologischen Forschung Überlappungen zu finden. Ein Verständnis der Zusammenhänge zwischen körperlichen Prozessen, Emotionen und Kognitionen könnte dabei helfen, die Mechanismen besser zu erfassen, die in der Psychotherapie (und auch, ganz allgemein gesehen, im Alltag) emotionalen Veränderungsprozessen zu Grunde liegen.
Hierzu soll zunächst detailliert auf ein theoretisches Rahmenmodell der sozialkognitven Forschung (das Reflektiv- Impulsiv Modell, RIM, Strack & Deutsch, 2004) eingegangen werden. Darauf aufbauend werden theoretische Ansätze zu Emotion, Intuition, Körper und Neurologie beschrieben, die die Vorhersagen des RIM differenzieren und erweitern. Einige der Methoden, Interventionsansätze und Ergebnisse der humanistischen Psychotherapie, des emotionalen Schreibparadigmas und der Traumatherapie sollen schließlich anhand dieses Grundgerüsts integriert und interpretiert werden. Auf Basis dieser Überlegungen werden konkrete Hypothesen über Einflussfaktoren auf affektive Veränderungsprozesse abgeleitet.
In einer empirischen Untersuchung wurden die Hypothesen überprüft; die Methodik und die Ergebnisse der Untersuchung werden im dritten und vierten Abschnitt dieser Arbeit ausführlich beschrieben.
Schließlich wird im letzten Teil der Arbeit diskutiert, inwieweit die vorliegenden Ergebnisse mit den oben genannten Grundlagentheorien und deren Implikationen vereinbar sind und an welchen Punkten darauf aufbauend die genannten (psychotherapeutischen und grundlagentheoretischen) Denkansätze einander befruchten und sowohl zu weiteren Forschungsarbeiten als auch zur Ableitung praktischer Empfehlungen anregen können.
2. Literaturüberblick
Im Folgenden sollen zunächst als Rahmen für spätere Argumentationen aktuelle sozial- und allgemeinpsychologische theoretische Grundlagen und einige erweiternde neurologische Modelle beschrieben werden. Darauf aufbauend werden Zusammenhänge zur körperbezogenen Traumatherapie, zur Expression von Emotionen und zu humanistischen Therapieverfahren geschildert.
2.1. Das Reflektiv- Impulsiv Modell
Das Reflektiv- Impulsiv Modell (RIM; Strack & Deutsch, 2004) ist eine Synthese von Modellen der allgemein- und sozialpsychologischen Forschung der letzten Jahrzehnte. Es geht davon aus, dass im Menschen zu jedem Zeitpunkt zwei Prozesse ablaufen: ein reflektiver und ein impulsiver Prozess. Beide Prozesse arbeiten parallel, sind unabhängig voneinander und konkurrieren in jedem Augenblick um die Kontrolle sozialer Handlungen. Zunächst sollen zum einen Merkmale dieser beiden Systeme geschildert werden; zum anderen soll dargelegt werden, wie sie zueinander in Beziehung stehen.
Merkmale der beiden Systeme. Im impulsiven System (IS) werden, entsprechend dem ideomotorischen Prinzip (vgl. James, 1890) unabhängig von Intentionen und Zielen, aber moderiert von Bedürfnissen, von Deprivation und von motivationalen Orientierungen, Verhaltensschemata durch sich assoziativ ausbreitende Aktivierung angeregt. Im reflektiven System (RS) hingegen ist Verhalten die Folge eines Entscheidungsprozesses, in dem die Erwartung und der Wert von verschiedenen Optionen abgewogen und integriert werden, woraus die Wahl eines bestimmten, optimalen Verhaltens resultiert. Mittels eines (sich selbst beendenden) intentionalen Prozesses werden daraus Verhaltensschemata aktiviert. Beide Systeme arbeiten parallel, wobei das IS permanent an der Informationsverarbeitung beteiligt ist, während das RS nur zeitweise rekrutiert wird. Das RS benötigt hohe kognitive Kapazität, ist aufmerksamkeitspflichtig, und seine Prozesse sind zeitaufwendiger als die des IS, weswegen die reflektive, aber nicht die impulsive Verarbeitung von Reizen durch Ablenkung, Ermüdung, zu hohem oder zu niedrigem Arousal, Zeitdruck oder auch geringe Motivation beeinträchtigt werden kann. Es kann jedoch eine Vielzahl von Aufgaben (Nachdenken, Planen, Vorstellung, etc.) durchführen. Das IS ist weniger störanfällig und übernimmt die Kontrolle über das Verhalten unter suboptimalen Umständen. Weiterhin bestehen im IS perzeptuelle, semantische, affektive und motorische Repräsentationen nicht-propositional nebeneinander in einem multimodalen assoziativen Speicher, dessen assoziative Verknüpfungen durch Kontiguitäts- und Ähnlichkeitsprinzipien etabliert werden. So können z.B. semantische Repräsentionen („alter Mensch“) und Motorprogramme (langsames Gehen) bidirektional verbunden sein (vgl. z.B. Bargh, Chen & Burrows, 1996; Dijksterhuis & Bargh, 2001; Krauss, Chen, & Gottesman, 2000; Mussweiler, 2006). Im RS werden einzelne Elemente propositional verbunden und sind mit einem Wahrheitswert belegt („Die Tasse ist weiß.“).
Die Beziehung der beiden Systeme zueinander. Assoziative Verknüpfungen im IS können durch reflektive Operationen geformt werden. Dies geschieht dann, wenn propositionale Elemente im RS oft miteinander gepaart werden (z.B. „6 mal 6“ ist „36“). In diesem Fall entstehen korrespondierende Verknüpfungen im impulsiven System auch dann, wenn die Elemente in der Realität nicht gemeinsam vorhanden sind. Propositionales Wissen entsteht dadurch, dass das RS propositionale Inhalte generiert, indem es wahrgenommene Reize zusammen mit einem Wahrheitswert einer semantischen Kategorie zuweist. Diese Repräsentationen lassen sich auf flexible Art und Weise erzeugen und verändern. Die einzelnen inhaltlichen Elemente der Propositionen werden beim Abruf dieser Repräsentation aus dem IS abgefragt; hierdurch wird die Verfügbarkeit dieser Inhalte im IS erhöht. Gefühle unterschiedlicher Qualitäten können auch im RS propositional repräsentiert werden (vgl. „Zuordnung zu einer prototypischen Kategorie“ bei Russell, 2003, S. 151f), und sind zugänglich, wenn sie kontextuell als angemessen eingeschätzt werden (vgl. Schwarz & Clore, 1983). Einmal generiertes propositionales Wissen ist syllogistischem Argumentieren zugänglich, wodurch (durch Schlussfolgerungen aus Prämissen) neues Wissen entstehen kann, das über die zuvor vorhandenen Informationen hinausgeht. Die Ausführung eines Verhaltens geschieht mittels der Aktivierung behavioraler Schemata, die Teil des IS sind, jedoch auch per Intention vom RS ausgelöst werden können. Wenn gleichzeitig unterschiedliche, konkurrierende Verhaltensschemata aktiviert werden, entscheidet die Stärke der Aktivierung darüber, welches Verhalten ausgeführt wird. Werden durch beide Systeme hingegen gleiche Verhaltensschemata aktiviert, wird das entsprechende Verhalten erleichtert. Abbildung 1 stellt beide Systeme und deren Zusammenspiel zusammengefasst schematisch dar.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Das Reflektiv-Impulsiv Modell (Strack & Deutsch, 2004, S. 222)
Eine wichtige Ergänzung zu dem bisher Beschriebenen bietet die Cognitive-Experiential Self-Theory (CEST; Epstein, 1990, 1993, 1994, 2003, 2008; Epstein, Pacini, Denes-Raj, & Heier, 1996). Auch hier wird von zwei grundsätzlichen Systemen ausgegangen, einem rational-analytischen System und einem experientiellen System. Auch wenn diese beiden Prozesse und die des RIM in den Details nicht vollständig übereinstimmen (z.B. werden Zahlen genau wie Rechenoperationen beim CEST im rationalen System kodiert, im RIM hingegen liegen sie auch als abzurufende Inhalte im IS vor), sind sie doch grundsätzlich ähnlich (vgl. Tabelle im Anhang A). CEST weist in seinem Schwerpunkt stärker als das RIM auf ein Kohärenz - Motiv zwischen impulsiven und reflektiven Prozessen hin, das eine Person antreibt, experientielle Erfahrungen zu assimilieren, einzuordnen, und sich selbst als konfliktfrei bezüglich der daraus resultierenden Handlungen zu erleben (1994, S. 717f). Außerdem wird im CEST das experientielle System als sehr viel komplexer angesehen, als das IS des RIM beschrieben wird. Im CEST wird dem IS eine aktivere Rolle (als die automatischen ähnlichkeits- und kontiguitätsbasierten Verknüpfungen des IS dies vermuten lassen würden) zugewiesen, wenn es z.B. darum geht, Probleme zu lösen: „It is important to recognize that even at simple levels, the experiential system under many circumstances is more effective in solving problems than the rational system“ (1994, S. 719) oder Zusammenhänge zu extrahieren und adaptives Verhalten auszulösen. So lassen sich z.B. Muskelreaktionen per EMG nachweisen, die völlig automatisch, also unabhängig vom RS, Folge der semantischen Kohärenz von Worttriaden sind (Topolinski, Likowski, Weyers, Strack, 2009). Insbesondere kleine Veränderungen im Affekt scheinen bei intuitiven kognitiven Urteile (die unabhängig von reflektiven Intentionen sind) eine sehr wichtige Rolle zu spielen (Topolinski & Strack, 2009).
Da sich die vorliegende Arbeit mit dem Thema der Affektveränderung beschäftigt, sollen aufbauend auf den bisher beschriebenen konzeptuellen Grundlagen nun die psychologischen Determinanten von Affekt und Emotion genauer betrachtet werden.
2.2. Die Rolle des Affekts
Affekt kann entweder direkt durch impulsive Prozesse (Le Doux, 1995; Zajonc, 1980) oder durch zusätzliche reflektive Operationen (Zuschreibungen, Appraisals etc.) entstehen (Lazarus, 1984, 1991; Neumann, 2000). Um dieses Zusammenspiel genauer zu beschreiben, lässt sich das Emotionsmodell von Russell (2003; vgl. auch Barrett, 2006a, 2006b) heranziehen:
Russell schlägt vor, Stimmungen und Emotionen (bzw. emotionale Episoden) als Phänomene zu fassen, zu denen mehrere Komponenten beitragen können, die jedoch nicht alle gleichzeitig bzw. vollständig auftreten müssen. Er diskutiert folgende Komponenten: (A) ein Ereignis, das eine emotionale Episode auslöst. (B) Den Kernaffekt (core affect) als neurophysiologischen Zustand, der dem Bewusstsein zugänglich ist, und in Form von nicht-reflektiven Gefühlen zu Stimmungen und Emotionen beiträgt: „Core affect is primitive, universal, and simple (irreducible on the mental plane). It can exist without being labeled, interpreted, or attributed to any cause. As an analogy, consider felt body temperature. You can note it whenever you want” (S. 148), und der sich zu jedem Zeitpunkt auf den beiden Dimensionen Aktivierung (hoch, niedrig) und Valenz (positiv, negativ) verorten lässt. (C) Eine Attribution, die dann erfolgt, wenn man das vorausgegangene Ereignis als ursächlich für den Kernaffekt zuordnet. (D) Eine Bewertung bezüglich eigener Ziele, Vorstellungen usw., als Gewichtung der Konsequenzen für das eigene Wohlbefinden (vgl. auch Lazarus, 1984; 1991). (E) Instrumentelle Handlungen (Annäherung und Vermeidung), die mit dem affektauslösenden Ereignis in Zusammenhang stehen und (F) physiologische und expressive Veränderungen. (G) Die subjektive, bewusste Wahrnehmung der emotionalen Episode, welche metakognitive Urteile beinhaltet (die Emotion Angst zeigt darin z.B. folgende Aspekte: „A sense of urgency, indecision, confusion, uncertainty, and incredulity; much of the episode seems beyond deliberate control. These metacognitive judgments are made hot by being accompanied by core affect.” (S. 150)). (H) Eine bewusste Erfahrung auf einer Metaebene (meta-experience), in welcher das Erlebte auf Basis der anderen Elemente der Episode bewusst einer Kategorie zugeordnet wird (z.B. „Ich bemerke, das, was ich da verspüre, ist Angst !“). (I) Emotionsregulation: nach der Kategorisierung (meta-experience), versucht man eventuell, die Emotion zu verändern, oder anzupassen.
Russell beschreibt den zeitlichen Ablauf beim Entstehen einer emotionalen Episode also in zwei unabhängigen Schritten: im ersten Schritt tauchen manifeste Komponenten auf (z.B. subjektive Gefühle, nonverbales Verhalten, autonome Erregungsmuster und instrumentelles Verhalten). Im zweiten Schritt werden diese Komponenten wahrgenommen und kategorisiert: „The observer can be the person having the emotion (in which case, this step is equivalent to emotional meta-experience), a witness, or a scientist.” (S. 151). Der zweite Schritt muss dabei nicht unbedingt erfolgen.
Strack und Deutsch (2004) diskutieren Zusammenhänge zwischen dem eben geschilderten Vorgang und dem RIM: „Following Russell's (2003) theory of emotion, our model implies that the impulsive system generates a simply structured state of core affect that, by reflective processes, can be transformed in more elaborate feelings and emotions” (S. 237).
Der Kernaffekt begleitet dabei zu jedem Zeitpunkt alle kognitiven Prozesse. Ein Beispiel hierfür liefert die Forschung zur „fluency“ (dt. Flüssigkeit, Effizienz) in der Verarbeitung von Stimuli: Reize, die leicht (d.h. mit hoher fluency) zu verarbeiten sind, sind automatisch von einem positiven Kernaffekt begleitet und umgekehrt. Da sich z.B. bestimmte Kunstwerke (u.a.) leichter prozessieren lassen, werden sie als ästhetisch schöner beurteilt (Reber, Schwarz & Winkielman, 2004), und auch semantische Kohärenz erzeugt automatisch einen phasischen positiveren Affekt (Topolinski et al., 2009; Topolinski & Strack, 2009).
2.3. Die Rolle des Körpers
Der im IS generierte Kernaffekt, der im Zentrum von Russells (2003) Ansatz steht, wird als ein neurophysiologischer Zustand beschrieben, der den Körper mit all seinen zu einem bestimmten Zeitpunkt vor sich gehenden Abläufen umfasst. Im Folgenden soll deshalb kurz dargelegt werden, welche Rolle der Körper in der bisherigen Affektforschung gespielt hat. Dazu werden zunächst (klassische) Theorien und deren Differenzierungen geschildert, die versuchen, jeweils entweder Körper und Affekt, Affekt und Kognition, oder Körper und Kognition zu integrieren. Weiterhin wird der neuere Embodiment-Ansatz erläutert, welcher einen Schritt weiter geht, indem er versucht, alle drei Bereiche, also Körper, Affekt und Kognition zu integrieren.
Körper und Affekt. James (1884, 1890) und Lange (1885) postulierten, dass die Wahrnehmung einer Emotion gleichbedeutend mit der sensorischen Wahrnehmung somatischer, viszeraler und motorischer (James) bzw. vaskulärer und motorischer (Lange) Reize sei. Tomkins (1962, 1963) beschreibt die Idee, dass reizgetrieben durch evolutionär entstandene Affektprogramme spezifische Muster in Muskelanspannungen (also körperliche Zustände) erzeugt werden, aus welchen sich emotionale Repräsentationen generieren. Neuere Forschungen belegen dies beispielsweise unter anderem anhand der Mimik beim Betrachten emotionaler Stimuli: es konnte gezeigt werden, dass (neben der willentlich kontrollierbaren) eine automatische, reizgetriebene Reaktion der Gesichtsmuskulatur erfolgt (Dimberg, 1997; 2000; 2002). Auch Laird (1984), Duclos et al. (1989) und Stepper und Strack (1993) belegen die Idee, dass Muskelbewegungen mentale Repräsentationen von Emotionen verursachen können.
Affekt und Kognition. Emotionale Reaktionen können eng mit kognitiven Einschätzungen zusammenhängen. Frijda (1986) zeigt, dass die Einschätzung der aktuellen Situation im Individuum Handlungsbereitschaften erzeugt, die emotionaler Natur sind und die jeweils ganz bestimmte, der Situation angepasste Verhaltensweisen erleichtern. Russell (2003), Scherer (1984, 1993, 1997, 2001) und Ortony, Clore und Collins (1988) differenzieren diese Idee dahingehend, dass Einschätzungen beeinflussen können, welche Emotionen ein Mensch wahrnimmt.
Körper und Kognition. Es ist des Weiteren auch bekannt, dass selbst subtilste kognitive Vorgänge zu unbewussten Körperveränderungen führen können: Bargh et al. (1996) zeigen, dass das (unbewusst applizierte) Priming eines Stereotyps (z.B. „alt“) körperliche Auswirkungen (z.B. langsameres Gehen) nach sich zieht. Auch umgekehrt aktivieren stereotype (z.B. langsame) Bewegungen das entsprechende Stereotyp (Mussweiler, 2006).
Embodiment: Integration von Körper, Affekt und Kognition. Schon Darwin (1872) definierte Einstellungen (Kognition) als eine Sammlung von motorischen Verhaltensweisen (Körper), welche die emotionale Reaktion (Emotion) eines Individuums auf ein Objekt widerspiegeln. Ein neuerer theoretischer Ansatz, der die bisherige Forschung und Darwins Idee verknüpft und erweitert, ist der Embodiment-Ansatz. Niedenthal (2007) schildert die grundlegende Idee: „The theories suggest that perceiving and thinking about emotion involve perceptual, somatovisceral, and motoric reexperiencing (collectively referred to as “embodiment”) of the relevant emotion in one’s self“ (S. 1002).
Eine Möglichkeit, diese These empirisch zu untersuchen, ist es, einen bestimmten körperlichen Zustand experimentell zu induzieren und dessen Auswirkungen auf Emotionen, Handlungen und Kognitionen zu messen. Ein solch klassischer Ansatz findet sich bei Strack, Martin und Stepper (1988), die zeigen können, dass emotionale Urteile von Körperzuständen abhängen. Wenn eine Person ihre Mundwinkel wie bei einem Lächeln, ohne sich dessen bewusst zu sein, nach oben hebt (indem sie den Stift, der die Kreuze auf dem Bewertungsbogen macht, zwischen den Zähnen hält), findet sie einen vor sich liegenden Comic lustiger als wenn sie die Mundwinkel nach unten zieht (indem sie den Stift zwischen den Lippen festhält). Zahlreiche weitere Experimente bestätigen diese Ergebnisse anhand unterschiedlichster Körpermanipulationen: beispielsweise weisen Stepper und Strack (1993) nach, dass das Erleben von Stolz und guter Stimmung von einer aufrechten Körperhaltung abhängt. Duckworth, Bargh, Garcia und Chaiken (2002) zeigen, dass Handbewegungen vom Körper weg eher mit betrachteten negativen Stimuli assoziiert sind, und Handbewegungen zum Körper hin eher mit positiven Stimuli. Cacioppo, Priester und Berntson (1993) zeigen, dass chinesische Schriftzeichen positiver bewertet werden, wenn dies mit dem Heranziehen des Arms zum Körper einhergeht und umgekehrt.
Eine zweite Möglichkeit zur Untersuchung der Embodiment-These besteht darin, körperliche Reaktionen auf Umweltreize bzw. affektive Zustände zu untersuchen. Tucker und Ellis (1998) zeigen z.B., dass die Entscheidung, ob eine den Probanden (Rechtshändern) gezeigte Tasse auf dem Kopf oder auf dem Boden steht, schneller getroffen werden kann, wenn sich der Tassenhenkel bei dem gezeigten Bild auf der rechten Seite befindet, und umgekehrt. Probanden, die sich emotionale Stimuli (Gesichter) anschauen, mimikrieren kurz dargebotene Stimuli sofort und erkennen die Valenz der Stimuli leichter, wenn sie bei der Mimikry nicht behindert werden (Niedenthal, Brauer, Halberstadt & Innes-Ker, 2001; vgl. auch Dimberg, 1997, 2000, 2002; Niedenthal, Ric, & Krauth-Gruber, 2002).
Niedenthal (2007) fasst die Forschung zum Zusammenhang von Körper, Affekt und Kognition folgendermaßen zusammen: „Research reveals that when individuals adopt emotion-specific postures, they report experiencing the associated emotions; when individuals adopt facial expressions or make emotional gestures, their preferences and attitudes are influenced; and when individuals’ motor movements are inhibited, interference in the experience of emotion and processing of emotional information is observed” (S. 1002).
Aus all dem lässt sich Folgendes schlussfolgern: kognitive Ereignisse werden in ihren Wurzeln durch die körperlich-affektiven Erfahrungen des Individuums mit der Welt erzeugt (vgl. Lakoff & Johnson, 1999). Kognitive Repräsentationen werden also von affektiv-sensomotorischen Repräsentationen konstituiert (vgl. Barsalou, 1999) . Selbst mit abstrakten Konzepten zu operieren bedeutet, affektiv-sensomotorische Simulationen durchzuführen: “Individuals simulate objects in the relevant modalities when they use them in thought and language” (Niedenthal, 2007, S. 1005). Eine wichtige Rolle dabei spielt auch der Kontext, in dem die Erfahrungen gemacht wurden; er wird in die Repräsentation der entstehenden Konzepte mit einbezogen (vgl. Barsalou & Wiemer-Hastings, 2005). In der Terminologie des RIM ausgedrückt bedeutet dies, dass die semantischen Inhalte, die das RS aus dem IS speist und seinen propositionalen Operationen unterzieht, genuin verkörpert, „embodied“ sind. Im Folgenden sollen einige Befunde dargestellt werden, die diesen Zusammenhang von Körper, Affekt und Kognition auch aus neurologischer Sicht[1] untermauern.
2.4. Neurologische Modelle
In der körperorientierten Traumatherapie (z.B. Ogden, Minton & Pain, 2006) wird das Modell des „triune brain“ als Grundlage herangezogen: MacLean (1985, 1990) sieht das menschliche Gehirn (vereinfacht) als ein „Gehirn mit einem Gehirn mit einem Gehirn“ (vgl. auch Panksepp, 2005) an. Er meint damit folgendes: Das Stammhirn, das der Mensch mit den Reptilien gemeinsam hat, reguliert Körperprozesse wie Arousal, Homöostase und basale Verhaltensprogramme. Das limbische System, welches bei höher entwickelten Lebewesen (v.a. Säugetieren) zu finden ist, ist vor allem für Emotionen und ein Emotionsgedächtnis, einige soziale Verhaltensweisen und Lernen (Cozolino, 2002) zuständig. Der hoch entwickelte Neokortex schließlich, den man beim Menschen findet, übernimmt mit seiner Fähigkeit zu bewusstem Denken und der Fähigkeit zur Selbst-Bewusstheit das Konsolidieren (Siegel, 1999) und die Weiterverarbeitung von Informationen. Grundsätzlich geht die körperorientierte Traumatherapie also von drei separaten Levels der Informationsverarbeitung (kognitiv, emotional, sensomotorisch; vgl. Wilber, 1996) aus, wobei jedes einzelne System dominant werden und die Aktivität der anderen zu einem bestimmten Zeitpunkt überschreiben kann. Das kognitive System ist somit grob den reflektiven Vorgängen (RS) des RIM zuzuordnen. Die sensomotorisch-körperlichen und emotionalen Impulse der beiden anderen neurologischen Systeme hingegen sind im IS anzusiedeln.
Die drei Systeme werden dabei, genau wie beim RIM, auch aus neurologischer Sicht nicht als völlig eigenständig, sondern als neuronal eng miteinander verknüpft und interdependent arbeitend angesehen (vgl. Damasio, 2003 ; LeDoux, 1996; Schore, 1994). Das Dominieren von kognitiven Funktionen über Körper und Emotion wird von LeDoux (1996) als Top-Down-Processing beschrieben: höhere Levels überschreiben, steuern und unterbrechen niedrigere Levels (z.B. „Ich habe Hunger, arbeite aber trotzdem weiter!“). Dies entspricht einem Dominieren des RS bei der Verhaltenssteuerung. Ein emotional-körperliches Hintergrundgefühl bildet umgekehrt auch ein Substrat für das Denken und Handeln (vgl. auch weiter oben: Embodiment), und körperliche bzw. emotionale Zustände („Somatische Marker“, Damasio, 1995) beeinflussen das Denken. Durch die Marker werden in der Informationsverarbeitung die Konsequenzen der Handlungsalternativen nicht nur lediglich rational einbezogen, sondern auch durch einen automatischen, körpergebundenen Prozess emotional bewertet (dies entspricht der korrespondierenden Aktivierung von impulsiven Inhalten und reflektiven Operationen)[2].
Der „Embodiment“-Ansatz (Niedenthal, 2007) integriert alle drei neurologisch unterscheidbaren Ebenen: die „embodied cognitions“, die darin beschrieben werden, sind nicht nur rein kognitive Phänomene, sondern ereignen sich zugleich auf einer kognitiven, emotionalen und sensomotorischen Ebene, d.h. in ihnen sind zugleich Stammhirn, limbisches System und Neokortex einbezogen.
Auch Damasio (2003) beschreibt einen Prozess, wie in einem Individuum deklaratives Wissen über die eigene Person durch die Interaktion von IS und RS im RIM (Strack & Deutsch, 2004) zustande kommt. Um eine propositionale Repräsentation, welche bei Damasio als emotional-körperbezogenes Selbstkonzept gefasst wird, zu generieren, bezieht das RS sensomotorisch-körperliche und affektive Inhalte aus dem polymodalen assoziativen Speicher des IS und integriert sie zu einem Bewusstseinsinhalt (S. 241). Auch Ogden et al. (2006) beschreiben aus traumatherapeutischer Sicht eben diesen Aspekt: „How, then, can we begin to know our minds? If the patterns of the body’s movements and posture influence reason, cognitive self-reflection might not be the only or even the best way of bringing the workings of the mind to consciousness. Reflecting on, exploring, and changing the posture and movement of the body may be as valuable” (S. 10).
Schlussfolgerung. Es kann also gezeigt werden, dass die drei Aspekte eines Individuums, welche der Embodiment-Ansatz integriert (Körper, Affekt und Kognition) neurologisch abgrenzbaren Systemen der Informationsverarbeitung entsprechen. Das RIM und die Embodiment-These haben wertvolle Hinweise auf den Mechanismus gegeben, wie propositionale Repräsentationen aus impulsiven Inhalten generiert werden; die neurologischen Modelle untermauern dabei, dass propositionale Repräsentationen (unter anderem) aus (a) körperlichen Empfindungen und (b) damit zusammenhängenden emotionalen Erfahrungen gespeist zu werden scheinen.
2.5. Veränderung affektiver Zustände
Die bisher beschriebenen Rahmenmodelle beschreiben zwar detailliert, wie affektive Zustände durch Umweltreize oder interne Informationsverarbeitung entstehen und wie diese propositional repräsentiert werden. In der Grundlagenliteratur findet sich jedoch relativ wenig Auskunft über den Prozessaspekt, also darüber, wie affektive Zustände sich wieder auflösen bzw. in andere Zustände umwandeln. Im Folgenden sollen deshalb zunächst Implikationen des RIM über den Prozessaspekt abgeleitet werden, anhand derer die (später geschilderten) in der psychotherapeutischen Praxis angewandten Interventionen eingeordnet werden können.
Implikationen des RIM. Das RIM impliziert vier Arten, wie sich affektive Zustände verändern können, die hier als Reizveränderung, Abschirmung, kognitive Integration und als rein impulsive Veränderung bezeichnet werden sollen. Die vorliegende Arbeit wird sich mit der kognitiven Integration als zentralem Faktor befassen, da diese in den später geschilderten psychotherapeutischen Verfahren ein Haupt-Wirkfaktor zu sein scheint. Reizveränderung und Abschirmung sind Faktoren, die im humanistischen Therapiekontext als Rahmenbedingungen für die eine effektive kognitive Integration fungieren können; deshalb sollen sie im Folgenden ebenfalls genauer betrachtet werden. Möglichkeit vier (rein impulsive Affektveränderung) soll nur kurz der Vollständigkeit halber genannt werden, da sie in der vorliegenden Argumentation keine weitere Rolle spielen wird.
Reizveränderung. Erstens kann ein Organismus mit neuen Reizen konfrontiert sein; diese werden wahrgenommen und aktivieren neue Knoten im assoziativen Speicher des IS und damit neue motivationale Orientierungen (vgl. Strack & Deutsch, 2004, S. 232). Es werden neue Inhalte verfügbar, neue motorische Impulse entstehen und neue subjektiv wahrnehmbare Stimmungen, Gefühle und Emotionen können durch den Einbezug des RS propositional repräsentiert werden. Diese Reize können aus der Umwelt kommen, und sensorisch wahrgenommen werden; aber auch interne Reize (z.B. Hunger) können auf diese Art den affektiven Zustand verändern. Eine Variation dieser Möglichkeit liegt in der Imagination affektinkompatibler Inhalte (vgl. Sanna, 2000). Durch reflektiv gesteuerte Top-Down-Prozesse werden durch die Imaginationen, genau wie durch die sensorische Wahrnehmung von tatsächlichen Umweltreizen, neue Inhalte im assoziativen Speicher aktiviert, was mit affektiven Veränderungen einhergehen kann. Eine weitere Variation dieser ersten Möglichkeit der Veränderung affektiver Zustände besteht darin, dass sich affektive Zustände auch dann ändern, wenn ein affekt-bezogenes instrumentelles Verhalten (z.B. Annäherung bzw. Vermeidung) ausgeführt wurde, und der Organismus wahrnimmt, dass dieses Verhalten die Umwelt verändert hat (vgl. Bradley & Lang, 2000; Carver & Scheier, 1990; Davidson, Ekman, Saron, Senulis, & Friesen, 1990; Russell, 2003). Auch hierbei entstehen durch das Verhalten neue (Umwelt-)Reize, die dem Individuum Auskunft darüber geben, inwieweit das Verhalten erfolgreich (oder nicht oder teilweise erfolgreich) war. Diese Reize werden auch hier wahrgenommen und aktivieren neue impulsive Inhalte. Der Unterschied liegt nun jedoch darin, dass die Reize, die das Individuum im letzteren Fall wahrnimmt, zumindest teilweise von ihm selbst aktiv beeinflusst worden sind. Möglichkeit eins der Affektveränderung ließe sich unter dem Stichwort Reizveränderung zusammenfassen.
Abschirmung. Eine zweite Möglichkeit der Veränderung affektiver Zustände liegt in einer antagonistischen Aktivierung des RS: das Individuum verarbeitet Reize im RS so, dass unerwünschte bzw. unangenehme Impulse aus dem IS möglichst von der propositionalen Verarbeitung ausgeschlossen, und erwünschte oder angenehme Impulse möglichst verstärkt verarbeitet werden. Eine Variation dieser Möglichkeit liegt darin, dass unerwünschte Informationen im RS verändert oder von der Verarbeitung ausgeschlossen werden. Beispielsweise kann ein Individuum sich in schwierigen Situationen vor allem auf positive Aspekte der Situation konzentrieren, und negative Aspekte gezielt ausblenden. Diese zweite Möglichkeit ließe sich unter dem Stichwort Abschirmung zusammenfassen (vgl. auch „goal shielding“, Shah, Friedman & Kruglanski, 2002; Veling & van Knippenberg, 2006).
Kognitive Integration. Die dritte Möglichkeit, wie sich affektive Zustände ändern können, liegt in einer synergetischen Aktivierung des RS: das Individuum kann die Zustände, Inhalte und Impulse, die zu einem bestimmten Zeitpunkt im assoziativen Speicher aktiv sind, im RS propositional repräsentieren (umgangssprachlich würde man sagen, „sich seine Gefühle, Inhalte und Impulse vor Augen führen“). Dieser Vorgang kann mit einer Änderung der affektiven Zustände im IS einhergehen: durch die propositionale Repräsentierung affektiver impulsive Inhalte werden diese syllogistischen Schlussfolgerungen und zusätzlichen reflektiv-getriggerten Bewertungen zugänglich, und sind damit in einen breiteren (propositional repräsentierten) Kontext gestellt. Wenn z.B. im IS vorhandene Angst-Impulse im RS reflektiv verarbeitet werden, können damit gleichzeitig auch relevante Verhaltensstrategien aktiviert werden, mit denen die Person in früheren Situationen erfolgreich reagiert hat. Durch den aktivierten Kontext werden also neue, korrespondierende Elemente im IS mit aktiviert, und diese Neuaktivierung führt zu einer Veränderung im Gesamtzustand (und der damit einhergehenden Veränderung des Kernaffekt, vgl. Russell, 2003) des Organismus. Diese dritte Möglichkeit der Änderung von affektiven Zuständen ließe sich also unter dem Stichwort kognitive Integration zusammenfassen.
Rein impulsive Affektveränderung. Eine ganz natürliche, rein impulsive vierte mögliche Art der Affektänderung stellen Vorgänge der Habituation, Sensitivierung und ein einfaches Abebben der affektiven Reaktionen dar (vgl. z.B. Margraf, 2005). Da diese Vorgänge in den später geschilderten humanistischen Therapieverfahren, im Paradigma des emotionalen Schreibens usw. keine größere Rolle spielen, soll diese vierte Möglichkeit der Affektänderung für die vorliegende Arbeit ausgeklammert werden.
Emotionsregulation. In der Literatur zur Emotionsregulation (z.B. Gross, 2007; Koole, 2009; Parkinson & Todderdell, 1999) finden sich zahlreiche Hinweise auf diese Möglichkeiten der Affektveränderung. Drei der genannten Strategien, die in ihrem Schwerpunkt der kognitiven Integration (Möglichkeit drei anhand des RIM) entsprechen, sollen exemplarisch herausgegriffen werden[3]:
Auf die Person zielende, aufmerksamkeitsbezogene Strategien der Emotionsregulation sind beispielsweise Meditation (Cahn & Polich, 2006) und Achtsamkeitstraining (Brown, Ryan & Reswell, 2007). In beiden Strategien wird versucht, in einer bewussten, absichtslosen Haltung einen kontinuierlichen Monitoring-Prozess zu etablieren, der die eigene Wahrnehmung von Umweltreizen, Gedanken und Affekten zum Gegenstand hat, ohne dass diese dabei aktiv beeinflusst oder verändert werden. Beide Strategien entsprechen also in ihrem Schwerpunkt der kognitiven Integration von Inhalten des IS im RS[4].
Ein weiteres Beispiel für die kognitive Integration von Inhalten des IS im RS ist der sprachliche oder schriftliche Ausdruck von Emotionen[5]. Diese Form der kognitiven Integration wird in vielen psychotherapeutischen Ansätzen induziert, da sie das psychische Wohlbefinden steigern kann (vgl. z.B. Cameron & Ellis, 1994; Frattaroli, 2006; Kennedy-Moore & Watson, 1999, 2001; Stanton, Kirk, Cameron, & Danoff-Burg, 2000). Auch in der Grundlagenforschung geht man davon aus, dass Priming-Effekte durch Expression neutralisiert werden können (z.B. Sparrow & Wegner, 2006): “(…) people indeed need some way to overcome the influence of primes (…) and not get stuck in a primed behavior loop—it may well be that expression of some kind could foster unpriming in many circumstances” (S. 1017). Deshalb soll dieses Thema etwas ausführlicher dargelegt werden.
Kennedy-Moore und Watson (1999, 2001) diskutieren zwei verschiedene Mechanismen[6], die beschreiben, wie die kognitive Integration mittels Emotionsausdruck das Wohlbefinden eines Menschen steigern kann. Der erste Mechanismus geht davon aus, dass der Ausdruck von Emotionen deren aversiven Charakter abschwächt: beispielweise kann ein Trauma sehr aversive Zustände in einem Menschen bewirken. Wenn dieser Mensch nun Angst hat, darüber zu erzählen, oder auch diese Empfindungen lediglich zuzulassen, stellt dies eine neue, zusätzliche Belastung dar (vgl. auch Baumeister und Exline, 2000). Eine selbstbestimmte Art, mit belastenden Emotionen umzugehen, wirkt also erleichternd: „Voluntarily choosing to express their feelings enables people to select the time, form, and context of their expression, thereby diminishing their sense of helplessness concerning these feelings” (Kennedy-Moore & Watson, S. 190). Durch die Integration von Affekten im RS entsteht im Individuum eine neue Sichtweise: der Stress wird zwar als schmerzhaft, aber nicht mehr als unaushaltbar wahrgenommen (Greenberg & Safran, 1987; Greenberg, Wortman & Stone, 1996).
Ein weiterer Mechanismus ist die Nutzung der in der Emotion implizierten Information, um Bedeutung und Sinn im Individuum zu generieren: „Expression makes covert emotional experience overt. (…) putting emotional experience into words can help people to recognize, understand, and interpret their inner subjective states” (Kennedy-Moore & Watson S. 192). Den eigenen Affekt zu verstehen, hilft dann dabei, besser auf die Anforderungen der Umwelt einzugehen (Mayer & Salovey, 1997; Salovey, Bedell, Detweiler, & Mayer, 1999; Watson & Greenberg, 1996), oder um den Affekt zu regulieren (Mayer & Gaschke, 1988; Mayer & Salovey, 1997). Die kognitive Integration impulsiver Inhalte im RS hilft also, die wahrgenommenen Gefühle zu strukturieren und zu organisieren und deren Ursachen in der Vergangenheit und Implikationen für die Zukunft zu verstehen (vgl. auch Horowitz, 1986). Kennedy-Moore und Watson schlussfolgern: „In general the better people understand their emotional experience, the better they are able to cope with it” (S. 193). Entscheidend dabei scheint zu sein, dass Menschen in der Lage sind, eine kohärente autobiographische Geschichte aus ihren Erlebnissen zu formen (vgl. auch „autobiographisches Selbst“ bei Damasio, 2003).
Der Ausdruck aversiver Emotionen führt jedoch nicht immer zu einer Verbesserung des Wohlbefindens. Beispielsweise konnte gezeigt werden, dass es bei Menschen, die kürzlich ihren Ehepartner verloren haben, sinnvoller sein kann, wenn sie eine „expressive avoidance“ pflegen (Bonanno, Keltner, Holen & Horowitz, 1995; Bonanno & Kaltmann, 1999; Bonanno, Znoj, Siddique & Horowitz, 1999). Auch Menschen, die chronisch eher zu negativem Affekt neigen (hohe „Negative Affectivity“, vgl. Watson, 2000; Watson & Clark, 1984), drücken im Alltag chronisch mehr Distress aus; es geht ihnen dadurch jedoch nicht besser. Der Ausdruck von Emotionen kann also in spezifischen Situationen den persönlich erlebten Stress steigern (Ebbesen, Duncan & Konecni, 1975). Es scheint also einen Faktor (oder mehrere Faktoren) zu geben, der darüber bestimmt, welche der beiden Möglichkeiten in einem bestimmten Fall zutrifft, und ob, davon abhängig, der Ausdruck von Emotionen hilfreich ist oder nicht.
Als ein solcher Faktor wird die emotionale Distanz diskutiert, die ein Mensch während des Ausdrucks seiner Emotionen zu diesen erlebt[7]. Scheff (1979) beispielsweise weist darauf hin, dass die Gefühle, die jemand ausdrückt, einerseits fühlbar sein müssen; andererseits muss er sich auch sicher fühlen. Auch Horowitz (1986) geht davon aus, dass die richtige „Dosierung“ des Emotionsausdrucks einen entscheidenden Unterschied macht. Kennedy-Moore und Watson (2001, S. 192) beschreiben, dass Emotionsausdruck dann am besten wirkt, wenn gleichzeitig ein Eintauchen in das Gefühl und Kontrolle über das, was geschieht, gewährleistet sind. Rice und Kerr (1986) und Mergenthaler (1996) zeigen, dass eine Integration emotionaler Zustände davon anhängt, dass Individuen nicht von ihren emotionalen Zuständen überwältigt werden: optimal ist es, wenn sie ihr Erleben flüssig ausdrücken können, und dabei genügend Distanz erleben, um ihre Gefühle zugleich sorgfältig untersuchen und interpretieren zu können.
Der Mechanismus, welcher die kognitive Integration erleichtert oder verhindert, wird vermutlich über das Arousal vermittelt. Eine Integration von Gedanken, Gefühlen, Erinnerungen und sensomotorischen Responses ist im Zustand der Über- oder Untererregung (oder in einem manchmal beobachteten schnellen Wechsel beider Phänomene, vgl. Ogden et al., 2006) nicht möglich. Zu wenig Arousal zieht eine emotionale Leere, Paralyse und Passivität nach sich (Bremner & Brett, 1997), wohingegen zu viel Arousal im Erleben gefangen hält (Post, Weiss, Smith, Li & McCann, 1997). Beispielsweise in der Traumatherapie wird deshalb ein sogenanntes „window of tolerance“ (Ogden et al., 2006, S. 27) angestrebt, in dem ein mittleres, optimales Arousal herrscht (s.a. Punkt 2.8.).
Aus Sicht des RIM ist eine kognitive Integration nur dann möglich, wenn das reflektive System genügend kognitive Ressourcen zur Verfügung hat (vgl. Strack & Deutsch, 2004, S. 223ff.). Eine emotionale Distanzierung stellt also (über die Regulation des Arousals) die Funktionsfähigkeit des RS sicher: „The reflective system requires a high amount of cognitive capacity. Therefore, distraction as well as extremely high or low levels of arousal will interfere with its operation” (Strack & Deutsch, 2004, S. 223). Auch die Untersuchungen von Bushman (2002; vgl. auch Bushman & Baumeister, 1998; Bushman, Phillips & Baumeister, 2001; Bushman, Stack & Baumeister, 1999) liefern Hinweise dafür: das Vorhandensein einer Emotion (in diesem Fall Ärger) steigt im Individuum kurzfristig an, wenn zum einen im Versuchsablauf keine explizite Möglichkeit der Aktivierung des RS gegeben ist, und wenn zum anderen der Ausdruck der Emotion nicht verbal, sondern durch (in diesem Fall aggressiv-körperliches) Verhalten erfolgt[8]. Aus Sicht des RIM dürfte vor allem die körperliche Aktivität, welche mit einem erhöhten physiologischen Arousal einhergeht, die Funktionsfähigkeit des RS deutlich eingeschränkt, und damit eine kognitive Integration wirksam verhindert haben.
Emotionale Distanz kann auf unterschiedlichste Art und Weise erzeugt werden (vgl. z.B. oben „Emotionsregulation“; Koole, 2009). Legt man die ersten beiden Möglichkeiten der Affektveränderung, die das RIM impliziert, zu Grunde, so lassen sich diese in zwei grundsätzlich beschreibbare Wege einteilen, wie ein Individuum sich emotional distanzieren kann. Die erste Möglichkeit besteht darin, Reizveränderung zu betreiben (dies entspricht auch Möglichkeit eins der Einteilung anhand des RIM). Emotionale Distanzierung ist in diesem Fall eine Folge von veränderten Umweltreizen (z.B. angenehmer Musik) oder von imaginierten angenehmen Inhalten (z.B. der Vorstellung von Schwere und Wärme bei Entspannungstechniken wie dem autogenen Training). Die emotionale Distanz wird in diesem Fall also durch eine Aktivierung affektinkompatibler Inhalte hervorgerufen. Das Experiment der vorliegenden Arbeit (vgl. Abschnitte 3 und 4) wird sich auf diese erste Möglichkeit der Schaffung emotionaler Distanz stützen. Eine zweite Möglichkeit, wie ein Individuum sich emotional von aversiven Affekten distanzieren kann, liegt in der reinen Abschirmung der aversiven Inhalte (dies entspricht damit auch der zweiten Möglichkeit der Einteilung anhand des RIM; vgl. auch Trope & Liberman, 2003).
2.6. Zwischen-Fazit
Bei der kognitiven Integration (Möglichkeit drei der Einteilung anhand des RIM) verknüpft das RS affektive, sensomotorische und semantische Inhalte aus dem IS, die genuin körperlich sind. Emotionsausdruck als eine der wichtigsten Möglichkeiten der kognitiven Integration führt dazu, dass Individuen ihre Affekte wahrnehmen, die darin liegende Information bei der reflektiven Verarbeitung zur Verhaltensgenerierung nutzen können und der affektive Zustand sich dadurch verändert. Um optimale Bedingungen hierfür zu gewährleisten, ist eine mittleres Arousal notwendig. Für dieses spielen gerade auch die ersten beiden Möglichkeiten der Einteilung anhand des RIM (Reizveränderung und Abschirmung) eine große Rolle, da durch sie das Arousal verstärkt oder abgeschwächt werden kann. Im Folgenden soll deshalb dargelegt werden, wie die beschriebenen ersten drei Möglichkeiten, die das RIM impliziert, in der psychotherapeutischen Praxis Anwendung finden. Die kognitive Integration wird dabei als Haupt-Wirkfaktor und die Reizveränderung und Abschirmung als Neben-Wirkfaktoren diskutiert, welche das Arousal regulieren. Diese Anwendung auf die Praxis soll am Beispiel des „emotionalen Schreibens“, der Traumatherapie und zweier neuerer humanistischer Therapieverfahren geschehen. Dabei soll insbesondere im Hinblick auf die Aspekte Körper, Affekt und Kognition Wert gelegt werden, die (entsprechend der Embodiment-These und den geschilderten neurologischen Modellen) eng miteinander verwoben sind.
2.7. Kognitive Integration im Paradigma des „emotionalen Schreibens“
Schreibinterventionen. Die oben beschriebene Expression emotionaler Zustände wurde beispielsweise intensiv anhand von Schreibinterventionen beforscht. Pennebaker und Beall (1986) waren die ersten, die nach folgendem Paradigma verfuhren: sie ließen Probanden an vier aufeinanderfolgenden Abenden jeweils für 15 Minuten über emotional traumatische Erfahrungen schreiben. Als Folge davon erlebten die Probanden kurzfristig negativere emotionale Zustände; langfristig jedoch wirkte sich die Intervention positiv auf die körperliche Gesundheit aus (geringere Zahl an Arztbesuchen im folgenden halben Jahr). Seither wurden mehr als 200 Studien nach diesem Verfahren durchgeführt (vgl. Meta-Analyse von Frattaroli, 2006). Am häufigsten werden dabei positive Auswirkungen auf die körperliche Gesundheit beobachtet: so verringern sich z.B. die körperlichen Effekte bei Asthmatikern und Rheumatikern (Smyth, Stone, Hurewitz, & Kaell, 1999), Menschen mit generalisierten chronischen Schmerzstörungen werden schmerzfreier (Broderick, Junghaenel & Schwartz, 2005; Norman, Lumley, Dooley, & Diamond, 2005), Frauen mit Brustkrebs zeigen weniger Symptome (Stanton et al., 2002), die Immunfunktion bei HIV-Infizierten ist stärker (Petrie, Fontanilla, Thomas, Booth, & Pennebaker, 2004), Menschen mit chronischer Insomnie können leichter einschlafen (Harvey & Farrell, 2003). Das Schreiben hat auch positive Effekte auf das psychische Wohlbefinden: z.B. depressive Symptome (z.B. Sloan & Marx, 2004) und posttraumatische Belastungssymptome (Schoutrop, Lange, Hanewald, Davidovich, & Salomon, 2002) nehmen ab.
Neben den gesundheitlichen Aspekten wird auch das allgemeine Leistungsniveau angehoben: so verringert sich z.B. bei Arbeitslosigkeit die Zeit bis zur Wiedereingliederung in ein Arbeitsverhältnis (Spera, Buhrfeind & Pennebaker, 1994) und bei Studenten zeigen sich bessere Prüfungsnoten (Cameron & Nicholls, 1998; Pennebaker, Colder & Sharp, 1990).
Neuere Studien können die Effekte emotionalen Schreibens jedoch teilweise nicht replizieren (z.B. Kovac & Range, 2002; Stroebe, Stroebe, Schut, Zech, & van den Bout, 2002; Kröner-Herwig, Linkemann & Morris, 2003)[9].
Emotionale Distanzierung beim Schreiben. Einen interessanten Befund liefern Pennebaker und Seagal (1999) und Pennebaker, Mayne & Francis (1997) dahingehend, dass die emotionale Distanzierung beim Schreibparadigma einen wichtigen Einflussfaktor darstellt. Bei der Analyse von nach dem oben erläuterten Paradigma entstandenen Texten zeigte sich, dass Probanden dann am meisten profitierten, wenn sie (1) eine hohe Anzahl von positiven Wörtern (z.B. „gut“, „angenehm“, „schön“ usw.) verwendeten, und (2) eine mittlere Anzahl an negativen Wörtern (z.B. „traurig“, „schlimm“, „schmerzhaft“ usw.) verwendeten, also sich in einer permanenten emotionalen Distanz zu den beschriebenen traumatischen Erlebnissen befanden, bei der auch affektinkompatible Inhalte aktiviert waren[10]. Die kognitive Integration könnte tatsächlich der entscheidende Wirkmechanismus sein, da (3) zusätzlich zu dem eben Beschriebenen bei den Probanden, die am meisten profitierten, die Anzahl der kognitiv-kausalen Wörter (z.B. „weil“, „deswegen“, „verstehen“) im Laufe der Schreibsessions stetig anstieg.
2.8. Kognitive Integration in der Traumatherapie
Aus der Traumaforschung ist bekannt, dass Traumatisierungen schwere somatische und emotionale Auswirkungen (IS) haben (vgl. Nijenhuis & Van der Hart, 1999; Van der Hart, Nijenhuis, Steele & Brown, 2004; van der Kolk, 1994; van der Kolk, McFarlane & Weisaeth, 1996). Van der Kolk (2006) berichtet: “Clients suffering from unresolved trauma nearly always report unregulated body experience; an uncontrollable cascade of strong emotions and physical sensations, triggered by reminders of the trauma, replays endlessly in the body” (S. xxviii). Traumatisierte Menschen leiden besonders oft unter Alexithymie (Taylor, Bagby & Parker 1997), also unter einer mangelnden kognitiven Integration (RS) impulsiver Inhalte (IS)[11].
Kognitive Integration in der klassischen Traumatherapie. In klassischen Modellen, die die Entstehung von Posttraumatischen Belastungsstörungen (PTSD) erklären (z.B. Ehlers, 1999), geht man davon aus, dass Erlebnisse, die zu aversiv sind, als dass sie ein Organismus zum Zeitpunkt des Erlebens adaptiv verarbeiten kann, im (autobiografischen) Gedächtnis von allen übrigen Lebensereignissen dissoziiert abgespeichert, und damit dem bewussten Erleben weitestgehend unzugänglich gemacht werden[12]. Sog. Intrusionen, also plötzlich auftauchende Bilder oder Erinnerungsfetzen, die i.d.R. mit einem starken aversiven Arousal verknüpft sind, durchbrechen diese Barriere im Alltag immer wieder. In der klassischen Behandlung von PTSD wird deshalb vor allem auf die Verarbeitung vergangener Erlebnisse durch Integration Wert gelegt wird. So werden beispielsweise Techniken angewandt, die es dem Patienten ermöglichen, die Erlebnisse aus einem sicheren Abstand heraus im Detail zu betrachten (z.B. dadurch, dass der Patient die Abfolge wie auf einer Filmleinwand vor sich imaginiert, und aus dieser sicheren emotionalen Distanz heraus beschreibt; Ehlers, 1999)[13], um sie einzuordnen und integrieren zu können (z.B. durch die Vorstellung, die beschrieben Details in einem imaginierten Schrank oder Archiv abzulegen, Ehlers, 1999)[14].
Körperbezogene Ansätze der kognitiven Integration. Die körperbezogene Traumatherapie erweitert diesen Ansatz um die weiter oben beschriebenen neurologischen Komponenten („triune brain“, vgl. MacLean, 1985, 1990; Panksepp, 2005); es sind vor allem Körpersensationen (und die damit verbundenen intensiven Affekte), die vom Bewusstsein ausgeschlossen werden: „Dissociation from the body and lack of connection to an inner experience of self is virtually the sine qua non of severe sexual abuse“ (Ray, 2006; vgl. Ogden & Minton, 2000; Price, 2002). Soldaten induzieren eine Art „körperlicher Anästhesie“ in bestimmten Körperbereichen, um spezifische Stresssituationen zu überstehen (Langholtz, 2000). In der Folgezeit nach dem Trauma versuchen die Betroffenen oft, mittels Drogen und Alkohol, sexueller Promiskuität, oder anderen rauschhaften Verhaltensweisen, ihr Leid zu lindern, welches vor allem damit zu tun hat, sich im eigenen Körper wohl oder eben unwohl zu fühlen (Scaer, 2001)[15].
Der Ansicht von Ogden et al. (2006) nach ist deshalb es ratsam, die klassische therapeutische Vorgehensweise zu differenzieren, indem man sowohl somatoviszerale, affektive, als auch kognitive Inhalte einbezieht: “In clinical practice, we find it useful to both examine each level of information processing separately and consider the interweaving of cognitions, emotions, and sensomotoric responses” (S. 8). Das Ziel der Therapie ist es, die integrativen Kapazitäten des Klienten zu erhöhen, so dass dissoziierte körperbezogene und emotionale Elemente der traumatischen Ereignisse assimiliert werden können (S. 38). Die körperlich-emotionalen Reaktionen werden über die bewusste Bezugnahme auf Körpersymptome der reflektiven Bearbeitung und damit der kognitiven Integration ins Selbst zugänglich. Ein Praxisbeispiel wird im Anhang (D) beschrieben.
Emotionale Distanzierung als Stabilisierungsfaktor. Der erste Schritt der Therapie (S. 206ff.) besteht darin, positive körperliche Ressourcen aufzubauen, die der Patient später nutzen kann. So lernt er zum Beispiel, welche Körperhaltungen sich hilfreich anfühlen[16], oder passendere Alternativen (und deren körperlich-fühlbare Resonanz) zu habituierten Reaktionen zu imaginieren[17]. Wichtig dabei ist es, die Aufmerksamkeit auf positive Empfindungen zu lenken, und diese dadurch zu sichern und zu verstärken[18]. Aus dieser körperlich gefühlten, sicheren emotionalen Distanz heraus kann dann auf die oben beschriebe Art (Aufmerksamkeit auf Körpersymptome usw.) integrativ auf schwierigere Themen eingegangen werden. Einige Beispiele für praktische körperbezogene Möglichkeiten der emotionalen Distanzierung sind in Anhang (E) beschrieben.
2.9. Kognitive Integration in den humanistischen Psychotherapieverfahren
Auch in der humanistischen Psychotherapie spielt die kognitive Integration als Haupt-Wirkfaktor eine entscheidende Rolle (in der dafür notwendigen emotionalen Distanzierung kommen auch in diesem Feld die Reizveränderung und die Abschirmung zum Tragen)[19]. Im Folgenden soll im Zusammenhang zu den bisherigen Überlegungen zunächst der klassische Ansatz der Gesprächspsychotherapie (z.B. Rogers, 1959, 1961, 1978, 1991) besprochen werden. Darauf aufbauend soll einerseits eine neuere Erweiterung dieser Grundlage, die vor allem emotionale Aspekte einbezieht („emotion focused therapy“, z.B. Greenberg, 2006; Greenberg, Rice & Elliot, 2003), aufgeführt werden. Andererseits soll auch auf eine vor allem auf den Körper bezogene Erweiterung der klientenzentrierten Grundgedanken („Focusing“, z.B. Gendlin, 1978, 1998; Gendlin & Wiltschko, 2004) eingegangen werden.
Kognitive Integration in der Gesprächspsychotherapie. Störungen werden in den klientenzentrierten Ansätzen als eine Folge von sog. Inkongruenzkonstellationen und damit als Aspekt der Persönlichkeitsstruktur gesehen (Speierer, 1994). Rogers (1959) beschreibt Inkongruenz als einen Zustand, in dem Erfahrung nicht vollständig zum Gewahrsein kommt, weil Selbstkonzepte dies verhindern. Es findet keine adäquate Symbolisierung der vollständigen Erfahrung statt; stattdessen treten Wahrnehmungsverzerrungen und selektive Wahrnehmung auf (Nemeskeri, 2003)[20]. Das Ziel von Therapie und Beratung ist es deshalb unter anderem, die Selbstexploration des Klienten zu fördern (Sander, 1999). Das bedeutet, dass Klienten lernen, ihre Gefühle, Wahrnehmungen, Affekte und Motive zu erkunden, und offen und aktiv über ihre Erfahrung zu sprechen (vgl. auch Sachse, 1986). Auch in der Gesprächstherapie findet sich die schon weiter oben beschriebene Notwendigkeit, Affektwahrnehmung und Reflektion integrativ zu verbinden (Stumm & Kritz, 2003). Heinerth (2003) führt die dem zugrunde liegende Theorie noch einmal deutlicher aus: „Erfahrung ist alles in einem bestimmten Augenblick gegebene Widerfahren, das potentiell der Gewahrwerdung zugänglich ist, d.h. symbolisiert werden kann. (...) Der Prozess der Bewusstwerdung führt zur (psychologischen) Wahrnehmung. Psychologische Wahrnehmung ist also das, was ins Bewusstsein eindringt. Bewusstsein ist symbolische Repräsentation eines Ausschnitts unserer Erfahrung“ (S. 90f). Der Therapeut fördert diesen Prozess, indem er sich im Gespräch in den inneren Bezugsrahmen des Klienten einzufühlen versucht, also in „alle Empfindungen, Wahrnehmungen, Bedeutungen, Erinnerungen und Gefühle sowie deren Wertungen des gegenwärtigen Moments, soweit sie der Gewahrwerdung zugänglich sind. Der innere Bezugsrahmen umfasst also sensorische (externale und viszerale), kognitive und emotionale Wahrnehmungen aus dem Gesamtorganismus, also aus Körper, Selbstkonzept und deren Verschränkung“ (Heinerth, 2003, S. 91). Der Therapeut versucht das, was er dabei empathisch wahrnimmt, dem Klienten zu „spiegeln“ (z.B. durch das sog. „Verbalisieren emotionaler Erlebnisinhalte“, VEE, vgl. Tausch, 1970), so dass dieser die Inhalte schließlich selbst wahrnehmen und kognitiv integrieren kann.
In der Begrifflichkeit des RIM (Strack & Deutsch, 2004) kann das Gewahrwerden also als kognitive Integration durch propositionale Repräsentation assoziativer Inhalte aus dem IS gefasst werden. Umweltreize, aber auch Kognitionen und Affekte lösen im IS ständig breitere assoziative Netzwerke aus, reaktivieren Erinnerungen und damit weitere chronisch verfügbare Affekte, sensomotorische Muster und Verhaltensdispositionen, die nicht notwendig propositional repräsentiert werden, sondern außerhalb der Aufmerksamkeit Verhalten und Erleben beeinflussen (vgl. auch „elderly prime“, Bargh et al., 1996; „affect misattribution procedure“, Payne, Cheng, Govorun, & Stewart, 2005; “unconscious goal pursuit”, Aarts, Custers & Marien, 2008; “Automatismen beim impliziten Lernen”, Cleeremans, 1997). Die „unvollständige Symbolisierung der Erfahrung“ nach Rogers entspricht also einer nicht stattfindenden (bzw. abgeschirmten) propositionalen Repräsentierung von Inhalten des IS im RS des RIM.
Es wird davon ausgegangen, dass als Folge der Selbstexploration Inkongruenz abnimmt, und Kongruenz entsteht. Letztere tritt dann auf, wenn „die Prozesse im Organismus, die prinzipiell erfahrbar sind, vom Organismus auch direkt und angemessen erfahren werden können; wenn also das Selbstkonzept in Übereinstimmung mit der Erfahrung ist, spricht man von exakter Symbolisierung der Erfahrung (...)“ (Nemeskeri, 2003, S. 142). In der Begrifflichkeit des RIM bedeutet dies, dass die Impulse des IS möglichst vollständig und möglichst genau propositional repräsentiert werden[21].
Emotionale Distanzierung in der Gesprächspsychotherapie. Um dies zu erreichen, nennt Rogers (1959, vgl. auch 1978) drei empirisch belegte Bedingungen, die der Therapeut erfüllen muss, damit Veränderung im psychotherapeutischen Kontext stattfindet[22]: der Therapeut befindet sich (1) in einem Zustand der Kongruenz, (2) fühlt sich empathisch in den inneren Bezugsrahmen des Klienten ein, und (3) bringt dem Klienten bedingungslose Wertschätzung entgehen. Es wird also ein therapeutischer Rahmen geschaffen, in dem der Klient sich sicher und geborgen fühlt[23]. Die emotionale Distanzierung übernimmt hier also (zu einem gewissen Grad) der Therapeut für den Klienten.
Kognitive Integration in der „emotionsfokussierten Therapie“. Greenberg (2000, 2004, 2006; Greenberg et al., 2003; Greenberg & Safran, 1987) erweitert diese klientenzentrierte Perspektive um den spezifischen Aspekt der Emotionalität[24]. Seiner Ansicht nach zeigen sich zwei nicht-adaptive chronische Dispositionen, vor allem mit negativem Affekt umzugehen: Menschen können entweder an Unterregulierung oder an Überregulierung ihres Affektes leiden. Personen der ersten Kategorie (die eher impulsiven Störungsbildern zuzuordnen sind) erleben ein Zuviel an intensivem negativem Affekt; wichtig für sie ist es, zu lernen, ihre Impulse abzuschwächen. Personen der zweiten Kategorie (die eher depressiven Störungsbildern zuzuordnen sind) nehmen ihre Gefühle nur in geringem Maße wahr, und haben Probleme damit, das Erleben aversiver emotionaler Erfahrungen zuzulassen und auszuhalten. Wichtig für diese Menschen ist es, dass sie lernen, ihre Gefühle wahrzunehmen und auszudrücken. Diese Sichtweise deckt sich auch mit der des RIM: „From the perspective of the reflective-impulsive model, the difference between the two types of behavior is only one of degree, not of kind. What we call ‘abnormal’ can often be described as the chronic determination of a behavior through only one operating system” (Strack & Deutsch, 2004, S. 243). Dies wäre im Fall der Unterregulierten ein prä-dominanter Einfluss des IS, im Fall der Überregulierten ein prä-dominanter Einfluss des RS.
Der Therapeut versucht in beiden Fällen, eine sogenannte Bearbeitungsorientierung zu etablieren: er begleitet den Klienten mittels der Rogers’schen Grundprinzipen (Empathie, Wertschätzung und Echtheit) und Techniken der Gestalttherapie (z.B. Zwei-Stühle-Dialog) dabei, seine affektiven Zustände zu erkunden. Das Ziel ist es, die in den Themen implizit vorhandenen primären Emotionen wahrzunehmen, zuzulassen und kognitiv zu interpretieren. Auch Greenberg geht dabei von zwei grundlegenden Verarbeitungsmodi (rational bzw. reflektiv und experientiell bzw. impulsiv) aus, wie das RIM (Strack & Deutsch, 2004) und das CEST (Epstein, 1994) sie beschreiben. Aufgabe der Therapie ist es demnach, erlebte emotionale Erfahrung zu integrieren: „Die Lösung des Dilemmas liegt nun keineswegs darin, einen Bewusstseinsstrom dem anderen vorzuziehen, sondern beide zu integrieren. Das können wir am besten erreichen, indem wir unsere Gefühle zulassen, ihnen Aufmerksamkeit schenken und über sie nachdenken“ (Greenberg, 2006, S. 10). Auch wenn der hier beschriebene Therapieansatz sich vor allem auf affektive Impulse konzentriert, ist auch für Greenberg der Einbezug des Körpers wichtig: „Es ist jedoch nicht so, dass die eine „Stimme“ bewusst ist und die andere unbewusst (...). Beide sind dem Bewusstsein zugänglich, die eine Stimme jedoch kommuniziert mit Worten, und die andere durch die sensomotorischen Kanäle unseres Körpers“ (2006, S. 10)[25].
Durch das Vorgehen der emotionsfokussierten Therapie wird versucht, die emotionalen Schemata des Klienten schrittweise zu verändern, welche konzeptuell überlernten affektiven, semantischen und behavioralen Clustern im IS entsprechen (vgl. auch Bargh, 2006). Oatley (1992) versteht unter emotionalen Schemata interne Ordnungsstrukturen oder Programme, die festlegen, wie Menschen automatisch auf (erblich übermittelte oder gelernte) Reize reagieren. Emotionale Schemata arbeiten schnell und funktionieren ohne bewusstes Nachdenken (vgl. komplexe Verhaltensdispositionen aus semantischen und affektiven Clustern, z.B. „racial bias“ bei Correll, Park, Judd, & Wittenbrink, 2002; Correll et al., 2007). Sie umfassen kognitiv-affektive Strukturen, innere Modelle und Skripte und stellen das komplexeste Wissenssystem dar, über das Menschen verfügen (Greenberg & Safran, 1987; Leventhal, 1984). Emotionale Schemata ändern sich dann, wenn es dem Klienten gelingt, den Emotionen eine reflektive Bedeutung zu geben: „Daher reicht es nicht aus, wenn jemand seine Emotionen verspürt, sondern er muss diesen auch einen Sinn geben. (...) Wenn man Emotionen in einer Therapie verspürt hat, sollte man sich von ihnen leiten lassen und nicht versuchen sie loszuwerden“ (Greenberg, 2006, S. 28).
Kognitive Integration im Focusing-Ansatz. Eine Erweiterung der klientenzentrierten Grundgedanken, in der vor allem der Körper als Ausdrucks- und Erfahrungsraum innerer Zustände angesehen wird, ist der von Eugen Gendlin entwickelte Focusing-Ansatz[26]. Während Rogers sich in seinen Forschungen im Schwerpunkt stärker auf Eigenschaften des Therapeuten konzentrierte, richtet Gendlin sein Hauptaugenmerk stärker auf die Eigenschaften des Klienten. Dabei fand er (1961), dass Klienten, die während der Psychotherapie Introspektion auf eine ganz bestimmte Art und Weise betreiben[27], stärker profitieren, als Klienten, die dies nicht tun: Gendlin nannte die gefundene Personenvariable „experiencing“ und später „experiential focusing“. Diese Variable wird in der sog. „Experiencing-Skala“ psychometrisch erfasst (Klein, Mathieu, Gendlin & Kiesler, 1969). Dahlhoff und Bommert (deutsche Übersetzung, 1978) beschreiben diese Eigenschaft dann als gegeben, wenn ein Klient „über ein klares Bild von seinem unmittelbar ablaufenden Erleben verfügt, und in der Lage ist, die Bedeutungen des Erlebens für sich selbst zu verstehen, und dieses Erleben zur Basis seines Handelns machen kann“ (S. 4). Spätere Forschung (z.B. Sachse, Atrops, Wilke & Maus, 1992) zeigt, dass Klienten, die einen hohen Experiencing-Score aufweisen, in der Lage sind, einen holistisch-intuitiven Problemlösemodus (Kuhl, 1983) einzunehmen, d.h. Informationen „in der Schwebe zu halten“, auf sich wirken, und eine Lösung „entstehen“ zu lassen. In derselben Studie konnte auch gezeigt werden, dass Personen dann am meisten profitieren, wenn sie eine hohe Ambiguitäts-Toleranz zeigen, d.h. wenn sie fähig sind, unklare Bedeutungen und Widersprüche zu tolerieren[28]. In der Sprache des RIM würde dies bedeuten, dass eine Person in der Lage ist, auch ambivalente Verhaltensimpulse (vgl. auch „approach-avoidance“ Konflikte; Stroebe, Mensink, Aarts, Schut & Kruglanski, 2008), semantische Inhalte und Affekte optimal in die Urteilsformation und Verhaltensgenerierung mit einzubeziehen. Im gewissen Sinne kann dies auch als eine hohe Toleranz gegenüber kognitiver Dissonanz (Festinger, 1957; Gawronski & Strack, 2004) gefasst werden.
Im Focusing wird den potentiell wahrnehmbaren Inhalten des IS dabei ein hoher Stellenwert zugewiesen. Wiltschko (2003a) weist auf den Umstand hin, dass assoziative Impulse sehr viel mehr Information beinhalten, als in einem bestimmten Augenblick potentiell propositional repräsentiert werden kann: „Zwischen impliziten Bedeutungen und expliziten Symbolisierungen besteht keine Gleichung: Implizite Bedeutungen übersteigen die expliziten Formen, die immer nur einzelne Aspekte impliziten Erlebens hervorheben können“ (S. 100). Nisbett und Wilson (1977) konnten aus sozialkognitiver Sicht zeigen, dass Aussagen einer Person über ihre eigenen kognitiven Prozesse von impliziten kausalen Theorien
[...]
[1] Weitere Hinweise auf Körpervorgänge und Embodiment in der Entwicklungspsychologie, Allgemeinpsychologie und Stressforschung werden kurz im Anhang (B) geschildert.
[2] Damasio (1995, 183ff) gibt zahlreiche Belege dafür an, dass die impulsiven Reaktionen in subkortikalen Regionen generiert werden (v.a. die Amygdala spielt eine wichtige Rolle), die mit präfrontalen Abschnitten des Kortex zusammenarbeiten, wo die Signale aus dem Körper und aus den sensorischen Kortices repräsentiert und integriert und schließlich in motorische Impulse überführt werden.
[3] Strategien, die in ihrem Schwerpunkt den Möglichkeiten eins und zwei der Einteilung anhand des RIM entsprechen, werden in Anhang (C) dargelegt
[4] Natürlich spielt hierbei auch die Reizveränderung (z.B. durch permanente Lenkung der Aufmerksamkeit auf den eigenen Atem; Möglichkeit eins) eine Rolle; effektive Emotionsregulationsstrategien kombinieren i.d.R. mehrere Möglichkeiten der Affektveränderung der Einteilung anhand des RIM auf effektive Art und Weise.
[5] Durch den Ausdruck von Emotionen wird (abgesehen von der kognitiven Integration) natürlich auch die (v.a. soziale) Umwelt beeinflusst und verändert. Dieser zusätzliche Effekt des Emotionsausdrucks würde eher der Möglichkeit eins (Reizveränderung) der Einteilung anhand des RIM entsprechen. Man könnte also beim Emotionsausdruck zwischen einer primären Folge (Affektveränderung durch kognitive Integration) und einer sekundären Folge (Affektveränderung durch Reizveränderung) unterscheiden. Diese Arbeit beschäftigt sich v.a. mit der primären Folge, da in den später erläuterten psychotherapeutischen Methoden und in der davon abgeleiteten empirischen Untersuchung vor allem diese zum Tragen kommen wird.
[6] Kennedy-Moore und Watson gehen in einem dritten Mechanismus davon aus, dass der Emotionsausdruck auch zwischenmenschliche Beziehungen verbessern kann: die Intimität von Beziehungen kann steigen, und man erhält soziale Unterstützung (entsprechend Möglichkeit eins der Einteilung anhand des RIM; Reizveränderung). Tice und Baumeister (1993) zeigten zum Beispiel, dass bei Beziehungskonflikten der Ärger immer wiederkehrt, wenn er nicht ausgesprochen wird. Frattaroli (2006) fügt dem noch zwei weitere mögliche Mechanismen hinzu: es könnte sein, dass durch den Ausdruck von Emotionen Katharsis fördert und dass durch Exposition, die z.B. in kognitiven Verhaltenstherapien ein wirkungsvolles Werkzeug darstellt (z.B. in der Technik des „Flooding“), positive Effekte erzielt werden.
[7] Eine optimale emotionale Distanz ist in der Psychotherapie vor allem an der Sprache erkennbar (Greenberg, 2006; Rice, Watson & Greenberg, 1993; Watson & Greenberg, 1996): innere Zustände ändern sich dann, wenn die Klienten eine weiche und lebendige Sprache haben, Pausen machen, um den Kontakt zu ihren Gefühlen nicht zu verlieren; wenn sie nach innen fokussiert sind, um die Gefühle zu erleben, um sie bedenken und evaluieren zu können, so dass dadurch „Bedeutung“ (i.S.d. kognitiven Integration) entsteht. Distanz ist also notwendig; eine zu große Distanz ist jedoch auch nicht hilfreich. Klienten, die eine eher kalte, analytische Sprache haben, profitieren oft weniger. Sie sind überdistanziert, und sprechen eher „über die Gefühle“, als mit ihnen in direkt erlebbarem Kontakt zu sein.
[8] Bushman induzierte z.B. in seinen Probanden Ärger, und ließ sie danach einige Minuten lang mit Blick auf eine Fotografie der im Versuch ärgerauslösenden Person auf Boxsäcke einschlagen. Dies entspricht einer Kombination aus Reizveränderung (Einblendung der Fotografie; Möglichkeit eins anhand des RIM) und Abschirmung (Verstärken der aggressiven Inhalte des IS; Möglichkeit zwei anhand des RIM).
[9] Ein ausführlicherer Überblick über den aktuellen Forschungsstand zum emotionalen Schreibparadigma findet sich bei Frattaroli (2006), Pennebaker und Chung (2007) und Smyth und Pennebaker (2008).
[10] Dies entspricht der Möglichkeit 2 der Einteilung anhand des RIM (Abschirmung)
[11] Dies entspricht einer pathologischen Variante der Möglichkeit 2 der Einteilung anhand des RIM (Abschirmung)
[12] Dies entspricht einer pathologischen Variante der Möglichkeit 2 der Einteilung anhand des RIM (Abschirmung)
[13] Möglichkeit eins der Einteilung anhand des RIM (Reizveränderung durch Aktivierung affektinkompatibler Inhalte: die Filmleinwand als imaginierter „beruhigender Stimulus“)
[14] Möglichkeit drei der Einteilung anhand des RIM (Kognitive Integration)
[15] Aus Sicht des RIM würde dies einer Kombination aus der ersten und zweiten Möglichkeit, wie affektive Zustände sich wandeln entsprechen: instrumentelles Verhalten erzeugt neue, in diesem Fall sehr intensive, Umweltreize, die neue Knoten im assoziativen Speicher aktivieren. Gleichzeitig werden aversive Impulse aus dem IS durch die Rauschzustände abgedämpft und damit vom bewussten Erleben abgeschirmt.
[16] Vgl. Abschnitt über Embodiment: z.B. in den Experimenten von Strack et al. (1988) und Stepper und Strack (1993) wurde über die Körperhaltung experimentell positiver Affekt induziert; Möglichkeit 2 der Einteilung anhand des RIM (Abschirmung)
[17] Möglichkeit eins der Einteilung anhand des RIM (Reizveränderung / Imagination affektinkompatibler Inhalte)
[18] Dies entspricht der Abschirmung (Möglichkeit zwei anhand der Einteilung anhand des RIM) von aversiven Impulsen zugunsten positiver Ressourcen, und der Aktivierung affektinkompatibler Inhalte (Möglichkeit eins der Einteilung anhand des RIM).
[19] In Metaanalysen (Elliott, 2002; Elliott, Greenberg & Lietaer, 2004; Biermann-Ratjen, Eckert & Schwartz, 2003) konnte gezeigt werden, dass gesprächstherapeutische Verfahren eine hohe Wirksamkeit (Effektivität und Effizienz) aufweisen.
[20] Dies entspricht einer (aus gesprächstherapeutischer Perspektive) pathologischen Sicht der Möglichkeiten eins und zwei (Reizveränderung und Abschirmung) der Einteilung anhand des RIM
[21] Rogers beschreibt die „fully functioning person“ als anzustrebenden, aber nie erreichbaren Endzustand der Therapie (s. Anhang F).
[22] Rogers nennt noch drei weitere Bedingungen, die nicht auf den Therapeuten bezogen sind: (1) es muss ein Mindestmaß an psychologischem Kontakt zwischen beiden Beziehungspartnern (Therapeut und Klient) vorhanden sein. (2) Der Klient befindet sich im Zustand der Inkongruenz. (3) Der Klient nimmt in einem Mindestmaß die bedingungslose Wertschätzung des Therapeuten wahr.
[23] Dies entspricht Möglichkeit eins der Einteilung anhand des RIM (Reizveränderung: der Klient nimmt die Körperhaltung, Mimik, Sprache, ... des wertschätzenden Therapeuten wahr).
[24] Das Vorgehen in der „emotion-focused therapy“ wird in der Wirksamkeitsforschung (z.B. Grawe, 1998) unter den sehr gut wirkenden Verfahren eingestuft.
[25] Genau dieselbe Parallelität zeigt sich in der Dissoziation zwischen impliziten und expliziten Maßen in der aktuellen sozialkognitven Forschung (z.B. Hofmann, Gschwendner, Nosek & Schmitt, 2005; Hofmann, Gawronski, Gschwendner, Le & Schmitt, 2005). Während die im Selbstbericht abgefragte explizite Einstellung, beispielsweise zu Süßigkeiten, propositional repräsentiert ist (und Verhalten durch Intentionen und Zielen, z.B. einem Diätziel, steuern kann), können die in der impliziten Einstellung durch Approach-Avoidance Maße (vgl. „sensomotorische Kanäle unseres Körpers“, Greenberg, 2006) erhobenen behavioralen Schemata genauso stark Verhalten beeinflussen.
[26] Hendricks (2001) schildert in einem Review anhand 27 empirisch belegter Studien einen hohen Einfluss des im Focusing wichtigen „Experiencing“-Niveaus des Klienten während der Therapie-Sessions auf den Therapieerfolg und anhand 23 empirisch belegter Studien die Wirksamkeit des Focusing-Verfahrens insgesamt auf den Therapieerfolg. In 11 empirisch belegten Studien wird die Lehr-/Trainierbarkeit des Focusing-Verfahrens nachgewiesen.
[27] Wiltschko (2003) beschreibt diese Form der Introspektion folgendermaßen: „Focusing wird der gesamte Prozess genannt, der geschieht, wenn eine Person ihre Aufmerksamkeit auf einen unmittelbaren Bezugspunkt ihres Erlebens richtet. (...) Im unmittelbaren Bezugnehmen ist das Erleben den Begriffen/Konzepten voraus. Das Erleben leitet und bestimmt dann die Begriffe/Konzepte. Die Person formt Konzepte, prüft sie an der unmittelbar gefühlten Bedeutung und entscheidet auf dieser Basis über ihre Richtigkeit“ (2003a, S. 100).
[28] Eine gegenläufige Persönlichkeitsvariable ist „Need for Closure“ (Kruglanski, Webster & Klem, 1993; Van Hiel & Mervielde, 2003): Menschen, die darauf hoch scoren, bevorzugen eher Vorhersagbarkeit, Ordnung und Entschiedenheit. Menschen mit niedrigem „Need for Closure“ sind kreativer (Chirumbolo et al., 2004).
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2009
- ISBN (eBook)
- 9783836640824
- DOI
- 10.3239/9783836640824
- Dateigröße
- 988 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Bayerische Julius-Maximilians-Universität Würzburg – Sozialpsychologie, Psychologie
- Erscheinungsdatum
- 2010 (Januar)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- emotion intuition körper aufmerksamkeit traumatherapie
- Produktsicherheit
- Diplom.de