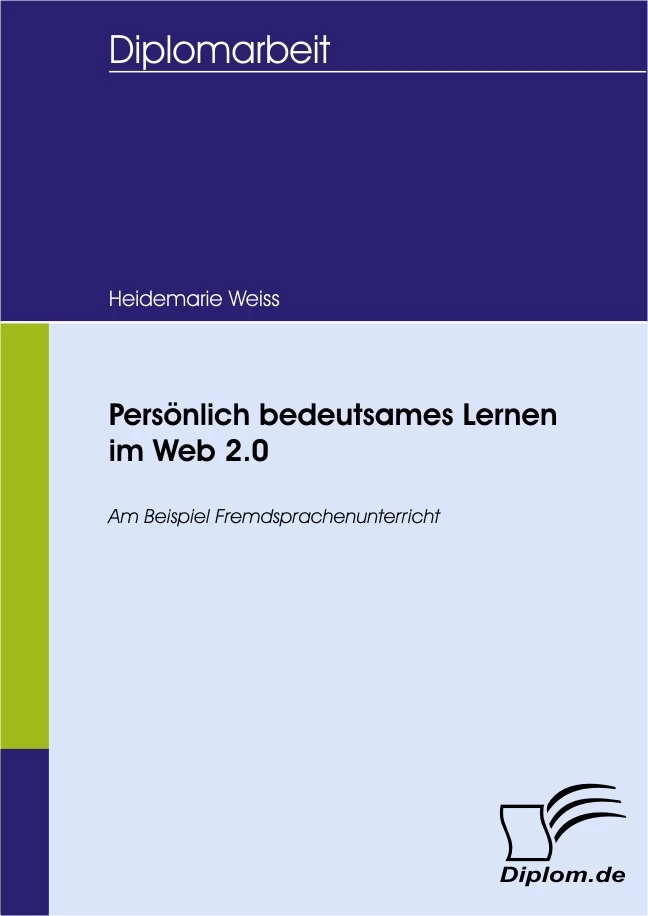Persönlich bedeutsames Lernen im Web 2.0
Am Beispiel Fremdsprachenunterricht
Zusammenfassung
In den letzten beiden Jahrzehnten fand eine große Veränderung beim Erlernen von Fremdsprachen statt. Der Fokus setzt sich derzeit auf unterschiedliche Wahrnehmung wie Reaktionen des einzelnen Lernenden und des Klassenzimmers und somit stellt sich implizit die Frage nach den persönlichen, sozialen und kulturellen Identitäten im Prozess des Erlernens einer Fremdsprache.
Problemstellung:
In den letzten Jahren ist im Internet ein Trend in Richtung Web 2.0 Anwendungen zu beobachten. Wikis, Blogs und Foren sind weit verbreitet. Für viele Menschen sind diese Begriffe jedoch ein Fremdwort und sie können sich nichts darunter vorstellen. Eine der größten Herausforderungen dabei ist es, mit den aufkommenden Veränderungen Schritt zu halten.
Die Wahl des Lernenden welche Texte, welche Aufgaben, welche Anwendungen eine persönliche Bedeutung spielen, fordert die Erforschung der Grundlagen für diese Entscheidungen und diese Schwerpunktthemen.
Persönlich bedeutsames Lernen ist das Schlüsselwort zum Erfolg, denn erst wenn das Lernen persönlich bedeutsam ist, kann es auch erfolgreich sein. Von dieser These geht auch die Themenzentrierte Interaktion(TZI) nach Ruth Cohn, aus. Unter TZI versteht man eine pädagogische Haltung die sich ganzheitlich am Menschen orientiert. Nicht nur der Mensch steht im Vordergrund, sondern ein Gleichgewicht zwischen dem ICH, dem WIR und dem UMFELD wird angestrebt.
Derzeit wird die TZI erfolgreich für Gruppen- und Lernprozesse eingesetzt die persönlich statt finden. Durch einen wachsenden Trend in Richtung Web 2.0 stellt sich nun die wesentliche Frage ob die TZI auch für den Einsatz dieser Anwendungen geeignet ist.
Diese Diplomarbeit gibt einen Überblick über die Nutzung von Web 2.0 Anwendungen unter dem Aspekt der Themenzentrierten Interaktion nach Ruth Cohn und spiegelt wichtige Merkmale des Next Generation Learning wider.
Ziel der Arbeit:
Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines Szenarios unter Einsatz einer Web 2.0 Anwendung. Einflüsse der TZI runden die Konzeptionisierung ab. Das Szenario wird im laufenden Unterricht an der Universität von Tolima eingesetzt und soll aufzeigen, ob persönlich bedeutsames Lernen auch im Web 2.0 stattfinden kann.
Es wird dargestellt, welche Einflüsse der TZI auf Web 2.0 Anwendungen umsetzbar sind und ob sich diese positiv auf den Lernerfolg der Studenten auswirken können. Diese Arbeit behandelt folgende Fragen:
Was kann die TZI für dieses Szenario bieten? […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Erklärung
Vorwort
Kurzfassung
Abstract
1 Einleitung
1.1 Ausgangsbasis
1.2 Zielsetzung
1.3 AufbauderArbeit
2 Humanistische Pädagogik
2.1 GrundlegendePrinzipien
2.2 ThemenzentrierteInteraktion
2.2.1 Einleitung
2.2.2 Axiome
2.2.3 TZI -Dreieck
2.2.4 Postulate
2.2.5 Hilfsregeln
2.2.6 TZI -Haus
2.2.7 TZIinderPraxis
3 Formen des Lernens
3.1 LernenalsWissensaneignung
3.2 PersönlichbedeutsamesLernen
3.3 GrundlegendeUnterschiede
4 Web 2.0
4.1 WasistWeb2.0?
4.2 Web2.0Dienste
4.2.1 Blogs
4.2.2 Podcasts
4.2.3 Wikis
4.2.4 SozialeNetzwerke
4.2.5 SocialBookmarking
4.2.6 Foto-undVideosharing
4.3 Prinzipien ..
4.4 Produsage..
4.5 Participatory culture
4.6 Persönlich bedeutsames Lernen mit Web
5 Konzeption
5.1 Ausgangslage
5.2 AuswahlderAnwendung
5.3 ProgramLogicMap
5.4 HandlungsleitendeFragen
6 Szenario
6.1 Beschreibung desSzenarios
6.2 Einsatzgebiet
6.3 ProgramLogicMap
7 Ergebnisse
7.1 Ergebnisse der Studentenbefragung
7.1.1 Welcheo-enenFragenstellensichvondenAntworten derStudierenden?
7.2 Ergebnissedero-enenFragen
7.3 ProgramLogicMap
8 Abschließende Reflexion
8.1 Reflexion der Handlungsleitenden Fragen
A Interviews
A.1Interviewleitfaden
A.1.1FragenandenProfessor
A.1.2FragenandieZielgruppe
A.2DokumentationderInterviews
A.2.1Befragung desProfessors
A.2.2Befragung derZielgruppe
Literaturverzeichnis
Erklärung
Hiermit erkläre ich an Eides statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohnefremdeHilfe verfasst, andere alsdie angegebenenQuellen und Hilfsmittel nicht benutzt und die aus anderen Quellen entnommenen Stellen als solchegekennzeichnethabe.
Hagenberg, am 2. November 2009
Heidemarie Weiss
Vorwort
„Erkläre mir, undich werde vergessen.Zeige mir, undich werde mich erinnern. Beteilige mich, und ich werde verstehen“ Konfu zius,(551 -479 vorChr.),chinesischerPhilosoph
DieseAussagebegleitete michstetsin meinemBerufspraktikum anderUniversität von Tolima, Kolumbien, wo ich als Englisch Assistent tätig war. Erzählte ich meinen Studenten etwas -vergaßen sie, zeigte ich ihnen etwas -erinnerten sie sich,führteichjedochSpiele oderÜbungendurchdie nicht nur am Papier stattfanden -verstanden sie auch.
Aus dieser Erkenntnis und aus Liebe zu Kolumbien ist diese Diplomarbeit entstanden.EinVersuch etwasAbwechslungfürdieStudenten zubieten und um sie zu motivieren.
An ersterStelledankeichmeinerBetreuerin undLeiterindesFachhochschul-Studiengangs „EngineeringfürComputer-basiertesLernen(CBL)“ ander Fachhochschule Hagenberg, die mich nicht nur bei der Themenfindung unterstützt hat, mich motiviert hat, mir die Möglichkeit geboten hat meine Diplomarbeit in Kolumbien zu schreiben, sondern vor allem an mich geglaubt hat.
Weiters möchte ich mich bei meiner „kolumbianischen Familie“ bedanken, die stets für mich da war und mich in allem tatkräftig unterstützt hat und somitKolumbien zu meiner zweitenHeimatgemachthat.
Ebenfalls danken möchte ich Herrn Guzman, Englischprofessor an der Universität vonTolima und seinenStudenten,die michtatkräftigbeiderDurchführung despraktischenTeils unterstützthaben.
AbschließenddankeichmeinenElternAnton undChristineGrübler, meinem BruderJürgen undseinerLebensgefährtinBarbarafür alldieUnterstützung während meinesStudiums.MeinerNichteFranziska,die mit einem einzelnen Lächeln meine Sorgen verblassen ließ.
Kurzfassung
In den letzten beiden Jahrzehnten fand eine große Veränderung beim Erlernen von Fremdsprachen statt. Der Fokus setzt sich derzeit auf unterschiedlicheWahrnehmung wieReaktionendes einzelnenLernenden unddes Klassenzimmers und somit stellt sich implizit die Frage nach den persönlichen, sozialen und kulturellen Identitäten im Prozess des Erlernens einer Fremdsprache.
DieWahldesLernenden welcheTexte, welcheAufgaben, welcheAnwendungen einepersönlicheBedeutung spielen,fordertdieErforschungderGrundlagen für diese Entscheidungen und diese Schwerpunktthemen.
Diese Diplomarbeit untersucht Möglichkeiten des persönlich bedeutsamen LernensinderWeb2.0Ära.Web2.0Anwendungengewinnen wachsendes Interesse und decken eine breite Palette von visuellen Hinweisen. Lerner-Zentrierter Unterricht, konversationelle Interaktion und das Potential der sozialen Netzwerke kann genutzt werden, um den Anforderungen von Studentengerecht zu werden.
Diese Diplomarbeit gibt einen Überblick über die Nutzung von Web 2.0 Anwendungen unter dem Aspekt der Themenzentrierten Interaktion nach RuthCohn undspiegelt wichtigeMerkmaledes „NextGenerationLearning“ wider.
Abstract
Within the last two decades a big change in foreign language learning happened.Currentlythefocus concentrates on thedi-erentperceptions such as the responses of theindividuallearner and the classroom.As a consequence we now face the question of personal, social and cultural identities in the process of learning a foreign language.
Thelearnerischoosing thetexts,tasks and applicationsthathave apersonal importance and this calls for a research of the basis for these decisions and these main topics.
Thisdissertationdeterminespossibilities ofthepersonalandimportantlearning in the Web 2.0 era. The interest in Web 2.0 applications is constantly growing and covers a wide range of visual details. Classes oriented on the learner, conversational interaction and the potential of the social networks can be utilized to meet the requirements of the students.
With emphasis on the theme-centered interaction according to Ruth Cohn thisdissertationprovides an overview of the utilization ofWeb2.0 applications and reflects important characteristics of „Next Generation Learning“.
Kapitel 1
Einleitung
In den letzten beiden Jahrzehnten fand eine große Veränderung beim Erlernen von Fremdsprachen statt. Der Fokus setzt sich derzeit auf unterschiedlicheWahrnehmung wieReaktionendes einzelnenLernenden unddes Klassenzimmers und somit stellt sich implizit die Frage nach den persönlichen, sozialen und kulturellen Identitäten im Prozess des Erlernens einer Fremdsprache.
1.1 Ausgangsbasis
In den letzten Jahren ist im Internet ein Trend in Richtung Web 2.0 Anwendungen zubeobachten.Wikis,Blogs undForen sind weit verbreitet.Für vieleMenschen sinddieseBegri-ejedoch einFremdwort und siekönnen sich nichtsdarunter vorstellen.EinedergrößtenHerausforderungendabeiist es, mit den aufkommenden Veränderungen Schritt zu halten.
DieWahldesLernenden welcheTexte, welcheAufgaben, welcheAnwendungen einepersönlicheBedeutung spielen,fordertdieErforschungderGrundlagen für diese Entscheidungen und diese Schwerpunktthemen.
Persönlich bedeutsames Lernen ist das Schlüsselwort zum Erfolg, denn erst wenn das Lernen persönlich bedeutsam ist, kann es auch erfolgreich sein. VondieserThesegeht auchdieThemenzentrierteInteraktion(TZI) nach Ruth Cohn, aus. Unter TZI versteht man eine pädagogische Haltung die sich ganzheitlich am Menschen orientiert. Nicht nur der Mensch steht im Vordergrund, sondern ein Gleichgewicht zwischen dem ICH, dem WIR und dem UMFELD wird angestrebt.
Derzeit wird die TZI erfolgreich für Gruppen-und Lernprozesse eingesetzt diepersönlich stattfinden.Durch einen wachsendenTrendinRichtungWeb dieser Anwendungen geeignet ist.
Diese Diplomarbeit gibt einen Überblick über die Nutzung von Web 2.0 Anwendungen unter dem Aspekt der Themenzentrierten Interaktion nach RuthCohn undspiegelt wichtigeMerkmaledes „NextGenerationLearning“ wider.
1.2 Zielsetzung
Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines Szenarios unter Einsatz einer Web 2.0 Anwendung. Einflüsse der TZI runden die Konzeptionisierung ab. Das Szenario wird im laufenden Unterricht an der Universität von Tolima eingesetzt und soll aufzeigen, ob persönlich bedeutsames Lernen auch im Web 2.0 stattfinden kann.
Es wird dargestellt, welche Einflüsse der TZI auf Web 2.0 Anwendungen umsetzbar sind und ob sich diese positiv auf den Lernerfolg der Studenten auswirken können. Diese Arbeit behandelt folgende Fragen:
- Was kann die TZI für dieses Szenario bieten?
- KönnenStörfaktorengemeinsaminderGruppebeseitigt werden?
- Fördert oder behindert der Einsatz von Web 2.0 Anwendungen ein TZI Szenario?
- Kann mit Einbindung von Web 2.0, persönlich bedeutsames Lernen imUnterrichtgefördert werden?
Es werden Ideen aufgezeigt wie Web 2.0 Anwendungen mit Aspekten der TZI miteinander verknüpft werden können und deren Auswirkungen auf den laufenden Unterricht dargestellt.
1.3 Aufbau der Arbeit
Der Aufbau dieser Arbeit wird in folgenden Abschnitten erläutert:
- Kapitel 2: Humanistische Pädagogik Der erste Teil der Arbeit behandelt die theoretischen Grundlagen die zur späterenKonzeptionserstellungfürdasSzenario eingesetzt werden. In den dazugehörigen Unterkapiteln werden die grundlegenden Prinzipien sowie auch die Themenzentrierte Interaktion dargestellt und fachliche Begri-e definiert.
- 1. Einleitung Kapitel 3: Formen des Lernens Dieses Kapitel beschäftigt sich mit Lernen als Wissensaneignung und mit dem persönlichen bedeutsamen Lernen. Die grundlegendsten Unterschiede sind im Punkt 3.3 angemerkt.
- Kapitel 4: Web 2.0 IndiesemKapitelgeht es um eingrundlegendesVerständnis vonWeb 2.0. Eine erste Begri-serklärung gibt Aufschluss darüber was sich eigentlich hinter dem Begri- versteckt. Anwendungen wie Wikis, Blogs und Podcasts werden in den Unterkapitel näher beschrieben und geben somit Einblick in die Welt des Web 2.0.
- Kapitel 5: Konzeption Kapitel 5 widmet sich der Konzeption eines konkreten Szenarios, wie eine Web 2.0 Anwendung im Laufenden Unterricht eingesetzt werden kann, anhand einer Program Logic Map.
- Kapitel 6: Szenario DasKapitel6kommentiertdasdurchgeführteSzenario undbeschreibt die eingetro-enenUnterschiedeinBezugaufdie vorhergegangeneKonzeption.
- Kapitel 7: Ergebnisse IndiesemKapitelwerdendieErgebnissedesSzenariosdargestellt welche mittels Befragungen festgestellt wurden. Nicht nur die Sicht der Studenten sondern auchdieSichtanhandderDurchführung wirdkommentiert.
- Kapitel 8: Abschließende Reflexion In Kapitel 8 werden die Antworten der Handlungsleitenden Fragen dieser Diplomarbeit dargestellt und reflektiert.
Kapitel 2
Humanistische Pädagogik
2.1 Grundlegende Prinzipien
Humanistische Pädagogik ist ein Sammelbegri- für verschiedenste Ansätze die sich mit dem Thema „persönlich bedeutsames Lernen“ beschäftigen. Lebenslanges Lernen und Wissen ist ein unverzichtbarer Faktor des wirtschaftlichen undprivatenErfolges.JedesJahr,jedenMonatgibt es neues Wissen, undderMenschlernt.Hobmair(2002)beschreibtdieHumanistische Theorien folgendermaßen[12]:
Humanistische Theorien gehen von der Annahme aus, dass der Mensch danach strebt, die eigene Persönlichkeit zu entwickeln und sich selbst zu verwirklichen. Der Mensch ist bestrebt, seine eigenenFähigkeiten undMöglichkeiten zu entfalten.Dabei wird davon ausgegangen, dass er seine Lebensbedingungen und seine Umwelt aktiv selbstgestalten undbewusstüberdieMöglichkeiten seinesHandelns entscheidet.(S.383)
Durch die humanistische Psychologie entwickelt, fanden immer mehr verschiedene therapeutische Ansätze auch in der Pädagogik Anregung. Jedoch stehenhier nichtdie therapeutischenAnsätzeimVordergrund, sondern vielmehr die Pädagogischen wie Lernen, Erziehen und Bildung.
Volker Buddrus fasst die wichtigsten Charakteristika folgendermaßen zusammen[4]:
- DiepädagogischenBemühungenrichten sichimmeranden ganzenMenschenin seinerkonkretenpersönlichenGestalt. DiesbedeutetdasBerücksichtigen von mentalen, emotionalen, seelischen und körperlichen Voraussetzungen und Befindlichkeiten sowohl im Ansatz wie im Prozess.
- 2. Humanistische Pädagogik Die Zielpersonen werden als Menschen angesehen, die sich in persönlichen Wachstumsprozessen befinden und aus ihrer eigenenMitte undBefindlichkeit sowie ausihrenbereits entwickeltenMöglichkeitenheraus andenWachstumsangeboten teilnehmen. Das Lernangebot wird von ihnen selbst aktiv mit ihrem Entwicklungsstand verknüpft oder auch nicht.
- Alle für den Wachstumsprozess erforderlichen Voraussetzungen sindbeidenLernenden schon vorhanden, müssen z.
T. aber erst entborgen werden. „Werde, was Du bist“.
- Die PädagogInnen stellen einen Entwicklungskontext und konkrete Handlungssituationen für bestimmte exemplarischeLernprozesse undderen reflexiverBearbeitung zurVerfügung sowie ihr Angebot zur Strukturierung der Lernprozesse und zur Begleitung bei Lernproblemen.
- Die PädagogInnen nehmen an den Lernprozessen der Lernenden teil aufgrund eigener vorausgehender Erfahrungen mit dem Gegenstand und unter Einbringen selektiver Authentizität.
- DieQualitätderVermittlungunddieWirksamkeitderMethoden wird in engem Zusammenhang mit dem persönlichenWachstumderPädagogInnengesehen. „DiePädagogin lehrt vornehmlich, was sie ist und was sie wird.“
- Professionalität, persönliches Wachstum und ein wachsender Fundus von Methoden und Theorien ersetzen das vormals bei wirkungsvollen PädagogInnen erforderliche Charisma, oder zumindest ergänzen sie es.HumanistischePädagogik wird stärkerlernbar.(S.386f.)
Nach Buddrus (1996) können der Humanistischen Pädagogik derzeit folgende Ansätze zugeordnet werden: Themenzentrierte Interaktion, Gestaltpädagogik, Psychodrama, Psychosynthese, Personenzentrierte Gesprächsführung, Transaktionsanalyse, Suggestopädie, Edukinestetik, Lehrkunstdidaktik, aber auch Neuro-Linguistisches-Programmieren, sowie Sokratische Mäeutik.1
Humanistischer Pädagogik ist keine Richtlinie, vielmehr eine alternative Form der Lehrens und Lernens mit unterschiedlichen Ansätzen und Konzepten. Nicht das Lernen als Wissensvermittlung sondern das „WIE“ steht im Vordergrund. Diepersönliche Entwicklung des Lernenden ist das Ziel.
vgl. Buddrus, 1996, S. 395
2. Humanistische Pädagogik
PersönlichkeitundWeiterbildunghaben eine starkeVerbindung.Denn mein Individuumbestimmtwasichlerne.Die eigenenpersönlichenInteressen stehen im Vordergrund. Ich bestimme selbst was ich bin und was ich lerne. Frontalunterrichtlässt nicht vieleMöglichkeiten o-en umdiePersönlichkeit zu entwickeln.
Wie oben erwähnt ist die Themenzentrierte Interaktion ein sehr wichtiger Ansatz der Humanistischen Pädagogik, in dem pädagogische Elemente wie persönlichbedeutsamesLernen unddieArbeitinGruppenimVordergrund stehen. Im folgenden Absatz wird daher der Ansatz der Themenzentrierten Interaktion näher erläutert.
2.2 Themenzentrierte Interaktion
2.2.1 Einleitung
Ruth Cohn, 1912 in Berlin geboren, gilt als Entwicklerin dieser Methode. 1931 studierte sie Nationalökonomie und Psychologie an den Universitäten Heidelberg und Berlin. 1933 emigriert sie nach Zürich, wo sie Psychologie, Philosophie und Literatur studierte. 1934 begann sie mit der psychoanalytischen Ausbildung in der Internationalen Gesellschaft für Psychoanalyse undihreLehranalysebeiMedardBoss(1934-1939).1941 emigrierte sie nach NewYork undbaute1946ihrePraxis alsPsychoanalytikerin undGruppentherapeutin auf.2 Arbeitserfahrung mitKindern und alsTherapeutin waren AusgangpunktederArbeitvonRuthCohn.Dabei suchte sie nach einerMöglichkeitmehrMenschen zu erreichen als es einemPsychoanalytiker mitPatienten möglichist.Erfahrungen undErkenntnisse ausdertiefenpsychologisch orientierten therapeutischenEinzelarbeit auf nicht-therapeutische Gruppen zuübertragen, warderGrundgedanke vonRuthCohn.MehrMenschen auf einmal zu erreichen um gemeinsam Lösungen zu finden und Aufgaben zu bewältigen.3 Cohns(1984) Grundgedanken zurThemenzentriertenInteraktion[7]:
Ich möchte,daßjederMenschganz „Ich“ sagenlernt, weil er nur dannseineErfüllung findenkann; undinjedemIchistbereits dasDu unddasWir unddieWelt enthalten.(S.373) 1955 initiiert sie einen Workshop zum Thema „Gegenübertragung“, dessen Methodik zumAusgangspunktfürdieThemenzentrierteInteraktion(TZI) wurde.
vgl. http://www.ruth-cohn-institute.org/ruthcohn/index.html, abgerufen am 21.04.2009 3 vgl. Langmaack, 2004, S. 20 f.
2. Humanistische Pädagogik
Die TZI wurde methodisch aus Prinzipien und Techniken der Gruppentherapie und anderen Lehr-und Kommunikationsmethoden abgeleitet. Ganzheitliches Lernen und Arbeiten in Gruppen soll in Balance stehen. TZI ist nicht nur Technik und Methode, sondern vielmehr persönlich bedeutsames Lernen undArbeiten.DieBedürfnisse undInteressenjedesEinzelnen und derGruppe solleninEinklangsein und eineproduktiveArbeitfördern.Erst wenn ich mich sehe, sehe ich alles andere. Dem einzelnen Menschen soll der persönliche Zugang zum Thema erleichtert werden, denn Lernprozesse verlaufenbeimMenschen umso erfolgreicherje mehrEmotion,Intellekt,Begri-ichkeitundErleben mit einfließen.InderTZIgeht mandavon aus,dass wirkliches Lernen nur dann stattfindet, wenn es persönlich bedeutsam ist. TZIbesitztnichtdiegleichenCharaktere wieFrontalunterricht,dennGruppenprozesse sollen individuell und persönlich verlaufen, ein ganzheitlicher VerlaufderKommunikation undInteraktion verbindet.RuthCohn(1993) beschreibt TZI folgendermaßen[6]:
DieGruppentherapie respektiertdieEntfaltungdesIndividuums und fördert die Aufmerksamkeit der Gruppe für den Beitragjedes einzelnen. Jedoch Gruppentherapie kennt nur ein Thema: „Ich möchte(mich)besserfühlen undbesserfunktionieren.“TZI dagegen verlagert den Schwerpunkt von diesem einen Thema Entwicklung des Wachstumspotentials des einzelnen -auf alle Aufgaben oder Themen, mit denen Menschen sich auseinanderzusetzen haben, ohne dabei die Einmaligkeit des einzelnen aus demAuge zu verlieren.(...)(S.14)
TZI findet sich nichtnurinTherapie-undErfahrungsgruppen,als einWeiterbildungsverfahren wird sie vor allem verbreitetinSchulklassen,Mitarbeitergruppen, Kommissionen, Management, kirchlichen Diensten, Organisationsberatung, Bürgerinitiativen, Frauen/Männerbewegungen, Supervision undCoaching angewandt.4 InalldiesenBereich findensichdieunterschiedlichstenThemen, wobeidiesfürTZIkeineRolle spielt,Themenkönnen sich auf Bereiche der Familie, Gemeinschaft und Zusammenleben genauso wie auf pädagogische, wissenschaftliche, künstlerische und organisatorische Bereiche beziehen. Die Gruppengröße und das Teilnehmeralter spielen keine Rolle, wobei zu beachten ist, dass die Strukturen und Modifikationen den konkreten Situationen angepasst werden.
TZI fördert:5
- Sich und andere im privaten und beruflichen Bereich aufmerksam wahrzunehmen
- 2. Humanistische Pädagogik Selbständigkeit und Eigenverantwortung im Kontakt mit andern zu stärken
- Wissensvermittlung lebendig und in Beziehung zu den beteiligtenPersonen zugestalten.
- Die Arbeitsnotwendigkeiten mit Achtung vor der Person undder zwischenmenschlichenBeziehung zu verbinden(im Profit-ebenso wie im Non-profit-Bereich)
- Arbeitsbesprechungen,Konferenzen,Kongresseusw.imSinne lebendiger Kommunikation zu führen und Rivalitäten zugunsten Kooperation zu nützen.
vgl. Langmaack, 2004, S. 214 f. und Henecka, 2005, S. 2 5 Quelle: http://www.tzi-schweiz.ch, abgerufen am 21.04.2009
2.2.2 Axiome
Die drei Axiome der TZI befassen sich mit den ethischen Grundlagen der TZI, sie sindsowohlBegrenzer als auch antreibendeKraft.Axiome sindkeine Richtlinien, sie sind vielmehr Grundgerüst der TZI, sie werfen Fragen auf, welche für die Gruppenarbeit von Vorteil sind. Ausgehend von ihren Erfahrungen und Einsichten entwickelte Ruth Cohn eine Art „systemische Kommunikationspsychologie“,dieingleichemMaße aufStrukturen undProzessesowieaufSachthemen zentriert seinsollte.AlledreiAxiome stehenin Verbindungmiteinander, und sinddaher auchgemeinschaftlich umzusetzen. Ein Fehlen dieser Grundvoraussetzungen spaltet die TZI in unzusammenhängendeTechniken.6 Cohn undFarau(1984)sehendieAxiome als wichtiges Grundgerüst der TZI[7]:
TZI-Axiome sind der Boden, auf dem die TZI-Methodik verstanden werden muß, und die entscheidenden Voraussetzungen für die gruppentherapeutische und pädagogische Intention der TZI. Ohne diese Axiome kann TZI so „wirksam“ sein wie ein in einemHeuschober angezündetesStreichholz.(S.356)
LautCohn undFarau(1999) bildenfolgendeAxiomedasFundamentfür humanesHandeln und realitätsgerechteEntscheidungen[8]:
1. Das existentiell-anthropologische Axiom:
Der Mensch ist eine psychobiologische Einheit und ein Teil des Universums. Er ist darum gleichermaßen autonom und interdependent. Autonomie (Eigenständigkeit) wächst mit demBewusstseinderInterdependenz(Allverbundenheit).(S. 356)
6 vgl. Langmaack, 2004, S. 39 f. und Padberg, 1998, S. 9 f.
2. Humanistische Pädagogik
Dieses Axiom zeigt ein ganzheitliches Bild des Menschen auf. Der Menschistein unabhängigesIndividuum,jedoch auchTeil seinerUmwelt, nicht möglich unabhängig von ihr zu leben. Jedes einzelne Individuumbestimmt selbst seineAktionen, wirdjedochbewusstdass zwischen dem ganzen Umfeld eine Wechselwirkung besteht, kann positiver Einfluss auf diese genommen werden. Die Autonomie ist umso größer,jebewusster erseine sozialeund universelleInterdepenzanerkennt und aktiviert. Ganzheitlichkeit bedeutet hierbei, dass intellektuellesLernen vonEmotionenbegleitet wird.DieseEmotionenkönnen sowohlpositive als auch negativeAuswirkungenhaben, und somitdas Lernen stark beeinträchtigen.
2. Das ethisch-soziale Axiom:
EhrfurchtgebührtallemLebendigen und seinemWachstum. Respekt vor dem Wachstum bedingt bewertende Entscheidungen. Das Humane ist wertvoll, Inhumanes ist wertebedrohend.(S. 357)
DerhoheWertdesLebensistein sehr wichtigerPunktfürRuthCohn. DieWeltwird ausgebeutet und zerstört, vergangenesWissengeht verloren. Human zu sein hat Priorität, wobei sich Inhumanes auch auf Vernachlässigen, Unterdrücken von zwischenmenschlichen Beziehungenbeziehenkann.DerRespektfürdie zwischenmenschlicheKommunikationistdieGrundlage allengemeinsamenArbeitens.Tretedeinem Gegenüber mitAchtungentgegen, unddieGemeinschaftkann sich entfalten.
3. Daspragmatisch-politischeAxiom:
FreieEntscheidunggeschiehtinnerhalbbedingenderinnerer und äußerer Grenzen; Erweiterung dieser Grenzen ist möglich. Freiheit im Entscheiden ist größer, wenn wir gesund, intelligent, materiell gesichert und geistig gereift sind, als wenn wir krank, beschränkt oder arm sind oder unter Gewalt und mangelnderReifeleiden.(S.357)
Das pragmatisch-politische Axiom versteht sich als praxisbezogenes Axiom. Nur wenn die Grenzen wahrgenommen werden, findet sich auch der Blick für die Spielräume die sich bieten. Eine Erweiterung derGrenzen oder auchderRahmenbedingungenistmöglich, unddiese sollten auchgenutzt werden.WenndieGrenzen nicht wahrgenommen werdenkanndies zumScheiternführen,ich willüberdieGrenzenhinaus, oderichbin zu weit entfernt und erreiche nicht meinepersönlichen Möglichkeiten.
2. Humanistische Pädagogik
Der Mensch verfügt über frei gewähltes Handeln, er hat Verantwortung gegenüber seinerUmwelt.Er selbstträgtVerantwortung überVeränderungen positiver oder negativerNatur.WertschätzunggegenüberAnderen,derUmwelt und sich selbstkann einepositiveVeränderung bewirken.
2.2.3 TZI -Dreieck
DiedreiFaktorenICH-WIR-ESwerdeninderTZIdurch eingleichseitiges Dreieckdargestellt,das sichin einemKreis(Globe)(sieheAbb.2.1)befindet. DiesesSymbolstehtfürdieganzheitlicheSichtweise vonTZI,derSichtweise
Abbildung 2.1: TZI-Dreieck
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
vonLernen,Leben undZusammenleben.RuthCohn(1993)beschreibt selbst dasSymbol mitfolgendenWorten[6]:
DiethemenzentrierteinteraktionelleGruppebemühtsich umBewußtwerdungundFörderungdesIch-Potentials,derWir-Kohäsion und der Themen-und Aufgabenerfüllung. Das strukturelle Bild derThemenzentriertenInteraktion(TZI)istdaher dasIch-WirEs-Dreieck:dieVerbindung dreierPunkte vongleicherWichtigkeit -Individuum, Gruppe und Thema -, das sich in der gegenseitigen Umgebungskugel, dem Globe, befindet.(S. 20)
DieseSymbolist „Markenzeichen“derTZI und wir auch vonGruppentheoretikern und Praktikern erkannt und angewandt. Probleme und Konflikte
2. Humanistische Pädagogik
werden gelöst, um sich wieder auf das wesentliche Thema konzentrieren zu können.Ist eineLösung ausständig,kanndieGruppe nichtfortfahren, oder dieArbeitwird erschwert.NichtdieAufgabe stehtimVordergrund, sondern jede einzelne Person.7 dasICH -jedebeteiligtePersonundihrAnliegen das WIR -die Gruppe mit Interessen und Beziehungen untereinander dasES -dasThema,diegemeinsameAufgabe derGLOBE -dasUmfeld,alleswasdiegemeinsameArbeitbeeinflusst
Die dynamische Balance der Faktoren steht im Vordergrund. Nicht jede Situation lässt sich mit den gleichen Faktoren lösen, es stellt sich die wesentlicheFrage, welcherdieserFaktoren stärkerbehandelt werden muss, um die gewünschte Balance herzustellen.8 Ist die Balance hergestellt, kann sie durchEinflüssederUmweltoder anderenStörfaktoren rasch wieder ausdem Gleichgewichtgebrachtwerden.DasLebenist nicht statisch,Gegenpole sollenberücksichtigtund eingebunden werden.Diesist aber nicht als negativer Aspekt anzusehen, vielmehr stärkt eine fehlende Balance die konstruktive Arbeit.Es veranlasst, neueLösungen zu suchen, neueIdeen umzusetzen und nicht nur starr zuhandeln.DasDreieckimKreisgilt alsHilfsmittelfürdie Diagnose, es zeigt auf welcher Faktor im Vordergrund steht und wo Handlungsbedarf besteht.
Anfangs stehtdasICH, erstnachKontaktaufnahme wirdderWeg zumWIR gefunden undsomit schließlich eineBasisfürkonstruktiveArbeitgescha-en. Der Anfang ist sehr wichtig, da er den weiteren Verlauf des Prozesses bestimmt.BarbaraLangmaack[16] skizziertdiesenVorgangfolgendermaßen (siehe Abb. 2.2):
vgl. Langmaack, 2004, S. 48 f. und Padberg, 1998, S. 6 f. 8 vgl. Grenz, 2002, S. 80
2. Humanistische Pädagogik
Abbildung 2.2: Themenaufbau im Dreiecksverlauf nach Barbara Lang
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
maack(S. 73)
EineGruppeistanfangskeineGruppeim engerenSinn, erstdasKennen lernen undVertrauender einzelnenTeilnehmer machtsie zu einer wirklichen Gruppe.
das ICH 9
Werbinich?DieseFrageistoftmalsnicht zubeantworten,viel zusehrverändert sich das Leben eines Menschen. Je realistischer die Meinung eines Menschenüber sich selbstist,destoleichterfällt esihm sich auf neueSituationen und Menschen einzulassen. Die TZI unterstützt den Menschen auf seinem Lebensweg, sie hilft die eigene Identität zu entwickeln und zu integrieren. Schon seit dem Beginn der Menschheit gibt es Normen an welche der Mensch sich anpasst. Selten gelingt es einem auszubrechen und diese „steifen“ Normenhinter sich zulassen.Wir wurden vonjeher so erzogen, dasunsereWelt soinOrdnung ist,dass esguttut nichtauszubrechen.Wir gehen zurSchule, zurArbeit undgliedern unsindemSystem ein.Wirdder DrangnachpersönlichemFreiraumdennoch verspürt,istderPreisderdafür bezahltwird oft sehrhoch.UnserUmfeldkann nurbegrenztVeränderungen ertragen und akzeptieren. Ein neuer Lebensweg bereitet Schmerzen, kostet Mühe und verlangt Mut. Durch veränderte Situationen wie Entlassung, ScheidungoderBeförderung wächstderDrangdenLebensweg zu verändern. Alles wasbishergutwar, wirdinFragegestellt.Willichdasüberhaupt?Bin
vgl. Langmaack, 2004, S. 75 f. und Cohn/Farau, 1993, S. 353 f.
2. Humanistische Pädagogik
ich mit meinemLeben so zufrieden?BarbaraLangmaack(2004) beschreibt dieSelbstverwirklichung mitdiesenWorten[16]:
Mit Selbstverwirklichung und wachsender Ich-Identität ist also in ersterLiniegemeint, sichderRealitätdesWandels zu stellen, diesen auch zu wollen,dieBilder von sich selbst aktiv zugestalten, anstatt siegeschehen zulassen oder sie von außenbenennen zu lassen.(S. 82)
Viele Menschen sehnen sich nach Belohnung, dass ihre Leistung anerkannt wird. Die persönliche psychische Gesundheit wird gefördert, indem für die erbrachte Leistungen von seinen Mitmenschen Annerkennung übermittelt wird.Anerkennung wirkt aufdiePersönlichkeit wie eineArtBelohnung.Sie fördertdieEntwicklungeinesjedenMenschen.Niederlage undErfolgbegleitetdenMenschen auf all seinenLebenswegen.Dochdadurch wirdErfahrung gesammelt und wichtigeErkenntnisfürdieZukunftgewonnen.
das WIR 10
Jedes ICH ist ein Teil des WIR. Der Mensch ist immer in vielen sozialen Beziehungen, in der Familie, im Berufsleben, in der Schule und im Freundeskreis -dem WIR. Sich zugehörig zu fühlen ist wichtig für Denken und Handeln.EsbeeinflusstdiepersönlichenGedanken undAktivitäteninGruppen.FindeteinePerson sein wirkliches wahresICH sokann sie auchPlatzim WIRfinden.DasWIRderTZIbeschäftigtsich vorallemmit einemgemeinsamenThemafürdieTeilnehmer,esistnicht vonNötendass allePersonen zeitgleich, am selben Ort daran arbeiten. Die Motivation sich einer Gruppe anzuschließen beruht auf dem Thema, dies kann freiwillig erfolgen oder auch gezwungenermaßen sein. Formen von Gruppenarbeiten finden sich in vielenBereichen, wie zumBeispielSchulen,Erwachsenenbildung undTeamarbeitinFirmen.Schon vonjeherlebtederMensch mit anderenMenschen zusammen. Dieses Zusammenleben prägt den Menschen, er bekommt neue Denkanstöße undwird zu neuemHandelngeleitet.JedesICHbeeinflusstdie Gruppe obnegativ oderpositiv.DenFaktorICHbeschreibtLangmaack mit folgenden Worten[16]:
Eine Gruppe wird nicht etwa stärker durch Mitglieder, die sich
aufgeben, sonderndurch solche,die sich eingeben.(S.97)
In TZI Gruppen finden sich die Teilnehmer in einem Kreis ein. Dies ist sehr wichtigfürdasGefühlderGleichwertigkeit undMitverantwortung.Jeder Teilnehmer besitzt die Möglichkeit seinem Ansprechpartner direkt in die Augen zu sehen. Jeder Teilnehmer beeinflusst die Gruppe und ist somitfürErfolg oderNiederlage mitverantwortlich.Wie schön erwähntist ein wichtiger Punkt für Gruppenarbeit die Anfangsphase. Das Kennen lernen
vgl. Langmaack, 2004, S. 93 f
2. Humanistische Pädagogik
undVertrauenderTeilnehmer untereinanderist eine wichtigeGrundvoraussetzung für ein erfolgreiches Arbeiten. Anfangs aufgestellte Regeln für die Gruppenarbeit sind ein sehrhilfreicherFaktor.Nicht zu viel auf einmal von den Teilnehmern zu verlangen ist eine Grunddevise. TZI-Gruppen besitzen folgende Merkmale:
- Vereinbarungen und Strukturen
- ein gemeinsames Ziel
- jeder soll mitarbeiten
- jeder besitzt eine eigene Persönlichkeit
Sind keine gemeinschaftlichen Aufgaben mehr vorhanden, verliert sich das WIR-Gefühl und die Gruppe tritt ihrem Ende entgegen.
das THEMA 11
DasThema spielteine wichtigeRolle undist einHauptschwerpunktimSystem der TZI. Als Thema bezeichnet sich das Anliegen einer Gruppe, die Fragestellung oder die Aufgabe. Es ist der Mittelpunkt der Gruppenarbeit. FehltdasThema, existiertdieGruppe oderdieBeziehungnicht mehrlange, denn es ist der Schlüssel zu Beziehungen.
Themen können sehr unterschiedlich sein, kleine Themen zum sofortigen Einsatz oderjedochgroße,dielängereZeitinAnspruchnehmen.EinThema kann alles sein,derInhalteiner „kleinenUnterhaltung“ sowieProbleme von Beziehungen, Durcharbeiten von Lern-und Diskussionssto-. Ein „gutes“ Themaistjenesdass zumMitmachen anregt,dasdieTeilnehmerbegeistert unddieIdeenbeflügelt.Nichtimmergibt esjedochdieseMöglichkeit,da es im beruflichen und persönlichen Alltag auch von Nöten ist, sich mit ungeliebter Thematik auseinanderzusetzen. Zur Entwicklung eines Themas sind nach B. Langmaack die folgenden Zugangspunkte[16]:
- Was ist mein eigener Bezug zum Thema? Was bedeutet es für mich?
- Wie setze ich das Thema und seine Bearbeitung mit dem bisherigen unddemkünftigenProzessderGruppeinBeziehung?
- WelchenSchwerpunktimTZI-Dreieck setzeichjetzt?
- WiestartenwirmitdemThemaeinenlebendigenProzess?
(S. 113 f.)
11 vgl. Langmaack, 2004, S. 106 f.
2. Humanistische Pädagogik
Ein „gutes“ Thema entsteht nicht von einer Sekunde auf die Andere, es braucht Zeit um wirklich zu reifen. Ideen zu einem Thema gibt es wahrscheinlich viele, jedoch ist es eine Kunst dies richtig zu formulieren und interessant zugestalten.WeitereHinweise vonB.Langmaackfür ein erfolgreichesThema sind[16]:
1. Bekanntes und Neues mit dem Thema verbinden
2. O-en für unterschiedliche Zugänge
3. Das Thema soll fordern, nicht überfordern
4. Das Thema ist noch nicht die Antwort
5. Themen handlungsorientiert formulieren
6. Das Thema soll ö-nen und abgrenzen zugleich
7. Klare Begri-ichkeit
8. Themen sind Schritte zum Handeln
9. Keine fremden Themen wählen
10. ÜbereinstimmungmitdemGlobe(S.115f.)
NachBeendigungderGruppenarbeitkannfestgestelltwerden obdasThema passend formuliert war oder nicht. Sollte der Verlauf anders sein? Oder ist alles zufrieden stellend. Je nach dem gewinnt der Gruppenleiter wertvolle Erfahrung, die er sich für das nächste Thema in Erinnerung rufen kann.
der GLOBE 12
DerGlobe umschließtdasDreieck undist somitderRahmenfürdieArbeit. Es ist die Bezeichnung für alles außerhalb der Gruppe. Dazu gehören das überschaubar nähere Umfeld, Dinge und Geschehnisse sowie Menschen. JederMenschbewegtsichin seinem eigenenGlobe,jedesElementdesDreiecks besitzt einen Globe und auch die Gruppe bildet einen gemeinsamen Globe. All dies sind Faktoren für eine gemeinsame Erreichung der Ziele. Das BewusstseinüberdieseFaktorenistfürjedeGruppe so wesentlich wiedasder ICH-, WIR-und ES-Faktoren.
Beispiel für den Globe einer Schulklasse nach Langmaack wären folgende Aspekte[16]:
- Einzugsgebiet, soziale Struktur
- Lehrergewerkschaft
- Lehrermangel
- Lehrplan
- Finanzquellen
2. Humanistische Pädagogik Ferienregelung
WelcheBerufe werdengebraucht?(S.130)
vgl. Langmaack, 2004, S. 125 f.
Bespielfür allgemeineGlobe-Aspekte sind nachLangmaackfolgende[16]:
- politische Lage
- wirtschaftliche Lage
- Leitbilder und ihr Wandel
- gesellschaftliche Norm
- Forschungsergebnisse
- Wetter
- aktuelle Ereignisse
- gesetzliche Feiertage(S. 131)
BereitsbeiderErstellungderGruppenarbeitsolltendie wesentlichstenAspekte gesammelt werden, da diese die Gruppenstruktur prägen und die Interaktion beeinflussen.
2.2.4 Postulate
AusdengrundlegendenAxiomen ergaben sichfürRuthCohngewissermaßen die beiden existentiellen Postuale der TZI, auch genannt die „Spielregeln“. Sie zeigen wie die Axiome im persönlichen Leben und in der Gruppe angewendet werden sollen.Sie wirken unterstützendfürdieLeitungderInteraktion, und stellendieVerbindungder methodischenEbene unddenAxiomen dar.13 DiePostulate nachCohn(1975) sindfolgende[5]:
1. SeideineeigeneChairperson-SeiChairpersondeinerselbst.
(S. 121)
2. Beachte Hindernisse auf deinem Weg, deine eigenen und die von anderen.Störungen undBetro-enheitenhabenVorrang; ohneihreLösung wirdWachstum verhindert oder erschwert.(S. 121).
Im folgenden Teil wird näher auf die beiden Postulate eingegangen.
1. Postulat
Der Begri- „chairperson“ wurde nicht aus dem amerikanischen Englisch übersetzt,da esinderdeutschenSprachekeinWortdafürgibt.(„Chairperson“ und „Globe“ sind die einzigen zwei Wörter die nicht in Ruth Cohns
vgl. Langmaack, 2004, S. 134 f. und Padberg, 1998, S. 10 f.
2. Humanistische Pädagogik
Büchern übersetzt wurden.) Was bedeutet Chairperson? -Ganz einfach ausgedrückt: Sei du selbst!
Ruth Cohn (1976, nach Barbara Langmaack, 2004) beschreibt in ihrem Buch „Von der Psychoanalyse zur Themenzentrierten Interaktion“ den Begri- „chairperson“ mitfolgendenWorten[16]:
Seidein eigenerChairman/Chairwoman, seidieChairpersondeiner selbst. Höre auf deine inneren Stimmen -deine verschiedenen Bedürfnisse, Wünsche, Motivationen und Ideen. Gebrauche alle deine Sinne -höre, sieh, rieche und nimm wahr. Gebrauche deinen Geist, dein Wissen, deine Urteilskraft, deine Verantwortung, deine Denkfähigkeit. Wäge Entscheidungen sorgfältig ab.NiemandkanndirdeineEntscheidungen abnehmen.Dubist die wichtigste Person in deiner Welt, so wie ich in meiner. Wir müssen uns untereinanderklar aussprechenkönnen und einander sorgfältig zuhören,denndiesist unsere einzigeBrücke vonInsel zu Insel.(S. 135)
Mit anderen Worten: sei dir deiner Umgebung bewusst. Jede Situation ist ein Angebot für Entscheidungen. Jeder Gruppenteilnehmer soll sich selbst und seinUmfeld wahrnehmen.Erst wenn sichjeder selbst wahrnimmt,kann die Gruppe erfolgreich sein. Bring menschliche Achtung entgegen, und akzeptiere alle Teilnehmer so wie sie sind.
Dieses Postulat fordert dazu auf nach innern zu sehen, und seine eigenen Gedanken,Gefühle,Ideen undWünsche zu akzeptieren und wichtig zu nehmen und volle Verantwortung dafür zu übernehmen.
2. Postulat
Dieses Postulat ist sehr eng mit dem ersten verbunden und soll dem TeilnehmerdieMöglichkeitgeben sichStörungenbewusst zu werden unddiese abzuarbeiten.DieStörung sollteidentifiziert werden undindieGruppenarbeit einfließen.
OhnedasLösen vonProblemenwirddieGruppenarbeitbeeinträchtigtund schreitet nur zögernd voran.Störungenkönnen zumBeispielLärm,Freude, Angst, Schmerz oder persönliche emotionale Betro-enheit sein. Entstehen Entscheidungen aufderBasis vonStörungen, sinddiese oft nichtgutdurchdacht.DasGespräch solltebesser unterbrochen alsfortgeführt werden.Störungen sind als eine Art Botschaft zu verstehen, sie übermitteln uns eine Unstimmigkeit. Sie können in allen Eckpunkten des Dreiecks wie auch im Umfeld ihren Ursprung haben. BarbaraLangmaack(2004) definiertdasStörungspostulat mitdiesenWorten[16]:
2. Humanistische Pädagogik
Das Störungspostulat sagt aus, dass gute Lern-und Arbeitsergebnisse nur zu erreichen sind, wenn Lehrende und Lernende unabgelenktbeiderSache seinkönnen, wennEinzelne sich nicht mit einemTeilihrerAufmerksamkeit ausgeklinkthaben.(S.150)
Nach Langmaack lösen vor allem folgende Mechanismen Störungen in der Gruppe aus[16]:
- wenn das Tempo zu schnell oder zu langsam ist;
- wenn Beteiligte zu wenig beteiligt werden;
- wenn über die Konsequenz der gemeinsamen Arbeit nicht inRuhegesprochen werdenkann;
- wenn kritische Fragen nicht gestellt werden dürfen oder nichtgehört werden;
- wenn in der Euphorie der guten Atmosphäre die eigentlichen Sachziele aus den Augen verloren werden;
- wennTabuthemendieSzenebeherrschen.(S.150)
Die TZI setzt daran, Störungen schon im Vorhinein den Zugang zu verwähren. Wie schon erwähnt, ist es ein sehr wichtiges Anliegen der TZI den Anfang „gut organisiert“ zu gestalten. Ein erfahrener Gruppenleiter kennt die „normalen“ Störungen und kann diesen schon von Beginn an entgegenwirken.
2.2.5 Hilfsregeln
Ruth Cohn hat in ihrem Werk „von der Psychoanalyse zur ThemenzentriertenInteraktion“ eineReihe vonRegeln erarbeitet,diedenpersönlichen Umgang mit den Axiomen und Postulaten unterstützen sollen. Dabei sind die Regeln nicht 1:1 anwendbar, sondern situationsbezogen an die Gruppe anzupassen. Es gilt herauszufinden, welche Regeln für die Beteiligten Sinn machen und welche nicht.RuthCohn(1995, zitiert nachGrenz,2002) selbst schreibt dazu[11]:
Sie(dieHilfsregeln,W.G.)helfen nur, wenn sie menschengerecht angewandt werden. Seelenlose, mechanische Kommunikation ist nicht menschengerecht.(S.361)
EinAuszugderHilfsregeln nachCohn(1975, zitiert nachPadberg,1998) [23]:
[...]
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2009
- ISBN (eBook)
- 9783836637787
- DOI
- 10.3239/9783836637787
- Dateigröße
- 2.5 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Fachhochschule Oberösterreich Standort Hagenberg – Software Engineering
- Erscheinungsdatum
- 2009 (November)
- Note
- 2,0
- Schlagworte
- themenzentrierte interaktion wiki lernen fremdsprache
- Produktsicherheit
- Diplom.de