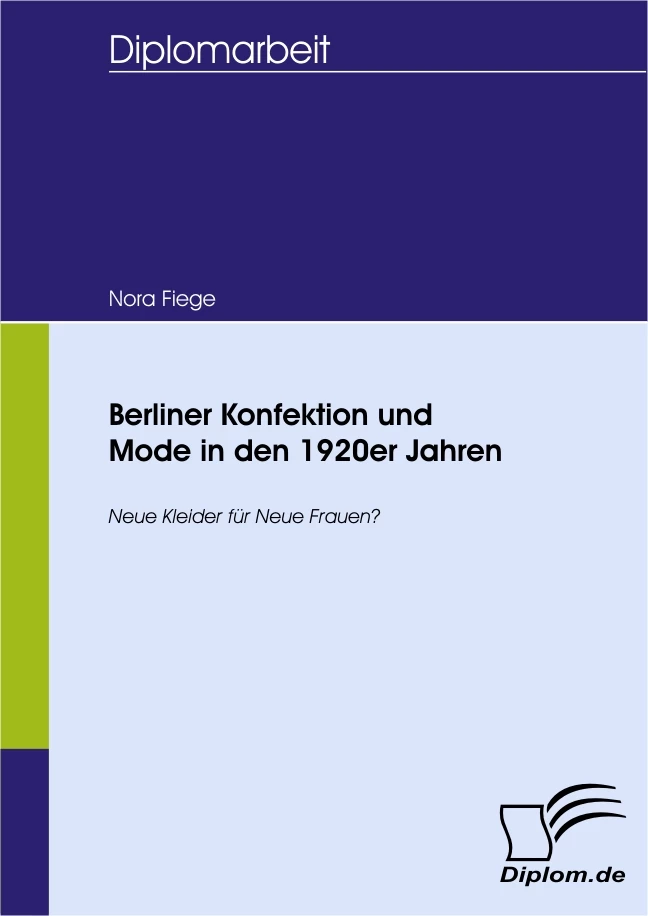Berliner Konfektion und Mode in den 1920er Jahren
Neue Kleider für Neue Frauen?
Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit wurde als theoretische Diplomarbeit im Fachbereich Modedesign an der Kunsthochschule Berlin Weißensee verfasst. Betreuende Professoren waren Gabriele Jaenecke und Rolf Rautenberg.
Entscheidend für die Wahl des Themas waren ein persönliches Interesse an Frauengeschichte und der Mode der 1920er Jahre, die Lektüre des Romans Das kunstseidene Mädchen von Irmgard Keun und nicht zuletzt der zufällige Fund eines kleinen Stilratgebers mit dem Titel Die perfekte Dame, der 1928 von der Autorin Paula von Reznicek verfasst wurde. Die Autorin stammte offenbar aus so genannten besseren Kreisen, dies erschließt sich zum einen aus ihrem Adelstitel, zum anderen aus ihren Texten, in denen zum Beispiel kostspielige Freizeitaktivitäten wie Opern- und Theaterbesuche, Fernreisen und Autofahren als selbstverständlich vorausgesetzt werden. Auch wenn Rezniceks Ratschläge nur für eine verschwindend kleine, vermögende Schicht von Frauen umsetzbar gewesen sein mögen, spiegeln sie doch die erfrischend ironische Sicht einer Augenzeugin auf die Zeitumstände wieder. Ich habe sie daher mehrfach zitiert.
Ziel der Arbeit sollte es sein, nicht nur ein Stück Berliner Stadtgeschichte zu dokumentieren, sondern auch die neuen Formen der Damenmode der Zwanziger Jahre im Zusammenhang mit der speziellen Berliner Situation zu betrachten. Zentrale Fragen waren dabei:
Welche Wurzeln hat die Berliner Konfektionsbranche und wie war ihre Produktionsweise? Inwiefern kann man von einem speziell Berliner Modestil sprechen? Welche Schnittstellen bestanden zu anderen wirtschaftlichen und kulturellen Bereichen? Welche Zusammenhänge bestanden zwischen modischen und gesellschaftlichen Entwicklungen, speziell in Bezug auf das Alltags- und Arbeitsleben von Frauen? Was bedeutet der Begriff Neue Frau und in wie fern trifft dieses vielfach überlieferte Klischee auf die reelle Situation von Frauen zu?
Die Recherche gestaltete sich nicht immer einfach. Zum einen, weil sich bis heute wenige originale Kleidungsstücke aus Berliner Konfektionsbetrieben erhalten haben, zum anderen weil im Zuge der politischen Entwicklungen seit 1933 offenbar nur sehr wenig Interesse an einer Aufarbeitung des Themas bestand. Was nicht durch Arisierung und Krieg verloren ging, verschwand im geteilten Berlin auf andere Weise. Qualifizierte Literatur zu dem Thema liegt eher begrenzt vor, ebenso verhält es sich mit Abbildungen, die eindeutig Berliner Mode zeigen. Bei der […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhalt
1. Einleitung
2. Historische Ausgangspunkte
2.1: Preußische Uniformproduktion
2.2: Jüdische Textilhandelstradition
2.3. Anfänge der Serienproduktion von Bekleidung
2.4: Die ersten Berliner Konfektionshäuser im 19. Jahrhundert
2.3-1: Herrmann Gerson
2.3-2 : Nathan Israel
2.3-3: Gebrüder Manheimer
2.3-4: Rudolph Hertzog
3. Die Berliner Modebranche in den Zwanziger Jahren
3.1: Industrie ohne Fabriken: Berliner Konfektionsfirmen in den zwanziger Jahren
3.2: Der Verband der deutschen Modenindustrie
3.3: Berlin - Paris
3.4: Die Berliner Durchreise
3.5: Mode, Bühne und Film
3.6: Berliner Modepresse
3.7: Warenhauskultur
3.7-1: Hermann Tietz (Hertie)
3.7-2: Wertheim
3.7-3: Das Kaufhaus des Westens
4. Die „Neue Frau“
4.1: Weibliche Angestellte: Verkäuferinnen und Sekretärinnen
4.2: Arbeiterinnen
4.3: Frauenberufe in der Berliner Konfektions- und Modebranche
5. Die Berliner Damenmode der 1920er Jahre
5.1: Schönheitsideale
5.2: Wäsche
5.3: Tagesmode
5.4: Sportmode
5.5: Abendmode
5.7 Mäntel
5.8: Accessoires
5.9: Schmuck
6. Abschließende Bemerkungen
Literaturverzeichnis und Abbildungsnachweis
1. Einleitung
Die vorliegende Arbeit wurde als theoretische Diplomarbeit im Fachbereich Modedesign an der Kunsthochschule Berlin Weißensee verfasst. Betreuende Professoren waren Gabriele Jaenecke und Rolf Rautenberg.
Entscheidend für die Wahl des Themas waren ein persönliches Interesse an Frauengeschichte und der Mode der 1920er Jahre, die Lektüre des Romans „Das kunstseidene Mädchen“ von Irmgard Keun und nicht zuletzt der zufällige Fund eines kleinen Stilratgebers mit dem Titel „Die perfekte Dame“, der 1928 von der Autorin Paula von Reznicek verfasst wurde. Die Autorin stammte offenbar aus so genannten „besseren Kreisen“, dies erschließt sich zum einen aus ihrem Adelstitel, zum anderen aus ihren Texten, in denen zum Beispiel kostspielige Freizeitaktivitäten wie Opern- und Theaterbesuche, Fernreisen und Autofahren als selbstverständlich vorausgesetzt werden. Auch wenn Rezniceks Ratschläge nur für eine verschwindend kleine, vermögende Schicht von Frauen umsetzbar gewesen sein mögen, spiegeln sie doch die erfrischend ironische Sicht einer Augenzeugin auf die Zeitumstände wieder. Ich habe sie daher mehrfach zitiert.
Ziel der Arbeit sollte es sein, nicht nur ein Stück Berliner Stadtgeschichte zu dokumentieren, sondern auch die „neuen“ Formen der Damenmode der Zwanziger Jahre im Zusammenhang mit der speziellen Berliner Situation zu betrachten. Zentrale Fragen waren dabei:
Welche Wurzeln hat die Berliner Konfektionsbranche und wie war ihre Produktionsweise? Inwiefern kann man von einem speziell Berliner Modestil sprechen? Welche Schnittstellen bestanden zu anderen wirtschaftlichen und kulturellen Bereichen? Welche Zusammenhänge bestanden zwischen modischen und gesellschaftlichen Entwicklungen, speziell in Bezug auf das Alltags- und Arbeitsleben von Frauen? Was bedeutet der Begriff „Neue Frau“ und in wie fern trifft dieses vielfach überlieferte Klischee auf die reelle Situation von Frauen zu?
Die Recherche gestaltete sich nicht immer einfach. Zum einen, weil sich bis heute wenige originale Kleidungsstücke aus Berliner Konfektionsbetrieben erhalten haben, zum anderen weil im Zuge der politischen Entwicklungen seit 1933 offenbar nur sehr wenig Interesse an einer Aufarbeitung des Themas bestand. Was nicht durch Arisierung und Krieg verloren ging, verschwand im geteilten Berlin auf andere Weise. Qualifizierte Literatur zu dem Thema liegt eher begrenzt vor, ebenso verhält es sich mit Abbildungen, die eindeutig Berliner Mode zeigen. Bei der Wahl der Abbildungen habe ich vorausgesetzt, dass Schönheitsideal und Modestil der zwanziger Jahre dem Leser im Allgemeinen bekannt sind. Es war mir wichtig, möglichst nur Stücke aus der Berliner Konfektionsbranche zu zeigen. Ich habe zu einem großen Teil auf Abbildungen aus dem Bestandskatalog der Kostümsammlung des Berlin Museums zurückgegriffen, da diese Abbildungen wohl am besten einen Eindruck von der hohen Qualität der Berliner Bekleidungsherstellung vermitteln. Ergänzend wurden Illustrationen verwendet, die von Künstlerinnen stammen, die in den Zwanziger Jahren in Berlin lebten und arbeiteten.
Über die Berliner Konfektionsbranche kann man nicht sprechen, ohne die verheerenden Folgen der Arisierung und Vertreibung jüdischer Konfektionäre durch die Nationalsozialisten zu thematisieren. Dieser Themenbereich wird in meiner Arbeit zwar angeschnitten, ich habe meine Schwerpunkte aber anders gesetzt und erwähne ihn nur am Rande. Diesen Teil der Berliner Geschichte aufzuarbeiten ist für professionelle Autoren und Historiker ein mühevolles Stück Arbeit, das nicht immer mit Wohlwollen betrachtet wird. Die Brisanz der Thematik war mir bis zur Lektüre von Uwe Westphals Buch „ Berliner Konfektion und Mode“ nicht bewusst.
2. Historische Ausgangspunkte
Die serienmäßige Herstellung von Bekleidung war im beginnenden zwanzigsten Jahrhundert durchaus keine Neuheit mehr. Mit der Erfindung der mechanischen Spinnmaschine „Spinning Jenny“ von James Hargraves 1767 und des ersten mechanischen Webstuhls von Dr. Edmund Cartwright 1785 wurden bereits im 18. Jahrhundert die Grundsteine für die Industrialisierung der Textilbranche gelegt. Versuche zur Entwicklung einer mechanischen Nähmaschine können bis ins Jahr 1790 zurückverfolgt werden, als sich der Engländer Thomas Saint die erste funktionsfähige Kettenstichnähmaschine für Schuhmacher patentieren ließ. Erster Nähmaschinenfabrikant war der Franzose Barthelemy Thimonnier, der 1830 eine Nähmaschine zum Patent anmeldete und ein Unternehmen aufbaute, das sowohl Nähmaschinen als auch maschinell genähte Uniformen für die französische Armee produzierte. Hier deutet sich bereits die Verknüpfung der Uniformproduktion und der Entwicklung der Textilindustrie an. 1851 gründete Isaac Merritt Singer die Firma I. M. Singer & Co, die Nähmaschinen herstellte. Singers Partner Edward Clark entwickelte 1856 den ersten Ratenzahlungsplan, das heißt die Nähmaschinen konnten auf Raten gekauft werden, die Kaufentscheidung wurde somit sehr erleichtert. Die ersten amerikanischen Nähmaschinen kamen um 1853 nach Deutschland, wo sie von deutschen Firmen nachgebaut und weiterentwickelt wurden. Der für damalige Verhältnisse hohe Anschaffungspreis für eine Nähmaschine lag um 1900 bei etwa 100 Mark. Dem gegenüber stand der durchschnittliche Wochenlohn einer Näherin von weniger als 10 Mark. Häufig stellte der Auftraggeber der Näherin eine Nähmaschine zur Verfügung, deren Anschaffungspreis dann mit einem Teil des Lohns verrechnet wurde. Das sich dieses Verfahren oft zu Ungunsten der Näherin auswirkte ist anzunehmen. Ohne Nähmaschine hätte die Erwerbsgrundlage gefehlt, mit Nähmaschine stand die Heimarbeiterin jedoch in der Schuld ihres Auftraggebers und war unter Umständen dessen Willkür ausgesetzt. Dennoch sollte nicht außer Acht gelassen werden, das die Erfindung der Nähmaschine eine gewisse „Demokratisierung“ der Mode nach sich zog, zumindest im Sinne einer breiteren Verfügbarkeit erschwinglicher, modischer Kleidung.
Begünstigt durch preiswerte, in großen Mengen verfügbare textile Rohstoffe aus den Kolonien, insbesondere der Baumwolle, und die Abwanderung der Landbevölkerung in die Städte, entwickelte sich die Textilindustrie zu einem der wichtigsten Wirtschaftszweige Europas. Es entstand eine Schicht von Arbeitern, die große Teile der Beschäftigten der Textilbranche stellte. Zusätzlich zur Technisierung der Bekleidungsproduktion förderten auch der modische Wandel, die Vereinfachung der Silhouetten und der Verzicht auf das Korsett ab der Jahrhundertwende die Herstellung von Konfektionskleidung mit Einheitsgrößen.
In Berlin bestanden über die Entwicklungen im Rahmen der allgemeinen Industrialisierung des Textilsektors hinaus weitere günstige Vorraussetzungen für die Weiterentwicklung der Konfektionsbranche. Die Herstellung und der Verkauf von Bekleidung hatten in der Stadt bereits eine lange Tradition, die sich bis ins Mittelalter zurückverfolgen lässt. Als Residenzstadt des Preußischen Königs hatte Berlin ein reges gesellschaftliches und kulturelles Leben, was die Nachfrage nach Modeartikeln verstärkte. Ein Strom an Zuziehenden aus ländlichen Gebieten gewährleistete einerseits billige Arbeitskräfte, andererseits einen vergrößerten Absatzmarkt für preiswerte Kleidung. Weitere Faktoren waren die preußische Uniformproduktion und die jüdische (Textil-) Handelstradition.
2.1: Die preußische Uniformproduktion
Die Serienproduktion von Bekleidung in Berlin geht unter anderem auf die massenhafte Anfertigung von Uniformen für die preußische Armee ab dem 17 Jahrhundert zurück. Uniformen wurden nach der so genannten „Blauen Patrone“, einem empirisch entwickelten Schnittmuster mit bestimmten Standardmaßen, zugeschnitten. Die Bezeichnung „Blaue Patrone“ entwickelte sich in Anlehnung an das blaue Zuckerhutpapier, aus dem die Schnittschablonen bestanden. Um den großen Bedarf an Uniformen decken zu können, wurde außerdem bereits damals nach einem System gearbeitet, das eine Vorform des späteren Zwischenmeistersystems darstellt: Die Uniformen wurden von Zunftbetrieben hergestellt, die sich an genaue Lieferfristen halten und mit dem vom Staat zugeteilten Material auskommen mussten. Der preußische Staat zahlte den Uniformschneidern einen geringen Stücklohn. Zwar konnten die Schneider aus einer einzelnen Uniform keinen großen Profit ziehen, die kontinuierliche Nachfrage nach Uniformen gewährleiste aber eine gewisse Stabilität der Einkünfte für die Produktionsbetriebe. Die sprichwörtliche preußische Sparsamkeit und die Tatsache, dass preußische Soldaten bestimmten Körpermassen gerecht werden mussten, förderten eine Stoff sparende, rationalisierte Fertigungsweise nach standardisierten Maßen. Die Qualitätsanforderungen an Material und Verarbeitung waren sehr hoch, wenn man bedenkt, welch starker Abnutzung die Uniformen ausgesetzt waren.
Laut Brunhilde Dähn sollen viele der weiblichen Angehörigen der Soldaten mit niedrigeren Rängen wiederum der Uniformkonfektion zugearbeitet haben, in dem sie in Heimarbeit für die Uniformschneidereien Tressen und Besätze nähten.[1] Das ist nicht unwahrscheinlich, zumal Frauen sämtlicher gesellschaftlicher Schichten traditionell in Handarbeitstechniken ausgebildet waren und die häusliche Handarbeit in einkommensschwächeren Familien eine - wenn auch nach außen oft geheim gehaltene – Erwerbsquelle darstellte.
Nicht nur die ersten Standardschnitte, auch der erste Einsatz einer Nähmaschine in Berlin 1853 gehen auf die preußische Armee zurück. So berichtete die Herrenzeitschrift „Phoenix“:
„Die patentierte, amerikanische Nähmaschine nimmt fortwährend das Interesse der Beteiligten Gewerbe in Anspruch. Zugleich hat sich das oekonomische Departement des königlichen Kriegsministeriums veranlasst gefunden, ein Exemplar dieser Maschine anzukaufen und zu diesem Zweck drei Mann kommandiert, um dieselbe in der Maschinenbauanstalt des Herrn Baermann, Berlin, Koepenickerstraße 71, einzuüben.(…)Die Resultate, welche auf diese Weise erzielt worden sind, haben den königlichen Oberstlieutenant Herrn von Ilyner bewogen, dieselbe der Armee zur allgemeinen Anwendung zu empfehlen.“[2]
2.2: Die Jüdische Textilhandelstradition
1288 gründete sich die Berliner Schneidergilde und erhielt den so genannten Gildebrief von den Brandenburgischen Markgrafen. Darin wurde festgelegt, dass niemand das Schneidergewerbe ausüben dürfe, ohne Mitglied der Gilde zu sein. Der Verkauf fertiger Kleidungsstücke auf dem Wochenmarkt wurde verboten, dafür aber auf dem Jahrmarkt erlaubt. Der Handel mit gebrauchten und vorgefertigten Kleidern wurde vor allem von Juden betrieben, da ihnen die Aufnahme in die christlichen Handwerkszünfte verwehrt blieb. Mit der steigenden Nachfrage nach Bekleidung in den wachsenden Städten wuchs auch der Konkurrenzkampf zwischen zünftigen Schneidern und jüdischen Kleiderhändlern. Diese waren nicht an die Preisabsprachen und Reglementierungen der Zünfte gebunden und waren deshalb in Bezug auf die Preisgestaltung flexibler. Lieferanten der Textilhändler waren die von den Zünften als „Störer“ und „Pfuscher“ bezeichneten illegalen, d.h. nicht-zünftigen Schneider, die zum Beispiel ebenfalls jüdischen Glaubens oder eingewandert waren. Während ein sehr kleiner Teil jüdischer Unternehmer das Privileg erhalten hatte, mit Seidenstoffen handeln zu dürfen, lebte der größte Teil der jüdischen Bevölkerung recht- und mittellos am Rande der Gesellschaft. Juden waren aus der städtischen Gemeinschaft ausgeschlossen und wurden im wirtschaftlichen Leben nur geduldet, sofern sie im Sinne der Preußischen Regierung zur positiven Entwicklung der Wirtschaft beitrugen. Trotz der Vorbehalte gegen jüdische Händler hatte aber speziell der Altkleiderhandel eine nicht zu unterschätzende gesellschaftliche Funktion, denn die umherziehenden Händler verbreiteten nicht nur politische sondern auch modische Neuigkeiten von Ort zu Ort.
Ein kleiner, staatswirtschaftlich nützlicher Teil der jüdischen Bevölkerung genoss die Privilegien eines „ordentlichen Schutzjuden“[3], der Großteil blieb jedoch weiterhin rechtlos und wurde widerwillig geduldet. Eine rechtliche Gleichstellung von Juden und Christen in Preußen erfolgte erst 1812 mit dem „Edikt betreffend die bürgerlichen Verhältnisse der Juden in dem preußischen Staate“ („Emanzipationsedikt“),[4] wobei Juden aber weiterhin vom Staatsdienst ausgeschlossen blieben. Von da an war es allen einheimischen Juden erlaubt, Land zu erwerben, ihren Wohnort frei zu wählen und ein freies Gewerbe auszuüben. Infolge des „Emanzipationsediktes“ kam es in den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts zu einer massenhaften Zuwanderung von Juden aus dem nicht preußischen Posen. Da viele der Posener Juden Schneider waren bedeutete dies einen Zuwachs an Arbeitskräften und neu gegründeten Zulieferbetrieben für die aufstrebende Berliner Konfektion. Nicht nur ein Teil der Konfektionäre, auch einige der Warenhausunternehmer hatte familiäre Wurzeln in Posen, darunter auch Oskar Tietz, dessen Unternehmen in den 1920er Jahren das größte Berlins werden sollte.
Juden lebten traditionell in ganz Europa verteilt und pflegten ihre Geschäftsbeziehungen nicht nur im Inland. Im Laufe der Zeit bauten die deutsch-jüdischen Konfektionäre enge, mitunter sogar freundschaftliche Geschäftsbeziehungen zu Lieferanten und Käufern im Ausland auf, die für die Konfektionsindustrie wichtige Anregungen aus dem Ausland und einen erweiterten Absatzmarkt bedeuteten.
2.3: Anfänge der Serienproduktion von Bekleidung in Berlin
Die Berliner Konfektionsindustrie hat ihre Wurzeln nicht nur in der Serienproduktion von Uniformen sondern auch in der Wäsche- und Mantelproduktion.
Die (Leib-)Wäschekonfektion entwickelte sich im 19. Jahrhundert aus dem Handel mit Leinen und Fertigwaren wie Spitzen. Nachdem die Leinenhändler zunächst nur die Materialien verkauft hatten, aus denen Frauen in häuslicher Handarbeit die Wäsche ihrer Familien selbst anfertigten, ging vermutlich speziell die wohlhabende Kundschaft bereits in den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts dazu über, die Wäsche nicht mehr im eigenen Hause zu fertigen (oder fertigen zu lassen), sondern diese bei den Leinwandhändlern in Auftrag zu geben. Diese Wäsche war meist nach Maß gefertigt und wurde in so genannten „Nähschulen“ hergestellt. Nach Einführung der Gewerbefreiheit in Preußen 18… wurden die Wäschestücke dann nicht mehr bei den „Nähschulen“ in Auftrag gegeben sondern bei Heimarbeiterinnen. Mit zunehmender Nachfrage nach vorgefertigter Wäsche ging man dazu über, nach Standardmaßen und auf „Vorrat“ zu produzieren. Einer Serienproduktion kam dabei entgegen, das Wäsche keine individuelle Passform haben musste, sondern lose auf der Haut lag, zumal das Form gebende Kleidungsstück, also das Korsett der Damen, über der Leibwäsche getragen wurde. Ab den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts soll es schließlich eine Wäschekonfektion in größerem Maßstab gegeben haben.[5] Zu den Konfektionsfirmen, die auf Grundlage der Wäschekonfektion entstanden sind gehört zum Beispiel auch das Unternehmen Nathan Israel.
Die Mantelkonfektion entwickelte sich aus der Herstellung und dem Vertrieb von Capes, Schals und Pellerinen. Diese bedurften ebenso wie Wäsche keiner genauen Passform, da sie zunächst nur relativ lose über die Krinolinenkleider des 19. Jahrhunderts drapiert wurden. Die so genannte „Shawlmode“ verbreitete sich etwa ab Ende des 18. Jahrhunderts zu den Chemisenkleidern des Empire in Europa. „Longshawls“ oder Langschals waren reich verzierte Umschlagtücher aus Seide, Samt und Cashmere.
Entscheidenden Auftrieb erhielt die Serienproduktion von Bekleidung durch die zunehmende Vereinfachung der Damenmode Ende des 18. Jahrhunderts. Solange die Damenmode komplizierter Unterkonstruktionen wie Korsetts, Krinolinen und Tournüren bedurfte war sie größtenteils nicht industriell umsetzbar. In dem Maße wie sich Schnittkonstruktion, Verarbeitungstechnik und Maschinen entwickelten, kamen nach und nach auch anspruchsvollere Kleidungsstücke wie Blusen und Röcke zu den konfektionierten Mänteln hinzu. Es konnten auch vorgefertigte Röcke mit dazugehörigem Material für das Oberteil des Kleides gekauft werden. Mit dem Wegfall der extrem körperbetonten Silhouetten in der Damenmode wurden die Schnitte der Kleider einfacher und mussten nicht mehr maßgenau an die Trägerin angepasst werden. Damit wurde die industrielle Bekleidungsproduktion maßgeblich erleichtert. In den zwanziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts erreichte die Vereinfachung der Silhouette einen vorläufigen Höhepunkt.
Zwar hatte es zuvor bereits zahlreiche Versuche von Künstlern und Medizinern gegeben, eine korsettlose Mode zu etablieren, die entsprechenden Kleider blieben aber weiterhin einer kleinen, begüterten Gruppe vorbehalten. In diesem Zusammenhang kommt der Konfektion eine besondere Rolle bei der Verbreitung einer körperfreundlichen Mode zu. Einerseits kamen die lockeren, schlichten Entwürfe von Vordenkern der Mode wie Coco Chanel der preiswerten Serienproduktion entgegen. Andererseits wurde diese neue Mode durch die Konfektion einem breiteren Publikum zugänglich.
2.4: Die ersten Berliner Konfektionshäuser im 19. Jahrhundert
Bereits in den dreißiger und vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts wurden die ersten Berliner Konfektionsfirmen gegründet. Laut einem Bericht der „Ältesten der Berliner Kaufmannschaft“ belief sich der Jahresumsatz der Berliner Konfektionsbranche 1867 auf 5 Mio. Taler. Bereits 1857 hatte man sich dem Export nach Österreich geöffnet, ab 1860 wurde nach Amerika geliefert. 1871 zählten die „Ältesten“ 60 Engros - Geschäfte (also Großhandelsgeschäfte) für Damenkonfektion, die von etwa 600 Zwischenmeistern und 6000 Arbeiterinnen und Arbeitern beliefert wurden. Amerika, England, die Niederlande, die Schweiz, Russland und Skandinavien importierten Berliner Konfektionskleidung. 1875 belief sich der Umsatz im Export auf 10 Mio. Mark, der inländische Umsatz auf 13 Mio. Mark Die Ursachen dafür lagen unter anderem im Ausbruch des deutsch-französischen Krieges 1870. Da Paris von der deutschen Armee eingeschlossen war, gaben die internationalen Einkäufer ihre Bestellungen in Berlin auf. Zudem hatte sich seit Anfang der Fünfziger Jahre die Nähmaschine rasant verbreitet und ermöglichte eine umfangreichere, schnellere Produktion von Kleidung. In dem Maße, wie die Konfektionsunternehmen wuchsen, siedelten sich auch zunehmend Zulieferbetriebe für Stoffe, Zutaten und Posamenten, Putzmacher und Kunstblumenhersteller an. 1890 gab es in Berlin 133 Betriebe für Damenkonfektion und 238 Geschäfte für Damenmäntel; einschließlich der Groß- und Einzelhandelsgeschäfte und der Geschäfte, die auf den Export spezialisiert waren. In dieser Zeit entwickelte sich der Hausvogteiplatz zum Zentrum der Berliner Konfektionsbranche. Das Konfektionsmilieu wurde als sehr lebendig und dem kulturellen und gesellschaftlichen Leben gegenüber sehr aufgeschlossen beschrieben. Viele der großen Konfektionsunternehmer betätigten sich als Mäzene und richteten umfangreiche Sozialleistungen für ihre Angestellten ein. Ihre internationalen Handelsbeziehungen wirkten sich zudem positiv auf die Entwicklung des kulturellen Austauschs über die deutschen Grenzen hinaus aus.
Ein Großteil der Konfektionsunternehmen fiel nach der Machtergreifung Hitlers der so genannten Arisierung zum Opfer. In der nationalsozialistischen Propaganda wurde behauptet, die Konfektion sei „verjudet“, was jedoch nicht den tatsächlichen Verhältnissen entsprach.[6] Jüdische Firmen wurden konfisziert, in scheinbar „korrekten“ Verfahren weit unter Wert an „arische“ Unternehmer verkauft oder aber die jüdischen Firmeninhaber vertrieben oder unter Vorwänden verhaftet. Die Nationalsozialisten erhofften sich große Deviseneinnahmen aus dem Konfektionsexport, der bis dahin einen großen Teil des Gesamtumsatzes der Konfektionsbranche ausgemacht hatte. Diese Rechnung ging jedoch nicht auf, da die nunmehr „arischen“ Besitzer der Konfektionsfirmen nicht auf die langjährige Erfahrung und die, über viele Jahre hinweg aufgebauten und gepflegten, internationalen Geschäftsbeziehungen der jüdischen Unternehmer zurückgreifen konnten. Da auch in Unternehmen christlicher Konfektionäre häufig Juden angestellt waren, oder aber Firmen von zwei Geschäftspartnern geleitet wurden, von denen je einer jüdischen und einer christlichen Glaubens war, traf die Arisierung nicht nur die jüdischen Konfektionsfirmen. Zusätzlich bekamen die deutschen Firmen nun im Ausland Konkurrenz durch von emigrierten jüdischen Konfektionären neu gegründete Unternehmen, die ihren alten Kundenstamm vom neuen Standort weiterbelieferten. Langfristig führte die Arisierung zur Auflösung der bis dahin international anerkannten und erfolgreichen Berliner Konfektionsbranche.
Im Folgenden sollen die wichtigsten Firmen der Gründerjahre der Berliner Konfektion kurz näher vorgestellt werden.
2.4-1: Hermann Gerson
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1.: Vorführ- und Verkaufsraum der Firma Gerson um 1890
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2: Herrmann Gerson
Hermann Gerson war Sohn eines jüdischen Kaufmanns aus Königsberg und kam 1835 unter dem Namen Hirsch Gerson Levin zusammen mit seinen sechs Brüdern nach Berlin. Noch im selben Jahr erwarb er den so genannten Judenbürgerbrief und gründete 1836 an der Königlichen Bauakademie Nr. 6 ein Geschäft für Seidenstoffe, Stickereien, Spitzen und französisches Leinen.1841erweiterte Gerson sein Angebot auf konfektionierte – also nach Standardmaßen vorgefertigte - Damenmäntel. Das Unternehmen florierte, wurde 1848 zum Hoflieferanten erklärt und konnte in ein Geschäftshaus am Werderschen Markt umziehen. Zu dieser Zeit beschäftigte Gerson bereits 5 Handwerksmeister, 3 Direktricen, 120-140 Werkstattarbeiter und –Arbeiterinnen und 100 Kommis und Aufseher für die Ladenräume und den Warenversand. Außerhalb des eigenen Hauses produzierten 1500 Schneider und Näher in Heimarbeit, die Gersons 150 Zwischenmeistern zuarbeiteten. 1860 konnte das Unternehmen 10 Mio. Taler Umsatz verbuchen. Hermann Gerson wird als geschäftstüchtiger, durchsetzungsfähiger Mann mit großem modischem Gespür beschrieben. Bereits Jahrzehnte bevor es den Beruf des Mannequins gab, erlaubte er attraktiven weiblichen Angestellten seines Hauses, Kleider aus der Modellabteilung bei Bällen leihweise „auszuführen.“ Auf diese Weise konnten neue Moden geschickt lanciert und das Haus Gerson bei einer gleichermaßen anspruchsvollen wie kaufkräftigen Zielgruppe beworben werden. Die nur ein Mal getragenen Kleider wurden anschließend zu einem reduzierten Preis verkauft. Um mit der Pariser Mode Schritt halten zu können, unternahm Hermann Gerson Reisen nach Paris und Lyon, wo er Stoffe einkaufte und sich über modische Neuheiten informierte. Brunhilde Dähn gibt in Ihrem Buch „Berlin Hausvogteiplatz“ die Aufzeichnungen des Krefelder Seidenfabrikanten Karl Weiß wieder, der eng mit Hermann Gerson zusammenarbeitete und ihn häufig auf Geschäftsreisen zu den französischen Stofffabrikanten begleitete:
„Bei Dufour in Lyon(…) stellte mich Gerson als seinen Bruder vor, was den Verkäufer offensichtlich verblüffte und mich zu einem nur schwer zu unterdrückenden Lachen hinriss. Man stelle sich vor, ich, ein hochgeschossener Blonder Hüne und er, der kleine, rundliche, schwarzlockige Jude. Aber Gerson ließ nicht von solchen Kleinigkeiten abhalten, er verlangte kurzerhand die Nouveautés zu sehen und schnitt ungeniert unter den Augen des Verkäufers mit einer schnell hervorgezogenen Schere kleine Stücke ab. Ehe dieser ob solcher Unverfrorenheit protestieren konnte ließ Gerson sich weiße Damaste – also klassische Ware – zeigen und bestellte rundweg für 10.000 Franc in diesen Artikeln, sozusagen als Ausgleich für seine Räubereien. Die Ausbeute auf Papier geklebt, Fehlendes dazu gezeichnet und schon ist die Kollektion für die nächste Saison fertig. (…) Die deutschen Modeblätter hätten mehrere tausend Taler für diesen Schatz gegeben“[7]
Die Methoden, an Informationen über modische Neuigkeiten aus Frankreich zu gelangen, werden im Abschnitt „Berlin – Paris“ noch etwas näher erläutert werden.
Nach dem Tod Hermann Gersons im Jahr 1861 wurde die Firmenleitung zunächst von seinen Brüdern übernommen. 1889 trat Phillip Freudenberg in das Unternehmen ein, der in seiner Heimatstadt Elberfeld bereits ein Kaufhaus gegründet hatte und auf Vorschlag der Gebrüder Gerson hin die Leitung des Unternehmens übernehmen sollte. Freudenberg ließ das Geschäftshaus am Werderschen Markt modernisieren und trieb die Entwicklung der Firma voran. Ebenso wie Gerson bewies auch Freudenberg ein ausgeprägtes Gespür für Zeitgeist und Marketing. Er initiierte beispielsweise eine Automobilausstellung im eigenen Kaufhaus, selbstverständlich lieferte die Firma Gerson die entsprechende Autogarderobe gleich dazu. Auch der Besuch von Paul Poiret, der 1911 seine korsettlosen Modelle von eigenen Mannequins in Berlin vorführen ließ geht auf eine Einladung Freudenbergs zurück.
2.4-2: Nathan Israel
Nathan Israel entstammte einer alteingesessenen jüdischen Berliner Familie, sein Großvater Israel Jakob hatte bereits 1741 einen der bereits erwähnten Schutzbriefe erworben und einen Handel für Stoffe und Leinen gegründet. Aufbauend auf dem großväterlichen Unternehmen eröffnete Nathan Israel 1815 in der Jüdengasse 18 einen Altkleiderhandel. 1818 zog die Firma zum Molkenmarkt 2 um, wo Israel ein Geschäft für Leinen- und Haushaltswäsche eröffnete. Das Unternehmen florierte und musste 1843 aus Platzmangel erneut umziehen. Das neue Geschäftshaus befand sich in der Spandauerstraße 26/29. Zwischen 1864 und 1895 wurden die Grundstücke Spandauerstraße 29 und 30 sowie Königsstraße 11/12 dazu gekauft. Das Unternehmen Israel entwickelte sich zu einem großen Kauf- und Versandhaus für Konfektionskleidung. Bis zum Bau des Wertheimkaufhauses in der Leipziger Straße muss das Kaufhaus Israel das größte Kaufhaus Berlins gewesen sein. Es hatte in etwa die Grundfläche des neueren Teils des Nikolaiviertels und befand sich direkt gegenüber dem Berliner Rathhaus. Ab 1895 befand sich im zweiten Stockwerk des Hauses eine separate Großhandels-Abteilung für Damen- und Kinderkonfektion, im dritten und vierten Stock waren Konfektionswerkstätten untergebracht. Im Kaufhaus Israel war vom teuren Modellkleid bis zur preiswerten Stapelware alles zu haben, jede Preisklasse wurde bedient.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3: Nathan Israel.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 4: Blick in einen der Lichthöfe des Kaufhauses Israel
Bis 1907 blieb das Haus samstags geschlossen, da die jüdische Familie Israel den Sabbat feierte. Für Angestellte wurden an diesen Samstagen Weiterbildungsangebote eingeführt, beispielsweise Kurse in Fremdsprachen und Buchführung oder Vorträge zu verschiedensten Fragen der Lebensführung. Daneben finanzierte das Unternehmen einen betriebseigenen Tennisplatz und ein Bootshaus in Strahlau und stellte seinen Beschäftigten eine Bibliothek und Clubräume für die Freizeitgestaltung zur Verfügung. Ziel der Firmenleitung war es, ein gutes Betriebsklima zu schaffen. Auch wenn diese Leistungen natürlich den Angestellten des Hauses vorbehalten blieben und nicht für die unzähligen Heimarbeiter zur Verfügung standen, war die Firma Israel in Bezug auf betriebliche Sozialleistungen sehr fortschrittlich. Das Unternehmen blieb im Besitz der Familie Israel, bis es 1938 der Arisierung durch die Nationalsozialisten zum Opfer fiel. Letzter Leiter der Firma war Wilfried Israel, der durch unermüdliches Engagement Zehntausenden verfolgten Juden das Leben rettete. Er kam in 1938 in einem Flugzeug ums Leben, das von der Wehrmacht abgeschossen wurde.
2.4-3: Rudolph Hertzog
Das Unternehmen Rudolph Hertzog war eines der wenigen christlichen Unternehmen aus den Gründerjahren der Konfektion. Rudolph Hertzog stammte aus einfachen Verhältnissen und wurde 1815 am Mühlendamm geboren. Nach einer kaufmännischen Lehre gründete er 1839 seine Firma in der Breitestraße 15. Hertzog war einer der ersten Konfektionäre, die mithilfe von Zeitungsannoncen gezielt für ihr Unternehmen warben. Er war Neuem gegenüber aufgeschlossen und gehörte zu den ersten Autofahrern, Telefonbesitzern und Luftpostnutzern Berlins. Sein Unternehmen galt als pedantisch organisiert, zahlte seinen Mitarbeitern aber auch faire Gehälter und bot ihnen ähnlich wie die Firma Israel umfangreiche Sozialleistungen. Einmal monatlich besuchte die gesamte Belegschaft auf Firmenkosten kulturelle Veranstaltungen wie Theater- oder Opernaufführungen. Neben einer Rentenkasse standen den Angestellten einmal jährlich bezahlter Urlaub und betriebliche Übernahme von Heilungskosten im Krankheitsfall zu. Nach dem Tod Rudolph Hertzogs wurde die Firma von seinem Sohn Rudolph Hertzog II und seinem Enkel Rudolph Hertzog III geleitet. 1908 wurden die Räumlichkeiten um die Grundstücke Brüderstraße 33 und Breitestaße 15 erweitert, so dass das Haus über eine Verkaufsfläche von 15. 875 qm verfügte. Zum Vergleich: das Berliner KaDeWe hat heute eine Gesamtfläche von rund 60.000 qm. 1912 wurde eine Abteilung eingerichtet, die sich ausschließlich mit dem Export nach Südamerika beschäftigte. Im Laufe des 19. Jahrhundertes hatte es mehrere Auswanderungswellen gegeben, im Zuge derer zehntausende Deutsche nach Lateinamerika ausgewandert waren. Populäre Auswanderungsländer waren vor allem Brasilien, Chile und Argentinien. Die emigrierten Deutschen integrierten sich nicht in die jeweilige Gesellschaft der Einwanderungsländer sondern gründeten zunächst rein deutsche Siedlungen und führten ihr Leben entsprechend den kulturellen Verhältnissen im Heimatland fort. Sie sprachen zum Beispiel weiterhin deutsch, kauften deutsche Möbel und stellten deutsche Pfarrer und Lehrer ein. Es ist daher denkbar, dass sie sich auch in deutsche Konfektion kleideten. Dies könnte eine Erklärung für die Einrichtung der Südamerika-Abteilung sein.
Die Erneuerung der Verkaufskultur zu Beginn des 19. Jahrhunderts äußerte sich bei Hertzog unter anderem darin, dass das Haus einen Erfrischungsraum einrichtete, in dem die Kundschaft mit Kaffee, heißer Schokolade, Limonade und Eis bewirtet wurde. 1914 verfügte die Firma über 2000 Angestellte, das sind so viele wie das KaDeWe heute beschäftigt. Als eines der wenigen christlichen Konfektionsunternehmen der Gründergeneration konnte die Firma Hertzog der Arisierung durch die Nationalsozialisten entgehen.
2.4-4: Gebrüder Manheimer
Die Brüder David, Moritz und Valentin Manheimer waren Söhne des jüdischen Kantors David Manheimer und gründeten 1837 die Firma Gebrüder Manheimer, die Herrenschlafröcke produzierte. 1839/40 trennten sich die Brüder, Valentin gründete die Firma „Valentin Manheimer“ während David und Moritz das ursprüngliche Unternehmen weiterführten. Valentin Manheimer etablierte sich schnell als Damenkonfektionär und wurde 1873 zum Kommerzienrat und 1884 zum geheimen Kommerzienrat ernannt. In den Nachrufen zu seinem Tod 1889 wurden seine besonderen Verdienste um die Öffnung der Berliner Konfektion für den Export gewürdigt. Nach Valentin Manheimers Tod wurde die Firma zunächst von seinen Brüdern Alfred, Ferdinand und Gustav übernommen, ging aber 1904 schließlich an Ferdinand als Alleininhaber über. Letzter Inhaber des Hauses war Ferdinands Sohn Adolf Manheimer, der von Kunden und Angestellten scherzhaft „König Adolf“ genannt wurde und das Haus bis 1931 führte, bis es aufgrund der wirtschaftlich schlechten Lage geschlossen werden musste. Nachdem er seine Gläubiger ausgezahlt hatte erwarb er ein Konfektionshaus in Magdeburg, wo er sich 1932 – bankrott - an seinem Schreibtisch erschoss.
3. Die Berliner Modebranche in den 1920er Jahren
3.1: Industrie ohne Fabriken: Die Berliner Konfektionsfirmen in den zwanziger Jahren
Schon die ersten Berliner Konfektionsfirmen arbeiteten nach dem so genannten Verlags- oder Zwischenmeistersystem. Der Begriff „Verlag“ leitet sich ab von „Vorlage“, das heißt, der Auftraggeber tritt mit Material oder Bezahlung in „Vorlage“ beziehungsweise Vorleistung. Charakteristisch für diese Produktionsform ist die Trennung von Produktion und Vertrieb. Das Produkt wird aus den vom Verleger – also dem Konfektionär – zur Verfügung gestellten Materialien hergestellt und anschließend an ihn geliefert. Damit entfällt für den Produzenten die Verantwortung für die Weitervermarktung und den Materialeinkauf, für den Verleger entfallen die direkten Personal- und Maschinenkosten. Vorformen des Verlagssystems existierten bereits im Mittelalter, speziell im Bereich der Tuchweberei, besonders verbreitet war es aber im 18. Jahrhundert. In den Städten ansässige Kaufleute nutzten die durch die Abschaffung des Frondienstes auf dem Land frei werdenden Arbeitskräfte, um die hohen Preise und strengen Reglungen der städtischen Zünfte zu umgehen. Vor allem Weber und Spinner in ländlichen Regionen arbeiteten für Verleger. Da der Bedarf an Textilien im bäuerlichen Milieu traditionell selbst gedeckt wurde, bestand auf dem Land ein hoch entwickeltes textilhandwerkliches Können und die benötigte Ausrüstung wie Spinnräder und Webstühle war meist schon vorhanden. Im Gegensatz zu den zünftigen Handwerkern in den Städten waren die ländlichen Textilhandwerker meist unorganisiert, denn die geografischen Gegebenheiten erschwerten Zusammenschlüsse zu Interessengemeinschaften. Die Verleger konnten deshalb immer niedrigere Stückpreise durchsetzten und die Waren zu immer billigeren Preisen verkaufen. Die städtischen Zünfte gerieten dadurch unter enormen Preisdruck, bis schließlich auch die Zunftbetriebe begannen, im Verlagssystem zu arbeiten.
Im Falle des Berliner Zwischenmeistersystems fungierte der Konfektionär beziehungsweise das Konfektionshaus als Verleger. „Konfektionär“ war ein Lehrberuf, die Lehrzeit betrug drei Jahre und führte durch alle Abteilungen eines Konfektionshauses. Je nach Berufserfahrung und wirtschaftlichem Erfolg konnten die Konfektionäre sehr hohe Gehälter durchsetzen, mitunter warben sich die Firmen ihre Konfektionäre auch gegenseitig ab. Ein Designstudium wie heute gab es in den Anfängen der Bekleidungsindustrie nicht. Erst 1920 wurde die erste Modeklasse an der Unterrichtsanstalt des Kunstgewerbemuseums Berlin eingerichtet, Leiter des Studiengangs war Otto Haas-Heye vom Modehaus Alfred-Marie.
Der Konfektionär war häufig künstlerischer und kaufmännischer Leiter eines Konfektionshauses in einer Person. Alternativ konnte ein Konfektionsunternehmen auch von zwei Geschäftspartnern geleitet werden, in diesem Fall war jeweils einer der Partner für den kreativen beziehungsweise für den kaufmännischen Teil der Unternehmensleitung zuständig. Große Firmen hatten ganze Entwurfsabteilungen, die heutigen Designteams entsprachen. Der Konfektionär bestimmte die modische Linie, Materialien, Dekoration und Schnitt und gab die Fertigung seiner Entwürfe außer Haus. Die fertige Ware kam dann ins Konfektionshaus zurück und wurde von dort aus im Groß- und Einzelhandel vertrieben. Entwurf, Schnittgestaltung, Materialauswahl und Preiskalkulation erfolgten im Konfektionshaus. Anschließend wurden Prototypen gefertigt, häufig im Konfektionshaus selbst, um Entwurf, Passform und Verarbeitungsweise prüfen zu können. Waren diese Kontrollen abgeschlossen, wurden Stoffe, Zutaten und Schnitte an die Zwischenmeister ausgegeben. Zwischenmeister waren gelernte, selbständige Schneidermeister, die in ihren Werkstätten Schneider und Näher beschäftigten. Häufig wurden auch die Zwischenmeister zu Verlegern, indem sie die zugeschnittenen Teile außer Haus gaben. Diese wurden dann für die teure Modellkonfektion in kleineren Werkstätten oder für das preiswerte Stapelgenre in Heimarbeit zu einem geringen Stücklohn verarbeitet. Der Produktionsprozess war oft vollkommen zergliedert. Teile wie Kragen und Ärmel wurden von den kleineren Werkstätten und Heimarbeiterinnen vorgefertigt und erst in der Werkstatt des Zwischenmeisters wieder zum endgültigen Kleidungsstück zusammengesetzt um dann an die Konfektionshäuser ausgeliefert zu werden. Auf dem Höhepunkt der Arbeitsteilung musste nicht einmal mehr der Zwischenmeister eine Schneiderausbildung haben. Häufig kamen diese Zwischenmeister aus branchenfremden Berufen und waren nur noch mit der Koordination und Organisation der Aufträge beschäftigt, während zum Beispiel ihre Ehefrau eine fachgerechte Ausbildung hatte und sich um Zuschnitt und Bügeln kümmerte. Auf diese Weise wurde der Zwischenmeister seinerseits ebenfalls Verleger. Aufgrund dieser dezentralen Produktionsweise kam die Berliner Konfektion ohne große Fabrikbauten aus, daher wurde sie mitunter auch als „Industrie ohne Fabriken“ oder „Industrie ohne Schornsteine“ bezeichnet.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 5: Einrichtungsabteilung der Firma Leopold Seligmann. Hier wurden die Zutaten und Stofflieferungen für die Zwischenmeister abgemessen und die Zutaten wie Knöpfe, Futterstoffe und anderes Zubehör bereitgelegt. Ca 1930
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 6: Versammlung der für L. Seligmann tätigen Zwischenmeister zur freitäglichen Abrechnung. Ca 1930
Da zur Gründung eines Konfektionsbetriebes nach Berliner Muster keine Produktionsmittel wie Maschinen notwendig waren, genügte ein verhältnismäßig geringes Startkapital. Entscheidend für den Erfolg des Konfektionshauses waren modisches Fingerspitzengefühl, kaufmännisches und organisatorisches Talent und gute Geschäftsbeziehungen des Konfektionärs. Da eine geringe Kapitalbindung bestand, konnten die Konfektionäre schnell auf modischen Wandel und veränderte Marktsituationen reagieren. Obwohl das Zwischenmeistersystem zur Blütezeit der Berliner Konfektion aus wirtschaftlicher Sicht bereits als veraltet galt und andere Branchen längst auf rationelle Fabrikproduktion umgestellt hatten, wurde es speziell den Anforderungen der Bekleidungsherstellung gerecht. Verglichen mit heutiger Kleidung waren die konfektionierten Modelle der zwanziger Jahre um ein Vielfaches anspruchsvoller in Gestaltung und Verarbeitung. Das hohe Niveau zumindest der gehobenen Konfektion in punkto modischer Aktualität und Verarbeitungsqualität hätte mit fabrikmäßiger Produktion nicht erreicht werden können. Im Vordergrund stand in diesem Bereich nicht die rationellste Herstellungsweise, sondern das Produkt, das möglichst Aufsehen erregen sollte. Zudem ist anzumerken, dass es für die Konfektionäre weitaus kostengünstiger war, ihre „maschinelle Ausrüstung“ über den „Umweg“ der maßlos unterbezahlten Konfektionsnäherinnen finanzieren zu lassen (da diese mit ihren eigenen Nähmaschinen arbeiteten), als selbst Maschinen anzuschaffen und zudem noch hohe Mietpreise für Werkstatträume zu zahlen[8] Durch die hohe Konzentration der Konfektionsbranche auf sehr engem Raum waren die Lieferwege extrem verkürzt und die Kommunikation sehr effektiv. Innerhalb weniger Tage konnte die Produktion eines Artikels, der sich schlecht verkaufte gestoppt werden und ein neues Produkt in den Handel gebracht werden. Persönliche Absprachen und direkter Austausch gewährleisteten die hohe Qualität der Berliner Konfektionsmode.
Allgemein wurde die Konfektionsbranche in drei Genres eingeteilt, die sich bezüglich modischer Aktualität, Qualität und Preislage stark unterschieden: Das gehobene Genre oder die Modellkonfektion, das Mittelgenre und das preiswerte Stapelgenre. Dem würden heute Designer-Segment, mittleres Segment und Massensegment entsprechen. In der Modellkonfektion wurde hochelegante, sehr teure Kleidung in kleinen Stückzahlen angefertigt, die sich nur ein kleiner sehr begüterter Kreis von Kunden leisten konnte. Die Modelle waren nach Pariser Vorbild gestaltet und verarbeitet und bestanden aus luxuriösen Materialien wie Seide und Pelz. Modellkonfektion wurde in repräsentativ ausgestatteten Salons vorgeführt und verkauft, die den Pariser Couture-Salons in nichts nachstanden. Die Kleidung des Mittelgenres war modisch aktuell und bestand aus hochwertigen Materialien, wurde aber in größeren Stückzahlen gefertigt und war deswegen sehr viel preiswerter als Modellkonfektion. Zielgruppe für Firmen im mittleren Genre war der wohl situierte Mittelstand. Als „Stapelware“ bezeichnete man schließlich die in großen Mengen hergestellte, qualitativ weniger hochwertige Massenware für das kleine Budget. Die Liste der Berliner Konfektionsfirmen um 1927 zeigt, dass die Modellkonfektion mit nur 31 Firmen zwar modisch einflussreich war, der weitaus größere Teil der Firmen arbeitete aber in den beiden preisgünstigeren Segmenten und produzierte Kleidung, die trotz aller modischen Aktualität alltägliche Bedürfnisse befriedigte.
„Laut einem Taschenadressbuch für Einkäufer, das der Verlag des Branchenblattes „Der Konfektionär“ 1927 veröffentlichte, findet sich eine Auflistung der Berliner Damenkonfektionsbetriebe
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Die Zahl der Doppelzählungen durch branchenübergreifende Produktion muss mit 52 Betrieben berücksichtigt werden, so dass 750 Betriebe der Damenkonfektion in Berlin verbleiben.)“[9]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 7: Anprobe im Modellsalon von Marie Latz um 1921. Marie Latz steht links außen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 8: Werbeanzeige des Modehauses Kersten und Tuteur. Das Logo der Firma stammt von dem Graphiker und Designer Ernst (Deutsch) Dryden, der auch des gesamte Erscheinungsbild, heute würde man corporate identity sagen, für die Firma entwarf. Das Gebäude an der Leipziger Straße, Ecke Charlottenstraße, in dem die Firma ihren Sitz hatte ist heute noch erhalten, im Erdgeschoß befindet sich eine Galerie
Zu den renommiertesten Modehäusern gehörten im Berlin der zwanziger Jahren neben etablierten Firmen wie Nathan Israel (Spandauer Straße), Valentin Manheimer, Rudolph Hertzog und Herrmann Gerson (Werderscher Markt) zum Beispiel Goetz (Kurfürstendamm), Friedländer und Zaduck (Krausenstraße), das Modehaus Alfred-Marie unter der Leitung von Otto Haas Heye, Flatow und Schädler, Kersten und Tuteur ((Leipziger Straße) und auch einige von Frauen geleitete Modeateliers wie die innovativen Maßsalons von Marie Latz, Johanna Marbach (Lennéstr.), Regina Friedländer (Friedrich-Ebert-Straße), Sophie Storch und der Hutsalon Johanna König. Eine sehr umfassende Auflistung, speziell jüdischer Berliner Konfektionsfirmen hat Uwe Westphal erarbeitet, sie kann im Anhang seines Buches „Berliner Konfektion und Mode 1836 – 1939. Die Zerstörung einer Tradition“ nachgelesen werden.
In den zwanziger Jahren wurde fast der gesamte deutsche Bedarf an Bekleidung durch inländische Firmen abgedeckt. Ein ebenfalls großer Teil des Umsatzes der Berliner Konfektionsfirmen war Ergebnis des Exports innerhalb Europas und nach Nord- und Südamerika. Vor allem Länder ohne eigene nennenswerte Textilproduktion wie die skandinavischen Staaten importierten aus Berlin. Größter Importeur von Berliner Mode waren die Niederlande, gefolgt von Großbritannien, Schweden, Dänemark, der Schweiz, den USA und Argentinien. 1925 belief sich der Gesamtumsatz des deutschen Konfektionsexport auf 95 Millionen Reichsmark, was zwar etwa ein Viertel weniger war als vor dem ersten Weltkrieg, aber immer noch enorm ist, wenn man bedenkt, dass die Konfektionskleidung fast durchweg von Klein- und Kleinstbetrieben hergestellt wurde. Der Rückgang des Exportumsatzes lässt sich unter anderem dadurch erklären, dass einige der Exportländer für deutsche Konfektion inzwischen eine eigene Konfektionsbranche nach Berliner Muster aufgebaut hatten.
Die Abnehmer in den Importländern schätzten nicht nur die gestalterischen Qualitäten der Berliner Produkte sondern auch die sprichwörtliche deutsche Pünktlichkeit und die qualitativ hochwertige Verarbeitung. Nach 1933 wurden die hervorragenden Geschäftsbeziehungen ins europäische Ausland für viele enteignete jüdische Konfektionsunternehmer zum rettenden Ast, da sie mit Hilfe ihres ausländischen Kundenstammes neue Firmen außerhalb Deutschlands aufbauen konnten.
[...]
[1] Vergleiche: Brunhilde Dähn; „Berlin Hausvogteiplatz. Bei den Kleidermachern in Berlin“; Göttingen ;1968
[2] „Phoenix, Modenzeitung für Herrenbekleidung“, 1853; zitiert in s.o.
[3] Juden konnten den so genannten „Judenbürgerbrief und damit Bürgerrechte erwerben. Während gewöhnliche Schutzjuden diese Rechte nur auf Lebzeit erwerben konnten, konnten „ordentliche Schutzjuden“ ihr Bürgerrecht weitervererben
[5] Vergleiche Karin Hausen: „Zur Sozialgeschichte der Nähmaschine“, überarbeitete, gekürzte Fassung des Aufsatzes in : Geschichte und Gesellschaft 4, 1978
[6] Vergleiche Uwe Westphal in „ Berliner Konfektion und Mode 1836-1939. Die Zerstörung einer Tradition“ 2. Auflage 1992
[7] Vergleiche: Brunhilde Dähn, a. a. O.
[8] Vergleiche Karin Hauser a. a. O
[9] Quelle Uwe Westphal, a. a. O., S.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2008
- ISBN (eBook)
- 9783836637404
- DOI
- 10.3239/9783836637404
- Dateigröße
- 3.2 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Kunsthochschule Berlin-Weissensee Hochschule für Gestaltung – unbekannt
- Erscheinungsdatum
- 2009 (Oktober)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- konfektionsgeschichte neue frau berlin mode
- Produktsicherheit
- Diplom.de