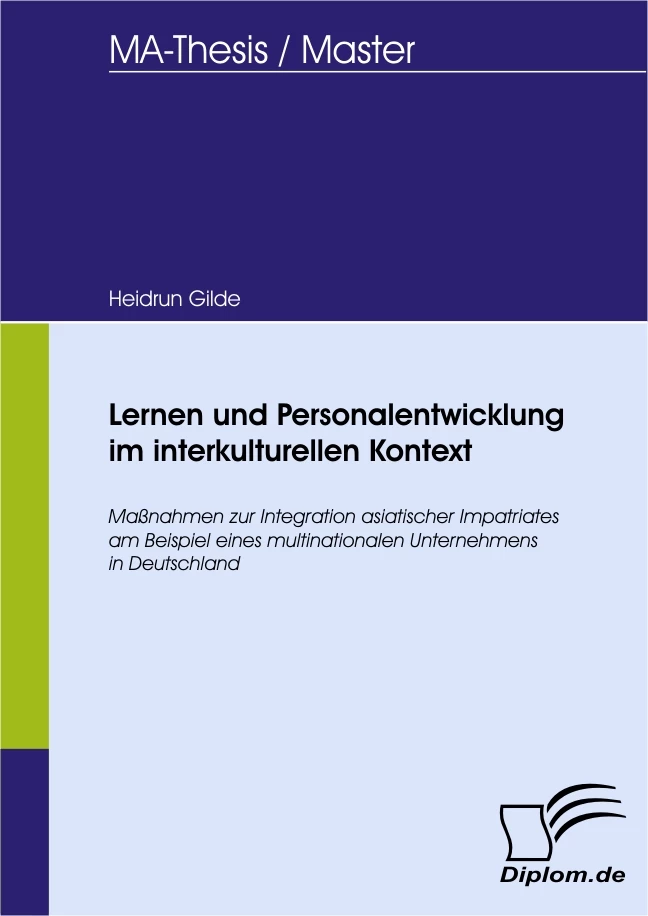Lernen und Personalentwicklung im interkulturellen Kontext
Maßnahmen zur Integration asiatischer Impatriates am Beispiel eines multinationalen Unternehmens in Deutschland
©2008
Masterarbeit
55 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Schlagworte wie Internationalisierung und Globalisierung signalisieren die weltweite politische, ökonomische und soziale Verflechtung. Die Zunahme der internationalen Unternehmenstätigkeiten seit Anfang der 1990er Jahre hat zu einem Bedeutungsanstieg des internationalen Personalmanagements geführt. Ein unternehmensinterner Personalaustausch über die nationalen und kulturellen Grenzen hinweg wird immer wichtiger. Im Zeitalter der Globalisierung, wo Führungsetagen multinationaler Unternehmen in weitaus stärkerem Maße als früher aus multikulturellen Teams bestehen, liegt eine wichtige Aufgabe des internationalen Personalmanagements in der Auslandsentsendung von Führungskräften. Inzwischen müssen sich deutsche Unternehmen daher vermehrt auch mit Impatriates (kurz: Impats) auseinandersetzen, also mit Fach- und Führungskräften aus ausländischen Unternehmenseinheiten, die zeitlich befristet in Deutschland eingesetzt werden und nach Ablauf ihrer Tätigkeiten dorthin zurückkehren. Auch wenn die Grundlogik des internationalen Personaleinsatzes gleichermaßen auf Expatriates wie Impatriates zutrifft, stellt der Einsatz von Impatriates besondere Anforderungen an die Personalexperten.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die erfolgreiche Integration von Impatriates in das neue kulturelle Umfeld nach ihrer Ankunft in Deutschland im Fokus der Personalentwicklungsarbeit näher zu beleuchten. Sie soll einen Beitrag zur Überprüfung der Integrationsmaßnahmen eines multinationalen deutschen Unternehmens leisten. Als spezifische Zielgruppe sollen dabei Impatriates der mittleren und oberen Hierarchieebenen betrachtet werden, also Team-, Gruppen- und Abteilungsleiter, die im Rahmen von drei- bis vierjährigen Entsendungen (sogenannten long term assignments) aus chinesischen, japanischen und indischen Unternehmenseinheiten nach Deutschland kommen. Es soll anhand der ausgewählten Zielgruppe die Hypothese überprüft werden, dass für eine erfolgreiche Integration von Impatriates aus fremdkulturellen Ländern neben einem für alle Entsendungen einheitlichen Rahmen auch maßgeschneiderte Maßnahmen nötig werden. Das Thema der Arbeit ist im Bereich des interkulturellen Personalmanagements anzusiedeln, bei dem Unternehmen den Untersuchungsgegenstand darstellen, jedoch im Unterschied zum internationalen Management Kultur und Kommunikation eine wesentliche Rolle spielen und die zwischenmenschliche Interaktion in den Mittelpunkt gestellt wird.
Mit ihrer […]
Schlagworte wie Internationalisierung und Globalisierung signalisieren die weltweite politische, ökonomische und soziale Verflechtung. Die Zunahme der internationalen Unternehmenstätigkeiten seit Anfang der 1990er Jahre hat zu einem Bedeutungsanstieg des internationalen Personalmanagements geführt. Ein unternehmensinterner Personalaustausch über die nationalen und kulturellen Grenzen hinweg wird immer wichtiger. Im Zeitalter der Globalisierung, wo Führungsetagen multinationaler Unternehmen in weitaus stärkerem Maße als früher aus multikulturellen Teams bestehen, liegt eine wichtige Aufgabe des internationalen Personalmanagements in der Auslandsentsendung von Führungskräften. Inzwischen müssen sich deutsche Unternehmen daher vermehrt auch mit Impatriates (kurz: Impats) auseinandersetzen, also mit Fach- und Führungskräften aus ausländischen Unternehmenseinheiten, die zeitlich befristet in Deutschland eingesetzt werden und nach Ablauf ihrer Tätigkeiten dorthin zurückkehren. Auch wenn die Grundlogik des internationalen Personaleinsatzes gleichermaßen auf Expatriates wie Impatriates zutrifft, stellt der Einsatz von Impatriates besondere Anforderungen an die Personalexperten.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die erfolgreiche Integration von Impatriates in das neue kulturelle Umfeld nach ihrer Ankunft in Deutschland im Fokus der Personalentwicklungsarbeit näher zu beleuchten. Sie soll einen Beitrag zur Überprüfung der Integrationsmaßnahmen eines multinationalen deutschen Unternehmens leisten. Als spezifische Zielgruppe sollen dabei Impatriates der mittleren und oberen Hierarchieebenen betrachtet werden, also Team-, Gruppen- und Abteilungsleiter, die im Rahmen von drei- bis vierjährigen Entsendungen (sogenannten long term assignments) aus chinesischen, japanischen und indischen Unternehmenseinheiten nach Deutschland kommen. Es soll anhand der ausgewählten Zielgruppe die Hypothese überprüft werden, dass für eine erfolgreiche Integration von Impatriates aus fremdkulturellen Ländern neben einem für alle Entsendungen einheitlichen Rahmen auch maßgeschneiderte Maßnahmen nötig werden. Das Thema der Arbeit ist im Bereich des interkulturellen Personalmanagements anzusiedeln, bei dem Unternehmen den Untersuchungsgegenstand darstellen, jedoch im Unterschied zum internationalen Management Kultur und Kommunikation eine wesentliche Rolle spielen und die zwischenmenschliche Interaktion in den Mittelpunkt gestellt wird.
Mit ihrer […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Heidrun Gilde
Lernen und Personalentwicklung im interkulturellen Kontext
Maßnahmen zur Integration asiatischer Impatriates am Beispiel eines multinationalen
Unternehmens in Deutschland
ISBN: 978-3-8366-3625-4
Herstellung: Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2009
Zugl. Technische Universität Kaiserslautern, Kaiserslautern, Deutschland, MA-Thesis /
Master, 2008
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und der Verlag, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplomica.de, Hamburg 2009
II
Inhaltsverzeichnis
Seite
1.
Einleitung
1
2.
Kurzdarstellung der Situation im Beispielunternehmen
3
3.
Theoretische und konzeptionelle Überlegungen für die Integration
6
von Impatriates in ein fremdkulturelles Umfeld
3.1
Zum Verständnis des Begriffs Kultur
6
3.2
Deutsche Kulturstandards
8
3.3
Kultur, Managementstile und Lernen in China, Japan und Indien
9
3.4
Phasen der Anpassung an ein fremdes kulturelles Umfeld
12
4.
Anforderungen an die Personalentwicklung bei der Integration
13
von Impatriates
4.1
Mit der Entsendung von Impatriates verbundene Unternehmensziele
14
4.2
Motivation und Zufriedenheit von Entsandten
16
4.3
Zur Integrationsphase in der Unternehmenspraxis
17
4.4 Zusammenfassung
der
Anforderungen
für eine erfolgreiche Integration 19
5.
Integrationsmaßnahmen
für
Impatriates
20
5.1
Interkulturelle Trainings- und Fortbildungsmaßnahmen
21
5.2
Andere Maßnahmen für die Integration von Impatriates
29
5.2.1
Mentoring-
und
Patensysteme 30
5.2.2
Interkulturelles
Coaching
32
5.2.3
Ergänzende
Integrationsmaßnahmen 35
6. Entwicklung
und
Implementierung eines Integrationskonzepts
39
für Impatriates
6.1
Grundelemente eines systematischen Integrationskonzepts
40
6.2
Monitoring und Erfolgsüberprüfung des Integrationsprozesses
42
6.3
Implementierung der Vorschläge zur Integration von Impatriates
45
7.
Zusammenfassung
und
Abschluss
46
Literaturverzeichnis
49
,,Nur wer den anderen und sich selbst gut kennt,
dem ist in 1000 Begegnungen Erfolg beschieden."
(Altes chinesisches Sprichwort)
1. Einleitung
Schlagworte wie Internationalisierung und Globalisierung signalisieren die weltweite
politische, ökonomische und soziale Verflechtung. Die Zunahme der internationalen
Unternehmenstätigkeiten seit Anfang der 1990er Jahre hat zu einem Bedeutungsan-
stieg des internationalen Personalmanagements geführt. Ein unternehmensinterner
Personalaustausch über die nationalen und kulturellen Grenzen hinweg wird immer
wichtiger. Im Zeitalter der Globalisierung, wo Führungsetagen multinationaler Unter-
nehmen in weitaus stärkerem Maße als früher aus multikulturellen Teams bestehen
1
,
liegt eine wichtige Aufgabe des internationalen Personalmanagements in der Auslands-
entsendung von Führungskräften.
2
Inzwischen müssen sich deutsche Unternehmen
daher vermehrt auch mit Impatriates (kurz: Impats) auseinandersetzen, also mit Fach-
und Führungskräften aus ausländischen Unternehmenseinheiten, die zeitlich befristet in
Deutschland eingesetzt werden und nach Ablauf ihrer Tätigkeiten dorthin zurückkehren
(vgl. Armutat u.a. 2007b, S. 13). Auch wenn die Grundlogik des internationalen Perso-
naleinsatzes gleichermaßen auf Expatriates wie Impatriates zutrifft, stellt der Einsatz
von Impatriates besondere Anforderungen an die Personalexperten (vgl. Armutat u.a.
2007a, S. 16).
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die erfolgreiche Integration von Impatriates in das
neue kulturelle Umfeld nach ihrer Ankunft in Deutschland im Fokus der Personalent-
wicklungsarbeit näher zu beleuchten
3
. Sie soll einen Beitrag zur Überprüfung der
Integrationsmaßnahmen eines multinationalen deutschen Unternehmens leisten. Als
spezifische Zielgruppe sollen dabei Impatriates der mittleren und oberen Hierarchie-
ebenen betrachtet werden, also Team-, Gruppen- und Abteilungsleiter, die im Rahmen
1
,,Aufgrund der durch die Globalisierung und durch die Öffnung innerhalb der EU entstandenen
Arbeitsmigration werden die Belegschaften heterogener: internationaler, altersdifferenzierter
und weiblicher." (Rühl 2007, S. 176)
2
Im Zuge dieser Entwicklung hat das Thema Auslandsentsendungen auch in der Forschung und
Literatur an Bedeutung gewonnen. Insgesamt entspricht der Grad der Beschäftigung mit
diesem Problemfeld allerdings noch nicht der Bedeutung der Humanressourcen in der
internationalen Wirtschaft (vgl. Schipper 2007, S. 13).
3
Die Integration von Impatriates ist wesentlicher Bestandteil des operativen Impat-
Managements, welches den in der Literatur üblicherweise in vier Phasen beschriebenen Prozess
von der Planung und Auswahl über Beratung und Vertrag, Integration und Einsatz bis zur
Rückkehr und Reintegration umfasst (vgl. Armutat u.a. 2007b, S. 14).
1
von drei- bis vierjährigen Entsendungen (sogenannten ,,long term assignments")
4
aus
chinesischen, japanischen und indischen Unternehmenseinheiten nach Deutschland
kommen. Es soll anhand der ausgewählten Zielgruppe die Hypothese überprüft wer-
den, dass für eine erfolgreiche Integration von Impatriates aus fremdkulturellen Län-
dern neben einem für alle Entsendungen einheitlichen Rahmen auch maßgeschneiderte
Maßnahmen nötig werden. Das Thema der Arbeit ist im Bereich des interkulturellen
Personalmanagements anzusiedeln, bei dem Unternehmen den Untersuchungs-
gegenstand darstellen, jedoch im Unterschied zum internationalen Management Kultur
und Kommunikation eine wesentliche Rolle spielen und die zwischenmenschliche
Interaktion in den Mittelpunkt gestellt wird.
5
Mit ihrer Entsendung nach Deutschland werden asiatische Führungskräfte mit einer
Umwelt konfrontiert, die sich in sozialer, politischer, kultureller und wirtschaftlicher
Hinsicht von jener unterscheidet, in der sie bis dahin tätig gewesen sind. Zwar besteht
eine der wichtigsten Aufgaben des internationalen Personalmanagements darin, die ins
Ausland entsandten Führungskräfte auf ihre neue Position vorzubereiten. Doch in vie-
len Unternehmen geht die fachliche zu Lasten der kulturellen Vorbereitung (vgl. Schip-
per 2007, S. 77). Zudem liegt der Fokus der Begleitung von Entsandten während ihrer
ersten Zeit im neuen Einsatzland häufig eher auf logistischen und nicht auf kultur-
spezifischen Aspekten.
Zentrale Fragestellungen, die im Rahmen dieser Arbeit untersucht werden sollen,
sind:
Welche Instrumente und Maßnahmen der Personalentwicklung sind (am Bei-
spiel der spezifischen Zielgruppe im ausgewählten multinationalen Unterneh-
men) für die erfolgreiche Integration von Impatriates anzuwenden?
Wie können diese Maßnahmen in einen sinnvollen Zusammenhang gebracht
und in ein systematisches Gesamtkonzept eingebettet werden?
Die vorliegende Arbeit will Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen geben, wie Maß-
nahmen und Instrumente gezielt eingesetzt werden können, um die Integration und
Anpassung asiatischer Impatriates an die deutsche Kultur erfolgreich zu gestalten.
4
Die Formen einer Impat-Entsendung unterscheiden sich hinsichtlich der Dauer und der
Ausgestaltung. Im Rahmen von long-term-assignments wird im Unterschied zu extended-
business-trips oder short-term-assignments ein normales Arbeitsverhältnis mit der
aufnehmenden Gesellschaft geschaffen.
5
Ökonomische, rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen von Entsendungen werden in
dieser Arbeit daher nicht vertieft.
2
2.
Kurzdarstellung der Situation im Beispielunternehmen
Allgemeine Daten zum Unternehmen und seinem internationalen Mitarbei-
teraustausch
Das im Rahmen dieser Arbeit anonymisiert dargestellte Beispielunternehmen der
Elektronik- Branche beschäftigt an 250 Standorten in über 100 Ländern rund 200.000
Mitarbeiter. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen weltweit einen Umsatz von
über 40 Mrd. Euro erwirtschaftet. Die internationale Zusammenarbeit der Unterneh-
mensgruppen erreicht eine überdurchschnittliche Häufigkeit und einen besonders
großen Umfang. Im Jahr 2007 sind über 800 Personen gleichzeitig als Impatriates im
Mutterhaus in Deutschland beschäftigt gewesen. Diese Anzahl soll im kommenden Jahr
noch einmal verdoppelt werden, so dass die erfolgreiche Integration von Impatriates
immer mehr Bedeutung erlangt. In Asien beschäftigt das Unternehmen ca. 25% seiner
Mitarbeiter, davon einen großen Teil in Indien, China und Japan. Etwa 50% der
Impatriates in Deutschland sind aus Asien, und davon rund die Hälfte auf der dritten
und vierten Führungsebene angesiedelt. Zur Zielgruppe dieser Arbeit zählen im Unter-
nehmen derzeit etwa 50-100 Personen.
Internationale Berufserfahrung durch eine Tätigkeit außerhalb des jeweiligen Heimat-
landes ist ein wichtiger Bestandteil der beruflichen Entwicklung der Fach- und Füh-
rungskräfte.
6
Der internationale Mitarbeiteraustausch innerhalb der Unternehmens-
gruppe gilt weltweit und für alle Funktionsbereiche.
7
Als zentrale Zielsetzungen dieses
Austauschs sind zu nennen:
die Entwicklung von Mitarbeitern zu international erfahrenen Fach- und
Führungskräften
die Entwicklung und Pflege der weltweiten Verständigung und Zusammenarbeit
der Transfer und Austausch von Wissen und Erfahrungen
die Wahrnehmung von Aufgaben an Standorten, an denen noch keine geeig-
neten nationalen Mitarbeiter zur Verfügung stehen.
6
Das Unternehmen strebt langfristig in allen Bereichen eine internationale Zusammensetzung
des Führungskreises an, wobei der Anteil aus dem jeweiligen Land, in dem sich der Standort
befindet, überwiegen soll.
7
Im Jahr 2006 wurde ein standardisiertes globales Entsendungsmanagement entwickelt, das
bis 2008 eingerichtet sein soll. Es beinhaltet u.a. eine globale Policy für Auslandsentsendungen,
die Orientierung der Entsendungsleistungen an marktüblichen Standards sowie die Steigerung
der Zufriedenheit bei entsandten Mitarbeitern.
3
Für asiatische Impatriates der dritten und vierten Führungsebene sind v.a. die ersten
drei Ziele relevant, d.h. Personalentwicklungsziele haben bei der Zielgruppe dieser
Arbeit einen großen Stellenwert. Im Unternehmen kann kein Mitarbeiter die zweite
Führungsebene erreichen, der nicht über ein solides internationales Netzwerk verfügt.
Von den nationalen Führungskräften der Auslandsgesellschaften der Unternehmens-
gruppe wird seitens des Mutterhauses in Deutschland grundsätzlich eine mehrjährige
Tätigkeit in einer Geschäftseinheit in Deutschland erwartet. Die nach Deutschland ent-
sandten Führungskräfte sollen die Kultur des Mutterhauses verstehen, damit umgehen
können und sich ein Netzwerk im Mutterhaus aufbauen, das sie nach ihrer Rückkehr
nutzen können.
Organisation der Entsendung: Maßnahmen und Zuständigkeiten
Das multinationale Unternehmen wählt seine Mitarbeiter für eine Auslandstätigkeit
sorgfältig aus, insbesondere hinsichtlich ihrer Fähigkeit und Bereitschaft, sich an die
örtlichen Lebens- und Arbeitsumstände anzupassen. Nach einem Entsendungsgespräch
mit dem potentiellen Impatriate findet eine Info-Reise des Mitarbeiters statt. Zentrale
Maßnahmen der sich daran anschließenden Auslandsvorbereitung sind ein dreitägiges
interkulturelles Vorbereitungstraining und ein Sprachkurs.
8
Auf die Übersiedlung nach
Deutschland folgt die Integration der entsandten Mitarbeiter, zu der u.a. ein Einarbei-
tungsplan
9
, ein zweitägiges Einführungsseminar in das Unternehmen sowie ein Einfüh-
rungsseminar für neue Führungskräfte wahlweise in englischer oder deutscher
Sprache gehören. Alle genannten Maßnahmen und Trainings sind verpflichtend.
Während ihrer Auslandstätigkeit bleiben die entsandten Mitarbeiter in Kontakt zu ihrem
Heimatland und werden bei der Planung und Realisierung ihrer Rückkehr und bei ihrer
Wiedereingliederung unterstützt. Von entsandten Mitarbeitern wird erwartet, dass sie
alles daran setzen, sich möglichst schnell in die neue Umgebung zu integrieren und die
gesellschaftlichen und kulturellen Normen und Werte des Aufenthaltlandes zu achten
und zu befolgen. Im Heimatland wird von der entsendenden Einheit in Absprache mit
dem Mitarbeiter eine erfahrene Führungskraft zu seinem Mentor benannt, der dem
Mitarbeiter insbesondere während seines Auslandsaufenthaltes beratend zur Seite steht
8
Führungskräfte, deren Muttersprache nicht deutsch ist, sollen Kenntnisse der deutschen
Sprache erwerben.
9
Ein Einarbeitungsplan ist für alle neuen Mitarbeiter des Unternehmens verbindlich und wird
vom neuen Mitarbeiter und einem Einarbeitungspaten verfolgt. Inwiefern dieses Verfahren im
Fall von Impatriates tatsächlich angewandt wird, ist nicht bekannt. Der Einarbeitungsplan
umfasst üblicherweise anhand von Checklisten die Aufgaben vor dem Eintritt des neuen
Mitarbeiters, die IT-Vorbereitung sowie die Aufgaben in den ersten beiden Wochen.
4
sowie bei der Wiedereingliederung ins Heimatland mitwirkt. In einem Gespräch vor
Beginn der Entsendung soll der Mentor dem Mitarbeiter Vorteile des Auslands-
aufenthaltes sowie realistische Erwartungen bezüglich der Karriere-Entwicklung ver-
mitteln. Während der Dauer der Entsendung sollen Mentor und entsandter Mitarbeiter
in geeigneter Weise Verbindung halten, regelmäßig Informationen austauschen sowie
sich mindestens einmal pro Jahr persönlich treffen. Der Mentor ist angehalten, zum
lokalen Vorgesetzten eine Verbindung zu halten und nimmt am jährlich stattfindenden
Mitarbeiterentwicklungsgespräch sowie an Gehaltsgesprächen teil.
Die entsendende Einheit ist ferner zuständig für die Vorauswahl geeigneter Kandidaten,
die Organisation der Inforeise sowie nachdem sie die aufnehmende Einheit für den
Kandidaten entschieden hat für die Vorbereitung und Durchführung der Entsendung.
Sie betreut den Mitarbeiter in Abstimmung mit der aufnehmenden Einheit hinsichtlich
der Einkommensentwicklung und kümmert sich um seine fachliche und persönliche
Weiterentwicklung. Die aufnehmende Einheit entscheidet, ob eine Stelle mit einem
Auslandsmitarbeiter besetzt werden soll und trifft die endgültige Auswahl. Sie ist auch
verantwortlich für die Regelungen der lokalen Beschäftigungsbedingungen und für die
berufliche und soziale Integration der entsandten Mitarbeiter. Sie unterstützt die Mit-
arbeiter in allen betrieblichen und rechtlichen Fragen des Aufenthaltslandes, bei
Anmeldungs- und sonstigen Formalitäten sowie bei der Beschaffung einer ange-
messenen Wohnung. Dies wird häufig über einen Relocation Service abgewickelt. Die
regional spezialisierten Betreuer der Abteilung International Assignments im Mutter-
haus beraten Impatriates und deren Partner insbesondere hinsichtlich der Entsen-
dungsbedingungen und vertraglicher Aspekte und unterstützen sie mit Vorbereitungs-
maßnahmen (Sprachtraining, Inforeise, interkulturelles Seminar, Auslandsvorberei-
tungsseminar, Umzug), in administrativen Fragen und mit Informationen zur Ziel-
region. Weitere Stellen, die in den Entsendungsprozess involviert sind und einen
Impatriate während der Entsendung begleiten, sind die Personalabteilungen im Hei-
mat- und im Aufenthaltsland, die Leitung der Human Resources Abteilung des jeweili-
gen Geschäftsbereichs (sie ist für die Qualität der Entsendung während des Aufenthalts
in Deutschland zuständig), der Relocation Service und der Werksärztliche Dienst.
Problemlage und Anliegen
Impatriates im deutschen Mutterhaus fühlen sich häufig allein gelassen und entwickeln
relativ bald nach der Ankunft Abwehr- und Vermeidungsmechanismen. Sie haben
Schwierigkeiten, zu Kollegen, Chefs und anderen Abteilungen Kontakte aufzubauen.
5
Während es in den Niederlassungen in Ländern wie Indien, Japan und China selbst-
verständlich ist, dass entsandte Mitarbeiter von ihren einheimischen Kollegen anfangs
begleitet werden, gehen deutsche Mitarbeiter und Führungskräfte im Mutterhaus des
Unternehmens davon aus, dass dies nicht notwendig ist. Asiatische Kollegen, die
Unbekannten gegenüber zunächst sehr vorsichtig sind, werden daher nur punktuell
unterstützt
10
. Sie nehmen deutsche Kollegen und Führungskräfte nicht selten als kühl,
formell und sachorientiert wahr. Es besteht im Mutterunternehmen die Befürchtung,
dass diese Erfahrungen eine langfristige erfolgreiche Integration und Identifikation mit
dem Unternehmen und der deutschen Kultur behindern oder im Extremfall auch in eine
Ablehnung gegenüber Deutschland umschlagen können.
Das Anliegen des Unternehmens ist es, die zur Integration von Impatriates einge-
setzten Instrumente und Maßnahmen hinsichtlich ihrer Nützlichkeit zu überprüfen. Im
Rahmen der vorliegenden Arbeit sollen zudem Empfehlungen zur Anwendung dieser
(und ggf. weiterer) Maßnahmen entwickelt werden, um die Integration von Impatriates
aus dem asiatischen Kulturraum (Indien, China, Japan) erfolgreich zu gestalten und die
mit der Entsendung verbundenen strategischen Ziele zu erreichen.
3. Theoretische und konzeptionelle Überlegungen für die Integration von
Impatriates in ein fremdkulturelles Umfeld
Dieses Kapitel zeigt in zusammengefasster Form Bedingungen für eine erfolgreiche
Integration asiatischer Impatriates in Deutschland auf und begründet die Notwendig-
keit einer gezielten Förderung. Es stellt die Auswirkungen verschiedener Einflussgrößen
auf ein Konzept zur Integration von Impatriates in multinationalen Unternehmen in
Deutschland dar und lässt erste Rückschlüsse auf mögliche Schwerpunkte eines
solchen Konzepts zu.
3.1
Zum Verständnis des Begriffs Kultur
Erst mit der Globalisierung der Märkte ist das Thema Kultur in Management und Unter-
nehmensführung relevant geworden
11
und wird zunehmend in den wissenschaftlichen
10
So hat z.B. eine im Juni 2007 unternehmensintern bei indischen Impatriates und ihren
Familien stattgefundene Befragung ergeben, dass die meisten indischen Mitarbeiter nicht mit
ihren deutschen Kollegen gemeinsam zu Mittag essen und auch außerhalb der Arbeit mit
deutschen Arbeitskollegen keine Kontakte haben.
11
Kultur wird hier im Sinne von Nationalkultur gebraucht. Unternehmenskulturelle,
berufskulturelle oder branchenkulturelle Aspekte werden nicht berücksichtigt.
6
Diskurs mit einbezogen. Es besteht jedoch hier noch eine Diskrepanz zur betrieblichen
Praxis, da in Unternehmen das Problembewusstsein hinsichtlich interkultureller Fragen
weiterhin gering ist (vgl. Schipper 2007, S. 18). Die Schwierigkeit beim Thema ,Kultur'
als Forschungsgegenstand besteht darin, dass es keine allgemein gültige Definition
gibt.
12
Hofstede, dessen Definition in den Bereichen der kulturvergleichenden und der
interkulturellen Managementforschung am häufigsten verwendet wird, definiert:
,,Culture is the collective programming of the mind which distinguishes the members of
one group or category of people from another." (Hofstede 2001, S. 9). In Verhaltens-
weisen anderer Personen oder in konkreten Produkten wird immer nur ein Bruchteil
einer Kultur sichtbar, welcher durch stärker im Verborgenen liegende Aspekte erklärt
werden kann.
13
Zur Beschreibung kulturspezifischer Merkmale werden in der Literatur Kulturdimen-
sionen und Kulturstandards benutzt. Verschiedene Forscher (Hofstede 1991, Trom-
penaars 1993, Hall 1977) haben Kulturdimensionen vorgeschlagen, die dichotomisch
strukturiert sind und die beiden entgegen gesetzten Extreme eines Kontinuums
beschreiben, zwischen denen sich die Dimensionswerte einer Kultur bewegen. Andere
Autoren arbeiten mit Kulturstandards, also Werten, Verhaltensweisen und Handlungen,
die von einer Mehrzahl von Mitgliedern einer Kultur als normal und typisch angesehen
und akzeptiert werden
14
. Die Kulturstandards regulieren Handlungen und kommen vor
allem in der Interaktion mit anderen Menschen und Kulturen zum Vorschein. Sie pas-
sen sich neuen Anforderungen an und sind daher dynamisch. Allerdings beziehen sie
sich immer bloß auf Durchschnitte bzw. allgemein gültige Kriterien. Sie können als
Referenzrahmen und Richtungsweiser dienen, von welchen man mögliche Verhaltens-
weisen und Handlungsmuster ableiten kann. In der Literatur wird beim Thema Kultur-
standards immer wieder vor der Verwendung von Stereotypen gewarnt: ,,Mittels der
Ausprägungen, welche die Mehrheit der Mitglieder der Kultur aufweisen, können diese
beschrieben werden, bergen aber die Gefahr von Stereotypisierung." (Fischlmayer
12
Die verschiedenen Disziplinen (Anthropologie, Ethnologie, Psychologie, Soziologie), die sich
mit dem Kulturbegriff auseinandersetzen und sich ihm aus verschiedenen methodologischen
Richtungen näher, setzen unterschiedliche inhaltliche Schwerpunkte (vgl. Schipper 2007, S. 22).
13
Zwei gängige Modelle zu diesem Aspekt sind das Eisbergmodell von Schein (1982, S. 6) und
die Kulturpyramide von Hofstede (1993, S. 6).
14
,,Kulturstandards können aufgefaßt werden als die von den in einer Kultur lebenden
Menschen untereinander geteilten und für verbindlich angesehenen Normen und Maßstäbe zur
Ausführung und Beurteilung von Verhaltensweisen. (...) Kulturstandards sind die zentralen
Kennzeichen einer Kultur, die als Orientierungssystem des Wahrnehmens, Denkens und
Handelns dienen." (Thomas 1999, S. 114 f.)
7
2004, S. 19). Stereotypyen müssen allerdings grundsätzlich nichts Schlechtes sein,
denn sie dienen der Komplexitätsreduktion und machen daher handlungsfähig. Wichtig
ist es, sich dessen beim Gebrauch von Kulturstandards (z.B. im Rahmen interkultureller
Trainings) bewusst zu sein (vgl. Pawlik 2000, S. 48).
3.2 Deutsche
Kulturstandards
Ergebnisse wissenschaftlicher Studien haben gezeigt, dass Menschen aus anderen
Kulturen insbesondere folgende deutsche Kulturstandards auffallen: Sachorientierung,
Wertschätzung von Strukturen und Regeln, regelorientierte internalisierte Kontrolle,
Zeitplanung, Trennung von Persönlichkeits- und Lebensbereichen, Direktheit der Kom-
munikation und Individualismus (vgl. Schroll-Machl 2002, S.34).
Auf der Grundlage von Forschungsstudien und langjährigen Erfahrungen mit inter-
nationalen Fach- und Führungskräften in deutschen Unternehmen stellt Schroll-Machl
deutsche Kulturstandards und ihre historischen Hintergründe vor, analysiert ihre Vor-
und Nachteile und gibt Empfehlungen für Nicht-Deutsche, die mit Deutschen arbeiten
(ebd.). Im Folgenden werden beispielhaft einige Empfehlungen für den Umgang mit
deutschen Kulturstandards wiedergegeben, die für die Integration von Impatriates aus
fremdkulturellen Ländern relevant sein können:
Empfehlungen zum Umgang mit dem Kulturstandard Sachorientierung: ,,Gehen Sie
davon aus, daß Sie im beruflichen Kontakt Deutsche vorwiegend betont sachorientiert
erleben. (...) Wenn Sie Deutsche von etwas überzeugen oder für etwas gewinnen wol-
len, dann bereiten Sie Ihr Anliegen sachlich auf. (...) Grundsätzlich gilt: Daten, Fakten,
Argumente überzeugen, subjektive Meinungen eher nicht. Machen Sie sich bewußt,
dass Deutsche über die Sache Beziehungen stiften." (Schroll-Machl 2002, S. 61).
Empfehlungen zum Umgang mit dem Kulturstandard Trennung von Persönlichkeits- und
Lebensbereichen: ,,Wenn Sie Kälte zu spüren bekommen, gehen Sie zunächst einmal
davon aus, daß sie nicht Ihnen gilt. Höchstwahrscheinlich liegen Sie richtig mit der An-
nahme, in dem Fall wolle sich jemand nur korrekt verhalten (...). Gewöhnen Sie es sich
an, Ihnen wichtige Punkte im formellen Rahmen zu sagen (z.B. bei Besprechungen).
Und zwar am besten dann, wenn Sie an der Reihe sind und Ihr Punkt auf der Tages-
ordnung steht. (...) Dann werden Sie gehört und zur Kenntnis genommen - informell
Gesagtes geht unter!" (ebd., S. 156-157).
Empfehlungen zum Umgang mit dem Kulturstandard Direktheit der Kommunikation:
,,Äußern Sie Ihre Bedürfnisse, Wünsche, Anliegen, Meinungen bitte mit Worten! (...)
Und das, was Sie sagen, formulieren Sie bitte direkt. Wenn Sie sich missverstanden
fühlen, vergegenwärtigen Sie sich einmal, was Sie dem Deutschen ausdrücklich und in
klaren Worten gesagt haben. (...) Suchen Sie nicht eine zusätzliche Interpretation des-
sen, was die Deutschen sagen. Die Deutschen sagen, was sie mitteilen wollen nicht
mehr und nicht weniger.(...) Sagen Sie klar ,,nein", wenn Sie etwas nicht wollen. Und
erläutern Sie, was genau Sie warum nicht wollen. Das wirkt dann überzeugend, klar
und professionell. (...) Wenn Sie etwas sprachlich nicht verstanden haben, fragen Sie
bitte nach. Die deutsche Art direkt zu sein läßt das problemlos zu." (ebd., S. 182-183).
8
Empfehlung an Menschen aus nicht-westlichen Kulturen zum Umgang mit dem Kultur-
standard Individualismus: ,,Erwarten Sie nicht, stets begleitet oder unterstützt zu wer-
den. Alle haben ihre Verpflichtungen und wahrscheinlich kaum Zeit für Sie. Außerdem
ist allein losgeschickt zu werden, ein Zeichen, daß man Sie für kompetent hält und
Ihnen viel zutraut. Man wird Sie nicht verstehen in Ihrem Gefühl, daß Sie ein Recht auf
mehr Hilfe hätten." (ebd., S. 206).
Diese Empfehlungen lassen Rückschlüsse darauf zu, wo Unterschiede zwischen deut-
schen Kulturstandards und den für Impatriates gewohnten Kulturstandards liegen. Sie
zeigen auf, welche Situationen von Impatriates bewältigt werden müssen und in wel-
chen Feldern sie unterstützt werden können, damit ihre Integration erfolgreich ver-
läuft. Im Hinblick auf die im Beispielunternehmen aufgetretenen Schwierigkeiten der
asiatischen Impatriates bei ihrer Beziehungsgestaltung und Integration (vgl. Kapitel 2)
wird deutlich, dass hier ein Zusammenhang zu den deutschen Kulturstandards Sach-
orientierung und Individualismus besteht. Die Empfehlung Schroll-Machls, nicht viel
Begleitung oder Unterstützung zu erwarten, lässt darauf schließen, dass asiatische
Impatriates in Deutschland wahrscheinlich eine andere Art von Betreuung erwarten als
z.B. deutsche Mitarbeiter, die in asiatische Länder entsandt werden.
3.3
Kultur, Managementstile und Lernen in China, Japan und Indien
Die asiatische Kultur insgesamt sowie innerhalb der Länder Indien, China und Japan ist
sehr heterogen und besteht aus verschiedenen Kulturelementen. Trotz der Gefahr
einer Verkürzung durch Selektion oder Verallgemeinerung sollen im Folgenden einige
für die Integration von Impatriates aus Indien, China und Japan wichtige asiatische
Kulturelemente genannt werden. Dabei stehen Aspekte mit Relevanz für die Arbeit in
multinationalen Unternehmen im Vordergrund.
In der Untersuchung von Hofstede (1991) wird die asiatische Kultur als am Kollektiv
orientiert klassifiziert. Die sozialen Beziehungen in der Gemeinschaft, in Familie, Schule
und Betrieb sind durch Gruppen- und Harmonie-Orientierung geprägt. Alle drei Länder
und insbesondere China unterscheiden sich von Deutschland deutlich in der Kultur-
dimension Individualismus-Kollektivismus durch die stärkere emotionale Bindung des
Einzelnen zu seiner Tätigkeit und den höheren Stellenwert inner- und außerorganisa-
torischer Beziehungen. Im Hinblick auf die Beziehungsgestaltung differenziert das
Modell von Kurt Lewin (1936) sogenannte ,Kokosnuss-Kulturen' und ,Pfirsich-Kulturen'.
Deutschland stellt nach diesem Modell eine typische ,Kokosnuss-Kultur' dar, in der
Menschen zunächst eine recht ,harte Schale' besitzen und Freundschaft in einem meist
langjährigen Prozess des Vertrauensaufbaus entsteht sowie von einer besonderen Tiefe
9
und Langfristigkeit gekennzeichnet ist. Indien gehört z.B. zu den ,Pfirsich-Kulturen', die
Freundschaften aufgrund der ,weichen Schale' schnell und spontan entstehen lassen,
allerdings mit einer anderen Tiefe als in Deutschland.
Ein geistig-kulturelles Merkmal Ostasiens ist das konfuzianische Yin-Yang-Prinzip, das
die Einheit von Widersprüchen umfasst und die Grundlage für die Harmonie-Orien-
tierung darstellt (vgl. Nagah 2002, S. 63). Ganzheitlichkeit hat in Asien insgesamt einen
hohen Stellenwert
15
. So hängen z.B. in Indien Familie und Arbeit zusammen und sind
nicht zwei voneinander zu trennende Bereiche. Das bedeutet in der Praxis, dass auch
berufliche Dinge über Beziehungsmanagement geregelt werden und am Arbeitsplatz
viel Zeit in die Kontaktpflege mit Mitarbeitern und Vorgesetzten investiert wird (vgl.
Nottebrock 2007). Hofstede (2001) konstatierte in neueren Untersuchungen für die
ostasiatischen Länder zudem eine langfristige Orientierung, welche sich von Deutsch-
land deutlich unterscheidet und auch für die strategische Orientierung des unter-
nehmerischen Handelns gilt (vgl. Nagah 2002, S. 64). Ein geduldiges, abwartendes
Verhalten des Managers in einer neuen Situation ist daher normal. Ein weiterer Unter-
schied zwischen der deutschen und der ostasiatischen Kultur besteht im Umgang mit
Informationen. Während es in Deutschland üblich ist, dass Mitarbeiter Informationen
oder etwaige Probleme dem Vorgesetzten mitteilen (,Bringschuld'), geht man in ost-
asiatischen Ländern davon aus, dass Vorgesetzte entscheiden, wann sie ihren Mit-
arbeitern Zeit widmen und sich über den Fortgang ihrer Arbeit erkundigen (,Holschuld')
(vgl. Bittner u.a. 1994, S. 70 f.). In den meisten asiatischen Unternehmen lässt sich
eine weitgehend zentralistisch-hierarchische Organisationsstruktur kombiniert mit ei-
nem großen Potential an Flexibilitäts- und Anpassungsfähigkeit feststellen (vgl. Nagah
2002, S. 98). Hofstedes Dimension Machtdistanz, die den Grad der Akzeptanz unglei-
cher Machtverteilung beschreibt, zeigt große Unterschiede zwischen China und Indien
16
15
Während im westlichen Raum Problemhandhabungsstrategien durch Gradlinigkeit,
Zielstrebigkeit und Strukturiertheit gekennzeichnet sind und das Denken in Ursache-Wirkung-
oder Zweck-Mittel-Ketten eine wichtige Rolle spielt, wird in Ostasien versucht, Probleme
ganzheitlich zu lösen (vgl. Sacra 1997, S. 83 f.).
16
So ist z.B. in Indien die Rolle des Mitarbeiters respektvoll, distanziert und untergeordnet.
Hierarchische Organisationsstrukturen und ein patriarchalisches Verhältnis zwischen
Vorgesetzten und Mitarbeitern, in dem Entscheidungen nur selten ohne den Vorgesetzten
getroffen werden, sind häufig. Die Fürsorgefunktion der Vorgesetzten erstreckt sich in Indien
auch auf familiäre Angelegenheiten der Mitarbeiter, und es wird erwartet, dass Kollegen und
Vorgesetzte sich immer wieder nach der persönlichen Lebenssituation ihrer Mitarbeiter
erkundigen. ,,Fürsorge bedeutet auch, dass Kritik seitens der Führungskraft nur im
Zweiergespräch geübt wird. Wichtig bei Kritik und Auseinandersetzungen ist eine Klarstellung,
die die Beziehung nicht infrage stellt und darauf zielt, möglichst bald wieder eine harmonische
Atmosphäre herzustellen (Nottebrock 2007, S. 49)."
10
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2008
- ISBN (eBook)
- 9783836636254
- DOI
- 10.3239/9783836636254
- Dateigröße
- 446 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau – Zentrum für Fernstudien, Studiengang Personalentwicklung
- Erscheinungsdatum
- 2009 (September)
- Note
- 1,7
- Schlagworte
- personalmanagement personalentwicklung integrationsmaßnahmen coaching auslandsentsendung
- Produktsicherheit
- Diplom.de