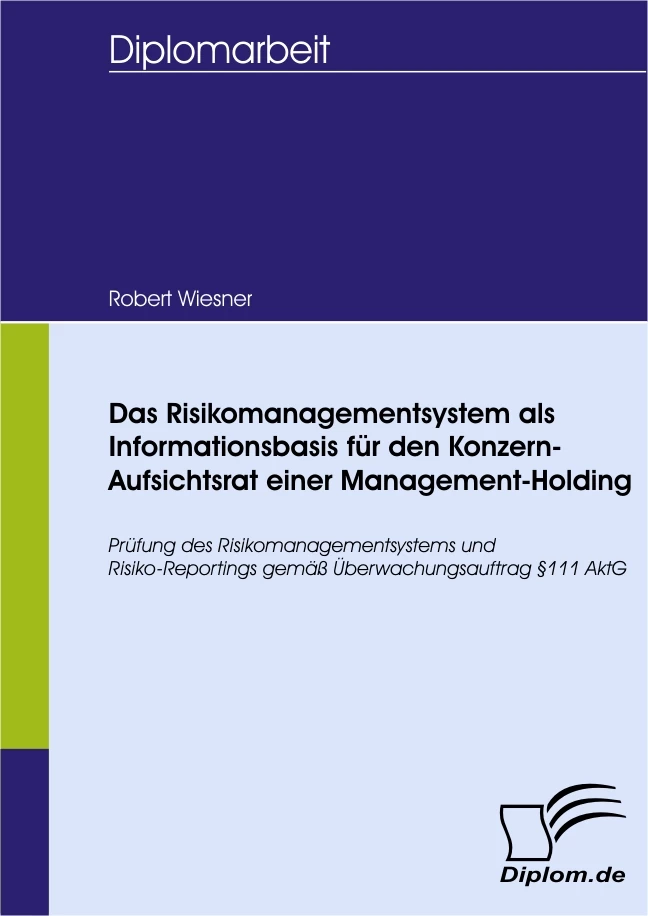Das Risikomanagementsystem als Informationsbasis für den Konzern-Aufsichtsrat einer Management-Holding
Prüfung des Risikomanagementsystems und Risiko-Reportings gemäß Überwachungsauftrag §111 AktG
©2009
Diplomarbeit
126 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Aufgrund der weltweiten Verflechtung der Wirtschaftsräume und der daraus resultierenden Expansion der Kapitalmärkte von nationalen zu international finanzierten Publikumsgesellschaften ist eine für die Anleger effiziente und zuverlässige Leitungs- und Überwachungsstruktur in den Unternehmen unverzichtbar. Auch die Globalisierung des Wettbewerbs und die stetig wachsende Internationalisierung verlangen zur langfristigen Existenzsicherung der Unternehmen eine leistungsfähige Struktur des Risikomanagement-(Systems). Die Unternehmenskrisen in der Vergangenheit (wie z.B. Metallgesellschaft AG, Enron, Philipp Holzmann AG, Bremer Vulkan Verbund AG und Balsam AG) und die durch die aktuelle Finanzkrise ausgelöste Schieflage der Großbanken (wie z.B. UBS, Citigroup Inc, JP Morgen Chase und Commerzbank) erwecken jedoch den Eindruck, dass die bestehenden Strukturen in der Leitung und Überwachung sowie die Risikomanagementsysteme in den Unternehmen erhebliche Defizite aufweisen.
Die Unternehmenskrisen in der Vergangenheit führten vor allem zu einer Diskussion mit Blickrichtung auf eine verantwortungsvolle Unternehmensführung und -überwachung. Diese wurde insbesondere in den USA unter dem Begriff Corporate Governance geführt. Die Diskussion erreichte kurze Zeit danach auch den deutschen Raum, wobei insbesondere die Überwachung des geschäftsführenden Organs im Fokus stand. Die gesetzgeberische Instanz reagierte auf die zunehmende Kritik am deutschen System der Corporate Governance mit der Verabschiedung eines Kontroll- und Transparenzgesetzes, das am ersten Mai 1998 in Kraft getreten ist. Das KonTrag bildete jedoch nur den Anfang und weitere gesetzgeberische Reformschritte (u.a. DCGK, TransPuG, BilReG, BilMoG) folgten im Zuge der Diskussion. Durch die Reformierung der Überwachung des Vorstands durch den Aufsichtsrat erhofft sich der Gesetzgeber vor allem einen Effizienzgewinn der deutschen Corporate Governance Struktur. Im Rahmen der Beziehung zwischen den beiden Organen ist nämlich eine deutliche Informationsasymmetrie festzustellen. Da jedoch die Effizienz der Aufsichtsratsüberwachung hauptsächlich durch die Informationsversorgung determiniert ist, musste der Gesetzgeber deren Verbesserung ins Zentrum seiner Reformschritte stellen.
Die Verantwortung, ein angemessenes Risikomanagementsystem in einer Aktiengesellschaft zu installieren, trägt der Vorstand. Dessen Pflichten diesbezüglich präzisiert, als Folge des KonTraG, der § 91 […]
Aufgrund der weltweiten Verflechtung der Wirtschaftsräume und der daraus resultierenden Expansion der Kapitalmärkte von nationalen zu international finanzierten Publikumsgesellschaften ist eine für die Anleger effiziente und zuverlässige Leitungs- und Überwachungsstruktur in den Unternehmen unverzichtbar. Auch die Globalisierung des Wettbewerbs und die stetig wachsende Internationalisierung verlangen zur langfristigen Existenzsicherung der Unternehmen eine leistungsfähige Struktur des Risikomanagement-(Systems). Die Unternehmenskrisen in der Vergangenheit (wie z.B. Metallgesellschaft AG, Enron, Philipp Holzmann AG, Bremer Vulkan Verbund AG und Balsam AG) und die durch die aktuelle Finanzkrise ausgelöste Schieflage der Großbanken (wie z.B. UBS, Citigroup Inc, JP Morgen Chase und Commerzbank) erwecken jedoch den Eindruck, dass die bestehenden Strukturen in der Leitung und Überwachung sowie die Risikomanagementsysteme in den Unternehmen erhebliche Defizite aufweisen.
Die Unternehmenskrisen in der Vergangenheit führten vor allem zu einer Diskussion mit Blickrichtung auf eine verantwortungsvolle Unternehmensführung und -überwachung. Diese wurde insbesondere in den USA unter dem Begriff Corporate Governance geführt. Die Diskussion erreichte kurze Zeit danach auch den deutschen Raum, wobei insbesondere die Überwachung des geschäftsführenden Organs im Fokus stand. Die gesetzgeberische Instanz reagierte auf die zunehmende Kritik am deutschen System der Corporate Governance mit der Verabschiedung eines Kontroll- und Transparenzgesetzes, das am ersten Mai 1998 in Kraft getreten ist. Das KonTrag bildete jedoch nur den Anfang und weitere gesetzgeberische Reformschritte (u.a. DCGK, TransPuG, BilReG, BilMoG) folgten im Zuge der Diskussion. Durch die Reformierung der Überwachung des Vorstands durch den Aufsichtsrat erhofft sich der Gesetzgeber vor allem einen Effizienzgewinn der deutschen Corporate Governance Struktur. Im Rahmen der Beziehung zwischen den beiden Organen ist nämlich eine deutliche Informationsasymmetrie festzustellen. Da jedoch die Effizienz der Aufsichtsratsüberwachung hauptsächlich durch die Informationsversorgung determiniert ist, musste der Gesetzgeber deren Verbesserung ins Zentrum seiner Reformschritte stellen.
Die Verantwortung, ein angemessenes Risikomanagementsystem in einer Aktiengesellschaft zu installieren, trägt der Vorstand. Dessen Pflichten diesbezüglich präzisiert, als Folge des KonTraG, der § 91 […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Robert Wiesner
Das Risikomanagementsystem als Informationsbasis für den Konzern-Aufsichtsrat
einer Management-Holding
Prüfung des Risikomanagementsystems und Risiko-Reportings gemäß
Überwachungsauftrag §111 AktG
ISBN: 978-3-8366-3392-5
Herstellung: Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2009
Zugl. Universität Dortmund, Dortmund, Deutschland, Diplomarbeit, 2009
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und der Verlag, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplomica.de, Hamburg 2009
I
Inhaltsverzeichnis
INHALTSVERZEICHNIS ...I
ABBILDUNGSVERZEICHNINS ... V
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS ... VI
1 EINLEITUNG ...1
1.1
Problemstellung...1
1.2
Gang der Untersuchung ...4
2 DIE MANAGEMENT-HOLDING ALS HANDLUNGSFELD DES
KONZERN- AUFSICHTSRATS ...7
2.1
Der rechtliche Konzernbegriff ...7
2.2
Der betriebswirtschaftliche Konzernbegriff ...10
2.3
Formen der Konzernorganisation ...11
2.3.1
Stammhauskonzern ...11
2.3.2
Holding-Konzern ...12
2.4
Finanz-Holding ...13
2.5
Management-Holding ...14
3 DER KONZERN-AUFSICHTSRAT UND RISIKOMANAGEMENT...16
3.1
Der Konzern-Aufsichtsrat der Management-Holding im dualistischen
System der Unternehmensverfassung ...16
3.2
Die zentrale Überwachungsnorm des § 111 Abs. 1 AktG ...19
3.3
Abgrenzung des Überwachungsumfangs durch § 90 AktG ...22
3.4
Neue regulatorische Rahmenbedingungen als Basis für die
Überwachung des Risikomanagement-(Systems) durch den Konzern-
Aufsichtsrat der Management-Holding ...26
3.4.1
KonTrag ( 01.05.1998)...26
3.4.1.1
Gesteigerte Risikoorientierung im Konzern ...27
3.4.1.2
Aufsichtsratsüberwachung im Lichte des KonTrag ...28
3.4.1.3
Die Überwachung des Abschlussprüfers im Lichte des KonTrag
29
Inhaltsverzeichnis
II
3.4.1.4
Zusammenspiel von Aufsichtsrat und Abschlußprüfer im Lichte
des KonTrag...30
3.4.2
Exkurs: Risikomanagement nach §§ 76 Abs. 1, 93 Abs. 1 AktG ...31
3.4.3
TransPug (26.07.2002) ...31
3.4.3.1
Zusätzliche Anforderungen für die Berichterstattung an den
Aufsichtsrat ...32
3.4.3.2
Zwingender Katalog zustimmungspflichtiger Geschäfte ...33
3.4.4
DCGK (26.07.2002) ...33
3.4.5
Auswirkungen auf die Aufsichtsratspraxis...35
3.4.5.1
Zusammenwirken von Vorstand und Aufsichtsrat (DCGK) ...35
3.4.5.2
Vorstand (DCGK)...36
3.4.5.3
Aufsichtsrat (DCGK) ...36
3.4.6
Bilanzrechtsreformgesetz (BilReg) 10.12.2004...37
3.4.7
Auswirkungen auf die Aufsichtsratspraxis...38
3.4.8
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMog) ...38
3.4.8.1
Der Risikomanagementbericht nach dem BilMoG ...39
3.4.8.2
Auswirkungen auf die Aufsichtsratspraxis ...39
3.5
Die Haftung des Konzern-Aufsichtsrats durch eine Pflichtverletzung bei
der Überwachung des Risikomanagement-(Systems) ...41
3.5.1
Haftungsgrundlage ...41
3.5.2
Pflichtverletzung des Konzern-Aufsichtsrats...41
4 DAS RISIKOMANAGEMENTSYSTEM ALS
ÜBERWACHUNGSGEGENSTAND UND INFORMATIONSBASIS ...44
4.1
Definition des Risikobegriffs ...44
4.2
Gesetzliche Rahmenbedingung ...45
4.3
Komponenten des Risikomanagementsystem ...47
4.3.1
Frühaufklärungssystem...47
4.3.2
Konzern-Controlling ...48
4.3.3
Internes Überwachungssystem (IÜS) ...51
4.3.3.1
Organisatorische Sicherungsmaßnahmen...52
4.3.3.2
Interne Kontrollen ...52
4.3.3.3
Interne Konzern-Revision ...53
4.3.4
Ziele des Risikomanagements...54
4.3.4.1
Risikomanagement-Prozess ...55
4.3.4.1.1
Risikoidentifizierung ...56
Inhaltsverzeichnis
III
4.3.4.1.2
Risikoanalyse-Risikobewertung...56
4.3.4.1.3
Risikosteuerung...57
4.3.4.1.4
Risikoüberwachung ...58
4.3.4.1.5
Prozessüberwachung...58
4.3.4.2
Risikomanagement-Organisation...58
4.3.4.3
Risikopolitische Grundsätze - Risikomanagement
Dokumentation ...59
5 DIE PRÜFUNG DER LEISTUNGSFÄHIGKEIT DES
RISIKOMANAGEMENTSYSTEMS DURCH DEN KONZERN-
AUFSICHTSRAT...62
5.1
Überwachungspflichten des Konzern-Aufsichtsrats mit Blickrichtung auf
das Risikomanagementsystem...62
5.2
Die Informationsmöglichkeiten des Konzern-Aufsichtsrats im Hinblick auf
das Risikomanagementsystem Der Konzern-Abschlussprüfer als
Erfüllungsgehilfe...64
5.2.1
Bericht über das Risikomanagementsystem...64
5.2.1.1
Berichtspflicht aus § 91 Abs. 2 AktG...64
5.2.1.2
Konkretisierung der Informationspflichten durch den Erlass einer
Informationsordnung ...66
5.2.2
Der Konzern-Abschlussprüfer als Informationslieferant bzw.
Erfüllungsgehilfe ...67
5.2.2.1
Prüfung des Risikofrüherkennungs- und Überwachungssystem
nach § 317 Abs. 4 HGB ...67
5.2.2.1.1
Erfassung des installierten Systems...69
5.2.2.1.2
Beurteilung der Eignung des Systems ...69
5.2.2.1.3
Prüfung der Wirksamkeit des Systems...70
5.2.2.2
Prüfungsbericht nach § 321 Abs. 4 AktG...70
5.2.2.3
Mündliche Berichterstattung im Rahmen der Bilanzsitzung ...71
5.2.3
Weitere Möglichkeiten der Informationsbeschaffung durch den
Konzern-Aufsichtsrat ...72
5.2.3.1
Die Möglichkeit einer aktiven Informationsbeschaffung in der
Management-Holding nach § 111 Abs. 2 AktG ...72
5.2.3.1.1
Zur Informationsbeschaffung in der Holding...72
5.2.3.1.2
Zur Informationsbeschaffung in den
Tochtergesellschaften ...73
5.2.3.2
Die Möglichkeit einer aktiven Informationsbeschaffung gemäß §
Inhaltsverzeichnis
IV
90 Abs.3 AktG (Anforderungsbericht) in der Holding und den
Tochtergesellschaften ...74
5.3
Einwirkungsmöglichkeiten des Konzern-Aufsichtsrats bei Feststellung
von Mängeln beim Risikomanagementsystem ...74
6 DIE STRATEGISCHE PLANUNG IM FOKUS EINER
RISIKOORIENTIERTEN ÜBERWACHUNG DURCH DEN KONZERN-
AUFSICHTSRATS ...77
6.1
Notwendigkeit der Kontrolle strategischer Pläne ...77
6.2
Abgrenzung zwischen traditioneller und strategischer Kontrolle ...80
6.3
Elemente eines strategischen Kontroll- und Informationssystems für den
Konzern-Aufsichtsrat ...82
6.3.1
Strategische Prämissenkontrolle ...84
6.3.2
Strategische Durchführungskontrolle...87
6.3.3
Strategische Überwachung...92
6.4
Einwirkungsmöglichkeiten auf die Risikopositionierung der Management-
Holding durch den Konzern-Aufsichtsrat ...94
6.4.1
Die Beratung als präventives Überwachungsinstrument ...94
6.4.2
Der Zustimmungsvorbehalt als präventives Überwachungs-
instrument ...96
6.4.2.1
Der ,,Zustimmungsvorbehalt" nach § 111 Abs. 4 S. 2 AktG ...96
6.4.2.2
Zustimmungsvorbehalte des Konzern-Aufsichtsrats...98
7 SCHLUSSBETRACHTUNG ...100
ANHANG ...105
GESETZE UND NORMEN ZUM RISIKOMANAGEMENT DIE IMPLIZIT
ODER EXPLIZIT DEN AUFSICHTSRAT BETREFFEN...105
LITERATURVERZEICHNIS...107
Abbildungsverzeichnins
V
Abbildungsverzeichnins
Abb. 2.1: Organisationsschema der Konzernformen ...10
Abb. 3.1: Abschnitte des DCGK...34
Abb. 4.1: (Konzern-)Risikomanagementsystem...46
Abb. 4.2: Risk-Map in der Tochtergesellschaft ...51
Abb. 4.3: Risikomanagement-Prozess...56
Abb. 5.1: Prüfungsumfang des Abschlussprüfers und Aufsichtsrats...68
Abb. 5.2: Maßnahmen nach § 91 Abs. 2 AktG als Prüfungsstandard ...69
Abb. 6.1: Vergleich von traditioneller und strategischer Kontrolle ...81
Abb. 6.2: Strategische Kontrolle im strategischen Prozess...83
Abb. 6.3: Prioriesierung der Prämissen anhand eines Prämissenportfolios...86
Abb. 6.4: Perspektiven und Fragestellung der Balanced Scorecard ...90
Abb. 6.5: Beispielhafte Perspektive der Balanced Scorecard ...91
Abkürzungsverzeichnis
VI
Abkürzungsverzeichnis
Abb
Abbildung
Abs
Absatz
AG
Aktiengesellschaft
AktG
Aktiengesetz
Art
Artikel
BGH
Bundesgerichtshof
BilMoG
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz
BilReG
Bilanzrechtsreformgesetz
BSC
Balanced Scorecard
BR-Drs.
Bundesrats-Drucksache
BT-Drs.
Bundestags-Drucksache
bzw.
beziehungsweise
DCGK
Deutscher Corporate Governance Kodex
d.h.
das heißt
DRS
Deutscher Rechnungslegungsstandard
EDV
Elektronische Datenverarbeitung
etc.
et cetera
eing.
Eingegangene
HGB
Handelsgesetzbuch
i.e.S.
im engsten Sinn
IDW
Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.
IDW PS
IDW Prüfungsstandard
IFRS
International Financial Reporting Standards
i.S.d
im Sinne des
i.V.m.
in Verbindung mit
i.w.S.
im weiteren Sinne
IÜS
internes Überwachungssystem
KonTraG
Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich
Reg-E
Regierungsentwurf
RM
Risikomanagement
RMS
Risikomanagementsystem
sog.
so genannt
TransPuG
Transparenz- und Publizitätsgesetz
UBS
Union de Banques Suisses
1 Einleitung
1
1 Einleitung
1.1
Problemstellung
Aufgrund der weltweiten Verflechtung der Wirtschaftsräume und der daraus
resultierenden Expansion der Kapitalmärkte von nationalen zu international fi-
nanzierten Publikumsgesellschaften ist eine für die Anleger effiziente und zu-
verlässige Leitungs- und Überwachungsstruktur
1
in den Unternehmen unver-
zichtbar. Auch die Globalisierung des Wettbewerbs und die stetig wachsende
Internationalisierung verlangen zur langfristigen Existenzsicherung der Unter-
nehmen eine leistungsfähige Struktur des Risikomanagement-(Systems). Die
Unternehmenskrisen in der Vergangenheit (wie z.B. Metallgesellschaft AG, En-
ron, Philipp Holzmann AG, Bremer Vulkan Verbund AG und Balsam AG) und
die durch die aktuelle Finanzkrise ausgelöste Schieflage der Großbanken (wie
z.B. UBS, Citigroup Inc, JP Morgen Chase und Commerzbank) erwecken je-
doch den Eindruck, dass die bestehenden Strukturen in der Leitung und Über-
wachung sowie die Risikomanagementsysteme in den Unternehmen erhebliche
Defizite aufweisen.
Die Unternehmenskrisen in der Vergangenheit führten vor allem zu einer Dis-
kussion mit Blickrichtung auf eine verantwortungsvolle Unternehmensführung
und -überwachung. Diese wurde insbesondere in den USA unter dem Begriff
,,Corporate Governance" geführt. Die Diskussion erreichte kurze Zeit danach
auch den deutschen Raum,
2
wobei insbesondere die Überwachung des ge-
schäftsführenden Organs im Fokus stand. Die gesetzgeberische Instanz rea-
gierte auf die zunehmende Kritik am deutschen System der Corporate Gover-
nance
3
mit der Verabschiedung eines Kontroll- und Transparenzgesetzes, das
am ersten Mai 1998 in Kraft getreten ist. Das KonTrag bildete jedoch nur den
Anfang und weitere gesetzgeberische Reformschritte (u.a. DCGK, TransPuG,
BilReG, BilMoG) folgten im Zuge der Diskussion. Durch die Reformierung der
Überwachung des Vorstands durch den Aufsichtsrat erhofft sich der Gesetzge-
1
Die Verwaltungsorgane der Aktiengesellschaft sind der Vorstand und Aufsichtsrat. Die Lei-
tungs- und Überwachungsstruktur der Aktiengesellschaft ist damit als dualistisches Verwal-
tungssystem angelegt, bei dem die Geschäftsführung und die Überwachung streng von ein-
ander getrennt sind. Siehe K.3.1.
2
Vgl. Diederichs/Kißler (2008), S.1.
3
Ringleb/Kremer/Lutter/v. Werder (2008
)
, S.13: ,,Corporate Governance bezeichnet den rechtli-
chen und faktischen Ordnungsrahmen für die Leitung und Überwachung eines Unterneh-
mens."
1 Einleitung
2
ber vor allem einen Effizienzgewinn der deutschen Corporate Governance
Struktur. Im Rahmen der Beziehung zwischen den beiden Organen ist nämlich
eine deutliche Informationsasymmetrie festzustellen.
4
Da jedoch die Effizienz
der Aufsichtsratsüberwachung hauptsächlich durch die Informationsversorgung
determiniert ist, musste der Gesetzgeber deren Verbesserung ins Zentrum sei-
ner Reformschritte stellen.
5
Die Verantwortung, ein angemessenes Risikomanagementsystem in einer Akti-
engesellschaft zu installieren, trägt der Vorstand. Dessen Pflichten diesbezüg-
lich präzisiert, als Folge des KonTraG, der § 91 Abs. 2 AktG. Demnach hat der
Vorstand ,,geeignete Maßnahmen zu treffen, insbesondere ein Überwachungs-
system einzurichten, damit den Fortbestand der Gesellschaft gefährdende Ent-
wicklungen früh erkannt werden".
6
Die Einrichtung eines Risikomanagementsys-
tems zählt zu den originären Aufgaben des Vorstands und ist damit vom Auf-
sichtsrat nach § 111 AktG zu überwachen.
7
Demnach hat der Aufsichtsrat zu
prüfen, ob der Vorstand ein leistungsfähiges Risikomanagementsystem instal-
liert hat. Bei börsennotierten Aktiengesellschaften ist das Risikomanagement-
system zwingend in die Prüfung des Jahresabschlusses durch den Abschluss-
prüfer mit aufzunehmen.
8
Er prüft das Risikomanagementsystem nach § 317
Abs. 4 HGB und hat seine Ergebnisse gemäß § 321 Abs. 4 AktG in einem ge-
sonderten Teil des Prüfungsberichts dem Aufsichtsrat zukommen zu lassen.
9
Die Überwachungsaufträge des Aufsichtsrats und des Abschlussprüfers unter-
scheiden sich jedoch in ihrem Umfang, so dass die Informationsversorgung hin-
sichtlich des Risikomanagementsystems für den Aufsichtsrat allein durch den
Prüfungsbericht nicht gedeckt werden kann.
Das Problem bei der Überwachung des Risikomanagementsystems durch den
4
Die Informationsasymmetrie ist vor allem auf das Prinzipal-Agent-Problem zurückzuführen.
Schmidt/Theilen bezeichnen die Prinzipal-Agent-Beziehung als ,,Situation, in denen ein Wirt-
schaftssubjekt (der Agent) beauftragt wird, im Interesse von einem oder einer Gruppe anderer
Wirtschaftssubjekte (der Prinzipal) Entscheidungen zu treffen und Handlungen durchzufüh-
ren." Schmidt/Theilen (1995), S.483
Der Aufsichtsrat, der die Interessen der Aktionäre vertritt, nimmt die Rolle des Prinzipals ein
und der Vorstand die des Agenten. Ausführlich zur Prinzipal-Agent-Problem im Zusammen-
hang mit dem Aufsichtsrat Grothe (2006), S.70ff. und in Grundzügen Diederichs/Kißler (2008),
S. 23ff.
5
Siehe zu den einzelnen Reformschritten K.3.4.
6
Vgl. § 91 Abs. 2 AktG
7
Vgl. Lutter/Krieger (2008), S.26.
8
Vgl. Theisen (2000), S.295; Schindler/Rabenhorst (2001), S.161
9
Vgl. Gernoth (2001), S. 304.
1 Einleitung
3
Aufsichtsrat ergibt sich hauptsächlich aus einem Informationsdefizit,
10
das ur-
sächlich aus dem dualistischen System der Unternehmensverfassung und der
mangelnden gesetzlichen Kodifizierung einer angemessenen Aufsichtsrats-
Informationsversorgung hinsichtlich des Risikomanagementsystems resultiert.
In diesem Zusammenhang stellen sich folgende drei Fragen:
·
Welche Überwachungsinformationen benötigt der Aufsichtsrat?
·
Woher kriegt der Aufsichtsrat die relevanten Informationen?
·
Wie kann sich der Aufsichtsrat die nötigen Informationen aktiv selbst be-
schaffen?
Der Überwachungsauftrag des Aufsichtsrats nach § 111 AktG ist nicht aus-
schließlich vergangenheitsorientiert, sondern er ist vielmehr zukunftsorientiert
wahrzunehmen. Wichtigstes Bezugsobjekt einer in die Zukunft gerichteten
Überwachung bildet die strategische Planung des Vorstands. Hier werden stra-
tegische Entscheidungen getroffen, die die Ertragsaussichten und Risikoexposi-
tion des Unternehmens über einen längeren Zeitraum festlegen. Für die pro-
spektive Überwachung und die Beurteilung der künftigen Geschäftsentwicklung
stellt die strategische Planung einen unverzichtbaren Bestandteil dar und ist
folglich mit dem Aufsichtsrat abzustimmen. Diese Beratung zählt daher neben
der reinen Überwachung auch zum Aufgabenfeld des Aufsichtsrats.
11
Dies imp-
liziert, dass sich die Aufsichtsratüberwachung neu auszurichten hat und dieser
sich intensiv mit den Planungsprämissen und Risiken, die den strategischen
Entscheidungen zugrunde liegen, zu beschäftigen hat.
12
Die für die Beratung
notwendige Informationenversorgung stellt für den Aufsichtsrat eines der
Hauptprobleme dar. Aufgrund der immanenten Bedeutung der strategischen
Entscheidungen für den Unternehmenserfolg und der Prognoseungewissheit
deren Auswirkungen ist jedoch eine durchgängige Transparenz über alle we-
sentlichen Risiken für den Aufsichtsrat zwingend notwendig.
Die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit ist es aufzuzeigen, das sich der Auf-
sichtsrat im Rahmen seines Überwachungsauftrags gemäß § 111 AktG mit dem
Risikomanagement in zweierlei Hinsicht zu beschäftigen hat: Zum einen mit der
10
Vgl. Salzberger (2000), S.760; Gernoth (2001), S. 299.
11
Vgl. Diederichs/Kißler (2008), S.101.
12
Vgl. Scheffler (2004), S. 107.
1 Einleitung
4
Prüfung des Risikomanagementsystems und zum anderen mit den Risikoinfor-
mationen, die ihm das System liefert, damit er seinen strategischen Beratungs-
funktionen nachkommen kann.
Im Rahmen der Prüfung des Risikomanagementsystems werden die weiter
oben vorgestellten Fragen aufgegriffen und die Möglichkeiten des Aufsichtsrats
hinsichtlich seiner Informationsbeschaffung herausgearbeitet. Hierbei wird auf-
gezeigt, welche Informationen er benötigt, um das System zu überprüfen, wer
ihn dabei unterstützt und wie er sich die Informationen aktiv selbst beschaffen
kann.
Hinsichtlich der Risikoinformationen, die der Aufsichtsrat für eine prospektive
Überwachung benötigt, wird ein strategisches Kontroll- und Informationskonzept
dargestellt, das ihm ermöglicht, seine Überwachung planungsbegleitend auszu-
führen und sich die wesentlichen Planungsprämissen und Risiken berichten zu
lassen.
Des Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass die Untersuchung aus der Sicht des
Konzern-Aufsichtsrats einer Management-Holding erfolgt. Dies geschieht im
Interesse einer möglichst hohen Relevanz für die Praxis.
1.2
Gang der Untersuchung
Im Anschluss an die Beschreibung der Problemstellung wird im Rahmen des
zweiten Kapitels die Management-Holding als Handlungsfeld des Konzern-
Aufsichtsrats mit ihren wesentliche Determinanten und Besonderheiten vorge-
stellt. In einem ersten Schritt werden dazu der rechtliche und betriebswirtschaft-
liche Konzernbegriff vorgestellt, um eine klare Abgrenzung des Konzerns vor-
nehmen zu können. In einem zweiten Schritt erfolgt dann eine Unterscheidung
des Stammhaus- und Holdingkonzerns, wobei für den letztgenannten noch eine
Differenzierung in Finanzholding und Management-Holding ausgeführt wird.
Das dritte Kapitel verdeutlicht einleitend, wie die Leitungs- und Überwachungs-
struktur im dualistischen System der Unternehmensverfassung angelegt ist. Mit
der Beschreibung der zentralen Überwachungsnorm (§111 Abs. 1 AktG) und
der Darstellung der Vorstandsberichte (§ 90 AktG) wird anschließend der Über-
wachungsauftrag und umfang des Konzern-Aufsichtsrats dargestellt. Danach
1 Einleitung
5
werden die neuen gesetzlichen Reformschritte aufgeführt, die die Aufsichtsrats-
überwachung seit den Neunzigerjahren tangiert haben. Hierbei soll verdeutlicht
werden, dass sich der Aufsichtsrat im Rahmen seines Überwachungsauftrags
zum einen mit Informationen bezüglich des Risikomanagementsystems und
zum anderen mit Informationen hinsichtlich der Risikolage des Unternehmens
bzw. Konzerns zu beschäftigen hat. Das Kapitel schließt mit der Haftung des
Konzern-Aufsichtsrats bei einer Pflichtverletzung im Hinblick auf die Überwa-
chung des Risikomanagement-(Systems).
Im vierten Kapitel wird ein Risikomanagementsystem als Überwachungsge-
genstand und Informationsbasis des Konzern-Aufsichtsrats vorgestellt. Hierzu
wird zuerst der Risikobegriff eingegrenzt und der § 91 Abs. 2 AktG als Anknüp-
fungspunkt für die Einrichtung des Systems erörtert. Auf diesen Grundlagen
werden dann die einzelnen Komponenten, die das Risikomanagementsystem
konstituieren, dargestellt. Im Folgenden werden die Ziele des Risikomanage-
ments, der Risikomanagement-Prozess, Organisation des Risikomanagements
sowie die risikopolitischen Grundsätze und Risiko-Dokumentation näher erläu-
tert.
In einem fünften Kapitel wird die Prüfung des Risikomanagementsystems durch
den Konzern-Aufsichtsrat beschrieben. Es wird zuerst die Überwachungspflicht
des Konzern-Aufsichtsrats herausgearbeitet und im Anschluss schwerpunkt-
mäßig seine Informationsmöglichkeiten vorgestellt. Einen besonderen Fokus
erhalten hierbei die Unterstützungsfunktion des Konzern-Abschlussprüfers und
die aktiven Informationsmöglichkeiten des Konzern-Aufsichtsrats sowohl in der
Holding als auch in den Tochtergesellschaften. Weiterhin werden im Rahmen
des Kapitels die unterschiedlichen Prüfungsumfänge des Aufsichtsrats und des
Abschlussprüfers aufgezeigt. Abschließend werden dann die Einwirkungsmög-
lichkeiten des Überwachungsorgans bei Feststellung von Mängeln beim Risi-
komanagementsystem beleuchtet.
Im Mittelpunkt des sechsten Kapitels steht die Vorstellung eines strategischen
Kontroll- und Informationssystems für den Konzern-Aufsichtsrat. In diesem Zu-
sammenhang werden die Notwendigkeit zur Kontrolle der strategischen Pla-
nung und eine Abgrenzung zwischen der traditionellen und strategischen Kon-
trolle herausgearbeitet. Anschließend werden die einzelnen Elemente des Sys-
tems, unter Rückgriff eines Prämissenportfolios und der Balanced Scorecard,
1 Einleitung
6
die die wesentlichen Informationen für den Konzern-Aufsichtsrat visualisieren,
vorgestellt. Die Beratung und der Zustimmungsvorbehalt als präventives Über-
wachungsinstrument, um Einfluss auf die Risikopositionierung der Manage-
ment-Holding zu nehmen, sind die Themen, die im letzten Teil des Kapitels be-
handelt werden.
Das abschließende siebte Kapitel fasst die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit
zusammen.
2 Die Management-Holding als Handlungsfeld des Konzern- Aufsichtsrats
7
2 Die Management-Holding als Handlungsfeld des Konzern-
Aufsichtsrats
Ziel dieses Kapitels ist es, die Management-Holding mit ihren wesentlichen De-
terminanten und speziellen Eigenschaften vorzustellen sowie sie in die mögli-
chen Konzernorganisationsformen einzuordnen. Grund hierfür sind die Beson-
derheiten, die sich für den Konzern-Aufsichtsrat im Hinblick auf die Überwa-
chung des Holding-Vorstands und damit in Konsequenz auch für die Prüfung
des Risikomanagementsystems aus einer dezentralen Führungsstruktur erge-
ben.
13
Um der Zielsetzung zu folgen und um eine exakte Abgrenzung des Konzerns
vornehmen zu können, wird daher in einem ersten Teil der rechtliche und be-
triebswirtschaftliche Konzernbegriff vorgestellt. Der zweite Teil stellt daraufhin
die möglichen Formen einer Konzernorganisation vor, während ein dritter Teil
die Finanzholding beschreibt. Im Mittelpunkt des Kapitals steht der vierte Teil, in
dem die Management-Holding vorgestellt wird.
2.1
Der rechtliche Konzernbegriff
Die zunehmende Konzernierung von Aktiengesellschaften und die damit ein-
hergegangenen Probleme zwangen die gesetzgeberische Instanz, den rechtli-
chen Rahmen zu optimieren und die betreffenden Objekte wie die beherrschten
Gesellschaften, Gesellschafter, Gläubiger und Aktionäre zu schützen. Der Ge-
setzgeber verabschiedete daraufhin das Aktiengesetz (§§ 15-22 AktG und §§
291-337 AktG) von 1965, in dem das Recht der ,,Verbundenen Unternehmen"
geregelt wurde.
14
Unter Verbundene Unternehmen werden rechtlich selbständige Unternehmen,
die Mitglied von Unternehmensverbindungen sind, verstanden. Die verschiede-
nen Formen der verbunden Unternehmen werden durch die §§15-19 AktG fol-
gendermaßen untergliedert
15
:
·
In Mehrheitsbesitz stehende und mit Mehrheit beteiligte Unternehmen (§
13
Hierzu allgemein zur Überwachung siehe K. 3.1 u. 3.2.; Im speziellen zur Prüfung des RMS
siehe K. 5.
14
Vgl. Mayer (1999), S. 20.; Scheffler (2005), S.3.
15
Vgl. Scheffler (2005), S.4; Theisen (2000), S.29; Hoffmann (1993), S.6.
2 Die Management-Holding als Handlungsfeld des Konzern- Aufsichtsrats
8
16 AktG)
·
Abhängige und herrschende Unternehmen (§ 17 AktG)
·
Konzernunternehmen (§ 18 AktG)
·
Wechselseitig beteiligte Unternehmen (§ 19 AktG)
Der Konzern und die Konzernunternehmen
16
sind die wohl wichtigste Gruppe
innerhalb der in den §§15-19 AktG definierten Formen von verbundenen Unter-
nehmen. Der Konzernbegriff, der juristischen Ursprungs ist, wird durch die
schon oben erwähnten §§ 15-22 und §§ 291-337 AktG geregelt. Der Tatbe-
stand des Konzerns gilt nach den rechtlichen Vorschriften des § 18 AktG als
erfüllt, wenn ein herrschendes und ein oder mehrere abhängige Unternehmen
unter der einheitlichen Leitung des herrschenden Unternehmens zusammenge-
fasst sind.
17
Hoffmann betont in diesem Zusammenhang, dass ,,demnach die
Zusammenfassung rechtlich selbständiger Unternehmen unter einheitlicher Lei-
tung"
18
das konstituierende Merkmal eines Konzerns ist. Während die rechtliche
Selbstständigkeit als Tatbestandsmerkmal in der Regel ohne Zweifel nachprüf-
bar ist, bedarf es einer Konkretisierung bezüglich des Begriffs der einheitlichen
Leitung. Diese wird vom Gesetzgeber in § 18 AktG bewusst nicht zur Verfügung
gestellt. Denn unter der Bedingung, dass es eine Vielzahl von Alternativen gibt,
Konzernbeziehungen zu gestalten, ist eine Operationalisierung des Begriffs der
einheitlichen Leitung äußerst problembehaftet.
19
Stattdessen tritt die durch den
Gesetzgeber geschaffene Konzernvermutung in Erscheinung
20
:
·
Nach § 18 I (2) AktG sind Unternehmen als unwiderlegbar unter einheitli-
cher Leitung zusammengefasst und somit als Konzern anzusehen, wenn
zwischen ihnen ein Beherrschungsvertrag nach § 291 AktG vorliegt, oder
wenn eines der Unternehmen in das andere nach § 319 AktG eingeglie-
dert ist.
·
Wird durch ein herrschendes Unternehmen unmittelbar oder mittelbar auf
ein anderes Unternehmen ein beherrschender Einfluss ausgeübt, liegt
16
Konzernunternehmen und Tochtergesellschaften werden synonym verwendet.
17
Vgl. § 18 AktG.
18
Hoffmann (1993), S. 6.
19
Vgl. Theisen (2000), S.34.
20
Vgl. Mayer (1999), S. 20.
2 Die Management-Holding als Handlungsfeld des Konzern- Aufsichtsrats
9
nach § 17 I AktG ein Abhängigkeitsverhältnis vor. Liegt dieser Tatbe-
stand zwischen zwei rechtlich selbständigen Unternehmen vor, so ist
nach § 18 I (3) AktG als widerlegbare Vermutung anzunehmen, dass das
abhängige mit dem herrschenden Unternehmen ein Konzern bildet.
Im Bezug auf die Konzernbildung und die daraus entstehenden Verhältnisse
zwischen Konzernzentrale und Konzernunternehmen unterscheidet man aus
organisatorischem Blickwinkel den Unterordnungs- und Gleichordnungskon-
zern
21
.
Beim Gleichordnungskonzern (§ 18 II AktG), der relativ selten in der Konzern-
welt anzutreffen ist, haben die Konzernunternehmen eine gleichrangige Stel-
lung bzw. es fehlt eine einseitige Abhängigkeit eines Konzernunternehmens. In
diesem Fall wird jedoch das konstitutive Merkmal eines Konzernverhältnisses
verletzt. Es fehlt die Zusammenfassung der Konzernunternehmen unter der
einheitlichen Leitung. Aus diesem Grund erfolgt die einheitliche Leitung auf Ver-
tragsbasis durch ein Gemeinschaftsorgan oder durch eine andere personelle
Verflechtung der Vorstände der involvierten Gesellschaften.
22
Steht an der Spitze des Konzerns eine Obergesellschaft, die die einheitliche
Leitung durch beherrschenden Einfluss gegenüber einem oder mehreren ab-
hängigen Konzernunternehmen ausübt, dann handelt es sich um einen Unter-
ordnungskonzern (§ 18 I AktG)
23
. Die einheitliche Leitung kann hier zum einen
aufgrund vertraglicher Basis (sog. Vertragskonzern) oder zum anderen allein
aufgrund ihrer Mehrheitsbeteiligung oder anderer faktischer Verhältnisse (sog.
faktischer Konzern) erfolgen
24
. Der Eingliederungskonzern (§ 319 AktG) ent-
steht bei der Eingliederung einer Aktiengesellschaft in eine andere und ist aus
juristischem Blickwinkel zwischen Beherrschungsvertrag und Fusion einzustu-
fen.
25
Theisen betont in diesem Zusammenhang, dass die Eingliederung ,,im
wirtschaftlichen Ergebnis der Verschmelzung nahe kommt".
26
Zu den verschie-
den Formen siehe auch Abb. 2.1.
21
Vgl. Theisen (1991), S. 75.; Hüllmann (2003), S.9.
22
Vgl. Scheffler (2005), S. 6.; Theisen (2000), S.41; Hoffmann (1993), S.7.
23
Vgl. Hoffmann (1993), S. 7.; Mayer (1999), S. 21.
24
Vgl. Scheffler (2005), S. 6.; Hoffmann (1993), S.7.
25
Vgl. §§ 319-327 AktG
26
Theisen (2000), S.43; Auch so Hüllmann (2003), S.11.
2 Die Management-Holding als Handlungsfeld des Konzern- Aufsichtsrats
10
Abb. 2.1: Organisationsschema der Konzernformen
27
2.2
Der betriebswirtschaftliche Konzernbegriff
In der betriebswirtschaftlichen Literatur existiert eine große und vielschichtige
Anzahl von Abgrenzungen des Konzernbegriffs
28
. Die Konzernbetrachtung aus
betriebswirtschaftlicher Sicht ist nicht als Alternative zur rechtlichen Interpretati-
on des Konzerns zu sehen, sondern stellt dem rechtlichen Begriff eine Sicht des
Konzerns als Organisationsform gegenüber und stellt somit einen gegensätzli-
chen Aspekt dar. Im Gegensatz zum juristischen Konzernverständnis ist der
Konzern nicht nur durch die rechtliche Selbstständigkeit der Konzernunterneh-
men und durch die Integrationskraft der einheitlichen Leitung charakterisiert,
sondern der Konzern als gesamte wirtschaftliche Entscheidungs- und Hand-
lungseinheit steht im Fokus der Betrachtung
29
. So grenzt Starck den Konzern ab
als ,,eine Gruppe rechtlich selbständiger Unternehmen, von denen eines die
legale Macht besitzt, die anderen Unternehmen der Gruppe in ihrer Geschäfts-
führung in umfassender und dauerhafter Weise seinen Willen unterzuordnen".
30
Auch interessant in diesem Zusammenhang ist die Abgrenzung von Schmalen-
bach aus dem Jahre 1937, weil sie schon damals im Rahmen der Auseinander-
setzung mit dem Konzern den zentralen betriebswirtschaftlichen Ansatzpunkt
beschreibt. Demnach stellt der Konzern ,,eine durch Beherrschung zusammen-
gehaltene Wirtschaftsgemeinschaft einer größeren Zahl von Unternehmun-
27
Entnommen aus Hüllmann (2003), S.9.
28
Vgl. Theisen (1991), S.19.
29
Vgl. Hoffmann (1993), S. 8.; Scheffler (2005), S.1.
30
Starck (1970), S. 10.
Konzern
Unterordnungskonzern
(§ 18 I AktG)
Gleichordnungskonzern
(§ 18 II AktG)
Eingliederungskonzern
(§ 18 I 2 AktG)
Vertragskonzern
(§ 18 I 2 AktG)
Faktischer Konzern
(§ 18 I 3 AktG)
2 Die Management-Holding als Handlungsfeld des Konzern- Aufsichtsrats
11
gen"
31
dar.
Theisen, der sich ausführlich in der Betriebswirtschaftslehre mit dem Konzern
befasst, beschreibt folgende Charakteristika, die die betriebswirtschaftlichen
Hauptmerkmale eines Konzerns kennzeichnen
32
:
·
Der Konzern stellt eine Einheit wirtschaftlicher Entscheidungen und
Handlungen dar,
·
die rechtliche Selbstständigkeit der einzelnen Tochtergesellschaften
bleibt im Konzern bestehen,
·
die Gesamtheit der Konzernunternehmen und betriebe steht unter ein-
heitlicher Leitung und
·
die Geschäftsführung der einzelnen Tochtergesellschaften ist in ihrer un-
ternehmerischen Entscheidungsfreiheit eingeschränkt.
Unter Rückgriff der Hauptmerkmale kann daher die Konzernunternehmung als
,,eine autonome Entscheidungs- und Handlungseinheit, die mehrere juristische
selbständige wie unselbstständige Unternehmen und Betriebe umfasst, die als
wirtschaftliche Einheit in personeller, institutioneller und / oder funktioneller Hin-
sicht zeitlich befristet oder auf Dauer im Rahmen entsprechender Planungen
ein gemeinsames wirtschaftliches Ziel verfolgen",
33
abgegrenzt werden.
Der vorangestellte Konzernbegriff bildet die begriffliche Grundlage der nachfol-
genden Ausführungen.
2.3
Formen der Konzernorganisation
2.3.1 Stammhauskonzern
Deutsche Großunternehmen waren bis vor kurzem mehrheitlich in der Organi-
sationsform des Stammhauskonzerns konzerniert, z.B. VW AG und Bayer AG.
Der Stammhauskonzern
34
lässt sich in den Worten von Hoffmann wie folgt ab-
grenzen: ,,Eine Konzernorganisationsform in Form eines Stammhauskonzerns
liegt dann vor, wenn die Spitzeneinheit selbst ,,operativ" am Markt tätig ist, sie
31
Schmalenbach (1937), S. 129.
32
Vgl. Hüllmann (2003), S. 14; Theisen (2000), S. 15.
33
Theisen (2000), S. 18.
34
Ausführlich zum Stammhauskonzern siehe Keller (1990), S. 139-145.
2 Die Management-Holding als Handlungsfeld des Konzern- Aufsichtsrats
12
also Produkte oder/und Dienstleistungen für externe Marktpartner erbringt"
35
.
Das vorrangige Unternehmensziel eines Stammhauskonzerns ist das eigenun-
ternehmerische Auftreten der Obergesellschaft am Markt. Die Tochtergesell-
schaften sind meistens kleinere Unternehmen, die in der Regel das Leistungs-
programm des Konzerngeschäftes in den vor- oder nachgelagerten Produkti-
onsstufen unterstützen. Hieraus resultiert, neben der rechtlichen, nun auch die
wirtschaftliche Abhängigkeit der Tochtergesellschaften vom Stammhaus bzw.
der Spitzeneinheit.
36
Die fehlende Aufspaltung zwischen der Führung des Stammhauses und dem
Gesamtkonzern führt zu einer Doppelfunktion der Konzernleitung, woraufhin
Entscheidungen zentralisiert werden und komplexe Koordinationsmaßnahmen
erforderlich werden.
37
Das Stammhaus grenzt sich von der Holding neben den operativen Aktivitäten
der Obergesellschaft durch eine Konzentration auf das Kerngeschäft ab.
Nachteile des Stammhauskonzerns resultieren aus der Entscheidungszentrali-
sation, die sich z.B. durch Inflexibilität und verlangsamte Reaktionsfähigkeit des
Konzerns äußert.
38
2.3.2 Holding-Konzern
Mit dem Begriff der ,,Holding" tun sich die Juristen schwer, denn er ist weder
gesetzlich abgegrenzt, noch findet er in der juristischen Literatur einheitliche
Verwendung. Daraufhin formuliert Lutter, ,,die Holding ist nicht als juristische
Sonderform zu begreifen, sondern als eine praktische Organisationsstruktur".
39
Abgeleitet werden kann der Holdingbegriff von dem englischen Verb ,,to hold",
d.h. ,,halten, beherrschen".
40
Aus diesem Grund erscheint es sinnvoll, die Hol-
ding als eine Unternehmung zu bezeichnen, ,,deren Hauptzweck in einer auf
Dauer angelegten Beteiligung an einer (oder mehreren) rechtlich selbstständi-
gen Unternehmung(en) liegt. Die Holding kann, sofern der Umfang der einzel-
nen Kapitalanlage und deren stimmrechtliche Ausgestaltung dies gestatten,
neben der Verwaltungs- und der Finanzierungsfunktion (Holding i.w.S.) auch
35
Hoffmann (1993), S. 12.
36
Vgl. Theisen (2000), S.169; Mayer (1999), S. 24.; Hüllmann (2003), S.25.
37
Vgl. Mayer (1999), S. 25; Hüllmann (2003), S. 25.
38
Vgl. Zeiss (2006), S.31.
39
Lutter (2004), S. 9.
2 Die Management-Holding als Handlungsfeld des Konzern- Aufsichtsrats
13
Führungsfunktion (Holding i.e.S.) einer konzernleitenden Dachgesellschaft mit
abhängigen Konzernunternehmungen wahrnehmen."
41
Mit der Entscheidung für
einen Holdingkonzern wird die Obergesellschaft, also die Holding, aus organi-
satorischem und rechtlichem Blickwinkel verselbständigt und von den operati-
ven Geschäftstätigkeiten getrennt. Demnach beschränkt sie sich allein auf die
Führung des Konzerns. Generell können die Holdings alle existierenden
Rechtsformen (Einzelunternehmen, Personengesellschaften, Kapitalgesell-
schaften oder Stiftung) einnehmen. Nach der Aufgaben- und Kompetenzvertei-
lung der Obergesellschaft lassen sich die Finanzholding (Holding i.w.S) und
Führungs- oder Management-Holding (Holding i.e.S) differenzieren.
42
Die wesentlichen Attribute eines Holdingkonzerns in Abgrenzung zum Stamm-
hauskonzern sind zum einen die fehlende operative Markttätigkeit der Spitzen-
einheit und zum anderen deren rechtliche Selbstständigkeit.
43
2.4
Finanz-Holding
Die Finanzholding befriedigt die Deklaration als ,,Holding i.w.S." aufgrund ihrer
Führungsbeziehungen zu den Tochtergesellschaften, die sich auf Finanzierung
und Verwaltung der Beteiligungen beschränkt. Sie delegiert sowohl die operati-
ve als auch die strategische Führung auf die Tochtergesellschaften.
44
Die Fi-
nanzholding nimmt somit keine Führungsfunktion gegenüber diesen wahr und
unterscheidet sich in diesem Punkt grundlegend von dem Stammhauskonzern.
Innerhalb der Holdingkonzerne ist die Finanzholding die Konzernorganisations-
struktur mit der dezentralsten Ausprägung.
45
Vorteile der Finanzholding, wie Einspar- und Synergieeffekte, rekrutieren sich
aus der Konzentration der Nachfrage nach Eigen- oder Fremdkapital und der
Zuteilung der finanziellen Ressourcen sowie aus der gemeinsamen Verwaltung
der Unternehmensbeteiligungen.
46
40
Vgl. Mayer (1999), S. 25; Keller (1990), S.49.
41
Keller (1990), S. 32.
42
Vgl. Scheffler (2005), S. 60.; Theisen (2000), S.176.
43
Vgl. Hüllmann (2003), S. 27.
44
Vgl. Hoffmann (1993), S. 16; Scheffler (2005), S.60f.;Hüllmann (2003), S.28f.
45
Vgl. Zeiss (2006), S.33;Keller (1990), S.59f.; Hüllmann (2004), S. 28f.
46
Vgl. Scheffler (2005), S. 61.; Hüllmann (2003), S. 30.
2 Die Management-Holding als Handlungsfeld des Konzern- Aufsichtsrats
14
2.5
Management-Holding
Die Management- oder Führungsholding wird als ,,Holding i.e.S." beschrieben.
Sie übernimmt im Gegensatz zur Finanzholding die strategische Konzernfüh-
rung und tritt nicht, wie die Spitzeneinheit im Stammhauskonzern, operativ am
Markt in Erscheinung. Bühner grenzt die Management-Holding folgendermaßen
ab: ,,Die Management-Holding ist eine dezentrale Form der Geschäftsbereichs-
organisation. Die geschäftsführenden Bereiche sind rechtlich selbständige
Tochtergesellschaften, die über einen hohen Grad an wirtschaftlicher Selbstän-
digkeit verfügen"
47
.
Nach Hoffman befindet sich die Management-Holding, ,,auf dem Kontinuum
zwischen den beiden extremen Ausprägungen der Konzernorganisation, der
Finanzholding und dem Stammhauskonzern"
48
. Als Begründung kann man hier
die jeweiligen Extrempunkte heranziehen, die der Stammhauskonzern und die
Finanzholding bezogen auf eine zentrale und dezentrale Führungsstruktur, ein-
nehmen.
Die Obergesellschaft verzichtet im Vergleich zum Stammhaus auf eine Leis-
tungserstellung für den externen Markt. Anders als in einer Finanzholding un-
terstehen ihr die operativen Gesellschaften in wirtschaftseinheitlicher Leitung.
49
In der Management-Holding herrscht eine Trennung der strategischen von den
operativen Führungsaufgaben, somit sind die Tochtergesellschaften für ihre
operativen Aktivitäten allein verantwortlich. Im Gegensatz zum Stammhauskon-
zern werden hier flache Hierarchien mit großen Leitungsspannen und geringe-
rem Verwaltungsaufwand
50
geschaffen und die im Stammhauskonzern übliche
Leitungs-Doppelrolle durchbrochen
51
.
Im Allgemeinen besteht eine Management-Holding aus der Holdingzentrale,
aus Geschäftsbereichen bzw. Tochtergesellschaften und operativen Einheiten
sowie den in der Holding angesiedelten Zentralabteilungen (Finanzen, Konzern-
Controlling, Konzern-Revision etc.).
52
47
Bühner (1992), S. 33.
48
Hoffman (1987), S. 232.
49
Vgl. Grunhold (1993),S. 509.
50
Vgl. Zeiss (2006), S.34; Bühner (1992), S. 38.
51
Vgl. Bühner (1992), S. 33.
52
Vgl. Zeiss (2006), S. 55f.; Bühner (1992), S.33.
2 Die Management-Holding als Handlungsfeld des Konzern- Aufsichtsrats
15
Jede Management-Holding kann gemäß ihrer spezifischen internen und exter-
nen Situation und ihrer jeweiligen Strategie die für sie effizienteste Führungs-
form wählen. Zur Wahl stehen hier zwei Optionen, die sich durch das Kriterium
der Führungsintensität unterscheiden lassen, und zwar, einerseits die strategi-
sche Management-Holding und andererseits die operative Management-
Holding.
53
Eine strategische Management-Holding, auch geschäftspolitisch zielsetzende
Management-Holding, legt ihren Fokus allein auf die strategische Ausrichtung
und die Festlegung der Unternehmensziele des Gesamtkonzerns. Die operati-
ven Aufgaben verbleiben in der Zuständigkeit der rechtlich selbständigen Ge-
schäftsbereiche.
54
Die operative Management-Holding, auch geschäftsführende Holding, widmet
sich strategischen, finanziellen und operativen Steuerungsfunktionen. Es be-
steht ein starker operativer Einfluss der Holding auf die Geschäftsbereiche, der
sich in Ausnahmefällen bis hin zur Steuerung des Tagesgeschäftes erstrecken
kann
55
. Nach Bleicher ist die operative Management-Holding ,,keine angestrebte
Organisationsform, sondern ergibt sich als temporäre Zwischenlösung beim
Übergang von einem Stammhauskonzern mit rechtlich unselbstständigen Ein-
heiten zu einer Management-Holding."
56
53
Vgl. Grunhold (1993), S. 509.; Schreyögg/Kliesch/Lührmann (2003), S.721.
54
Vgl. Hoffmann (1993), S.15.
55
Vgl. Grunhold (1993), S. 510.
56
Bleicher (1991), S. 633.
3 Der Konzern-Aufsichtsrat und Risikomanagement
16
3 Der Konzern-Aufsichtsrat und Risikomanagement
Nachdem im vorangegangen Kapitel die Management-Holding als Handlungs-
feld für den Konzern-Aufsichtsrat vorgestellt wurde, wird im Rahmen dieses Ka-
pitels einleitend der Konzern-Aufsichtsrat ins dualistische System der Unter-
nehmensverfassung eingeordnet. Danach wird durch die Darstellung der zent-
rale Überwachungsnorm des Aufsichtsrats und der Vorstandsberichte nach §
90 AktG der Überwachungsauftrag- und umfang verdeutlicht. Die darauf folgen-
den Ausführungen stehen dann im Mittelpunkt des Kapitels. Dabei werden die
neuen gesetzlichen Reformschritte aufgeführt, die die Aufsichtsratsüberwa-
chung seit den Neunzigerjahren tangiert haben. Hierbei soll verdeutlicht wer-
den, dass sich der Aufsichtsrat im Rahmen seines Überwachungsauftrags zum
einen mit Informationen bezüglich des Risikomanagementsystems und zum
anderen mit Informationen hinsichtlich der Risikolage des Unternehmens bzw.
Konzerns zu beschäftigen hat. Zuletzt wird die Haftung des Aufsichtsrats bei
einer Pflichtverletzung im Rahmen der Überwachung des Risikomanagement-
(Systems) beschrieben.
3.1
Der Konzern-Aufsichtsrat der Management-Holding im dualis-
tischen System der Unternehmensverfassung
Das dualistische System, das auch als Trennungsmodell oder in der englisch-
sprachigen Debatte als Two Tiers-System bekannt ist, verfolgt das Prinzip der
strikten Trennung zwischen ausschließlicher aber gemeinsamer Geschäftsfüh-
rungsverantwortung des Vorstands auf der einen Seite und der nahezu voll-
ständigen formellen wie materiellen Geschäftsführungsprüfung durch den Auf-
sichtsrat auf der anderen Seite.
57
Der Vorstand hat demnach nach § 76 Abs. 1
AktG das Unternehmen unter eigener Verantwortung zu leiten und der Auf-
sichtsrat hat die Geschäftsleitung gemäß § 111 Abs. 1 AktG zu überwachen.
58
Diese Tatsache betrifft auch die Geschäftsführung innerhalb des Konzerns.
59
Die Konzernleitung und die Konzernüberwachung
60
obliegen jeweils den Ver-
waltungsorganen der Holding. Aufgrund dessen wird daher häufig der Auf-
sichtsrat in der Holding auch als Konzern-Aufsichtsrat tituliert. Diese Bezeich-
nung bzw. Funktion trifft nicht zu, denn nicht die Management-Holding, sondern
57
Vgl. Potthoff/Trescher (2003), S. 22.
58
Vgl. Lutter/Krieger (2008), S.25; Hoffmann-Becking (1999), S. 159.
59
In den folgenden Ausführungen soll es sich bei dem Konzern um eine Management-Holding
handeln.
60
Zur Überwachung im Konzern ausführlich siehe Semler (1996), S. 381ff.,411ff.;Krieger
(2004), S.228ff.
3 Der Konzern-Aufsichtsrat und Risikomanagement
17
nur das herrschende Unternehmen hat einen Aufsichtsrat.
61
Im Konzern gilt jedoch Folgendes zu beachten: Die strikte Trennung zwischen
der Kontrolltätigkeit der Vorstandsmitglieder einerseits und der Überwachungs-
tätigkeit des Aufsichtsrats andererseits ist auf den unterschiedlichen Konzern-
stufen in praktischer Hinsicht zum Teil aufgehoben.
62
Demnach ist es möglich,
dass Vorstandsmitglieder der Holding Aufsichtsratstätigkeiten in den Tochter-
gesellschaften wahrnehmen.
63
Dies hat diesbezüglich rechtliche Überlegungen
provoziert, ob und inwieweit der Holding-Vorstand seiner Kontrollpflicht dadurch
nachkommt, indem er Aufsichtsratsmandate in den abhängigen Unternehmen
wahrnimmt, oder ob er sogar hierzu im Rahmen seiner Kontrollpflicht verpflich-
tet ist.
64
In Betracht gezogen wurde daraufhin auch, ob und inwieweit Defizite im
Umfeld der Aufsichtsratsüberwachung in Deutschland durch die Kontrolltätigkeit
der Vorstandsmitglieder ausgeglichen werden können.
65
Im Allgemeinen hat der Aufsichtsrat eines herrschenden Unternehmens die
gleichen Rechte und Pflichten, wie sie ihm gegenüber der Leitung einer nicht
konzernmäßig gebundenen Gesellschaft zustehen. Da sich aber die Leitungs-
aufgaben des Vorstands nicht nur auf das herrschende Unternehmen begren-
zen, ist davon auszugehen, dass die Überwachung in einer Management-
Holding andere Dimensionen einnehmen wird. Denn die mit der Konzernleitung
verbundenen Entscheidungen wirken sich mehr oder weniger stark auf die
Tochtergesellschaften aus. Im gleichen Maßstab wird sich auch die Verantwor-
tung bzw. die Überwachungsaufgabe des Aufsichtsrats ausdehnen.
66
Das hat
für den Aufsichtsrat zur Folge, dass er das geschäftsleitende Organ sowohl be-
ratend als auch begleitend darauf zu überprüfen hat, ob der Vorstand nicht nur
bei der Leitung der Holding, sondern auch bei der Leitung der Tochtergesell-
schaften weitestgehend den Maßstab
67
der Ordnungsmäßigkeit anwendet.
68
Des Weiteren ist bei der Überwachung einer Management-Holding durch den
61
Vgl. Potthoff/Trescher (2003), S.132.
62
Die Wahrnehmung von Aufsichtsratsmandaten in der Obergesellschaft durch Vorstandsmit-
glieder der Tochtergesellschaften wird durch § 100 Abs. 2 Nr. 2 AktG nur für diese verboten.
63
Vertiefend zu Doppelmandaten im Konzern siehe Löbbe (2003), S.63-73.
64
Vertiefend hierzu siehe Löbbe (2003), S.143-146.
65
Vgl. Löbbe (2003), S.32; Nachfolgend soll unter den Verwaltungsorganen des herrschenden
Unternehmens der Vorstand und Aufsichtsrat allein stehend verstanden werden. Sollte eine
Differenzierung zwischen den Verwaltungsorganen der Holding und den Tochtergesellschaft
nötig sein, dann erfährt dies eine explizite Erwähnung.
66
Vgl. Bellavite-Hövermann (2005), S.122.
67
Zu den Maßstäben der Überwachung ausführlich Potthoff/Trescher (2008), S. 130f.; Bellavite-
Hövermann (2005), S. 102f.
68
Vgl. Potthoff/Trescher (2003), S. 132.
3 Der Konzern-Aufsichtsrat und Risikomanagement
18
Aufsichtsrat der Aufbau des Konzerns auf strukturelle Hindernisse dahingehend
zu überprüfen, ob diese zu Einschränkungen in der Konzernleitung und
überwachung führen. In diesem Zusammenhang hat der Aufsichtsrat einen be-
sonderen Fokus auf die Einrichtung eines konzernweiten Informations- und Ri-
sikomanagementsystems zu richten und den Aufbau einer konzernweiten
Compliance Organisation durch den Vorstand sicherzustellen.
69
Außerdem hat
der Aufsichtsrat der Holding die Aufgabe, den Konzernabschluss und Konzern-
lagebericht nach § 171 Abs. 1 AktG zu prüfen.
70
Die Hauptversammlung bildet mit dem Vorstand und dem Aufsichtsrat das dritte
Organ in der Unternehmensverfassung. Die Hauptversammlung hat nach § 119
Abs. 1 Nr. 1 AktG das Recht zur Wahl der Aufsichtsratsmitglieder,
71
woraufhin
die Anteilseigner indirekt Einfluss auf die Wahl der Vorstandsmitglieder erhal-
ten, die durch den Aufsichtsrat berufen werden. Weiterhin ist die Hauptver-
sammlung für die Entlastung der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder, die
Bestellung der Abschlußprüfer sowie Beschlussfassung über die Verwendung
des Bilanzgewinns zuständig. Ihr Einflussbereich wird durch den § 119 AktG
beschränkt.
72
Die Überwachungsaufgabe des Aufsichtsrats bezieht sich nur alleine auf die
Geschäftsführung des Vorstands. Der Aufsichtsrat hat die Tätigkeit des Vor-
stands unter eigener Verantwortung zu überwachen, ,,nicht aber diese selbst an
sich zu reißen bzw. in das Unternehmen hinein zu regieren."
73
Weiterhin ist zu
beachten, dass der Vorstand das Unternehmen eigenverantwortlich gemäß §
76 AktG leitet. In § 111 Abs. 4 AktG wird dazu ausgeführt: ,,Maßnahmen der
Geschäftsführung können dem Aufsichtsrat nicht übertragen werden."
74
Nach
h.M. hat sich die Überwachung im Gesamten auf die Einhaltung der wesentli-
chen Grundsätze für eine ordnungsgemäße Geschäftsführung zu beziehen.
Hierunter werden im Allgemeinen die Tatbestände der Rechtmäßigkeit, Ord-
nungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit subsumiert. Darüber
hinaus sollte sich die Überwachung nicht nur auf die Vergangenheit beziehen,
sondern der Aufsichtsrat soll den Vorstand auch durch eine zukunftsgerichtete
69
Vgl. Lutter/Krieger (2008), S.31.
70
Vgl. § 171 Abs.1 S.1, 2.HS AktG
71
Vgl. Bellavite-Hövermann (2005), S.49.
72
Vgl. Hoffmann-Becking (1999), S.161.
73
Bellavite-Hövermann (2005), S. 97.
74
Hüffer (1999), S. 512.
3 Der Konzern-Aufsichtsrat und Risikomanagement
19
Beratung unterstützen. Auch im Deutschen-Corporate-Governance-Kodex wird
die Beratung mit dem Vorstand in der Ziff. 5.1.1 explizit erwähnt. Demnach ist
es die Aufgabe des Aufsichtsrats, ,,den Vorstand bei der Leitung des Unterneh-
mens regelmäßig zu beraten und zu überwachen."
75
Um die vorangestellten Aufgaben erfüllen zu können, ist der Aufsichtsrat auf die
regelmäßige Berichterstattung nach § 90 AktG angewiesen. Kritik an der bishe-
rigen Berichterstattungspraxis äußern in diesem Zusammenhang Hommel-
hoff/Mattheus, die die prospektive Überwachung in der Vergangenheit zuneh-
mend zu Gunsten der vergangenheitsorientierten Kontrolle vernachlässigt se-
hen. Dem Aufsichtsrat ist es demnach unmöglich, eine prospektive und auf die
Unternehmensplanung gerichtete Überwachung durchzuführen.
76
Der Gesetz-
geber reagierte hierauf in der Vergangenheit durch eine Präzisierung und Er-
weiterung des § 90 Abs. 1 S. 1 AktG durch das KonTrag und dem TransPug.
Somit lassen sich zwei ganz wesentliche Punkte festhalten: Zum einen kommt
dem Aufsichtsrat im dualistischen System der Unternehmensverfassung die
zentrale Aufgabe der Bestellung und Abberufung sowie der Überwachung der
Unternehmensleitung zu. Zum anderen kann als konkrete Auswirkung des dua-
listischen Systems konstatiert werden, dass der Vorstand auf der einen Seite
durch den Aufsichtsrat überwacht wird. Auf der anderen Seite ist aber der Vor-
stand wichtigster Informationslieferant für den Aufsichtsrat nach § 90 AktG.
Hieraus ergibt sich für den Aufsichtsrat schon systemimmanent die Notwendig-
keit, bezüglich der Qualität der Informationen ein gesundes Maß an Misstrauen
zu hegen. Hier besteht ein Defizit im Überwachungssystem des Aufsichtsrats.
3.2
Die zentrale Überwachungsnorm des § 111 Abs. 1 AktG
Die zentrale Norm der Überwachungstätigkeit des Aufsichtsrats ist der § 111
Abs. 1 AktG. Hiernach hat der Aufsichtsrat die Geschäftsführung des Vorstands
zu überwachen. Der Aufsichtrat hat den Vorstand auf Gesetzesmäßigkeit, Ord-
nungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit zu kontrollieren. Die
Intensität der Aufsichtsratsüberwachung richtet sich nach der Lage des Kon-
zerns und wird grundsätzlich durch den Gesamtaufsichtsrat durchgeführt.
77
Dem Aufsichtsrat stehen hierfür einige Befugnisse zur Verfügung, die in § 111
AktG nur beispielhaft aufgeführt werden. Zu den zentralen Befugnissen gehören
75
DCGK Ziffer: 5.1.1.
76
Vgl. Hommelhoff/Mattheus (1998), S.253.
77
§ 111 Abs. 1 verpflichtet den AR als Organ, die Geschäftsführung zu überwachen.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2009
- ISBN (eBook)
- 9783836633925
- DOI
- 10.3239/9783836633925
- Dateigröße
- 943 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Technische Universität Dortmund – Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät
- Erscheinungsdatum
- 2009 (August)
- Note
- 1,7
- Schlagworte
- aufsichtsrat risikomanagementsystem prüfung strategische planung reporting
- Produktsicherheit
- Diplom.de