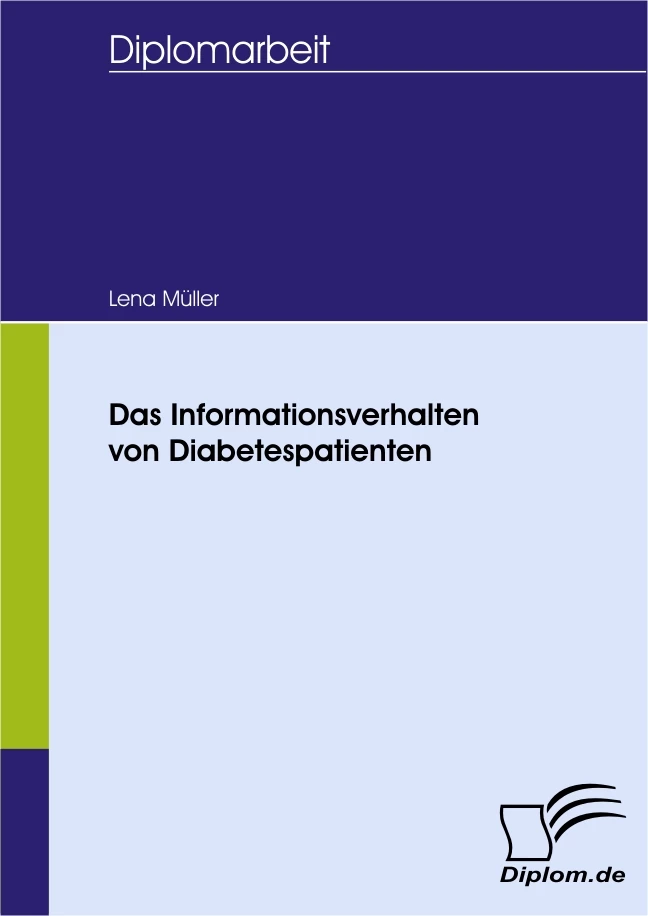Zusammenfassung
Information als Therapieform:
Die Zahl der an Diabetes Erkrankten beläuft sich in Deutschland momentan auf acht Millionen, was ca. zehn Prozent der deutschen Bevölkerung entspricht. Diese Zahl steigt vor allem aufgrund der Zunahme von übergewichtigen und physisch weniger aktiven Menschen stetig weiter an. Bereits heute gilt Diabetes in allen Altersstufen als die häufigste chronische Erkrankung. Mangelnde Informationen über wichtige alltags- und gesundheitsrelevante Fragestellungen zum Leben mit Diabetes und unzureichende Krankheitsbewältigung können schwerwiegende bis lebensgefährliche Folgen für die Gesundheit der Patienten haben. Dies bedeutet, dass eine erfolgreiche Diabetesbehandlung untrennbar mit einer engagierten Beteiligung der Patienten verbunden ist, wofür ein ausreichender Informationsstand unerlässlich ist. Jahrelange Forschung hat gezeigt, dass informierte und in die Behandlung ihrer Krankheit involvierte Patienten bessere gesundheitliche Fortschritte machen und zufriedener mit ihrer Behandlung sind als andere Patienten. Wie wichtig gesundheitsrelevante Informationen für Patienten sein können, zeigt auch Deering (1998). Sie stellt dar, dass nur ungefähr fünf der 30 Jahre höheren Lebenserwartung, welche Amerikaner im Laufe des letzten Jahrhunderts dazu gewonnen haben, tatsächlich der medizinischen Versorgung zuzuschreiben sind. Die restlichen 25 Jahre dagegen sind Vorsorge- und Aufklärungsprogrammen zu verdanken, welche vor allem Gesundheitsinformationen für Patienten beinhalten.
Darüber hinaus wollen auch immer mehr Patienten ihre Behandlung selbst mitbestimmen, wofür ein umfassender Informationsstand unbedingt notwendig ist. Jahrelang war es üblich, dass der Arzt die nahezu einzige Quelle zur Beschaffung gesundheitsrelevanter Informationen war. Seit einigen Jahren jedoch gewinnt die mediale Vermittlung gesundheitsrelevanter Informationen immer mehr an Bedeutung und es besteht ein großes öffentliches Interesse an gesundheitsrelevanten Informationen auf Seiten der immer gesundheitsbewussteren Patienten. Die Internetsuchmaschine Google liefert aktuell beispielsweise 108 Millionen Ergebnisse auf den Suchbegriff Gesundheit und Amazon Deutschland führt nahezu 110 000 Bücher zum Thema Medizin. In der Zeitschrift FOCUS wurden im Jahr 2006 über 160 Seiten zu Gesundheit und Psychologie veröffentlicht und auch die Zahl der sich auf diese Themenbereiche spezialisierten Titel wie Stern gesund leben, Vital oder […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis – Anhang
Tabellenverzeichnis
1 Information als Therapieform – eine Einleitung
2 Diabetes – die häufigste chronische Erkrankung
2.1 Gesundheit und Krankheit
2.2 Charakteristika chronischer Krankheiten
2.3 Diabetes mellitus
3 Gesundheitsinformationen – Der Forschungsstand
3.1 Das Forschungsfeld Gesundheitskommunikation
3.2 Gesundheitsrelevante Informationsbedürfnisse
3.2.1 Informationsbedürfnis – eine Definition
3.2.2 Arten von Informationsbedürfnissen von Patienten
3.2.3 Merkmale von nach Informationen suchenden Patienten
3.3 Quellen für gesundheitsrelevante Informationen
3.3.1 Die Rolle der Printmedien bei der Informationsbeschaffung
3.3.2 Die Rolle des Fernsehens bei der Informationsbeschaffung
3.3.3 Die Rolle des Internets bei der Informationsbeschaffung
3.3.4 Die Rolle von Ärzten bei der Informationsbeschaffung
4 Uses and Gratifications – Die theoretische Grundlage
4.1 Grundannahmen
4.2 Grundlegende Komponenten
4.2.1 Das Konzept des aktiven Rezipienten
4.2.2 Soziale und psychologische Ursprünge von Bedürfnissen
4.2.3 Medienrelevante Bedürfnisse
4.2.4 Medieneinstellung, -erwartung und -konsum
4.2.5 Gesuchte und erhaltene Gratifikationen
4.2.6 Das Erwartungs-/ Bewertungsmodell
4.3 Kritische Beurteilung
5 Diabetespatienten und Informationen – eine explorative Untersuchung
5.1 Fragestellung
5.2 Methodik
5.2.1 Erhebungsverfahren
5.2.2 Auswahl- und Rekrutierungs-Verfahren
5.2.3 Materialien
5.2.4 Erhebungsprozedur
5.2.5 Datenanalyse
6 Was Diabetespatienten wollen – Die Untersuchungsergebnisse
6.1 Die Informationsquellen
6.1.1 Genutzte Quellen
6.1.2 Erwartungen und Bewertungen bzgl. medialer Quellen
6.1.3 Erwartungen und Bewertungen bzgl. nicht-medialer Quellen
6.2 Die Informationsbedürfnisse
6.2.1 Nutzungsmotive
6.2.2 Vermeidungsmotive
6.2.3 Themenpräferenzen
6.3 Erwartungen, Bewertungen und Quellennutzung
6.4 Gesuchte und erhaltene Gratifikationen
6.4.1 Sicherheits-Bedürfnisse
6.4.2 Kognitive Bedürfnisse
6.5 Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse
6.5.1 Hypothesenbildung
6.5.2 Grenzen der Studie
7 Optimierte Kommunikation mit Diabetespatienten – Ein Leitfaden
7.1 Empfehlungen an die Medien im Allgemeinen
7.2 Empfehlungen an spezifische Medien
7.3 Empfehlungen an Ärzte
8 Nächste Schritte – Fragebogen zur Durchführung einer quantitativen Befragung
9 Neue Herausforderungen für die Pharmabranche – Fazit und Ausblick
10 Literatur
11 Anhang
11.1 Rekrutierung und Leitfäden
11.2 Transkriptionen der Einzelinterviews
11.3 Transkriptionen der Gruppendiskussionen
11.4 Auswertungen
11.5 Quantitativer Fragebogen
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Diabetes nach Alter und Geschlecht
Abbildung 2: Nutzung verschiedener Quellen für Gesundheitsinformationen
Abbildung 3: Modell des Uses and Gratifications Ansatzes
Abbildung 4: Erwartungs-/ Bewertungsmodell
Abbildung 5: Erwartungs-/ Bewertungstypologie
Abbildung 6: Relevante Komponenten für die vorliegende Arbeit
Abbildung 7: Nutzungsmotive in Kategorien
Abbildung 8: Leitfaden für die Kommunikation in den Medien
Abbildung 9: Leitfaden für die Kommunikation in Zeitschriften
Abbildung 10: Leitfaden für die Kommunikation in Informationsbroschüren
Abbildung 11: Leitfaden für die Kommunikation im Internet
Abbildung 12: Leitfaden für die Kommunikation für Ärzte
Abbildungsverzeichnis – Anhang
Abbildung Anhang 1: Brief an Selbsthilfegruppen-Mitglieder
Abbildung Anhang 2: Soziodemographischer Fragebogen
Abbildung Anhang 3: Leitfaden für Einzelgespräche
Abbildung Anhang 4: Leitfaden für Focus Groups
Abbildung Anhang 5: Transkription Einzelinterview E1
Abbildung Anhang 6: Transkription Einzelinterview E2
Abbildung Anhang 7: Transkription Einzelinterview E3
Abbildung Anhang 8: Transkription Einzelinterview E4
Abbildung Anhang 9: Transkription Einzelinterview E5
Abbildung Anhang 10: Transkription Einzelinterview E6
Abbildung Anhang 11: Transkription Einzelinterview E7
Abbildung Anhang 12: Transkription Einzelinterview E 8
Abbildung Anhang 13: Transkription Gruppendiskussion G1
Abbildung Anhang 14: Gruppendiskussion G2
Abbildung Anhang 15: Auswertung Quellennutzung
Abbildung Anhang 16: Auswertung Erwartungen an Medien im Allgemeinen
Abbildung Anhang 17: Auswertung Erwartungen an kostenlose Zeitschriften
Abbildung Anhang 18: Auswertung Erwartungen an Kaufzeitschriften
Abbildung Anhang 19: Auswertung Erwartungen an das Fernsehen
Abbildung Anhang 20: Auswertung Erwartungen an das Internet
Abbildung Anhang 21: Auswertung Erwartungen an Bücher
Abbildung Anhang 22: Auswertung Erwartungen an Informationsbroschüren
Abbildung Anhang 23: Auswertung Erwartungen an Ärzte
Abbildung Anhang 24: Auswertung Erwartungen an Freunde und Verwandte
Abbildung Anhang 25: Auswertung Erwartungen an Selbsthilfegruppen
Abbildung Anhang 26: Auswertung Erwartungen an Vorträge und Schulungen
Abbildung Anhang 27: Auswertung Nutzungsmotive
Abbildung Anhang 28: Auswertung Vermeidungsmotive
Abbildung Anhang 29: Auswertung Themenfelder
Abbildung Anhang 30: Überblick über die Erwartungen an Medien
Abbildung Anhang 31: Fragebogen für quantitative Befragung
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Nutzungsmotive in der Medienforschung
Tabelle 2: Kritik am Uses and Gratifications Ansatz
Tabelle 3: Beschreibung der Teilnehmer der Einzelinterviews
Tabelle 4: Beschreibung der Teilnehmer der Focus Groups
Tabelle 5: Vermeidungsmotive
Alle geschlechterspezifischen Ausdrücke, insbesondere die Begriffe „Patient“, „Arzt“ und „Diabetiker“ werden in der folgenden Arbeit, soweit nicht anders erläutert, sowohl für weibliche als auch männliche Personen verwendet.
„As a general rule, the most successful man in life is the man who has the best information.”
Benjamin Disraeli (1804-81) britischer Politiker und Schriftsteller
1 Information als Therapieform – eine Einleitung
Die Zahl der an Diabetes[1] Erkrankten beläuft sich in Deutschland momentan auf acht Millionen, was ca. zehn Prozent der deutschen Bevölkerung entspricht (vgl. Hauner 2008, S. 10). Diese Zahl steigt vor allem aufgrund der Zunahme von übergewichtigen und physisch weniger aktiven Menschen stetig weiter an. Bereits heute gilt Diabetes in allen Altersstufen als die häufigste chronische Erkrankung (vgl. Heinz 2003, S. 1). Mangelnde Informationen über wichtige alltags- und gesundheitsrelevante Fragestellungen zum Leben mit Diabetes und unzureichende Krankheitsbewältigung können schwerwiegende bis lebensgefährliche Folgen für die Gesundheit der Patienten haben. Dies bedeutet, dass eine erfolgreiche Diabetesbehandlung untrennbar mit einer engagierten Beteiligung der Patienten verbunden ist, wofür ein ausreichender Informationsstand unerlässlich ist. Jahrelange Forschung hat gezeigt, dass informierte und in die Behandlung ihrer Krankheit involvierte Patienten bessere gesundheitliche Fortschritte machen und zufriedener mit ihrer Behandlung sind als andere Patienten (vgl. Greenfield/Kaplan/Ware 1985; Joos/Hickam 1990; Lorig/Mazon-son/Holman 1993; Deber 1994; Evans/Clarke 1983). Wie wichtig gesundheitsrelevante Informationen für Patienten sein können, zeigt auch Deering (1998). Sie stellt dar, dass nur ungefähr fünf der 30 Jahre höheren Lebenserwartung, welche Amerikaner im Laufe des letzten Jahrhunderts dazu gewonnen haben, tatsächlich der medizinischen Versorgung zuzuschreiben sind. Die restlichen 25 Jahre dagegen sind Vorsorge- und Aufklärungsprogrammen zu verdanken, welche vor allem Gesundheitsinformationen für Patienten beinhalten (vgl. S. 126).
Darüber hinaus wollen auch immer mehr Patienten ihre Behandlung selbst mitbestimmen, wofür ein umfassender Informationsstand unbedingt notwendig ist. Jahrelang war es üblich, dass der Arzt die nahezu einzige Quelle zur Beschaffung gesundheitsrelevanter Informationen war. Seit einigen Jahren jedoch gewinnt die mediale Vermittlung gesundheitsrelevanter Informationen immer mehr an Bedeutung (vgl. Bleicher/Lampert 2003, S. 348; Deering 1998, S. 127) und es besteht ein großes öffentliches Interesse an gesundheitsrelevanten Informationen auf Seiten der immer gesundheitsbewussteren Patienten (vgl. Deering/Harris 1996; Brown 1996). Die Internetsuchmaschine Google liefert aktuell beispielsweise 108 Millionen Ergebnisse auf den Suchbegriff „Gesundheit“ und Amazon Deutschland führt nahezu 110 000 Bücher zum Thema Medizin. In der Zeitschrift FOCUS wurden im Jahr 2006 über 160 Seiten zu Gesundheit und Psychologie veröffentlicht und auch die Zahl der sich auf diese Themenbereiche spezialisierten Titel wie „Stern gesund leben“, „Vital“ oder „Men’s Health“ nehmen immer mehr zu (vgl. FOCUS 2007, S. 33). Rund 65 Prozent der deutschen Bevölkerung geben darüber hinaus an, an Informationen zum Thema Gesundheit, über Medikamente und Heilmittel (sehr) interessiert zu sein und 54 Prozent sind der Meinung, dass man sich heutzutage selbst darüber informieren muss, was man für seine Gesundheit tun sollte und welche Behandlungsmethoden für einen angemessen sind[2] (vgl. Marktforschung Axel Springer AG 2003, S. 11).
Darüber hinaus verstärkt das Betroffensein von einer chronischen Erkrankung die Suche nach gesundheitsbezogenen Informationen noch zusätzlich (vgl. Marstedt 2004, S. 4). Fox und Rainie konnten beispielsweise zeigen, dass Rezipienten mit abnehmender Gesundheit vermehrt nach gesundheitsrelevanten Informationen im Internet suchen[3] (vgl. Fox/Rainie 2000, S. 9) und auch in anderen Medien werden von chronisch Kranken vermehrt Informationen zu gesundheitsrelevanten Themen nachgefragt.
Welche Diabetespatienten suchen aus welchen Bedürfnissen heraus wo nach Informationen bezüglich ihrer Krankheit und inwiefern werden ihre Informationsbedürfnisse befriedigt?
Diese Frage liefert den Ausgangspunkt für die vorliegende Diplomarbeit. Die theoretische Grundlage hierfür bildet der Uses and Gratifications Ansatz, mit dessen Hilfe ein Zusammenhang zwischen den demographischen Eigenschaften der Diabetespatienten, deren Informationsbedürfnissen, deren Erwartungen an die Medien und deren Mediennutzungsverhalten hergestellt und zudem dargestellt wird, inwiefern die vorhandenen Informationsbedürfnisse befriedigt werden. Zur Identifizierung dieser Zusammenhänge wurden Leitfadeninterviews und Gruppendiskussionen mit Diabetespatienten sowie qualitative Inhaltsanalysen der dadurch erhobenen Daten durchgeführt.
In dieser Arbeit werden zunächst in Kapitel 2 einige grundlegende Informationen zu der chronischen Krankheit Diabetes gegeben. Hierfür wird definiert, was in dieser Arbeit unter Krankheit verstanden werden soll, was eine chronische Krankheit im Gegensatz zu einer akuten kennzeichnet und was die Krankheit Diabetes für den betroffenen Patienten bedeutet. Das darauf folgende Kapitel 3 beschreibt den aktuellen Forschungsstand. Hierbei wird zunächst das Forschungsfeld Gesundheitskommunikation vorgestellt. Anschließend werden bisherige Studien zu den gesundheitsrelevanten Informationsbedürfnissen von Patienten dargestellt. Des Weiteren werden in diesem Kapitel Forschungsarbeiten zu den Quellen gesundheitsrelevanter Informationen aufgezeigt, wobei insbesondere auf die Rolle der Printmedien, des Fernsehens, des Internets und die Rolle von Ärzten bei der Informationsbeschaffung eingegangen wird. In Kapitel 4 wird auf die theoretische Grundlage dieser Arbeit eingegangen, indem der Uses and Gratifications Ansatz vorgestellt und auf diese Arbeit angewendet wird. Hierfür werden zunächst die Grundannahmen der Theorie vorgestellt und schließlich die grundlegenden Komponenten des Ansatzes genauer erläutert beziehungsweise kritisch hinterfragt. Schließlich wird dargestellt, welche Rolle diese Theorie bei der vorliegenden Arbeit spielt beziehungsweise in welcher Form sie Anwendung auf diese Arbeit findet. Kapitel 5 befasst sich mit dem Vorgehen der vorliegenden Studie. Es wird dabei zunächst auf die Fragestellung eingegangen, bevor die Methode und das Untersuchungsdesign genauer erläutert werden. In Kapitel 6 werden schließlich die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung dargestellt. Dabei wird zunächst auf die von den Diabetespatienten genutzten Informationsquellen und deren Informationsbedürfnisse eingegangen und schließlich auf Teile des Uses and Gratifications Ansatzes in Bezug auf die erhaltenen Ergebnisse. Zudem wird in Kapitel 7 aufgezeigt, wie eine optimale Kommunikation von Pharmaunternehmen bzw. Verbänden mit Diabetespatienten den Ergebnissen zu Folge aussehen kann und es werden Empfehlungen für die Kommunikation mit Hilfe spezifischer Medien gegeben. Mit Hilfe der Ergebnisse aus Kapitel 5 und 6 wird in Kapitel 8 schließlich dargestellt, wie ein Fragebogen für eine quantitative Befragung aussehen kann. Kapitel 9 bildet den Abschluss dieser Arbeit, indem gezeigt wird, welche über diese Arbeit hinaus führenden Forschungsmöglichkeiten bestehen und wie die vorliegende Arbeit in der Praxis Anwendung finden kann.
2 Diabetes – die häufigste chronische Erkrankung
Diabetes mellitus gilt aktuell als die häufigste chronische Krankheit in allen Altersgruppen (vgl. Finck/Holl 2006, S. 102). Um Diabetes erläutern zu können, werden in diesem Kapitel daher zunächst die Begrifflichkeiten Gesundheit und Krankheit, sowie chronische Krankheit behandelt. Anschließend wird genauer auf Diabetes eingegangen.
2.1 Gesundheit und Krankheit
Seit vielen Jahren versuchen Forscher verschiedener Fachrichtungen den Begriff Gesundheit zu definieren. Ihre oftmals biologische Orientierung führt dabei allerdings dazu, Gesundheit als das Fehlen einer Krankheit zu bezeichnen. Dieser Definition folgend würden wichtige Themen wie die Unterstützung in Selbsthilfegruppen oder die auf psychologischer Behandlung basierende Kommunikation nicht in den Forschungsbereich der Gesundheitskommunikation fallen (vgl. Ratzan/Payne 1996 S. 30). Im Gegensatz zu dieser biologischen Orientierung versucht die biopsychosoziale Perspektive Gesundheit als einen „Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht allein das Fehlen von Krankheit und Gebrechen“ (Weltgesundheitsorganisation 2006, S. 1) zu beschreiben. Mit Hilfe dieser Definition werden alle die Gesundheit betreffenden Bereiche der Kommunikation mit in den Bereich der Gesundheitskommunikation eingeschlossen (vgl. Ratzan/Payne 1996, S. 30). Daher wird diese Definition für die vorliegende Arbeit verwendet.
2.2 Charakteristika chronischer Krankheiten
Eine chronische Krankheit ist im Gegensatz zu einer akuten dadurch gekennzeichnet, dass sie sich langsam entwickelt und zudem langwierig – meist sogar dauerhaft – verläuft (vgl. Roth/Rüschmann 2000, S. 94). Bei den meisten Definitionen steht demnach der zeitliche Aspekt einer Krankheit im Vordergrund. Andere Definitionen fokussieren demgegenüber die Unheilbarkeit als zentrales Kriterium einer chronischen Krankheit, was jedoch als problematisch anzusehen ist, da einige chronische Kinderkrankheiten bei richtiger Behandlung nach ein paar Jahren ausheilen können und demnach nicht als unheilbar einzustufen sind. Eine genaue Abgrenzung kann jedoch bei vielen Krankheiten nicht vorgenommen werden, da diese je nach Individuum und Begleitumständen sowohl chronisch als auch akut auftreten können. Es existieren demnach Krankheiten, die grundsätzlich chronisch verlaufen wie Diabetes, Parkinson und Alzheimer und daneben Krankheiten wie Rückenschmerzen oder Schwindel-Syndrome, die nur unter bestimmten Bedingungen chronisch verlaufen können (vgl. Gerste/Niemeyer/Lauterberg 2000, S. 67 f.).
2.3 Diabetes mellitus
Diabetes mellitus bezeichnet verschiedene Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels, die durch chronisch erhöhte Blutzuckerwerte gekennzeichnet sind und mit dem Risiko schwerer Begleit- und Folgeerkrankungen einhergehen (vgl. Hauner 2008 S. 7). Es werden hauptsächlich zwei Arten von Diabetes unterschieden: Typ 1, dem schätzungsweise fünf bis zehn Prozent der Diabetiker in Deutschland zuzuordnen sind, kommt durch einen Mangel an Insulin, verursacht durch eine Zerstörung der insulinproduzierenden Zellen der Bauchspeicheldrüse, zu Stande. Meist wird dieser Typ bei Kindern zwischen dem 11. und 13. Lebensjahr diagnostiziert. Typ 2 kommt durch ein vermindertes Ansprechen der Körperzellen auf Insulin zu Stande, welches sich meist erst nach dem 40. Lebensjahr bemerkbar macht. An diesem Typ leiden in Deutschland etwa 90 Prozent der Diabetiker. Typ 2 wird insbesondere durch fettreiche Kost, Übergewicht und Bewegungsmangel ausgelöst (vgl. Scherbaum 2005). Hinzu kommen andere Diabetesformen, wie z. B. Schwangerschaftsdiabetes oder Diabetes infolge einer Entzündung der Bauchspeicheldrüse, welche allerdings zahlenmäßig weniger bedeutend sind und daher in dieser Arbeit keine weitere Beachtung finden (vgl. Scherbaum 2005).
Nach Angaben der American Diabetes Association ist die Zahl der Diabetiker in den letzten 20 Jahren von weltweit etwa 30 Millionen auf 230 Millionen Betroffene angestiegen. Zudem wird ein weiter wachsender Trend vorausgesagt, der inzwischen seuchenartige Größenordnungen erreicht (vgl. Standl 2006, S. 5). So fordert Diabetes mittlerweile genauso viele Opfer wie HIV/AIDS, das heißt alle 10 Sekunden stirbt ein Diabetiker an den Folgen seiner Erkrankung. Es wird geschätzt, dass 80 Prozent aller Typ 2 Diabetesfälle durch eine Änderung der Ernährungsgewohnheiten und mehr körperliche Bewegung vermieden werden könnten (vgl. Lütke 2006).
Abbildung 1 zeigt die Verteilung von Diabetes mellitus in Deutschland nach Altersgruppen jeweils für Männer und Frauen. Dabei wird deutlich, dass Diabetes mit steigendem Alter immer häufiger wird und die große Mehrheit der Diabetespatienten über 60 Jahre alt ist. Außerdem wird sichtbar, dass allgemein mehr Männer an Diabetes leiden als Frauen.
Abbildung 1: Diabetes nach Alter und Geschlecht
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Quelle: Robert Koch Institut 2006)
Diabetes kann bei den betroffenen Patienten schwere gesundheitliche Konsequenzen nach sich ziehen, welche nur durch eine ständige Blutzuckerkontrolle verhindert werden können. Die Blutzuckerkontrolle hängt jedoch hauptsächlich vom Selbstmanagement der Betroffenen ab (vgl. Burke et al. 2006, S. 103). Wird diese Kontrolle nicht regelmäßig durchgeführt, kann es zu Unter- bzw. Überzuckerung kommen. Unterzuckerungen (Hypoglykämien) führen zu meist kurzfristigen Leistungseinbußen, die allerdings beispielsweise im Straßenverkehr extreme Folgen für den Patienten und Dritte haben können. Chronisch erhöhte Blutzuckerwerte können dagegen längerfristige Leistungseinschränkungen mit sich bringen (vgl. Finck/Holl 2006, S. 103). Die Betroffenen sehen sich dadurch einer erhöhten Gefahr ausgesetzt jünger zu sterben und an einer Vielzahl akuter und chronischer Leiden wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Nierenleiden, Retinopathien[4] und Nervenleiden zu erkranken (vgl. Liebl 2006, S. 24). Diabetes mellitus liegt Biermann (2006) zufolge an vierter Stelle der Todesursachen in den Industrieländern, ist die führende Ursache von Erblindungen und schweren Sehstörungen bei Erwachsenen und die häufigste Ursache für Amputationen, die nicht durch Verletzungen bedingt sind. Diabetespatienten haben zudem ein zwei- bis vierfach erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und ein doppelt so hohes Risiko für Schlaganfälle. Rund 75 Prozent aller Diabetiker leiden an Bluthochdruck im Gegensatz zu 44 Prozent unter der Normalbevölkerung (vgl. S. 65).
Diabetespatienten müssen vom Tag der Diagnose an grundlegende und komplexe Veränderungen in ihrem alltäglichen Verhalten vornehmen, welche insbesondere Ernährung, Sport, Zigarettenkonsum, Alkohol, Medikation, Fußpflege und Blutzuckermessung betreffen (vgl. Burke et al. 2006, S. 104). Eine erfolgreiche Behandlung von Diabetes kann dabei nur gelingen, wenn die Betroffenen die Therapie in Form einer Lebens- und Verhaltensumstellung weitestgehend selbst in die Hand nehmen (vgl. Siegel 2006, S. 29). Das Leben mit Diabetes fordert daher vom Patienten eine lebenslange Anpassungsleistung, um mit der Erkrankung und möglichen Folgen zurechtzukommen, Diabetes bestmöglich in das eigene Leben zu integrieren und sich tagtäglich neu zu den notwendigen Therapiemaßnahmen zu motivieren (vgl. Kulzer 2006, S. 56). Burke et al. (2006) eruierten in qualitativen Interviews mit Diabetespatienten im Rahmen einer Studie zu den Ansichten von Diabetespatienten bezüglich Arztterminen die größten Probleme von Diabetikern. Hierzu gehören unerbittliche Schmerzen durch diabetische Nervenleiden, Depressionen, Schlaganfälle, Herzprobleme und Nierenprobleme. Hinzu kommt, dass Diabetespatienten jeden Tag genügend Zeit für Sport, adäquate Nahrungszubereitung, Informationsbeschaffung und Blutzuckermessung einplanen müssen und außerdem mit Ängsten vor Blindheit, Amputationen, Arbeitsplatzverlust und frühzeitigem Tod leben (vgl. S. 107-109).
3 Gesundheitsinformationen – Der Forschungsstand
Nachdem erläutert wurde, was die Krankheit Diabetes für einen Betroffenen bedeutet und wie sich diese auswirkt, wird nun im folgenden Kapitel der aktuelle Forschungsstand im Forschungsfeld Gesundheitskommunikation dargestellt. Insbesondere wird dabei auf die bisherige Forschung zu gesundheitsrelevanten Informationsbedürfnissen und auf von Patienten genutzte mediale und nicht-mediale Informationsquellen eingegangen. Die hierfür beschriebenen Ergebnisse beziehen sich jedoch nicht in allen Fällen auf Diabetespatienten, da in diesem Bereich die Anzahl der Studien noch sehr gering ausfällt. Es wurde jedoch bei der Auswahl der vorgestellten Ergebnisse darauf geachtet, dass die Studien sich auf Patienten beziehen, die mit Diabetespatienten in Bezug auf Ausmaß der Erkrankung und Einfluss auf das Leben des Erkrankten vergleichbar sind. Daher handeln die meisten der im Folgenden vorgestellten Studien von chronisch Kranken.
3.1 Das Forschungsfeld Gesundheitskommunikation
In den USA hat sich das Fachgebiet „Health Communication“ innerhalb der Kommunikationswissenschaft schon in den 70er Jahren etabliert (vgl. Kreps/Bonaguro/Query 1998, S. 1). Seitdem werden Artikel in immer mehr interdisziplinären sozialwissenschaftlichen Schriften veröffentlicht, die sich mit diesem Themenfeld befassen (vgl. Kreps 2003, S. 359). Im Vergleich dazu wird der Gesundheitskommunikation im deutschsprachigen Raum recht wenig Aufmerksamkeit geschenkt und sie bildet bislang innerhalb der Medien- und Kommunikationswissenschaft kein eigenständiges Fachgebiet (vgl. Bleicher/Lampert 2003, S. 348). Anfangs beschäftigte sich die Gesundheitswissenschaft vorwiegend mit interpersonaler Kommunikation insbesondere innerhalb der Arzt-Patienten-Beziehung. Eine andere modernere Forschungsrichtung innerhalb der Gesundheitskommunikation beschäftigt sich mit der Massenkommunikation. Hierbei stehen die effektive Verbreitung von Gesundheitsbotschaften, Gesundheitsvorsorge-Kampagnen und Gesundheitsmarketing im Vordergrund. Erst allmählich wird diese Trennung der Bereiche in der Gesundheitskommunikation aufgelöst und diese beispielsweise von Hurrelmann und Leppin (2001) definiert als: „die Vermittlung und den Austausch von Wissen, Meinungen und Gefühlen zwischen Menschen, die als professionelle Dienstleister oder Patienten/Klienten in den gesundheitlichen Versorgungsprozess einbezogen sind, und/oder als Bürgerinnen und Bürger an Fragen der Gesundheit und Krankheit und öffentlicher Gesundheitspolitik interessiert sind“ (S.11). Ziel der Gesundheitskommunikation ist es, „bestimmte Wirkungen zu erzielen und das Gesundheitsbewusstsein, wenn nicht gar das Verhalten, positiv zu beeinflussen“ (Bleicher/Lampert 2003, S. 350). Die Konsumenten verlassen sich dabei auf Kommunikation, um relevante Gesundheitsinformationen zu erhalten, mit deren Hilfe sie wichtige Behandlungsentscheidungen treffen und somit zum Erhalt ihrer Gesundheit beitragen (vgl. Kreps 2003, S. 354 f.). Das Ziel der Forschung im Bereich Gesundheitskommunikation ist, die Informationsbedürfnisse der Konsumenten zu identifizieren und Strategien zu entwickeln, um Konsumenten dazu anzuhalten, Verantwortung für ihre Gesundheit zu übernehmen. Dabei versucht sie angemessene Informationsquellen für gesundheitsrelevante Themen zu identifizieren und Medienprogramme zu erstellen, um die Bedürfnisse der Konsumenten optimal zu befriedigen (vgl. Kreps 2003, S. 360). Im Rahmen dieser Forschung spielen die intrapersonelle, die interpersonelle, die Gruppen-, die Organisations- und die soziale Ebene eine Rolle (vgl. Kreps/Bonaguro/Query 1998, S. 1). Das Forschungsgebiet Gesundheitskommunikation wird dadurch zu einem extrem breiten Forschungsgebiet, in welchem viele verschiedene Kommunikationslevel und -richtungen erforscht werden.
3.2 Gesundheitsrelevante Informationsbedürfnisse
Zur Darstellung des Forschungsstandes zu gesundheitsrelevanten Informationsbedürfnissen wird zunächst definiert, was unter einem Informationsbedürfnis innerhalb dieser Arbeit zu verstehen ist. Anschließend werden die Ergebnisse verschiedener Studien dargestellt, die sich mit den verschiedenen Arten von Informationsbedürfnissen beschäftigt haben. Darüber hinaus werden Ergebnisse zu den spezifischen Merkmalen von Patienten aufgezeigt, die ihr Informationsverhalten beeinflussen können. Auf dieser Grundlage lässt sich die vorliegende Arbeit in den aktuellen Forschungsstand eingeordnen.
3.2.1 Informationsbedürfnis – eine Definition
Die Suche nach Informationen findet im Allgemeinen auf Grund einer vorhandenen Lücke im bestehenden Wissen einer Person statt (vgl. Eriksson-Backa 2003, S. 85). Dervin und Nilan (1986) definieren eine Situation, in welcher ein Informationsbedürfnis entsteht, als Situation, in welcher der innere Sinn eines Individuums verloren gegangen ist und ein neuer Sinn geschaffen werden muss. Ihrem Modell zu Folge wird ein „sense-maker“ in einer Situation von einer Lücke bzw. Frage gestoppt und muss durch jegliche Art vorhandener Hilfe versuchen, diese Lücke zu füllen (vgl. S. 20). Belkin, Oddy und Brooks (1982) dagegen sprechen von einem Informationsbedürfnis, wenn sich ein Mensch in einem anormalen Zustand von Wissen über etwas befindet, wobei dieser meist zuvor nicht genau weiß, was er benötigt, um diese Anomalie zu beseitigen (vgl. S. 62). Mit einem Anwachsen von Unsicherheit nimmt demnach die Suche nach Informationen systematisch zu. Zudem steigt diese auch mit der Wichtigkeit der Entscheidung (vgl. Atkin 1973, S. 215). So konnte beispielsweise gezeigt werden, dass schwere Krankheiten wie Krebs zu wachsenden Informationsbedürfnissen führen (vgl. Eriksson-Backa 2003, S. 85). Je größer demnach die Wissenslücke eines Diabetespatienten und je wichtiger ihm seine Gesundheit ist, desto größer ist sein Informationsbedürfnis und desto mehr wird er nach Informationen suchen.
3.2.2 Arten von Informationsbedürfnissen von Patienten
Die Diagnose für eine Krankheit wie Diabetes zu bekommen, bedeutet für Patienten in erster Linie ein großes Maß an Unsicherheit in Verbindung mit Angst. Viele wissen kaum etwas über die diagnostizierte Krankheit und können häufig nicht einordnen, was die Diagnose konkret bedeutet (vgl. Burke et al 2006, S. 107). Erst durch nach und nach erworbenes Wissen können Patienten Entscheidungen treffen, an der Behandlung ihrer Krankheit maßgeblich teilhaben und sich so mit dieser identifizieren. Jedoch bleiben auch im weiteren Verlauf der Krankheit Informationsbedürfnisse bezüglich der eigenen Krankheit beim Patienten bestehen, welche auf die folgenden Arten von Informationen bezogen sein können: (1) Prozedurale Informationen beziehen sich auf bestimmte Abläufe wie beispielsweise das Abnehmen von Blut, (2) Verhaltens-Informationen geben Anleitungen zum Selbstmanagement, (3) sensorische Informationen beschreiben, was ein Patient erwarten sollte zu fühlen, hören oder schmecken, (4) Informationen zur emotionalen Bewältigung, welche Patienten helfen sollen, ihre Ängste abzubauen, (5) kognitive Informationen zu Fakten, Ursachen und Prognose der Krankheit sowie (6) Informationen zur Motivationsunterstützung beim Selbstmanagement (vgl. Evans/Clarke 1983, S. 234-237). Zu jedem Zeitpunkt während des Verlaufs der Krankheit bestehen beim Patienten Informationsbedürfnisse in irgendeiner Form. Die spezifischen Informationsbedürfnisse von Patienten können sich dabei jedoch mit der Zeit verändern. So fanden beispielsweise Luker et al. (1996) heraus, dass erst kürzlich mit Brustkrebs diagnostizierte Frauen insbesondere das Bedürfnis nach Informationen über Heilungschancen, über das Stadium der Krankheit und über Behandlungsmöglichkeiten haben. Nach zwei Jahren dagegen überwiegen Bedürfnisse nach Informationen zu den Risiken für Familienmitglieder und den Nebenwirkungen der Behandlung[5] (vgl. S. 489 f.). Informationsbedürfnisse von Patienten dürfen dieser Studie zufolge also nicht als statisch angesehen werden, sondern entwickeln sich unter anderem je nach Ausmaß bisherigen Wissens und Stadium der Krankheit immer weiter. Insbesondere bei chronisch kranken Patienten zeigt sich, dass nach einer Anfangsphase in der Einführungs-Informationen, d.h. allgemeine Informationen zu der jeweiligen Krankheit, gewünscht werden, eine Phase folgt, in welcher viele Patienten zu Experten ihrer eigenen Krankheit werden und sehr spezifische und detaillierte Informationen suchen (vgl. Coulter/Entwistle/Gilbert 1998, S. 32). Inhaltlich lassen sich die Informationsbedürfnisse dabei unterteilen in (1) Informationen über Zugang und Möglichkeiten der Behandlung, (2) Informationen über die Erkrankung an sich und (3) Informationen zum Umgang mit der Krankheit. Es werden demnach sowohl technische als auch unterstützende Informationen gewünscht (vgl. Rees 1993, S. 3). In Gesprächen im Rahmen von Focus Groups innerhalb einer britischen Studie von Coulter, Entwistle und Gilbert (1998) wurden Patienten mit Rückenschmerzen, grauem Star, erhöhten Cholesterin-Werten, Depressionen, Mittelohrentzündungen, Hüftgelenkprothesen, Menstruationsstörungen, Schlaganfällen, Unfruchtbarkeit und Prostatavergrößerungen nach ihren Informationsbedürfnissen gefragt. Dabei konnten die folgenden Arten von Bedürfnissen eruiert werden:
(1) Das Bedürfnis danach, erklären zu können, was falsch gelaufen ist: Patienten berichteten davon, Informationen zu benötigen, um zu verstehen, was mit ihnen passiert und was ihre Symptome verursacht hat.
(2) Das Bedürfnis danach, eine realistische Vorstellung der Prognose zu erhalten: Menschen wünschen sich hoffnungsvolle aber ehrliche Antworten auf die Frage „Wie sieht meine Zukunft aus?“ (vgl. auch Hummelinck/Pollock 2006, S. 230).
(3) Das Bedürfnis danach, den Arztbesuch effektiv zu nutzen: Vor Arztbesuchen benötigen Patienten Informationen, um ihre Fragen formulieren und ihre Symptome klar beschreiben zu können. Nach Arztbesuchen wünschen sie sich Informationen, um sich an das Besprochene zu erinnern und um ungeklärte Fragen zu beantworten. Auch Fox und Fallows (2003) fanden in ihrer Studie zur Nutzung des Internets bezüglich Gesundheitsinformationen heraus, dass Menschen das Internet nutzen, um sich über für sie relevante Themen zu informieren und diese Informationen dann zu ihrem Arztbesuch mitzunehmen (vgl. S. 15).
(4) Das Bedürfnis danach, den Behandlungsprozess und Tests zu verstehen: Patienten wünschen sich Informationen um Behandlungsweisen zu verstehen und um entscheiden zu können, ob sie die empfohlene Behandlungsmethode durchführen wollen (vgl. auch Hummelinck/Pollock 2006, S. 230). Atkin (1973) beschreibt dieses Bedürfnis als das Bedürfnis nach Informationen zur Kontrolle der Situation, welche der Patient nur durch ein gewisses Level an Verständnis erreichen kann (vgl. S. 208 f.).
(5) Das Bedürfnis nach Unterstützung im Selbst-Management der Krankheit: Es werden Informationen darüber nachgefragt, was man selbst tun kann.
(6) Das Bedürfnis danach, Möglichkeiten der Hilfe kennen zu lernen: Patienten wünschen sich Informationen darüber, wer Hilfe anbietet und wie sie diese Hilfe bekommen können.
(7) Das Bedürfnis nach Absicherung und Hilfe bei der Bewältigung von Problemen: Patienten suchen nach Informationen, die ihnen vermitteln, dass sie nicht allein mit ihren Problemen sind und dass es jemanden gibt, der versteht, was sie durchmachen.
(8) Das Bedürfnis danach, Anderen helfen zu können, die Krankheit zu verstehen: Insbesondere für Familienmitglieder und Freunde, aber auch für Arbeitgeber und die allgemeine Öffentlichkeit wünschen sich viele Patienten Informationen, um in der Lage zu sein, ihre Krankheit erklären zu können. Dieses Bedürfnis ist auch insbesondere bei Eltern chronisch kranker Kinder sehr stark ausgeprägt (vgl. Collier et al. 2001 sowie Hummelinck/Pollock 2006, S. 230).
(9) Das Bedürfnis nach Informationen, um Ängste und Bedenken zu rechtfertigen: Wenn Patienten fühlen, dass Andere (z.B. Ärzte) ihre Probleme missverstehen, wünschen sie sich Informationsmaterialien, die ihre Probleme beschreiben, damit sie diese vorlegen können. Atkin beschreibt dieses Bedürfnis als das Bedürfnis nach Absicherung und nachträglicher Bestätigung, welches aus Selbst-Zweifeln heraus entsteht (vgl. Atkin 1973, S. 208 f.).
(10) Das Bedürfnis nach weiteren Informationen und Selbsthilfegruppen: Patienten wünschen sich Informationen darüber, wie sie ihr Wissen weiter vertiefen können und wo ihre Fragen beantwortet werden.
(11) Das Bedürfnis nach Informationen, um den besten Arzt zu finden: Wenn sie eine Unzufriedenheit mit dem behandelnden Arzt verspüren, wünschen sich Patienten Informationen darüber, woran man einen guten Arzt erkennt und wo man diesen finden kann.
(vgl. Coulter/Entwistle/Gilbert 1998, S. 29-32)
Die genannten Arten von Bedürfnissen konnten für Diabetespatienten bislang nicht eruiert werden. Es finden sich jedoch zum Informationsverhalten von Diabetespatienten in der Literatur einige qualitative Forschungsarbeiten, die sich ansatzweise mit deren Informationsbedürfnissen befassen. Als Informationsbedürfnisse werden in den vorhandenen Studien insbesondere Bedürfnisse nach Informationen zu bestimmten Themenbereichen genannt. Burke et al. (2006) fanden beispielsweise heraus, dass sich Diabetespatienten vorwiegend Informationen zu den Themenfeldern Blutzuckerkontrolle, Selbstkontrolle und -management sowie generelle Informationen zum Leben mit Diabetes wünschen. Zudem wird deutlich, dass Diabetespatienten, auch wenn ihre Diagnose schon sehr lange zurückliegt, sehr häufig nach Informationen in den Medien suchen (vgl. S. 111). Ein Teilnehmer fordert neu mit Diabetes Diagnostizierte sogar auf „Read or listen to get all the information you can on diabetes. ’Cause you’ll never learn all there is to know about diabetes“ (ebd., S. 110) während ein anderer fortführt: “You really have to stay on top of things” (ebd., S. 110). Darüber hinaus merkte eine andere Teilnehmerin an: “That [reading a lot of books] helped me a lot to realize that I have my life in hands. I can choose to do the right thing or take the consequences” (ebd., S. 111). Beeney, Bakry und Dunn (1996) eruierten in einer australischen Studie ebenfalls die Informationsbedürfnisse von Diabetikern zum Zeitpunkt der Diagnose[6]. Sie fanden dabei heraus, dass sich die Patienten in erster Linie um Injektionen, Ernährungseinschränkungen, Alltagsbeeinträchtigungen und Komplikationen Sorgen machen und sich zum Zeitpunkt der Diagnose Informationen vor allem in Form eines Diabetes-Lehrers oder eines mehrtägigen Kurses wünschen. Aus welchen Beweggründen heraus Diabetespatienten jedoch nach Informationen suchen, konnte bislang noch nicht dargestellt werden. Auf diesen Punkt wird daher in der vorliegenden Studie ein Schwerpunkt gelegt und so wird insbesondere aufgezeigt, warum Diabetespatienten nach Informationen suchen.
3.2.3 Merkmale von nach Informationen suchenden Patienten
Die Frage, ob soziodemographische Merkmale von Patienten einen Einfluss auf deren Informationsbedürfnisse haben und wenn ja, wie groß dieser Einfluss ist, wurde in vielen Studien erforscht. Die meisten Studien konnten dabei einen Einfluss des Alters und des Geschlechts der Patienten, sowie deren Ausbildung und Einkommen auf die Informationsbedürfnisse beziehungsweise das Informationssuchverhalten bezüglich gesundheitsrelevanter Informationen zeigen (vgl. Almeida 1997, S. S18; Ramadhan/Viswanath 2006, S. 132; Dutta-Bergman 2003, S. 103 f.).
Beispielsweise erforschten Ramanadhan und Viswanath (2006) in einer Studie diejenigen, die nicht aktiv nach gesundheitsrelevanten Themen suchen („information nonseekers“)[7]. Sie fanden wichtige Unterschiede zwischen nach Informationen Suchenden und Nicht-Suchenden bezüglich Ausbildung und Einkommen, Aufmerksamkeit und Vertrauen in die Medien und allgemeinem Gesundheitsverhalten. Insbesondere Ausbildung und Einkommen beeinflussen ihren Ergebnissen zu Folge, ob eine Person nach Informationen sucht oder nicht (vgl. S. 134). Je höher dabei das Einkommen und die Ausbildung sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Rezipient aktiv nach Informationen sucht. Zudem sind nicht nach Informationen Suchende durchschnittlich sechs Jahre älter als nach Informationen Suchende (vgl. ebd. S. 135). Auch Rutten, Squiers und Hesse (2006) fanden in den USA heraus, dass Krebspatienten, die aktiv nach Informationen suchen, eher weiblich und unter 65 Jahre alt sind, aber dafür ein Einkommen von über $50000 und einen College-Abschluss haben sowie bereits an Krebs erkrankte Familienmitglieder aufweisen[8] (vgl. S. 147).
Über die soziodemographischen Variablen hinaus, konnten Matthews et al. (2002) sogar noch weitere Faktoren aufzeigen, die das Informationsverhalten von afro-amerikanischen Krebspatienten beeinflussen: (1) Veranlagungen oder Neigungen, wie soziale oder psychologische Variablen, die bereits vor der Informationssuche bestanden, (2) Ermöglichungs-Variablen, d.h. Faktoren welche die Informationssuche beeinflussen oder behindern, und (3) verstärkende Ergebnisse des Verhaltens, d.h. der wahrgenommene Nutzen des Informations-Such-Verhaltens. Als wichtige Faktoren, die das Informationsverhalten der Befragten beeinflussen, stellten sich eingeschränktes Wissen, Fehlinformationen über Krebs, Misstrauen Ärzten gegenüber, Bedenken zu Privatsphäre, religiöse Gründe und Angst heraus[9] (vgl. S. 213-216).
Maibach et al. (2006) erforschten die Präferenzen von Konsumenten bezüglich Gesundheitsinformationen und entwickelten ein Instrument, um diese in Segmente zu unterteilen, welche spezifisch angesprochen werden können. Sie identifizierten vier Segmente von Konsumenten, die sich signifikant in ihren Präferenzen bezüglich Gesundheitsinformationen bezogen auf das Ausmaß ihres Engagements bei der Gesundheitsverbesserung und ihrem Ausmaß an Unabhängigkeit beim Treffen von gesundheitsbezogenen Entscheidungen unterscheiden. Das erste Segment beinhaltet die „Unabhängigen Aktiven“. Sie erachten Informationen zu Gesundheit und Prävention als wichtig und erarbeiten gesundheitliche Entscheidungen gemeinsam mit ihrem Arzt. Sie sind eher weiblich, besser gebildet und besser verdienend und glauben extrem gut über Gesundheitsthemen Bescheid zu wissen. „Arzt-abhängige Aktive“ dagegen sprechen gesundheitsrelevanten Informationen zwar auch einen großen Stellenwert zu, können diese allerdings nicht immer verstehen und vertrauen am meisten den Entscheidungen ihres Arztes. Sie sind eher älter und geringer verdienend. „Unabhängige Passive“ suchen eher nicht selbständig nach gesundheitsrelevanten Informationen, haben oft keine kollaborative Zusammenarbeit mit ihrem Arzt und treffen gesundheitsrelevante Entscheidungen meist allein. Sie sind die jüngsten unter den Segmenten und eher männlich. Demgegenüber haben „Arzt-abhängige Passive“ eine bessere Beziehung zu ihrem Arzt und vertrauen auf dessen Entscheidungen ohne sich selbst zu informieren. Sie sind dabei zumeist männlich und geringer verdienend[10].
Außerdem konnte gezeigt werden, dass ein hoher signifikanter Einfluss von allgemeinem Gesundheitsbewusstsein auf das Informationsverhalten von Patienten besteht. Je stärker sich demnach Patienten mit ihrer Krankheit identifizieren und je höher ihr Involvement – also ihr Engagement bzw. ihre Ich-Beteiligung – bezüglich Gesundheit ist, desto häufiger suchen sie nach gesundheitsrelevanten Informationen[11] (vgl. Dutta-Bergman 2003, S. 106).
3.3 Quellen für gesundheitsrelevante Informationen
Rezipienten haben auf Grund unterschiedlicher Bedürfnisse jeweils ganz spezifische Präferenzen für Quellen gesundheitsrelevanter Informationen. Eine Informationsquelle bzw. eine Gruppe von Informationsquellen, die einen großen Einfluss auf das Verhalten der Rezipienten hat, sind die Medien. Viele Studien haben gezeigt, dass Patienten eine Vielzahl verschiedener Medien nutzen, um sich über ihre Krankheit zu informieren, und sie dadurch auch die größtmögliche Wissenserweiterung erfahren (vgl. Almeida 1997 zu gesunder Ernährung; Rees/Barth 2000 zu Brustkrebs; Belongia et al. 2002 zu Antibiotika; Meischke et al. 2002 zu Herzinfarkt bei Frauen). Abbildung 2 verdeutlicht die Nutzung von Medien für gesundheitsrelevante Informationen bezogen auf Schulabschluss und Alter. Dabei wird ersichtlich, dass Zeitungen und Zeitschriften insbesondere von Älteren, dagegen das Internet vor allem von Jüngeren genutzt wird, dass Familie und Bekannte für alle Alters- und Bildungsklassen als Informationsquellen gleichbedeutend sind, der Hausarzt insbesondere bei Älteren und geringer Gebildeten eine wichtige Rolle spielt und Bücher als Informationsmedien vor allem Älteren und höher Gebildeten dienen[12] (vgl. Böcken 2004, S. 13).
Abbildung 2: Nutzung verschiedener Quellen für Gesundheitsinformationen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten(Quelle: Böcken 2004, S. 13)
Von Diabetespatienten werden in bisherigen Studien zum einen Massenmedien, zum anderen aber auch Personen bzw. deren Meinung als bevorzugte Informationsquelle genannt. Eine finnische Studie beschäftigte sich beispielsweise im Jahr 2003 sowohl mit der Nutzung von Massenmedien und anderen Quellen zu gesundheitsrelevanten Themen, als auch mit dem existierenden Wissen über Gesundheitsthemen und mit Gesundheits- und Essgewohnheiten[13]. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass sich die Befragten nach ihrer Informationsquelle in drei Gruppen einteilen lassen (vgl. Eriksson-Backa 2003, S. 96). In der ersten Gruppe werden Befragte zusammengefasst, die sich vorwiegend bei ihren Ärzten zu gesundheitsrelevanten Themen informieren. Die zweite Gruppe umfasst diejenigen Probanden, die eine Präferenz für Zeitschriften und Bücher zum Thema Gesundheit aufweisen. Diese Gruppe weist die aktivste Informationssuche auf. Dagegen bezieht die dritte Gruppe ihre gesundheitsrelevanten Informationen größtenteils aus dem Fernsehen und der Zeitung und ist am wenigsten interessiert und aktiv in ihrer Informationssuche. In der Gruppe der Zeitschriften und Bücher Lesenden sind 50 Prozent mit den erhaltenen Informationen zufrieden, wohingegen die andere Hälfte insbesondere Qualitätsgarantien und eine größere Fülle an Informationen mit verschiedenen Standpunkten vermissen (vgl. Eriksson-Backa 2003, S. 96 f.). Carlson et al. (2006) fanden darüber hinaus heraus, dass insbesondere über 60-jährige Diabetiker und diejenigen mit einer Ausbildung von weniger als 12 Jahren, Probleme haben, das Internet und Bibliotheken bei Ihrer Suche zu nutzen. Sie verlassen sich lieber auf Ärzte, Ehepartner und Freunde. Die Autoren konnten darüber hinaus eruieren, dass Internetnutzer offener über ihre Erfahrungen mit ihrer Krankheit sprechen, mehr in Entscheidungen involviert sind und ein größeres Wissen über ihre Krankheit haben[14]. Dabei geben in den USA 10,4 Prozent der Diabetespatienten an, das Internet oft für gesundheitsrelevante Informationen zu nutzen, 15,8 Prozent tun dies manchmal, 9,1 Prozent nutzen das Internet hierfür kaum und 64,7 Prozent nie[15] (vgl. Ayers/Kronenfeld 2007). Hierbei muss allerdings beachtet werden, dass mehr als die Hälfte der Diabetiker älter als 65 Jahre alt ist (vgl. Scherbaum/Kiess 2004, S. 32).
Zu den am meisten genutzten Quellen für gesundheitsrelevante Informa-tionen gehören demnach Printmedien, Fernsehen, Internet sowie Ärzte und andere Gesundheitsspezialisten. Auf diese wird daher im Folgenden genauer eingegangen.
[...]
[1] Diabetes ist die Kurzform von Diabetes mellitus. In Deutschland wird Diabetes auch als Zuckerkrankheit bezeichnet.
[2] Befragt wurden hierfür 2517 Personen der deutschen Bevölkerung ab 14 Jahren mittels einer Telefonbefragung (CAPI) im Zeitraum zwischen dem 1. März und den 17. April 2003.
[3] Die Daten beruhen auf zwei Befragungen: zum einen einer telefonischen Befragung von 12751 mindestens 18-jährigen Amerikanern zwischen März und August 2000 und zum anderen einer ebenfalls telefonischen Befragung von 2109 über 18-jährigen Amerikanern zwischen dem 3. und dem 14. August 2000.
[4] Retinopathien sind Erkrankungen der Netzhaut des Auges, welche die Sehschärfe mindern, das Gesichtsfeld einschränken und zudem zu Erblindungen führen können.
[5] Hierfür wurden 105 Frauen mit Brustkrebs aus einer Klinik in Großbritannien sowohl zum Zeitpunkt der Diagnose als auch ca. 21 Monate später persönlich interviewt.
[6] Sie befragten hierfür zum einen 1159 Diabetespatienten mittels schriftlicher Fragebögen und interviewten zum anderen 100 Ärzte telefonisch zu den Ergebnissen der Patientenbefragung.
[7] Mit Hilfe von Daten des National Cancer Institute aus der Health Information National Trends Survey 2003 eruierten die Autoren demographische und psychografische Charakteristika von vier Gruppen von Menschen: Krebspatienten, die Informationen bezüglich Krebs suchen; Krebspatienten, die keine Informationen bezüglich ihrer Krankheit suchen; nicht an Krebs Erkrankte, die nach Informationen bezüglich Krebs suchen und nicht an Krebs Erkrankte, die nicht nach Informationen bezüglich Krebs suchen.
[8] Die Daten hierfür stammen aus der 2003 Health Information National Trends Survey (HINTS), für welche 6149 erwachsene Amerikaner telefonisch interviewt wurden.
[9] Hierfür wurden 21 afro-amerikanische Krebspatienten (vier Männer und 17 Frauen) im Rahmen von Focus Groups befragt.
[10] Maibach et al. nutzten zur Erhebung dieser Ergebnisse die Datenbank von Porter Novellis HealthStyles 1999 und 2003. Diese Datenbank enthält Daten von zwei repräsentativen Postbefragungen der erwachsenen US-Bevölkerung pro Jahr. Die Stichprobe bestand im Jahr 1999 aus 2636 und im Jahr 2003 aus 4035 Befragten.
[11] Hierfür wurden die Daten einer jährlichen Verbraucherstudie von DDB Needham, Inc. aus dem Jahr 1998 genutzt, an welcher 3388 erwachsene US-Amerikaner aus insgesamt 48 Staaten teilgenommen und einen schriftlichen Fragebogen ausgefüllt haben.
[12] Die Daten stammen zum einen aus einer repräsentativen schriftlichen Befragung von zweimal 1500 erwachsenen Deutschen und einer telefonischen Ärztebefragung von 500 in Deutschland niedergelassenen Ärzten, die nach Facharztgruppe quotiert wurden.
[13] Die Stichprobe bestand dabei aus 50 Finnen, von welchen 17 an Diabetes erkrankt und 18 schwanger waren, da bei diesen ein erhöhtes Interesse an Ernährungsthemen angenommen wurde. Die Teilnehmer der Studie wurden zwischen Januar und Juli 2001 persönlich mittels Leitfadeninterviews befragt.
[14] Hierfür befragten sie im Jahr 2005 zum einen 306 afro-amerikanische Diabetiker in Charleston und Georgetown (USA) mit schriftlichen Fragebögen und zum anderen 28 afro-amerikanische Diabetiker im Rahmen von Focus Groups.
[15] Diese Daten entstammen einer Studie auf Grundlage von Daten der „Impact of the Internet and Advertising on Patients and Physicians, 2000-2001“ (United States), für welche eine aus 4188 Befragten bestehende repräsentative Stichprobe der erwachsenen US-Bevölkerung mittels Telefoninterviews befragt wurde.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2008
- ISBN (eBook)
- 9783836631686
- DOI
- 10.3239/9783836631686
- Dateigröße
- 1.6 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Technische Universität Ilmenau – Mathematik und Naturwissenschaften, Medien- und Kommunikationswissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2009 (Juni)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- diabetes informationsverhalten gesundheitskommunikation public relation chronische erkrankung
- Produktsicherheit
- Diplom.de