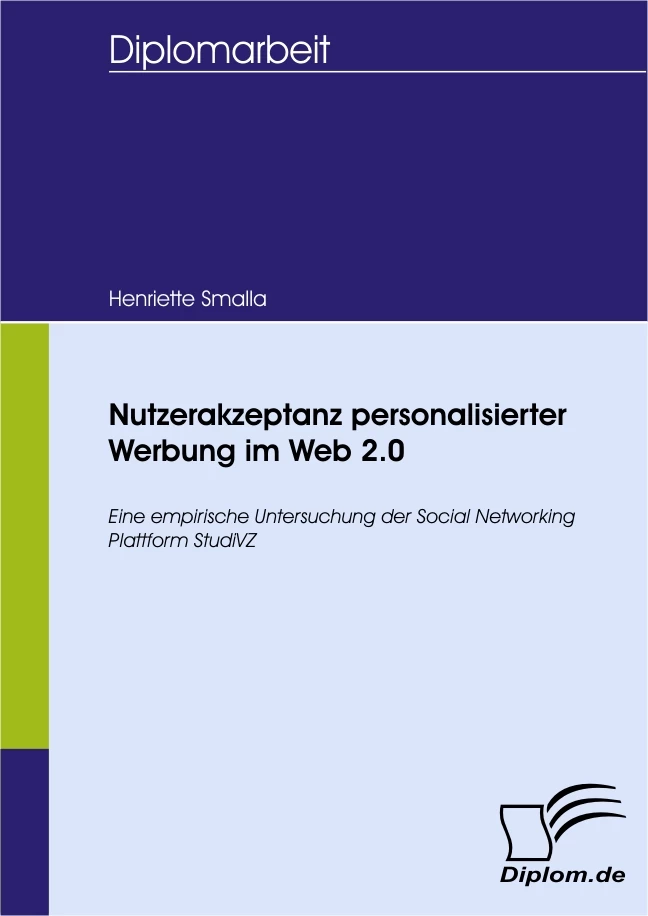Nutzerakzeptanz personalisierter Werbung im Web 2.0
Eine empirische Untersuchung der Social Networking Plattform StudiVZ
Zusammenfassung
Das Internet durchlebte in den letzten zehn Jahren zweifelsohne bedeutende Veränderungen sowohl in technologischer und inhaltlicher Hinsicht als auch im Hinblick auf das Umfeld. Durch die zunehmende Verbreitung wurde das Massenmedium vor allem für die Werbeindustrie interessanter. Dabei ist eine der großen Stärken, die durch die technologischen Entwicklungen des World Wide Web erzeugt wurde, die Reduzierung von Streuverlusten in der Online-Werbung. Mithilfe sogenannter Targeting-Methoden ist es möglich, exakt definierte Zielgruppen bzw. Zielpersonen mit der für sie relevanten Werbung zu erreichen. Somit erlaubt die Technik eine Individualkommunikation im Massenpublikum. Voraussetzung der personalisierten Ansprache von Nutzern ist die Erfassung personenbezogener Daten. Diese gestatten die Erstellung eines umfassenden Präferenzprofils, anhand dessen geeignete Werbung für die Zielpersonen ausgewählt werden kann. Die vorliegende Diplomarbeit beschäftigt sich in den folgenden Kapiteln mit den Rahmenbedingungen der personalisierten Werbung. Sie beleuchtet die technologischen Entwicklungen des Internets als Voraussetzung und Triebmittel für die Verbreitung persönlicher Daten, im Speziellen bedingt durch die Bildung virtueller Netzwerke.
Betrachtet man die weltweite Internetnutzung im Allgemeinen, so lässt sich feststellen, dass die Verbreitung des Internets in den letzten Jahren permanent gestiegen ist. Gemäß einer Studie des IT-Branchenverbandes Bitkom zählen 2007 1,23 Milliarden Menschen zu den Internet-Verwendern. Im Jahr 2002 waren im Vergleich dazu lediglich rund 600 Millionen Personen im Netz aktiv. Damit hat sich die Zahl in den letzten fünf Jahren folglich verdoppelt. Fast jeder fünfte Mensch ist heutzutage online. Laut Bitkom wird die Zahl der Internetnutzer bis 2010 auf 1,5 Milliarden ansteigen. Auch in der Bundesrepublik ist dieser Trend zu beobachten. Die Internetnutzung überschreitet deutschlandweit erstmalig die 40-Millionen-Grenze. Die Studie internet facts 2007-IV der Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V. (AGOF) zeigt auf, dass 41,32 Millionen Deutsche ab 14 Jahren das Internet nutzen. Dies entspricht 63,7 Prozent der deutschen Bevölkerung. Das Web gehört hierzulande schon längst zum Alltag und ist aus diesem nicht mehr wegzudenken.
Hintergrund solcher Entwicklungen sind, unter anderem, die seit der Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes 1989 rückläufigen Kosten für den Internetgebrauch. Die Preise […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Einführung in die Problemstellung
1.2 Ziel und Methodik der Arbeit
2 Web 2.0
2.1 Web 2.0 vs. Web 1.0
2.2 Prinzipien des Web 2.0
2.3 Soziale Netzwerke (real und virtuell)
2.4 Social Networks (Definition, Abgrenzung, Beispiele)
2.4.1 Netzwerkeffekte und Kritische-Masse-Phänomen
2.4.2 Selbstdarstellung im Netz
3 Online-Werbung
3.1 Determinanten der Online-Werbung
3.2 Werbeformen im Internet
3.3 Defizite ungerichteter Massenkommunikation im Internet
3.4 Bedeutung und Möglichkeiten der Personalisierung im Internet
3.4.1 Marktsegmentierung und ihre Bedeutung für die Personalisierung von Online-Werbung
3.4.1.1 Markterfassung: Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten
3.4.1.2 Datenschutzaspekte auf Basis informationeller Selbstbestimmung
3.4.1.3 Marktbearbeitung durch die Methoden des Targetings
3.4.2 Relevanz von Social Networks als Werbeplattform
3.4.3 StudiVZ
3.4.3.1 Das Konzept
3.4.3.2 Aktuelle Entwicklungen und externe Rahmenbedingungen
4 Zwischenfazit
5 Methodische Vorgehensweise der empirischen Studie
5.1 Zielsetzung und Forschungsfragen
5.2 Auswahl und Darstellung der Erhebungsmethode
5.3 Organisation und Durchführung der Studie
5.4 Aufbereitung der Daten
6 Darstellung der Ergebnisse
6.1 Beschreibung der Stichprobe
6.1.1 Soziodemografische Faktoren
6.1.2 Allgemeine Faktoren der Social Network-Nutzung
6.1.3 Mitgliedsspezifische Faktoren der StudiVZ-Nutzung
6.2 Themenkomplex „Werbung“
6.2.1 Allgemeine Einstellungen gegenüber Online-Werbung
6.2.2 Spezifische Einstellung gegenüber personalisierter Werbung
6.3 Themenkomplex „Sicherheits- und Sichtbarkeitseinstellungen“
6.3.1 Profildarstellung und eigener Datenschutz
6.3.2 Akzeptanz personalisierter Werbung und Gegenmaßnahmen
7 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse
7.1 Mitgliederprofil
7.2 Netzwerkeffekt (Forschungsfrage 1)
7.3 „Strength of Weak Ties“ und soziales Kapital (Forschungsfrage 2)
7.4 Gebührenaspekt (Forschungsfrage 1)
7.5 Bedeutung der Selbstdarstellung (Forschungsfrage 2)
7.6 Anonymitätsaspekt (Forschungsfrage 3)
7.7 Privatsphäre und Datenschutz (Forschungsfrage 3)
7.8 Online-Werbung in Social Networks (Forschungsfrage 4)
7.9 Personalisierte Online-Werbung (Forschungsfrage 5)
8 Fazit und Ausblick
Literaturverzeichnis
Anhang: Fragebogen
Eidesstattliche Erklärung
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Zusammenhänge im Web 2.0
Abb. 2: Motivationen für die Nutzung von Social Networks
Abb. 3: Zusammenhang von Anwenderzahl und Nutzen
Abb. 4: Positive Rückkopplung
Abb. 5: Annahme-Dynamik
Abb. 6: Komponenten der Marktsegmentierung
Abb. 7: Unpersonalisierte Angebote und personalisierte Angebote
Abb. 8: Einordnung von Datenquellen in Benutzerprofilen
Abb. 9: Community-Modell
Abb. 10: Wirkungsgefüge von Mitgliederprofilen in Social Networks
Abb. 11: Mitgliederwachstum der Studentenplattform StudiVZ
Abb. 12: Geschlechterverteilung der Stichprobe (n=210)
Abb. 13: Aktuell ausgeübte Tätigkeit der Stichprobe (n=210)
Abb. 14: Faktoren der Attraktivität von Social Networks
Abb. 15: Gründe für einen wahrscheinlichen Austritt aus Social Networks
Abb. 16: Verwendungszwecke des StudiVZ
Abb. 17: Beurteilung von Internet-Werbung
Abb. 18: Beurteilung der Werbung im StudiVZ
Abb. 19: Beurteilung von Werbeformen im StudiVZ
Abb. 20: Mittelwertevergleiche der Geschlechter im Hinblick auf die Werbeformen
Abb. 21: Erwartete Konsequenzen für den personalisierten Werbeeinsatz
Abb. 22: Bevorzugte Ortsbezogenheit der Werbebotschaften (n=210)
Abb. 23: Einstellungen in der Profilsichtbarkeit (n=210)
Abb. 24: Anlässe für Namensänderungen bzw. Profilsperrungen
Abb. 25: Opting-Out-Einstellungen der Stichprobe (n=210)
Abb. 26: Akzeptanz von Maßnahmen für die personalisierte Werbeauslieferung
Tabellenverzeichnis
Tab. 1: Exemplarische Auswahl an Social Networking Plattformen
Tab. 2: Determinanten der Online-Werbung
Tab. 3: Internet-Werbeformen
Tab. 4: Altersdurchschnitt (n=210)
Tab. 5: Verteilung der Stichprobe nach Bildungsabschlüssen (n=210)
Tab. 6: Anzahl der parallel genutzten Social Networks
Tab. 7: Verteilung der Stichprobe nach genutzten Netzwerken (Mehrfachantworten) und Auswahl nach Primärgebrauch (n=210)
Tab. 8: Ergebnis des T-Tests für unabhängige Stichproben mit der Testvariable „Angst vor Missbrauch meiner Daten“ und der Gruppenvariable „Geschlecht“ (n=210)
Tab. 9: Verteilung der Stichprobe nach Dauer der Internetnutzung (n=210)
Tab. 10: Verteilung der Stichprobe nach der Nutzungsfrequenz des StudiVZ (n=210; weiblich =111, männlich=99)
Tab. 11: Verteilung der Stichprobe nach der Verweildauer im StudiVZ (n=210; weiblich =111, männlich=99)
Tab. 12: Gegenüberstellung der Anzahl bestätigter Kontakte und Freundschaftsbeziehungen (n=210)
Tab. 13: Anzahl an Gruppenmitgliedschaften und genutzte Gruppen für den Informationsbezug (n=210)
Tab. 14: Ergebnis des T-Tests für unabhängige Stichproben mit der Testvariable „Spezielle Angebotswerbung“ und der Gruppenvariable „Geschlecht“ (n=210)
Tab. 15: Informationsbezug über die Neuerungen im StudiVZ (Angaben in %; n=210)
Tab. 16: Ergebnisse der Mittelwertevergleiche der Variablen „Unsicherheit über Veränderungen“ und „Informationen aus Nachrichten/Mundpropaganda“ (n=210)
Tab. 17: Ergebnisse der Korrelationsrechnung nach Pearson
Tab. 18: Lauterkeit der Namenskennung und Profilangaben (Angaben in %; n=210)
Tab. 19: Ergebnis des Chi-Quadrat-Tests für die Variablen „Informiert/keine Sperrung“ und „Geschlecht“ (n=210)
Tab. 20: Ergebnis des T-Tests für unabhängige Stichproben mit der Testvariable „Nach Bekanntgabe personalisierter Werbung Profilangaben entfernt“ und der Gruppenvariable „Datenweitergabe an Dritte“ (n=210)
Tab. 21: Ergebnisse der Korrelationsrechnung nach Pearson (n=210)
Tab. 22: Ergebnisse der Korrelationsrechnung nach Pearson (n=210)
Tab. 23: Ergebnisse der Korrelationsrechnung nach Pearson (n=210)
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Einleitung
Das Internet durchlebte in den letzten zehn Jahren zweifelsohne bedeutende Veränderungen sowohl in technologischer und inhaltlicher Hinsicht als auch im Hinblick auf das Umfeld. Durch die zunehmende Verbreitung wurde das Massenmedium[1] vor allem für die Werbeindustrie interessanter. Dabei ist eine der großen Stärken, die durch die technologischen Entwicklungen des World Wide Web erzeugt wurde, die Reduzierung von Streuverlusten in der Online-Werbung. Mithilfe sogenannter Targeting-Methoden ist es möglich, exakt definierte Zielgruppen bzw. Zielpersonen mit der für sie relevanten Werbung zu erreichen. Somit erlaubt die Technik eine Individualkommunikation[2] im Massenpublikum. Voraussetzung der personalisierten Ansprache von Nutzern ist die Erfassung personenbezogener Daten. Diese gestatten die Erstellung eines umfassenden Präferenzprofils, anhand dessen geeignete Werbung für die Zielpersonen ausgewählt werden kann. Die vorliegende Diplomarbeit beschäftigt sich in den folgenden Kapiteln mit den Rahmenbedingungen der personalisierten Werbung. Sie beleuchtet die technologischen Entwicklungen des Internets als Voraussetzung und Triebmittel für die Verbreitung persönlicher Daten, im Speziellen bedingt durch die Bildung virtueller Netzwerke.
Betrachtet man die weltweite Internetnutzung im Allgemeinen, so lässt sich feststellen, dass die Verbreitung des Internets in den letzten Jahren permanent gestiegen ist.[3] Gemäß einer Studie des IT-Branchenverbandes Bitkom zählen 2007 1,23 Milliarden Menschen zu den Internet-Verwendern. Im Jahr 2002 waren im Vergleich dazu lediglich rund 600 Millionen Personen im Netz aktiv. Damit hat sich die Zahl in den letzten fünf Jahren folglich verdoppelt. Fast jeder fünfte Mensch ist heutzutage online. Laut Bitkom wird die Zahl der Internetnutzer bis 2010 auf 1,5 Milliarden ansteigen. Auch in der Bundesrepublik ist dieser Trend zu beobachten.[4] Die Internetnutzung überschreitet deutschlandweit erstmalig die 40-Millionen-Grenze. Die Studie internet facts 2007-IV der Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V. (AGOF) zeigt auf, dass 41,32 Millionen Deutsche ab 14 Jahren das Internet nutzen. Dies entspricht 63,7 Prozent der deutschen Bevölkerung. Das Web gehört hierzulande schon längst zum Alltag und ist aus diesem nicht mehr wegzudenken.[5]
Hintergrund solcher Entwicklungen sind, unter anderem, die seit der Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes 1989 rückläufigen Kosten für den Internetgebrauch.
Die Preise haben sich im Durchschnitt seit dem Jahr 2000 nahezu halbiert.[6] Darüber hinaus kommt auch den neuen Breitbandanschlüssen bei der Nutzungszunahme Bedeutung zu. Analoge Modemzugänge oder ISDN konnten durch schnellere DSL-Verfahren substituiert werden. Bereits 40 Prozent der deutschen Haushalte gehen heute über einen Breitbandzugang ins Netz.[7] Erst die sinkenden Preise für die Nutzung und die schnelleren Internetanschlüsse ermöglichten es, dass das Web von einer großen Masse erschlossen wurde. Den Usern erlauben solche Bedingungen, immer mehr Zeit im Internet zu verbringen. Waren es 1997 noch 76 Minuten, sind es 2007 schon 118 Minuten tägliche Verweildauer im Netz.[8]
Diese Entwicklungen ziehen einen weiteren Trend mit sich, der insbesondere für die Werbeindustrie von Bedeutung ist. Gemäß den Erhebungen der AGOF verwenden 96,7 Prozent der Internetnutzer das Netz als Informationsquelle für Produktinformationen.[9] Dabei haben 79,7 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten Produkte im Internet gekauft.[10] Die zentrale Rolle, die das World Wide Web in der Bevölkerung und insbesondere im Hinblick auf den Entscheidungs- und Kaufprozess, inzwischen einnimmt[11], macht das Internet für die Werbeindustrie zu einem höchst gefragten Medium. Dies verdeutlicht ebenfalls die Werbestatistik des Online-Vermarkter-Kreises im Bundesverband Digitale Wirtschaft (OVK). Rund 2,9 Milliarden Euro wurden von der Werbewirtschaft im Jahr 2007 in Online-Werbung investiert.[12] Dabei sei das Potenzial des Online-Werbemarktes laut Ludger Wibbelt, Geschäftsführer der Nielsen Media Research GmbH, noch längst nicht ausgeschöpft.[13]
1.1 Einführung in die Problemstellung
Die erweiterten Internettechnologien sowie die Verbreitung des Webs führen zu zahlreichen neuen Anwendungen und zu Veränderungen in der Internetnutzung für den User. War dieser in früheren Zeiten bloßer Informationskonsument, kann er sich heutzutage aktiv beteiligen und eigene Inhalte einer Weltöffentlichkeit zugänglich machen. Das Web wandelt sich zunehmend zum „Mitmach-Netz“[14], bedingt durch benutzerfreundliche Softwarelösungen.
Ein Schlagwort, welches in diesem Zusammenhang regelmäßig fällt, ist das des „Web 2.0“. Dieser Begriff wird gemeinhin zusammenfassend für die aktuellen Entwicklungen des World Wide Web verwendet. Die Zunahme der internetnutzenden Bevölkerung und die Möglichkeit der Partizipation der User im Web 2.0 bedingt, unter anderem, das Entstehen sogenannter „Social Networking Plattformen“[15]. Das Wesen dieser Kontakt- und Beziehungsnetzwerke gründet sich auf den nutzergenerierten Inhalten ihrer Mitglieder. Sorgte in den 80er-Jahren die Volkszählung und die damit einhergehende Erfassung personenbezogener Daten in der Bundesrepublik noch für deutschlandweiten Aufruhr[16], zeichnet sich heute ein genauer Gegentrend ab. Die Deutschen machen ihr Leben zunehmend öffentlich.[17] Bereits jeder Fünfte stellt private Informationen, etwa in Form von Profilen, ins Netz, wobei 10 Prozent der Deutschen über eine Internet-Präsenz in Social Networks verfügen. Dabei sind Online-Communities gerade bei Schülern und Studenten beliebt und werden von 45 Prozent dieser Gruppe zur Eigendarstellung genutzt.
Die nutzergenerierten Inhalte in solchen Netzwerken besitzen insbesondere für die Werbeindustrie Attraktivität. Sie können Aufschluss über soziodemographische Daten und psychographische Angaben, wie etwa Interessen oder Vorlieben, geben. Anhand der Informationen ist es möglich, Präferenzprofile der Mitglieder zu erstellen und diese für die Werbeansprache zu verwenden. Dieses Potenzial hat die Werbeindustrie bereits erkannt. Weltweit wurden 1,2 Millionen Dollar in Social Network-Werbung investiert, wobei nach Schätzungen des Marktforschungsinstitutes Emarketer mit einer Verdreifachung dieser Zahl bis 2011 gerechnet werden kann.[18] Diesen Trend schöpfen immer mehr soziale Netzwerke, wie etwa das deutsche Studentenportal StudiVZ, aus, indem sie die persönlichen Angaben ihrer Mitglieder für die Verteilung personalisierter Werbung einsetzen und somit ihre Plattformen kommerziell vermarkten.
Welche Wirkungen eine solche Monetarisierung des nutzergenerierten Contents auf die Nutzer hat, ist weitestgehend unerforscht. Die vorliegende Arbeit wird sich in den nachfolgenden Kapiteln aus diesem Grund mit folgenden Forschungsfragen beschäftigen:
- Was bringt Nutzer dazu, freiwillig persönliche Informationen im Web preiszugeben?
- Welche Möglichkeiten bieten Targeting-Formen für die Nutzeransprache?
- Welches Potenzial bergen Social Communities für die Werbeindustrie?
-
- Wie stehen die Nutzer personalisierter Werbung und der Verwendung ihrer Daten gegenüber?
- Welche Reaktionen auf personalisierte Werbung sind auf lange Sicht von den Mitgliedern solcher Communities zu erwarten?
1.2 Ziel und Methodik der Arbeit
Wie bereits erläutert, zeichnet sich durch die Möglichkeiten des Internets ein neuer Trend in der Werbeansprache ab. Der Einsatz von Targeting-Methoden in Social Networking Plattformen hat dabei sowohl Auswirkungen auf die Nutzer als auch auf die Community-Betreiber.
Aufgrund der relativ jungen Werbeart existieren noch große Forschungslücken in diesem Bereich. Ziel der Arbeit ist es, aufbauend auf den theoretischen Erkenntnissen der personalisierten Werbung und deren Rahmenbedingungen, die Nutzerakzeptanz der Mitglieder in Social Networks gegenüber personalisierter Werbung mittels einer empirischen Studie zu erfassen. Dabei soll sich der Begriff der Nutzerakzeptanz in dieser Abhandlung nicht auf die enge Definition der Bereitschaft, diese Werbeart zu tolerieren, beschränken, sondern schließt darüber hinaus die Erfassung der Wirkungen bzw. Auswirkungen des Targetings auf die Mitglieder mit ein. Auf die Wirkungseffizienz einzelner Werbemittel und -träger wird verzichtet. Gleichermaßen sollen technologische Aspekte im theoretischen Teil nur am Rande, und soweit zum Verständnis des Untersuchungsgegenstandes notwendig, erläutert werden. Anhand der theoretischen Erkenntnisse und der empirischen Ergebnisse sollen abschließend, hinsichtlich der Gestaltung solcher personalisierter Werbeauslieferung, Handlungsempfehlungen für die Community-Betreiber ausgesprochen werden.
Die vorliegende Arbeit gliedert sich in 8 Kapitel. Im Anschluss an das 1. Kapitel, welches die Einführung in das Thema bildet, wird in Kapitel 2 unter dem Schlagwort „Web 2.0“ auf die wichtigsten Neuerungen des Internets eingegangen. Diese bilden die Grundlage und Voraussetzung für das Entstehen und den Aufbau von Social Networking-Plattformen, deren Themenumfeld im selben Abschnitt näher beleuchtet wird. Anschließend werden die Triebkräfte für das zunehmende Wachstum der Communities (Netzwerkeffekte) und für die ansteigende Datenfülle (Selbstexhibitionismus) aufgeführt. Das 3. Kapitel ist dem Werbemedium „Internet“ gewidmet und präsentiert in einem ersten Schritt die Charakteristiken der Online-Werbung, um nachfolgend auf die Defizite der ungerichteten Massenkommunikation näher einzugehen. Darauf aufbauend erfolgt die Darstellung der personalisierten Werbeauslieferung als Perspektive, die Mängel der klassischen Werbeansprache zu kompensieren. Ein wichtiger Aspekt bildet die Datenerfassung als wesentliche Voraussetzung für eine individuelle Werbekommunikation und wird, ergänzt durch die damit zusammenhängende Datenschutzproblematik, ebenfalls in Kapitel 3 erörtert. Es schließt die Darstellung der verschiedenen Targeting-Methoden an. Der letzte Teil dieses Kapitels ermöglicht den wesentlichen Brückenschlag zu den Networking-Plattformen, indem dieser auf die Relevanz der Communities als Werbeplattform näher fokussiert. Die Vorstellung der Studentenplattform StudiVZ, welche als Unternehmensbeispiel dient, beendet dieses Kapitel. Das 4. Kapitel bildet das Zwischenfazit, in welchem aufbauend auf den theoretischen Ergebnissen die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst werden, um nachfolgend in Kapitel 5 die empirische Studie zu beginnen. Auf Basis der Ergebnispräsentation sollen die Resultate anschließend interpretiert und diskutiert werden. Die Arbeit schließt mit einem Fazit und dem Ausblick in Kapitel 8.
2 Web 2.0
Web 2.0. Ein Schlagwort, welches das Einläuten eines neuen Internetzeitalters betitelt und für viele Internet-User bereits zum Alltag gehört. Laut ARD/ZDF-Online-Studie 2006 nutzen rund 12 Prozent der Gesamtbevölkerung ab 14 Jahren in der Bundesrepublik Deutschland einmal pro Woche oder öfter eine Web 2.0-Anwendung.[19] Einen vergleichbar großen Anteil repräsentiert darunter die Gruppe der 14- bis 29-Jährigen mit 49 Prozent.
Der Gebrauch eines Web 2.0-Dienstes vollzieht sich jedoch weitestgehend unbewusst, wie aus den Ergebnissen des Marktforschungsinstitut Academic Data im Auftrag der PR-Agentur ZPR hervorgeht. Nur etwa 6 Prozent der befragten 16- bis 65-Jährigen geben an, den Begriff „Web 2.0“ zu kennen oder zu wissen, was sich dahinter verbirgt.[20] Zu einem ähnlichen Ergebnis gelangt die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers AG mit einer Umfrage von 501 ausgewählten Haushalten in Deutschland. Nur 15 Prozent der Befragten können gemäß der Umfrage den Ausdruck „Web 2.0“ einordnen und repräsentieren mit diesem Wissen somit eine Minderheit.[21]
Der Grund für solche Bilanzen lässt sich auf die unscharfe Markierung bzw. Eingrenzung des Begriffes zurückführen. Eine genaue, allgemein akzeptierte Definition des Web 2.0 existiert nicht. Der Wortgebrauch steht für alles, was sich im Netz und um das Netz herum in den letzen Jahren entwickelt hat. Dazu zählen neben technologischen und wirtschaftlichen Aspekten auch soziale Phänomene, auf die im folgenden Verlauf noch weiter eingegangen wird. Um die Begrifflichkeit näher zu erläutern und verständlich zu gestalten, wird nachfolgend zunächst die Entstehung dieses Schlagwortes dokumentiert. Darauf aufbauend soll im Anschluss eine Gegenüberstellung der dem „alten“ Web zugrunde liegenden Charakteristika dienen, die Neuerungen des Web 2.0 zu spezifizieren. Es folgen abschließend die Erläuterungen der vielfach zitierten Web 2.0- Prinzipien des Wortschöpfers Tim O`Reilly, Gründer und Inhaber des Computerbuchverlages O`Reilly Media.
2.1 Web 2.0 vs. Web 1.0
Der Begriff „Web 2.0“ entstand 2004 in einer Brainstorming-Sitzung zwischen dem Veranstaltungsunternehmen MediaLive International[22] und dem Computerbuchverlag O´Reilly Media im Zuge der Namensfindung einer gemeinsam geplanten Konferenz
über die konstitutiven Entwicklungen des World Wide Web.[23] Hintergrund dieses initiierten Kongresses waren die beobachtbaren neuen Geschäftsmodelle und Angebote der Internetfirmen, die sich nach dem Platzen der „Dotcom-Blase“[24] 2001 etablierten. Um die Neuerungen unter einem Schlagwort zusammenzufassen, diente die Anlehnung an die Praxis der Vergabe von Softwareversionen.[25] Die Verwendung von Versionsnummern impliziert im Allgemeinen Veränderung. So wurde dem „neuen“ Web dementsprechend lediglich eine höhere Nummer zugeteilt. Die Grenzen zwischen dem „alten“ Web und dem Web 2.0 sind jedoch nicht so klar gezogen wie dies etwa durch die Wahl der Bezeichnung suggeriert wird, sondern gestalten sich in vielerlei Hinsicht eher fließend.[26] Um die Evolution, die das Internet seither durchlebt hat, fassen zu können, soll im Folgenden ein Vergleich des „alten“ Web, dem Web 1.0, der Verständlichkeit dienen.
Grundlegende Voraussetzung, die den Weg für das Web 2.0 ebnete, ist das im ersten Kapitel bereits erwähnte veränderte Internetumfeld. Durch die Entwicklungen in der Zunahme von Zugangsgeschwindigkeiten und deren schnellen Diffusion in der Bevölkerung wurden multimediale Anwendungen, die auf der Übertragung von großen Datenmengen aufbauen, überhaupt erst möglich. Daneben tragen ferner die gefallenen Kosten für die Internetnutzung dazu bei, dass der Umstieg auf derartige schnellere Verbindungen erleichtert wird. Die erodierenden Preise führen zu einem vermehrten Wechsel auf Pauschaltarife (Flatrate), welche die Erschließung durch die breite Masse und die Beschäftigung mit dem Internet zusätzlich antreiben.[27]
Diese Bedingungen bedurften viele der unter dem Web 1.0 nicht tragfähigen Geschäftsmodelle. Die Version 1.0 konnte somit nicht einwandfrei laufen, da die „Systemanforderungen“, sprich die technischen Möglichkeiten und die Benutzerzahl, dieser Version nicht erfüllt waren.[28] Darüber hinaus trägt ebenfalls die Standardisierung auf einen einheitlichen Browser zur Entwicklung des Web 2.0 bei.[29] Der Fortschritt neuer Anwendungen gestaltete sich zuvor noch recht schwierig, da die Softwarefirmen versuchten, den Markt über Softwarestandards zu kontrollieren.[30] Um den Verkauf eigener Anwendungen anzutreiben, war die Durchsetzung des eigenen Browsers[31] notwendig, und es entbrannte ein heißer Kampf um eine dominierende Marktstellung. Der Browserkrieg endete zugunsten von Microsoft und deren Internet Explorer. Mussten Website-Administratoren neu erstellte Seiten vorher noch in verschiedenen Browser testen, können sich die Entwickler nun auf einen einzigen konzentrieren. Dies führt zu einer Vereinfachung in der Entwicklung und der Entstehung von Rich User Interfaces, sprich einfacheren Benutzeroberflächen.[32] Stellte der Zugang zum Internet in früheren Zeiten aufgrund seiner Komplexität noch eine Herausforderung dar und war vorwiegend Experten vorbehalten, erlauben die simplere Bedienbarkeit und die neuen Anwendungen nun auch die Partizipation der breiten Masse.[33] Die Nutzung des Internets beschränkt sich fortwährend nicht mehr allein auf den Informationskonsum und das Web als Abrufmedium, sondern erlaubt es dem User, sich aktiv durch die Generierung und Veröffentlichung eigener Inhalte einzubringen. Die Folge ist die Entstehung sozialer Netzwerke im Web, in denen der Austausch von Inhalten und Informationen stattfindet.[34] Gemäß Tim Berners-Lee, dem Erfinder des World Wide Web, sei das Web 2.0 somit nichts grundlegend Neues, sondern nur eine fortschreitende Realisierung des ursprünglichen Zieles des Web 1.0, nämlich die Vernetzung von Menschen, ermöglicht durch neue Technologien und soziale Umfeldbedingungen.[35]
Abbildung 1 dient der Verdeutlichung der genannten Zusammenhänge:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Zusammenhänge im Web 2.0 (Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Koch; Richter [2007], S. 5)
Um die grundlegenden Neuerungen im Internet zu spezifizieren, fungieren die von O´Reilly aufgestellten Prinzipien. Der Netztheoretiker fasst die Veränderungen unter sieben Schlagworten zusammen: „ Das Web als Plattform“, „ Die Nutzung kollektiver Intelligenz“, „ Die Daten als nächstes Intel Inside“, „ Abschaffung des Software-
Lebenszyklus“, „ Lightwight Programming Models“, „ Software über die Grenzen hinaus“ und „ Rich User Experiences“.[36]
2.2 Prinzipien des Web 2.0
Der Dotcom-Crash 2001[37] führte zu einer Neuorientierung und einem Überdenken bestehender Geschäftsmodelle. Hierbei zeichneten sich Gemeinsamkeiten in den Trends derer ab, die den Crash überlebten, und solcher, die neu entstanden waren.[38] O´Reilly, als Schöpfer des Begriffes, trägt in einem Artikel unter dem Titel „What is Web 2.0“ 2005 eine Reihe von Merkmalen zusammen, deren Ursprung in den Konzepten erfolgreicher Internetfirmen oder neuer Anwendungen zu finden seien. Die Prinzipien sollen nun im Folgenden erläutert werden.
Das Web als Plattform bildet einen der grundlegendsten Gedanken in der Web 2.0-Ära. Der Ansatz dieses Paradigmas bezeichnet die zunehmende Verlagerung von Desktop-Programmen ins Netz.[39] Musste Software zuvor teuer eingekauft und auf dem eigenen Rechner installiert werden, ist dies bei den neuen Web-Applikationen nicht mehr notwendig. Das Programm läuft auf dem Server des Anbieters selbst, lediglich ein Browser zur Webseitenbetrachtung wird benötigt. Ein Beispiel stellt die kostenlose Textverarbeitung „Text und Tabellen“ des Unternehmens Google dar, welche vollständig im Web genutzt werden kann und somit die Konkurrenz zur Microsoft-Anwendung „Word“ antritt. Mit der Nutzung des Webs als Plattform wird des Weiteren eine Entwicklung aufgezeigt, welche die Kundenintegration verfolgt. Bestand das Internet vorwiegend aus statischen Seiten mit nur gelegentlichen Aktualisierungen und einer lokalen Bearbeitung, so geht der Trend zu dynamischen Plattformen, die regelmäßige Updates ermöglichen und auf die Partizipation und die Bedürfnisse der Benutzer ausgerichtet sind.[40] Dies erlaubt zeitlich und örtlich verteilten Menschen die Erstellung und Bearbeitung einer gemeinsamen Sache.[41] Dabei ist der Erfolg maßgeblich von den Benutzern abhängig, die durch ihre Beteiligung den Service am Leben erhalten.[42] „Die klassische „Ein-Weg-Kommunikation“ des Web 1.0, bei der die Anbieter Content produzieren und die Konsumenten diesen lediglich aufgerufen haben“, ist demnach gemäß den Autoren Hess, Walsh und Kilian „größtenteils Geschichte“.[43] Das Abrufmedium wandelt sich zunehmend zum Mitmach-Medium, in welchem Informationen kommentiert oder eigens generiert werden können. Insbesondere im Bereich der Social Networking Plattformen erhöhe dabei „die Möglichkeit, die Daten wahlweise freizugeben (...), die Bereitschaft, diese Daten überhaupt erst einmal einzustellen“.[44]
Der Plattform-Gedanke und die damit einhergehende Erstellung nutzergenerierter Inhalte[45] erlaubt vielen Geschäftsmodellen des Weiteren die Nutzung kollektiver Intelligenz. Ziel ist es, verstreutes Wissen zu vernetzen und ihm einen geeigneten Rahmen zu geben.[46] Das bekannteste Beispiel ist die Online-Enzyklopädie Wikipedia, deren Inhalte vollständig von den Nutzern im Netz erstellt und ständig erweitert werden. Der amerikanische Wirtschaftsjournalist James Surowiecki[47] meint, „unter den richtigen Umständen“ seien „Gruppen bemerkenswert intelligent – und oft klüger als die Gescheitesten in ihrer Mitte“, denn „im kollektiven Wissen liegt die Lösung“.[48] Durch zunehmende Verlinkungen und Bezugnahme der Seiten untereinander vergrößert sich das Netz der Verbindungen auf natürliche Weise.[49] Die angebotenen Dienste wenden sich an die unterschiedlichsten Interessen der Nutzer und sprechen die verschiedensten Zielgruppen an. Damit verfolgen die Betreiber das Konzept des „Long Tail“[50], bei dem nicht allein die breite Masse ökonomisch attraktiv sein muss, sondern auch die Masse der Nischen.[51]
Der User-generated Content der Nutzer spielt auch für das Prinzip Daten als nächstes Intel Inside eine grundlegende Rolle. Dahinter steckt der Aspekt, dass Daten die Basis einer Web-Anwendung bilden und als solche die entscheidende Komponente des Angebotes schaffen. Ebenso wie die Marke Intel inside, an welche die Prinzipbezeichnung sich anlehnt, als nur einzelner Bestandteil eines Computers für die Qualität eines ganzen PC zu stehen vermag[52], fungieren die Datenbestände auch für Web-Applikationen als Grundstock und Kapital des Dienstes. Überträgt man diesen Aspekt auf den Bereich der Social Networks, welche auf die Suche und den Austausch zwischen den Mitgliedern abzielen, so ist ein Netzwerk umso interessanter, je mehr Informationen die Plattform für ihre Mitglieder über andere Nutzer bereithält. Nicht nur in Business-Netzwerken spielt dieser Gedanke eine entscheidende Rolle, denn auch Freizeit- Communities bauen auf dem Prinzip des Kennenlernens und Kontaktens auf.
Die letzten vier Prinzipien sollen hier nur in aller Kürze erörtert werden, da sie die bisher dargelegten Gesichtspunkte lediglich weiterführen. Ein Aspekt, welcher an den Gedanken des Webs als Plattform anschließt, ist das Prinzip der Abschaffung des Software-Lebenszyklus. Da Software nicht mehr als Produkt, sondern als Service im Web den Nutzern bereitsteht, können Anwendungen permanent bearbeitet und aktualisiert werden.[53] Die Dienste werden bereits in einem frühen Stadium im Netz veröffentlicht und ermöglichen somit die Einbeziehung der User, die diese Service somit maßgeblich mitprägen können. Die Applikationen befinden sich sozusagen in einer ständigen Beta-Phase[54]. Des Weiteren verfolgt die Nutzung von Lightweight Programming Models in den Programmieransätzen von Web-Applikationen den Grundsatz von Simplizität und Minimalismus.[55] Offene Personal-Publishing-Systeme ermöglichen den Nutzern, auch ohne fundierte Programmierkenntnisse Inhalte schnell zu generieren und zu verteilen. Die Durchsetzung von gewissen Web-Standards in der Darstellung von Anwendungen leiten zu einem übersichtlichen und reduzierten Design, welches die Bedienbarkeit für die Nutzer wesentlich vereinfacht.[56] Diese Rich User Experiences sorgen für die Erhöhung des Nutzens mit der Folge, dass mehr Anwender aktiv an den Diensten mitwirken.[57] Da viele interaktive Angebote von einer aktiven Beteiligung der Nutzer abhängen, sind solche Voraussetzungen wesentlich. Frei verfügbare Datenformate, durch den Gedanken von Open Source[58], erlauben daneben das Übertragen der Daten auf PC-unabhängige mobile Endgeräte.[59] Dahinter steht das Prinzip von Software über die Grenzen einzelner Geräte hinaus. Die Einhaltung gewisser Standards gestattet es, dass die Websites auf den plattformunabhängigen Endgeräten stets optimal angezeigt werden können.
Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass das Web 2.0 weit mehr umfasst als eine rein technologische Weiterentwicklung des Internets. Neben den neuen Techniken spielt auch die veränderte Nutzungsart eine entscheidende Rolle. Kostenregression und erhöhte Zugangsgeschwindigkeiten fördern die Verbreitung und die Beteiligung am Web. Als Folge kristallisieren sich neue Mitmach-Anwendungen in Form von sogenannten Weblogs[60], Wikis[61] oder Communities heraus. Dabei sind gemeinsame Eigen-
schaften aller erfolgreichen Web 2.0-Dienste die Nutzerintegration und der Gemeinschaftsgedanke. Der Nutzer und seine Bedürfnisse rangieren bei diesen Diensten im Mittelpunkt der Betrachtung. Bot das Web 1.0 noch wenig Raum für soziale Tätigkeiten, wird das Medium Internet nun durch eine Funktion erweitert, die kennzeichnend ist für das Web 2.0, den Aufbau sozialer Beziehungen.
2.3 Soziale Netzwerke (real und virtuell)
Jeder Mensch lebt bewusst oder unbewusst in sozialen Gemeinschaften bzw. Netzwerken, sei es beispielsweise die Schule, die Familie, der Sportverein, die Universität oder der Beruf. Der Soziologe Udo Thiedeke versteht die Bildung von Gemeinschaften als „grundlegende Erscheinungsform[en] der Vergesellschaftung“.[62] Er sieht die Begründung für die Gruppenbildungen unter anderem darin, dass die Menschen in Gemeinschaften „Unterstützung, Anerkennung und Eingebundenheit“[63] erfahren. Dabei stellt Thiedeke fest, dass eine Verlagerung von familiär orientierten Gruppierungen hin zu funktions- und interessengeleiteten Gruppen eine Konsequenz der modernen Gesellschaft ist.[64] „Reale“ Gruppen können dabei nur durch eine zumindest zeitweilige, persönliche Face-to-face-Begegnung aufrechterhalten werden. Die Folge ist, dass die Gruppengröße dementsprechend klein ausfallen muss. Die „Gemeinschaft“ kann somit geografisch als eine Gruppe interpretiert werden, die einer gewissen Nähe ihrer Mitglieder zueinander bedarf.[65] Diese örtliche Begrenzung ist zwar immer noch vorhanden, übernimmt jedoch in der modernen Gesellschaft eine zunehmend untergeordnete Funktion.[66] Bei der Übertragung des Begriffs auf den Bereich der medialen Kommunikation geht dieser Aspekt gänzlich verloren. Das Internet zeichnet sich gerade durch eine ortsunabhängige Verständigung aus.[67] Es ermöglicht eine Vernetzung zu Menschen, die nicht im unmittelbaren Umfeld leben, und gestattet dadurch die Verbindungen zu einer wesentlich höheren Anzahl an Kontakten. Die „realen“ sozialen Beziehungen werden durch die Möglichkeiten der elektronischen Kommunikation jedoch nicht ersetzt, virtuelle Kontakte treten lediglich ergänzend hinzu.
Das persönliche Beziehungsnetzwerk lässt sich in unterschiedliche Stärken der Kontaktverbindungen aufteilen. In der Netzwerkterminologie werden enge Interaktionspartner, die emotionale Unterstützung liefern, als starke Beziehungen (`strong ties´) und die verbleibenden Kontakte, verantwortlich für eine soziale Nutzenstiftung, als schwache Beziehungen (weak ties´) deklariert.[68] Das Internet begünstigt die Kontaktausweitung dieser schwachen Verbindungen, die im realen Leben aufgrund von räumlichen Entfernungen nicht hätten aufrechterhalten werden können, durch die Nutzung von beispielsweise elektronischen Nachrichten (E-Mail).[69] Somit ist die „Medialisierung“[70] persönlicher sozialer Beziehungen keinesfalls eine neuartige Erscheinung. Neu ist jedoch, dass die technologischen Entwicklungen im Zuge des Web 2.0 durch sogenannte Social Networking-Plattformen den Nutzern den zielgerichteten Aufbau, die ganzheitliche Abbildung und die Pflege ihres persönliches Netzwerks offerieren. Es geht zusammenfassend um die Partizipation, das Vernetzen, die Darstellung sowie den Austausch und dies alles zumeist über eine spezielle, dafür bereitgestellte Plattform.[71] Dabei sind die sozialen Netzwerke der Nutzer keineswegs in Online- und Offline- Netzwerke getrennt, sondern fließen größtenteils ineinander über.[72]
Wie wichtig soziale Netzwerke und gerade die Verbindungen der „weak ties“ sein können, verdeutlicht schon 1973 der Soziologe Marc Granovetter mit seinen Erhebungen zur Einflussnahme von losen Beziehungen auf die Erlangung eines Arbeitsplatzes (n=300).[73] Hierbei findet er heraus, dass zumeist die Verbindungen über Freundes-Freunde hergestellt werden. Eine europaweite Studie von Stepstone (n=2035) gelangt zu einem ähnlichen Ergebnis und bestätigt somit erneut die Theorie der „Strengh of weak ties“ von Granovetter.[74] Rund 37 Prozent der deutschen Befragten (n=1220) geben demnach an, ihren Job über Beziehungen gefunden zu haben und betonen die Wichtigkeit sozialer Verbindungen.
Dass das soziale Netzwerken ein grundlegendes Bedürfnis der Menschen darstellt, verdeutlichen eben solche Studien-Resultate wie die der Fox Interactive Media, wonach mehr als 200 Millionen Menschen jeden Monat weltweit Social Networking Seiten nutzen.[75] Gemäß des Online-Panel Services Nielsen Net Ratings haben darüber hinaus die 10 größten Social Networking Seiten der U.S.A. sich innerhalb eines Jahres um 47 Prozent von 46, 8 Millionen auf 68, 8 Millionen Besucher vergrößert und erreichen somit schon 45 Prozent der dortigen Internetnutzer.[76] Betrachtet man den europäischen Markt, befinden sich 56 Prozent aller Webnutzer in sozialen Netzwerken.[77] Deutschlandweit sind es 2006 rund 47 Prozent mit Potenzial nach oben. Immer mehr
dieser Plattformen erscheinen im Netz und sprechen die unterschiedlichsten Bedürfnisse und Zielgruppen an.
Eine Studie der Microsoft Digital Advertising Solutions fasst die meist genannten Motivationen für die Partizipation in einem Social Network in drei grundlegende Bedürfnisse der Menschen zusammen: Selbstdarstellung, Teil einer Gemeinschaft sein und die Ausweitung des eigenen Netzwerkes.[78] Welche Faktoren dort weiterhin mit einfließen, ist Abbildung 3 zu entnehmen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2: Motivationen für die Nutzung von Social Networks (Quelle: Microsoft Digital Advertising Solutions [2007], http://www.advertising.microsoft.com)
2.4 Social Networks (Definition, Abgrenzung, Beispiele)
Social Networking Plattformen lassen sich der sogenannten sozialen Software[79] zuordnen.[80] Dabei ist dieser Begriff ebenso wenig klar abgegrenzt wie der des Web 2.0.[81] Es existieren eine Vielzahl von Definitionen in der Literatur, die versuchen, das Wesen dieser Anwendungssoftware zu beschreiben. Exemplarisch soll die folgende Auswahl an Definitionsvorschlägen verschiedener Autoren einer besseren Verständlichkeit dienen.
Alby erläutert, dass „der Begriff Social Software selbst (..) in der Regel für Systeme genutzt [wird], mit denen Menschen kommunizieren, zusammenarbeiten oder auf eine andere Art interagieren können“.[82] Da ihm dies etwas zu weit gefasst erscheint, fügt er ein weiteres Kriterium an, welches die Förderung und die Unterstützung des Aufbaus und Selbstmanagements einer Community notwendig erscheinen lässt.[83] Somit ordnet er Wikis, Instant Messenger und Webforen bzw. Communities der sozialen Software zu und kategorisiert diese nach ihrer Funktion in zwei Arten:
1. „Social Software, bei der die Kommunikation im Vordergrund steht.
2. Social Software, bei der zwar auch kommuniziert wird, aber auch Inhalte im Mittel- punkt stehen, die von den Teilnehmern erstellt oder zumindest in irgendeiner Weise angereichert werden; der Community-Gedanke steht im Vordergrund.“[84]
So fallen Instant Messenger in die erste Kategorie, Webforen und Wikis in die zweite.
Bächle schließt sich dieser Definition an, scheint jedoch zwischen Communities und Social Networks zu differenzieren. Er subsumiert Social Software als „Softwaresysteme, welche die menschliche Kommunikation und Kollaboration unterstützen“.[85] Dabei sei den Systemen gemein, „dass sie den Aufbau und die Pflege sozialer Netze und virtueller Gemeinschaften (sog. Communities) unterstützen und weitgehend mittels Selbstorganisation funktionieren“.[86]
Richter und Koch gehen noch weiter in ihrer Auslegung und beschreiben Social Software als „Anwendungssysteme, die auf Basis neuer Entwicklungen im Bereich der Internettechnologien und der Ausnutzung von Netzwerk- und Skaleneffekten, indirekte und direkte zwischenmenschliche Interaktion (Koexistenz, Kommunikation, Koordination, Kooperation) auf breiter Basis ermöglichen und die Beziehungen ihrer Nutzer im World Wide Web abbilden und unterstützen“.[87]
Allen Definitionen gemein ist der Focus auf den Nutzer, der sich im Mittelpunkt solcher Anwendungen befindet. Der User erhält die Möglichkeit, eigene Inhalte zu generieren und zu verbreiten und sich mittels solcher Plattformen mit anderen auszutauschen. Die Anwendungssysteme, die unter den Begriff der Social Software fallen, zeichnen sich somit, wie der Name impliziert, durch ihren sozialen Charakter aus. Wie aufgeführt, wird hier jedoch oftmals zwischen der „klassischen Community“ und Social Networks unterschieden. Um die Differenzen deutlich zu machen, muss zunächst die virtuelle Community definiert werden, um im Anschluss die Besonderheiten von Social Networks aufzuzeigen.
Auch in der Community-Begrifflichkeit existieren vielfältige Definitionsvorschläge. Eine in der Literatur viel zitierte ist die von Howard Rheingold, in welcher er virtuelle Gemeinschaften als „soziale Zusammenschlüsse“ beschreibt, „die dann im Netz entstehen, wenn genug Leute (..) öffentliche[n] Diskussionen lange genug führen und dabei ihre Gefühle einbringen, so dass im Cyberspace ein Geflecht persönlicher Beziehungen entsteht“.[88] Es lassen sich jedoch häufig mehr funktionsorientierte Begriffsdefinitionen finden wie beispielsweise die der Autorin Pawlowitz, welche virtuelle Communities charakterisiert als „Gruppen von Menschen, die aufgrund gleicher Interessen an einem Hobby, an einer Dienstleistung, an einem Produkt oder einer Produktgruppe im Internet miteinander interagieren und kommunizieren“.[89]
Gemeinsame Merkmale von Communities sind demnach zusammenfassend eine größere Anzahl von Menschen mit einem spezifischen Interessensschwerpunkt, die das Bedürfnis nach Interaktion und Gemeinschaftsintegration haben sowie über einen längeren Zeitraum mittels Internet miteinander kommunizieren und eigene Inhalte generieren können.
Die ersten Communities sind nahezu so alt wie das Internet an sich.[90] Die erste Diskussionsrunde wurde 1975 etabliert und baute auf dem ebenso jungen E-Mail-System auf.[91] Diese wesentlichen Funktionen haben sich bis heute durchgesetzt. Der alleinige Unterschied zur damaligen Situation besteht darin, dass sich seither die Zahl der Communities und der Nutzer vervielfacht hat.
Die aufgezeigten Community-Funktionen spielen auch in den modernen Social Networks eine grundlegende Rolle. Diese Plattformen erweitern jedoch den „klassischen“ Community-Gedanken um eine Funktion, die charakteristisch ist für das Wesen des Web 2.0, nämlich die Vernetzung mit anderen Nutzern. Dabei werden dem Nutzer oftmals die Verbindungen angezeigt, die er zu den Freundes-Freunden seiner Kontakte unterhält. Der Theorie des Psychologen Stanley Milgram zufolge, stehen weltweit alle Menschen über wenige Verbindungen miteinander in Beziehung.[92] Auch wenn die damaligen Experimente bis heute nicht bewiesen werden konnten, so bleibt eine gewisse Faszination in seiner Annahme des „Small World Phenomenon“ doch bestehen. Aufbauend auf diesem Prinzip, bieten Social Networking-Seiten ihren Mitgliedern die Funktion, einen anderen Nutzer als Kontakt hinzuzufügen, um so Teil eines Netzwerkes zu werden und sich die Verbindungsgrade der Freundes-Freunde sichtbar zu machen.[93]
Social Software bzw. Social Networks lassen sich nach Schmidt subsumierend hinsichtlich ihrer Funktionalität in drei Hauptkategorien unterteilen, die gleichzeitig mehrere soziale Bedürfnisse der Nutzer stillen:[94]
- Informationsmanagement: Suche, Bewertung und Verwaltung von Informationen
- Identitätsmanagement: Präsentation von Aspekten seiner selbst im Netz.
- Beziehungsmanagement: Aufbau, Ausbau, Pflege und Präsentation von Kontakten und sozialen Kommunikationsbeziehungen.
Für die vorliegende Arbeit von besonderem Interesse ist der Aspekt des Identitätsmanagements. Dieses bildet eine Grundfunktion in Social Networks und ermöglicht den Nutzern, durch die Profilbildung sich selbst einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.[95] Die daraus resultierende Fülle an bewusst eingesetzten, persönlichen Angaben besitzt insbesondere für die werbetreibende Industrie im Zuge der Zielgruppenbestimmung große Attraktivität. Der Wert der Daten für kommerzielle Werbezwecke, die es den Plattform-Betreibern ermöglicht, den Service rentabel zu gestalten, soll in den nachfolgenden Kapiteln näher präzisiert werden.
Weltweit existieren bereits eine Vielzahl unterschiedlichster Social Networking-Plattformen. Die nachfolgende Tabelle liefert einen Überblick über die in Deutschland, den Nutzerzahlen nach, beliebtesten.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 1: Exemplarische Auswahl an Social Networking Plattformen (Quelle: eigene Darstellung)
2.4.1 Netzwerkeffekte und Kritische-Masse-Phänomen
Die im vorangegangenen Kapitel aufgezeigten hohen Mitgliederzahlen der größten Social Networking Plattformen weltweit bzw. deutschlandweit sind Folgen positiver Skaleneffekte. Betrachtet man die Wachstumskurve dieser Plattformen, so lässt sich feststellen, dass die flache Steigung der Mitgliederzahlen in der Anfangsphase schnell durch ein exponentielles Wachstum im Verlauf ersetzt wurde.[97] Ab einer gewissen Anzahl von Anwendern wird der Dienst zum Selbstläufer und lässt Communities wie von selbst entstehen.[98] Diese Feststellung beinhaltet den Gedanken des aus der Wirtschaft stammenden Netzwerkeffektes, nach welchem der Nutzen einer Anwendung für den einzelnen Benutzer steigt, je mehr Personen sich an einem Dienst beteiligen.[99] Somit handelt es sich bei Netzwerkeffekten um derivative Nutzenstiftung, bei der sich der Wert eines Produktes bzw. eines Dienstes nicht aus der eigentlichen direkten Verwendung desselben ergibt (=originärer Nutzen), sondern sich vom Gesamtnutzen ableitet.[100] So steigt eben auch beispielsweise beim Telefon der Wert dieses Kommunikationsmittels mit der Anzahl der weiteren Besitzer eines solchen Gerätes.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3: Zusammenhang von Anwenderzahl und Nutzen (Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Shapiro; Varian [1999], S. 180)
Überträgt man dieses Phänomen auf den Bereich des virtuellen Netzwerkens, so steigt mit jedem Nutzer der Wert der Plattform, da sich mit wachsender Mitgliederzahl auch die Sammlung möglicher Kontakte und Kommunikationspartner erhöht.[101] Dadurch erhält das Netzwerk auch für weitere Interessenten eine größere Attraktivität, sich dieser Plattform anzuschließen.[102] Das Gesetz der wachsenden Erträge, ein Phänomen in vernetzten Systemen, impliziert eine Korrelation der zunehmenden Verbreitung mit der Nachfrage nach dem Produkt bzw. der Anwendung.[103] Hintergrund ist der Prozess der
positiven Rückkopplung, der besagt, je mehr Teilnehmer ein Netzwerk hat, desto mehr neue Teilnehmer werden angezogen, umso schneller wächst es.
[...]
[1] Vgl. Kroeber-Riel; Weinberg [2002], S. 588.
[2] Vgl. Schweiger; Schrattenecker [2001], S. 8 f.
[3] Vgl. hier und im Folgenden: Bitkom [EITO], http://www.bitkom.org.
[4] Vgl. hier und im Folgenden: AGOF [Basisdaten Teil 1], http://www.agof.de, S. 5.
[5] Vgl. Statistisches Bundesamt Deutschland [2007], http://www.destatis.de.
[6] Vgl. Bitkom [2007], http://www.bikom.org.
[7] Vgl. Bitkom [2007], http://www.bikom.org.
[8] Vgl. Eimeren; Frees [Internetnutzung], S. 375.
[9] Vgl. AGOF [Basisdaten Teil 1], http://www.agof.de, S. 25.
[10] Vgl. AGOF [Basisdaten Teil 1], http://www.agof.de, S. 28.
[11] Vgl. OVK [2008], http://www.ovk.de, S. 24.
[12] Vgl. OVK [2008], http://www.ovk.de, S. 4.
[13] Vgl. Wibbelt, zitiert nach Nielsen Media Research [2007], http://nielsen-media.de.
[14] Gscheidle; Fisch [Onliner], S. 393.
[15] Die Begrifflichkeit Social Networking-Plattformen wird hier und im Folgenden synonym verwendet für
Social Networks, Social Networking-Dienste, Social Networking-Anwendungen und Social Networking-Services.
[16] Vgl. Merati-Kashani [2007], S. 29.
[17] Vgl. hier und im Folgenden: Bitkom [forsa], http://www.bikom.org.
[18] Vgl. Emarketer [2007], http://emarketer.com.
[19] Vgl. hier und im Folgenden: Haas et al. [Web 2.0], S. 215.
[20] Vgl. ZPR [Web 2.0], http://www.z-pr.de.
[21] Vgl. PWC [2007], http://www.pwc.de.
[22] Heute: CMP Technology.
[23] Vgl. hier und im Folgenden: O`Reilly [2005], http://www.oreilly.de.
[24] „Unter der Dotcom-Blase versteht man die Konzentration von Dotcom-Unternehmen mit Kapital aber
ohne Konzept, die anschließend zur Übersättigung und einer Krise der Internet-Wirtschaft führten.“ Friedmann [2007], S. 25.
[25] Vgl. hier und im Folgenden: Alby [2008], S. 17 f.
[26] Vgl. Hein [2007], S. 10.
[27] Vgl. Gscheidle; Fisch [Onliner] S. 394.
[28] Vgl. Alby [2008], S. 2.
[29] Vgl. Alby [2008], S. 2.
[30] Vgl. hier und im Folgenden: O`Reilly [2005], http://www.oreilly.de.
[31] „Ein Browser ist ein Programm, mit dessen Hilfe der Nutzer durch das Internet surfen, also beliebige
Websites suchen und betrachten kann.“ Reichardt [2000], S. 270.
[32] Vgl. Alby [2008], S. 14.
[33] Vgl. hier und im Folgenden: Friedmann [2007], S. 23 ff.
[34] Vgl. Berge; Buesching [1997], S. 24.
[35] Vgl. Berners-Lee, zitiert nach Laningham [2008], http://www-128.ibm.com.
[36] Vgl. O`Reilly [2005], http://www.oreilly.de.
[37] Siehe Abschnitt 2.1
[38] Vgl. hier und im Folgenden: O`Reilly [2005], http://www.oreilly.de.
[39] Vgl. hier und im Folgenden: Friedmann [2007], S. 36.
[40] Vgl. Hein [2007], S.12 f.
[41] Vgl. Hess; Walsh, Kilian [2008], S. 7.
[42] Vgl. Hess; Walsh, Kilian [2008], S. 10.
[43] Hess; Walsh, Kilian [2008], S. 9.
[44] Hess; Walsh, Kilian [2008], S. 7.
[45] Für diese Begrifflichkeit wird im Folgenden synonym die häufig verwendete, aus dem Englischen stam-
mende Bezeichnung des „User-generated Content“ gebraucht.
[46] Vgl. O´Reilly [2005], http://www.oreilly.de, Hess; Walsh, Kilian [2008], S. 6 f.
[47] James Surowieki erlangte 2004 als Autor des Buches „The Wisdom of Crowds“ (Die Weisheit von Vie- len) internationale Bekanntheit.
[48] Surowiecki, zitiert nach Hornig [2006], S. 63.
[49] Vgl. O´Reilly [2005], http://www.oreilly.de.
[50] Der Begriff „Long Tail“ wurde 2004 von Chris Anderson, Chefredakteur der amerikanischen Technology
Zeitschrift Wired Magazin, geprägt.
[51] Vgl. O´Reilly [2005], http://www.oreilly.de.
[52] Vgl. Intel [Inside], http://www.intel.com.
[53] Vgl. hier und im Folgenden: O´Reilly [2005], http://www.oreilly.de.
[54] Die Beta-Phase bezeichnet das Entwicklungsstadium eines unvollendeten Computerprogramms.
[55] Vgl. hier und im Folgenden: Friedmann [2007], S. 40.
[56] Vgl. Friedmann [2007], S. 43.
[57] Vgl. Hess; Walsh, Kilian [2008], S. 10.
[58] Bei Open-Source Software steht der Quellcode frei verfügbar im Netz und ermöglicht den Anwendern,
diese uneingeschränkt zu verwenden und zu bearbeiten als auch mit fremden Applikationen zu ver-
knüpfen.
[59] Vgl. hier und im Folgenden: O´Reilly [2005], http://www.oreilly.de.
[60] Ein Weblog ist eine regelmäßig aktualisierte Webseite, die als eine Art „Tagebuch“ von einer Person im
Web geführt wird. Vgl. Alby [2008], S. 21.
[61] Als Wikis werden Seitensammlungen im Internet bezeichnet, die online von jeder beliebigen Person
bearbeitet werden können. Vgl. Alby [2008], S. 252.
[62] Thiedeke [2003], S. 7.
[63] Thiedeke [2003], S. 7.
[64] Vgl. hier und im Folgenden: Thiedeke [2003], S. 7.
[65] Vgl. Brunold; Merz; Wagner [2000] S. 23, Thiedeke [2003], S. 7.
[66] Vgl. Castells [2005], S. 139.
[67] Vgl. Brunold; Merz; Wagner [2000], S. 23.
[68] Vgl. Gräf [1997], S. 103.
[69] Vgl. Richter; Koch [2008], http://www.kooperationssysteme.de, S. 2.
[70] Beck [2005], S. 176.
[71] Vgl. Gscheidle; Fisch [Onliner], S. 398.
[72] Vgl. Beck [2005], S. 184.
[73] Vgl. hier und im Folgenden: Granovetter [1973].
[74] „New job through personal connections?“ „Yes, almost always. In today´s world, connections are
essential“ (EU: 36%). Vgl. hier und im Folgenden: Stepstone [2004], http://www.stepstone.de.
[75] Vgl. Fox Interactive Media [2007], http://www.tns-us.com, S. 35; Stand: 2007.
[76] Vgl. Nielsen//NetRating [2006], http://www.nielsen-netratings.com; Stand: 2006.
[77] Vgl. hier und im Folgenden: Comscore [2007], http://www.comscore.com.
[78] Vgl. Microsoft Digital Advertising Solutions [2007], http://www.advertising.microsoft.com.
[79] Für diese Begrifflichkeit wird im Folgenden synonym die gebräuchliche, aus dem Englischen stammen-
de Bezeichnung der „Social Software“ benutzt.
[80] Vgl. Beck [2007], S. 9.
[81] Vgl. Alby [2008], S. 89.
[82] Alby [2008], S. 89.
[83] Vgl. hier und im Folgenden: Alby [2008], S. 89.
[84] Vgl. Alby [2008], S. 89 ff.
[85] Bächle; Kolb [2008], S. 28.
[86] Bächle; Kolb [2008], S. 28.
[87] Richter; Koch [Social], S. 8.
[88] Rheingold [1994], S. 16.
[89] Pawlowitz [2002], S. 67.
[90] Die Geburtsstunde des Internets wird allgemein auf den 29. Oktober 1969 datiert. Vgl. Brunold; Merz;
Wagner [2000], S. 25.
[91] Vgl. hier und im Folgenden: Brunold; Merz; Wagner [2000], S. 25 ff.
[92] Vgl. Milgrim (1967).
[93] Vgl. Alby [2008], S. 118 f., Richter; Koch [2008], S. 2.
[94] Vgl. hier und im Folgenden: Schmidt [2006], S. 37 ff.
[95] Vgl. Richter; Koch [2008], S. 5.
[96] Nutzerzahlen nach Angaben der Plattformbetreiber; Stand: 2008.
[97] Zur beispielhaften Visualisierung siehe den Wachstumsverlauf des StudiVZ im Abschnitt 3.4.3.2.
[98] Vgl. Brunold; Merz; Wagner [2000], S. 55 f.
[99] Vgl. Friedmann [2007], S. 37.
[100] Vgl. Clement; Litfin; Peters [1998], S. 102 f.
[101] Vgl. Brunold; Merz; Wagner [2000], S. 55.
[102] Vgl. Kollmann; Stöckmann [2007], S. 40.
[103] Vgl. hier und im Folgenden Brunold; Merz; Wagner [2000], S. 53 f.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2008
- ISBN (eBook)
- 9783836627672
- DOI
- 10.3239/9783836627672
- Dateigröße
- 5.8 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Hochschule Fresenius; Köln – Medienwirtschaft
- Erscheinungsdatum
- 2009 (März)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- online werbung social communities marketing kommunikation
- Produktsicherheit
- Diplom.de