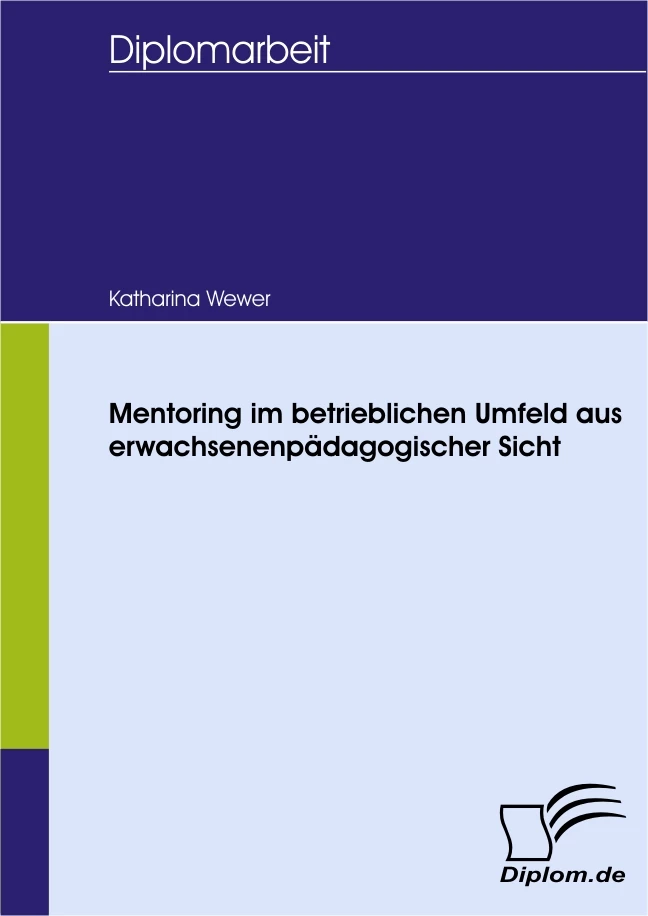Mentoring im betrieblichen Umfeld aus erwachsenenpädagogischer Sicht
Zusammenfassung
Mentoring ist ein zunehmend beliebtes Personalentwicklungsinstrument in deutschen Unternehmen. Dies wird durch den stetig steigenden Einsatz und der anwachsenden wissenschaftlichen Beschäftigung belegt. Daneben weist die Existenz zahlreicher Ratgeber- und Managementliteratur auf ein anhaltendes Interesse an diesem Phänomen hin. Durch Mentoring sollen Fach- und Führungskräfte in ihrer fachlichen, vor allem aber in ihrer persönlichen Entwicklung gefördert werden. Die Förderung von Nachwuchsführungskräften stellt heutzutage eine zentrale Aufgabe der Unternehmen dar, weil sie im so genannten war of talents einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil bietet. Mentoring wird daher als zukunftsweisendes Praxisberatungsmodell beschrieben, das als hoch interessant eingestuft wird.
Allerdings stehen noch eingehende Untersuchungen zu diesem Instrument aus. Schließlich ist bislang gar nicht oder nur unzureichend geklärt, wie die Beteiligten ihre Lernsituation innerhalb dieser Entwicklungsmaßnahme gestalten bzw. welche Möglichkeiten ihnen dazu offen stehen. Es ist unklar, wie sie ihre (berufs-) biographischen Erfahrungsbestände einsetzen bzw. welche Rolle diesen Erfahrungsbeständen zukommt. Außerdem muss untersucht werden, welche Lernprozesse bei den Beteiligten tatsächlich stattfinden. Eine umfassende Analyse der (Lern-) Faktoren, die eine effektive Förderung durch Mentoring begünstigen, muss grundsätzlich daher noch stattfinden. Es kann festgestellt werden, dass Mentoring-Programme in ihren Formen zwar insgesamt immer vielfältiger und wandlungsfähiger werden, es ist jedoch immer noch wenig über die Dynamik dieser Organisationsform selbst bekannt ( ). Dazu stellt Dehnbostel stellvertretend für zahlreiche Arbeitszusammenhänge fest, dass die Anzahl an Lernmöglichkeiten zunimmt, es aber zu prüfen bleibt, inwiefern diese Angebote wirksam und nachhaltig sind.
Um eine effektive Förderung durch Mentoring in Unternehmen zu gewährleisten, ist es daher erforderlich, dass das zentrale Thema Lernen eine stärkere Berücksichtigung findet. Es muss bei den Prozessverantwortlichen der Unternehmen ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, wie Lernprozesse Erwachsener überhaupt ablaufen und wie diese durch Mentoring gefördert werden können.
Zielsetzung der Arbeit:
Ausgehend von diesen Überlegungen stellt die vorliegende Arbeit einen Zusammenhang zwischen den Lernprozessen Erwachsener und Mentoring als ein Instrument der Personal- und […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Ausgangssituation und Problemstellung
Mentoring ist ein zunehmend beliebtes Personalentwicklungsinstrument in deutschen Unternehmen. Dies wird durch den stetig steigenden Einsatz und der anwachsenden wissenschaftlichen Beschäftigung belegt (vgl. Punkt 4.3.2). Daneben weist die Existenz zahlreicher Ratgeber- und Managementliteratur auf ein anhaltendes Interesse an diesem Phänomen hin. Durch Mentoring sollen Fach- und Führungskräfte in ihrer fachlichen, vor allem aber in ihrer persönlichen Entwicklung gefördert werden. Die Förderung von Nachwuchsführungskräften stellt heutzutage eine zentrale Aufgabe der Unternehmen dar, weil sie im so genannten „war of talents“ (Koreman 2005, 45) einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil bietet. Mentoring wird daher als „zukunftsweisendes Praxisberatungsmodell“ (Rotering-Steinberg 2007, 40) beschrieben, das als hoch interessant eingestuft wird (vgl. ebd., 40).
Allerdings stehen noch eingehende Untersuchungen zu diesem Instrument aus. Schließlich ist bislang gar nicht oder nur unzureichend geklärt, wie die Beteiligten ihre Lernsituation innerhalb dieser Entwicklungsmaßnahme gestalten bzw. welche Möglichkeiten ihnen dazu offen stehen. Es ist unklar, wie sie ihre (berufs-) biographischen Erfahrungsbestände einsetzen bzw. welche Rolle diesen Erfahrungsbeständen zukommt. Außerdem muss untersucht werden, welche Lernprozesse bei den Beteiligten tatsächlich stattfinden (vgl. Schell-Kiehl 2007, 14). Eine umfassende Analyse der (Lern-) Faktoren, die eine effektive Förderung durch Mentoring begünstigen, muss grundsätzlich daher noch stattfinden (Fellenberg 2007, 424). Es kann festgestellt werden, dass Mentoring-Programme in ihren Formen zwar insgesamt immer vielfältiger und wandlungsfähiger werden, es ist „jedoch immer noch wenig über die Dynamik dieser Organisationsform selbst bekannt (…)“ (Peters 2006, 8). Dazu stellt Dehnbostel (2007) stellvertretend für zahlreiche Arbeitszusammenhänge fest, dass die Anzahl an Lernmöglichkeiten zunimmt, es aber zu prüfen bleibt, inwiefern diese Angebote wirksam und nachhaltig sind (vgl. Dehnbostel 2007, 67).
Um eine effektive Förderung durch Mentoring in Unternehmen zu gewährleisten, ist es daher erforderlich, dass das zentrale Thema „Lernen“ eine stärkere Berücksichtigung findet. Es muss bei den Prozessverantwortlichen der Unternehmen ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, wie Lernprozesse Erwachsener überhaupt ablaufen und wie diese durch Mentoring gefördert werden können.
1.2 Zielsetzung der Arbeit
Ausgehend von diesen Überlegungen stellt die vorliegende Arbeit einen Zusammenhang zwischen den Lernprozessen Erwachsener und Mentoring als ein Instrument der Personal- und Führungskräfteentwicklung her. Die Arbeit versucht zu klären, welche Lernprozesse durch das Mentoring gefördert werden und wie nachhaltig diese sind. Konkret lässt sich daraus folgende Hauptfragestellung ableiten:
Inwieweit wird Mentoring den Anforderungen an erwachsenenpädagogische Lernprozesse gerecht und kann auf diese Art und Weise erfolgreich zur Förderung von Nachwuchsführungskräften eingesetzt werden? So kann konkret gefragt werden: Welche lernförderlichen Prozesse werden durch Mentoring auf den Weg gebracht? Ist es als Instrument zur Nachwuchsförderung innerhalb eines Unternehmens geeignet und welche Bedingungen sind damit verbunden?
Um diese Hauptfrage beantworten zu können, sind folgende Einzelfragen zu stellen:
- Welche Bedingungen sind beim Lernen Erwachsener zu berücksichtigen?
- Welche Anforderungen werden an Nachwuchsführungskräfte gestellt?
- Wie ist Mentoring als Förderinstrument angelegt?
- Welche Lernprozesse werden durch Mentoring angeregt? Wie lernt die Nach- wuchsführungskraft (Mentee) von der Führungskraft (Mentor)?
- Was bedeutet das Lernen innerhalb des Mentorings für die Arbeit von Personal- entwicklern und Prozessbegleitern? Welche Möglichkeiten bieten sich zur er- folgreichen Gestaltung und Begleitung dieses Prozesses?
Die Beantwortung der aufgeworfenen Fragen erfolgt anhand einer theoriegeleiteten Untersuchung. Dazu werden einschlägige aktuelle Studien und Werke herangezogen. Wie bereits im Vorwort erwähnt wurde, ist ein Mentoring-Programm im Unternehmen E bislang noch nicht implementiert. Aus diesem Grund kann keine empirische Analyse zu der Lernsituation und den Wirkungen des Mentorings in diesem Unternehmen erfolgen. Eine empirische Analyse würde sich im Anschluss an ein Pilotprogramm im Unternehmen E ergeben.
Die intensive theoretische Auseinandersetzung mit Mentoring-Prozessen soll insgesamt das Bewusstsein für erwachsenenpädagogische Aspekte innerhalb dieser Personalentwicklungsmaßname schärfen. Dadurch sollen die Chancen, aber auch die Gefahren des Mentorings als Entwicklungsinstrument aufgezeigt werden. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen eine Basis für die Implementierung von Mentoring in Unternehmen bieten.
1.3 Aufbau der Arbeit und formale Hinweise
Nachdem in Kapitel 1 die Ausgangssituation und die Problemstellung skizziert und daraus die Zielsetzung dieser Arbeit abgeleitet wurde, werden in Kapitel 2 die Grundlagen des Lernens Erwachsener behandelt. Dabei wird zunächst beleuchtet, wie das Lernen nach den klassischen psychologischen Lerntheorien im Allgemeinen verläuft. Anschließend wird ein Bezug zum Lernen Erwachsener hergestellt. Dabei werden Lernformen vertieft, die den Bedürfnissen des erwachsenen Lerners im besonderen Maß entsprechen. Daraus werden didaktische Implikationen an die Lernprozesse Erwachsener abgeleitet.
In Kapitel 3 werden die Grundlagen der betrieblichen Personal- und Führungskräfteentwicklung behandelt. Das Lernen Erwachsener wird auf diese Art und Weise in einen Kontext eingebunden. Auf der Grundlage des herausgearbeiteten Verständnisses von Personalentwicklung wird im Speziellen die Entwicklung von Führungskräften betrachtet, die wiederum besondere Anforderungen mit sich bringt. Die vorliegende Arbeit betrachtet explizit die Anforderungen an Führungskräfte, weil anhand dieser Anforderungsanalyse die Entwicklung einer umfassenden Handlungskompetenz herausgestellt wird.[1] Anschließend wird aufgezeigt, wie die Entwicklung von Handlungskompetenz im Unternehmen gestaltet werden kann.
Als eine mögliche Maßnahme zur Entwicklung von Handlungskompetenz wird Mentoring in Kapitel 4 vorgestellt. Nach einer umfassenden begrifflichen und inhaltlichen Bestimmung von Mentoring, wird die Interaktionsebene zwischen Mentor und Mentee als charakteristisches Merkmal dieser Maßnahme herausgestellt. Anschließend wird die Umsetzung und Ausgestaltung in den Unternehmen betrachtet, wobei Formen des Mentorings und die Verbreitung in deutschen Unternehmen beleuchtet werden.
In Kapitel 5 wird das Potential des Mentorings mithilfe der vorangegangenen Ausführungen erfasst. Dazu wird auf der Grundlage der in Kapitel 4 vorgenommenen Darstellung von Mentoring eine Mentoring-Situation im Abgleich mit einer kompetenzförderlichen Lernsituation betrachtet. Daraus werden mögliche Lernprozesse abgeleitet. Ausgewählte Wirkungen auf die Akteure sollen das grundsätzliche Potential des Mentorings belegen. Für eine abschließende Potentialeinstufung wird auf unterschiedliche Lernbedingungen aufmerksam gemacht, die auch auf die Gefahren des Mentoring-Prozesses hinweisen. Daraus werden Schlussfolgerungen für die Praxis von Personalentwicklern und Prozessbegleitern gezogen.
Das Fazit in Kapitel 6 fasst die Ergebnisse der aufgeworfenen Fragen zusammen und zieht ein abschließendes Resümee.
Die Inhalte der vorliegenden Arbeit beziehen sich in gleichem Maße sowohl auf Frauen als auch auf Männer. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird jedoch die männliche Form für alle Personenbezeichnungen gewählt. Die weibliche Form wird dabei stets mitgedacht. Eine Ausnahme bilden die Inhalte, die ausdrücklich auf Frauen bezogen werden.
Der Begriff „Mentoring“ ist eine feststehende Bezeichnung aus dem anglo-amerikanischen Sprachgebrauch. Der Genetiv wird nach einer Empfehlung des Dudens in der vorliegenden Arbeit mit einem „s“ gebildet (vgl. Dudenredaktion 2007, 329). Daneben verwenden deutsche Veröffentlichungen zu diesem Thema auch die Form ohne Genetiv-s, die ebenfalls möglich ist.
„Ich lerne vom Leben. Ich lerne solange ich lebe. So lerne ich heute noch.“
Otto von Bismarck (1815-1898),
Gründer des Deutschen Reiches und dessen erster Kanzler
2 Grundlagen des Lernens Erwachsener
Der erste Teil dieses Kapitels stellt die Grundlagen des Lernens vor, indem ein allgemeines Lernverständnis dargelegt wird und die Grundzüge der klassischen Lerntheorien der Psychologie aufgezeigt werden. Der zweite Teil behandelt ausführlich das Lernen Erwachsener. Dazu wird der Erwachsene als Lerner analysiert und aufgezeigt, welche Lernformen eine besondere Relevanz für ihn besitzen. Anschließend werden aus diesen Erkenntnissen didaktische Implikationen für das Lernen Erwachsener gezogen. Dabei wird stets ein Bezug zum Lernen im Prozess der Arbeit hergestellt, der im Hinblick auf das Thema der vorliegenden Arbeit eingehalten wird.
2.1 Zum allgemeinen Lernverständnis
Der folgende Teil nähert sich dem Lernbegriff an und zeigt im Anschluss einen Überblick über gängige psychologische Lerntheorien auf. Diese Theorien stellen Annahmen darüber auf, wie sich menschliches Lernen vollzieht. Auf der Grundlage dieses Wissens können pädagogische Maßnahmen effektiver geplant und umgesetzt werden. Schließlich ist es „die vornehmste pädagogische Aufgabe“ (Göhlich et al. 2007, 9) die Umgebung so zu gestalten, dass sie „anregend klärend, aber auch stärkend wirkt“ (ebd., 9) und damit eine Lernunterstützung bietet.
2.1.1 Annäherung an den Lernbegriff
Das Leben jedes Menschen und lernfähigen Individuums ist von Lernprozessen geprägt. Vor allem die menschliche Individualität und Anpassungsfähigkeit an die Umweltbedingungen sind auf Lernprozesse zurückzuführen (vgl. Gagné 1980, 13). Lernen bedeutet demnach im weitesten Sinn „Entwicklung“, die von natürlichen, genetisch-bedingten Reifeprozessen zu unterscheiden ist (vgl. ebd., 13). Die Entwicklung durch Lernen beinhaltet vielmehr „alle relativ dauerhaften Veränderungen im Verhaltenspotenzial, die aus Erfahrung resultieren (…)“ (Lefrançois 2006, 6), so eine allgemeine Definition der Psychologie. Auf diese Art und Weise wird durch Lernen die Bildung einer menschlichen Kultur vorangetrieben und die eigentliche „Menschwerdung“ (Göhlich et al. 2007, 7) unterstützt.[2] Die internen Vorgänge des Lernens sind dabei für Außenstehende nicht unmittelbar einsehbar (vgl. Siebert 2001, 195).
Der Lernbegriff impliziert stets ein aktives Tätigsein des Lerners[3], was über Tätigkeitsworte, wie aneignen, erfassen, begreifen und erwerben, deutlich wird (vgl. Nuissl 2006, 220). Aus der Lernaktivität gehen in der Regel Lernergebnisse hervor, die zum Teil durch vorher zugewiesene Lernziele gesteuert werden. Gagné (1980) zeigt anhand von fünf Klassen unterschiedliche Lernergebnisse auf, die hier beispielhaft genannt werden: intellektuelle Fähigkeiten, kognitive Strategien, verbale Information, motorische Fähigkeiten und Einstellungen (vgl. Gagné 1980, 37ff.). Diese Ergebnisse führt Gagné auf acht Lernstufen zurück, die sich an unterschiedlichen Komplexitätsgraden orientieren. Die Stufen reichen vom Signallernen, bei dem der Lernende auf ein Signal hin eine Reaktion zeigt, bis hin zum Problemlösen, bei dem der Lernende durch die Kombination von Regeln Leistungen höherer Ordnung vollbringt (vgl. ebd., 78ff.). Mit Hilfe der psychologischen Lerntheorien wird versucht, diese Stufen als Lernvorgänge zu erklären. Der Erfolg des Lernens ist dabei von bestimmten Lernbedingungen abhängig. Zum einen nennt Schüßler (2007) in diesem Zusammenhang die personale Dimension. Darunter sind Persönlichkeitseigenschaften sowie Fähigkeiten und Motivationen einer Person bezüglich ihres Lernverhaltens zu verstehen (vgl. Schüßler 2007, 119). Weiterhin ist die situative Dimension, wie „das soziokulturelle Millieu, Lernsettings, Arbeitsplatzbedingungen, familiäre oder berufliche Situation“ (ebd., 119), zu berücksichtigen. Als dritte Dimension tritt die didaktische Dimension hinzu, die Lernprinzipien, didaktische und methodische Verfahren, Interaktions- und Kommunikationsstrukturen und die pädagogische Professionalität des Lehrenden in den Blick nimmt (vgl. ebd., 119). Lernen umfasst demnach Tätigkeiten, die in Abhängigkeit von bestimmten Faktoren über verschiedene Stufen zu einem Ergebnis führen. Daher ist Lernen stets in einen Prozess eingebunden (vgl. Nuissl 2006, 220).
Aus der Abhängigkeit von den Umweltbedingungen können weiterhin verschiedene Arten des Lernens ausgemacht werden, die unterschiedliche Lernsituationen aufzeigen. Die Lernarten stehen sich oftmals als Gegensatzpaare gegenüber, wie zum Beispiel erfahrungsbezogenes versus wissenschaftsbezogenes, selbstgesteuertes versus fremdgesteuertes oder informelles versus institutionelles Lernen (vgl. Faulstich/ Zeuner 2006, 28). Im Zuge des wirtschaftlichen und demografischen Wandels wird besonders das Konzept des „Lebenslangen Lernens“ betont. Dieses Lernkonzept begreift Lernen als „individuelles und biografisches Kontinuum“ (Nuissl 2006, 217). Lernen findet hier außerhalb theoretisch-empirischer Zusammenhänge statt und kann als permanente Neugier und Aufgeschlossenheit des Menschen gegenüber Neuem verstanden werden (vgl. Siebert 2001, 197).
Wie die verschiedenen Elemente und Phänomene des Lernens begründet sind und was unter dem Lernbegriff genau zu fassen ist, wird innerhalb der Humanwissenschaften unterschiedlich ausgelegt (vgl. Siebert 2001, 194; vgl. Nuissl 2006, 219). Die Pädagogik begreift Lernen vor allem in Rückbezug auf den jeweiligen Lerner und seine Lebenswelt. So betont Siebert ein reflexives Lernverständnis der Pädagogik zur Bewusstwerdung und Bildung des eigenen Selbst (vgl. Siebert 1985, 60). Die Steuerbarkeit von Lernprozessen bzw. die aktiven Gestaltungsmöglichkeiten von Lernumgebungen sind weitere Grundannahmen des pädagogischen Lernverständnisses (vgl. Göhlich et al. 2007, 7).
Die vorliegende Arbeit wendet sich im Folgenden der psychologischen Sichtweise des Lernens zu, indem die zentralen Aspekte der klassischen psychologischen Lerntheorien beleuchtet werden. Das Erkenntnisinteresse besteht darin, die Mechanismen und Strukturen von Lernprozessen zu erforschen. Diese Erkenntnisse bilden die Grundlage für die Theoriebildung innerhalb der Pädagogik.
2.1.2 Klassische Lerntheorien der Psychologie
Wie deutlich wurde, beschreibt Lernen sehr komplexe Prozesse. Lerntheorien können als systematische Versuche verstanden werden, diese Prozesse zu erklären und vorherzusagen (vgl. Lefrançois 2006, 24). Dabei stehen jeweils unterschiedliche Aspekte im Mittelpunkt der Betrachtung. Nach den historischen Hauptströmungen in der Lernforschung können drei wesentliche Theoriegruppen unterschieden werden: Behaviorismus, Kognitivismus und Konstruktivismus. Diese Annahmen zum Lernen sind für Menschen jeder Altersklasse relevant (vgl. Krämer 2007, 49; vgl. Steiner 2006, 157) und werden im Folgenden skizziert. Aufgrund der zeitlichen Aufeinanderfolge greifen die Theorien ineinander über und überschneiden sich zum Teil. Eine endgültige, wissenschaftliche Klärung der genauen Funktionsweise des Lernens steht allerdings bis heute aus (vgl. Schwarzer/ Buchwald 2007, 217).
2.1.2.1 Behaviorismus
Die Theorien des Behaviorismus beschäftigten sich mit den objektiv beobachtbaren Aspekten des menschlichen Verhaltens und deren Bedingungen. Die Grundannahme lautet, dass jedes Verhalten durch äußere Reize (Stimuli) ausgelöst und kontrolliert wird (vgl. Lefrançois 2006, 41). Die Stimuli bilden damit die vorausgehenden Bedingungen für eine Reaktion, die sich im menschlichen Verhalten äußert. Die Art und Weise der Reaktion wird über nachfolgende Konsequenzen gesteuert, die einer Belohnung, Bestrafung oder einer neutralen Auswirkung auf das gezeigte Verhalten entsprechen können. Je nachdem, wie die Konsequenz auf das gezeigte Verhalten ausfällt, wird das Verhalten wiederholt. Dieses zusammenhängende Schema wird als Reiz-Reaktionsschema bezeichnet (vgl. ebd., 41f.). Die menschlichen Verarbeitungsprozesse bleiben in diesen Theorien weitestgehend unberücksichtigt (vgl. Steiner 2006, 140). Unter Lernen kann nach diesen Annahmen jede dauerhafte Änderung des Verhaltens bezeichnet werden, die durch äußere Stimuli hervorgerufen wird. Dabei spielen vor allem Anreizsysteme eine wichtige Rolle (vgl. Faulstich/ Zeuner 2006, 26).
Der Behaviorismus war in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die dominierende Lerntheorie. Allerdings berücksichtigt diese Theorie nicht hinreichend menschliche Kognitionsprozesse, wie zum Beispiel menschliches Bewusstsein und Bedeutsamkeit und konnte damit auch kein kreatives Handeln erklären (vgl. Göhlich et al. 2007, 10). Sie übertrug in großen Teilen die Versuchsergebnisse von Tieren auf Menschen und wurde daher zunehmend in Frage gestellt (vgl. Lefrançois 2006, 57). In ihren wesentlichen Annahmen dient sie als Grundlage für weiterführende Theorien, wie den Kognitivismus.
2.1.2.2 Kognitivismus
Das Leitbild des Kognitivismus bilden die Prozesse der internen Informationsverarbeitung. Kognitive Prozesse des Individuums, wie das Denken, Vorstellen und Problemlösen, werden in die Erklärungsversuche zum Lernen einbezogen (vgl. Lefrançois 2006, 190). Das Individuum speichert Informationen (Input) in organisierter Form als Kognitionen, die auch als „geistige Repräsentationen“ (ebd., 191) bezeichnet werden. Diese Kognitionen enthalten Informationen über Gegenstände, Situationen, Handlungen sowie Verhaltensweisen und Emotionen von Menschen. Als Produkt der Verarbeitung wird ein bestimmtes Verhalten erzeugt (Output).
Analog zu den Informationsverarbeitungsprozessen von Computern unterliegen Kognitionen bestimmten menschlichen Verarbeitungsprozessen, d. h. sie werden permanent mit bestehenden Wissensstrukturen verglichen (vgl. ebd., 191). Der Bereich des Vorwissens bildet daher eine zentrale Kategorie.[4]
Im Unterschied zur behavioristischen Sichtweise besitzt das Individuum die Möglichkeit zur kognitiven Vorwegnahme von Konsequenzen auf sein Verhalten (Antizipation). Dadurch wird seine Selbsttätigkeit und Unabhängigkeit von Umwelteinflüssen herausgestellt (vgl. Schwarzer/ Buchwald 2007, 218). Weiterhin ist von Bedeutung, dass Wissen prinzipiell unabhängig vom Lernenden selbst zur Verfügung steht und objektiv definiert werden kann (vgl. ebd., 220).
2.1.2.2.1 Lernen am Modell
Im Hinblick auf das Thema der vorliegenden Arbeit wird angenommen, dass das soziale Lernen in Mentoring-Prozessen eine zentrale Rolle einnimmt. Daher wird im Folgenden die sozial-kognitive Lerntheorie nach Bandura (1979) in ihren wesentlichen Annahmen dargestellt. Bandura greift in seiner Theorie behavioristische Erklärungsmodelle auf und ergänzt diese um die Elemente der Beobachtung und Imitation, die einer kognitiven Verarbeitung und Bewertung bedürfen (vgl. Lefrançois 2006, 312ff.; vgl. auch Mazur 2004, 412).
Über das „Lernen am Modell“, das synonym auch als „Beobachtungslernen“, „Nachahmungslernen“, „Imitationslernen“ oder „Modellieren“ bezeichnet wird (vgl. Steiner 2006, 157), werden grundlegende menschliche Verhaltensweisen erlernt (vgl. Bandura 1979, 31). Die Beobachtung anderer Menschen bietet dem Lernenden Informationen darüber, wie Tätigkeiten ausgeführt werden. Daraus können eigene Handlungsrichtlinien abgeleitet werden sowie „sehr verlässlich (…) Einstellungsänderungen“ (Gagné 1980, 231) von Personen herbeigeführt werden. Zur Beobachtung werden solche Modelle ausgewählt, die „gewinnende Eigenschaften“ (Bandura 1979, 33) besitzen. Neben der allgemeinen Anerkennung des Modells gelten u. a. folgende Bedingungen für das „Lernen am Modell“, die in zahlreichen Untersuchungen festgestellt wurden (vgl. Mazur 2004, 422ff.; vgl. auch Bandura/ Huston 1961, 317): Das Modell hat eine höhere soziale Position inne als der Lernende. Der Lernende kann sich mit dem Modell identifizieren. Der Lernende verbindet mit der Beziehung zum Modell positive Emotionen. Weiterhin sind physische und psychische Voraussetzungen des Lernenden für den Lernerfolg erforderlich (vgl. Bandura 1979, 38f.).
2.1.2.2.2 Teilprozesse und Ergebnisse des Modelllernens
Dem Beobachtungslernen liegen vier Teilprozesse zugrunde, wie die folgende Abbildung zeigt:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Teilprozesse des Beobachtungslernens. Quelle: Eigene Darstellung auf der
inhaltlichen Grundlage von Bandura 1979, 32.
Aufmerksamkeitsprozesse steuern die Wahrnehmung des Beobachtenden. Der beigemessene „Funktionswert von Verhaltensweisen“ (Bandura 1979, 33) ist dabei entscheidend, welche Modelle beobachtet werden. Die als positiv erachteten Verhaltensweisen werden in Form von „Reaktionsmuster[n] symbolisch im Gedächtnis repräsentiert“ (ebd., 34). Als Ergebnis dieser Behaltensprozesse liegen visuelle Repräsentationen, z. B. Vorstellungen zu bestimmten Handlungsabläufen, und verbale Repräsentationen, z. B. Beschreibungen von Handlungsabläufen, vor. In einem weiteren Schritt setzt der Lernende die symbolischen Repräsentationen in eigenes Handeln um. Diese motorischen Reproduktionsprozesse erfordern nach ihrer Auslösung eine permanente Überwachung und „Korrektur auf der Grundlage informativer Rückkoppelungen“ (ebd., 36). Schließlich entscheiden motivationale Prozesse darüber, ob das gelernte Verhalten in bestimmten Situationen tatsächlich ausgeführt wird. Wenn eine Verstärkung des gezeigten Verhaltens erwartet wird, wirkt dies als Antrieb zur Verhaltensausführung (vgl. ebd., 33ff.).
Die Beobachtung von Modellen kann für den Lernenden unterschiedliche Wirkungen haben: Der Lernende kann eine vollständig neue Verhaltensweise oder Einstellung erwerben. Dabei können Verhaltensweisen des Modells auch abgewandelt oder kombiniert werden (vgl. ebd., 49ff.). Die Beobachtung kann dazu führen, dass der Lernende ein bestehendes Verhaltensmuster verstärkt zeigt oder unterdrückt, nachdem er die Konsequenzen auf das gezeigte Verhalten bei dem Modell wahrgenommen hat. Es ist weiterhin möglich, dass das Verhalten des Modells ein bestehendes Verhalten des Lernenden spontan auslöst (vgl. Lefrançois 2006, 316ff.).
Anhand dieser vielfältigen Wirkungsweisen wird deutlich, dass der Einfluss von Modellen hoch ist. Im Zusammenhang mit einem Lernen im Prozess der Arbeit betonen Sonntag und Stegmaier (2007), dass "Kollegen, Vorgesetzte oder auch Kunden wertvolle Quellen für Lernprozesse“ (Sonntag/ Stegmaier 2007, 45) darstellen können. Dabei ist kritisch anzumerken, dass auch negative Verhaltenweisen und Ängste von Modellen übernommen werden können (vgl. Mazur 2004, 430f.).
2.1.2.3 Konstruktivismus
Während der Kognitivismus menschliche Verarbeitungsprozesse betont, gehen die Annahmen des Konstruktivismus einen Schritt weiter und stellen die Aufnahme und Verarbeitung von Informationen als aktive Konstruktionsleistung des Individuums heraus (vgl. Göhlich et al. 2007, 11; vgl. Steiner 2006, 166). Jeder Mensch konstruiert so in dauerhafter Auseinandersetzung mit einer vorgefundenen Außenwelt seine Erkenntnisse selbst. Die Welt und das zugrunde liegende Wissen kann dabei nicht „abgebildet“, „widergespiegelt“ oder „angeeignet“ (Siebert 1994, 13) werden, weil sie nicht objektiv erfahrbar sind. Die menschliche Konstruktionsleistung erzeugt vielmehr Bilder, die das eigene Selbst, andere Menschen und die Welt als Ganzes erfassen. Diese Bilder können auch als Deutungsmuster bezeichnet werden (vgl. ausführlicher Punkt 2.2.2.1.2). Dies begründet eine subjektive Lebenswelt, die auf eigenen Erfahrungen und eigenem Erleben beruht (vgl. Siebert 1994, 13). Der Mensch bildet diesen Annahmen zufolge ein „informationell geschlossenes System“ (Göhlich et al. 2007, 11). Eine Verständigung mit anderen Menschen ist dennoch möglich und findet in Form „symbolische[r] Interaktionen“ (Siebert 1994, 14) statt.
Das Lernen von Menschen kann insofern als „relativ eigenständiger, operational geschlossener, selbstreferentieller Prozeß“ (Arnold/ Siebert 2003, 81) verstanden werden. Diese Abgeschlossenheit und Selbstreflexivität wird unter dem Begriff „Autopoiesis“[5] gefasst, der für Selbstorganisation steht (vgl. ebd., 81). Dieses Prinzip verdeutlicht, dass die Generierung von Wissen ein kreativer und schöpferischer Akt ist, der auf einer Zuschreibung von Sinn beruht (vgl. Siebert 1994, 81). Neue Erfahrungen und Eindrücke werden dabei mit bereits bestehendem Vorwissen in Verbindung gebracht (vgl. ebd., 47f.). Unter Berücksichtigung dieses Vorwissens werden Informationen dann zu subjektivem Wissen verarbeitet, wenn sie dem Individuum relevant, neu, anschlussfähig und viabel (hilfreich) erscheinen (vgl. Arnold/ Siebert 2003, 113). Wenn sich in diesem Prozess ein bestehendes Weltbild als nicht mehr viabel herausstellt, wird ein Verlernen gewohnter Deutungen und Verhaltensweisen, ein so genanntes Refraiming, erforderlich (vgl. ebd., 117; vgl. Siebert 1994, 51).
Da das Lernen noch stärker als in den kognitivistischen Theorien als individueller Prozess betont wird, ist Wissen prinzipiell nicht vermittelbar. Siebert (1993) formuliert diesen Umstand treffend, indem er sagt: „Bildung ist nicht organisierbar“ (Siebert 1993, 123). Der Lehrende ist vielmehr aufgefordert eine anregende Umgebung zu gestalten und „fördernd-indirekte Impulse“ (vgl. Arnold/ Siebert 2003, 7) abzugeben. Deshalb wird die Rolle des Lehrenden häufig mit der eines Moderators, Anleiters, Lernberaters oder Trainers beschrieben. Der Lernende soll dadurch in seiner Lerntätigkeit angeregt werden. Die so genannte „Ermöglichungsdidaktik“ greift diese Annahmen zur Lehre auf (vgl. Schüßler 2007, 200f.; vgl. zur Ermöglichungsdidaktik Punkt 2.2.3).
Die Erkenntnistheorie des Konstruktivismus ist in der Lernforschung derzeit vorherrschend (vgl. Schwarzer/ Buchwald 2007, 217). Sie bietet vor allem für erwachsenenpädagogisches Handeln zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten, weil sie den Anforderungen des erwachsenen Lerners im Besonderen entspricht, wie im Folgenden noch aufgezeigt wird. Daher bezeichnen Arnold und Siebert (2003) diese Theorie auch als eine „Art Gegenstandstheorie der Erwachsenenbildung“ (Arnold/ Siebert 2003, 8).
2.2 Zum Lernverständnis Erwachsener
Die vorliegende Arbeit versucht u. a. zu klären, welche Lernprozesse durch das Mentoring gefördert werden und welche Lernsituationen dies unterstützen. Der Mentor und der Mentee sind schließlich als (erwachsene) Personen in eine Entwicklungsmaßnahme eingebunden, die zentral auf das Thema Lernen angelegt ist. Insofern ist es zunächst notwendig, das Lernen Erwachsener im Allgemeinen darzulegen.[6] Dabei findet stets ein Rückbezug auf das Lernen im Prozess der Arbeit statt.
2.2.1 Der Erwachsene: Definition und (Lern-) Vorurteile
Der Bezeichnung „Erwachsener“ ist historisch geprägt und steht für Personen, die in der Regel bestimmte Merkmale vereinen (vgl. Faulstich/ Zeuner 2006, 36). Als Zusammenfassung unterschiedlicher Definitionsansätze soll für die vorliegende Arbeit die Begriffsbestimmung von Faulstich und Zeuner (2006) gelten. Folgende Merkmale zeichnen demnach Erwachsene aus:
- Zustand körperlicher Reife
- Stabilität von Verhaltens-, Erlebens-, Denk- und Lernformen
- Umgang mit Kindheit und Alter
- Übernahme von Rollen wie Partnerschaft und Elternschaft
- Erwerb von Pflichten und Rechten
- Stehen in einer Erwerbstätigkeit und wirtschaftlicher Selbstständigkeit
(vgl. ebd., 36).
Diese Merkmale lassen keine trennscharfe Begriffsbestimmung zu, da sie keine objektiven Messgrößen für den Grad des Erwachsenseins darstellen. Allerdings wird im Kern deutlich, dass ein Erwachsener für einen „selbstverantwortlichen und selbstbestimmten Menschen“ (ebd., 36) steht, der mit einem selbstständigen Lernen in Verbindung gebracht werden kann, wie noch ausgeführt wird.
Dennoch existiert eine Vielzahl an Vorurteilen, die dem Lernen im Erwachsenenalter zum Teil noch entgegengebracht werden. Dies manifestiert sich in Aussagen wie diesen: Die menschliche Natur könne man nicht verändern. Man könne einem alten Hund keine Kunststücke beibringen. Das durchschnittliche geistige Alter bleibe bei zwölf Jahren stehen. Lernfähigkeit sei eine Sache der Intelligenz. Was Hänschen nicht lerne, lerne Hans nimmermehr (vgl. Kidd 1979, 16ff.; vgl. Schwarzer/ Buchwald 2007, 213). Die so genannte „Adoleszenz-Maximum-Hypothese"[7] stellt schließlich den Versuch dar, diese Vorurteile wissenschaftlich zu belegen. Wie jedoch in vielen Studien aufgezeigt wurde, ist die Lernfähigkeit von Menschen auf kein bestimmtes Alter begrenzt (vgl. bspw. Faulstich/ Tymister 2002, 2ff.; vgl. Löwe 1976). Auch aus neurophysiologischer Sicht bestehen keine Unterschiede zwischen Kindern und Erwachsenen (vgl. Siebert 2001, 196). Entscheidend ist allerdings das Lerntraining, wie in zahlreichen Untersuchungen belegt wurde (vgl. Schaie 1994, 304ff.). Wichtige physische und psychische Funktionen Erwachsener sollten durch beständiges Training (Aktivitätshypertrophie) aktiviert bleiben (vgl. Siebert 1985, 35). Weiterführendes Lernen ist zudem stärker von der Qualität der Lehre abhängig als von eigenen Anlagen oder so genannten Reifungsvorgängen, wie Roth bereits im Jahr 1969 feststellt (vgl. Roth 1969, 520ff.).
Aus diesen Gegenargumentationen kann schlussgefolgert werden, dass Erwachsene lernfähig sind und die Vorurteile demgegenüber nicht haltbar sind. Schließlich legen dies auch die vorangegangenen Ausführungen zum allgemeinen Lernverständnis (vgl. Punkt 2.1.1) und den psychologischen Lerntheorien (vgl. Punkt 2.1.2) nahe. Das Lernen Erwachsener ist vielmehr an besondere Bedingungen geknüpft, die vor allem auf ihren individuellen Lebenslauf zurückzuführen sind und besondere Lerngelegenheiten erforderlich machen.
2.2.2 Übergreifende Merkmale des erwachsenen Lerners
Wie bereits im vorherigen Punkt angedeutet wurde, bringt die wissenschaftliche Betrachtung des erwachsenen Lerners zahlreiche Erkenntnisse hervor, die für besondere Lernbedingungen Erwachsener sprechen. Ortner und Schneider (1992) haben dahingehend wesentliche Erkenntnisse der Erwachsenenpädagogik zusammengestellt und übergreifende Merkmale des Lernens von Erwachsenen formuliert. In ihrer Darstellung finden vor allem die empirischen Erkenntnisse von Kolb, Rubin und Osland zum Lernen Erwachsener in Organisationen Berücksichtigung (vgl. Kolb et al. 1991). Ebenso schließen sie die Theorie der „Andragogy in Action“ von Knowles in ihre Übersicht mit ein (vgl. Knowles 1984).
Aktuell nehmen Erpenbeck und Heyse darauf Bezug (vgl. Erpenbeck/ Heyse 2007, 100f.). Neben der Darstellung der typischen Merkmale des erwachsenen Lerners geben Ortner und Schneider allgemeine pädagogische Handlungsanweisungen (vgl. im Folgenden Ortner/ Schneider 1992, 251ff.):
- Erwachsene verfügen über eine langjährige Lebenserfahrung und bringen einen
hohen Wissensstand in Lernprozesse ein. Ihre Erfahrung tritt vor allem über die
Interaktion mit anderen Menschen zutage und ist als individuelle Stärke zu
werten.
- Erwachsene haben relativ gefestigte Werte, Einstellungen und Meinungen. In
respektvollen Auseinandersetzungen können Lernprozesse angeregt werden, die
zum Nachdenken und Überprüfen dieser Themen bewegen.
- Erwachsene vergleichen neues Wissen mit ihren bestehenden Wissens- und
Erfahrungsbeständen. Das Lernen ist daher so zu gestalten, dass es an ihre
individuellen Erfahrungen anschließt.
- Das Selbstbild von Erwachsenen ist ebenso gefestigt wie ihre Werte,
Einstellungen und Meinungen. In Lernsituationen ist wichtig, dass sie sich als
Individuen respektiert fühlen und sich auf diese Art und Weise entfalten können.
- Erwachsene besitzen ein ausgeprägtes Bedürfnis nach Selbstorganisation und
Eigenverantwortung. Wenn Lernergebnisse selbstständig erarbeitet und
präsentiert werden, kann dadurch ihr Selbstwirksamkeitsempfinden gesteigert
werden. Dies wirkt sich förderlich auf ihre Lernmotivation aus.
- Erwachsene neigen dazu, ihren Lernprozess aus einer problemzentrierten
Sichtweise zu betrachten. Das neue Wissen soll daher stets einen Bezug zu ihren
aktuell relevanten Problemen und Situationen haben (vgl. dazu auch Löwe
1976, 133ff.). Das selbstgesteuerte und eigenverantwortliche Lernen
unterstützt diesen Anwendungsbezug, indem der Erwachsene eigenständig
praxisnahe Lernfelder erschließt.
Diese Auflistung macht die Unterschiede zum Lernen von Kindern und Jugendlichen deutlich und zeigt auf, dass das Lernen Erwachsener stark an ihrer „gewachsenen Individualität“ ausgerichtet sein muss, wenn es erfolgreich verlaufen soll. Diese Annahme ist ebenfalls grundlegend für die subjektwissenschaftliche Lerntheorie nach Holzkamp (1993). Im Zentrum dieser Theorie steht das handelnde Subjekt, dem es um die Realisierung von gesellschaftlichen Handlungsmöglichkeiten geht. Die Gründe für das Lernen sind im „subjekthaft-aktiven Weltbezug bzw. Weltzugriff als Erweiterung der Verfügung über die eigenen Lebensbedingungen zu verstehen“ (Holzkamp 1993, 23). Die subjektiven Lebensinteressen dienen daher stets als Begründungen für das Lernen. Der Lerner sichert sich durch ein expansives Lernen seine Lebensqualität und stellt seine emotionale Ausgeglichenheit her (vgl. Schüßler 2007, 178). Damit wendet sich Holzkamp explizit gegen den „Lehrlernkurzschluss“ (Holzkamp 1993, 387), der unterstellt, dass alles das gelernt werde, was zuvor gelehrt wurde.
In den folgenden Punkten dieser Arbeit werden die genannten Merkmale zum Lernen Erwachsener in unterschiedlichen Lernformen wieder aufgegriffen und vertieft, indem auch Rückbezüge auf das Lernen im Prozess der Arbeit hergestellt werden.
2.2.2.1 Lernen im Lebenslauf
Die Pädagogik hat ihre Aussagen und Theorien in vielfacher Hinsicht durch den Lebenslauf begründet (vgl. Arnold 2006, 150). Allerdings wurde ein deutlicher Rückbezug auf Erwachsene erst ab Mitte der 1970er Jahre herausgestellt. Dazu haben vor allem die Erkenntnisse der „neue[n] Soziologie des Lebenslaufs“ (ebd., 151) sowie die Ergebnisse der Erwachsenensozialisation und der erwachsenenpädagogischen Biographieforschung[8] in dieser Zeit beigetragen. Das gestiegene Interesse an mikrodidaktischen Fragen und die Forderung nach einer höheren Teilnehmerorientierung haben außerdem den Lebenslauf Erwachsener in den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt (vgl. Siebert 1985, 37).
Diese späte Zuwendung ist insofern verwunderlich, als dass der Lebenslauf eine zentrale erwachsenenpädagogische Kategorie bildet und für Lernprozesse Erwachsener von hoher Bedeutung ist (vgl. Arnold 2006, 150ff.). Der Lebenslauf bildet sich in der ständigen Auseinandersetzung des Individuums mit seiner Umwelt heraus. Dabei entscheidet die subjektive Wahrnehmung darüber, wie die eigene Lebenswelt konstruiert wird:
Der Lebenslauf ist weder nur die Geschichte des autonomen Subjekts noch nur das Resultat gesellschaftlicher Verhältnisse. Der Subjekt-Objekt-Dualismus erweist sich als fragwürdig. Zwar finden wir eine Umwelt vor, aber jeder von uns interpretiert und konstruiert diese Umwelt neu und nimmt handelnd (oder erduldend) auf sie Einfluß (…). So ist der Lebenslauf die unverwechselbare Art und Weise, in der Menschen ihre Wirklichkeit wahrnehmen, verarbeiten und prägen. Anders formuliert: Der Lebenslauf ergibt sich aus der Interdependenz von Individuum und sozialer sowie physischer Umwelt (Siebert 1985, 42).
Diese ausführliche Beschreibung des Lebenslaufs verdeutlicht die Relevanz für erwachsenenpädagogische Lernprozesse: Erwachsene haben im Verlauf ihres Lebens zahlreiche Wissens- und Erfahrungsbestände aufgebaut, die ihre Denk- und Handlungsweisen und schließlich ihre Identität bestimmen. Das Lernen Erwachsener sollte demnach einen Bezug zu ihrem individuellen „Relevanzsystem“ herstellen. Eine solche „biographische Verankerung der Lerninhalte“ (Siebert 1985, 114) ermöglicht es, dass neue Lerninhalte in vorhandene kognitive Strukturen integriert werden bzw. ein Nachdenken anregt wird (vgl. ebd., 114). Faulstich und Zeuner (2006) stellen ebenfalls fest, dass der Rückbezug auf den Lebenslauf beim Lernen Erwachsener unerlässlich ist, da Erfahrungen aus der Kindheit, der Schule, dem Arbeitsplatz, der Familie und weiteren Sozialisationsinstanzen das zukünftige Lernverhalten prägen (vgl. Faulstich/ Zeuner 2006, 36). Der Erwachsene wird durch Erfahrungen für bestimmte Lerninhalte sensibilisiert und ordnet neues Wissen nach bestehenden Deutungsmustern. Erst die Berücksichtigung des Lebenslaufs ermöglicht ein sinnerfülltes und nachhaltiges Lernen, weil es für den jeweiligen Lerner eine subjektive Bedeutung erhält (vgl. Arnold 2006, 154).
Bis heute liefert die Biographieforschung wichtige Ansatzpunkte für neue Lehr-Lern-Konzepte innerhalb der Erwachsenenbildung (vgl. Schell-Kiehl 2007, 79, vgl. Alheit 2003, 7ff.). Im Hinblick auf die weiteren Ausführungen steht noch eine genaue Definition des Erfahrungsbegriffs aus. Außerdem wird der eigentliche Lernprozess im Lebenslauf als Deutungslernen dargelegt.
2.2.2.1.1 Erfahrungsbegriff
Die Bestimmung des Erfahrungsbegriffs folgt in der vorliegenden Arbeit handlungsorientierten und erkenntnistheoretischen Ansätzen, wie sie beispielsweise Dewey (1995, 2002) liefert. Den Ausgangspunkt für Erfahrungsprozesse bildet dabei die individuelle Lebenswelt, die als eine Einheit verstanden wird und kulturelle sowie sozial historische Bezüge aufweist. Erfahrungen helfen dem Individuum sich in einer ständig wandelnden Welt zu orientieren und ihre Gegenwart bestmöglich zu gestalten (vgl. Dewey 2002, 232). Der Erfahrungsbildungsprozess beinhaltet nach Dewey sowohl eine kognitive als auch eine emotionale Dimension (vgl. Dewey 1995, 54). Eine weitere Dimension fügt Dehnbostel (2007) mit der sozialen Dimension hinzu (vgl. Dehnbostel 2007, 29). Daher handelt es sich um einen umfassenden Prozess, „der den ganzen Menschen (…) in seiner Körperlichkeit und Leiblichkeit betrifft“ (Schell-Kiehl 2007, 81).
Zunächst gehen jeder Erfahrung sinnliche Wahrnehmungen aus der Umwelt voraus, die als „Elemente des episodalen Gedächtnisses“ (Nuissl 2006, 225) abgespeichert werden. Darüber hinaus sind Denk- und Reflexionsprozesse notwendig, damit die sinnlichen Wahrnehmungen im Bewusstsein verankert werden (vgl. Dewey 1995, 51). So lassen sich primäre und sekundäre Erfahrungen unterscheiden: Primäre Erfahrungen entspringen alltäglichen Situationen und sind an bestimmte Handlungen geknüpft. Sekundäre Erfahrungen sind Ergebnisse von Reflexionsprozessen, die in kritischen Lebenssituationen einsetzen. Durch diese Reflexion werden primäre Erfahrungen um eine Metaebene erweitert und als sekundäre Erfahrungen vertieft (vgl. Schäfer 1985, 229; vgl. Schell-Kiehl 2007, 82). Erfahrungen können daher als „Verbindung von Erlebtem mit reflexiven Deutungen“ (Siebert 1994, 84) verstanden werden. Die soziale Umwelt bildet dabei die Ausgangsbasis für Erfahrungsprozesse. Die vertieften Wahrnehmungen haben sich in zurückliegenden Handlungsverläufen bewährt und stehen dem Individuum für die Lebensbewältigung zur Verfügung (vgl. Erpenbeck/ Heyse 2007, 162). Dehnbostel (2007) spricht im Zusammenhang mit einer erweiterten Perspektive von Erfahrungen von innerer Erfahrung. Dabei werden äußere Erfahrungen durch „mentale, emotionale und interaktive Prozesse“ (Dehnbostel 2007, 30) in innere Erfahrungen überführt. Dieses umfassende Erfahrungsverständnis ist für die Entwicklung von Kompetenzen relevant, wie in Punkt 3.2.3 aufgezeigt wird.
Für Lernprozesse ist das Prinzip der Kontinuität hervorzuheben, nach dem „jede Erfahrung ebenso von den vorausgegangenen Erfahrungen beeinflusst wird wie sie ihrerseits die Qualität der ihr folgenden Erfahrung modifiziert“ (Dewey 2002, 241). Erfahrungen unterliegen daher ständigen Entwicklungsprozessen, d. h. neue Erfahrungen werden anhand bestehender Erfahrungen überprüft, weiter differenziert oder auch revidiert. Neben diesen pädagogisch wertvollen Erfahrungen können auch negative Erfahrungen die weitere Entwicklung des Individuums behindern (vgl. ebd., 242). Fest steht jedoch, dass Erfahrungen stets eine Verbindung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft herstellen (vgl. ebd., 272). Diese Art des Lernens wird im folgenden Punkt als Deutungslernen[9] beschrieben.
2.2.2.1.2 Deutungslernen
Erfahrungswissensbestände des Individuums dienen als Grundlage zur Ausbildung von Deutungsmustern. So stellt Schüßler (2007) fest: „Deutungsmuster sind der in Erfahrungen geronnene Alltagswissensbestand“ (Schüßler 2007, 183). Dabei setzen sich Deutungsmuster als übergeordnete Schemata aus vielen Einzelerfahrungen zusammen (vgl. Schell-Kiehl 2007, 83). Mithilfe von Deutungsmustern kann das Individuum in Handlungssituationen seine Umwelt gezielt wahrnehmen und diejenigen Inhalte auswählen, die durch bestehende Deutungsmuster interpretiert werden können. Deutungsmuster bieten dem Menschen so „ein Stück Sicherheit, Sinnhaftigkeit und Kontinuität in seinem Verhalten“ (Schüßler 2007, 183).
Der in Erfahrungen geronnene Alltagswissensbestand ist in Erkenntnissen, Einsichten und Einstellungen repräsentiert und kann als Produkt kultureller Prägung und individueller Verarbeitung der Umwelt verstanden werden. Im Zuge des Sozialisationsprozesses und der Auseinandersetzung mit einer bestimmten Umwelt sind in Deutungsmustern soziale Erfahrungen und Sinngehalte eingelagert. Das bedeutet, dass das Individuum Erfahrungen und Wissensbestände auch von anderen Menschen übernimmt. Dies spiegelt die kulturelle Prägung eines Menschen wider (vgl. Schüßler 2007, 184). Daneben sind Deutungsmuster Ausdruck einer individuellen Erfahrungsverarbeitung und einer subjektiven Definition von sozialen Situationen (vgl. ebd., 184). Dadurch, dass sowohl individuelle als auch kollektive Wissensbestände in Deutungsmustern eingelagert sind, wird ein kommunikativer Austausch mit anderen Menschen erst ermöglicht. Innerhalb dieses Rahmens findet ein Überprüfen eigener Deutungsmuster statt (vgl. ebd., 184). Unter Deutungslernen kann demnach eine „systematische, mehrfachreflexive und auf Selbsttätigkeit verwiesene Auseinandersetzung des Erwachsenen mit eigenen und fremden Deutungen“ (Arnold/ Siebert 2003, 5) verstanden werden. Die folgende Abbildung veranschaulicht den Prozess dieser Auseinandersetzung:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Erwachsenenlernen als Deutungsarbeit.
Quelle: Arnold/ Siebert 2003, 149 (mit eigenen Ergänzungen).
Wie ersichtlich wird, entscheidet die individuelle Wahrnehmung darüber, ob fremde Deutungen in Form von neuem Wissen aufgenommen werden und in bestehende Deutungsmuster integriert werden. Auch wenn bestehende Deutungsmuster dem Individuum Orientierung und Sicherheit im Handeln bieten, so kann genau diese Tatsache ihre Wahrnehmung einschränken und neues Wissen abwehren (vgl. Schüßler 2000, 100f.). Das Individuum zeigt durch diese Abwehrhaltung, dass es bestrebt ist an bestehenden Mustern festzuhalten, um Verunsicherungen gegenüber vertrauten Ansichten zu vermeiden. Besonders die Deutungsmuster, die früh im Lebenslauf erworben wurden, erweisen sich als resistent gegenüber Veränderungen (vgl. Schüßler 2007, 184). Fremde Deutungen, die vom Individuum wahrgenommen werden, weisen strukturelle Ähnlichkeiten mit bestehenden Deutungsmustern auf, d. h. sie sind anschlussfähig. Individuen ziehen jedoch vor allem auch in kritischen Situationen neue und relevante Wissensgehalte und Interpretationsschemata heran (vgl. ebd., 184; vgl. Arnold/ Siebert 2003, 113), wie bereits im Zusammenhang mit der Reflexion von Erfahrungen festgestellt wurde. Jede herbeigeführte Veränderung innerhalb der Erfahrungsaufschichtung und schließlich innerhalb eines Deutungsschemas kann als Lernprozess aufgefasst werden (vgl. Schell-Kiehl 2007, 87).
Das Lernen Erwachsener ist immer schon als Deutungslernen zu verstehen gewesen, weil Erwachsene Deutungsmuster konstruieren und ständig auf ihre Viabilität hin überprüfen (vgl. Arnold/ Siebert 2003, 4). Daher ist die didaktische Theorie folgerichtig als lebenswelt- und deutungsmusterbezogene Erwachsenenbildung anzulegen (vgl. ebd., 147; vgl. auch Schüßler 2007, 185). Bei dieser Didaktik geht es nicht um eine objektive Angemessenheit von Deutungsmustern, sondern vielmehr darum „Distanz- und Differenzerfahrungen zu initiieren und zu fördern“ (Arnold/ Siebert 2003, 147):
Vorhandene, biographisch überlieferte und bewährte Deutungen werden durch die Diskussion, den diskursiven Vergleich und die Verschränkung mit ‚neuen’ Deutungsperspektiven zu – wieder – viablen Deutungen entwickelt, ein ‚Perspektivenmanagement’, das hohe Anforderungen an die pädagogische Professionalität stellt (ebd., 148; Kursivstellung im Original).
Dieses explizite Deutungslernen ist u. a. in Mentoring-Prozessen angelegt, weil Einstellungen, Werte und schließlich Kompetenzen vermittelt bzw. verfestigt werden sollen. Dabei ist im Einzelfall zu prüfen, inwiefern eine Erfahrungsvermittlung auf Seiten des Lernenden (Mentees) durch den Lehrenden (Mentor) gelingt. Eine erfolgreiche Erfahrungsvermittlung kann gegebenenfalls dazu führen, dass „dysfunktionale Deutungsmuster“ (Schell-Kiehl 2007, 84), die den Mentee in seiner bisherigen Arbeit eingeschränkt haben, ausdifferenziert werden.
2.2.2.2 Selbstständiges Lernen als selbstgesteuertes Lernen
Die Selbstorganisation bildet zusammen mit dem Deutungsmusteransatz ein grundlegendes Konzept einer konstruktivistisch-orientierten Erwachsenenbildung (vgl. Arnold/ Siebert 2003, 7; vgl. auch Scheitler 2005, 203). Der Lehrende und die Lernenden sind „lebende Systeme“ (Arnold/ Siebert 2003, 7), die autopoietisch und selbstverantwortlich angelegt sind. Ein selbstständiges Lernen ist demnach als logische Konsequenz zu werten, die der Eigendynamik und dem Eigensinn des erwachsenen Lerners entspricht (vgl. ebd., 5; vgl. Punkt 2.2.2).
Die intensive Beschäftigung mit diesem Themenkomplex zeigt, dass zahlreiche Begriffe mit einem selbstständigen Lernen in Verbindung gebracht werden. So werden Begriffe, wie selbstgesteuertes, selbstreguliertes, selbstbestimmtes, selbstorganisiertes, autonomes oder autodidaktisches Lernen sowie Selbstlernen oder Selbststudium, von vielen Autoren synonym verwendet und unter dem Konzept des selbstgesteuerten Lernens gefasst (vgl. bspw. Reinmann/ Mandl 2006, 645; vgl. Sonntag/ Stegmaier 2007, 45). Dagegen nehmen andere Autoren ganz bewusst eine Unterscheidung vor, indem sie den Grad der Selbstständigkeit differenziert betrachten: Beim selbstorganisierten Lernen sieht sich der Lernende einer Vielzahl an nicht festgelegten und nicht einschätzbaren Handlungsmöglichkeiten gegenüber. „ Seine Zukunft ist offen“ (Erpenbeck/ Heyse 2007, 132; Kursivstellung im Original). Damit ist er in der Lage, sein Lernen selbstständig zu organisieren. Das selbstgesteuerte Lernen hingegen folgt einem übergeordneten Ziel, das zumindest in seinem Umriss festgelegt ist. Innerhalb dieser Vorgabe kann der Lernende seine Aktivitäten selbstständig steuern (vgl. ebd., 132). Das Lernen im Prozess der Arbeit ist daher überwiegend als selbstgesteuert zu bezeichnen, weil es durch organisatorische Rahmenbedingungen von außen festgelegt ist. Das vollkommen offene, selbstorganisierte Lernen ist davon abzugrenzen (vgl. Dehnbostel 2007, 27). Im Hinblick auf die betriebliche Ausrichtung folgt die vorliegende Arbeit tendenziell stärker dem Verständnis des selbstgesteuerten Lernens, wobei der organisatorische Rahmen eher als Chance für Lernanregungen und weniger als individuelle Einschränkung begriffen wird.
Die Definitionen zum selbstgesteuerten Lernen orientieren sich überwiegend an den vier Komponenten des gesteuerten Lernens nach Neber (1978):
(1) den Lernzielen,
(2) den Operationen und Strategien der Informationsverarbeitung,
(3) den zielorientierten Kontrollprozessen und
(4) dem Offenheitsgrad der Lernziele, der Operationen und der Kontrollprozesse (vgl. Neber 1978, 40). Beim selbstgesteuerten Lernen werden alle diese Komponenten – zumindest in größeren Teilen – von dem Lernenden selbst bestimmt. Im Gegensatz dazu gibt der Lehrer beim fremdgesteuerten Lernen diese Komponenten vor (vgl. Erpenbeck/ Heyse 2007, 132; Reinmann/ Mandl 2006, 645). Konkret lässt sich selbstgesteuertes Lernen als aktiver Aneigungsprozess bezeichnen, bei dem der Lernende seine eigenen Lernbedürfnisse und in einem bestimmten Rahmen seine eigenen Interessen und Vorstellungen in die Lernziele einbezieht und anstrebt (vgl. Dehnbostel 2007, 27). Eine solche inhaltliche Ausrichtung ermöglicht ein Anknüpfen an seine eigenen Erfahrungen (vgl. ebd., 28; vgl. Meueler 2006, 72). Der Lernende hat in Bezug auf die Operationen und Kontrollprozesse weiterhin die Möglichkeit
(…) die notwendigen menschlichen und materiellen Ressourcen (inklusiver professioneller Lernangebote oder Lernhilfen) hinzuziehen, (…) Lernwege, -tempo und –ort weitestgehend selbst festzulegen und zu organisieren sowie geeignete Methoden auszuwählen und einzusetzen und schließlich den Lernprozess auf seinen Erfolg sowie die Lernergebnisse auf ihren Transfergehalt hin zu bewerten (Arnold/ Gómez-Tutor/ Kammerer 2003 in Arnold/ Gómez-Tutor 2006, 54).
Die betriebliche Praxis zeigt, dass es wiederum unterschiedlich hohe Grade der Selbststeuerung gibt (vgl. Lehmann 2006, 18). Daher kann diese Definition nur eine theoretische Annäherung darstellen. Dennoch wird ersichtlich, dass das selbstgesteuerte Lernen als „hoch voraussetzungsreich“ (ebd., 18) eingestuft werden kann. Als Voraussetzungen des Lernenden gelten beispielsweise so genannte Selbstlernkompetenzen (vgl. Arnold/ Gómez-Tutor 2006, 57ff.). Darunter fallen neben der sozialen und kommunikativen Kompetenz vor allem die Bereiche der Fachkompetenz, Methodenkompetenz, personalen Kompetenz und emotionalen Kompetenz (vgl. zu den einzelnen Kompetenzbereichen Punkt 3.2.2.2). In einem weiteren Modell heben Friedrich und Mandl (1997) kognitive und motivationale Einflussgrößen hervor (vgl. Friedrich/ Mandl 1997, 237ff.; vgl. auch Reinmann/ Mandl 2006, 645f.). Die motivationalen Komponenten, wie zum Beispiel Bedürfnisse und volitionale Strategien, bestimmen die Aufgabenwahl, Anstrengung und Ausdauer des Lernenden. Die kognitiven Komponenten, wie zum Beispiel Inhaltswissen und Strategien der Informationsverarbeitung, sind entscheidend für die Fähigkeit zur mentalen Auseinandersetzung mit den Lerninhalten. Für betriebliche Anlässe ist wichtig, dass die Unternehmen Möglichkeiten und Instrumente bereitstellen, die den Lernenden dabei unterstützen, diese kognitiven und motivationalen Voraussetzungen zum selbstgesteuerten Lernen aufzubauen (vgl. Sonntag/ Stegmaier 2007, 47). Darüber kann auch sichergestellt werden, dass sich die Mitarbeiter mit Themen beschäftigen, die - neben ihrer subjektiven Zufriedenheit - in betrieblichen Zusammenhängen verwertet werden können.
2.2.2.3 Situiertes und informelles Lernen
Wie bereits im Zusammenhang mit den vorangegangenen Ausführungen deutlich wurde, ist jedes Lernen in einen bestimmten Kontext eingebettet. Dies betont auch Holzkamp (1993), indem er sagt, dass der Mensch ein sinnlich-körperhaftes Wesen ist, dessen Wahrnehmung, Interpretationen und Deutungen von seiner Lebenswelt, vorangegangenen Biographie und Leiblichkeit beeinflusst werden (vgl. Holzkamp 1993, 253ff.). Diese Erkenntnis trifft in besonderem Maße auf Erwachsene zu, weil sie zahlreiche Erfahrungen in ihrem Leben gesammelt haben. Die Erfahrungsaufschichtung findet vor allem in sozialen Kontexten statt, die für das situierte Lernen entscheidend sind: „Die Situation und der soziale Kontext prägen das situierte Lernen, womit zugleich gesagt ist, dass dieses Lernen nicht funktional reduziert, sondern eine Form der Enkulturation ist“ (Dehnbostel 2007, 25). Lave/ Wenger (1991) beschreiben dieses Hineinwachsen in eine bestimmte soziale Gruppe als „legitime periphere Partizipation“ (Lave/ Wenger 1991, 27). Indem der Lernende am produktiven Schaffen seiner Mitmenschen Teilhabe hat, wird er schrittweise in eine „community of practice“ (ebd., 94) eingeführt und integriert. Unter einer „community of practice“ verstehen die Autoren eine Gemeinschaft von handelnden Experten, die der Lernende gezielt für sich nutzt, um sich aufgabenbezogenes Fachwissen sowie die Einstellungen und Werthaltungen der sozialen Gruppe anzueignen (vgl. Dehnbostel 2007, 25f.). Die soziale Situation dient so zum einen als Medium und ermöglicht ein Lernen durch soziale Beziehungen. Zum anderen stellt sie den eigentlichen Lerninhalt dar, weil sozial geteilte Sachverhalte vermittelt werden (vgl. Sonntag/ Stegmaier 2007, 42). Das Konzept des situierten Lernens kann daher in einem weit gefassten Verständnis als soziales Lernen gedeutet werden (vgl. Dehnbostel 2007, 25; vgl. auch Punkt 2.1.2.2.1). Es ist von dem Modell „Learning by Doing“ zu unterscheiden, das die praktische Umsetzung des Gelernten fokussiert (vgl. Lave/ Wenger 1991, 31). Das situierte Lernen geht vielmehr darüber hinaus, weil es nicht nur funktionales Wissen bildet, sondern eine Form der Enkulturation ist.
In der betrieblichen Praxis existieren zahlreiche Ansätze zum situierten und problemorientierten Lernen, wobei das problemorientierte Lernen eine Form des situierten Lernens bildet (vgl. Sonntag/ Stegmaier 2007, 42) Ein Beispiel ist der „Cognitive-Apprenticeship-Ansatz“ nach Collins, Brown und Newmann aus dem Jahr 1989. Ein zentrales Element bildet der Austausch des Lernenden mit einem Experten, wodurch der Lernende schrittweise an komplexe Problemstellungen der Arbeitswelt herangeführt wird (vgl. Collins et al. 1989, 453ff.). Das Lernen wird dadurch unterstützt, dass sowohl der Experte als auch der Lernende seine praktischen Arbeitsschritte artikuliert und somit kognitive Vorgänge für den Partner sichtbar macht. Die Erprobung des „Cognitive-Apprenticeship-Ansatzes“ in der Arbeitswelt zeigt, dass Lernende stärker als in abstrakten, nicht situierten Kontexten in der Lage sind, Wissen zu internalisieren und auf vielfältige Kontexte zu
übertragen (vgl. Sonntag/ Stegmaier 2007, 82f.). Daraus lässt sich für lernförderliche Arbeitsumgebungen festhalten, dass authentische Lernarrangements, der soziale Austausch mit Kollegen und vielfältige Methoden den Lerntransfer erhöhen.
Der Ansatz des situierten Lernens nach Lave/ Wenger entspringt der „Situated-Cognition-Bewegung“, der weitere situiert-orientierte Modelle zugeordnet werden (vgl. Sonntag/ Stegmaier 2007, 41; vgl. Reinmann/ Mandl 2006, 626ff.). Grundlegend ist diesem übergeordneten Konzept, dass Lernen als Wechselwirkung zwischen Individuum und sozialer Situation begriffen wird, d. h. Wissen wird aktiv von dem Lernenden aus der Situation heraus konstruiert. Dieser Theorie stehen traditionelle Vermittlungsformen, wie die Instruktion durch den Lehrenden, gegenüber (vgl. Lave/ Wenger 1991, 47; vgl. Sonntag/ Stegmaier 2007, 41). Das informelle Lernen kann in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem situierten Lernen betrachtet werden, weil es ebenfalls losgelöst ist von einer gezielten und organisierten Vermittlung durch einen Lehrenden. Diese Grundannahme ist allen Ansätzen zum informellen Lernen gemeinsam, auch wenn es im internationalen Vergleich unterschiedliche Abstufungen gibt (vgl. Overwien 2004, 51ff.). Die Europäische Kommission (2001) definiert informelles Lernen beispielsweise folgendermaßen:
Lernen, das im Alltag, am Arbeitsplatz, im Familienkreis oder in der Freizeit stattfindet. Es ist (in Bezug auf die Lernziele, Lernzeit oder Lernförderung) nicht strukturiert und führt üblicherweise nicht zur Zertifizierung. Informelles Lernen kann zielgerichtet sein, ist jedoch in den meisten Fällen nichtintentional (oder „inzidentiell“/beiläufig) (Europäische Kommission 2001, 33).
Dies ist eine allgemein gehaltene Definition zum informellen Lernen, die hinsichtlich des Verständnisses zur Intentionalität nicht uneingeschränkt geteilt wird. Zwar unterscheidet Dehnbostel (2007) informelles Lernen am Arbeitsplatz ebenfalls in reflexives und implizites Lernen. Dabei versteht er unter reflexivem Lernen ein Lernen, das Erfahrungen und Reflexionen einbezieht und zur Erkenntnis führt (vgl. Dehnbostel 2007, 51). Das implizite Lernen ist dem Lernenden im Verlauf und Ergebnis nicht bewusst (vgl. ebd., 52). Dennoch betont er zuvor klar, dass es beim informellen Lernen nicht an Intentionalität fehlt. Vielmehr ist diese „auf andere Ziele und Zwecke und nicht auf Lernoptionen als solche gerichtet“ (ebd., 49). Darunter werden in der vorliegenden Arbeit höhere individuelle Ziele verstanden, die in der aktuellen (Lern-) Handlung nicht explizit formuliert sind, aber dennoch jedes Lernen beeinflussen, wie z. B. das eigene berufliche Vorankommen. So wählt jeder Lernende nach dem Ansatz des Deutungslernens viable und relevante Wissensbestände aus der vorgefundenen Umwelt aus und verfolgt damit seine persönliche Entwicklung.
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die Kultusministerkonferenz schließen das „zufällige oder beiläufige Lernen“ vom informellen Lernen konsequent aus (vgl. BMBF 2006, 187; vgl. KMK/ BMBF 2008, 146). Das Lernen Erwachsener innerhalb der beruflichen Weiterbildung ist demnach stets intentional angelegt, auch wenn es informell ausgerichtet ist (vgl. Punkt 3.1.2). Dafür spricht auch die Tatsache, dass ein leitender Angestellter bis zu 80 Prozent seines Handlungswissens über informelle Lernprozesse erlangt (vgl. BMBF 2006, 194). Dieser hohe Anteil am Wissensbestand kommt nicht ohne jede Absicht zustande und folgt daher in großen Teilen einem übergeordneten Ziel.
Unter dieser Prämisse wird informelles Lernen als Lernen betrachtet, dass sich aus Handlungs- und Arbeitserfordernissen ergibt und dabei ein bestimmtes oder aber ein übergeordnetes Ziel verfolgt. Entscheidend ist, dass es nicht institutionell organisiert und geplant wird, sondern vom Lernenden selbst wahrgenommen wird. Die Lernergebnisse spiegeln insofern eigenständige „Situationsbewältigungen und Problemlösungen“ (vgl. Dehnbostel 2007, 49) wider. Daher korrespondiert das informelle Lernen ebenfalls stark mit dem selbstgesteuerten Lernen.
2.2.3 Didaktische Implikationen
Der Begriff „Didaktik“ stammt aus dem Griechischen „didaskein“ und steht für „Lehre“. Das didaktische Handeln des Lehrenden stellt sich als „ symbolische, meist sprachliche Intervention “ (Siebert 2003, 1; Kursivstellung im Original) dar.
Auf diese Art und Weise findet eine „Vermittlung zwischen der Sachlogik des Inhalts und der Psychologik des/der Lernenden“ (ebd., 2; Kursivstellung im Original) statt. Dies bedeutet, dass die inhaltlichen Strukturen und Zusammenhänge der Lernthemen auf die Lern- und Motivationsstrukturen des Lernenden abgestimmt werden. Den Ausgangspunkt aller didaktischen Überlegungen bilden daher die Voraussetzungen und Bedürfnisse des Lernenden (vgl. Faulstich/ Zeuner 2006, 51). Je nachdem, welche Lernsituationen betrachtet werden, können unterschiedliche Ebenen didaktischen Handelns festgemacht werden (vgl. Siebert 2003, 7ff.). Für die vorliegende Arbeit sind vor allem die mikrodidaktische Situation zwischen Mentor und Mentee und die Programm- bzw. Veranstaltungsplanung innerhalb des Unternehmens relevant.
Aus den vorgestellten Lernformen lassen sich zusammenfassend Anforderungen an die didaktische Gestaltung von Lehr-Lernsituationen Erwachsener ableiten. Als Grundlage dient dabei die konstruktivistische Betrachtung von Lernprozessen. Im Rahmen der so genannten „Ermöglichungsdidaktik“ (Arnold 1993, 53) werden Lernformen, wie das selbstgesteuerte Lernen, das Deutungslernen und das situierte Lernen, aufgegriffen und vertiefend behandelt. Diese Einstellung gegenüber dem Lernen ist in modernen Arbeitsprozessen „möglich und notwendig“ (Dehnbostel 2007, 30). Wie der Begriff „Ermöglichungsdidaktik“ bereits beinhaltet, werden die Prozesse einer selbstständigen Wissenserschließung ermöglicht (vgl. Arnold 1993, 53). Diese „spezifische pädagogische Haltung“ (Schüßler 2007, 201) ist sich der begrenzten „Machbarkeit“ von Lernergebnissen bewusst, ohne dabei das Erreichen bestimmter Lernziele auszuschließen. Die traditionelle „Belehrungsdidaktik“ (Siebert 2003, 24) bzw. „Herstellungsdidaktik“ (Faulstich/ Zeuner 2006, 51), nach denen ein Lehrender Wissensgehalte aktiv vermittelt und die Lernenden diese Inhalte eher passiv aufnehmen, treten demgegenüber zurück.
Im Einzelnen richtet sich die Ermöglichungsdidaktik an verschiedenen Prinzipien aus, die in ihrer Gesamtheit ein nachhaltiges Lernen Erwachsener zulassen. Die folgende Beschreibung dieser Prinzipien berücksichtigt speziell die Anforderungen an den Lehrenden, der die Funktion eines Lernprozessbegleiters inne hat (vgl. im Folgenden Schüßler 2007, 329ff.): Der Lehrende orientiert sich an den Lernbedürfnissen und Erwartungen des Lernenden und beteiligt ihn an didaktischen Entscheidungen. Besonders der Lernende trägt ein hohes Maß an Eigenverantwortung, weil er den Lernprozess überwiegend selbst steuert. Aber auch der Lehrende ist eigenverantwortlich tätig, indem er seine Interventionen kritisch hinterfragt und verantwortet. Mithilfe empathischer Methoden, wie zum Beispiel der Metakommunikation, regt der Lehrende eine Rückkopplung beim Lernenden an. Innerhalb einer derart vertrauensvollen Atmosphäre ist der Lernende eher bereit seine bestehenden Deutungsmuster offen zu legen. Der Lehrende beleuchtet Sachverhalte und Probleme aus multiplen Perspektiven und zeigt damit alternative Denk- und Handlungsmuster auf. Ebenso betrachtet er den Lernenden aus verschiedenen Perspektiven und entwickelt ein Gespür für seine Lebenswelt. Gegebenfalls kann ein Co-Trainer oder Supervisor den Lehrenden in seiner Arbeit unterstützen. Die Öffnung des Lehr-Lernprozesses hinsichtlich neuer Methoden, Lernorte und Lernkooperationen verlangt von dem Lehrenden eine umfassende Methodenkompetenz. Darüber hinaus wird von ihm eine hohe Unsicherheitstoleranz und Offenheit gefordert, weil er die eigenwilligen Lernwege des Lernenden akzeptiert und unterstützt. Daher ist es für den Lehrenden ebenfalls wichtig eine pädagogische Gelassenheit in den Lernprozess einzubringen. Er nimmt sich in seiner Rolle zurück und zeigt über sensible Maßnahmen einen andragogischen Takt, d. h. er tritt als Begleiter (Coach) und nicht als (Um-) Erzieher in Lernprozessen auf. Dieses Prinzip geht mit dem Coaching einher, bei dem der Lehrende eine „Hilfe zur Selbsthilfe“ anbietet. Er beobachtet den Lernenden intensiv und versucht so über den gesagten Inhalt hinaus subjektive Muster des Lernenden herauszufiltern. Die Lebenswelt des Lernenden steht daher stets im Vordergrund des Lernprozesses. Indem der Lehrende reale Lernsituationen schafft, die einen Bezug zur Lebenswelt des Lernenden aufweisen und prozessorientiert sind, werden die Authentizität der Umgebung, die Lernmotivation und der Lerntransfer insgesamt gesteigert. Da Lernen vor allem auch in kritischen Lebenssituationen stattfindet, bietet der Lehrende behutsam Differenzerfahrungen an. Dabei ist abzuwägen, wann und auf welche Art und Weise er Irritationen und provozierende Sichtweisen in den Lernprozess einfließen lässt (vgl. auch Siebert 2003, 241ff.). Außerdem plant der Lehrende ausreichend Raum für praktisches Handeln und Erleben des Lernenden ein. Diese Handlungsorientierung stellt eine direkte Bedeutung des Lerninhaltes zum „Relevanzsystem“ des Lernenden her und ermöglicht neue Erfahrungswerte. Eine anschließende Reflexion des Erlebten hilft bei der Verarbeitung. Der Lehrende schafft insgesamt einen Raum für ein positives emotionales Erleben des Lernenden. Dies kann durch die eigene Emotionalität gefördert werden, d. h. der Lehrende verleiht seinen Gefühlen in einem bestimmten Rahmen Ausdruck und dient somit als motivierendes Vorbild. Ein nachhaltiges Lernen in der Weiterbildung bezieht alle genannten Prinzipien mit ein und berücksichtigt darüber hinaus die Sicherung von Ressourcen. Dies bedeutet, dass sich der Lehrende hinsichtlich seiner pädagogischen Ausrichtung und Tätigkeit immer wieder kritisch reflektiert. In einem erweiterten Sinn wird unter der Ressourcensicherung die umfassende Verantwortung der Unternehmen verstanden, Lernmöglichkeiten zu sichern.
[...]
[1] Es wird darauf hingewiesen, dass Mentoring in zahlreichen weiteren Förderbeziehungen im Prozess der Arbeit und darüber hinaus zum Einsatz kommt.
[2] Für weiterführende Informationen zur historischen Begründung und pädagogischen Tradition des Lernbegriffs vgl. beispielsweise Göhlich et al. 2007, 13ff.
[3] In der Regel werden menschliche Individuen mit Lernprozessen in Verbindung gebracht, so wie es die vorliegende Arbeit ebenfalls vorsieht. Dennoch sollte die Tatsache nicht vernachlässigt werden, dass auch Organisationen und die darin bestehenden Gruppen lernfähig sind und Gegen-stand von Lernprozessen sein können (vgl. dazu ausführlicher Argyris/ Schön 2006).
[4] Der Entwicklungspsychologe Jean Piaget prägte im Zusammenhang mit der Informationsverarbeitung die Begriffe der Assimilation und der Akkommodation. Die Assimilation beschreibt die Integration von Umwelterfahrungen in bestehende kognitive Strukturen des Individuums. Im Gegensatz dazu werden bei der Akkomodation die eigenen kognitiven Strukturen an signifikante Umwelterfahrungen angepasst, weil die bisherigen Denk- bzw. Handlungsschemata die Vorgänge nicht hinreichend erfasst haben (vgl. Piaget 1985, 32ff.).
[5] Den Begriff „Autopoiesis“ hat Niklas Luhmann in seiner Systemtheorie soziologisch erschlossen. Seine Grundannahme lautet, dass soziale Systeme ausschließlich aus Kommunikation bestehen und sich in einem ständigen, selbstbeschleunigenden Prozess 1selbst erschaffen (vgl. Luhmann 1991).
[6] Eine detaillierte Betrachtung von individuellen Lernstilen findet an dieser Stelle nicht statt. Das Lernen Erwachsener sollte jedoch stets neben den allgemeinen Besonderheiten des Erwachsenen auch kognitive, motivationale, charakterliche und sozial-kommunikative Unterschiede unter Erwachsenen berücksichtigen (vgl. für nähere Informationen zu Lernstilen Erpenbeck/ Heyse 2007, 101ff.).
[7] Die „Adoleszenz-Maximum-Hypothese“ aus dem Jahr 1972 geht auf den deutschen Sprachwissenschaftler und Neurologen Eric Lenneberg zurück und besagt, dass die sprachliche Lernfähigkeit des menschlichen Gehirns auf die Zeit seiner Pubertät und davor begrenzt ist (vgl. Lenneberg 1972).
[8] Forschungsarbeiten stützen sich in diesem Zusammenhang meist auf die Biographie eines Menschen. Die Biographie entspricht allerdings nicht dem eigentlichen Lebenslauf, sondern ist als subjektiv gedeuteter und wiedergegebener Lebenslauf zu verstehen (vgl. Arnold/ Siebert 2003, 75).
[9] Das „Erfahrungslernen“ oder „biographische Lernen“ wird zum Teil synonym für diese Art des Lernens verwand (vgl. bspw. Schell-Kiehl 2007, 94). Die vorliegende Arbeit bevorzugt den Be-griff des Deutungslernens.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2008
- ISBN (eBook)
- 9783836626569
- DOI
- 10.3239/9783836626569
- Dateigröße
- 1001 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Carl von Ossietzky Universität Oldenburg – Erziehungs- und Bildungswissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2009 (Februar)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- mentoring personalentwicklung erwachsenenpädagogik handlungskompetenz ermöglichungsdidaktik
- Produktsicherheit
- Diplom.de