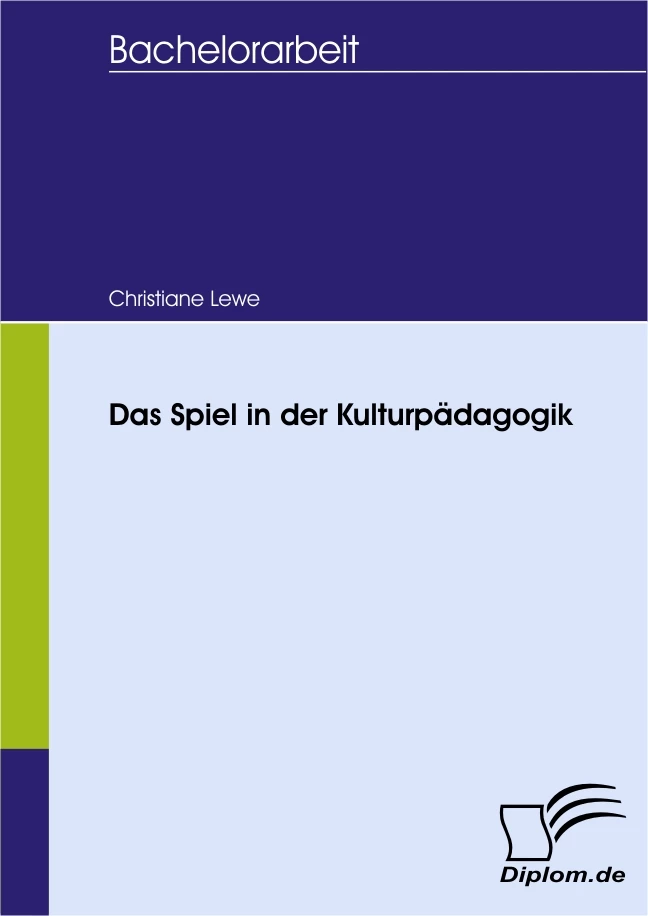Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema Das Spiel in der Kulturpädagogik. Die Frage, die mich zur Bearbeitung dieses Themas verleitet hat, lautet: Welche Rolle spielt das Spiel im menschlichen Leben bzw. welchen Stellenwert verdient es? Und daraus folgt: Welchen Stellenwert verdient das Spiel in der Kulturpädagogik als pädagogische Disziplin, die sich den Menschen zum Mittelpunkt ihrer Bemühungen macht. Das Spiel ist der Dreh- und Angelpunkt dieser Arbeit - nicht als Randphänomen der Kindheit und Freizeit, nicht als Lehr-Methode, nicht als Instrument für kulturpädagogische Zwecke, sondern als Phänomen mit eigenem Wert, dem sich die Kulturpädagogik anerkennend zuwenden muss. Diese Arbeit ist als Plädoyer für die kulturpädagogische Spielförderung zu verstehen.
Ich beginne mit der Klärung, was sich hinter Kulturpädagogik verbirgt, vor welchem Hintergrund sie agiert, welche Ziele sie verfolgt. Es wird sich zeigen, dass dies die theoretische und praktische Disziplin ist, die im Sinne humanistischer Werte die Entfaltung des Menschen und seiner Kultur verfolgt mit dem Ziel einer gelingenden Lebensführung. Als solche ist sie auch die Instanz der Spielförderung.
Der große Mittelteil der Arbeit beschäftigt sich eingehend mit dem Spiel aus unterschiedlichen Perspektiven. Stets war das Spiel von Interesse für die unterschiedlichsten Fachrichtungen. Schon vor etwa 200 Jahren maß Friedrich Schiller in seinen philosophischen Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen dem Spiel eine besondere Bedeutung als Mittel der Befreiung bei. Daraus stammt der vielzitierten Satz: Der Mensch ( ) ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. (Schiller, 15. Brief). Die Untersuchung von Schillers Sichtweise darf daher in dieser Arbeit nicht fehlen.
Darauf folgt ein Kapitel, das ich dem feinen Unterschied zwischen Mensch und Tier widme: dem Symbol. Es soll ein Verständnis von der Eigentümlichkeit des Menschen vermitteln, die letztlich auch die Voraussetzung für die besondere Qualität des menschlichen Spiels ist.
Die Frage nach dem Wesen des Spiels beantwortet eingehend das Kapitel über Hans Scheuerls Phänomenologie des Spiels.
Daran schließt die kulturanthropologische Spieltheorie von Johan Huizinga an, die das Spiel mit der Kultur in Verbindung bringt und den wahren Stellenwert des menschlichen Spiels weiter erhellt.
Um die konkrete Funktion des Spiels in der menschlichen Entwicklung dreht sich ein weiteres Kapitel über die […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Was ist Kulturpädagogik?
3. Das Spiel
3.1 Friedrich Schillers ästhetische Erziehung im Spiel
3.2 Die Besonderheit des Menschen und die Voraussetzung für sein Spiel: Das Symbol
3.3 Phänomenologische Antwortversuche auf die Frage „Was ist Spiel?“
3.3.1 Das Moment der Freiheit
3.3.2 Das Moment der „inneren Unendlichkeit“
3.3.3 Das Moment der Scheinhaftigkeit
3.3.4 Das Moment der Ambivalenz
3.3.5 Das Moment der Geschlossenheit
3.3.6 Das Moment der Gegenwärtigkeit
3.3.7 Spieltätigkeit und Spielgeschehen
3.4 Johan Huizingas kulturanthropologische Spieltheorie
3.5 Zwei entwicklungspsychologische Theorien zum Thema Spiel
3.5.1 Spiel als Spannungsbereich zwischen Subjekt und Welt
(Donald W. Winnicott)
3.5.2 Die Entstehung und Entwicklung des Spiels im Kindesalter
(Jean Piaget)
3.6 Versuch einer Gliederung vielfältiger Spielphänomene
3.6.1 Grundlagen der Gliederung
3.6.2 Bewegungsspiele
3.6.3 Darstellende Spiele
3.6.4 Schöpferische Spiele
3.6.5 Kommunikationsspiele
3.6.6 Zufallsspiele
3.6.7 Geistige Spiele
3.7 Nicht-Spiel
4. Das Spiel in der Kulturpädagogik
4.1 Die besonderen Qualitäten und Möglichkeiten des Spiels
4.1.1 Spiel fördert, fordert und bildet (?)
4.1.2 Spiel ermöglicht unangepasste Kreativität und autonome
Handlungsfähigkeit in der Auseinandersetzung mit der Welt
4.1.3 Soziales Spiel bildet Spielgemeinschaften
4.1.4 Spiel bereichert das Leben
4.1.5 Lernziel Spielfähigkeit oder die idealtypische Utopie vom
Homo Ludens
4.2 (Kulturpädagogische) Konsequenzen und Forderungen
4.3 Kulturpädagogische Spielpraxis: AKKI e.V. Düsseldorf
5. Abschließende Zusammenfassung: Das Spiel ist ein konstitutives Prinzip des menschlichen Lebens
Anhang
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema „Das Spiel in der Kulturpädagogik“. Die Frage, die mich zur Bearbeitung dieses Themas verleitet hat, lautet: Welche Rolle spielt das Spiel im menschlichen Leben bzw. welchen Stellenwert verdient es? Und daraus folgt: Welchen Stellenwert verdient das Spiel in der Kulturpädagogik als pädagogische Disziplin, die sich den Menschen[1] zum Mittelpunkt ihrer Bemühungen macht. Das Spiel ist der Dreh- und Angelpunkt dieser Arbeit - nicht als Randphänomen der Kindheit und Freizeit, nicht als Lehr-Methode, nicht als Instrument für kulturpädagogische Zwecke, sondern als Phänomen mit eigenem Wert, dem sich die Kulturpädagogik anerkennend zuwenden muss. Diese Arbeit ist als Plädoyer für die kulturpädagogische Spielförderung zu verstehen.
Ich beginne mit der Klärung, was sich hinter „Kulturpädagogik“ verbirgt, vor welchem Hintergrund sie agiert, welche Ziele sie verfolgt. Es wird sich zeigen, dass dies die theoretische und praktische Disziplin ist, die im Sinne humanistischer Werte die Entfaltung des Menschen und seiner Kultur verfolgt mit dem Ziel einer gelingenden Lebensführung. Als solche ist sie auch die Instanz der Spielförderung.
Der große Mittelteil der Arbeit beschäftigt sich eingehend mit dem Spiel aus unterschiedlichen Perspektiven. Stets war das Spiel von Interesse für die unterschiedlichsten Fachrichtungen. Schon vor etwa 200 Jahren maß Friedrich Schiller in seinen philosophischen Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen dem Spiel eine besondere Bedeutung als Mittel der Befreiung bei. Daraus stammt der vielzitierten Satz: Der Mensch „[…] ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.“ (Schiller, 15. Brief)[2]. Die Untersuchung von Schillers Sichtweise darf daher in dieser Arbeit nicht fehlen.
Darauf folgt ein Kapitel, das ich dem „feinen Unterschied“ zwischen Mensch und Tier widme: dem Symbol. Es soll ein Verständnis von der Eigentümlichkeit des Menschen vermitteln, die letztlich auch die Voraussetzung für die besondere Qualität des menschlichen Spiels ist.
Die Frage nach dem Wesen des Spiels beantwortet eingehend das Kapitel über Hans Scheuerls Phänomenologie des Spiels.
Daran schließt die kulturanthropologische Spieltheorie von Johan Huizinga an, die das Spiel mit der Kultur in Verbindung bringt und den wahren Stellenwert des menschlichen Spiels weiter erhellt.
Um die konkrete Funktion des Spiels in der menschlichen Entwicklung dreht sich ein weiteres Kapitel über die entwicklungspsychologische Spieltheorie, vertreten durch Donald. W. Winnicott und Jean Piaget.
Um das Spielverständnis abzurunden, folgt ein Versuch die vielfältigen Spielphänomene zu gliedern und in einem Raster zu ordnen. Damit erhoffe ich mir, den „Spielhorizont“ des Lesers deutlich zu weiten, um auf die Spielphänomene aufmerksam zu machen, die uns unentwegt begegnen.
Der Hauptteil über das Spiel schließt mit einer kurzen Schlussfolgerung, was letztlich noch als „Nicht-Spiel“ bezeichnet werden kann.
Im letzten Teil werde ich die besonderen Qualitäten des Spiels für den Menschen, seine Lebensführung und die Kultur sammeln, um eine (kulturpädagogische) Förderung zu legitimieren. Daraus folgen kurz formulierte Forderungen bezüglich der wesentlichen, förderbedürftigen Aspekte der Spielpraxis. Auf das „Dass“ folgt das „Wie“ in einer kurzen Vorstellung der kulturpädagogischen Initiative „AKKI e.V.“, die sich der Förderung der Spielkultur der Kinder verschreibt. Sie veranschaulicht, wie gelingende Spielpraxis aussehen kann.
Möge diese Arbeit den Blick schärfen für die Relevanz des Spiels, das mehr ist als Freizeitvergnügen für Kinder und Kindgebliebene.
2. Was ist Kulturpädagogik?
Noch immer ist kulturelle Bildungsarbeit unter dem Begriff „Kulturpädagogik“ in der breiten Öffentlichkeit weitgehend unbekannt. Man vermutet dahinter eine Art „Sahnehäubchen-Pädagogik“, einen Bonus im Freizeitprogramm für Kinder und Jugendliche, auf den man im Falle leerer Kassen getrost verzichten kann. Das Dilemma liegt in der Bezeichnung: „Kulturpädagogik“ und ihr Gegenstand „kulturelle Bildung“ sind als Begriffe für alles offen und kommen vagen Vorstellungen entgegen. „Kultur“ ruft meist Assoziationen wie Kunst, Museum, Theater, Film, Musik hervor - das klassische „kulturelle“ Repertoire im Veranstaltungskalender einer Stadt. In Verbindung mit den Worten „Pädagogik“ oder „Bildung“ liegt die Vorstellung einer Lehrtätigkeit in einem Museum oder Theater nahe. „Er ist Kulturpädagoge, er unterrichtet Kultur, sein Arbeitsplatz ist eine private oder öffentliche Einrichtung mit einer kleinen oder großen Kulturabteilung.“ (Mies, 2005, S.251f)[3] So hat es Georg-Achim Mies überspitzt formuliert.
Bei aller Offenheit des Begriffs haben viele Menschen doch ein sehr enges Verständnis von diesem riesigen Feld kultureller Bildung. Sowohl ihr Kultur- als auch ihr Bildungsbegriff sind sehr eingeschränkt. Eine enge Definition kann dieser Disziplin nicht gerecht werden. Das zuvor erwähnte „Dilemma“ der unklaren Bezeichnung ist zugleich eine Chance. Wie sonst sollte ein so umfassendes Theorie- und Praxisfeld mit so vielgestaltigen Inhalten betitelt werden? Jede Einschränkung durch eine zu enge Definition wäre unpassend.
Auf den folgenden Seiten möchte ich beleuchten, was hinter dieser diffusen Bezeichnung stecken kann. Damit wird hoffentlich jedem Leser klar, dass Kulturpädagogik zu den grundlegenden pädagogischen Disziplinen gehört bzw. gehören sollte.
Was ist gemeint, wenn hier von „Kultur“ und „kulturell“ die Rede ist? Welcher Kulturbegriff liegt der kulturellen Bildung zugrunde? Justin Stagl hat es folgendermaßen zusammengefasst: „Kultur ist das Insgesamt der in Auseinandersetzung mit der Welt erbrachten menschlichen Leistungen.“ (Stagl, 1993, S.12)[4] Der Mensch nimmt in der Welt eine Sonderrolle ein, die ihn zwingt, „Strategien zur Daseinsbewältigung“ (Käser, 1997, S.37)[5] zu entwickeln bzw. zu erlernen. Im Gegensatz zum Tier fehlen ihm Instinkte, die das Verhalten zur unmittelbaren Lebensbewältigung mit einfachen Reiz-Reaktions-Schemata lenken und das Individuum zu einem perfekt in seine Umwelt eingepassten Organismus machen. Jeder Mensch ist aufgrund seines offenen, unbestimmten Daseins auf ein Leben in Gemeinschaft und auf ihre im Kollektiv entwickelten und tradierten Bewältigungsstrategien angewiesen, die erlernt und verinnerlicht werden müssen. Dazu gehören sowohl Verhaltensstrategien als auch Kommunikationsmittel, Weltdeutungsmuster und Werte. Die menschliche Fähigkeit zum symbolischen Denken und zum symbolischen Ausdruck beispielsweise in Schrift, Sprache oder Bild machen es erst möglich, die entwickelten oder modifizierten Strategien zum Ausdruck zu bringen und im kollektiven wie im individuellen Gedächtnis als „Kulturgut“ zu verankern, zu verarbeiten, zu modifizieren und weiterzugeben.[6] Dieses „Insgesamt“ (Stagl, 1993, S.12) sozialisierter Verhaltensregeln und Bewältigungsleistungen ist überlebensnotwendig und unentbehrlich für eine soziale Ordnung.
Was mit der Bearbeitung, symbolischen Ordnung, Gestaltung und Pflege der eigenen Natur und der natürlichen Umgebung zur effektiveren Existenzsicherung im arbeitsteiligen Kollektiv beginnt, führt unter gleichem Namen („Kultur“) zu Verhaltensregeln wie der Straßenverkehrsordnung oder der katholischen Liturgie, zu Regeln der Kommunikation, zu Konventionen des alltäglichen Miteinanders, zu Moral, Gesetz, Religion, Wirtschaft, Wissenschaft, Architektur, Kunst[7] und schließlich zur Verabsolutierung dieser arbeitsteiligen Bereiche hochentwickelter Gesellschaften mit ihren je eigenen Codes, Symbolsystemen und Deutungsmustern. Vom anthropologischen, weiten Verständnis bis hin zum engen Begriff von Kultur als geistiger (Re-)Produktion, der dem landläufigen Kulturverständnis am nächsten kommt, umspannt der Begriff „Kultur“ alle Facetten menschlichen, bewussten und unbewussten Denkens, Handelns und Kommunizierens als stets dynamischen sozialen Prozess. „Wir könnten von einer Spannung zwischen Verfestigung und Evolution sprechen, zwischen einer Tendenz, die zu festen, stabilen Formen führt, und einer anderen Tendenz, die dieses strenge Schema aufbricht. […] Es herrscht ein unablässiger Kampf zwischen Tradition und Innovation, zwischen reproduzierenden und kreativen Kräften.” (Cassirer, 1996, S.339)[8] Der Mensch ist angewiesen auf die verlässlichen Standards und Strategien, die sein Leben in Gemeinschaft ordnen, Sinn, Orientierung und Identität geben und ihn überhaupt erst handlungsfähig machen. Wer als Teil einer Kulturgemeinschaft oder innerhalb eines Kulturbereichs (z.B. Kunst, Religion, Wissenschaft) kompetent agieren will, muss die Spielregeln beherrschen und befolgen.[9] Die ertappten Falschspieler und Spielverderber werden ausgeschlossen. Stets kommt es zu Spannungen, wenn die tradierten Ordnungen und Standards hinterfragt werden. Sei es durch Interaktion zwischen verschiedenen Kulturen, Generationen, Szenen, anderen Vergemeinschaftungen[10] mit ihren je eigenen Inventaren, durch veränderte Umweltbedingungen oder durch kreative Einzelne, die mit dem Etablierten brechen. In diesem Kampf um Bedeutung, Normen und Verhaltensmuster besteht die Veränderung, Erweiterung und der Fortschritt der Kultur.
Spätestens seit der Aufklärung wissen wir: Der Mensch soll nicht einfach Zahnrad in einer Maschine, sondern Mitspieler sein - mündiges Mitglied der Gemeinschaft, das fähig ist, die Balance zwischen notwendiger Anpassung und individueller Freiheit zu halten und Mitgestalter seiner eigenen wandelbaren Kultur ist. Dazu bedarf es kultureller Bildung, die ihn zum kompetenten, verantwortungsbewussten, partizipierenden, gestaltenden, freien Mitglied seiner Gemeinschaft (besser: Gemeinschaften) macht. Der Kulturpädagogik liegt in dieser Hinsicht ein erweiterter Kulturbegriff zugrunde, der sich nicht in dem gesellschaftlichen Teilbereich der geistigen (Re-)Produktion in Kunst, Literatur, Musik, Theater etc. erschöpft, sondern die gesamte Sachkultur, Symbolkultur und die soziale Kultur umfasst. (Vgl. Stagl, 1993, S.13) Thema der kulturellen Bildung unter dem Schlagwort „Kultur“ sind eigene und fremde gesellschaftliche Konventionen, Weltbilder, Orientierungsmuster, Symbolsysteme, Wert- und Moralvorstellungen - eben Hervorbringungen der Kultur in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, mit denen der Mensch im alltäglichen Leben immer wieder konfrontiert wird.
Heute sind weite Teile der Menschheit geprägt durch sogenannte Individualisierungsprozesse.[11] Darunter versteht man Entwicklungen der (westlichen) Gesellschaft, die den Einzelnen aus vorgegebenen Lebensmustern befreien. Das heißt verbindliche Sozialstrukturen wie Familie, Nachbarschaft, Gemeinde lösen sich auf und mit ihnen ihre tradierten, strukturierenden Orientierungsrahmen und Vorgaben. Mit der Geburt in eine bestimmte Schicht, Region oder Familie war vormals die Biographie schon vorgezeichnet, die Art der Lebensgestaltung stand nicht zur Wahl, sondern war qua Geburt festgelegt. Mit der Auflösung aller Vorgaben wird die Gestaltung der eigenen Biographie wählbar. Durch Prozesse der letzten Jahrzehnte verfügen die Menschen heute über mehr Einkommen, mehr Bildung, mehr Freizeit. Damit eröffnet sich eine Fülle von neuen Entscheidungsmöglichkeiten zur Lebensgestaltung. „Die Normalbiographie wird [..] zur Wahlbiographie […]“ (Beck, Beck-Gernsheim, 1994, S.13) und damit zur „Risikobiographie“ (ebd.), denn der Einzelne ist nun alleinverantwortlich für seine Lebensentscheidungen - ohne Netz und doppelten Boden. Mit der Normalbiographie schwinden die Vorhersehbarkeiten des Lebenslaufs und die „gesellschaftlich garantierten Verlässlichkeiten“ (Hitzler, 2005, S.14)[12]. Zugleich wachsen die gesellschaftlichen und institutionellen Anforderungen an das Individuum. Die Berufswahl steht jedem frei, aber der Arbeitsmarkt straft jede „Fehlentscheidung“ gnadenlos und fordert darüber hinaus ein Höchstmaß an Kompetenz, Flexibilität, Mobilität, Eigeninitiative. Wahlfreiheit ist eine Illusion, es handelt sich um einen Wahlzwang, und zwar den Zwang die richtige Entscheidung zu treffen, um die eigene Biographie gelingen zu lassen und den Anforderungen zu genügen. (Vgl. Schmid, 1998, S.188ff)[13] Die komplexen, unüberschaubaren, gesellschaftlichen Zusammenhänge erschweren eine sachlich fundierte Entscheidung.
Der Prozess der Individualisierung evoziert demnach zugleich mannigfaltige Chancen und unberechenbare Risiken. „Individualisierung führt - vereinfacht gesprochen - einerseits zu einer Vermehrung von Handlungsressourcen und Handlungsalternativen für jene Akteure, die die Kompetenzen haben, die zunehmende Komplexität des (globalen) sozialen Lebens für sich zu nutzen. Andererseits befördert sie aber auch die Erfahrung vermehrter und einengenderer Restriktionen bei solchen Akteuren, die diese Kompetenzen (warum auch immer) eben nicht besitzen.“ (Hitzler, 2005, S.14)
Kulturpädagogik heißt daher vor allem, Kompetenz zu vermitteln für den freien, autonomen, bewussten, reflexiven Umgang mit diesem Wahl-Modus mit keinem geringeren Ziel als das (subjektiv) „gelingende Leben“ (Zacharias, Opladen, 2001, S.23)[14]. Der Mensch steht im Mittelpunkt der kulturpädagogischen Arbeit. (Vgl. ebd.) Was ist nötig für die Gestaltung eines gelingenden Lebens innerhalb eines sozialen Gefüges? Kulturelle Bildung heißt nicht, eine entsprechende Gebrauchsanleitung zu lehren. Kulturpädagogen sind keine Lebensberater. Die Adressaten kultureller Bildung sollen selbst autonome Gestalter ihres Lebens sein. Kulturelle Bildung ist Selbstbildung mit dem „Lernziel Lebenskunst“ (Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung, 2001)[15].
Mit dieser Subjektorientierung ist die Autonomie des Subjekts durch Bildung eng verknüpft. Kulturpädagogik als emanzipatorische Bildungsarbeit kann das Individuum aus der Anpassung befreien. In der individualisierten Gesellschaft hieße Anpassung, nicht die Potenziale der Entscheidungsfreiheit für sich nutzen zu können, sondern sich den gesellschaftlichen Anforderungen (z.B. des Arbeitsmarktes) aus einem Mangel an Handlungs- und Reflexionsfähigkeit blind unterzuordnen: passive Einfügung statt aktiver Lebensführung. Erst Bildung befähigt, trotz sich ständig verändernder Bedingungen, ein Gefühl der Handlungsfähigkeit und Selbstsicherheit zu entwickeln. Die Bildungspolitik zielt leider gerade heute auf eine instrumentalisierte Bildung der Anpassung an ökonomische Zwänge. Das degeneriert Bildung zu „Qualifikation“ und befähigt nicht mehr zu Mündigkeit und aktiver Partizipation, was in letzter Konsequenz die Voraussetzung für Demokratie gefährdet. Eine demokratische Ordnung braucht mündige, selbstbestimmte Teilnehmer, dies setzt allerdings die Chance zur Bildung mit Selbstzweck für alle voraus.[16] Die Autonomie des Subjekts kann erreicht werden durch eine allgemeine Bildung, die Zusammenhänge und Strukturen der Lebenswelt offenlegt und Horizonte erweitert, die kompetent macht im Umgang mit den umgebenden Symbolsystemen (z.B. Massenmedien) und auch praktische Fertigkeiten vermittelt in der konkreten, kreativ-ästhetischen Selbsttätigkeit.[17] Denn für eine den Alltag bereichernde Lebensgestaltung setzt Kulturpädagogik besonders auf die Fähigkeit zur „Ästhetisierung des Alltags“. Kulturpädagogische Praxis in Form von meist außerschulischen Projekten, Workshops, Veranstaltungen ist deshalb häufig im Umfeld von Kunst, Musik, Theater, Film usw. anzutreffen, weil sie die Ziele kultureller Bildung durch „Ästhetische Bildung zwischen Sinn und Sinnlichkeit“ (Zacharias, Bonn, 2001, S.85)[18] realisiert, das heißt den Akt der Selbstbildung ermöglicht durch sinnliche Erfahrungen mit Erkenntnisgehalt in der selbsttätigen wie rezeptiven Auseinandersetzung mit den Hervorbringungen der Kultur.[19] Schon Schiller verdeutlichte vor gut 200 Jahren die Relevanz von sinnlich-vernünftiger Erfahrung im Spiel mit der Schönheit.[20] Seine Überlegungen werde ich im nachfolgenden Kapitel näher beleuchten. Damit sei ein erster Schritt getan zu zeigen, dass sich kulturelle Bildung als ästhetische Bildung im Spiel vollziehen kann.
3. Das Spiel
3.1 Friedrich Schillers ästhetische Erziehung im Spiel
Friedrich Schiller hat einen Spielbegriff erarbeitet, der Kernstück seiner Theorie zur ästhetischen Erziehung des Menschen ist. Er prägte darin den Satz: Der Mensch „[…] ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.“ (Schiller, 15. Brief)
Schillers Abhandlung darf in meiner Arbeit nicht fehlen, da er - ganz im Sinne kulturpädagogischer Ziele - dem ästhetischen Spiel die grundlegende Bedeutung einer Möglichkeit des „guten Lebens“ beimisst und die kompetenten Spieler zu autonomen, moralischen Lebenskünstlern erhebt, auf dass die so befreiten, ästhetisch gebildeten Bürger idealiter einen human-gesellschaftlichen Staat bilden. Er unterstützt damit meine Intention, in dieser Arbeit die fundamentale Bedeutung des Spiels im menschlichen Leben herauszustellen.
Schiller unterscheidet zwei Grundtendenzen im Menschen: (sinnlicher) „Stofftrieb“ und (rationaler) „Formtrieb“ (Vgl. ebd., 12. Brief )[21], die sich wechselseitig bedingen. Der dialektische Charakter des Menschen lässt sich in vielen weiteren Begriffspaaren gegenüberstellen, die so oder ähnlich auch Schiller kontrastiert: das Natürliche und das Göttliche; wechselnder Zustand und konstante Person; Realität und Idee; Sinnlichkeit und Vernunft; Begierde und Sittlichkeit; Leben und Gestalt; Materie und Form; Gefühl und Intellekt; Schicksal und Selbstbestimmung. Gemeint ist doch stets der natürliche Ursprung des Menschen als endliches Naturwesen verhaftet in der physischen Welt der Sinne auf der einen Seite und dem gegenüber seine Anlage zu „mehr“, die ihn von dem bloß natürlichen Dasein abhebt. Dieser Formtrieb befreit ihn aus dem blinden Naturzustand im ständigen Strom der Veränderung, macht ihn zur bleibenden Person mit dem Bewusstsein eines konstanten Ichs, sichert seine Autonomie gegenüber der Natur, strukturiert das Chaos und stachelt ihn zur denkenden Gestaltung von sich und seiner Umwelt. Sein Kennzeichen ist die Vernunft. (Vgl. ebd.)
“Wo also der Formtrieb die Herrschaft führt und das reine Objekt in uns handelt, da ist die höchste Erweiterung des Seins, da verschwinden alle Schranken, da hat sich der Mensch aus einer Größen-Einheit, auf welche der dürftige Sinn ihn beschränkte, zu einer Ideen-Einheit erhoben, die das ganze Reich der Erscheinungen unter sich fasst.” (ebd.)
Und doch hält der Stofftrieb den Menschen mit beiden Beinen auf dem Boden der Tatsachen. „Mit unzerreißbaren Banden fesselt er den höher strebenden Geist an die Sinnenwelt und von ihrer freiesten Wanderung ins Unendliche ruft er die Abstraktion in die Grenzen der Gegenwart zurück.“ (ebd.) Der Stofftrieb macht den Menschen zur bloßen veränderlichen Materie, zu einer schlichten Größen-Einheit in der Welt, der das Leben „erleidet“. Er setzt seinem Streben nach „mehr“ natürliche Schranken, äußert sich in Bedürfnissen und drängt auf Befriedigung. Sein Kennzeichen ist die Sinnlichkeit.
Zugleich bedingen sich beide Triebe wechselseitig. „Mit einem Wort, nur, insofern er [der Mensch, C.L.] selbständig ist, ist Realität außer ihm, ist er empfänglich; nur, insofern er empfänglich ist, ist Realität in ihm, ist er eine denkende Kraft.“ (ebd., 13. Brief) Der Mensch ist also nur in dieser doppelten Natur denkbar.
Die Aufgabe der Kultur ist es, beiden Trieben ihre Grenzen zu sichern: „Die Sinnlichkeit gegen die Eingriffe der Freiheit zu verwahren; […] Die Persönlichkeit gegen die Macht der Empfindung sicherzustellen. Jenes erreicht sie durch Ausbildung des Gefühlsvermögens, dieses durch Ausbildung des Vernunftvermögens.“ (ebd.) Durch die Vereinseitigung der einen oder der anderen Tendenz kommt es zu fataler Fehlleitung des Menschen. Überwiegt der Stofftrieb, wird der Mensch zum egozentrischen „Wilden“, der - von Gefühlen und Affekten geleitet - moralische Grundsätze verachtet und sich von den Geboten der Natur beherrschen lässt. Überwiegt der Formtrieb, werden die Gefühle missachtet und zerstört. Der Mensch wird zum „Barbaren“, der die Natur verachtet und sich nur von rationalen Gesetzen beherrschen lässt. (Vgl. ebd., 4. Brief)
Doch kann Schiller nicht bestreiten, dass die Divergenz beider Seiten das wirksamste Instrument des Kulturfortschritts ist und die fortschreitende Zivilisation diese Kluft noch befördert. (Vgl. ebd., 6.Brief) „Einseitigkeit in Übung der Kräfte führt zwar das Individuum unausbleiblich zum Irrtum, aber die Gattung zur Wahrheit.“ (ebd., 6. Brief) Doch wenn auch die rationalisierte Menschheit zu höchster Erkenntnis (wissenschaftliche „Wahrheit“) gelangt, muss das Individuum doch vor der Einseitigkeit des rationalen Denkens und der daraus folgenden Gefühlskälte bewahrt werden, ebenso vor einem seichten, an bloßer Befriedigung orientiertem Dasein, das die menschlichen Möglichkeiten ignoriert. Vergönnt der Fortschritt doch nur einem Teil der Menschheit Bildung und Selbstverwirklichung, während die Masse keine Chance hat, ihr Vernunftvermögen zu entfalten.[22]
Es muss also zu einer Einheit, besser gesagt, zu einem fruchtbaren Wechselverhältnis von Stoff- und Formtrieb kommen, in dem sich beide zur Wirksamkeit bringen und zugleich in Schach halten. Um eine „vollständige Anschauung seiner Menschheit“ zu gewinnen, müsse er die „doppelte Erfahrung“ zugleich machen. Er müsse sich zugleich seiner Freiheit bewusst sein und sein Dasein empfinden. Diese Erfahrung wecke „einen neuen Trieb“ in ihm, in dem beide anderen Triebe zusammenwirkten: den „Spieltrieb“ (ebd., 14. Brief).
Schiller erklärt, dass der Mensch sowohl von der physischen Nötigung der Sinne als auch von der gesetzlichen Verpflichtung der Vernunft befreit werde, indem im Spiel sein sinnliches und sein geistiges Vermögen zugleich auf sein Gemüt wirkten.(Vgl. ebd.) Der Formtrieb gibt den Dingen bleibende Gestalt, d. h. er gibt der Welt Ordnung, Gesetz, Bedeutung - eine formale Struktur, die als „Denkinstrument“ dient. Der sinnliche Trieb gibt dieser „Gestalt“ Leben, indem die formale, gedachte Struktur - die reine Abstraktion - auch als Realität in den Sinnen erlebbar wird. Der Gegenstand des Spieltriebs ist also die „lebende Gestalt“ (ebd., 15. Brief). Diese ästhetische Erfahrung als Verknüpfung von sinnlicher Wahrnehmung und Erkenntnis fasst Schiller zusammen in dem Begriff der Schönheit: „Durch die Schönheit wird der sinnliche Mensch zur Form und zum Denken geleitet; durch die Schönheit wird der geistige Mensch zur Materie zurückgeführt und der Sinnenwelt wieder gegeben.“ (ebd., 18. Brief)
Schiller unterscheidet die real erfahrbare Schönheit von dem Idealschönen, das aus dem idealen Spiel, im vollkommenen Gleichgewicht der Triebe hervorgehe. Doch in der Realität könne diese ideale Harmonie nie erreicht werden. Ebenso wenig ist die absolute Vereinseitigung der Triebe real erfahrbar. Die reale Schönheit bleibe immer eine doppelte. Er unterscheidet daher die Erfahrung der „schmelzenden Schönheit“ und der „energischen Schönheit“ (ebd., 16. Brief), die sich gegenseitig regulieren. Wilfried Noetzel übersetzt die erstgenannte mit „Schönheit im engeren Sinne“ (Noetzel, 2006, S.79)[23], die den Menschen sowohl von den Zwängen der Naturgesetze als auch von den Pflichten der Vernunft zu befreien vermag und ihn in einen ästhetischen Zustand der „Abspannung“ (Schiller, 17. Brief) versetzt. Diese Schönheit bedarf allerdings eines Regulativs, und zwar des Erhabenen in Form der „energischen Schönheit“. Noetzel weist nachdrücklich auf die Bedeutung der Erhabenheit - also der ästhetischen Erfahrung des Hässlichen, Erschütternden, Disharmonischen - als korrigierende Kraft in Schillers ästhetischer Theorie hin. Sie intensiviert Empfindung und Vernunft zugunsten des angespannten, moralisch aktiven Menschen, der sich „[…] auch im Unglück als human bewährt […]“ (Noetzel, 2006, S.49). Mit dieser Komponente erhält Schillers ästhetische Erziehung eine ethische und politische Dimension. Es geht ihm nicht allein um den Einzelnen, der im ästhetischen Spiel mit Schönheit die Freiheit des Menschseins erfährt, sein Gemüt harmonisiert und sein Leben bereichert, sondern um die Idee des Humanismus, die durch ganzheitlich ästhetisch gebildete Bürger endlich gesamtgesellschaftlich realisiert werden soll.
Das ästhetische Spiel darf daher nicht missverstanden werden als bloße Mußestunde, als Kunstgenuss von gefälliger Schönheit, die jedoch wirkungslos bleibt für das Gemeinschaftsleben. Wo Gefühl und Vernunft intensiv zusammenwirken, kann die Moral in der gesellschaftlichen Praxis nur profitieren. Schillers Theorie hat aber auch deshalb heute noch Relevanz, weil sie an die (Selbst-)Bildungsfunktion der ästhetischen Erfahrung (im Spiel) erinnert, die - sofern sie allen ermöglicht wird - die Mitglieder einer Gesellschaft zu Mündigkeit und Partizipation befähigt. Darauf beruft sich gerade heute wieder die Kulturpädagogik, die ein demokratisches Bildungsideal verfolgt.
„Je vielseitiger sich die Empfänglichkeit ausbildet, je beweglicher dieselbe ist, und je mehr Fläche sie den Erscheinungen darbietet, desto mehr Welt ergreift der Mensch, desto mehr Anlagen entwickelt er in sich; je mehr Kraft und Tiefe die Persönlichkeit, je mehr Freiheit die Vernunft gewinnt, desto mehr Welt begreift der Mensch, desto mehr Form schafft er außer sich. Seine Kultur wird also darin bestehen, erstens: Dem empfangenden Vermögen die vielfältigsten Berührungen mit der Welt zu verschaffen und auf Seiten des Gefühls die Passivität aufs Höchste zu treiben; zweitens: Dem bestimmenden Vermögen die höchste Unabhängigkeit von dem empfangenden zu erwerben und auf Seiten der Vernunft die Aktivität aufs Höchste zu treiben.“ (Schiller, 13. Brief)
Dies ist nur möglich, wenn sowohl Stoff- als auch Formtrieb gleichberechtigt zur Wirkung kommen, also weder der eine noch der andere dominiert: im Spiel. Darin kann der Mensch wahrhaft seine doppelte Natur als Realist und Idealist verwirklichen, kann anhand einer Fülle von ästhetischen Erfahrungen - sowohl schöne als auch erhabene - sein sinnliches und sein rationales Vermögen ausbilden und stärken. Wenn er sich auf diese Weise ganz als Mensch erfährt - nicht als Spielball der Naturgewalten, nicht als Opfer restriktiver Strukturen, nicht als Zahnrad einer rationalisierten Maschinerie, sondern autonom und handlungsfähig - und sich seines Vermögens bewusst ist, kann er wahrhaft menschlich handeln und wirken. So ist er „[…] nur da ganz Mensch, wo er spielt.“ (ebd., 15.Brief)
3.2 Die Besonderheit des Menschen und die Voraussetzung für sein Spiel: Das Symbol
Dieses Kapitel widme ich der Eigenart des Menschen, die ihn maßgeblich vom Tier unterscheidet. Die Erörterung wird Aufschluss darüber geben, dass jener Unterschied letztlich die Grundvoraussetzung für die zentralen menschlichen Hervorbringungen wie Kultur, Religion, Wissenschaft, Kunst und Spiel und damit für seine Sonderrolle in der Welt bildet. Darüber hinaus wird sie hoffentlich einige nachfolgende Erörterungen zum Spiel verständlicher machen.
Ernst Cassirer bezeichnete den Menschen als „animal symbolicum“ (Cassirer, 1996, S.51). Den Menschen zeichnet vor allem der Gebrauch von Symbolsystemen aus, für den es im Tierreich kein Äquivalent gibt. Dieser Symbolgebrauch eröffnet ihm einen Zugang zu einer „neuen Dimension der Wirklichkeit“ (ebd., S.49), führt zu einem Dasein in einem selbstgeschaffenen, symbolischen Universum aus Sprache, Religion, Wissenschaft, Kunst, Moral, Mythos usw..
Auch Tiere verfügen mitunter über komplexe Zeichensysteme. Durch Gestik, Mimik oder Lautäußerungen drücken einige Arten Gefühle aus. Oder dressierte Hunde können beispielsweise lernen, auf Zeichen des Herrchens unmittelbar zu reagieren, etwa auf mündliche Befehle, Handzeichen oder Geräusche. Der maßgebliche Unterschied zum Symbol besteht aber in der bloßen Signalwirkung des Zeichens. Für das Tier verweist es direkt auf eine wahrnehmbare Sache der physikalischen Welt und bewirkt damit eine Reaktion darauf. Das Zeichen ist fest und eindeutig mit der einen bezeichneten Sache oder konkreten Situation verbunden, als sei das Zeichen eine Eigenschaft. Es hat aber keine objektive Bedeutung. So verharrt die „Tiersprache“ auf dem vorsprachlichen Niveau eines subjektiven, affektiven Signalgebrauchs. (Vgl. ebd., S.55ff)
Beim Menschen hat sich eine weitere Dimension zwischen sinnlicher Wahrnehmung und Reaktion geschoben, umspannt sie regelrecht. Diese Dimension ist durch das Symbolsystem Sprache (im weitesten Sinne des Wortes) gekennzeichnet. „Das Prinzip des Symbolischen mit seiner Universalität, seiner allgemeinen Gültigkeit und Anwendbarkeit ist das Zauberwort, das Sesam, öffne dich!, das den Zugang zur menschlichen Welt, zur Welt der menschlichen Kultur, gewährt.“ (ebd., S.63) Wesentlich für das menschliche Symbolsystem ist zum einen seine universelle Anwendbarkeit (alles hat einen Namen) sowie seine Flexibilität und Wandelbarkeit. Alles kann auf viele verschiedene Weisen bezeichnet werden, da die Symbole nicht zu einer konkreten Sache, sondern zu einem abstrakten System gehören - zu einer Architektur aus allgemeinen und spezifischen Kategorien, Begriffen, Bedeutungen und Beziehungen, die unabhängig von der sinnlichen Wahrnehmung ein relationales Denken ermöglichen.(Vgl. ebd., S.52ff) Symbole verweisen auf Vorstellungen von Dingen, die in der Vergangenheit schon einmal wahrgenommen wurden und erinnert werden, oder auf Vorstellungen, die sich aus anderen Vorstellung und ihren Beziehungen rein symbolisch generiert haben. (Vgl. Langer, 1984, S.39)[24]
Jedoch gilt: Was grundsätzlich außerhalb der symbolischen Ordnung liegt - z.B. Beziehungen, die die Sprache nicht auszudrücken vermag - kann auch nicht gedacht werden. Die „diskursive“ Sprache (z.B. Lautsprache) (Vgl. ebd., S.88) ist aber nicht das einzige Medium, um Zusammenhänge zu denken. „Präsentative“ Symbole (Vgl. ebd., S.103), z.B. Bilder, können durch die nicht-lineare, sondern zeitgleiche sinnliche Wahrnehmung von Formen und Zusammenhängen, Dinge zum Gegenstand der Erkenntnis machen, die die „diskursive“ Sprache niemals ausdrücken könnte. (Vgl. ebd., S.87ff). Darin liegt beispielsweise die besondere Ausdrucksfähigkeit von Meisterwerken in der Kunst.
Bei aller beeindruckenden Komplexität und Anwendbarkeit der menschlichen Symbolsysteme wäre es ein Irrtum, das Symbolisieren als Spitze eines Entwicklungsprozesses zu interpretieren, den nur der Mensch zu Ende gegangen ist und der ihn damit im Tierreich zur „Krone der Schöpfung“ macht, weil ihm die hochentwickelte Technik des Symbolisierens eine effektivere Daseinsbewältigung garantiert. Das ist ein Trugschluss. Die neue Dimension des Symbolisierens verschließt dem Menschen tatsächlich die unmittelbare Konfrontation mit der biologischen Welt. Er lebt gewissermaßen auf dem Umweg, ist anfällig für Fehler, Ineffizienz, Selbstgefährdung und unpraktisches Handeln (z.B. religiöse Rituale), während Tiere durch ihre Eingepasstheit in die Natur ihr Leben effektiver, einfacher und unmittelbar bewältigen. Tiere sind Realisten, Menschen leben dagegen in ihrer eigenen, abstrakten, symbolischen Welt. (Vgl. ebd., S.42ff)
[...]
[1] Aus Gründen der Praktikabilität beschränke ich mich in der Arbeit auf das generische Maskulinum. Natürlich sind weibliche Personen mitgemeint.
[2] Schiller, Friedrich: Über die ästhetische Erziehung des Menschen, 1795, In: Hille & Partner GbR, Projekt Gutenberg-DE, Hamburg: http://gutenberg.spiegel.de/?id=5&xid=2407&kapitel=1#gb_found, 15.05.2008
[3] Mies, Georg-Achim: Kultur mit „K“ wie „Krake“, In: Schmid Noerr, Gunzelin (Hrsg.): Kultur und Unkultur - Perspektiven der Kulturkritik und Kulturpädagogik, Mönchengladbach, 2005, S.251-269
[4] Stagl, Justin: Der Kreislauf der Kultur, in: Schmied-Kowarzik, W. (Hrsg), Stederoth, D. (Hrsg.): Kultur-Theorien - Annäherungen an die Vielschichtigkeit von Begriff und Phänomen der Kultur, Kassel, 1993, S.11-32
[5] Käser, Lothar: Fremde Kulturen - Eine Einführung in die Ethnologie für Entwicklungshelfer und kirchliche Mitarbeiter in Übersee, Erlangen, Lahr, 1997
[6] Vgl. in dieser Arbeit: Kapitel 3.2 Die Besonderheit des Menschen und die Voraussetzung für sein Spiel: Das Symbol
[7] Stagl fasst die „Leistungen“ zusammen in drei Hauptkategorien: „Sachkultur“ (vom Menschen verwendete, bearbeitete, hergestellte Objekte und ihre Verwendung), „Symbolkultur“ (Formen des Ausdrucks und der Auslegung der Ordnung und der Sinnhaftigkeit der Welt) sowie „soziale Kultur“ (Formen des Umgangs der Menschen miteinander). (Stagl, 1993, S.13)
[8] Cassirer, Ernst: Versuch über den Menschen - Einführung in eine Philosophie der Kultur, Hamburg, 1996
[9] Vgl. hierzu Wulff, Erich: Kulturelle Identität als Lebensform und Lebensbewältigung in verschiedenen Gesellschaftstypen, in: Fuchs, Max (Hrsg.): Kulturelle Identität - Dokumentation der Fachtagung „Kulturelle Identität - Eine Aufgabe für die Jugendarbeit?“, Remscheid, 1993, S.10-23
[10] Vgl. hierzu Baumann, Zygmunt: Vom Nutzen der Soziologie, Frankfurt a. M., 2000, S.56-101
[11] Vgl. hierzu Beck, Ulrich, Beck-Gernsheim, Elisabeth: Riskante Freiheiten, Frankfurt a. M., 1994
[12] Hitzler, Ronald: Leben in Szenen, Wiesbaden, 2005
[13] Schmid, Wilhelm: Philosophie der Lebenskunst, Frankfurt a. M., 1998
[14] Zacharias, Wolfgang: Kulturpädagogik - Kulturelle Jugendbildung. Eine Einführung, Opladen, 2001
[15] Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung (Hrsg): Kulturelle Bildung und Lebenskunst - Ergebnisse und Konsequenzen aus dem Modellprojekt „Lernziel Lebenskunst“, Remscheid, 2001
[16] Vgl. hierzu Fuchs, Max: Kulturelle Bildung im Spannungsfeld von Leben und Kunst - Reflexion der Fachtagung vor dem Hintergrund unseres Modellprojektes „Lernziel Lebenskunst“, In: Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung (Hrsg): Kulturelle Bildung und Lebenskunst - Ergebnisse und Konsequenzen aus dem Modellprojekt „Lernziel Lebenskunst“, Remscheid, 2001, S.87-94
[17] Vgl. hierzu Zacharias, Wolfgang: Kulturpädagogik - Kulturelle Jugendbildung. Eine Einführung, Opladen, 2001
[18] Zacharias, Wolfgang: Kultur und Bildung. Kunst und Leben - Zwischen Sinn und Sinnlichkeit. Texte 1970-2000, Bonn, 2001
[19] Vgl. hierzu Mayrhofer, Hans; Zacharias, Wolfgang: Ästhetische Erziehung - Lernorte für aktive Wahrnehmung und soziale Kreativität, Reinbek, 1976
[20] Vgl. Schiller, 1795
[21] Das Wort „Trieb“ darf hier nicht im psychoanalytischen Sinne verstanden werden. Schiller nutzt den Begriff als Metapher für die zwei Tendenzen im menschlichen Denken und Handeln.
[22] Man muss bedenken, dass Schiller die Verhältnisse zur Zeit der Aufklärung im Sinn hatte. Nur die höheren Klassen hatten Zugang zu Bildung und Kunst, während das Leben der benachteiligten Klassen schlicht aus Arbeit bestand.
[23] Noetzel, Wilfried: Friedrich Schillers Philosophie der Lebenskunst - Zur Ästhetischen Erziehung als einem Projekt der Moderne, London, 2006
[24] Langer, Susanne K.: Philosophie auf neuem Wege - Das Symbol im Denken im Ritus und in der Kunst, Frankfurt a. M., 1984
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2008
- ISBN (eBook)
- 9783836621717
- Dateigröße
- 1.3 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach – Sozialwesen, Studiengang Kulturpädagogik
- Erscheinungsdatum
- 2014 (April)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- spiel kreativität kulturpädagogik ästhetik lebenskunst
- Produktsicherheit
- Diplom.de