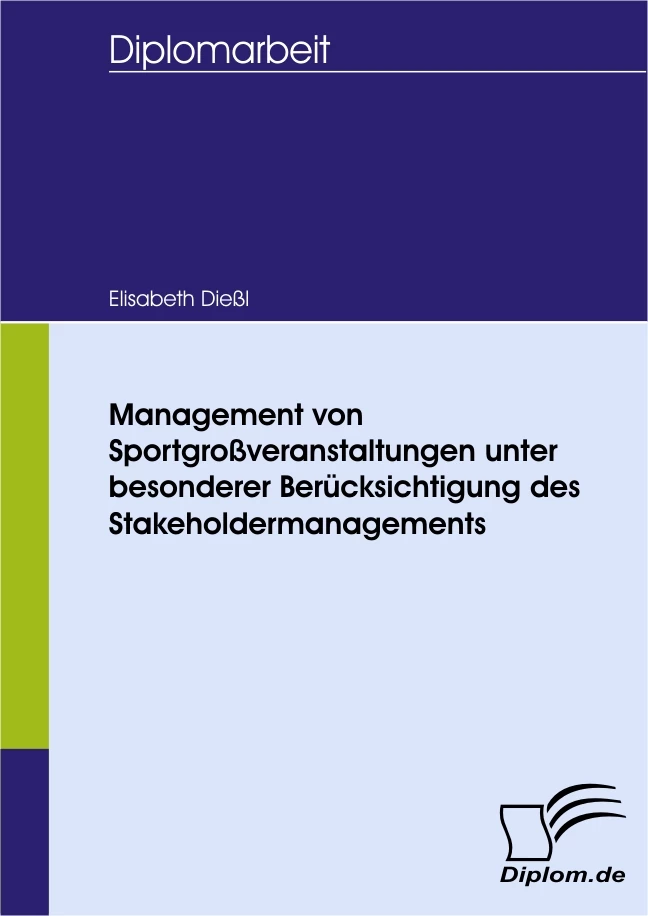Management von Sportgroßveranstaltungen unter besonderer Berücksichtigung des Stakeholdermanagements
©2008
Diplomarbeit
134 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Ausgangssituation:
Sportliche Großveranstaltungen, wie Olympische Spiele oder Weltmeisterschaften, die weltweit Millionen von Fans begeistern haben in den letzten Jahren eine enorme ökonomische und gesellschaftliche Aufwertung erfahren. Der Bedeutungszuwachs von Sportgroßveranstaltungen äußert sich sowohl in der wachsenden Anzahl und Größe von Sportereignissen, in der Verringerung der zeitlichen Abstände, als auch im steigenden Wettbewerb der Städte und Regionen um die Austragung solcher Events.
Sportwettkämpfe stellen kein neues Phänomen dar, sondern besitzen eine lange Tradition, die auf die Panhellenischen Spielen in die Antike zurückgeführt werden können. Neu ist jedoch, dass das Geschehen in den meisten Sportarten heute nicht mehr ausschließlich durch die sportliche Bestätigung geprägt ist. Vielmehr finden sich wirtschaftliche Zwänge, mediale Verflechtungen, strukturelle Abhängigkeiten und finanzielle Interessen - vor allem im Spitzen- und Profisport.
Auch die gesellschaftlichen Entwicklungen mit einem veränderten Konsumenten-verhalten, den gewachsenen Ansprüchen an den Sportkonsum, dem Wandel zur Kommunikations- und Freizeitgesellschaft tragen ihren Teil dazu bei, dass sich die Rahmenbedingungen im und um den Sportsektor ziemlich verändert haben. All dies sind einige Gründe dafür, warum Sportveranstaltungen zu einem nicht mehr wegzudenkenden Bestandteil unserer Freizeitkultur geworden sind.
Dadurch haben sich die Herausforderungen an die Führung und Finanzierung von Vereinen sowie die Behauptung im Wettbewerb um Fans, Sponsoren und Medien stark gewandelt.
Aus diesem Grund kann es sich kein Sportler, Club, Verein oder Verband mehr leisten, Management- und Marketingkompetenzen zu vernachlässigen eine zunehmende Professionalisierung ist gefordert. Der Sport braucht heutzutage nicht mehr nur professionelle Sportler und Trainer, sondern auch professionelle Manager.
Problemstellung:
Sportgroßveranstaltungen haben sowohl quantitativ als auch qualitativ neue Dimensionen erreicht. Dies zeigt sich zum einen an dem quantitativ wachsenden Sporteventsektor und andererseits an den qualitativen Entwicklungen wie Kommerzialisierung, Mediatisierung und Professionalisierung.
Insbesondere bei Sportorganisationen stoßen jedoch Wörter wie Businessplan und strategische Ziele meist auf Verwunderung. Doch gerade diese befinden sich in einem sehr komplexen Umfeld mit vielen verschiedenen Anspruchsgruppen, die mit […]
Ausgangssituation:
Sportliche Großveranstaltungen, wie Olympische Spiele oder Weltmeisterschaften, die weltweit Millionen von Fans begeistern haben in den letzten Jahren eine enorme ökonomische und gesellschaftliche Aufwertung erfahren. Der Bedeutungszuwachs von Sportgroßveranstaltungen äußert sich sowohl in der wachsenden Anzahl und Größe von Sportereignissen, in der Verringerung der zeitlichen Abstände, als auch im steigenden Wettbewerb der Städte und Regionen um die Austragung solcher Events.
Sportwettkämpfe stellen kein neues Phänomen dar, sondern besitzen eine lange Tradition, die auf die Panhellenischen Spielen in die Antike zurückgeführt werden können. Neu ist jedoch, dass das Geschehen in den meisten Sportarten heute nicht mehr ausschließlich durch die sportliche Bestätigung geprägt ist. Vielmehr finden sich wirtschaftliche Zwänge, mediale Verflechtungen, strukturelle Abhängigkeiten und finanzielle Interessen - vor allem im Spitzen- und Profisport.
Auch die gesellschaftlichen Entwicklungen mit einem veränderten Konsumenten-verhalten, den gewachsenen Ansprüchen an den Sportkonsum, dem Wandel zur Kommunikations- und Freizeitgesellschaft tragen ihren Teil dazu bei, dass sich die Rahmenbedingungen im und um den Sportsektor ziemlich verändert haben. All dies sind einige Gründe dafür, warum Sportveranstaltungen zu einem nicht mehr wegzudenkenden Bestandteil unserer Freizeitkultur geworden sind.
Dadurch haben sich die Herausforderungen an die Führung und Finanzierung von Vereinen sowie die Behauptung im Wettbewerb um Fans, Sponsoren und Medien stark gewandelt.
Aus diesem Grund kann es sich kein Sportler, Club, Verein oder Verband mehr leisten, Management- und Marketingkompetenzen zu vernachlässigen eine zunehmende Professionalisierung ist gefordert. Der Sport braucht heutzutage nicht mehr nur professionelle Sportler und Trainer, sondern auch professionelle Manager.
Problemstellung:
Sportgroßveranstaltungen haben sowohl quantitativ als auch qualitativ neue Dimensionen erreicht. Dies zeigt sich zum einen an dem quantitativ wachsenden Sporteventsektor und andererseits an den qualitativen Entwicklungen wie Kommerzialisierung, Mediatisierung und Professionalisierung.
Insbesondere bei Sportorganisationen stoßen jedoch Wörter wie Businessplan und strategische Ziele meist auf Verwunderung. Doch gerade diese befinden sich in einem sehr komplexen Umfeld mit vielen verschiedenen Anspruchsgruppen, die mit […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Elisabeth Dießl
Management von Sportgroßveranstaltungen unter besonderer Berücksichtigung des
Stakeholdermanagements
ISBN: 978-3-8366-1994-3
Druck Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2008
Zugl. MCI - Management Center Innsbruck GmbH, Innsbruck, Österreich, Diplomarbeit,
2008
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2008
Printed in Germany
HERZLICHEN DANK AN...
...meine Betreuerin Frau Mag. Ulrike Reisner, die mir während meiner Diplomarbeit
immer mit Rat und Tat zur Seite stand
... das MCI, das uns stets gut betreute und ihr Bestes gibt ein qualitativ hochwertiges
Studium anzubieten
...meine Studienkollegen und Freunde, die dazu beigetragen haben meine
Studienzeit zu einem sehr schönen und unvergesslichen Lebensabschnitt zu machen
...meine Familie, die mir dieses Studium ermöglicht haben und mich immer in allen
Lebenslagen unterstützen
Inhaltsverzeichnis I
Inhaltsverzeichnis
1.
E
INLEITUNG
... 1
1.1
Ausgangssituation ... 1
1.2
Problemstellung ... 2
1.3
Zielsetzung und Forschungsfrage... 3
1.4
Methodik und Aufbau der Arbeit... 5
2.
S
PORTEVENTS
... 8
2.1
Event ... 8
2.1.1
Definition des Begriffes ...9
2.1.2
Stellenwert von Events in der Gesellschaft ...10
2.1.3
Charakteristik von Events ...12
2.1.4
Eventtypologien ...15
2.2
Sport... 20
2.2.1
Definition des Begriffes ...20
2.2.2
Charakteristik und Besonderheiten des Produktes Sport...22
2.2.3
Bedeutung des Sports...24
2.2.3.1.
Individuelle Bedeutung
...24
2.2.3.2.
Gesellschaftliche Bedeutung
...25
2.3
Sportevents ... 26
2.3.1
Definition Zusammenführung der Begriffe Sport und Event ...27
2.3.2
Charakteristik und Besonderheiten von Sportevents ...28
2.3.2.1. Projektphasen... 28
2.3.2.2. Personalstruktur ... 31
2.3.2.3. Budget ... 31
2.3.3
Kommerzialisierung von Sportevents...32
2.3.4
Dimensionen und Wirkungsfelder von Sportevents ...33
2.3.4.1. Mögliche
Einteilungskriterien... 35
2.3.4.2. Ökonomische Wirkungen ... 37
2.3.4.3. Ökologische Wirkungen ... 42
2.3.4.4. Soziale Wirkungen... 42
2.3.4.5. Multiplikatorenwirkung... 44
Inhaltsverzeichnis II
3.
S
TAKEHOLDERMANAGEMENT
... 47
3.1
Definition des Begriffes Stakeholder... 47
3.2
Arten von Stakeholdern Einteilungsformen ... 49
3.2.1
Primäre und sekundäre Stakeholder...49
3.2.2
Interne und externe Stakeholder...50
3.2.3
Bezugsgruppen, Interessensgruppen & strategische
Anspruchsgruppen ...50
3.3
Stakeholdertheorie... 53
3.4
Zielsetzung des Stakeholdermanagements... 56
3.5
Vorgehensweise des Stakeholdermanagements ... 58
3.5.1
Identifikation...58
3.5.2
Einteilung ...59
3.5.3
Klassifizierung...61
3.5.4
Integration und Steuerung...62
3.5.5
Kontrolle...63
3.6
Kritik am Stakeholderkonzept ... 64
4.
S
TAKEHOLDERMANAGEMENT BEI
S
PORTGROßVERANSTALTUNGEN
. 67
4.1
Stand der Forschung ... 67
4.2
Notwendigkeit des Stakeholdermanagements bei
Sportgroßveranstaltungen ... 68
4.2.1
Viele verschiedene Stakeholdergruppen...69
4.2.2
Zahlreiche Einflussgrößen auf die Erwartungen der Stakeholder ...70
4.2.3
Divergierende Interessen ...71
4.2.4
Veränderte Interessen im Laufe der Zeit...74
4.2.5
Die Macht einzelner Stakeholdergruppen ...74
4.3
Vorteile durch Stakeholdermanagement... 75
5.
Z
WISCHENFAZIT
T
HEORETISCHE
G
RUNDLAGEN
... 77
Inhaltsverzeichnis III
6.
F
ALLBEISPIEL
S
PECIAL
O
LYMPICS
... 79
6.1
Einleitung... 79
6.2
Ausgangspunkte der empirischen Untersuchung ... 79
6.2.1
Die Fallstudie als Forschungsmethode ...80
6.2.2
Repräsentativität des Fallbeispiels...81
6.2.3
Informationsquellen des Fallbeispiels ...82
6.3
Ergebnisse der Fallstudie... 82
6.3.1
Allgemeine Informationen zu den Special Olympics ...82
6.3.1.1. Special
Olympics International ... 83
6.3.1.2. Special
Olympics Österreich ... 83
6.3.1.3. Die 3. Nationale Winterspiele von SOÖ ... 84
6.3.1.4. Zahlen
und
Fakten der Spiele ... 85
6.3.1.5. Strategische Ausrichtung ... 86
6.3.2
Ausgewählte Besonderheiten des Managements ...87
6.3.2.1.
Die Bewerbung
...88
6.3.2.2.
Organisationsstruktur & Personalplanung
...88
6.3.2.3.
Finanzierung
...92
6.3.3
Die Stakeholder der 3. Nationalen Winterspiele...92
6.3.4
Das Stakeholdermanagement der 3. Nationalen Winterspiele...95
7.
Z
USAMMENFASSENDE
E
RGEBNISSE AUS
T
HEORIE UND
P
RAXIS
... 99
7.1
Anforderungen an das Management von
Sportgroßveranstaltungen ... 99
7.2
Resümee und Ausblick... 103
A
BBILDUNGSVERZEICHNIS
...IV
L
ITERATURVERZEICHNIS
...105
A
NHANGSVERZEICHNIS
...116
Abbildungsverzeichnis IV
A
BBILDUNGSVERZEICHNIS
Abbildung 1: Event und Veranstaltung... 14
Abbildung 2: Indikatoren und Grenzwerte zur Abgrenzung sportlicher
Großveranstaltungen ... 16
Abbildung 3: Kategorisierung von Events nach Ihrer Größe... 18
Abbildung 4: Anlässe bzw. Inhalt von Events ... 20
Abbildung 5: Besonderheiten des Produktes Sport ... 22
Abbildung 6: Schnittstelle Sportevents... 27
Abbildung 7: Vor- und Nachteile sportlicher Großveranstaltungen ... 36
Abbildung 8: Wirkungsdreieck von Sportgroßveranstaltungen ... 37
Abbildung 9: ökonomische Nutzen und Kosten des Veranstalters ... 38
Abbildung 10: Ökonomische Nutzen und Kosten auf die Bevölkerung... 39
Abbildung 11: Ökonomische Nutzen und Kosten auf die Besucher... 39
Abbildung 12: Ökonomische Nutzen und Kosten auf die öffentliche Verwaltung ... 40
Abbildung 13: Ökonomische Nutzen und Kosten auf das Gastgewerbe und den
Einzelhandel... 41
Abbildung 14: Ökonomische Nutzen und Kosten auf sonstige Unternehmen des
Veranstaltungsortes ... 41
Abbildung 15: Ökologische Nutzen und Kosten... 42
Abbildung 16: Soziale Nutzen und Kosten auf die Besucher... 43
Abbildung 17: Soziale Nutzen und Kosten auf die Bevölkerung ... 44
Abbildung 18: Gesamtwirtschaftliche Effekte von Sportgroßveranstaltungen ... 45
Abbildung 19: Das Umfeld von Sporteventorganisationen... 46
Abbildung 20: Strategische Anspruchsgruppen, Bezugsgruppen,
Interessensgruppen ... 51
Abbildung 21: Verschiedene Stakeholdertheorien ... 55
Abbildungsverzeichnis V
Abbildung 22: Ziel des Stakeholdermanagements... 57
Abbildung 23: Stakeholder-Mapping ... 61
Abbildung 24: Verschiede Stakeholder bei Sportevents ... 70
Abbildung 25: Einflussfaktoren auf die Erwartungen der Stakeholder ... 71
Abbildung 26: Verschiedene Erwartungen unterschiedlicher Stakeholder an
Sportgroßveranstaltungen... 72
Abbildung 27: Organisationsstruktur INNOK 2008... 91
Abbildung 28: Die Stakeholder der 3. Nationalen Winterspiele von Special Olympics
Österreich... 93
Abbildung 29: Kernbereiche des Sporteventmanagements... 101
Einleitung 1
1. E
INLEITUNG
1.1 Ausgangssituation
Sportliche Großveranstaltungen, wie Olympische Spiele oder Weltmeisterschaften,
die weltweit Millionen von Fans begeistern haben in den letzten Jahren eine enorme
ökonomische und gesellschaftliche Aufwertung erfahren.
1
Der Bedeutungszuwachs
von Sportgroßveranstaltungen äußert sich sowohl in der wachsenden Anzahl und
Größe von Sportereignissen, in der Verringerung der zeitlichen Abstände, als auch
im steigenden Wettbewerb der Städte und Regionen um die Austragung solcher
Events.
2
Sportwettkämpfe stellen kein neues Phänomen dar, sondern besitzen eine lange
Tradition, die auf die Panhellenischen Spielen in die Antike zurückgeführt werden
können. Neu ist jedoch, dass das Geschehen in den meisten Sportarten heute nicht
mehr ausschließlich durch die sportliche Bestätigung geprägt ist. Vielmehr finden
sich wirtschaftliche Zwänge, mediale Verflechtungen, strukturelle Abhängigkeiten
und finanzielle Interessen - vor allem im Spitzen- und Profisport.
Auch die gesellschaftlichen Entwicklungen mit einem veränderten Konsumenten-
verhalten, den gewachsenen Ansprüchen an den Sportkonsum, dem Wandel zur
Kommunikations- und Freizeitgesellschaft tragen ihren Teil dazu bei, dass sich die
Rahmenbedingungen im und um den Sportsektor ziemlich verändert haben. All dies
sind einige Gründe dafür, warum Sportveranstaltungen zu einem nicht mehr
wegzudenkenden Bestandteil unserer Freizeitkultur geworden sind.
Dadurch haben sich die Herausforderungen an die Führung und Finanzierung von
Vereinen sowie die Behauptung im Wettbewerb um Fans, Sponsoren und Medien
stark gewandelt.
3
1
vgl. Rohlmann/Schewe, 2005, S.269
2
vgl. Gans/Horn/Zemann, 2003, S. 123
3
vgl. Horn, 2005, S. 1; Rohlmann/Schewe, 2005, S.3 ff.
Einleitung 2
Aus diesem Grund kann es sich kein Sportler, Club, Verein oder Verband mehr
leisten, Management- und Marketingkompetenzen zu vernachlässigen eine
zunehmende Professionalisierung ist gefordert. Der Sport braucht heutzutage nicht
mehr nur professionelle Sportler und Trainer, sondern auch professionelle
Manager.
4
1.2 Problemstellung
Sportgroßveranstaltungen haben sowohl quantitativ als auch qualitativ neue
Dimensionen erreicht.
5
Dies zeigt sich zum einen an dem quantitativ wachsenden
Sporteventsektor und andererseits an den qualitativen Entwicklungen wie
Kommerzialisierung, Mediatisierung und Professionalisierung.
6
Insbesondere bei Sportorganisationen stoßen jedoch Wörter wie Businessplan und
strategische Ziele meist auf Verwunderung. Doch gerade diese befinden sich in
einem sehr komplexen Umfeld mit vielen verschiedenen Anspruchsgruppen, die mit
unterschiedlichsten Zielsetzungen und Erwartungen an die Organisation herantreten
und es somit schwierig machen, Zufriedenheit und Erfolg zu definieren und
Erwartungen zu managen.
7
Menschen sind es, die die Wirklichkeit schwer erfassbar
machen, da das Umfeld aus all ihren Bedürfnissen, Einstellungen, Erwartungen und
Eigenheiten besteht und der Erfolg von ihnen entscheidend mit entschieden wird.
8
,,A crucial element in the creation of an event is the understanding of the event
environment."
9
Wie man an diesem Zitat sieht, befinden sich Sportanbieter in einem
Beziehungsgeflecht mit verschiedenartigen Organisationen und Gruppierungen.
4
vgl. Horch, 1999, S. 7f. ; Rohlmann/Schewe, 2005, S.3f.
5
vgl. Horn, 2005, S. 1
6
vgl. Horch, 1999, S. 7f.
7
vgl. Schnitzer, 2006, S. 10
8
vgl. Bornholdt/Noll/Ruck, 2006, I
9
Allen, 2005, S. 86
Einleitung 3
Die erfolgreiche Arbeit eines Sportanbieters wird durch sein Umfeld, genauer gesagt
durch jene Personen, Gruppierungen bzw. Organisationen, die sich tatsächlich oder
potentiell für ihn interessieren bzw. deren Entscheidungen Auswirkungen auf ihn
haben bzw. haben könnten, mitbestimmt.
10
Diese Gruppen, auch Stakeholder genannt, können Interesse, Vorbehalte, Ab-
neigungen, Gleichgültigkeit oder sogar Feindschaft gegenüber einem Event haben.
Die Aufgabe des Managements ist es, die verschiedenen Einflussbereiche auf die
Veranstaltung zu identifizieren, zu organisieren und die bestmögliche Lösung für alle
Beteiligten zu finden.
11
Aus diesem Grund beschäftigt sich die Arbeit mit dem Thema ,,Management von
Sportgroßveranstaltungen unter besonderer Berücksichtigung des
Stakeholdermanagements"
1.3 Zielsetzung und Forschungsfrage
Das Hauptziel der Arbeit besteht darin, die beiden Felder ,,Management von
Sportgroßveranstaltungen" und ,,Stakeholdermanagement" zu verknüpfen. Durch
eine umfassende Literaturrecherche soll die Verknüpfung dieser Teilbereiche
erörtert werden. Ziel ist es, sich näher mit dem Thema ,,Management von
Sportgroßveranstaltungen unter besonderer Beachtung des Stakeholder-
management" zu befassen und den bereits aus der Betriebswirtschaftslehre
bekannten Stakeholderansatz auf das Management von Sportgroßveranstaltungen
umzulegen. Es soll daher die Notwendigkeit des Stakeholdermanagements für eine
professionelle Sportgroßveranstaltung aufgezeigt werden.
Die Arbeit dient dazu, einen Leitfaden für Veranstalter von Sportgroß-
veranstaltungen darzustellen und soll aufzeigen auf, welche Besonderheiten sie bei
dem Management von Sportveranstaltungen achten müssen unter besonderem
Augenmerk einer Besonderheit, dem Stakeholdermanagement. Durch die
aufgezeigten Anforderungen an das Management von Sportgroßveranstaltungen
10
vgl. Heinemann, 1995, S.150
11
vgl. Allen, 2005, S.31
Einleitung 4
soll diese Arbeit klare Bedingungen und Forderungen für zukünftige Sport-
eventmanager stellen.
Aufgrund der Zielsetzung ergibt sich folgende zentrale Forschungsfrage, die
großteils aus dem Titel der Arbeit entnommen werden kann:
Ist Stakeholdermanagement wichtig für das erfolgreiche Management von
Sportgroßveranstaltungen und falls ja, welche Rolle spielt das Stakeholder-
management für das erfolgreiche Ausrichten einer Sportgroßveranstaltung?
Aus dieser Forschungsfrage ergeben sich weitere Untersuchungsfragen, die mit
Hilfe der verschiedenen Kapitel beantwortet werden sollen. Dabei wird immer wieder
auf die Kernfrage der Arbeit Rückschluss gegeben:
1. Welche für das Management zu beachtenden Besonderheiten weisen
Sportgroßveranstaltungen auf?
2. Was sind die zentralen Elemente des Stakeholderkonzeptes?
3. Welche Vorteile ergeben sich für Sporteventorganisationen, wenn sie
das Stakeholderkonzept anwenden?
4. Wie werden in der Praxis Sportgroßveranstaltungen im speziellen die
3. Nationalen Winterspielen von Special Olympics Österreich -
organisiert und inwieweit wurde das theoretische Stakeholderkonzept
in die Praxis umgesetzt?
5. Welche Anforderungen werden an das professionelle Management von
Sportgroßveranstaltungen gestellt?
Es ist somit nicht das Ziel dieser Arbeit, allgemeine Hypothesen und Theorie-
entwürfe auf ihre Gültigkeit und Erklärungskraft zu überprüfen, sondern vielmehr
praktisches, nützliches Wissen zu gewinnen und dieses auf die Anwendbarkeit der
Lösung praktischer Probleme zu überprüfen.
Einleitung 5
1.4 Methodik und Aufbau der Arbeit
Die Arbeit wird aus der Sichtweise des Managements, bzw. der Veranstalter von
Sportgroßveranstaltungen geschrieben und gliedert sich wie folgt:
Einführung in die Thematik
Mit Hilfe der Einleitung soll der Leser in die Thematik eingeführt werden. Die
Problemstellung, Zielsetzung und die daraus folgende zentrale Forschungsfrage mit
ihren weiteren Untersuchungsfragen sowie der Aufbau der Arbeit werden hier näher
beschrieben.
Theoretische Grundlagen
Der theoretische Teil der Arbeit gliedert sich in vier Überpunkte:
Sportevents
Um näher auf Sportgroßveranstaltungen und Ihre Stakeholder eingehen zu können,
wird zunächst - um eine Basis für die Arbeit zu schaffen - näher auf die Begriffe
Event, Sport und Sportevents eingegangen. Besonderheiten von Sportevents sowie
deren Dimensionen und Wirkungsfelder werden herausgearbeitet. Aufgrund der
zahlreichen dargestellten Wirkungsfelder von Sportgroßveranstaltungen gibt es viele
verschiedene Anspruchsgruppen, die so genannten Stakeholder. Diese haben einen
hohen Einfluss auf das Ergebnis der Sportgroßveranstaltung und werden im
kommenden Kapitel näher betrachtet.
Stakeholdermanagement
Der Inhalt dieses Kapitels gilt ebenso als Basiswissen für die weitere Arbeit. Eine
allgemeine Definition des Begriffes Stakeholder, die verschiedenen Arten und
Einteilungsformen von Stakeholdern sowie die Stakeholdertheorie und die
Zielsetzung und Vorgehensweise des Stakeholdermanagements sollen einen
näheren Einblick bieten. Die am Ende dieses Kapitels dargestellten Kritikpunkte am
Stakeholderkonzept, sollen die ganzheitliche Betrachtung mit der Thematik
widerspiegeln.
Einleitung 6
Stakeholdermanagement bei Sportgroßveranstaltungen
Nachdem die Begrifflichkeiten Event, Sport, Sportevents und Stakeholder erklärt
sind, wird aufbauend auf die vorherigen Kapitel das Stakeholdermanagement bei
Sportgroßveranstaltungen näher betrachtet. Zunächst wird der Stand der Forschung
geprüft und anschließend die Problematik der verschiedenen Wechselwirkungen
analysiert und somit die Notwendigkeit des Stakeholdermanagements bei
Sportgroßveranstaltungen aufgezeigt. Außerdem werden in diesem Kapitel die
entstehenden Vorteile durch Stakeholdermanagement bei Sportgroß-
veranstaltungen aufgezeigt.
Zwischenfazit theoretische Grundlagen
Zum Abschluss des Theorieteils wird eine Zusammenfassung die wichtigsten
dargestellten Aspekte darstellen. Die Beantwortung der im Punkt 1.3 ermittelten
Untersuchungsfragen helfen dabei, die theoretischen Erkenntnisse zusammenzu-
fassen.
Empirie
Fallbeispiel - Special Olympics Österreich
Nachdem das Thema theoretisch diskutiert wurde, findet eine praktische
Betrachtung anhand der 3. Nationalen Winterspiele von Special Olympics
Österreich statt. Dabei soll die Untersuchungsfrage ,,Wie werden in der Praxis Sport-
großveranstaltungen - im speziellen die 3. Nationalen Winterspiele von Special
Olympics Österreich - organisiert und inwieweit wurde das theoretische
Stakeholderkonzept in die Praxis umgesetzt?" beantwortet werden.
Hierfür werden zunächst die Grundlagen zur empirischen Untersuchung und zur
gewählten Forschungsmethode näher erläutert. Anschließend, nach allgemeinen
Informationen über Special Olympics und die 3. Nationalen Winterspiele von Special
Olympics Österreich, wird wie im theoretischen Teil großteils dargestellt, auf einige
Besonderheiten des Managements von Sportgroßveranstaltungen eingegangen.
Weiters werden die Stakeholder der Spiele aufgezeigt und es wird auf
Beobachtungen des Stakeholdermanagements eingegangen.
Einleitung 7
Zusammenfassende Ergebnisse aus Theorie und Praxis
Abschließend werden die theoretischen und praktischen Erarbeitungen
zusammengefügt. Die Bedeutung des Stakeholdermanagements für Sportgroß-
veranstaltungen wird beurteilt und allgemeine Anforderungen an das Management
von Sportgroßveranstaltungen werden erstellt. Abschließend stellt ein Resümee
nochmals die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit dar.
Für den Verlauf der weiteren Arbeit ist noch anzumerken, dass die theoretischen
Ausführungen nicht den Anspruch auf Vollständigkeit stellen. Das Thema
Management von Sportgroßveranstaltungen kann aus vielen verschiedenen
Blickwinkeln betrachtet werden. Um eine gewisse Struktur und Übersichtlichkeit zu
gewährleisten und den Rahmen einer Diplomarbeit nicht zu überschreiten, schien es
wichtig, einige inhaltliche Schwerpunkte zu setzen und manche Gesichtspunkte
auszuklammern. Beispielsweise wurde aus diesem Grund der in der Literatur oft
verwendete vergleichende Shareholder-/Stakeholderansatz nicht betrachtet. Es
werden nur jene Teilbereiche näher behandelt, die im Zusammenhang der
Integration für die Arbeit von besonderer Bedeutung sind. Aufgrund exakter
Quellenangaben kann sich der interessierte Leser weiter in die verschiedenen
Teilbereiche vertiefen.
Sportevents 8
2. S
PORTEVENTS
Sportgroßveranstaltungen sind Attraktionen, die immer mehr Menschen begeistern.
Sie ziehen die verschiedensten Zielgruppen an: von Zuschauern, die den Profis
zujubeln, bis zu Breitensportlern, die zum Mitmachen animiert werden oder
Geschäftsleuten, die die Euphorie des Sports zur Verbesserung ihrer Geschäfts-
beziehungen nutzen. Sportevents wirken durch Nähe, Emotion und Begeisterung
und sind ein kaum wegzudenkender Bestandteil unserer Freizeitkultur geworden.
12
Sie sind sowohl Ausdruck als auch Motor eines neuen Konsumstils, bei dem Spaß-
und Erlebnisorientierung immer mehr in den Vordergrund rücken.
13
Allerdings steht die praktische Relevanz der Forschung dieser Entwicklung nicht
repräsentativ gegenüber und Beiträge sind nur in einem bescheidenen Umfang
vorhanden.
14
Weder für Sport noch für Events bestehen eindeutige Definitionen in
der Literatur. Beide Bereiche haben ein vielfältiges Erscheinungsbild und unklare
Grenzen, sodass ein diffuses Erscheinungsbild von Sportevents entsteht.
Aus diesem Grund soll dieses Kapitel Klarheit über die Begriffe und Besonderheiten
von Sport und Events verschaffen, um anschließend näher auf Sportgroß-
veranstaltungen eingehen zu können. Die im Punkt 1.3 dargestellte erste
Untersuchungsfrage soll mit Hilfe dieses Kapitels beantwortet werden:
Welche für das Management zu beachtenden Besonderheiten weisen Sport-
großveranstaltungen auf?
2.1 Event
Events haben immer mehr an Bedeutung gewonnen, es scheint; als wären sie
überall. Sie liegen im Trend und gehören zum Leben vieler Menschen selbst-
verständlich dazu.
12
vgl. Anders/Hartmann, 1996, S. 55
13
vgl. Schulze, 1992, S. 44; Opaschowski, 1993, S. 24
14
vgl. Shannon, 1999, S. 517
Sportevents 9
Hierbei besteht jedoch die Notwendigkeit zu klären, was Events überhaupt sind und
ab wann eine Veranstaltung ein Event ist. Obwohl es Veranstaltungen schon seit
Jahrtausenden gibt, ist die Eventindustrie in der Welt von Kommunikation, Marketing
und Beziehungs- wie Reputationsmanagement noch ein recht junges
Instrumentarium. Seit den Achtziger Jahren spricht man von einer eigenständigen
Event-Industrie, die akademische Auseinandersetzung kam jedoch erst deutlich
später und ist auch bis heute noch nicht vollständig.
15
Um eine Grundlage zu schaffen, wird in diesem Kapitel zunächst näher auf den
Begriff Event und in der Folge auf die Charakteristiken und Typologien von Events
eingegangen.
2.1.1 Definition des Begriffes
,,Events entstehen im Kopf desjenigen, der es erlebt."
16
Da der Begriff ,,Event" nicht wissenschaftlichen Ursprungs ist, sondern in den letzten
Jahren vorwiegend der Praxis entnommen wurde, gibt es keine allgemeingültige
und wissenschaftliche Definition. Genauso wenig findet sich in der Literatur eine
eindeutige Abgrenzung von den Begriffen Festival, Ereignis, Veranstaltung oder
Attraktion.
Der Begriff ,,Event" kommt aus dem Englischen und bedeutet übersetzt Ereignis.
17
Ereignis wiederum beschreibt eine nicht objektiv messbare Eigenschaft und ist laut
Duden ,,etwas, was den normalen, alltäglichen Ablauf in bemerkenswerter Weise
unterbricht und durch seine Ungewöhnlichkeit auffällt und in Erscheinung tritt."
18
Auch obiges Zitat verdeutlicht subjektive Wahrnehmung von Events.
Holzbauer greift auch auf den Ereignischarakter und definiert Events wie folgt:
,,Events sind erlebnisorientierte organisierte Ereignisse und einmalige
Veranstaltungen."
19
15
vgl. Thuy/Wünsch, 2007, S. 13
16
Holzbaur et al., 2003, S. 6
17
Breitsprecher, 1997, S. 383
18
Duden, 2003, S. 480
19
Holzbaur et al, 2003, S. 1
Sportevents 10
Obwohl Getz sagt, "It seems at times that special events are everywhere; they have
become a growth industry. The field of special events is now so vast that it is
impossible to provide a definition that includes all varieties and shades of events."
20
hat er eine viel zitierte Definition entwickelt, die auch für die vorliegende Arbeit als
Arbeitsdefinition gilt.
,,A special event is a onetime or infrequently occurring event outside the
normal program or activities of the sponsoring or organizing body.
To the customer, a special event is an opportunity for a leisure, social, or
cultural experience outside the normal range of choices beyond everyday
experience."
21
2.1.2 Stellenwert von Events in der Gesellschaft
,,Nicht wer am ältesten wird, hat am längsten gelebt, sondern wer am stärksten
erlebt hat."
22
Der bekannte Lebenskünstler Jean-Jacques Rousseau lebte bereits im 18.
Jahrhundert nach diesem Prinzip. Gerade in der heutigen Gesellschaft gilt verstärkt
das Motto: ,,Das Erleben des Lebens rückt ins Zentrum."
23
Die Devise heißt nicht
mehr - leben, um zu arbeiten, sondern arbeiten, um zu leben.
24
Die Grundbedürfnisse sind in der westlichen Welt weitaus befriedigt und es besteht
immer mehr eine Freizeit-, Genuss-, und Erlebnisorientierung. ,,Erlebnis" ist der
Inbegriff der Freizeitforschung und Menschen können bzw. wollen, auch in
wirtschaftlich schwierigen Zeiten, nicht mehr auf Erlebniswerte verzichten.
25
Erlebnisse definieren sich wie folgt:
,,Erlebnis im engeren Sinn ist ein stark gefühlsbetontes und unmittelbares
Ergriffenwerden anlässlich eines Ereignisses oder einer Begegnung."
26
20
Allen, 2005, S. 11
21
Getz, 1991, S. 44
22
Kiel, 2004, S. 73
23
Schulze, 1992, S. 33
24
Kiel, 2004, S. 82
25
vgl. Opaschowski, 2000, S. 19
26
Bertelsmann, 1995, S. 91
Sportevents 11
Der Wandel vom reinen Versorgungskonsum zum Erlebniskonsum kündigt sich
schon seit Jahrzehnten an:
27
·
Ende der 40er Jahre: Rund drei Viertel des Einkommens geben die
Menschen für Essen und Kleidung aus.
·
50er Jahre: Befriedigung der Grundbedürfnisse. Die so genannte
,,Fresswelle" setzt ein.
·
60er Jahre: Konsumwelle vom Staubsauger über den Kühlschrank bis
zum Fernseher und Auto.
·
70er Jahre: Neue Nachfrageautomatik: wachsende Bevölkerung +
wachsende Kaufkraft + wachsende Freizeit = Entstehung einer
Freizeitindustrie.
·
80er Jahre: Wertewandel Vom Materialismus zum Postmaterialismus, das
heißt, die Menschen suchen vermehrt nach Zufriedenheit in ihrer Arbeit und
Freizeit, statt purem Einkommenszuwächsen.
·
Anfang der 90er Jahre: Konsumgewohnheiten werden vom Schlagwort
,,Lifestyle" beherrscht. Neue Trendgruppen entstehen: junge
Doppelverdiener, berufstätige Frauen, kinderlose Familien und Senioren mit
überdurchschnittlichem Einkommen geben den Ton an.
·
In den nächsten Jahren wird mit einem noch stärkeren Wunsch nach
Konsumerlebnis gerechnet. Die Polarisierung vom Versorgungskonsum und
Erlebniskonsum verstärkt sich. Die Erlebnisqualität wird zum wichtigsten
Kaufkriterium. Produkte ohne Erlebniswert verlieren an Attraktivität.
Events als künstliche Erlebniswelten stellen ein geeignetes Mittel dar, der
Gesellschaft die gewünschten Erlebnisse zu vermitteln.
27
vgl. Kiel, 2004, S. 73 f.
Sportevents 12
2.1.3 Charakteristik von Events
Im Folgenden werden die wesentlichen Merkmale von Events näher aufgezeigt.
·
Etwas Besonderes
Events werden mit etwas außergewöhnlichem, einmaligem verbunden. Oft werden
sie auch mit einem Paukenschlag oder Knalleffekt, aber auch mit Stimmung,
Festlichkeit und Erlebnischarakter in Verbindung gebracht. Die Besucher suchen
nach Abwechslung vom Alltag und wollen Erlebnisse in größerer Gesellschaft
genießen.
28
·
Inszenierung
,,In event-related projects, the future is not predicted, it is invented...
Managers must translate reasonable dreams into reality."
29
Jede Veranstaltung ist ,,ein kleines Theaterstück", welches mit Inszenierungs-
techniken arbeitet.
30
Events sind somit künstlich geschaffene Erlebniswelten.
Erlebnisse lassen sich nicht produzieren, da sie von jedem anders wahrgenommen
werden und Emotionen sind. Dies zeigt sich auch anhand der Tatsache, dass in der
Geschichte der Menschheit noch kein einziges Erlebnis verkauft wurde.
31
Wie auch obiges Zitat verdeutlicht, kann jedoch von Eventveranstaltern ein
günstiger Rahmen geschaffen werden, um Erlebnisse überhaupt zu ermöglichen.
·
Subjektivität
Jeder Mensch nimmt etwas anderes wahr und aufgrund der Tatsache, dass es sich
bei Events nicht um materielle Güter handelt, wird das Erlebnis von jedem subjektiv
anders empfunden, wie auch folgende Definition von Erlebnissen deutlich macht:
,,Erlebnisse sind Emotionen und setzen Ereignisse voraus, die aber erst durch
Erkenntnisse zur persönlichen Erfahrung werden."
32
28
vgl. Haase, 2004, S. 71; Freyer, 2005, S.60
29
Bergeri/Geffroy/Sordet, 2005, S. 18
30
vgl. Pfaff, 2002, S. 162
31
vgl. Schulze, 1992, S. 14ff.
32
Müller/Scheurer, 2004, S.4
Sportevents 13
·
Teilnahme
Events ermöglichen die Teilnahme und leben durch die Aktiviertheit der Teilnehmer.
Aus diesem Grund sind rechtzeitige Ankündigung, Marketing, Werbung und Public
Relations wichtige Faktoren für den Gesamterfolg.
33
·
Einmaligkeit
"Every such event is unique, stemming from the blend of management,
program, setting and people."
34
Das Ergebnis einer Veranstaltung ist immer einmalig und wird von jedem Besucher
anders wahrgenommen. Es gibt zwar wiederkehrende Events, aber es herrscht
immer eine einmalige, nicht zu wiederholende Stimmung.
35
·
Positivität
Events charakterisieren sich unter anderem durch ihren stets positiven Charakter.
Ein Fußballspiel welches wegen Regen abgesagt werden muss und die Teilnehmer
Stunden im Regen auf den Rücktransport warten müssen, kann zwar als
herausragendes Ereignis bezeichnet werden, ist jedoch kein Event.
36
·
Unvorhersehbarkeit
Ähnlich wie beim Wetter, gibt es bei Events viele kleine Einflüsse, die den Gesamt-
effekt unvorhersehbar machen.
Im Eventmanagement versucht man dem durch genaue Planung und Inszenierung
entgegenzuwirken, um möglichst gut auf diese Einflüsse reagieren zu können.
37
·
Zusatzeffekt
Jedes Event ist eine Veranstaltung, aber nicht jede Veranstaltung ist ein Event. Um
eine Veranstaltung zu einem Event zu machen, braucht es einen Zusatzeffekt, das
so genannte Sahnehäubchen, welches die Veranstaltung einzigartig macht.
Abbildung 1 verdeutlicht dies.
33
vgl. Haase, 2004, S. 71; Freyer, 2005, S.60; Holzbaur, 2003, S. 2
34
Getz, 2005, S. 16
35
vgl. Getz, 2005, S. 16
36
vgl. Holzbaur, 2003, S.11
37
vgl. Holzbaur, 2003, S. 13
Sportevents 14
Abbildung 1: Event und Veranstaltung
38
·
Fixer Termin mit einem vorgegebenen Anfang und Ende
"Planned events are temporary occurrences with a
predetermined beginning and end."
39
Folgendes Zitat macht deutlich, dass der Termin fest ist und nicht verschoben
werden kann. Ebenso wenig kann das Ergebnis nachgebessert werden.
·
Umfangreiche Vorbereitung
Im Vergleich zur Dauer des Events ist die Vorbereitungszeit von weitaus größerem
Zeitumfang. Der Hauptaufwand liegt in der Planung und Vorbereitung; mit dem
Startschuss der Veranstaltung ist das meiste gelaufen.
40
38
Quelle: Holzbaur, 2003, S. 23
39
Getz, 2005, S. 16
40
vgl. Haase, 2004, S. 71; Freyer, 2005, S.60; Holzbaur, 2003, S. 2
Veranstaltung
Event
Sportevents 15
2.1.4 Eventtypologien
,,The universe of events is amazingly diverse, and any
classification is bound to be incomplete."
41
Durch das Wachstum von Events in Zahl und Größe haben sich immer mehr
verschiedene Eventarten entwickelt und es gibt viele unterschiedliche Möglichkeiten
diese zu kategorisieren und einzuteilen. In der Literatur sind keine einheitlichen und
vollständigen Abgrenzungskriterien zu finden, wie auch obiges Zitat verdeutlicht.
42
Es erscheint im Rahmen dieser Arbeit jedoch als notwendig, einen Versuch der
Einteilung vorzunehmen, um aufzeigen zu können, auf welche Art von Events diese
Arbeit ihre Schwerpunkte setzt. Dieses Wissen gilt als Vorraussetzung um später in
Punkt 2.3.4 auf die zahlreichen Wirkungen von Großveranstaltungen eingehen zu
können.
Eine Möglichkeit ist es, Events nach Ihrer Entstehung, Größe, Dauer,
Regelmäßigkeit und ihrem Anlass bzw. Inhalt einzuteilen.
·
Entstehung
Es wird zwischen künstlichen und natürlichen Events unterschieden.
43
Diese Arbeit
spezialisiert sich auf künstlich inszenierte Events.
·
Größe
Die Größe wird nach Kriterien wie Besucherzahlen, wirtschaftliche Effekte,
Reichweite des Events, Medienkontakte, Übernachtungszahlen, Vorbereitungs-
phase usw. bewertet. Die Größe ist ein wichtiges Kriterium für die Einteilung von
Events und wird oftmals als Entscheidungsgröße für die wirtschaftliche Wirkung
angesehen.
44
Mit der Größe wächst auch die Anzahl der verschiedenen Effekte. Je kleiner die
Veranstaltung ist, desto geringer ist die Vielzahl der Wirkungen und desto höher ist
die Intensität der einzelnen Effekte.
45
41
Getz, 2005, S. 19
42
vgl. Allen, 2005, S.11
43
vgl. Scherhag, 1998, S. 87
44
vgl. Freyer, 2005, S. 63f.; Freyer, 1998, S. 27
45
vgl. Horn, 2005, S. 43
Sportevents 16
Auch hierfür findet man in der Literatur findet keine klaren und einheitlichen
Abgrenzungskriterien. Müller und Stettler bezeichnen beispielsweise eine
Sportveranstaltung dann erst als groß, wenn mindestens einer der Grenzwerte der
Indikatoren - wie in Abbildung 2 ersichtlich - Anzahl der Sportler, Betreuer,
Zuschauer und Veranstaltungsbudget oder mediale Attraktivität übertroffen wird.
Indikatoren zur Abgrenzung
Grenzwert
Anzahl aktiver Sportler
Anzahl Betreuer/Helfer/Funktionäre
Anzahl der Zuschauer
Veranstaltungsbudget
Mediale Attraktivität und Verbreitung (TV)
10.000
1.000
20.000
1 Mio. Schweizer Franken
Direktübertragung/Teilaufzeichnung
durch das Schweizer Fernsehen
Abbildung 2: Indikatoren und Grenzwerte zur Abgrenzung sportlicher
Großveranstaltungen
46
Die vorliegende Arbeit greift auf die Einteilung von Events nach dem Kriterium
Größe in Mega-, Medium- und Mikro-Events zurück. Die in der Literatur
vorherrschenden Definitionen sind jedoch hierbei auch nicht einheitlich und die
Grenzen sind fließend.
Mega-Events
Mega bedeutet groß, doch dies ist eine relative Bedeutung. Wie schon erwähnt,
bestehen in der Literatur keine einheitlichen Abgrenzungskriterien. Mega-Events
werden häufig auch als Hallmark Events oder Special Events bezeichnet. Die
Begriffe sind jeweils im Austausch verwendbar. Als Mega-Events werden
Veranstaltungen wie die Olympischen Spiele, Fußballweltmeisterschaften oder
Weltmessen bezeichnet.
47
Veranstaltungen dieser Art finden nicht nur in der Öffentlichkeit eine besondere
Beachtung, sondern auch die Eventliteratur setzt sich eingehend mit derartigen
Sportgroßveranstaltungen auseinander. Auch die vorliegende Arbeit spezialisiert
ihre Untersuchungen auf diese Kategorie von Events.
46
Quelle: Müller, Stettler, 1999, S. 11
47
vgl. Allen, 2005, S. 12
Sportevents 17
Medium-Events
Diese Art von Events werden häufig auch als Media- oder Medium-Events
bezeichnet. Im Gegensatz zu Mega-Events finden diese oftmals in verschiedenen
Destinationen statt und werden häufig wiederholt.
48
Mini-Events
Mini-Events werden auch als Mikro-Events, Lokale Events, Marktveranstaltungen
oder im englischen Communitiy Events bezeichnet.
49
Sie werden wie folgt definiert als:
"...familyfun events that are considered `owned´ by a community, employ public
venues such as streets, parks and schools and are produced at the direction of local
government agencies or nongovernment organizatons (NGOs) such as service
clubs, public satiety organizations or business associations."
50
Obwohl diese Events keine so große wirtschaftliche Bedeutung und Auswirkung
haben, sind sie aus lokaler Sicht durchaus bedeutend und stellen oftmals die
Höhepunkte des Jahres im lokalen Geschehen dar.
51
Folgende Abbildung stellt als Übersicht nochmals die verschiedenen Eventgrößen
gegenüber und zeigt eine mögliche Einteilungsform. Die weiterführende Arbeit
bezieht sich auf diese Einteilung und spezialisiert ihre Untersuchungen auf die
Kategorie der Mega-Events und Medium-Events.
48
vgl. Freyer, 1998, S. 29
49
vgl. Allen, 2005, S. 14; Freyer, 1998, S. 30
50
Alleen, 2005, S. 14
51
vgl. Freyer, 1998, S. 30
Sportevents 18
KRITERIUM
AUSPRÄGUNG
Größe
Mega-Event
Medium-Event
Mikro-Event
Zuschauer- und
Teilnehmerzahl
Über 40.000
15.000-40.000
Unter 15.000
Reichweite und
Bedeutung
Besucher aus In-
und Ausland
Besucher aus
Inland
Ortsansässige
Besucher
Medieninteresse
Umfangreiche
internationale
Medienberichter-
stattung
Regionale, max.
nationale
Berichterstattung
Regionale
Berichterstattung
Vorbereitungsphase
Mehrjährige
Vorbereitung
1-2 Jahre
Vorbereitung
Kurzfristige
Vorbereitung
Kosten
Hohen Kosten aus
verschiedenen
Budgets finanziert
Aus kommunalen
und regionalen
Budgets finanziert
Private und/oder
kommunale
Finanzierung
Zielgruppe
Einheimische,
Urlauber aus In-
und Ausland
Mehr Einheimische
als Fremde
Überwiegend
Einheimische
Abbildung 3: Kategorisierung von Events nach Ihrer Größe
52
·
Dauer
Egal welche Art von Event, ,,the basic criterion defining all types of event is that they
are temporary."
53
Events können eintägig oder mehrtägig stattfinden. Die meisten Events dauern
jedoch nur einen kurzen Zeitraum, oftmals nur wenige Stunden. Die Dauer von
Veranstaltungen ist ein wichtiges Kriterium für die Wirtschaftlichkeit. Mehrtägige
Events haben höhere Übernachtungsraten und es werden höhere Einnahmen durch
die Ausgaben der Besucher für Gastronomie, Einzelhandel und weiterer Branchen
generiert.
54
·
Regelmäßigkeit
Das Kriterium Regelmäßigkeit lässt sich in die Klassen einmalig, mehrmalig und
dauerhaft einteilen.
Die Häufigkeit einer Veranstaltung ist ein wichtiger Faktor für die Rentabilität von
Investitionen, insbesondere für Entscheidungen für den Auf- und Ausbau von
Sportstätten und anderer Infrastruktur. Findet ein Sportereignis regelmäßig an
52
Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Getz, 2005; Freyer/Groß, 2002; Horn, 2005
53
Getz, 2005, S. 15
54
vgl. Freyer, 1998, S. 27; Getz, 1991, S. 28; Zemann, 2005, S. 91
Sportevents 19
einem bestimmten Ort statt, dann können sich die Investitionen selbst, unabhängig
von der Nachnutzung, amortisieren.
55
·
Anlass bzw. Inhalt
Events können aus den verschiedensten Anlässen, wie aus kulturellen, sportlichen,
wirtschaftlichen und politischen Gründen stattfinden. Kulturelle und sportliche
Events decken hierbei den größten Bereich ab.
Erwähnenswert ist auch, dass die wenigsten Großveranstaltungen aus touristischen
Gründen entstanden sind, jedem Event jedoch mehr oder weniger eine große
touristische Bedeutung zukommt.
56
Hall betont zudem, dass zu den politischen Veranstaltungen nicht nur die
offensichtlich rein politischen Veranstaltungen zählen, sondern fast alle Events
einen politischen Unterton haben.
57
Die große Ausstrahlungskraft und die
emotionalen Mechanismen von Sportgroßveranstaltungen dienen der Politik in
zweierlei Hinsicht: nach innen, als gewisse Ablenkungsfunktion, da ernstere und
wichtigere Dinge für eine bestimmte Zeit in den Hintergrund gerückt werden und
somit soziale Spannungen abgebaut werden können. Zweitens dienen sie der Politik
nach außen als Selbstdarstellung und Aushängeschild für die Leistungsfähigkeit
eines Landes.
58
Je länger ein Event vorbereitet wird, desto mehr treten die eigentlichen Anlässe wie
zum Beispiel Sport oder Kultur in den Hintergrund. Gesamtgesellschaftliche Aspekte
treten in den Vordergrund und der Erfolg wird letztendlich weniger eventspezifisch
bestimmt.
59
Abbildung 4 stellt eine gängige Einteilung von Events nach Ihrem Anlass, bzw.
Inhalt dar und zeigt jeweils die wichtigsten Beispiele auf. Die weiterführende Arbeit
spezialisiert ihre Untersuchungen auf Sportevents.
55
vgl. Freyer, 1998, S. 25; Zemann, 2005, S. 90f.
56
vg. Freyer, 1998, S. 19f.; Freyer, 2005, S. 65ff.; Haase, 2004, S. 80f.
57
vgl. Hall, 1992, S. 84
58
vgl. Brönnimann, 1982, S. 33
59
vgl. Freyer, 2005, S. 72
Sportevents 20
Abbildung 4: Anlässe bzw. Inhalt von Events
60
2.2 Sport
Im Folgenden wird zunächst näher auf die Begrifflichkeit Sport und die besonderen
Charakteristiken des Produktes Sport eingegangen. Um die Bedeutung des Sports
für die Gesellschaft zu bewerten, werden anschließend der Stellenwert des Sports
in der Gesellschaft und ihre Entwicklung näher analysiert.
2.2.1 Definition des Begriffes
,,Sport is why some people get out of bed"
61
Sport lässt sich als ein soziales Phänomen kultureller Art bezeichnen, das sich nicht
autonom definiert, sondern aus dem bilateralen Austausch mit anderen Lebens-
bereichen.
62
60
Quelle: eigene Darstellung, modifiziert nach Freyer, 1998, S. 20
61
Coakley, 2001, S. 1
Sportevents 21
Für das Gesamtphänomen Sport gibt es keine einheitliche Definition, da es sich
zusehends weniger sportoriginär, sondern aus den Wechselwirkungen mit anderen
Teilbereichen der Gesellschaft definiert.
63
Außerdem wird der Begriff Sport je nach
Zeit, Land und Gesellschaft unterschiedlich verstanden. Der Sportbegriff kann enger
oder weiter, leistungs- oder freizeitorientierter gesehen werden. So definiert Freyer
beispielsweise den Sport als das ,,was die Menschen darunter verstehen."
64
Während bis in die siebziger Jahre das Motto ,,schneller, höher, weiter" den
Sportbegriff beschrieb, wird der neue eher mit dem Motto ,,Fit und Fun" verbunden.
Der neue Sportbegriff ist weniger leistungsorientiert, sondern immer mehr lifestyle-
orientiert in Verbindung mit Spaß, Mode und Fitness.
65
Der organisierte Sport
verliert hierbei immer mehr an Bedeutung.
Für die diese Arbeit wird auf die Definition des Europarats zurückgegriffen, welches
den Begriff Sport wie folgt umreißt:
,,Sport are all forms of physical activity which, through casual or organised
participation, aim at expressing or improving physical fitness and well-being,
forming social relationships, or obtain results in competition at all levels"
66
Diese Definition wurde herangezogen, da sie sowohl den Erholungs- und Freizeit-
als auch den Wettbewerbscharakter inkludiert.
Für die vorliegende Diplomarbeit ist es außerdem notwendig, zwischen dem aktiven
und dem passiven Sport zu differenzieren.
Als aktiver Sportkonsum wird die eigenständige sportliche Betätigung verstanden.
Unter dem passiven Sportkonsum versteht man die Verfolgung des Sports im
Stadion, über die Medien oder als ehrenamtliches Mitglied in Sportvereinen.
67
Im
Zusammenhang mit Events wird der Schwerpunkt auf den passiven Sportkonsum
gelegt.
62
vgl. Wernecken, 2000, S. 16
63
vgl. Wernecken, 2000, S. 36
64
Freyer, 2003, S. 44
65
vgl. Freyer, 2002, S. 13
66
Game Plan, 2002, S. 21
67
vgl. Horn, 2005, S. 14f.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2008
- ISBN (eBook)
- 9783836619943
- DOI
- 10.3239/9783836619943
- Dateigröße
- 889 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Management Center Innsbruck Internationale Fachhochschulgesellschaft mbH – Tourismus, Unternehmensführung in der Tourismus- und Freizeitwirtschaft
- Erscheinungsdatum
- 2008 (September)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- stakeholder management events sport großveranstaltungen
- Produktsicherheit
- Diplom.de