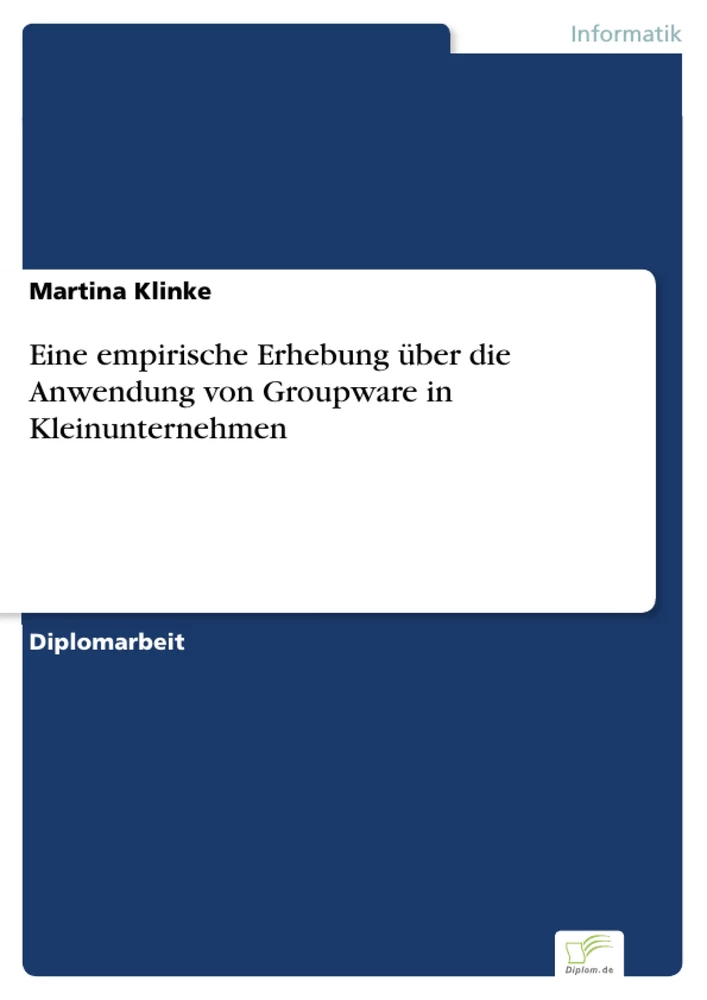Eine empirische Erhebung über die Anwendung von Groupware in Kleinunternehmen
Zusammenfassung
Gruppen- und Teamarbeit stellt eine effiziente Form der Zusammenarbeit in Unternehmen und über Unternehmensgrenzen hinweg dar. Zunehmend läuft diese Form der Zusammenarbeit softwaregestützt über räumliche und zeitliche Distanzen ab. Für den Einzelnen geht es um die Verwaltung von E-Mails und das Pflegen von Kontakten und Terminen. Für das Team geht es um Kommunikation, Kooperation und Koordination. Die Software zur Unterstützung der Zusammenarbeit in einer Gruppe bezeichnet man als Groupware.
In der Regel setzt sich fast jede heute am Markt erhältliche Groupware-Applikation aus zwei Komponenten zusammen: Ein Server hält die Daten an einer zentralen Stelle vor und ein Client stellt dem Anwender die Daten des Servers und lokal gespeicherte Informationen am PC zur Verfügung. Bei Microsoft z. B. bildet das Produkt Exchange den Server und die Anwender greifen über den Client Outlook auf ihre Daten am Arbeitsplatzrechner zu.
Der Groupware-Markt wird heute im Wesentlichen von zwei Herstellern dominiert: Microsoft Exchange mit Outlook und IBM mit Lotus Notes/Domino sind die führenden Anbieter. Die Bemühungen der Anbieter anderer Goupware-Applikationen setzen vor allem an der Server-Komponente an. In der Regel können an diese Lösungen die üblichen Clients wie Microsoft Outlook angebunden werden. Damit können Unternehmen auf der Server-Seite Geld sparen, ohne auf der Client-Seite mit der Akzeptanz der Benutzer kämpfen zu müssen.
Laut einer Berlecon-Studie warten insbesondere Communigate, Ipswitch, Kerio, Open-Xchange und Scalis in Deutschland mit Alternativen zu den großen Anbietern auf. Dr. Joachim Quantz, Senior Analyst bei Berlecon: Nach wie vor dominieren Microsoft Exchange, IBM Lotus Domino und mit einigem Abstand dahinter Novell Groupwise den Markt für Messaging Groupware. In den letzten Jahren haben sich aber eine Reihe von Wettbewerbern etabliert, die gerade für mittelständische Unternehmen interessant sind, da sie kostengünstige und gleichzeitig qualitativ hochwertige Lösungen anbieten.
Literatur- und Praxisbeispiele zum Thema Groupware konzentrierten sich bisher überwiegend auf die Einführung und Umsetzung verschiedener Konzepte in mittleren bis großen Unternehmen.
Nur einige wenige Anbieter richten sich an Kleinunternehmen. Open-Xchange bietet beispielsweise das Basispaket seiner Groupware Open-Xchange Express Edition mit Outlook-Anbindung für 5 Nutzer zu einem Preis von 299 Euro an. Die Auslagerung des […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
INHALTSVERZEICHNIS
Abbildungen
Tabellen
1 Einleitung
1.1 Groupware in Kleinunternehmen
1.2 Gegenstand der Untersuchung
1.3 Aufbau der Arbeit
1.4 Danksagung
2 Begriffsdefinitionen
2.1 Arbeitsgruppe
2.2 Team
2.3 Gruppenprozesse
2.4 Computer Supported Cooperative Work (CSCW)
2.5 Groupware
2.5.1 Synchrone und asynchrone Groupware
2.5.2 Groupwarefunktionen
2.5.3 Groupware in Kleinunternehmen
2.6 Statistische Grundbegriffe
2.6.1 Nominalskala
2.6.2 Ordinalskala
2.6.3 Mittelwert
2.6.4 Standardabweichung
3 Studienaufbau
3.1 Aufbau des Fragebogens
3.2 Online-Fragebogen
3.3 Kann eine Online-Umfrage repräsentativ sein?
3.4 Probandenauswahl
3.5 Datenauswertung
4 Darstellung der Ergebnisse
4.1 Allgemeine Daten zum Unternehmen und der technischen Infrastruktur
4.1.1 Branche
4.1.2 Mitarbeiteranzahl
4.1.3 Computerarbeitsplätze
4.1.4 Internetzugang
4.1.5 Branchenspezifische Anwendungssoftware
4.1.6 Groupware-Einsatz
4.1.7 Groupware-Lösung geplant?
4.2 Groupware-Lösung bereits realisiert
4.2.1 Server
4.2.2 Groupware-Umgebung
4.2.3 Grund der Groupware-Einführung
4.2.4 Groupware-Anforderungen
4.2.5 Kostenverteilung
4.2.6 Funktionsumfang der eingesetzten Groupware-Lösung
4.2.7 Mögliche eigene Applikationen
4.2.8 Nicht erfüllte Anforderungen an die eingesetzte Groupware-Lösung
4.3 Groupware-Einführung geplant
4.3.1 Server
4.3.2 Investition
4.3.3 Kostenverteilung
4.3.4 Erwartete Verbesserungen durch eine Groupware-Einführung
4.3.5 Anforderungen an die geplante Groupware-Lösung
4.3.6 Eigene Applikationen
4.3.7 Funktionsumfang der einzusetzenden Groupware-Lösung
4.4 Ablehnung von Groupware
4.4.1 Grund der Ablehnung
4.5 Zusammenfassung
4.5.1 Branchenzugehörigkeit und Groupware-Einsatz
4.5.2 Dienstleistungs- und Handelsbranche und Groupware-Einführung
4.5.3 Anzahl Mitarbeiter und Groupware-Einsatz
4.5.4 Anzahl Mitarbeiter und Groupware-Einführung geplant?
4.5.5 Anzahl Mitarbeiter und Branchenzugehörigkeit
4.5.6 Internet und Groupware-Einsatz
4.5.7 Internetverbindung über zentralen Server und Groupware-Einsatz
4.5.8 Branchenspezifische Anwendungssoftware und Groupware-Einsatz
4.5.9 Branchenspezifische Anwendungssoftware und Groupware geplant
4.5.10 Grund der Groupware-Einführung (Rang 1) und Anzahl Mitarbeiter
4.5.11 Kostenverteilung (Rang 1) und Groupware-Umgebung
4.5.12 Kostenverteilung (Rang 6) und Groupware-Umgebung
4.5.13 Investition und Anzahl Mitarbeiter
4.5.14 Ablehnungsgründe und Anzahl Mitarbeiter
5 Diskussion
6 Ausblick
Referenzen
Anhang
Anhang 1 Online Fragebogen
Anhang 2 Übersicht über die deskriptiven Statistiken
Abbildungen
Abbildung 1: Gruppenprozesse
Abbildung 2: Synchrone und asynchrone Groupware
Abbildung 3: Branche
Abbildung 4: Anzahl Mitarbeiter
Abbildung 5: Anzahl Computerarbeitsplätze
Abbildung 6: Internetzugang
Abbildung 7: Zusammenfassung Groupware-Einsatz
Abbildung 8: Server für die eingesetzte Groupware-Lösung
Abbildung 9: Grund der Groupware-Einführung (Rang 1)
Abbildung 10: Grund der Groupware-Einführung (Rang 9)
Abbildung 11: Groupware-Anforderungen (Rang 1)
Abbildung 12: Groupware-Anforderungen (Rang 8)
Abbildung 13: Kostenverteilung (Rang 1)
Abbildung 14: Kostenverteilung (Rang 6)
Abbildung 15: Funktionsumfang der eingesetzten Groupware-Lösung 1
Abbildung 16: Funktionsumfang der eingesetzten Groupware-Lösung 2
Abbildung 17: Funktionsumfang der eingesetzten Groupware-Lösung 3
Abbildung 18: Einbindung eigener Applikationen in die Groupware
Abbildung 19: Server für die geplante Groupware-Lösung
Abbildung 20: Investition
Abbildung 21: Kostenverteilung (Rang 1)
Abbildung 22. Kostenverteilung (Rang 6)
Abbildung 23: Erwartete Verbesserungen durch eine Groupware-Einführung (Rang 1)
Abbildung 24: Erwartete Verbesserungen durch eine Groupware-Einführung (Rang 9)
Abbildung 25: Anforderungen an die geplante Groupware-Lösung (Rang 1)
Abbildung 26: Anforderungen an die geplante Groupware-Lösung (Rang 8)
Abbildung 27: Einbindung eigener Applikationen in die geplante Groupware
Abbildung 28: Funktionsumfang der einzusetzenden Groupware-Lösung 1
Abbildung 29: Funktionsumfang der einzusetzenden Groupware-Lösung 2
Abbildung 30: Funktionsumfang der einzusetzenden Groupware-Lösung 3
Abbildung 31: Ablehnungsgründe
Abbildung 32: Branchenzugehörigkeit und Groupware-Einsatz
Abbildung 33: Dienstleistungs- und Handelsbranche und Groupware-Einführung
Abbildung 34: Anzahl Mitarbeiter und Groupware-Einsatz
Abbildung 35: Anzahl Mitarbeiter und Groupware-Einführung geplant?
Abbildung 36: Anzahl Mitarbeiter und Branchenzugehörigkeit
Abbildung 37: Internet und Groupware-Einsatz
Abbildung 38: Internetverbindung über einen zentralen Server und Groupware-Einsatz
Abbildung 39: Branchenspezifische Anwendungssoftware und Groupware-Einsatz
Abbildung 40: Branchenspezifische Anwendungssoftware und Groupware- geplant
Abbildung 41: Grund der Groupware-Einführung (Rang 1) und Anzahl Mitarbeiter
Abbildung 42: Kostenverteilung (Rang 1) und Groupware-Umgebung
Abbildung 43: Kostenverteilung (Rang 6) und Groupware-Umgebung
Abbildung 44: Investition und Anzahl Mitarbeiter
Abbildung 45: Ablehnungsgründe und Anzahl Mitarbeiter
Tabellen
Tabelle 1: Typisierung aufgabenbezogener Tätigkeiten
Tabelle 2: Anzahl Mitarbeiter
Tabelle 3: Anzahl Computerarbeitsplätze
Tabelle 4: Verwendung branchenspezifischer Anwendungssoftware
Tabelle 5: Branchenspezifische Anwendungssoftware
Tabelle 6: Einsatz von Groupware geplant
Tabelle 7: Groupware-Umgebung
Tabelle 8: Kommentare zur Groupware-Umgebung
Tabelle 9: Nicht erfüllte Anforderungen an die eingesetzte Groupware-Lösung
Tabelle 10: Branche
Tabelle 11: Anzahl Mitarbeiter
Tabelle 12: Anzahl Computerarbeitsplätze
Tabelle 13: Arbeitsplätze sind nicht mit dem Internet verbunden
Tabelle 14: Zugang zum Internet nur an privilegierten Arbeitsplätzen
Tabelle 15: Jeder Computer ist mit dem Internet verbunden
Tabelle 16: Realisierung der Internetverbindung über einen zentralen Server
Tabelle 17: Verwendung branchenspezifischer Anwendungssoftware
Tabelle 18: Branchenspezifische Anwendungssoftware
Tabelle 19: Einsatz von Groupware im eigenen Unternehmen
Tabelle 20: Einsatz von Groupware geplant
Tabelle 21: Zusammenfassung Groupware-Einsatz
Tabelle 22: Server für die eingesetzte Groupware-Lösung
Tabelle 23: Groupware-Umgebung
Tabelle 24: Kommentare zur Groupware-Umgebung
Tabelle 25: Grund der Groupware-Einführung (Rang 1)
Tabelle 26: Grund der Groupware-Einführung (Rang 2)
Tabelle 27: Grund der Groupware-Einführung (Rang 3)
Tabelle 28: Grund der Groupware-Einführung (Rang 4)
Tabelle 29: Grund der Groupware-Einführung (Rang 5)
Tabelle 30: Grund der Groupware-Einführung (Rang 6)
Tabelle 31: Grund der Groupware-Einführung (Rang 7)
Tabelle 32: Grund der Groupware-Einführung (Rang 8)
Tabelle 33: Grund der Groupware-Einführung (Rang 9)
Tabelle 34: Groupware-Anforderungen (Rang 1)
Tabelle 35: Groupware-Anforderungen (Rang 2)
Tabelle 36: Groupware-Anforderungen (Rang 3)
Tabelle 37: Groupware-Anforderungen (Rang 4)
Tabelle 38: Groupware-Anforderungen (Rang 5)
Tabelle 39: Groupware-Anforderungen (Rang 6)
Tabelle 40: Groupware-Anforderungen (Rang 7)
Tabelle 41: Groupware-Anforderungen (Rang 8)
Tabelle 42: Kostenverteilung (Rang 1)
Tabelle 43: Kostenverteilung (Rang 2)
Tabelle 44: Kostenverteilung (Rang 3)
Tabelle 45: Kostenverteilung (Rang 4)
Tabelle 46: Kostenverteilung (Rang 5)
Tabelle 47: Kostenverteilung (Rang 6)
Tabelle 48: Funktionsumfang der eingesetzten Groupware-Lösung
Tabelle 49: Einbindung eigener Applikationen in die Groupware
Tabelle 50: Nicht erfüllte Anforderungen an die eingesetzte Groupware-Lösung
Tabelle 51: Server für die geplante Groupware-Lösung
Tabelle 52: Investition
Tabelle 53: Kostenverteilung (Rang 1)
Tabelle 54: Kostenverteilung (Rang 2)
Tabelle 55: Kostenverteilung (Rang 3)
Tabelle 56: Kostenverteilung (Rang 4)
Tabelle 57: Kostenverteilung (Rang 5)
Tabelle 58: Kostenverteilung (Rang 6)
Tabelle 59: Erwartete Verbesserungen durch eine Groupware-Einführung (Rang 1)
Tabelle 60: Erwartete Verbesserungen durch eine Groupware-Einführung (Rang 2)
Tabelle 61: Erwartete Verbesserungen durch eine Groupware-Einführung (Rang 3)
Tabelle 62: Erwartete Verbesserungen durch eine Groupware-Einführung (Rang 4)
Tabelle 63: Erwartete Verbesserungen durch eine Groupware-Einführung (Rang 5)
Tabelle 64: Erwartete Verbesserungen durch eine Groupware-Einführung (Rang 6)
Tabelle 65: Erwartete Verbesserungen durch eine Groupware-Einführung (Rang 7)
Tabelle 66: Erwartete Verbesserungen durch eine Groupware-Einführung (Rang 8)
Tabelle 67: Erwartete Verbesserungen durch eine Groupware-Einführung (Rang 9)
Tabelle 68: Anforderungen an die geplante Groupware-Lösung (Rang 1)
Tabelle 69: Anforderungen an die geplante Groupware-Lösung (Rang 2)
Tabelle 70: Anforderungen an die geplante Groupware-Lösung (Rang 3)
Tabelle 71: Anforderungen an die geplante Groupware-Lösung (Rang 4)
Tabelle 72: Anforderungen an die geplante Groupware-Lösung (Rang 5)
Tabelle 73: Anforderungen an die geplante Groupware-Lösung (Rang 6)
Tabelle 74: Anforderungen an die geplante Groupware-Lösung (Rang 7)
Tabelle 75: Anforderungen an die geplante Groupware-Lösung (Rang 8)
Tabelle 76: Einbindung eigener Applikationen in die geplante Groupware
Tabelle 77: Funktionsumfang der einzusetzenden Groupware-Lösung
Tabelle 78: Ablehnungsgründe
Tabelle 79: Branchenzugehörigkeit und Groupware-Einsatz
Tabelle 80: Dienstleistungs- und Handelsbranche und Groupware-Einführung
Tabelle 81: Anzahl Mitarbeiter und Groupware-Einsatz
Tabelle 82: Anzahl Mitarbeiter und Groupware-Einführung geplant
Tabelle 83: Anzahl Mitarbeiter und Branchenzugehörigkeit
Tabelle 84: Internet und Groupware-Einsatz
Tabelle 85: Internetverbindung über einen zentralen Server und Groupware-Einsatz
Tabelle 86: Branchenspezifische Anwendungssoftware und Groupware-Einsatz
Tabelle 87: Branchenspezifische Anwendungssoftware und Groupware geplant
Tabelle 88: Grund der Groupware-Einführung (Rang 1) und Anzahl Mitarbeiter
Tabelle 89: Kostenverteilung (Rang 1) und Groupware-Umgebung
Tabelle 90: Kostenverteilung (Rang 6) und Groupware-Umgebung
Tabelle 91: Investition und Anzahl Mitarbeiter
Tabelle 92: Ablehnungsgründe und Anzahl Mitarbeiter
1 Einleitung
1.1 Groupware in Kleinunternehmen
Gruppen- und Teamarbeit stellt eine effiziente Form der Zusammenarbeit in Unternehmen und über Unternehmensgrenzen hinweg dar. Zunehmend läuft diese Form der Zusammenarbeit softwaregestützt über räumliche und zeitliche Distanzen ab. Für den Einzelnen geht es um die Verwaltung von E-Mails und das Pflegen von Kontakten und Terminen. Für das Team geht es um Kommunikation, Kooperation und Koordination (vgl. [Gulden, 2007]). Die Software zur Unterstützung der Zusammenarbeit in einer Gruppe bezeichnet man als Groupware.
In der Regel setzt sich fast jede heute am Markt erhältliche Groupware-Applikation aus zwei Komponenten zusammen: Ein Server hält die Daten an einer zentralen Stelle vor und ein Client stellt dem Anwender die Daten des Servers und lokal gespeicherte Informationen am PC zur Verfügung. Bei Microsoft z. B. bildet das Produkt „Exchange“ den Server und die Anwender greifen über den Client „Outlook“ auf ihre Daten am Arbeitsplatzrechner zu (vgl. [computerwoche, 2007]).
Der Groupware-Markt wird heute im Wesentlichen von zwei Herstellern dominiert: Microsoft Exchange mit Outlook und IBM mit Lotus Notes/Domino sind die führenden Anbieter. Die Bemühungen der Anbieter anderer Goupware-Applikationen setzen vor allem an der Server-Komponente an. In der Regel können an diese Lösungen die üblichen Clients wie Microsoft Outlook angebunden werden. Damit können Unternehmen auf der Server-Seite Geld sparen, ohne auf der Client-Seite mit der Akzeptanz der Benutzer kämpfen zu müssen (vgl. [computerwoche, 2007]).
Laut einer Berlecon-Studie 2006 warten insbesondere Communigate, Ipswitch, Kerio, Open-Xchange und Scalis in Deutschland mit Alternativen zu den großen Anbietern auf. Dr. Joachim Quantz, Senior Analyst bei Berlecon: „Nach wie vor dominieren Microsoft Exchange, IBM Lotus Domino und mit einigem Abstand dahinter Novell Groupwise den Markt für Messaging Groupware. In den letzten Jahren haben sich aber eine Reihe von Wettbewerbern etabliert, die gerade für mittelständische Unternehmen interessant sind, da sie kostengünstige und gleichzeitig qualitativ hochwertige Lösungen anbieten.“(vgl. [pcwelt, 2007])
Literatur- und Praxisbeispiele zum Thema Groupware konzentrierten sich bisher überwiegend auf die Einführung und Umsetzung verschiedener Konzepte in mittleren bis großen Unternehmen.
Nur einige wenige Anbieter richten sich an Kleinunternehmen.
Open-Xchange bietet beispielsweise das Basispaket seiner Groupware Open-Xchange Express Edition mit Outlook-Anbindung für 5 Nutzer zu einem Preis von 299 Euro an (vgl. [entwickler-magazin, 2007]). Die Auslagerung des kompletten Messaging-Systems zu einem Webhoster bietet das Angebot MailXchange von der 1 & 1 Internet AG und richtet sich damit ebenfalls an Kleinunternehmer. Es kostet für 100 Nutzer 199 Euro pro Monat; inklusive Outook-Anbindung sind es 299 Euro pro Monat (vgl. [business-und-it, 2007]).
Im Jahr 2005 gab es laut Bundesagentur für Arbeit 1.945.601 Kleinunternehmen bis 50 Beschäftigte und 83.111 Unternehmen mit einer Betriebsgröße ab 50 Beschäftigte in Deutschland (vgl. [wikipedia, 2007]). Trotz dieser Zahlen finden sich in der Literatur nur wenig bis keinerlei Hinweise, welche Erfahrungen bei Kleinunternehmen in der Einführung und Umsetzung von Groupware bestehen.
Kleinunternehmen haben mit anderen Voraussetzungen, Chancen und Risiken umzugehen.
Kennzeichnend für Kleinunternehmen sind Teamarbeit und Innovationsfreudigkeit1. Sie zeichnen sich durch hohes Engagement und Flexibilität der Mitarbeiter aus. Die Einführung und Umsetzung von Groupware-Programmen in Kleinunternehmen kann somit möglich und vor allem auch wirtschaftlich von Bedeutung sein. Gegen eine Einführung von Groupware spricht jedoch, dass die Hierarchie in Kleinunternehmen meist flach ist und daraus folgend der Kontakt der Mitarbeiter untereinander eher direkt erfolgt.
Als Schwächen sind oft fehlende Prozess- und Verfahrensorganisation2 und eine mangelnde formale Regelung von Kommunikations- und Informationsfluss anzuführen (vgl. [Djawarie, 2007]).
1.2 Gegenstand der Untersuchung
Ob kleine Unternehmen Groupware im gleichen Maße einführen und nutzen können wie Großunternehmen ist Zielsetzung dieser Untersuchung. Dem Groupware-Anbieter bzw. Entwickler soll die Auswertung dieser Studie Aufschluss darüber geben, ob ein Groupware-Markt für Kleinunternehmen vorhanden ist oder nicht.
Kleinunternehmen sollen hier als Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern verstanden werden.
Im Einzelnen werden folgende Fragestellungen diskutiert:
- Gibt es Branchen, in denen der Bedarf an einer Groupware-Lösung größer ist als in anderen Branchen? Ist als Konsequenz daraus eine branchen-spezifische Groupware-Lösung möglich?
- Ist es sinnvoll, die Kleinunternehmen nochmals nach Beschäftigtenanzahl zu differenzieren? Hängt die Nutzung von Groupware überhaupt von der Unternehmensgröße ab?
- Besteht ein Zusammenhang zwischen der technischen Ausstattung (Internetverbindung, Server…) der Unternehmen und der Nutzung von Groupware?
- Führen die Unternehmen Groupware ein, um die Kommunikation unter den Mitarbeitern zu verbessern oder zur Produktivitätssteigerung etc.? Welche Gründe haben Kleinunternehmen dazu bewogen, Groupware einzuführen bzw. eine Einführung in Erwägung zu ziehen?
- Auf welche Anforderungen legen die Unternehmen besonderen Wert? Zu nennen wären da z. B. einfache Bedienbarkeit, Flexibilität oder Sicherheit.
- Mit welchen Kosten rechnen Unternehmen bei einer Groupware-Einführung? In wieweit hängt die Kostenverteilung von der eingesetzten Groupware-Lösung ab? Wieviel sind die Kleinunternehmen bereit, in eine Groupware-Lösung zu investieren? Hängt die Investitionsfreudigkeit von der Unternehmensgröße ab?
- Was vermissen die Unternehmen bei ihrer derzeitigen Groupware-Lösung?
- Besteht ein Bedarf an der Einbindung eigener Applikationen in die Groupware?
- Welche Groupware-Funktionen werden von den Unternehmen bereits genutzt, bei welchen Funktionen ist der Einsatz geplant? Zählt ein Gruppen-Terminkalender, ein Dokumentenmanagementsystem, eine Ideenfindung, etc. zur notwendigen Ausstattung?
- Für einige Unternehmen kommt die Einführung von Groupware nicht in Frage. Hängt die Begründung von der Unternehmensgröße oder von der Branchenzugehörigkeit ab?
1.3 Aufbau der Arbeit
Zu Beginn der Arbeit werden einige Grundbegriffe definiert, da sie für das Verständnis der Arbeit von Bedeutung sind. Es folgt der Studienaufbau mit dem Aufbau des Fragebogens und der Erläuterung, warum die Befragung online durchgeführt wird. Das Kapitel endet mit den Teilnahmevoraussetzungen an der Umfrage und der Datenauswertung.
Das nächste Kapitel stellt die Umfrageergebnisse in graphischer und tabellarischer Form vor. In der darauf folgenden Diskussion werden die Ergebnisse besprochen und in einem Ausblick kommentiert. Die Arbeit schließt mit dem Online-Fragebogen in Anhang 1 und einer Übersicht der deskriptiven1 Statistiken in Anhang 2.
1.4 Danksagung
An dieser Stelle möchte ich all jenen danken, die durch ihre fachliche und persönliche Unterstützung zum Gelingen dieser Diplomarbeit beigetragen haben.
Ein besonderer Dank gebührt meiner Familie und Freunden, die großes Interesse für meine Arbeit zeigten und mir dieses Studium durch ihre Unterstützung ermöglicht haben.
Des Weiteren bedanke ich mich bei Herrn Prof. Dr. Frank Victor für die Betreuung meiner Diplomarbeit und die wertvollen Ratschläge und Tipps, die zum Gelingen der Arbeit beigetragen haben. Ein Dankeschön geht auch an Herrn Prof. Dr. Holger Günther als Zweitprüfer dieser Diplomarbeit. Ein ganz besonderer Dank gilt meiner lieben Freundin Hildegard Christ für die fachliche Hilfestellung bei der Auswertung der Umfrage-Ergebnisse. Vielen Dank den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Online-Umfrage für die Zeit und Geduld bei der Beantwortung der Fragen.
Martina Klinke
Marienheide, Februar 2008
2 Begriffsdefinitionen
2.1 Arbeitsgruppe
Eine Arbeitsgruppe ist eine formale Organisationseinheit, bei der mehrere Personen in Form der Gruppenarbeit eine gemeinsame Aufgabe bearbeiten (vgl. [Schulte-Zurhausen, 2002]). Dabei kommt es zu einer gegenseitigen Beeinflussung, die beispielsweise so aussehen kann, dass eine Tätigkeit erst dann in Angriff genommen werden kann, wenn eine Vorleistung von einer anderen Person erbracht wurde oder dass eine bestimmte Tätigkeit nur erledigt werden kann, wenn gleichzeitig von mehreren Personen daran gearbeitet wird (vgl. [Teufel, 1996]).
Die Aufgabenerfüllung bei strukturierten Tätigkeiten erfolgt durch die Arbeitsgruppe nach einem festgelegten Lösungsweg und dadurch meist vergleichsweise träge und unflexibel. Strukturierte Tätigkeiten oder Aufgaben zeichnen sich durch niedrige Komplexität und hohe Planbarkeit aus. Der Informationsbedarf ist vorgegeben und auch die Kommunikationsparameter sind immer gleich bleibend. Am größten ist der Handlungsspielraum für die Arbeitsgruppe bei unstrukturierten Aufgaben, da die Problemstellung, der Informationsbedarf, die Kommunikationsparameter und der Lösungsweg erst im Laufe der Aufgabenerfüllung definiert werden können (vgl. [Hasenkamp, 1996]).
Tabelle 1 gibt einen Überblick der aufgabenbezogenen Tätigkeiten, eingeteilt in 3 Typen nach dem Grad ihrer Strukturierung, entnommen aus [Picot, 1987]:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 1: Typisierung aufgabenbezogener Tätigkeiten
Bei der Betrachtung von Groupware-Systemen zur Unterstützung von Gruppenarbeit sind neben den Besonderheiten des Anwendungsbereiches vor allem die unterschiedlichen Anforderungen dieser Aufgabentypen zu berücksichtigen (vgl. [Hasenkamp, 1996]).
2.2 Team
Teams werden in der Regel nicht zur Erfüllung einer bestimmten Aufgabe sondern zur Erfüllung eines bestimmten Ziels eingesetzt, d. h. die Gruppenmitglieder haben den Willen, dieses zu erreichen. Sie sind meist kleiner als Arbeitsgruppen und geprägt durch intensive wechselseitige Beziehungen und einen starken Zusammenhalt (vgl. [Hasenkamp, 2000]). Mitarbeiter eines Teams engagieren sich nur dann für (gemeinsame) Ziele und fühlen sich für Erfolg oder Misserfolg ihrer Arbeit verantwortlich, wenn ihnen der Sinn ihrer Arbeit klar ist. Verschiedene Groupware-Systeme machen diese Transparenz möglich. Nach der Erfüllung des angestrebten Ziels werden die Teams wieder aufgelöst (vgl. [Gierhake, 2000]).
Folgende Merkmale machen die Notwendigkeit von Teamarbeit deutlich und fordern eine entsprechende organisatorische und technische Unterstützung (vgl. [Gierhake, 2000]):
- Die zur Bearbeitung von Prozessen benötigten Kompetenzen sind häufig auf mehrere Mitarbeiter verteilt, die Abstimmung dieser Kompetenzen ist meist kommunikationsintensiv.
- Es besteht die Notwendigkeit des Zugriffs auf Arbeitsergebnisse von Kollegen.
- Positive Synergieeffekte
- Minimierung von Fehlentscheidungen
- Kreativität fördern
Der Einsatz von Teams birgt jedoch auch einige organisatorische Schwierigkeiten (vgl. [Burger, 1997]):
- Die Teammitglieder haben ihren Arbeitsplatz in unterschiedlichen Abteilungen oder an verschiedenen Standorten.
- Die Teammitglieder verrichten ihre Arbeit zu unterschiedlichen Zeiten.
- Wie sind kooperations- bzw. koordinationsrelevante Informationen zu verwalten?
- Wann und in welchem Umfang sollen Informationen bei den einzelnen Teilnehmern dargestellt werden?
- Wie kann gewährleistet werden, dass sich die bearbeiteten Dokumente und Objekte in einem konsistenten Zustand befinden?
Ansatzpunkte für die Computerunterstützung von Gruppenarbeit liegen in der Verminderung der genannten organisatorischen Schwierigkeiten. Letztlich geht es dabei um die Unterstützung der Gruppenprozesse Kommunikation, Kooperation und Koordination.
2.3 Gruppenprozesse
Zur Ausführung der aufgabenbezogenen – und somit zielorientierten – Tätigkeiten sind bestimmte Gruppenprozesse notwendig, wobei diese Gruppenprozesse in drei Kategorien differenziert werden können (vgl. [Teufel et al, 1996] und [Koster, 1999]):
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Gruppenprozesse
Die Begriffe Kommunikation, Kooperation und Koordination werden wie folgt definiert:
K ommunikation ist die Verständigung mehrerer Personen untereinander (vgl. [Teufel et al, 1996]).
K ooperation bezeichnet jene Kommunikation, die zur Koordination und zur Vereinbarung gemeinsamer Ziele notwendig ist (vgl. [Teufel et al, 1996]).
K oordination baut auf Kommunikation und Kooperation auf. Kommunikation und Kooperation unterstützen lediglich einzelne Teammitglieder. Erst durch die Koordination ist es möglich, vorhandene Ressourcen aufgabengerecht einzusetzen, um so effiziente Teamarbeit zu ermöglichen (vgl. [Gubler, 2007]).
2.4 Computer Supported Cooperative Work (CSCW)
Die Computerunterstützung von Gruppenarbeit ist Schwerpunkt des Forschungsgebiets „Computer Supported Cooperative Work“ (CSCW). Der Begriff „Groupware“ bezeichnet dabei die Produkte, die aus der Disziplin CSCW hervorgehen (vgl. [Hasenkamp, 2000]).
CSCW ist ein in hohem Maße interdisziplinäres Forschungsgebiet, das nach Ellis et al. bereits 1991 wie folgt definiert wurde (vgl. [Werner, 2002]):
“CSCW looks at how groups work and seeks to discover how technology (especially computers) can help them work.”
2.5 Groupware
Die praktische Umsetzung der im CSCW-Forschungsgebiet gewonnenen Erkenntnisse in ein Informations- und Kommunikationssystem, das Teamarbeit unterstützt, wird als Groupware bezeichnet (vgl. [Bornschein-Grass, 1995]).
Groupware ist ein Kunstwort, das sich zusammensetzt aus den englischen Begriffen group und software. Es beschreibt eine Kategorie von Programmen, die die Zusammenarbeit von Arbeitsgruppen in Netzwerken unterstützen sollen, so dass der reibungslose Datenaustausch innerhalb einer Gruppe und zwischen verschiedenen Arbeitsgruppen gewährleistet ist [Linke, 1999].
Die folgenden Definitionen werden üblicherweise benutzt und von den Industrie-Leadern verwendet:
Ray Ozzie, der das Konzept für Lotus Notes entwickelte:
„I use to mean any kind of software that lets people share things or track things with other people. “ [Gubler, 2007]
Franz-Joachim Kauffels:
„Der Begriff GroupWare(!) bezeichnet die Computerunterstützung von Arbeitsgruppen oder Projektteams durch die Nutzung spezieller Hard- und Software, Informations- und Kommunikationsdienste und sonstiger Hilfen beim Gruppenarbeitsprozess im Gegensatz zur IDV (Individuelle Datenbearbeitung).“ [Koch, 1995]
Otto Petrovic:
„Groupware ist weit mehr als nur eine spezielle Art der Software, wie oftmals in kommerziellen Publikationen dargestellt. Vielmehr handelt es sich um eine Kombination spezifischer Hard- und Software.“ [Koch, 1995]
Groupware ist auch eine kollaborative Technologie. Dies bedeutet, dass sie einen Einfluss darüber hat wie die Menschen miteinander kommunizieren; dass es somit auch die Art wie gearbeitet wird oder wie die Unternehmensstruktur eventuell geändert werden muss beeinflusst (vgl. [Pickel et all, 2001]). Wenn Groupware in einer Organisation oder einem Unternehmen eingeführt wird, dann greift diese tief in die Kommunikationsstruktur ein.
2.5.1 Synchrone und asynchrone Groupware
Die Automatisierung von Informationsaustausch kann in real time (synchron) oder in non-real time (asynchron) geschehen (vgl. [Pickel et all, 2001]).
Asynchrone Groupware
Unter asynchroner Groupware versteht man Programme zur Gruppen-Kommunikation, bei denen Sender und Empfänger nicht gleichzeitig miteinander kommunizieren. Die wichtigsten Anwendungen werden in Abbildung 2 vorgestellt.
Synchrone Groupware
Bei der synchronen Groupware kommunizieren verschiedene Sender und Empfänger gleichzeitig, also in Echtzeit. Abbildung 2 aus [Tschanz et al, 2003] gibt einen Überblick über die gängigen Groupware-Arten:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Synchrone und asynchrone Groupware
2.5.2 Groupwarefunktionen
Nachfolgend sollen beispielhaft einige Groupware-Funktionalitäten aus dem Open Source1 Groupware-Tool „egroupware“ vorgestellt werden (vgl. [eGroupWare, 2007]).
Gruppen-Terminkalender
Ein Gruppen-Terminkalender wird eingesetzt, wo mehrere Personen oder Projektteilnehmer (dies können auch externe Unternehmen sein) miteinander kommunizieren. Hier ein paar typische Features2:
- Anderen Usern3 Termine eintragen
- Profilbildung für häufige Personenkombinationen
- Terminplan mehrerer User nebeneinander
- Terminen Anmerkungen, Kontakte und Projekte zuweisen
- Termine als privat oder öffentlich kennzeichnen
- Buchung von Ressourcen (z. B. Räume, Fahrzeuge)
Projektmanagement
Ein Projekt ist ein zeitlich begrenztes Vorhaben, das unternommen wird, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Oftmals sitzen nicht nur interne Mitarbeiter im Projektteam, sondern auch externe Unternehmen. Die Mitarbeiter betreuen mehrere Projekte in unterschiedlichen Rollen und zeitlichem Umfang.
Groupware hilft bei der Koordination der einzelnen Projekte. Die Projekte können effektiv geplant und durchgeführt werden wobei sich jedes Projektmitglied jederzeit über den Projektstand informieren kann. Hier ein paar typische Features:
- Zuweisung von Arbeitsstunden auf laufende Projekte
- Statistikauswertung über gebuchte Stunden
- Kostenauswertung, Warnung bei Budgetüberschreitung
- Aktualisierung des Projektstands durch Projektleiter
- Listendarstellung von Projekten
- Unterprojekte in beliebiger Tiefe darstellbar
- Gantt Diagramm (Zeitlinien)
- Anzeige aller zugehöriger Dateien
Elektronisches Adressbuch
Neben Namen, Adressen und Telefonnummern können in einem Adressbuch auch Informationen über die persönlichen Vorlieben und Gewohnheiten der Kunden, Lieferanten oder Geschäftspartner festgehalten werden. Erfolgt die Adressverwaltung mit Groupware, so fallen Doppelerfassung und lästige Absprachen weg. Z. B. kann Mitarbeiter A sofort erkennen, was Mitarbeiter B als letztes mit dem Kunden X besprochen hat.
Wissensdatenbank
In der Wissensdatenbank können Benutzer Fragen und die dazugehörigen Antworten abspeichern. So kann mit der Zeit ein großes Wissensarchiv geschaffen werden, das Mitarbeitern bei Problemen hilft oder für den Support beim Kunden eingesetzt wird. Fragen können auch ohne Antwort gespeichert werden. Wenn ein anderer Benutzer die Antwort auf die Frage kennt, kann er dann die Antwort verfassen.
Ressourcenverwaltung
Ressourcen wie Räume, Flipcharts, Laptops oder Fahrzeuge, können über die Zuweisung von Terminen gebucht werden. Eine Übersicht aller vorhandenen Ressourcen und die Ansicht über alle gebuchten Ressourcen helfen jedem Mitarbeiter, jederzeit die Übersicht zu behalten.
Neben dem Senden und Empfangen von E-Mails bietet Groupware weitere hilfreiche Features:
- ASCII oder html format, attachments1 anhängen
- Mehrere Konten abfragen
- Fax und SMS2 Support
Todos
In einer ToDo-Liste wird festgehalten, welche Aufgaben anstehen, wer dafür verantwortlich ist und bis wann es erledigt sein muss. Groupware übernimmt die Koordination von Todos. Die User können Todos empfangen und anderen Usern, einem Kontakt oder Projekt zuweisen. Bei Überschreitung der deadline1 erhalten die User einen Hinweis. Sie können Prioritäten vergeben und den aktuellen Fortschritt eintragen. Jeder User kann Todos akzeptieren oder ablehnen.
Reminder
Ein Reminder zeigt alle aktuellen Erinnerungen und Termine in einem kleinen Fenster an, so dass eine echte Zeitplanung möglich ist. Die E-mail Konten können periodisch abgefragt und neue E-mails angezeigt werden. Auf Wunsch wird automatisch eine E-Mail aufs Mobiltelefon geschickt, sobald eine Erinnerung oder Nachverfolgung ansteht.
Dokumentenmanagement
Unter einem Dokumentenmanagement versteht man die Verwaltung ursprünglich meist papiergebundener Dokumente in elektronischen Systemen. Im Dateisystem kann der Anwender nur über Dateiname, ggf. Dateiendung, Größe oder Änderungsdatum suchen. Beim Dokumentenmanagement stehen beliebige Felder zur Verfügung wie z. B. Kundennummer, Auftragsnummer, Betreuer usw. Hier einige beispielhafte Features einer Groupware-Dokumentenverwaltung:
- Bilder, Dokumente, Videos, in einer Datenbank abspeichern
- Versionszählung und Versionierung2
- Zugriffsregelung für eigene Dateien
- Filter für Kategorien und User
- Passwortgeschützte Verschlüsselung
- Optionale Schreibrechte für ausgewählte User
- Benachrichtigung aller Gruppenmitglieder bei Upload
Ideenfindung
Folgende Phasen werden durchlaufen: Problemklärung, Ideenfindung, Ideenbewertung und die Ergebnisanzeige. Die Eingabe und Bewertung erfolgt zeitlich unabhängig und anonym durch die Teammitglieder. Die Auswahl der aktiven Stufe erfolgt durch den Teamleiter.
2.5.3 Groupware in Kleinunternehmen
Was sind Kleinunternehmen?
Als Kleinunternehmen gelten nach dem Handelsgesetzbuch Unternehmen mit weniger als 50 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten, mit einer Bilanzsumme von unter 4,015 Millionen Euro und einem Umsatz pro Jahr von unter 8,030 Millionen Euro (vgl. [wikipedia, 2007]).
Die besonderen Merkmale von Kleinunternehmen sind:
- Flache Hierarchien und daraus folgend mehr direkter Kontakt der Mitarbeiter untereinander.
- Geringer Grad der Formalisierung.
- Häufiger auftretende “horizontale Differenzierung”, d.h. mehrere Führungskräfte teilen sich unstrukturiert ihre Aufgaben.
Kleinunternehmen sind gekennzeichnet durch ihr hohes Engagement der Mitarbeiter, Teamarbeit, Innovationsfreudigkeit und Flexibilität. Als Schwächen wären insbesondere fehlende Prozess- und Verfahrensorganisation, eine mangelnde formale Regelung von Kommunikations- und Informationsfluss, schwankende Produktqualität und mangelhafte Schulung und Weiterbildung anzuführen (vgl. [Djawari, 2007]).
In dieser Arbeit wird auf Kleinunternehmen im Sinne des Handelsgesetzbuches eingegangen, wobei lediglich das Kriterium Mitarbeiterzahl berücksichtigt wurde. Angaben über Bilanzsumme bzw. Umsatz wurden nicht ermittelt.
2.6 Statistische Grundbegriffe
2.6.1 Nominalskala
Die Nominalskala ist eines der Skalenniveaus in der Statistik. Ein Merkmal heißt nominal, wenn seine möglichen Ausprägungen zwar unterschieden, nicht aber in eine Rangfolge gebracht werden können (vgl. [wikipedia, 2007]).
2.6.2 Ordinalskala
Die Werte können geordnet werden, man kann aber keine Abstände zwischen ihnen angeben (z.B. Rangplätze, Schulnoten) (vgl. [members, 2007]).
2.6.3 Mittelwert
Der Mittelwert (das arithmetische Mittel) ist das wichtigste Zentralmaß (vgl. [members, 2007]).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2.6.4 Standardabweichung
Die Standardabweichung ist ein Maß für die Streuung der Werte einer Zufallsvariablen um ihren Mittelwert. Liegt eine Beobachtungsreihe Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten der Länge N vor, so sind empirischer Mittelwert und empirische Standardabweichung die zwei wichtigsten Maßzahlen in der Statistik zur Beschreibung der Eigenschaften der Beobachtungsreihe (vgl. [wikipedia, 2007]).
3 Studienaufbau
3.1 Aufbau des Fragebogens
Der Fragebogen wurde in 4 Fragenkomplexe unterteilt: Die Probanden wurden so durch die Umfrage geführt, dass sie nur die für sie relevanten Fragen beantworten mussten.
Folgende Daten wurden erhoben und entsprechend den Fragenkomplexen zugeordnet:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten1
3.2 Online-Fragebogen
Durch die Übertragung der Erhebungsmethode von Fragebogen in Papierform auf ein anderes Medium, dem Internet ergeben sich methodische und gestalterische Vorteile, die den Ausschlag geben, die Befragung online durchführen zu lassen (vgl. [Hesse, 2006]).
Asynchronität, Alokalität
Ein online zur Verfügung gestellter Fragebogen kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt von den Teilnehmern ausgefüllt werden, die Ergebnisse stehen unmittelbar zur Auswertung zur Verfügung. Dabei spielt es keine Rolle, an welchem Ort sich Teilnehmer und Versuchsleitung befinden (vgl. [Hesse, 2006]).
Automatisierbarkeit der Durchführung und Auswertung
Der Fragebogen muss nicht an die Teilnehmer verteilt oder versendet werden, sondern kann jederzeit einer definierten Gruppe von Teilnehmern zur Verfügung gestellt werden. In technischer Hinsicht können Funktionen implementiert werden, die für Paper-Pencil-Verfahren nicht zur Verfügung stehen. Dies ist z.B. die Anpassung der Fragenreihenfolge und –auswahl durch Filterfunktionen sowie neue Formen von Ratingskalen wie z.B. stufenlose Schieberegler. Die Ergebnisse einer Online-Umfrage können mit entsprechender Software, z.B. dem Statistikprogramm SPSS, weiterverarbeitet werden (vgl. [Hesse, 2006]).
Ökonomie, Objektivität
Ein großer Vorteil von Online-Umfragen ist, dass die aufwändige und häufig fehlerhafte Übertragung der Daten in ein digitales Format entfällt (vgl. [Hesse, 2006]).
Adaptive Frageführung
Bei adaptiver Frageführung macht man den weiteren Verlauf einer Befragung abhängig von den vorherigen Eingaben des Befragten. So kann man Filterfragen verwenden, in denen zunächst nach wichtigen Unterscheidungen gefragt wird. Von diesen Fragen hängt in der Folge ab, welche weiteren Fragen eingeblendet werden. Außerdem kann man, je nach vorhergehenden Antworten, unpassende Antwortmöglichkeiten bei Fragen unterdrücken. Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, dass der Befragungsteilnehmer immer nur jeweils so viele Fragen wie nötig lesen muss und ausschließlich Fragen gestellt bekommt, die auch auf ihn passen (vgl. [Trump, 2007]).
Mit dem Open Source Umfragesystem „LimeSurvey 1.52“ wurde speziell für diese Datenerhebung ein Online-Fragebogen erstellt (vgl. [limesurvey, 2007]) und auf der Internet-Seite: <http://www.voting-online.de/diplomarbeit/umfrage> für 2 Monate aktiviert.
3.3 Repräsentative Online-Umfrage?
Repräsentativ ist eine Umfrage, wenn die Befragten so ausgewählt werden, dass sie die gesamte Bevölkerung repräsentieren oder eben den Teil, dessen Meinungen abgebildet werden soll (vgl. [mdr, 2007]). Große Probleme bestehen bei Erhebungen im Internet, da die Grundgesamtheit1 hier oft nicht abgegrenzt werden kann und da zudem bei der Verwendung passiver Auswahlverfahren das Problem der Selbstselektivität auftritt (vgl. [wikipedia, 2007]).
Eine Online-Auswahl bzw. Online-Rekrutierung der Teilnehmer nach dem Zufallsverfahren ist nicht möglich, da weder eine vollständige und aktuelle Liste aller Internetnutzer vorliegt, noch existieren Websites, deren Besucherstrukturen die gesamte Bevölkerung repräsentieren oder genau den Teil, dessen Meinungen abgebildet werden soll (vgl. [adm-ev, 2007]).
Viel wichtiger als Repräsentativität sind für die Qualität einer Umfrage aber andere Kriterien, wie z. B. die Art der Fragestellung bzw. Ansprache der Befragten. Hiermit könnten bestimmte Antworten nahe gelegt oder ausgeschlossen werden. Bei Ranglisten ist es entscheidend, wie detailliert nachgefragt und wie stark bei der Auswertung differenziert wird (vgl. [mdr, 2007]).
3.4 Probandenauswahl
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Auf der Internet-Seite: <http://www.xing.com/> wurde in diversen Foren um die Teilnahme an der Online-Umfrage gebeten, falls die Voraussetzung des Kleinunternehmertums bis zu 50 Mitarbeitern erfüllt ist. Des Weiteren wurden berufstätige Studenten des Verbundstudiums im Forum der VS-online Seiten <http://online.verbundstudium.de/vso/login.php> um Teilnahme an der Online-Umfrage gebeten.
3.5 Datenauswertung
Die Auswertung der Daten wurde mit der Analyse-Software SPSS Version 14.0.2 durchgeführt. Der Datensatz wurde bei nominal und ordinal skalierten Daten durch
Häufigkeitstabellen und Balkendiagrammen beschrieben . Für metrisch skalierte Daten wurden als statistische Kenngrößen Mittelwerte und Standard-abweichungen eingesetzt, die graphische Darstellung erfolgte durch Histogramme.
Bei den Prozentangaben handelt es sich immer um die gültigen Prozente, d. h. diejenigen Probanden, bei denen eine gültige Antwort vorlag, wurde auf
100 % gesetzt.
4 Darstellung der Ergebnisse
Es lagen 123 ausgefüllte Fragebögen vor wovon 38 Fragebögen nicht verwendet werden konnten. Davon lieferten 16 Fragebögen unsinnige, nicht auswertbare Ergebnisse. Bei 22 Fragebögen lag die Anzahl der Mitarbeiter im Unternehmen über 50 Personen.
Aufgrund der in Kapitel 3.3 genannten Gründe handelt es sich um eine nicht repräsentative Online-Umfrage.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4.1 Allgemeine Daten zum Unternehmen und der technischen Infrastruktur
4.1.1 Branche
85 (100 %) Unternehmen nahmen an der Umfrage teil. 4 (4,7 %) Unternehmen gehörten der Branche „Bildung + Wissen“ an. 55 (64,7 %) Unternehmen zählten zur Dienstleistungsbranche. 10 (11,8%) Unternehmen waren Handelsunternehmen, 3 (3,5%) Handwerksbetriebe, 6 (7,1 %) Produktionsbetriebe und 7 (8,2%) Unternehmen gaben Sonstige als Branche an (vgl. Abbildung 3).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Branche
4.1.2 Mitarbeiteranzahl
Im Durchschnitt beschäftigen die Unternehmen 19 ± 16 Mitarbeiter. Die Beschäftigungsanzahl variierte zwischen 1 und 50 Personen (vgl. Tabelle 2 und Abbildung 4).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 2: Anzahl Mitarbeiter
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4: Anzahl Mitarbeiter
4.1.3 Computerarbeitsplätze
Im Mittel waren die befragten Unternehmen mit 18 ± 16 Computerarbeitsplätzen ausgestattet mit einem Minimum von 2 und einem Maximum von 55 Computerarbeitsplätzen (vgl. Tabelle 3 und Abbildung 5).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 3: Anzahl Computerarbeitsplätze
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 5: Anzahl Computerarbeitsplätze
[...]
1 Innovation heißt wörtlich „Erneuerung“.
2 In einer Prozessorganisation ist ein Unternehmen nach durchgehenden Geschäftsprozessen organisiert.
1 Eine Menge von beobachteten Daten wird summarisch dargestellt. Quelle: < http://de.wikipedia. org/wiki/Deskriptive_Statistik http > (19.12.2007)
1 Open Source ist die Software, deren Lizenzverträge den folgenden drei charakteristischen Merkmalen entsprechen: 1. Der Quelltext liegt in einer für den Menschen lesbaren und verständlichen Form vor. 2. Die Software darf beliebig kopiert, verbreitet und genutzt werden. 3. Die Software darf verändert und in der veränderten Form weitergegeben werden. Quelle: <http://de.wikipedia.org/wiki/Open_Source> (18.08.07)
2 Funktionalität
3 Anwender, Benutzer
1 Anhang an eine Mail, der Dateien, Bilder oder andere Daten enthalten kann.
2 Short Message Service ist ein Telekommunikationsdienst zur Übertragung von Textnachrichten.
1 ein festgelegter Termin, bis zu dem etwas erledigt werden soll.
2 In der Softwareentwicklung stellen Versionen die Veränderung und Weiterentwicklung einer Software oder eines Teils einer Software über die Zeit dar. Quelle: <http://de.wikipedia. org/wiki/Version_%28Software%29> (11.12.07)
1 Ein Computerprogramm, das eine für den Anwender nützliche Funktion ausführt.
1 Die Menge aller potentiellen Untersuchungsobjekte für eine bestimmte Fragestellung. Quelle: < http://de.wikipedia.org/wiki/GrundgesamtheitGrundgesamtheit > (10.01.08)
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2008
- ISBN (eBook)
- 9783836611671
- DOI
- 10.3239/9783836611671
- Dateigröße
- 836 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Technische Hochschule Köln, ehem. Fachhochschule Köln – Informatik, Wirtschaftsinformatik
- Erscheinungsdatum
- 2008 (April)
- Note
- 1,7
- Schlagworte
- online-umfrage groupware kleinunternehmen computer supported cooperative work wirtschaftsinformatik
- Produktsicherheit
- Diplom.de