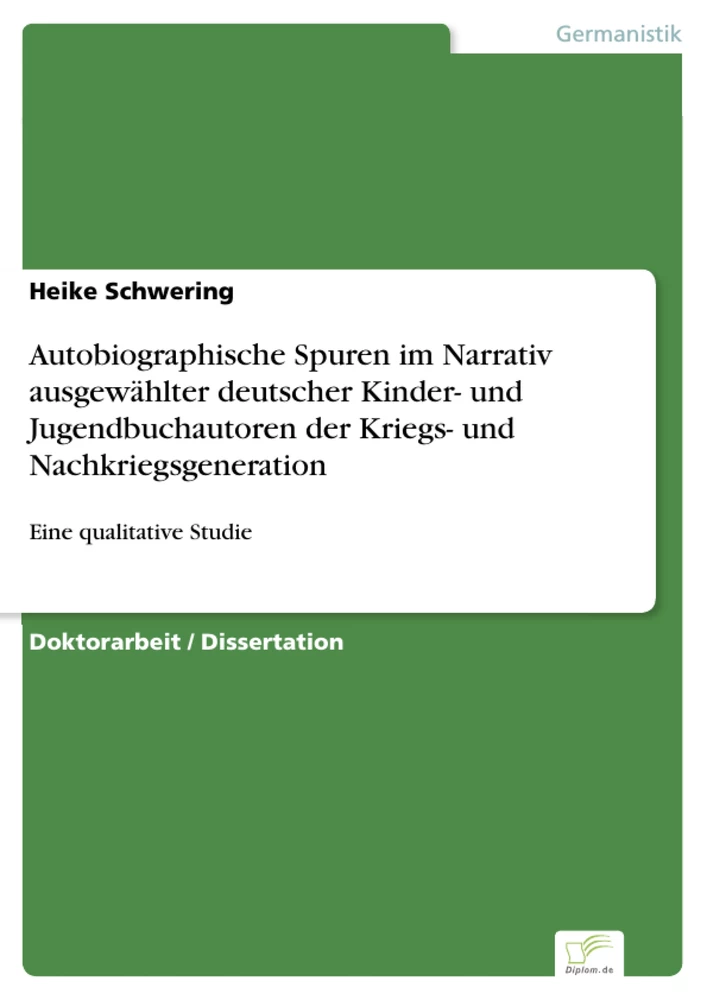Autobiographische Spuren im Narrativ ausgewählter deutscher Kinder- und Jugendbuchautoren der Kriegs- und Nachkriegsgeneration
Eine qualitative Studie
Zusammenfassung
Erstens Der Autor als Individuum mit seiner Geschichte: Die Dissertation soll die sechs ausgewählten Autoren und Autorinnen von zeitgeschichtlicher Kinder- und Jugendliteratur als Personen mit ihren ganz individuellen biographischen Hintergründen abbilden, und hierdurch ein bisher bekanntes Datenspektrum durch neue Erkenntnisse und Informationen ergänzen und vertiefen. Die gewonnenen Erkenntnisse gehen explizit aus den Aussagen (Interviews) der Autoren hervor und sind als authentisches wie gegenstandsangemessenes Material anzusehen. In diesem Zusammenhang erfolgt eine Vernetzung von Autoren- und Werkbiographie.
Zweitens Die Generation der Kriegs- und Nachkriegsautoren: Über die intensive Auseinandersetzung mit jeder Einzelperson hinaus wird eine Annäherung an die Auswirkungen von Kriegskindheit- und Jugend im Kontext von Persönlichkeitsentwicklung- und Identitätsfindung angestrebt. Hierbei geht es u.a. um die Bedeutung des Eltern-Kind-Verhältnisses sowie um weitere prägende Faktoren wie die eigene Lesebiographie und die gesellschaftliche wie soziale Position. Am Ende sollen im Fallvergleich zentrale Themen herausgestellt werden, die charakteristisch für Kinder- und Jugendbuchtautoren dieser Generation sind, und somit eine zentrale Aussage über biographische Verläufe zulässt, ohne dabei generalisierende wie pauschalisierende Übertragungen vornehmen zu wollen.
Drittens Aktueller Forschungsstand: Die vorliegende Arbeit stellt die Entwicklung wie den aktuellen Forschungsstand der zeitgeschichtlichen Kinder- und Jugendliteratur in Verbindung mit den neuesten Erkenntnissen zur Kindheitsforschung, insbesondere die der Kriegs- und Nachkriegskindheiten dar. Darüber hinaus geht es um die Beziehung zwischen Autor und Leser im Sinne eines autobiographischen Paktes.
Viertens Eine interdisziplinäre Triangulierung: Der gesamte Forschungsprozess im Rahmen qualitativer Sozialforschung soll eine interdisziplinäre Brücke zwischen den Sozial- und Geisteswissenschaften schlagen. D.h. durch die intensive Darstellung des thematischen Kodierens nach STRAUSS und CORBIN an sechs Fallbeispielen von Autoren der Kinder- und Jugendliteratur wird ein methodischer Weg aufgezeigt, der einen gegenstandsangemessenen Zugang ermöglicht. Die analysierten und kategorisierten Daten können zu veränderten, erweiterten oder gar neuen Sichtweisen auf literarische Texte der interviewten Schriftsteller führen, und darüber hinaus zu einem […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhalt
Persönliche Worte
I. KAPITEL
Einleitung
1.1 Der Versuch über eine interdisziplinäre Triangulierung
1.2 Zielsetzung und Fragestellung
1.3 Gang der Darstellung
II. KAPITEL
Autoren zeitgeschichtlicher Kinder- und Jugendliteratur - Zwischen Biographie, Autobiographie und dem Autobiographischen
2.1 Die Biographie
2.2 Die Autobiographie
2.2.1 Kurzer Abriss zur Historie und Wandel der Autobiographie
2.2.2 Die Autobiographie - Wirklichkeit, Wahrheit und Wahrhaftigkeit
2.3 Der Autor und das Autobiographische
2.4 ZUSAMMENFASSUNG
III. KAPITEL
Das zeitgeschichtliche Kinder- und Jugendbuch im Gesamtkontext der Kinder- und Jugendliteratur
3.1 Kinder- und Jugendliteratur – Gegenstandseingrenzungen auf der literarischen Handlungsebene
3.2 Die Geschichte der Kindheit und der Kinder- und Jugendliteratur
3.3 Kinder- und Jugendliteratur nach 1945: Heile Welt bis Holocaust
3.3.1 Die zeitgeschichtliche Kinder- und Jugendliteratur
3.3.2 Die Spezies Kinder- und Jugendbuchautor
3.4 ZUSAMMENFASSUNG
IV. KAPITEL
Der Forschungsansatz – oder das weite Feld der biographischen Forschung
4.1 Begriffsbestimmung „Biographische Forschung“
4.2 Historische Entwicklung der biographischen Forschung
4.3 Sechs charakteristische Forschungsziele – „Sechs Augen des Forschers“
4.4 ZUSAMMENFASSUNG
V. KAPITEL
Das methodische Vorgehen
5.1 Datengenerierung
5.1.1 Grounded Theory
5.1.2 Der Forscher
5.1.3 Auswahlkriterien und Kontaktaufnahme
5.1.4 Technische Vorbereitung
5.1.5 Das narrative Interview – Rekonstruktion von Lebenskonstruktion als Stehgreiferzählung
5.1.6 Der Interviewleitfaden – Struktur für das Narrativ
5.1.7 Biographische Wendepunkte – Struktur für den Interviewleitfaden
5.2 Vom Tonträger auf das Papier
5.2.1 Transkription
5.2.2 Dokumentationsbogen
5.2.3 Feldnotizen
5.3 ZUSAMMENFASSUNG
VI. KAPITEL
Praktische Schritte im methodischen Vorgehen
6.1 Das thematische Kodieren in Anlehnung an STRAUSS / CORBIN
6.1.1 Offenes Kodieren
6.1.2 Axiales Kodieren
6.1.3 Selektives Kodieren
6.1.4 Komparative Analyse
6.2 Theorieentwicklung
6.2.1 Gegenstandsbezogene Theorien
6.2.2 Formale Theorien
6.3 ZUSAMMENFASSUNG
VII. KAPITEL
Sechs Autoren zeitgeschichtlicher Kinder- und Jugendliteratur – ihre Geschichte, ihre Geschichten und die Geschichte
7.1 Kurze Einführung in die Untersuchung
7.2 Dagmar Chidolue (1944) Das ewige Flüchtlingskind in mir 105
7.2.1 Identifikation zentraler Themen
7.2.1.1 Nachkriegszeit: zwischen Angst und Abenteuer
7.2.1.2 Der Fluch auf uns Flüchtlingen
7.2.1.3 Mein fremder, ferner Vater
7.2.1.4 Der wache Blick
7.2.2 ZUSAMMENFASSUNG /Analyse
7.3 Gudrun Pausewang (1928) Mein harter, langer Kampf
7.3.1 Identifikation zentraler Themen
7.3.1.1 Außenseiterfamilie – Außenseiterkind
7.3.1.2 Traurige (Kriegs-)Jugend
7.3.1.3 Hörige Vertraute der Mutter
7.3.1.4 Im Kampf gegen das Vergessen – Das Selbst und die Gesellschaft
7.3.2 ZUSAMMENFASSUNG / Analyse
7.4 Waldtraut Lewin (1937)Die Musen an der Wiege – mein Schicksal
7.4.1 Identifikation zentraler Themen
7.4.1.1 Die Kindheit der Bilder
7.4.1.2 Die fortgesetzte Freiheit der Mutter
7.4.1.3 Die Außenseiterin in Parallelwelten
7.4.2 ZUSAMMENFASSUNG / Analyse
7.5 Michail Krausnick (1943) Der politische Autodidakt auf der Suche nach seiner Wahrheit 177
7.5.1 Identifikation zentraler Themen
7.5.1.1 Scheidungskind ohne väterlichen Kriegshelden
7.5.1.2 Vom naiven (Christ-)Kind zum politischen Kritiker
7.5.1.3 Bilder, Geschichten und Fakten gegen die Verdrängung – für die eigene Seele
7.5.2 ZUSAMMENFASSUNG / Analyse
7.6 Paul Maar (1937) Trostbücher gegen (m)eine traurige Kindheit 198
7.6.1 Identifikation zentraler Themen
7.6.1.1 Glückliche Kindheit ohne Vater
7.6.1.2 Eine unglückselige Konstellation: Kriegsversehrter Vater – ungeliebter Sohn
7.6.1.3 Zum Heil durch Sprache und Phantasie
7.6.2 ZUSAMMENFASSUNG / Analyse
7.7 Willi Fährmann (1929) Geschichten zwischen Weinen und Lachen - und Gott als roter Faden
7.7.1 Identifikation zentraler Themen
7.7.1.1 Heile Kindheit – kaputte Zeit
7.7.1.2 Ein erzähltes Leben – Ein Leben der Erzählungen
7.7.1.3 Schreiben als Einzelbeitrag für eine bessere Welt – und für sich selbst
7.7.2 ZUSAMMENFASSUNG / Analyse
VIII. KAPITEL Zusammenfassende Diskussion der Ergebnisse
8.1 Fallvergleichende Analyse
8.2 Ergebnis-Essenz
IX. KAPITEL Schlussbetrachtung und Ausblick
X. KAPITEL LITERATURVERZEICHNIS
Abbildungen
Abb. 1: Die interdisziplinäre Triangulierung
Abb. 2: Die fünf Prozessstufen des Erinnerns nach Schulze
Abb. 3: Die wissenschaftsgeschichtlichen Wurzeln der biographischen Forschung
Abb. 4: Die sechs Augen des biographischen Forschers
Abb. 5: Die vier Säulen der theoretischen Sensibilität
Abb. 6: Struktur und Ablauf des narrativen Interviews
Abb. 7: Das thematische Kodieren
Abb. 8: Identifikation / Integration einer Kernkategorie
Abb. 9: Dagmar Chidolue – Vier autobiographische Ebenen
Abb. 10: Gudrun Pausewang – Vier autobiographische Ebenen
Abb. 11: Waldtraut Lewin – Drei autobiographische Ebenen
Abb. 12: Michail Krausnick – Drei autobiographische Ebenen
Abb. 13: Paul Maar – Drei autobiographische Ebenen
Abb. 14: Willi Fährmann – Drei autobiographische Ebenen
Abb. 15: Vom allgemeinen Motto zu den zentralen Kernkategorien – der komplexe Forschungsprozess
Persönliche Worte
Soweit ich mich erinnern kann, waren es immer Menschen und Bücher, denen mein besonderes Interesse galt. Mich im Rahmen dieser Dissertation mit Menschen zu beschäftigen, die Kinder- und Jugendbücher schreiben, ist mir, neben allem wissenschaftlichen Interesse, eine große Freude wie persönliche Bereicherung gewesen. Daher rührte auch bis zum Ende, bei allen Irrungen und Wirrungen des Schreibens, die solch ein Vorhaben auch mit sich bringt, ein unerschütterliches Vertrauen in die Themenwahl. Ich wage zu behaupten, dass nur wenige thematische Alternativen mein ehrliches wie aufrechtes Interesse über diesen Zeitraum so hätten fesseln können. Doch das allein reicht nicht aus.
In diesem Zusammenhang gilt mein besonderer Dank den sechs Autorinnen und Autoren Gudrun Pausewang, Dagmar Chidolue, Waldtraut Lewin, Michail Krausnick, Paul Maar und Willi Fährmann. Ohne ihre Gesprächsbereitschaft und ihre Offenheit hätte diese Arbeit nicht entstehen können. Jede Begegnung war etwas eigenes, hat mich sehr angerührt und wird mir noch lange in Erinnerung bleiben. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Biographien der sechs Autoren konnte wiederum nur durch die intellektuelle und institutionelle Unterstützung von Herbert Schulte erfolgen. Seine leise doch gezielte Betreuung war fachlich wertvoll und menschlich eine Bereicherung. Dafür bin ich ihm aufrichtig dankbar. Auch die Professoren Franz Breuer und Peter Heitkämper haben hilfreich zu der methodischen wie formalen Ausgestaltung dieses Vorhabens beigetragen. Durch meine „kritische Vorleserin“ und Freundin Monica Leuer-Rose habe ich gelernt, wissenschaftliche Texte auditiv wahrzunehmen und zu verarbeiten. Eine großartige wie inspirierende Erfahrung! Lisa Kreft und Peter Lienkamp bin ich in Freundschaft und Dank verbunden für ihre unermüdliche Unterstützung und fortwährende Lesebereitschaft. Mein Mann hat die Zeit des Schreibens, einhergehend mit unsteten Launen, unerträglicher Euphorie sowie einer bisweilen latenten Geistesabwesenheit mit Geduld und Liebe getragen. Das tat gut.
Mein letzter Gedanke sei Bobby Flokati gewidmet, den ich bis zu seinem letzten Herzschlag treu an meiner Seite wusste.
„Die Taten unseres Lebens, die wir die guten nennen
und von denen zu erzählen uns leicht fällt,
sind fast alle von jener ersten ‚leichten’ Art,
und wir vergessen sie leicht.
Andere Taten, von denen zu sprechen uns Mühe macht,
vergessen wir nie mehr,
sie sind gewissermaßen mehr unser als andere,
und ihre Schatten fallen lang
über alle Tage unseres Lebens.“
(H. Hesse, 1918)
I. KAPITEL Einleitung
Um Schatten, die einen Menschen ein Leben lang begleiten, bedecken, verstecken und bisweilen auch schützen, soll es im Folgenden gehen. Schatten, die sich auf subtile Art und Weise immer wieder aufs Neue in Gegenwart und Zukunft schleichen und das Licht verdecken, welches durch die Distanz zum Geschehenen eine Berechtigung auf Geltung einfordert. Diese Schatten schreien nach Reflexion und Verarbeitung, wollen sich registriert wissen, und strafen bei Ignoranz mit Verdunkelung der Seele. Ein jeder Mensch sieht sich in der Auseinandersetzung mit der eigenen Biographie mit ebendiesen dunklen Seiten, problematischen Lebensphasen wie biographischen Wendepunkten konfrontiert. Der innere wie äußere Disput kann hierbei gewiss in unterschiedlicher Form und auf verschiedenen Ebenen vollzogen werden. Die Vermutung liegt nahe, dass die Schatten der Kriegs- und Nachkriegszeit in diesem Kontext insofern einer besonderen Beschäftigung bedürfen, als dass sie einhergehen mit der faktischen Zeitgeschichte.
1.1 Der Versuch über eine interdisziplinäre Triangulierung
„Zeitzeugen des NS-Regimes gehören heute zu den ältesten Mitgliedern unserer Gesellschaft. Sie hatten 60 Jahre Zeit, Abstand von jener Zeit zu nehmen und über sie nachzudenken, zu reflektieren. Zeit genug, um Erkenntnisse zu sammeln und Konsequenzen zu ziehen. Viele von ihnen haben diese immer größer werdende zeitliche Distanz genutzt, andere ließen sie ungenutzt verstreichen, wieder andere haben sich nie von ihr distanziert“ (Wilcke (Pausewang) 2005, 21). Im Rahmen dieser Arbeit findet jene Gruppe von Zeitzeugen Beachtung, die nach vielen Jahren der Verdrängung und inneren Emigration den Mut zur Reflexion gefunden sowie die Notwendigkeit der Vergangenheitsbewältigung letztlich zu einer Tugend hat werden lassen: Gemeint sind die Autoren von zeitgeschichtlicher Kinder- und Jugendliteratur, hier stellvertretend sechs ausgewählte Repräsentanten dieses Genres. Alle haben gemein, ihre Kindheit bzw. Jugend in der Kriegs- und Nachkriegszeit erlebt zu haben und sich im Laufe ihres Schriftstellerdaseins mit unterschiedlicher Gewichtung wie Intention, bewusst wie unbewusst mit ebendieser Zeit im Narrativ auseinandergesetzt zu haben. Kinder- und Jugendbuchautoren, Krieg, Kindheit und Jugend, Erinnerung, (zeitgeschichtliche) Kinder- und Jugendliteratur: Diese Schlagworte stehen charakteristisch für die thematische Fokussierung dieses Forschungsprojekts. Weder die Erziehungswissenschaft, die Literaturwissenschaft noch die Psychologie allein würde ihnen intradisziplinär gerecht werden bzw. könnten Anspruch auf ganzheitliche Untersuchung der Interdependenz von Autoren- und Werkbiographie erheben. Soll doch primär der Mensch als Individuum, als Subjekt seines Erlebens gesehen werden, um im zweiten Schritt zu rekonstruieren, inwieweit sich bestimmte biographische Ereignisse im Narrativ wiederfinden. Es werden also keine interpretativen Rückschlüsse von dem Text auf Leben und Persönlichkeit des Autoren gezogen. Sondern vielmehr wird im Rahmen biographischer Forschung durch die Erarbeitung biographischen Hintergrundwissens ein autobiographiebasierter Zugang zum Text intendiert. Die wissenschaftsgeschichtlichen Wurzeln der biographischen Forschung finden sich sowohl in Goethes „Dichtung und Wahrheit“ und dem damit verbundenen Interesse an der Persönlichkeitswerdung im Entwicklungsroman wieder, als auch in der Psychologie / Psychiatrie mit dem Interesse an individuellen Lebensläufen und Lebensgeschichten (Fuchs-Heinritz 2005, 85). Weiter setzen sie sich fort in den Sozialwissenschaften mit der Untersuchung von Schichten, Gruppierungen und Milieus und finden sich gleichermaßen in der erziehungswissenschaftlichen Biographiearbeit (u.a. Kraul u. Marotzki 2002) wieder. Daraus resultiert das Anliegen einer interdisziplinären Triangulierung für diese Arbeit, im Sinne einer Authentizität im Umgang mit erzählter wie erlebter Lebensgeschichte, sowohl im Hinblick auf entwicklungspsychologische Aspekte der Kriegskindheit – und Jugend als auch einer literaturwissenschaftlichen Betrachtungsweise ebendieser.
Folgende Abbildung illustriert den Forschungsansatz:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Die interdisziplinäre Triangulierung
Ist die biographische Forschung in den Sozialwissenschaften aus primärem Interesse an den sozialen Unterschichten und Arbeitermilieus als ein methodisch-verzweigtes Nebensystem (Fuchs-Heinritz, 2005, 85) gewachsen, so ist sie doch auch für die folgende Erhebung von Autorenbiographien ein adäquates Instrument. Unabhängig von Herkunft und Bildung bleibt, „...dass nur das Individuum selbst Zeuge seines Verhaltens im natürlichen Ablauf seines Lebens ist.“ (Thomae 1968, 111). Aus diesem Grund wird hier der Frage nach den autobiographischen Einflüssen auf das Narrativ nicht primär im Narrativ, sondern in direkter Kommunikation mit den entsprechenden Personen nachgegangen. Zeitzeugengespräche sind unwiederbringliche Dokumente wie Dokumentationen von subjektiven Erinnerungen, die in objektiv historische Prozesse eingebettet sind. Die Autorin Mirjam Pressler in einem Interview: „Fast jedes meiner Bücher basiert auf persönlichen Erfahrungen, aber kein Einziges ist wirklich autobiographisch.“ (Pressler 2001, 51/52). Diese Aussage von M. Pressler wirft einmal mehr die Frage nach der erzählten und tatsächlich erlebten Lebensgeschichte auf, welcher im weiteren Verlauf nachgegangen werden soll. Denn Erinnerung geht nicht selten einher mit Veränderung, Verdrängung, Verfälschung und Vergessen. Welche Erfahrungen lassen einen Schriftsteller schreiben, ferner bewusst wie unbewusst das ICH mit einfließen, und welche Dimension hat in diesem Kontext die emotionale Beteiligung durch (lebens-) geschichtliche Erinnerung? Gibt es Lebensphasen oder biographische Wendepunkte, die das Schreiben insbesondere autobiographisch prägen? Sechs Interviews mit ausgewählten, bekannten deutschen Autoren der Kinder- und Jugendliteratur stellen primär den Menschen und seine Lebensgeschichte in den Vordergrund, um Antworten auf o.g. Fragen zu finden. Hierbei erfolgt sowohl eine intensive Auseinandersetzung mit Leben und Werk eines jeden einzelnen Schriftstellers, als auch die Analyse der Summe individueller Erkenntnisse über eine Autorengeneration, die sich schließlich in einer Schnittmenge zentraler Themen aller untersuchten Biographien wiederfindet, und eine Aussage über vergleichbare biographische Verläufe anstrebt. Nicht zuletzt weil alle Interviewpartner gemein haben, dass ihre Bücher, Geschichten, Gedichte seit vielen Jahren als Klassenlektüren in den Schulen pädagogisch verbreitet und verarbeitet werden. Sowie die Untersuchung hervorbringen wird, von welch großer Relevanz die eigene Lesebiographie der Autoren für die Weiterentwicklung war, ist Kinderbüchern eine signifikante Bedeutung für Identifikations- wie Bewusstseinsprozesse zuzuschreiben. „Kinderbücher stempeln Muster in Kinderköpfe, die nie wieder weg gehen. Kinderbücher sind Heimat, sind Erinnerungen der Zukunft und erlebte Politik“ (Paxmann 2005, 9). Für die Erziehungswissenschaft, im Speziellen den didaktischen Umgang und die Aufarbeitung von Kinder- und Jugendliteratur im Unterricht wird eine veränderte Perspektive auf das Narrativ intendiert: Weg von der gegenstandsbezogenen geschichtlichen Belehrung, hin zur Leserorientierung und Authentizität des Autors.[1] Um diese für den Leser transparent zu machen, bedarf es jedoch einer gewissen Bereitschaft von Seiten des Autoren, sich seiner Leserschaft zu offenbaren. Auch eine kritische Auseinandersetzung mit der Positionierung von Kinder- und Jugendbuchautoren im literarischen Gesamtkontext muss angesprochen werden, wenn es um die Weitergabe lebensgeschichtlicher Erinnerung geht. „Wenn wir lernen, autobiographische Geschichten zu erzählen, lernen wir nicht nur, wie solche Geschichten eingeleitet werden, was eine zeitliche Chronologie ist oder welche Kriterien für narrative Kohärenz und Plausibilität gelten. Wir lernen auch, bei welchen Gelegenheiten man autobiographische Geschichten erzählt und wann es unpassend ist, wem man etwas erzählen kann und was man wann und wem besser verschweigt, man lernt Unterschiede zwischen Privatem und Öffentlichem, zwischen Inoffiziellem und Offiziellem, zwischen Wahrheit und Lüge. Wir machen uns, mit anderen Worten, kulturelle Konventionen und soziale Normen zu Eigen...“ (Tschuggnall 2004, 11). Die Gespräche mit Dagmar Chidolue, Gudrun Pausewang, Waldtraut Lewin, Michail Krausnick, Paul Maar und Willi Fährmann haben, neben vielen anderen Erkenntnissen deutlich gemacht, dass sich Autoren im Rahmen autobiographischen Erzählens einer Gratwanderung zwischen den o.g. Parametern aussetzen: Zum einen können sie grundsätzlich entscheiden, was, wie viel und ob sie den Leser grundsätzlich an der eigenen Lebensgeschichte Anteil nehmen lassen wollen. Zum anderen laufen unterschiedliche Verarbeitungsprozesse im Unterbewusstein ab und sind rational gar nicht steuerbar. Im Ergebnis bleibt die Frage nach individuellen Einschnitten wie parallelen Einflussfaktoren auf das Narrativ, unabhängig davon, ob bewusst oder unbewusst in den Text eingeflossen. Hierbei geht es weniger darum, ob eine autobiographische Erzählung das in sprachliche Form gegossene Ergebnis eines Gedächtnisprozesses ist, oder aber das Erzählen selber erst das Gedächtnis konstituiert. Vielmehr geht es darum, welche Lebensphasen bzw. Entwicklungsprozesse das Verhältnis von Kognition, Sprache und Erinnerung konstituieren und verändern. Insbesondere im Hinblick auf die durchlebte Kriegs- und Nachkriegszeit, die ähnliche bis vergleichbare politische wie soziale Rahmenbedingungen vorgab, bleibt, bei aller Betonung der Individualität einer jeden Lebensgeschichte, die Frage nach gemeinsamen autobiographisch prägenden Ereignissen, deren Erarbeitung unter 1.2. skizziert wird. Doch zuvor nochmals eine zusammenfassende Übersicht über die Intention der vorliegenden Arbeit.
1.2 Zielsetzung und Fragestellung
Die Dissertation soll die sechs ausgewählten Autoren und Autorinnen von zeitgeschichtlicher Kinder- und Jugendliteratur als Personen mit ihren ganz individuellen biographischen Hintergründen abbilden, und hierdurch ein bisher bekanntes Datenspektrum durch neue Erkenntnisse und Informationen ergänzen und vertiefen. Die gewonnenen Erkenntnisse gehen explizit aus den Aussagen (Interviews) der Autoren hervor und sind als authentisches wie gegenstandsangemessenes Material anzusehen. In diesem Zusammenhang erfolgt eine Vernetzung von Autoren- und Werkbiographie.
Über die intensive Auseinandersetzung mit jeder Einzelperson hinaus wird eine Annäherung an die Auswirkungen von Kriegskindheit- und Jugend im Kontext von Persönlichkeitsentwicklung- und Identitätsfindung angestrebt. Hierbei geht es u.a. um die Bedeutung des Eltern-Kind-Verhältnisses sowie um weitere prägende Faktoren wie die eigene Lesebiographie und die gesellschaftliche wie soziale Position. Am Ende sollen im Fallvergleich zentrale Themen herausgestellt werden, die charakteristisch für Kinder- und Jugendbuchtautoren dieser Generation sind, und somit eine zentrale Aussage über biographische Verläufe zulässt, ohne dabei generalisierende wie pauschalisierende Übertragungen vornehmen zu wollen.
Die vorliegende Arbeit stellt die Entwicklung wie den aktuellen Forschungsstand der zeitgeschichtlichen Kinder- und Jugendliteratur in Verbindung mit den neuesten Erkenntnissen zur Kindheitsforschung, insbesondere die der Kriegs- und Nachkriegskindheiten dar. Darüber hinaus geht es um die Beziehung zwischen Autor und Leser im Sinne eines autobiographischen Paktes.
Der gesamte Forschungsprozess im Rahmen qualitativer Sozialforschung soll eine interdisziplinäre Brücke zwischen den Sozial- und Geisteswissenschaften schlagen. D.h. durch die intensive Darstellung des thematischen Kodierens nach STRAUSS und CORBIN an sechs Fallbeispielen von Autoren der Kinder- und Jugendliteratur wird ein methodischer Weg aufgezeigt, der einen gegenstandsangemessenen Zugang ermöglicht. Die analysierten und kategorisierten Daten können zu veränderten, erweiterten oder gar neuen Sichtweisen auf literarische Texte der interviewten Schriftsteller führen, und darüber hinaus zu einem authentisierten Blick auf den Schriftsteller selbst. Dabei geht es weniger um die Explikation einer biographischen Wahrheit, als vielmehr um Rückschlüsse auf das subjektive Erleben und Erinnern.
1.3 Gang der Darstellung
In der Auseinandersetzung mit Kinder- und Jugendbuchautoren der Kriegs- und Nachkriegsgeneration im Rahmen biographischer Forschung bedarf es eines schrittweisen Aufbaus, a) um durch eine entsprechende Analyse von Datenquellen- und Materialen eine verifizierbare wie signifikante Aussage zu Schnittstellen autobiographischer Prägung vornehmen zu können und b) um diese für den Leser nachvollziehbar zu machen.
Die vorliegende Arbeit gliedert sich in drei große Bereiche, die aufeinander aufbauen und fließend ineinander übergehen. Der erste Teil beinhaltet die fünf Kapitel umfassende Theorie zur Einführung in die (zeitgeschichtliche) Kinder- und Jugendliteratur. Darüber hinaus erfolgt die Erläuterung des Forschungsansatzes der biographischen Forschung sowie die des methodischen Vorgehens im Rahmen der Grounded Theory.
Resultierend aus der Frage nach den autobiographischen Einflüssen auf das Narrativ führt, nach der Einleitung im I. Kapitel, das Kapitel II in die Grundbegriffe der Biographie wie Autobiographie ein und grenzt diese jeweils zu dem allgemein Autobiographischen ab. In Hinführung auf die Kinder- und Jugendbuchautoren der Kriegs- und Nachkriegsgeneration erfolgt im Kapitel III. eine Einführung in das zeitgeschichtliche Kinder- und Jugendbuch sowie dessen aktuellen Forschungsstand, eingebunden in den Gesamtkontext der Kinder- und Jugendliteratur. Darüber hinaus erfahren die Kinder- und Jugendbuchautoren, als Außenseitergruppe unter den Schriftstellern, abschließend eine besondere Beachtung. Der zugrundeliegende Forschungsansatz der biographischen Forschung wird in seiner historischen Entwicklung wie durch seine sechs Forschungsziele im IV. Kapitel charakterisiert. Kapitel V. expliziert das methodische Vorgehen im Rahmen der Grounded Theory. Hierbei wird zunächst dem Forscher selbst im Kontext der Datengenerierung eine wichtige Funktion zugeschrieben. Des weiteren werden die einzelnen Forschungsschritte von der Kontaktaufnahme über die Entstehung des Interviewleitfadens bis hin zur Verschriftlichung des gesammelten Materials skizziert. Um einen professionellen Umgang mit dem vorliegenden Material geht es im Kapitel VI. Die Beschreibung praktischer Schritte zur thematischen Annäherung, inhaltlichen Strukturierung wie der Darstellung erfolgt auf dem Hintergrund des thematischen Kodierens in Anlehnung an CORBIN und STRAUSS. Im letzten Schritt der theoretischen Vorbereitung wird auf die Theorieentwicklung eingegangen. Auf dieser theoretischen Basis des ersten Teils baut sich im folgenden der Praxisteil auf. Das Kapitel VII. bildet nach einer kurzen Einführung in die Untersuchung jeden Autor als Individuum in gleicher Weise ab, so dass im weiteren Schritt fallvergleichend vorgegangen werden kann. Als erstes Ergebnis des Kodierens wird jedes Interview mit einer Überschrift versehen, die als „allgemeines Motto“ repräsentativ für das transkribierte Datenmaterial steht. Des weiteren erfolgt die „Identifikation der zentralen Themen“, welche durch entsprechend charakteristische Titel gekennzeichnet und ausführlich dargelegt werden. In diesem Zusammenhang erfolgt zur Unterstützung der konstatierten Themen die Hinzunahme weiteren Datenmaterials und zusätzlicher Quellen sowie die Vernetzung aus Autoren- und Werkbiographie. Einer jeden ausführlichen Darstellung schließt sich eine analytische Zusammenfassung an. Durch die fallvergleichende Analyse des VIII. Kapitels soll schließlich eine gemeinsame Schnittmenge von charakteristischen Aussagen gefunden werden, welche als Ergebnis-Essenz zusammengefasst wird. Eine abschließende Betrachtung der Erkenntnisse wie Ergebnisse dieser Arbeit, einhergehend mit sich daraus folgernden Perspektiven, findet sich im IX. Kapitel.
Kapitel X. beinhaltet das Literaturverzeichnis.
Abschließend drei Hinweise zum Verständnis des folgenden Textes.
1. Abkürzungen wie „z.B.“, „d.h.“ sowie „u.a.“ werden als geläufig vorausgesetzt. Des weiteren werden die sechs Autorennamen der hier untersuchten Biographien in den entsprechenden Darstellungen und Analysen wie folgt abgekürzt:
DC = Dagmar Chidolue
GP = Gudrun Pausewang
WL = Waldtraut Lewin
MK = Michail Krausnick
PM = Paul Maar
WF = Willi Fährmann
Darüber hinaus wird von der Verwendung von Abkürzungen abgesehen, weshalb auf ein Abkürzungsverzeichnis verzichtet wird.
2. Es soll Klarheit über die Verwendung des Begriffs „Autor“ geschaffen werden. Gemeint sind hiermit sowohl männliche als auch weibliche Schriftsteller. Die durchgehend männliche Schreibweise stellt weder eine Ausgrenzung noch Degradierung des weiblichen Geschlechts dar. Es handelt sich lediglich um die nüchterne Tatsache, dass das Schreiben durch eine Vereinheitlichung erleichtert wird. Gleichermaßen verhält es sich mit der Verwendung des Begriffs „Forscher“.
3. Im Rahmen dieses Forschungsprojekts, nicht zuletzt angeregt durch den qualitativen Forschungsansatz, habe ich mich intensiv mit der Form des kreativen wissenschaftlichen Arbeitens auseinandergesetzt. In diesem Zusammenhang erfolgte, neben allem Anspruch auf Wissenschaftlichkeit, eine individuelle Gestaltung von Themen und Inhalten sowie eine insgesamt illustrierte Präsentation von Erkenntnissen und Ergebnissen. Das Bildmaterial stützt und unterstützt eine wissenschaftliche Lebendigkeit, die der biographischen Forschung, insbesondere auf dem speziellen theoretischen Hintergrund des zeitgeschichtlichen Kinder- und Jugendbuches, hoffentlich gut zu Gesichte steht.
II. KAPITEL Autoren zeitgeschichtlicher Kinder- und Jugendliteratur - Zwischen Biographie, Autobiographie und dem Autobiographischen
Unabhängig von der zeitgeschichtlichen Kinder- und Jugendliteratur ist in den letzten Jahren ein allgemeiner Trend zur Biographie und Autobiographie zu verzeichnen. Eine breite Leserschaft stürzt sich zunehmend auf biographische und autobiographische Zeugnisse in der Hoffnung, authentischen Erfahrungen und Geschichten zu begegnen. Die Bandbreite biographischer und autobiographischer Veröffentlichungen macht das weite Feld der verfassten Lebensgeschichte einmal mehr deutlich: „Neben literarisch anspruchslosen, oftmals von Ghostwritern verfassten und in der Nähe des Enthüllungsjournalismus angesiedelten Darstellungen des Lebens von Personen aus dem Bereich der Medien- und Unterhaltungsbranche stehen solide erzählte und fundiert recherchierte Lebensberichte historischer und zeithistorischer Persönlichkeiten sowie schließlich literarisch ambitionierte Texte, die sich an geschultes Lesepublikum wenden“ (Wagner-Egelhaaf 2005, 1).Wo ist in diesem breiten Spektrum die zeitgeschichtliche Kinder- und Jugendliteratur einzuordnen und wodurch definiert sie sich? Bevor das III. Kapitel jene Literaturgattung näher beleuchtet, soll im Umgang mit den bis hierher genannten Fachtermini „Biographie“, „Autobiographie“ und „das Autobiographische“ die Beziehung dieser zueinander hergestellt werden. Wieso spricht man von biographischer Forschung, wenn das Datenmaterial die Aussagen eines Menschen über seine Lebensgeschichte abbildet, sprich: Subjekt und Objekt identisch sind? Handelt es sich hierbei nicht eher um eine Autobiographie? Was ist aber dann das Autobiographische an einem Text, wenn es sich nicht explizit um eine Autobiographie handelt? Ist am Ende die Terminologie und ihre disziplinäre Zuordnung erfolgt, wird schließlich der Bogen zur zeitgeschichtlichen Kinder- und Jugendliteratur gespannt. Das geschieht nicht zuletzt, um die Nähe zu den hier untersuchten Biographien sowie dem autobiographischen Material der sechs Autoren herzustellen und vorbereitend zu untermalen, welche Rolle dem Autobiographischem durch die Abbildung von erlebter und erzählter Lebensgeschichte zukommt.
2.1 Die Biographie
Das Wort „Biographie“ setzt sich aus den beiden griechischen Silben „bios“ (Leben) und „graphein“ zusammen und steht für geschriebenes Leben bzw. Lebensbeschreibung. Die Nachzeichnung des Lebenslaufs eines Menschen kann auch als Kunstform für die Verbindung von Elementen der Geschichtsschreibung und der Dichtung stehen. Als literarische Gattung entstand die Biographie bereits in der Antike. Den typisierenden Römern und Griechen von Plutarch folgten Lebensbeschreibungen von römischen Kaisern durch Sueton bis hin zu den Heiligenbiographien des Mittelalters. Die Renaissance entwickelte erstmalig einen Sinn für das Individuelle, worauf sich im 15. Jahrhundert eine Sammelbiographie der bildenden Künstler Italiens anschloss. Mit der „Geschichte Friedrichs des Großen“ von T. Carlyle im 19. Jahrhundert und einer „Biographie der Heldenverehrung“ wurde in Deutschland der Grundstein für die historisch-kritische Biographie mit zeit- und geistesgeschichtlichem Hintergrund gelegt. In der Erwachsenenliteratur steht das Werk von Golo Mann „Wallenstein“ (1979) exemplarisch für diese Entwicklung. Im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur hat u.a. der Verlag Beltz und Gelberg eine Biographie-Reihe vorgelegt, in der z.B. „Die Lebensgeschichte des Dietrich Bonhoeffer“ von Renate Wind sowie „Das Leben des Jean-Henri Fabre“ von Martin Auer erschienen sind.[2] Peter Härtling postulierte mit „Niembsch oder der Stillstand“ (1964), einem mehr oder weniger fiktiven Portrait über Nicolaus Lenau, den Biographie-Roman. Waren es bis in die 80er Jahre eher Veröffentlichungen über gesellschaftlich bekannte Persönlichkeiten, so setzte sich ab den 90er Jahren ein zunehmendes Interesse an Publikationen von unbekannten Personen durch. Die Lebensgeschichte der Bäuerin Anna Wimschneider in „Herbstmilch“ war mehrere Monate auf den Bestsellerlisten vertreten, was repräsentativ für eine gewisse Neugier an dem Unbekannten stehen könnte.
Bleiben wir bei der literarischen Gattung, lassen sich nach Wagner-Egelhaaf (2005) folgende Kriterien für die Biographie benennen:
- Form der Sprache: Die Biographie ist eine Erzählung in Prosa.
- Behandelter Gegenstand: Sie behandelt die Lebensgeschichte eines der Öffentlichkeit unbekannten Menschen oder die Lebensgeschichte einer bedeutenden Persönlichkeit.
- Situation des Autors: Autor und Erzähler sind identisch.
- Position des Erzählers: Die Erzählperspektive ist retrospektiv.
Trotz dieser klaren Eingrenzungen ist der Übergang zu den Nachbargattungen (Memoiren, Autobiographie, Essay, Selbstportrait, autobiographisches Gedicht) oft fließend, wodurch der heuristische Charakter von Gattungsbestimmungen als relativ anzusehen ist. Ein Beispiel hierfür ist Goethes „Dichtung und Wahrheit“, in der Goethe nicht nur als Autobiograph, sondern genau genommen auch als Biograph seiner Schwester Cornelia auftritt. Schildert Willi Fährmann in seinem Buch „Die Stunde der Lerche“ (2005) seine Jugendjahre in der Nachkriegszeit, so ist er nicht nur autobiographischer Zeitzeuge, sondern auch Biograph seiner ganzen Familie, die unmittelbar mit seiner Geschichte verbunden ist. Letztlich könnten jedoch keine Gattungsüberschreitungen vorgenommen werden, wenn diese als solche nicht definiert sind. Deshalb erfolgt nun die zusammenfassende Begrifferklärung zur Biographie als literarische Gattung:
Unabhängig von der Literaturwissenschaft wird umgangssprachlich gleichsam der (stichwortartige) Lebenslauf, auch „Vita“ genannt, als Biographie bezeichnet. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Biographie, dem eigenen Lebenslauf, ist u.a. Thema und Inhalt der Biographiearbeit.
Genauso verhält es sich in den Sozialwissenschaften mit ihrer Biographischen Forschung (vgl. Kap. IV). Hier ist „biographisch im Übrigen, was selten bemerkt wird, im Grunde irreführend: Autobiographisch müsste es heißen, wenn damit nicht die Verwechslung mit der literaturwissenschaftlichen Gattung festgelegt würde“ (Fuchs-Heinritz 2005, 11). Deutlich wird dieses Phänomen an einem Beispiel aus der Erziehungswissenschaft. Im Bereich der Biographie- und pädagogischen Kindheitsforschung wird ausschließlich autobiographisches Material, u.a. in Form lebensgeschichtlicher Interviews untersucht, und doch ist es in Abgrenzung zum literarischen Genre der Autobiographie als biographische Forschung benannt.[3] In diesem Zusammenhang ist für den weiteren Forschungsverlauf die Erläuterung der Autobiographie unverzichtbar. Im Vergleich zur kurzen Abhandlung der „Biographie“ kommt der „Autobiographie“ im folgenden aufgrund ihrer Relevanz in der biographischen Forschung eine umfassendere wie detailliertere Darstellung zu.
2.2 Die Autobiographie
Wird die Geschichte der Menschen bis zu ihren Anfängen zurück verfolgt, weist jede Epoche auf unterschiedliche Art und Weise das menschliche Bedürfnis auf, sich mitzuteilen zu wollen. Denken wir nur an die Höhlenmalereien in der Steinzeit, die vorchristlichen Runenschriften oder die Anfänge des Briefschreibens, hier u.a. die Liebesbriefe der Romantik.
Seit wann die Autobiographie jedoch als Gattung Bestand hat, und wie sich diese definiert und theoretisch erklärt, wird in den sich nun anschließenden Abschnitten aufgezeigt.
2.2.1 Kurzer Abriss zur Historie und Wandel der Autobiographie
Das Wort „Autobiographie“ setzt sich aus den drei griechischen Silben „autos“ (selbst), „bios“ (Leben) und „ graphein“ (schreiben) zusammen. Historisch lassen sich die Ursprünge der Autobiographie sowohl an der religiösen Selbsterforschung als seelische Läuterung auf dem Weg zu Gott festmachen, als auch an der profanen Chronik, die dem Autor die Rolle des Zeitzeugen zuweist. Voraussetzung für den Prozess der Beschreibung der eigenen inneren wie äußeren Entwicklung ist die „Entdeckung der Individualität“ (Misch 1949, 73 ff.). Erkennbare Anfänge sieht Misch in der altgriechischen Literatur um 700 v. Chr. sowie im mystischen Schriftentum der Griechen. Beide wurden jedoch erst in den ersten Jahrhunderten nach Christi fortgeführt. „Der Fortgang der Individualisierung und damit der autobiographische Selbstausdruck stehen in direkter Abhängigkeit von der Entwicklung philosophischen Denkens, von den ersten metaphysischen Entdeckungen der Naturphilosophen bis hin zu einem frühen Höhepunkt der Sokratischen Selbstbesinnung“ (Holdenried 2000, 87). Nach pragmatisch-häuslichen Lebensberichten oder kurzen Berufsbiographien, die zur Entwicklung des selbstreflexiven und analytischen Ich beigetragen haben, entstanden erst im 18. Jahrhundert klassische Autobiographien. J.J. Rousseau und J.-W. von Goethe prägten durch ihre autobiographischen Schriften, losgelöst von äußeren gesellschaftlichen wie inneren seelischen Zwängen, die literarische Gattung maßgeblich mit. Sich daran anschließend legten Fontane und Ebner-Eschenbach für das 19. und 20. Jahrhundert durch kleine Anekdoten mit motivischen Wiederholungen, entgegen aller Chronologie, antizipierende Elemente für die künftige literarische Praxis fest. Es ging primär um den Grundton einer Lebensgeschichte, nicht wie zuvor ästhetisch bestimmt um das vorherrschende Gestaltungsmoment.
Die autobiographischen Erzählungen von T. Bernhard[4] stehen exemplarisch für den Zerfall chronologisch-globaler Ordnungen und das Zerbrechen der Ganzheitsvorstellung vom Individuum. Diese gestalttheoretischen Entwicklungen schreiten nur langsam voran, stagnieren nahezu in den 30er und 40er Jahren gänzlich (vgl. Niggl 1998, 4), um schließlich in den 70er Jahren eine Renaissance der Autobiographieforschung einzuläuten. In der Abhandlung „Identität und Rollenzwang“ von Bernd Neumann (1970) wird „anhand Freudscher Kategorien zwischen Autobiographie als Ausdruck, der Identitätsbildung des Heranwachsenden und „Memoiren“ als Darstellung des sozialen Rollenspiels des Erwachsenen unterschieden“ (Niggl 1998, 8). Durch das wachsende sozialhistorische Interesse seit den 70er Jahren erfolgt eine verstärkte Beschäftigung mit Autobiographien sozialer Rand- und Sondergruppen[5], deren gesellschaftliche Etablierung und Identitätssuche an ausgewählten Beispielen demonstriert werden: Ist es in Amerika die Black Autobiography[6], erwacht in Deutschland ein neues Interesse an Arbeiterlebenserinnerungen (vgl. Bollenbeck 1976) und Lebensdarstellungen von Frauen im Zusammenhang mit gesellschaftlicher Emanzipation. Diese Entwicklung von der „grand recit“, der „großen Erzählung“, hin zu kleinen Archiven von Normalbürgern belegen ferner das Tagebucharchiv in Emmendingen und der Gesprächskreis „Erzähltes Leben“ in Zehlendorf. Auch Walter Kempowskis[7] „Echolot“, die Zusammenstellung zahlreicher autobiographischer Aufzeichnungen zu einem kollektiven Tagebuch, zeichnet diesen Trend in den 80/90er Jahren und macht Bewusstseinsgeschichte und Geschichtsbewusstsein über die autobiographische dokumentierte Erfahrung vermittelbar (vgl. Holdenried 2000). Schließlich kann die Geschichte der Autobiographie als Geschichte des menschlichen Selbstbewusstseins verstanden werden (vgl. Niggl 1998), da Persönlichkeitsentwicklungen durch Autoreflexion eine äußere Form wie gesellschaftliche Beachtung finden. Deutlich soll in diesem Zusammenhang auch werden, dass die Autobiographie im Laufe ihrer Entwicklung zu einer literarischen Gattung reifte, die gleichsam für andere Disziplinen wie z.B. die Soziologie, Psychologie und Erziehungswissenschaften an Forschungsrelevanz zunahm, hier jedoch nicht in der klassischen literarischen Gattung, sondern durch die Untersuchung autobiographischen Materials. Der in den 70er Jahren einsetzende und bis dato anhaltende Boom der biographischen Forschung trifft auf alle o.g. Wissenschaftsgebiete zu und bestätigt diese Entwicklung (vgl. hierzu Kap. IV).
2.2.2 Die Autobiographie - Wirklichkeit, Wahrheit und Wahrhaftigkeit
Wie der Historie der Autobiographie bereits zu entnehmen ist, kann sie viele unterschiedliche Gesichter haben bzw. liegt ein breites Spektrum an Erscheinungsformen vor. Auch wenn ihr Gattungsstatus nicht immer eindeutig ist, und u.a. der belgisch-amerikanische Literaturtheoretiker Paul de Man (vgl. de Man 1979) ihre Definition gänzlich in Frage stellt[8], soll hier eine gattungsspezifische Definition nach Philippe Lejeune Orientierung bringen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Um für weitere Erhellung zu sorgen und die Abgrenzung zu Nachbargattungen wie Biographie, Memoiren etc. zu verdeutlichen, folgt nun eine Festlegung der Grundparameter für die Autobiographie nach Wagner-Egelhaaf (2005) und Lejeune (1975):
- Form der Sprache: Die Autobiographie ist ein Bericht oder ist Prosa
- Behandelter Gegenstand: Sie behandelt die Lebensgeschichte eines der Öffentlichkeit unbekannten Menschen oder die Lebensgeschichte einer bedeutenden Persönlichkeit.
- Situation des Autors: Autor (dessen Name auf eine reale Person verweist) und Erzähler sind identisch
- Position des Erzählers: Identität des Erzählers ist identisch mit der der Hauptfigur, und
- die Erzählperspektive ist retrospektiv.
Doch wie bereits unter 2.2.1 aufgeführt, triff die Problematik der Klarheit und Eindeutig einer definierten Gattung auch auf die Autobiographie zu. Spricht Heinrich Seuse[9] in seiner Vita im Jahre 1313 nicht von „Ich“ sondern über sich in der dritten Person, bedient er sich der Darstellungsform der Biographie, obwohl es sich um autobiographische Prosa handelt. Leitet Gudrun Pausewang ihren zeitgeschichtlichen Jugendroman „Überleben“ (2005) mit einem Vorwort an die Enkelin Stefanie ein, erhält der Text von vorn herein Autobiographiecharakter, obwohl er lediglich autobiographische Anteile beinhaltet. Genau an dieser Stelle werden drei Grundspannungen deutlich: 1. Autobiographien beanspruchen, und Leser knüpfen ihre Erwartungen an diesen Anspruch, dass durch die Darstellung des gelebten Lebens des Verfassers eine historische Realität abgebildet wird. Dadurch, dass diese Realität von einer realen Person durchlebt wurde, verspricht sich ein Leser mehr aus einer bestimmten Zeit, einer geschichtlichen Epoche zu erfahren, als z.B. ein Geschichtsbuch hergibt, wodurch die Autobiographie zu einem referenziellen Text gemacht wird.
2. steht dieser objektiven Berichterstattung eine subjektive Autorposition gegenüber. Ist aus der Psychoanalyse die Gratwanderung zwischen Selbsterkennung und Selbstverkennung im Rahmen von Selbst- und Fremdeinschätzung unzählige Male thematisiert, lässt sich das Phänomen der subjektiven Wahrnehmungsperspektive auf die Position des Autors übertragen. Denn: „In autobiographischen Schriften kann vielerlei vorkommen: Landschaftsschilderungen, Personenbeschreibungen, Milieuschilderungen, Darstellungen von Arbeitsprozessen und –bedingungen oder von historischen Ereignissen, Auseinandersetzungen, Kritik usw. Aber ihr eigentlicher Inhalt, ihre Substanz ist eine Lebensgeschichte oder besser: die Konstituierung einer Lebensgeschichte“ (Baacke / Schulze 1979, 59). Der Erwartung des Lesers, hinsichtlich der Abbildung von (historischer) Realität durch Objektivität gerecht zu werden ist, in diesem Kontext kaum möglich.
Schließlich ist 3. das Kriterium der Objektivität höchst problematisch, da sich die Frage nach der grundsätzlichen Verifizierbarkeit im Zusammenhang mit subjektiver Erinnerung und Erzählung stellt. Die logische Konsequenz aus dieser Problematik ist letztlich, dass die Vorstellung von einer objektiven Wirklichkeit als Bewertungsgrundlage für die Gattung der Autobiographie untauglich ist. Nicht zuletzt deshalb, weil diese durch die Einnahme unterschiedlicher Perspektiven, Symbiosen, Zeitraster etc. vielerlei Gestalt annehmen kann. Denn Objektivität ist mathematisch nicht messbar, sondern bleibt lediglich eine Kategorie, die durch Vereinbarung und Berücksichtigung der Faktenlage entsteht. Der Begriff „ Wirklichkeit “ im Zusammenhang mit der Autobiographie ist insofern nicht haltbar, als er wie auch die „Objektivität“ den Anspruch auf Allgemeingültigkeit erhebt. Bedenkt man an dieser Stelle die Gestalthaftigkeit von Erinnerung und Erzählung, relativiert sich die Wirklichkeit einer Lebensgeschichte einmal mehr. Während das Soeben-Gewesene in der Erinnerung noch sehr präsent ist, muss man sich dieses Ereignis nach Tagen, Monaten oder gar Jahren wieder ins „Gedächtnis rufen“ (vgl. Husserl 1976). Die Metapher des Zurückrufens impliziert, dass dieses Ereignis im Gedächtnis abgespeichert und jederzeit 1:1 abgerufen werden kann. Doch Husserls Analysen zum Erinnern belegen, dass nicht Gespeichertes abgerufen, sondern die Erinnerung reproduziert wird. Hier ist das Vergangene in das Präsens der Gegenwart und die antizipierte Zukunft integriert und unterliegt somit einer ständigen Modifikation. „Die Erinnerung ist in einem ständigen Fluss, weil das Bewusstsein in beständigem Fluss ist, und nicht nur Glied an Glied in der Kette sich fügt. Vielmehr wirkt jedes Neue zurück auf das Alte, seine vorwärtsgehende Intention erfüllt sich und bestimmt sich dabei, und das gibt der Reproduktion eine bestimmte Färbung“ (Husserl, 1976, 412). Auf diesem Hintergrund lässt sich gut nachvollziehen, warum Goethe seine autobiographischen Schriften nicht „Dichtung und Wirklichkeit“ sondern als „Dichtung und Wahrheit“ betitelte. „Es sind lauter Resultate meines Lebens, und die erzählten einzelnen Facta dienen bloß, um eine allgemeine Beobachtung, eine höhere Wahrheit zu bestätigen“ (Goethe 1831). Die Kategorie der Wahrheit steht dem Faktischen, der zuvor benannten historischen Realität entgegen. Sie ist das subjektive Ergebnis rekonstruierter erlebter und erzählter Lebensgeschichte, weshalb die biographische Forschung diese beiden Bereiche bewusst getrennt voneinander reflektiert (vgl. Rosenthal 1995). Neben den Kategorien „Wirklichkeit“ und „Wahrheit“ kommt als letztes Kriterium für die Autobiographie das der „Wahrhaftigkeit“ hinzu. Bekommt der Leser, aufgrund der Begrenzung durch subjektive Wahrnehmung des Autors, schon nicht die „wahre Wirklichkeit“ präsentiert, so ist der Autor mit dem Anspruch nach Wahrhaftigkeit aufgefordert, nach bestem Wissen und Gewissen zu berichten. Nicht zuletzt macht sich hieran eine Authentizitätserwartung des Lesers an den Autor fest. Mögen die hier abgehandelten Kriterien auch noch so plausibel klingen und tatsächlich als Wesensmerkmale, wenn auch auf unkritischem Terrain angesiedelt, zur Unterscheidung von Autobiographie und reiner Fiktionalität dienen, so ist abschließend, auch im Hinblick auf die zeitgeschichtliche Kinder- und Jugendliteratur, folgendes anzumerken: „Auf der Grundlage der Texte selber lassen sich „Wirklichkeit“, „Wahrheit“, „Wahrhaftigkeit“ und „Authentizität“ nicht feststellen (Wagner-Egelhaaf 2005, 4). Letztlich ist ein autobiographischer Text nicht ohne zusätzliche Information (Klappentext, Vorwort, Nachwort, Hintergrundwissen etc.) von einem Ich-Roman zu unterscheiden. Ein autobiographischer Text, nehmen wir beispielsweise ein zeitgeschichtliches Jugendbuch, wird jedoch
a) mit einer anderen Ernsthaftigkeit gelesen, wenn das gesicherte Wissen darüber herrscht, dass es sich um eine authentische Lebensbeschreibung handelt, und b) bietet er dem jungen Leser die Chance, sein biographisches Wissen über den Autobiographen bewusst zu erweitern und in Beziehung zu dessen Narrativ zu setzen. Vorgreifend auf die pädagogische Intention der Verbindung aus biographischer Forschung und Autoren der zeitgeschichtlichen Kinder- und Jugendliteratur sei an dieser Stelle bereits darauf hingewiesen.
Die Kinder- und Jugendbuchautorin Mirjam Pressler antwortete einmal in einem Interview auf die Frage „Ist ‚Wenn das Glück kommt’ ein autobiographisches Buch?“: „Fast jedes meiner Bücher basiert auf persönlichen Erfahrungen, aber kein Einziges ist wirklich autobiographisch. Ich verwende allenfalls Details aus meiner Lebensgeschichte. Einiges ist authentisch, anderes verändert, vieles ganz und gar erfunden.“ (Pressler 2001, 51/52). Dem ratlosen wie ausgelieferten Leser stellt sich die Frage danach, wer spricht: das Subjekt oder der Text? In diesem Kontext gilt es nun, der Autorenfunktion und dem, was als „das Autobiographische“ bezeichnet wird, nachzugehen, um sich somit der zeitgeschichtlichen Kinder- und Jugendliteratur schrittweise weiterhin zu nähern.
2.3 Der Autor und das Autobiographische
„Unter Autobiographien oder autobiographischen Schriften im engeren Sinne verstehe ich alle zusammenhängenden schriftlichen Äußerungen, in denen sich Personen aus eigenem Antrieb mit ihrer eigenen Lebens- und Lerngeschichte oder mit Ausschnitten davon beschäftigen“ (Schulze 1979, 51). Mit dieser Aussage des Erziehungswissenschaftlers T. Schulze bewegen wir uns weg von der klassischen literarischen Gattung der Autobiographie, hin zu den Verfassern und deren Erzählungen, in denen autobiographische Anteile oder „autobiographiebasierte Texte“ (Holdenried 2000, 40) als „das Autobiographische“ enthalten sind . Für jedwedes autobiographische Material, hierzu gehören Erzählungen, Teilberichte oder Tagebuchaufzeichnungen genauso wie Interviews, Briefe oder Photographien, gibt es keine allumfassende wissenschaftliche Definition. „Die Selbstbiographie ist keine Literaturgattung wie die anderen. Ihre Grenzen sind fließender und lassen sich nicht von außen festhalten und nach der Form bestimmen wie bei der Lyrik, dem Epos oder Drama,...und ruht doch auf dem natürlichsten Grunde, auf dem Bedürfnis nach Aussprache und dem entgegenkommenden Interesse der anderen Menschen, womit das Bedürfnis nach Selbstbehauptung der Menschen zusammengeht; sie ist selber eine Lebensäußerung, die an keine bestimmte Form gebunden ist“ (Misch 1949). Fest steht jedoch, dass autobiographische Schriften wie auch anderes Material ihr Dasein einem langwierigen und mehrschichtigen Prozess auf unterschiedlichen Realitätsebenen über Jahre und Jahrzehnte zu verdanken haben. Die Prozessstufen des Erlebens und Erinnerns, die letztlich „das Autobiographische“ schreiben, setzen sich nach Schulze (1979) aus fünf Schichten zusammen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2: Die fünf Prozessstufen des Erinnerns nach Schulze
Diese fünf Schichten sollten nicht getrennt voneinander gesehen werden, sondern können unmerklich einander übergreifen und sich schneiden. Letztlich geht es hier um das Verstehen des Erinnerns von Vergangenem und um das Erklären und Interpretieren der strukturellen, inhaltlichen wie inneren Zusammenhänge des Erlebten von Seiten des Verfassers. Wilhelm Dilthey[10] spricht von einer Symbiose aus Einheit, Zusammenhang und Bedeutung, anders formuliert: „Der Lebenslauf besteht aus Teilen, besteht aus Erlebnissen, die in einem inneren Zusammenhang miteinander stehen. Jedes einzelne Erlebnis ist auf ein Selbst bezogen, dessen Teil es ist; durch die Struktur mit anderen Teilen zu einem Zusammenhang verbunden. In allem Geistigen finden wir Zusammenhänge; so ist Zusammenhang eine Kategorie, die aus dem Leben entspringt“ (Dilthey 1927). In dieser Aussage spiegelt sich letztlich die Lehre der Hermeneutik: Ausgehend davon, dass der Mensch Erkenntnisobjekt ist, geht es um die Lehre vom Verstehen des Fremden, vom Verstehen von Welt, eines Textes, aber auch seiner selbst. Für das Autobiographische birgt dieser zirkuläre Prozess zwei Handlungsebenen:
1. Durch das Erkennen und Verstehen erfolgt ein bewusster Umgang mit dem reflektierten Autobiographischen, und
2. Verdrängtes, Vergessenes wie Verschwiegenes fließen zunächst unbewusst in den hermeneutischen Zirkel ein, um dann ggfls. in späteren Prozessen bewusst reflektiert zu werden.
Die unterschiedlichen gedanklichen Prozesse des Auseinandersetzens mit der eigenen Person und das damit verbundene Bewusstmachen von inneren wie äußeren Entwicklungen, suchen sich ihre ganz eigenen Ventile, weshalb es eine Tendenz gibt, nach der das Autobiographische stets latent vertreten ist. „Ich möchte von der These ausgehen, dass jedes Schreiben autobiographisch ist, zumindest wenn es sich um erzählte Kindheit handelt. Schließlich kann man nur das erzählen, was man gehört, gesehen, gelesen – oder selbst erlebt hat“ (Pressler 2001, 63, vgl. Wagner-Egelhaaf 2005, 9). Das trifft auf rein literarische Texte wie auf autobiographisches Material im weitesten Sinne gleichermaßen zu. Für die Praxis zieht das einen aufmerksamen Leseprozess nach sich, in dem jenen realen lebensgeschichtlichen Erfahrungen nachgespürt wird. An dieser Stelle wird die Funktion des Autors einmal mehr deutlich. M. Foucault[11] beschäftigt sich in diesem Zusammenhang aufschlussreich mit der Frage: „Was ist ein Autor?“ (1979), und kommt zu dem Ergebnis, dass es sich bei der Autorfunktion um ein Ordnungsschema handelt. Gemeint ist damit die Aussagekraft des Narrativs aufgrund seiner Zuordnung zu einem Namen, einem Verfasser. Somit sind Äußerungen nicht beliebig, sondern können einem bestimmten Modus der Rezeption zugesprochen werden. Bei der klassischen Autobiographie herrscht in diesem Kontext eine noch größere Eindeutigkeit, einhergehend mit verstärkt radikalem Anspruch an den Autoren als Schöpfer seiner Geschichte in seiner Geschichte.
2.4 ZUSAMMENFASSUNG
Dieses Kapitel erhellt die Fachtermini „Biographie“ und „Autobiographie“ und schafft in Abgrenzung zur rein literaturwissenschaftlichen Gattung einen Übergang zum interdisziplinären Element des Autobiographischen. Allen eindeutigen Definitionen zum Trotz ist oftmals eine klare Abgrenzung zu den Nachbargattungen nicht möglich, und insbesondere mit Blick auf die Autobiographie spricht Lejeune von einer „Gattungsproblematik“ . Kann hier in jedem Fall eine Namensidentität zwischen Autor, Erzähler und Protagonist hergestellt werden, erfährt dagegen das Autobiographische keine eindeutige Markierung durch den Eigennamen. Vielmehr ist es ein Konglomerat aus Wahrheit, Wirklichkeit und Fiktion, sprich: tatsächlich Erlebtes, subjektiv Erinnertes wie Wahrgenommenes und frei Erfundenes - ob literarische Gattung, empirisches Forschungsmaterial oder das Autobiographische in fiktionalen Texten. Für alle Formen und literarischen Gattungen fasst folgendes Zitat von M. Holdenried (2000, 12) das Wesentliche zusammen: „ Selbst-Erfahrung, Selbstauslegung, Verständigung mit anderen sind – neben dem immer mitlaufenden apologetischen Element – die Parameter, zwischen denen sich autobiographisches Schreiben von jeher vollzieht. Obwohl natürlich historischen Veränderungen unterliegend, ist das formale Gerüst im Kern unverändert: Ein Mensch beschreibt sein eigenes Leben, in der Regel von den ersten Erinnerungen bis zum Schreibzeitpunkt oder zu einem anderen zäsurbildenden Zeitpunkt.“ In welcher Form sich dieser Kern in der Kinder- und Jugendliteratur wiederfindet, hier im Speziellen in der Gattung der zeitgeschichtlichen Kinder- und Jugendliteratur, soll der nächste Abschnitt verdeutlichen, nachdem auch hier eine Annäherung an den Forschungsgegenstand über die literarische Definitions- und Handlungsebene erfolgt.
III. KAPITEL Das zeitgeschichtliche Kinder- und Jugendbuch im Gesamtkontext der Kinder- und Jugendliteratur
Dieses Kapitel arbeitet in vier Schritten auf das hin, was im empirischen Teil zum Untersuchungsgegenstand wird: zu dem Autor zeitgeschichtlicher Kinder- und Jugendliteratur. Wird im ersten Schritt zunächst der Gesamtkorpus Kinder- und Jugendliteratur auf der literarischen Handlungsebene dargestellt, folgt im zweiten Schritt, parallel zu einer kurzen Einführung in die „Geschichte der Kindheit“, eine Hinführung zur Geschichte der Kinder- und Jugendliteratur.
Letztere wird schließlich mit dem dritten Schritt für die Zeit von 1945 bis in die 70er Jahre ausführlich dargestellt, um dann durch den letzten Abschnitt über die Explikation zeitgeschichtlicher Kinder- und Jugendliteratur eine Brücke zu den entsprechenden Autoren zu schlagen. Wurden in den vorangestellten beiden Abschnitten noch allgemeine literarische Erscheinungsformen abgehandelt, erfolgt nun eine gegenstandsbezogene Eingrenzung. Was ist in diesem Zusammenhang also Kinder- Jugendliteratur? Wie ist sie im Rahmen von methodischer Forschung einzuordnen, und welche grundlegenden Aspekte im wissenschaftlichen Kontext liegen zu Grunde? Eine kurze Übersicht über die einzelnen Aspekte der Kinder- und Jugendliteratur, hier ausschließlich bezogen auf das Medium Buch, soll nun, einleitend in die Thematik, vorangestellt werden.
3.1 Kinder- und Jugendliteratur – Gegenstandseingrenzungen auf der literarischen Handlungsebene
Wird nun vor Augen geführt, wie Kinder- und Jugendliteratur eigentlich zu ebendieser wird, und wann, wo und von wem sie gelesen wird, leuchtet schnell ein, warum die folgenden acht Definitionen nach Ewers[12] (2000, 15ff.) erforderlich sind, um alle möglichen gegenstandsbezogenen Perspektiven aufzuzeigen. Darüber hinaus macht die Unterscheidung, auch auf dem Hintergrund der pädagogischen Intention deutlich, dass dem weiten Feld der Kinder- und Jugendliteratur nicht mit nur einer Definition Genüge getan wird. Filtert man im ersten Schritt aus dem Gesamtfundus des eigens für Kinder und Jugendliche geschriebenen Lesestoffs jenen heraus, der außerhalb des Unterrichts freiwillig von seinen Lesern zur Hand genommen wird, ist bereits ein erster Terminus erklärt:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Da die Schullektüre in der Regel verpflichtend ist, hierzu ist die eigentliche Unterrichtslektüre sowie die unterrichtsbegleitende Lektüre zu zählen, ist sie als eigener Textkorpus zu sehen, der nicht zur freiwilligen Kinder- und Jugendlektüre gezählt wird. Gleichwohl kann nicht ausgeschlossen werden, und im Hinblick auf die zeitgeschichtliche Kinder- und Jugendliteratur bleibt es zu wünschen, dass die eine oder andere Schullektüre gleichsam freiwillig in der Freizeit gelesen wird. Durch wen wird über den Schulalltag hinaus des Weiteren festgelegt, welche Literatur Kindern und Jugendlichen zugedacht werden kann? Im weitesten Sinne sind es die Erwachsenen. Genauer hingeschaut, sind es Autoren, Verleger, Buchhändler, Pädagogen/Erzieher und nicht zuletzt die Eltern. Hierbei ist völlig irrelevant, ob die über die Festlegung entscheidende Instanz literarisch, pädagogisch oder auf anderer Ebene autorisiert ist. Das, was von jedem beliebigen Erwachsenen als Kinder- und Jugendliteratur erachtet wird, ist folgendermaßen definiert:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Praktisch kann ein empfohlenes Hesse-Gedicht genauso dazugehören wie die eigens vom Dressler Verlag herausgegebene Reihe der Klassiker für Kinder. Die intentionale Kinder- und Jugendlektüre erhält mit einer explizit an jungen Lesern orientierten Buchproduktion sowie durch den, insbesondere seit der PISA-Studie wachsenden Bereich der Leseförderung, ein zunehmend breiteres, kreativeres wie buntes Spektrum.[13] Doch bei weitem nicht alles, was für die jungen Leser geschrieben und produziert wird, landet auf fruchtbarem Boden, sprich: Nicht alles, was jungen Menschen als geeignet zugewiesen wird, wird auch gelesen. Daraus ergibt sich eine weitere Definition:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Neben den Literaturempfehlungen wie -verbreitungen durch Erwachsene unterschiedlichster Professionen und Autoritäten werden zunehmend Kinder- und Jugendliche in die Gestaltung ihres eigenen Marktes mit einbezogen: durch Befragungen von Meinungsforschungsinstituten, Mitsprache in einer Kinderjury oder direkte Ansprache durch diverse Kinder- und Jugendbuchverlage.[14] Gerade dadurch gibt es eine positive Schnittmenge aus empfohlener und tatsächlich gelesener Lektüre, die sich folgendermaßen definiert:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Interessant und schwer greifbar sind im weiteren Verlauf jene Texte, die von Kindern und Jugendlichen gelesen werden, ohne allgemein als geeignet zu gelten. Gemeint kann damit sowohl die „heimliche“ Lektüre auf dem Dachboden sein, sowie die nicht geschätzte aber dennoch wissentlich tolerierte Lektüre. Als Beispiel hierfür sei allgemein die gänzlich verbotene, als „Schmutz und Schund“ bekämpfte Lektüre aufgeführt, sowie beispielsweise die bis heute aktuelle Jugendzeitschrift „BRAVO“.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Waren bei der intentionalen Kinder- und Jugendlektüre vom Grundsatz her alle Erwachsenen durch ihr Erwachsensein als solches zur Empfehlung von Lektüren autorisiert, ist das im Textkorpus der sanktionierten und nicht-sanktionierten Kinder- und Jugendliteratur anders. Blickt man in diesem Zusammenhang zurück auf die Historie, so bestimmte lange Zeit die Kirche den Literaturkanon, bis dieses Geschäft dann Organe des Staates übernahmen, „...die es wiederum an Gremien des säkularisierten Bildungswesens abgeben, die schließlich abgelöst werden von Instanzen der pädagogischen Fachöffentlichkeit“ (Ewers 2000, 20).[15]
Das Wort „Sanktion“ ist in diesem Kontext insofern als positiv zu bewerten, als damit unterschiedliche Formen der Auszeichnung und Würdigung gemeint sind.[16]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Kritisch zu hinterfragen sei in diesem Zusammenhang jedoch, wer aus welchen Beweggründen welche Sanktionen vornimmt. Die Tendenz, dass das herstellende und vertreibende Buchhandels- und Verlagswesen durch wachsende Markterfolge gleichzeitig mehr Entscheidungsrechte in Bezug auf Bestimmung von geeigneter Kinder- und Jugendlektüre erhält, führt zu einer Spaltung der intentionalen Kinder- und Jugendliteratur: zum einen in die unter 6. gekennzeichnete, sanktionierte Kinder und Jugendliteratur, die homogen mit dem pädagogisch-literarischem Interesse ist, und zum anderen in die „nicht-sanktionierte Kinder- und Jugendliteratur“.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Voraussetzung für nicht-sanktionierte Kinder- und Jugendliteratur, aber auch für alle von 1.-6. explizierten Lektüren und Literaturen ist, dass sie bereits vor ihrer o.g. Einteilung auf dem Buch- und Lesermarkt existent waren, und nicht eigens für diesen produziert wurden, oder erst durch die Entscheidung von Erwachsenen / Instanzen und durch das Leseverhalten von Kindern- und Jugendlichen zum Genre der Kinder- und Jugendliteratur gehören. Anderes gilt für die „spezifische Kinder- und Jugendliteratur“, die explizit für diesen einen Markt in Auftrag gegeben bzw. direkt vom Autor geschrieben wurde.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Zusammenfassend sollte nicht, trotz der vorangestellten Bestimmungen zur Abbildung kinder- und jugendliterarischer Realitäten, vom Inbegriff „der“ Kinder- und Jugendliteratur gesprochen werden. Vielmehr geht es darum, bei aller literatur- und erziehungswissenschaftlicher Systematik und Intention, eine Offenheit im Sinne von “Genremix“ (vgl. Daubert 1999) zuzulassen. Denn letztlich führte und führt eine sich ständig verändernde Wirklichkeit nicht nur zu einem sich wandelnden Markt, sondern auch zu neuen Perspektiven und Themen. Muss es trotzdem Prüf- und Kontrollorgane wie z.B. die Bundesprüfstelle geben? „Die Bundesprüfstelle[17] und ihr ehemaliger Leiter Rudolf Steffen gehen davon aus, dass die heutigen Erkenntnisse der Wirkungsforschung begründet vermuten lassen, dass Kinder und Jugendliche durch die Aufnahme von bestimmten Medienprodukten in ihrem sozial- und sexualethischen Reifungsprozess negativ beeinflusst werden und Schaden erleiden können. Zu den jugendgefährdenden Medien zählen „verrohend wirkende, zur Gewalttätigkeit, Verbrechen und Rassenhass anreizende, NS- und kriegsverherrlichende und verharmlosende, frauendiskriminierende und pornographische Medien. Mit diesen Worten erläuterte die Bundesprüfstelle 1989 in einem Gesamtverzeichnis indizierter Bücher den Ausgangspunkt ihrer Tätigkeit“ (Kaminski 1998). Hat man sich erst seit 1953 Gedanken über die Kinder- und Jugendgefährdung gemacht? Fest steht, dass der Wandel des Kinderbildes über die Jahrhunderte gleichsam einen veränderten literatur- und erziehungswissenschaftlichen Ansatz mit sich brachte. „Neu aufkommende Vorstellungen von Kindheit und Jugend erzeugten andere Erwartungen an eine passende Kinder- und Jugendlektüre“ (Ewers 2000, 23). Wie sich das Kinderbild und das damit verbundene pädagogische Handlungssystem der Kinder- und Jugendliteratur sowie ihre Geschichte verändert haben, wird im folgenden Abschnitt kurz aufgezeigt.
3.2 Die Geschichte der Kindheit und der Kinder- und Jugendliteratur
Beschäftig man sich mit der Kinder- und Jugendliteratur, hier insbesondere mit ihrer Legitimation im Gesamtkontext literarischer Gattungen, so stößt man beinahe zwangsläufig auf „Die Geschichte der Kindheit“ des Historikers Philippe Ariès. Der Titel erschien 1960 erstmals in Frankreich und hat in den 70er Jahren auch in Deutschland interdisziplinäre Wellen geschlagen. Die beiden Historien der Kindheit wie der Kinder- und Jugendliteratur stehen insofern in symbiotischer Beziehung zueinander, als das die Herausbildung wie das Bewusstmachen von Kindheit durch die Kinder- und Jugendliteratur verbreitet wurde, um dabei selbst von der Geschichte der Kindheit beeinflusst zu werden, bedenkt man, dass seit dem 16. Jahrhundert erstmals ein Interesse an der Altersbestimmung von Personen bzw. von Kindern entstand, und „erst im 17. Jahrhundert beginnt die Darstellung eines Kindes um seiner selbst Willen“ (Kaminski 1998, 9). Mit Beginn des 18. Jahrhunderts hatte sich also eine allgemeine Ansicht darüber durchgesetzt, dass es a) eine Kindheit gab, und b) diese zur natürlichen Ordnung der Dinge gehörte. Obgleich bis weit in das 18. Jahrhundert hinein zwischen Kindheit und Adoleszenz nicht unterschieden wurde, fügten sich Adjektive wie „schwach“, „unschuldig“ oder „verspielt“ mit zunehmender Selbstverständlichkeit in die gesellschaftliche Vorstellung von Kindheit ein. Wurden Kinder im Mittelalter ungeachtet ihrer Morphologie als kleine Erwachsene gesehen, behandelt und eingebunden, sollte das 18. und 19. Jahrhundert ihnen eine zunehmend kindgerechtere Bildung und Entwicklung zugestehen. Zwar betraf diese Entwicklung zunächst primär den Adel und das Bürgertum, ist sie trotzdem ein eindeutiges Zugeständnis an Kindsein und akzeptierte Kindheit. In dieser Zeit war das Handlungssystem „Privaterziehung“ im Hinblick auf die Kinder- und Jugendliteratur insofern von historischer Bedeutung, als dass der Privatlehrer gleichzeitig auch als (literarischer) Erzieher in Erscheinung trat. In dieser Zeit nahmen erstmals Pädagogen/Erzieher direkten Einfluss auf die Auswahl von Lektüre.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Was der Hauslehrer im 18./19. Jahrhundert leistete, übernahm in einem anderen Rahmen dann das System Schule. „Auf einer anderen Ebene spiegelt sich der Wandel der Kindheit in der Veränderung der Schule – und in der Identifizierung der Zeit der Kindheit mit der Schulzeit - , diese verändert sich von der sogenannten Scholarenfreiheit des Mittelalters zur modernen Disziplinarordnung. Es ändert sich ebenso die Position des Lehrers. Er ist nicht mehr „erster unter Gleichen“, sondern wird „Verwalter übergeordneter Autorität“ (Kaminski 1998, 10). Blieben sogenannte Arbeiterkinder im 19. Jahrhundert der Schule fern und wurden psychisch wie physisch durch Erwachsenenarbeit belastet und überfordert, sind es heute andere erschwerende Zustände, die der kindlichen Entwicklung entgegenstehen. Kontrolle, Reglementierung, enge Strukturen wie Leistungsdruck bestimmen in der heutigen Zeit den Kinderalltag mit. Konnten „Trümmerkinder“ sich mit kindlicher Phantasie in den Kriegsruinen unbeaufsichtigt bewegen und eigene Abenteuer kreieren wie erleben, gibt es heutzutage kaum noch unbeaufsichtigte kindliche Freiräume. Zudem ist Kindheit im 21. Jahrhundert durch fortschreitende Technologien eine „Medienkindheit“ (vgl. Hentig 1975). Einmal mehr sind Lehrer (und selbstverständlich auch Eltern) in ihrer pädagogischen Funktion gefordert, die Gradwanderung zwischen zeitgemäßer Medienrezeption und passivem Sichergeben zu begleiten. Hierzu gehört auch die Hilfestellung im Bereich der Privatlektüre wie eine reizvolle Auswahl der Schullektüre. Denn neben dem pädagogisch funktionalen Wert des Lesens, der Vermittlung von Wissen und Erfahrung wie dem erlebnishaften Erfassen ist Lesen ein wichtiger Zugang zur Welt (vgl. Maier 1993). Abschließend lässt sich folgendes feststellen: Sowie die Erziehungswissenschaft und Pädagogik im Laufe ihrer Entwicklung im Ansatz immer wieder schwankte zwischen „kindlichem Schonraum“, „Konfrontation und schonungsloser Einbindung in die Realität“ bis hin zu “Laissez-faire“, zeichnete die Kinder- und Jugendliteratur symbiotische Entwicklungen zum jeweils aktuellen pädagogischen Ansatz. Wie diese Entwicklung, einhergehend mit politischen und historischen Veränderungen, schließlich zum zeitgeschichtlichen Kinder- und Jugendbuch führt, verdeutlicht der nächste Abschnitt.[18]
3.3 Kinder- und Jugendliteratur nach 1945: Heile Welt bis Holocaust
Dieser Titeltext der Jugendzeitschrift „Pinguin“, herausgegeben von Erich Kästner[19] im Jahr 1946, ist in keiner Weise repräsentativ für die Stimmung der kinder- und jugendliterarischen Landschaft unmittelbar nach dem Krieg. Ganz im Gegenteil: Das literarische Leben nach dem Zweiten Weltkrieg wurde einerseits durch Papiermangel und Zensurmaßnahmen der Alliierten beschnitten, und andererseits war noch kein Material von jungen, unpolitischen Autoren greifbar. „Für die Literatur wie für jeden anderen Lebensbereich markiert die Jahreszahl 1945 den entscheidenden Einschnitt in der jüngsten Geschichte. Daran ändert die Tatsache nichts, dass viele Menschen versuchten, weiterzuleben wie bisher; dass z.B. die meisten Kinderbuchautoren weiterschrieben, als sei nichts geschehen“ (Mattenklott 1989, 16). Auch wenn nationalsozialistisches Gedankengut nicht mehr den Schulunterricht beherrschte, blieben seine autoritären Grundströmungen bis in die 50er Jahre erhalten und lebten auch in manchem kinderliterarischen Werk weiter. Hans Baumann[20] und Alfred Weidenmann[21] setzten in ihren Abenteuer- und Sachbüchern paradebeispielhaft den unerschütterlichen Glauben an bedingungslose Kameradschaft, Autorität von oben sowie straffe Gruppenhierarchien fort. Parallel zur Bewahrung des Altbewährten setzte der Trend zur Vermittlung einer heilen Welt ein. Nach den Kriegsjahren, geprägt von Schmerz, Verlust, Hunger und Einschränkung, flüchteten sich die Menschen in Schweigen und Verdrängung über das Vergangene. Und die Kinder- und Jugendliteratur folgte fügsam mit Trotts[22] heiler „Pucki“-Welt. Diese restaurativen Tendenzen ließen die deutsche Bevölkerung zurückblicken auf vermeintlich bessere Zeiten vor 1933 und ihre Klassiker wie „Robinson Crusoe“, „Grimms Märchen“, „Winnetou“ u.v.m. „Auf diese Weise half die Kinderliteratur und ihre Pädagogik bei der Stabilisierung der „Verschwörung des Schweigens“ (Kaminski 1990, 303). Der CDU-Abgeordnete Emil Kemmer, von 1952-1961 Vorsitzender des Ausschusses für Kinder- und Jugendfragen, fasst die „ideale Jugend der 50er“ in einer Rede im Deutschen Bundestag 1952 treffend zusammen: „Wir wollen ohne jede Prüderie und ohne jedes Muckertum eine saubere, quicklebendige Jugend, der alles offen stehen soll, was schön und gut ist, von der aber auch ferngehalten werden muss, was ihr schadet“ (Schikorsky 2003, 141).
Enid Blyton[23] mit ihrer Abenteuerreihe „Fünf Freunde“, der „Geheimnis“-Serie, den Internats-Mädchengeschichten „Hanni und Nanni“ wie den Pferdeabenteuern von „Dolly“ standardisierte Konflikte und schematische Lösungen in schlichter Sprache, schrieb stets jugendgerecht in gut-böse-Kategorien und konnte trotzdem ein Aufbrechen der Harmonie und idealisierten Welt nicht aufhalten. Aus der Vorstellung einer autonomen Kindheit bildet sich in der zweite Hälfte der 50 er Jahre ein eigenständiges Profil der Kinder- und Jugendliteratur in Deutschland heraus.
Junge Autoren wie Michael Ende[24] und Otfried Preußler[25] sprechen den jungen Lesern eine eigene Entwicklungswelt, fern der belasteten und vorgegebenen Erwachsenenrealität zu und setzen dabei auf eine kindlich schöpferische Kraft, die sich zu Selbstvertrauen und Stärke entwickelt. Hierbei geht es nicht um die Konfrontation mit der Realität, sondern um eine sanfte Heranführung an diese durch Phantasie und Imagination. Phantasiegestalten und positive Helden wie „Die kleine Hexe“, „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ wie auch Astrid Lindgrens[26] „Pippi Langstrumpf“ entheroisieren, entzaubern und bauen Hierarchien und Machtbilder ab. Neben der romantischen Grundidee von einer Erneuerung der Gesellschaft durch Phantasie, Kunst und Poesie, auch „fantastische Zivilisationskritik“ (Schikorsky 2003, 147) genannt, wurden weitere Schritte in Richtung Gesellschaftskritik getan. James Krüss[27] verfasste mit „Tim Thaler oder das verkaufte Lachen“ (1962) einen märchenhaften Bildungs- und Abenteuerroman, um auf diesem neuen Weg Kritik an der kapitalistischen Konsumwelt der Wirtschaftswunderjahre zu üben. „Für Krüss hatte Fantasie eine Aufklärungsfunktion zu erfüllen, sie sollte als das
[...]
[1] Im Schwerpunkt geht es bei dieser Arbeit jedoch nicht um die didaktische Aufbereitung von Kinder- und Jugendliteratur im Schulunterricht. Gleichwohl kann die im Forschungskontext erarbeitete Methode sowie das Herangehen an Biographie und Werk als eine didaktische Vorarbeit gesehen werden, aus der als Folgeprojekte u.a. Modelle entwickelt werden sollen, die insbesondere einen fächerübergreifenden Unterricht ergänzen wie erweitern können.
[2] Kordon, K. (1943); deutscher Kinder- und Jugendbuchautor. Schrieb in gleicher Reihe „Die Zeit ist kaputt. Die Lebensgeschichte des Erich Kästner“ und erhielt dafür 1994 den Jugendliteraturpreis.
[3] vgl. Heinz-Hermann Krüger , Rede zur Eröffnung des Promotionskollegs „ Kinder und Kindheiten im Spannungsfeld gesellschaftlicher Modernisierungen“, Internetressource: www.uni-kassel.de/fb04/verwaltung/homeBE2/promotionskolleg/eroeffnung.
[4] Bernhard, T. (1931); die autobiographischen Erzählungen „Die Ursache“ (1975), „Der Keller“ (1976), „Die Kälte“ (1981) und „Ein Kind“ (1982) sprechen von einer Jugend und Kindheit als uneheliches Kind. Demütigung, Leiderfahrungen und Krankheiten begründen seine kontinuierlich Befassung mit der Zerstörung individuellen Lebens.
[5] Die Autobiographie der drogensüchtigen Christiane F. „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ (1979) stand in den 80er Jahren lange Zeit auf den Bestsellerlisten und wurde von Jugendlichen wie Erwachsenen gelesen. Es wird der Einblick in eine bis dahin tabuisierte Welt der Drogen, Prostitution und Beschaffungskriminalität gewährt, und dem Leser durch Authentizität glaubwürdig wie schockierend vermittelt.
[6] Neben zahlreichen Aufsätzen sind hier allein an Büchern zu nennen: Stephen Butterfield (1974), Sidonie Smith (1974), Rebecca Chamlers Barton (1976), Klaus Ensslin (1983); vgl. auch die einschlägige Primär-Bibliographie von Russel C. Brignano (1974)
[7] Kempowski, W. (1929); deutscher Schriftsteller. Er hat sich als Sach- und Kinderbuchautor, Verfasser von Hörspielen und Gründer eines Archivs deutscher Familiengeschichten einen Namen gemacht und gilt als Gesellschaftsromancier von literarischem Rang.
[8] „.Can we not suggest...that whatever the writer does is in fact governed by the technical demands of self-portraiture and thus determind in all it’s aspects, by the ressources of his medium” (de Man 1979, 920).
[9] Seuse, H. (1295-1366); deutscher Mystiker. Mit dem „Büchlein der Wahrheit“ (1326) versuchte er die Mystik Meister Eckharts zu verteidigen. Weitere Schriften wie die „Vita“ , das „Kleine Briefbüchlein“ und das „Büchlein der ewigen Weisheit“ sind von Seuses Frömmigkeit wie dem emotionalen Erleben seiner mystischen Vereinigung mit Gott geprägt.
[10] Dilthey, W. (1833-1911; deutscher Philosoph, Psychologe und Pädagoge. Schuf mit seinem lebenslangen Projekt „ Kritik der historischen Vernunft“ die Grundlage für die von ihm benannten Geisteswissenschaften.
[11] Foucault, M. (1926-1984); französischer Philosoph. Hielt 1969 einen Vortrag am Collège de France mit dem Titel „Was ist ein Autor?“. Hiermit leistete er einen wichtigen Beitrag zu der Debatte um die Rolle des Autors in der modernen Literatur.
[12] Ewers, Hans-Heino, Professor für Germanistik / Literaturwissenschaft mit dem Schwerpunkt Kinder- und Jugendliteratur an der Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt a.M. Seit 1990 Direktor des Instituts für Jugendbuchforschung. Publikationen u.a. zur Theorie der Kinder- und Jugendliteratur vom 18. bis zum 20. Jahrhundert, zum aktuellen Wandel der Kinder- und Jugendmedien wie zur zeitgeschichtlichen Kinder- und Jugendliteratur.
[13] „Die PISA-Studie 2000 gibt deutschen Schülerinnen und Schülern nicht nur ein „Mangelhaft“ in Sachen Lesekompetenz. Bei der Erhebung zeigte sich auch, dass in Deutschland immerhin 42% der 15-Jährigen nicht zum Vergnügen lesen. Im internationalen Vergleich wird dieser Prozentsatz von keinem anderen Land übertroffen“ (B. Stelzner / D. Breitmoser, in: Das Jugendbuch. München: Arbeitskreis für Jugendliteratur).
[14] Die Göttinger Jubu-Crew besteht aus 15 Jugendlichen zwischen 8 und 17 Jahren und wählt monatlich ein „Buch des Monats“. Ein Mitglied der Crew schreibt jeweils eine Rezension, die an zahlreiche internationale Adressen verschickt wird (vgl. Kinder- und Jugendbuchverlage von A-Z. München: Arbeitsgemeinschaft von Jugendbuchverlagen 2006).
[15] Hier einige wichtige Institutionen der pädagogischen Fachöffentlichkeit: Stiftung Lesen, Mainz; Arbeitskreis für Jugendliteratur e.V., München; Institut für Jugendbuchforschung, Frankfurt a.M.; Bulletin Jugend und Literatur, Hamburg; Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW).
[16] Hier die wichtigsten Preise und Auszeichnungen: a) Deutscher Jugendliteraturpreis: wird als einzigere Staatspreis für Jugendliteratur seit 1956 verliehen. Gestiftet vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, organisiert durch Arbeitskreis Jugendliteratur e.V., München. b) Großer Preis der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur e.V.: jährliche Auszeichnung für hervorragende Leistungen auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendliteratur; zusätzlich Sonder- und Förderpreis für Autoren, Übersetzer und Literaturvermittler. c) Hans-Christian-Andersen-Preis: wird alle zwei Jahre vom internationalen Kuratorium für das Jugendbuch für das Gesamtwerk eines Autoren und eines Illustrators vergeben. d) Evangelischer Buchpreis: seit Mai 1998 wird mit dem Preis, gestiftet vom Deutschen Verband Evangelischer Büchereien, ein Jugendbuch ausgezeichnet. Er versteht sich als Leserpreis, da alle Vorschläge aus den öffentlichen Büchereien, also vom Leser selbst kommen. e) Katholischer Kinder- und Jugendbuchpreis: wurde 1977 von der Deutschen Bischofskonferenz gestiftet und wird seit 2001 jährlich ausgeschrieben. Intendiert ist die Förderung religiöser Kinder- und Jugendliteratur aller Altersstufen bis etwa zu 14 Jahren.
[17] Bundesprüfstelle: Kontrollinstanz, die sich 1953 für die Durchführung des „Gesetzes über das jugendgefährdende Schriftentum“ verantwortlich zeichnete. Die Berechtigung dieser Einrichtung wird unter anderem mit Argumenten der sozial-kognitiv orientierten Wirkungsforschung begründet, die behauptet, dass Medien Wirkungen zeitigen und den Einzelnen prägen. Wir lernen an Modellen und durch Vorbilder, weshalb es nicht länger erlaubt sei, die Annahme der alten Katharsis-Theorie zu übernehmen. Es gibt, so die sozialkognitiv orientierte Wirkungsforschung, keine Katharsis durch die Beobachtung von Modellen, sondern wir haben eher Anlass zu der Vermutung, dass wir Modelle imitieren und Verhalten habitualisieren“ (vgl. Kaminski, W. 1998, 13).
[18] Zur Einordnung in den historischen Gesamtkontext dienen „graue Orientierungsleisten“, welche signifikante zeitgeschichtliche Ereignisse einblenden.
[19] Kästner, E. (1899-1974); deutscher Schriftsteller. „Gebrauchslyriker“ und Romancier für Kinder und Erwachsene. Ferner machte er sich einen Namen als Satiriker, Journalist und Drehbuch-autor. „Emil und die Detektive“ (1929), „Pünktchen und Anton“ (1931) sowie „Das fliegende Klassenzimmer“ (1933) gehören u.a. zu seinen bekanntesten Kinderbüchern.
[20] Baumann, H. (1914-1988); deutscher Lyriker, Liedschreiber für Nationalsozialisten sowie Kinder- und Jugendbuchautor und Übersetzer. Der Schwerpunkt seines Schaffens nach dem Krieg lag auf der Darstellung historischer Ereignisse und der Konfrontation der Hauptfiguren mit der Macht und dem Charisma realer Personen. Sein Wirken während des Dritten Reiches ist bis heute umstritten.
[21] Weidemann, A. (1959); deutscher Kinder- und Jugendbuchautor. Sein Kinderkrimi „Gepäckschein 666“ (1965) gehört mit zu seinen bekanntesten Veröffentlichungen der Nachkriegszeit.
[22] Trott, M. (1880-1945); deutsche Kinder- und Jugendbuchautorin, Erzieherin sowie radikale Frauenrechtlerin bis in die späten 20er Jahre. Insbesondere durch ihre „Pucki“-Bände (ab 1936), welche seit 1950 in einer 7 Millionen Auflage verkauft worden sind, erreichte sie weltweit einen hohen Bekanntheitsgrad.
[23] Blyton, E.M. (1897-1968); eine der bekanntesten englischen Kinder- und Jugendbuchautorinnen des 20. Jahrhunderts. Seit 1950 wurden ihre Bücher auch in Deutschland veröffentlicht. Insgesamt schrieb sie mehr als 700 Bücher und 10.000 Kurzgeschichten. Die Reihen „Hanni und Nanni“, „Die Insel der Abenteuer“ sowie „Dolly“ und die „Geheimnis“ -Serie gehören zu den bekanntesten Veröffentlichungen.
[24] Ende, M. (1929-1995); deutscher Schriftsteller, Kinder- und Jugendbuchautor sowie Anthroposoph. Seine Werke wurden in über 45 Sprachen übersetzt, haben eine Gesamtauflage von 20 Millionen erreicht, weshalb M. Ende zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Schriftstellern zählt. „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ (1960), „Momo“ (1973) und die „Unendliche Geschichte“ sind seine bekanntesten Werke.
[25] Preußler, O. (1923); gehört zu den erfolgreichsten deutschen Kinder- und Jugendbuchbuchautoren. U.a. „Der kleine Wassermann“ (1956), „Bei uns in Schilda“ (1950), die Geschichten vom „Räuber Hotzenplotz“ (1962, 1969, 1973) sowie „Krabat“ (1971) haben ihn in über 40 Ländern bekannt werden lassen.
[26] Lindgren, A. (1907-2002); schwedische Schriftstellerin, gehört zu den bekanntesten Kinderbuchautorinnen der Welt. Sie ist die geistige Mutter von „Pippi Langstrumpf“ (1945), „Ronja Räubertochter„ ( 1981), „Kalle Blomquist“ (1946) sowie den Kindern aus „Bullerbü“ (1947) und vielen anderen Figuren.
[27] Krüss, J. (1926-1997); deutscher Dichter und Schriftsteller. Seinem ersten Kinderbuch „Der Leuchtturm auf den Hummerklippen“ (1956) folgten u.a. „Mein Urgroßvater und ich“ (1959) und „Timm Thaler oder das verkauft Lachen“ (1962).
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2006
- ISBN (eBook)
- 9783836611558
- DOI
- 10.3239/9783836611558
- Dateigröße
- 5.3 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Münster – Erziehungswissenschaften, Erziehungswissenschaften/Psychologie
- Erscheinungsdatum
- 2008 (April)
- Note
- 0,7
- Schlagworte
- biographieforschung kinder- jugendbuchautoren kriegs- nachkriegsgeneration kriegskind narrativ
- Produktsicherheit
- Diplom.de