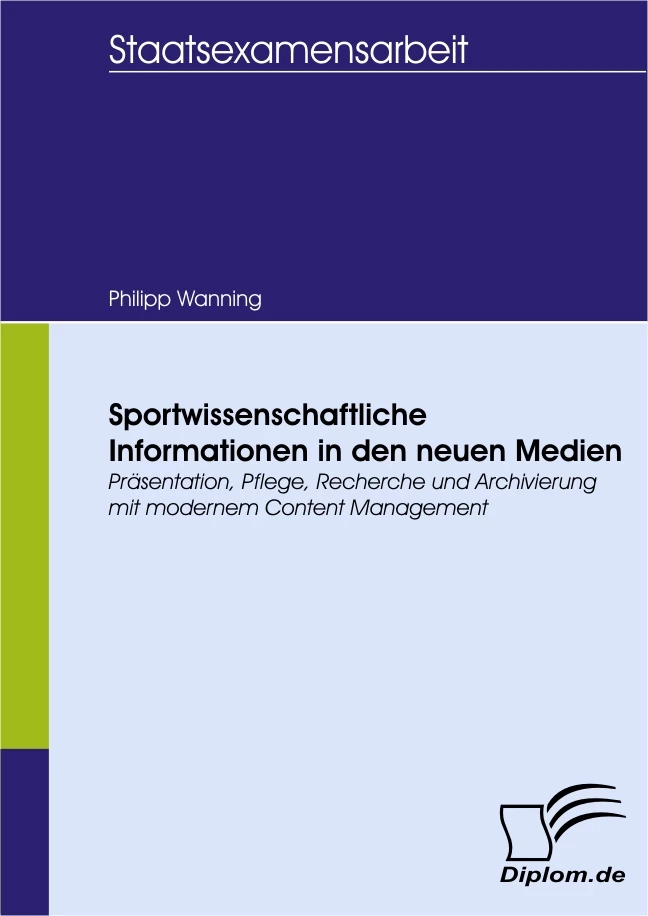Sportwissenschaftliche Informationen in den neuen Medien
Präsentation, Pflege, Recherche und Archivierung mit modernem Content Management
Zusammenfassung
Das Vorlesungsverzeichnis im Internet, ein Beamer im Hörsaal und die schnelle Referatsvorbereitung dank Google: Dass dies nicht alles sein konnte, was die Sportwissenschaft vom Informationszeitalter zu erwarten hatte, war für mich während des Studiums immer mehr als nur eine Hoffnung.
Auch wenn an unserem Institut sportinformatorische Themen bisher keine Rolle spielten, blieben mir die hoffnungsvollen Signale aus der Ferne zum Beispiel durch die Dokumentation des Projekts Sportwissenschaft ins Internet nicht verborgen.
Dabei stand für mich als Betreuenden des institutseigenen Internetangebots immer der Gedanke einer effizienten Verbreitung sportwissenschaftlicher Informationen über die Neuen Medien im Zentrum meines Interesses. So rieb ich mich beispielsweise beim Aufschlagen der dvs-Informationen aus dem März 2001 an dem fehlenden Merkmal wissenschaftlicher Publikationen im Analyseraster der Untersuchung institutioneller Internetauftritte, genauso wie ich mich über die im gleichen Heft dargestellte Vision eines vernetzten Internetportals für die Sportwissenschaft freute.
Daher möchte ich den Rahmen dieser Examensarbeit nutzen, um einen Überblick der Sportinformatik im Allgemeinen zu erarbeiten, das Thema der elektronischen Publikation weitergehend zu untersuchen und diese Elemente abschließend in einer praktischen Anwendung zusammenzuführen.
Dementsprechend ist auch meine Arbeit in einen theoretischen Abschnitt mit dem Titel Neue Medien und Sportwissenschaft sowie einen praktischen Bereich unter der Überschrift Online-Publikation und Content Management aufgeteilt.
Die deutlich umfangreicheren theoretischen Betrachtungen bewegen sich dabei von einer medientheoretischen Analyse über die Bedeutung der Neuen Medien innerhalb der Wissenschaft zu den diesen Teil bestimmenden Punkten Sportinformatik und Elektronisches Publizieren. In der Annahme, dass die Sportinformatik innerhalb der Sportwissenschaften eher ein Nischendasein fristet, wurde ich von der Vielzahl der vorgefundenen Arbeiten doch überrascht. Da das Standardwerk von Prof. Dr. J. Perl schon 1995 konzipiert wurde, arbeitete ich mich im Kontext der aktuellen Entwicklungen durch das dort dargestellte Spektrum der Sportinformatik.
Eine dieser Entwicklungen ist die Elektronische Publikation, der bezüglich unseres Produktions- und Rezeptionsverhaltens nicht nur in der Wissenschaft ein revolutionäres Potential nachgesagt wird. Inwieweit […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung
II. Neue Medien und Sportwissenschaft
1. Die Definitionsproblematik
2. Neue Medien in der Wissenschaft
2.1. Auswirkungen auf die universitäre Lehre
2.2. Einsatz Neuer Medien in der Forschung
3. Sportinformatik
3.1. Entwicklung
3.2. Gegenstands- und Anwendungsbereiche
4. Elektronisches Publizieren
4.1. Grundlagen
4.2. Kategorien
4.3. Elektronische Bücher (E-Books)
4.4. Elektronische Zeitschriften (E-Journals)
4.5. Graue Literatur
III. Online-Publikation und Content Management
1. Ziel des Projekts
2. Einsatz eines Content Management Systems am IFSW
2.1. Systemauswahl
2.2. Frontend-Entwicklung
2.3. Architektur
2.4. Produktion
3. OAI-konforme Publikation
3.1. Theoretische Grundlagen
3.2. Realisierung am IFSW
IV. Schlussbetrachtungen
V. Literaturverzeichnis
I. Einleitung
Das Vorlesungsverzeichnis im Internet, ein Beamer im Hörsaal und die schnelle Referatsvorbereitung dank „Google“: Dass dies nicht alles sein konnte, was die Sportwissenschaft vom Informationszeitalter zu erwarten hatte, war für mich während des Studiums immer mehr als nur eine Hoffnung.
Auch wenn an unserem Institut sportinformatorische Themen bisher keine Rolle spielten, blieben mir die hoffnungsvollen Signale „aus der Ferne“ – zum Beispiel durch die Dokumentation des Projekts „Sportwissenschaft ins Internet“[1] von Prof. Dr. Claus Tiedemann und Dr. Klaus-Peter Elpel – nicht verborgen.
Dabei stand für mich – als Betreuenden des institutseigenen Internetangebots – immer der Gedanke einer effizienten Verbreitung sportwissenschaftlicher Informationen über die Neuen Medien im Zentrum meines Interesses. So rieb ich mich beispielsweise beim Aufschlagen der „dvs-Informationen“ aus dem März 2001 an dem fehlenden Merkmal wissenschaftlicher Publikationen im Analyseraster der Untersuchung institutioneller Internetauftritte[2], genauso wie ich mich über die im gleichen Heft dargestellte Vision eines vernetzten Internetportals für die Sportwissenschaft[3] freute.
Daher möchte ich den Rahmen dieser Examensarbeit nutzen, um einen Überblick der Sportinformatik im Allgemeinen zu erarbeiten, das Thema der elektronischen Publikation weitergehend zu untersuchen und diese Elemente abschließend in einer praktischen Anwendung zusammenzuführen.
Dementsprechend ist auch meine Arbeit in einen theoretischen Abschnitt mit dem Titel „Neue Medien und Sportwissenschaft“ sowie einen praktischen Bereich unter der Überschrift „Online-Publikation und Content Management“ aufgeteilt.
Die deutlich umfangreicheren theoretischen Betrachtungen bewegen sich dabei von einer medientheoretischen Analyse über die Bedeutung der Neuen Medien innerhalb der Wissenschaft zu den diesen Teil bestimmenden Punkten „Sportinformatik“ und „Elektronisches Publizieren“. In der Annahme, dass die Sportinformatik innerhalb der Sportwissenschaften eher ein Nischendasein fristet, wurde ich von der Vielzahl der vorgefundenen Arbeiten doch überrascht. Da das Standardwerk von Prof. Dr. J. Perl schon 1995 konzipiert wurde[4], arbeitete ich mich im Kontext der aktuellen Entwicklungen durch das dort dargestellte Spektrum der Sportinformatik.
Eine dieser Entwicklungen ist die Elektronische Publikation, der bezüglich unseres Produktions- und Rezeptionsverhaltens – nicht nur in der Wissenschaft – ein revolutionäres Potential nachgesagt wird. Inwieweit hier Anspruch und Wirklichkeit übereinstimmen und welche Entwicklungen in der Zukunft zu erwarten sind, ist Inhalt des gewichtigsten Teils meiner Arbeit, der sich besonders auf die Untersuchungen zum Thema „E-Journals“ stützt.
Nach der theoretischen Erörterung der „Elektronischen Publikation“ setze ich dieses Thema in die Praxis um. Unter dem Titel „Online-Publikation und Content Management“ stelle ich abschließend die Implementierung des Content Management Systems Imperia mit dem Schwerpunkt einer – aus informationstheoretischer Sicht optimierten – Veröffentlichung digitaler Dokumente des Instituts für Sportwissenschaften der Universität Hannover vor.
Bedanken möchte ich mich bei Herrn Prof. Dr. Gunter A. Pilz, der sich dieses Themas angenommen hat, obwohl es wahrlich nicht zum Standardrepertoire unseres Instituts gehört, und bei dem Leiter des Arbeitsbereichs EDV am Fachbereich Erziehungswissenschaft der Universität Hannover Herrn OStR Uwe Meier, der als zweiter Gutachter die technischen Aspekte meiner Arbeit betreut hat.
II. Neue Medien und Sportwissenschaft
1. Die Definitionsproblematik
Neue Medien hat es immer gegeben – und zwar seit Tausenden von Jahren. Warum hält sich dieser vergängliche und undifferenzierte Begriff nun schon seit einem halben Jahrhundert für die Beschreibung jeglicher medialer Phänomene rund um den Computer?
Bei den folgenden Ausführungen zu diesem Thema müssen die enormen gesellschaftlichen Auswirkungen der Mitte des letzten Jahrhunderts in alle Lebensbereiche einziehenden Nutzung von elektronischer Datenverarbeitung und Mikrotechnologie beachtet werden. Durch diesen als „zweite industrielle Revolution“ (Dastyari, 2000, S. 153) bezeichneten Siegeszug der Computer erhielten alle Aspekte dieser Technologie besondere Aufmerksamkeit und sind aufgrund ihrer technischen Komplexität und rasanten Entwicklung für einen Großteil der Bevölkerung schwer zu erfassen.
Dies mag zwar die Beständigkeit des Begriffs in den Massenmedien erklären, reicht aber zur Begründung der auffälligen Definitionsschwierigkeiten in der Wissenschaft nicht aus. So wird er seit den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts für alle neuen Technologien vom Radio bis zum Bildschirmtext „BTX“ (Lehnhardt, 1983, S. 24 ff.) verwendet und ist weder inhaltlich noch formal klar definiert. Dies liegt zum großen Teil an der semantischen Bedeutung des Wortes „Neue“, das in der Medientheorie teilweise als Gattungsbegriff und teilweise als Adjektiv verstanden wird. Hier ist die sich seit etwa 15 Jahren manifestierende Verengung des Begriffs auf die Beschreibung von computergestützten Medien der erste sinnvolle Schritt, um eine angemessene Definition zu entwickeln.
Diese Differenzierung möchte ich anhand eines aktuellen Medienkonzepts näher erläutern. Dazu nutze ich die mediengeschichtliche Einordnung dieses Themenkomplexes von Werner Faulstich (2000, S. 31 ff.). Diese hat sich in der gesamthistorischen Betrachtung in Konkurrenz zu rein kommunikationstheoretischen Ansätzen als sinnvolle Möglichkeit zur modellhaften Darstellung der Medienentwicklung durchgesetzt. Faulstich hat dazu ein Vier-Phasen-Modell entwickelt, das auf der Einteilung der Medien in Primär-, Sekundär-, Tertiär- und Quartär-Medien basiert[5]. Die Phase A ist dabei dominiert von Primär-(Mensch-)Medien und datiert bis ins 16. Jahrhundert. Sie wird mit der Verlagerung auf Sekundär-(Druck-) Medien von der Phase B abgelöst. Ab 1900 definiert Faulstich die dritte Phase mit der Dominanz von Tertiär-(elektronischen) Medien und mit den Neuen Medien beginnt Ende des 20. Jahrhunderts die Phase D, die durch Quartär-(digitale) Medien geprägt wird.
Faulstichs Modell bietet drei interessante Ansatzpunkte zur Klärung des Begriffs „Neue Medien“:
Der erste zeigt eine auffallende temporale Verkürzung der Phasen, in denen Medien entstanden und ihre Dominanz entfalteten. Während Bücher und Zeitschriften noch rund 300 Jahre von der Erfindung des Drucks bis zum Massenmedium brauchten und das Fernsehen für seine Entwicklung immerhin etwa 50 Jahre benötigte, bestimmte das Internet in Form des World Wide Webs (WWW) schon nach wenig mehr als fünf Jahren weite Teile des öffentlichen und privaten Lebens. Dadurch stand der Forschung viel weniger Zeit zur Verfügung, auf aktuelle technologische Entwicklungen adäquat zu reagieren und differenzierte Modelle zu entwickeln. Weiterhin war dieses Thema der etablierten Forschergemeinde in den Anfangsjahren auch aufgrund der technischen Komplexität wenig vertraut, so dass die ersten Beschreibungen der Phänomene eher „unwissenschaftlich-normatives Niveau“ hatten, „da sie von Spekulationen über das künftig technisch Machbare auf die gegenwärtige Bedeutung und Funktion“ des Mediums schlossen (Dastyari, 2000, S. 153). Es entstanden Worthülsen wie „Cyberspace“ oder „Interaktivität“, die erst nach und nach von der Forschung erfasst und gefüllt wurden und werden.
Der zweite Gesichtspunkt besteht in der Tendenz zur Medien-Diversifizierung auf dem Weg in die Moderne. Mit Buch, Zeitung und Zeitschrift sowie weiteren Druckerzeugnissen wie Plakaten oder Flugblättern gab es auch in der Phase B schon eine Vielzahl inhaltlich und formal unterschiedliche Ausprägungen. Als Kategorie blieben sie allerdings klar als Druckerzeugnisse einzuordnen. Eine vom Ansatz her ähnlich globale Kategorisierung ist in der Einteilung der verschiedenen Ausprägungen der Neuen Medien als „Digitale Medien“ zu beobachten.
So beschreibt etwa Simanowski (2002, S. 9) die Neuen Medien als „die auf dem Prinzip des digitalen Codes basierenden Speicher- und Übertragungstechnologien Computer, Diskette, CD-ROM, DVD und Internet“. Auch Winko (1999, S. 511) versucht sich mit einer technischen Definition und schreibt: „… neuer Medien – also elektronischer Digitalmedien, die an den Bildschirm als Repräsentationsform gebunden sind – …“.Oft wird auch die Speicherung in binärer Sprache, die Digitalität[6], als alleiniges Kennzeichen genannt. Überspitzt bezeichnet Kittler (1999, S. 65) es als „Euphemismus, von Neuen Medien im Plural zu reden“, wo es doch nur „ein einziges neues Medium, nämlich Digitalcomputer gibt“.
Es stellt sich insoweit die Frage, ob das Merkmal der digitalen Speicherung allein ausreicht, um eine Mediengattung zu bestimmen. Wird eine alte Tonbandaufnahme nur durch Digitalisierung und Speicherung auf eine DVD schon ein Neues Medium? Welcher Unterschied besteht darin, ob ein Film analog oder digital auf die Leinwand geworfen wird? Ist ein Medium wie das E-Book, dessen erklärtes Ziel es ist, möglichst eine Originalnachbildung des Buches zu liefern, schon aus dem Grund ein Neues Medium, weil die Informationen nicht mehr auf Papier gedruckt, sondern in Einsen und Nullen gespeichert und auf neuartigen Folien präsentiert werden? In diesen Fällen wird der Computer, bzw. die digitale Speicherung, nur als Werkzeug zur Medien-Präsentation oder Verwaltung genutzt und qualifiziert sich noch nicht zu einem eigenen Medium. Dastyari (2000, S. 153) spricht hier von „Computer als Peripheriegerät von Medien“ und Jens Schröter weist besonders auf die Definitionsschwäche des Begriffs Computer hin:
Der dispersive Computer … wird je anders metaphorisiert, programmiert, mit anderen Peripherien verschaltet, um ein jeweils anderes ‚Neues Medium’ (oder andere Maschinen) hervorzubringen. Der Computer im ‚Reinzustand’ ist kein Medium insbesondere, enthält aber potentiell jedes Medium approximativ. (Schröter, 2004a, S. 398)
Damit erscheint eine rein technische Definition als deutlich zu kurz gefasst. Wenn dieser Aspekt auch eine entscheidende Rolle in einer Definition spielen muss, fehlt bei den dargestellten Versuchen klar die Beachtung der kommunikativen Perspektiven der Medientheorie. Diesen Mangel hat auch der zu Beginn der technischen Entwicklung unternommene Versuch, die Neuen Medien lediglich als Weiterentwicklung bestehender, alter Medien zu bestimmen.
Kommunikationswissenschaftlich betrachtet und nach publizistischen Kriterien eingeschätzt handelt es sich (...) de facto bei den neuen Medien lediglich um erweiterte und neue Medientechniken, eigentlich um nichts anderes als um neue Distributionsformen längst bekannter und entwickelter Medien. (Schiemann, 1987, S. 14 ff.)
Diese Sicht gerät nicht nur angesichts des genuin Neuen, das mit der Entwicklung des Internets (als Synonym für webbasierte Dienste wie z.B. WWW, Chat, E-Mail, …) verbunden ist, deutlich zu kurz. Auch kommunikationstheoretisch sind die Online-Medien nicht mit den bekannten Sender-Empfänger-Modellen zu erfassen. Allein bei der Navigation durch Internetseiten (in ihrer Funktion als Hypertext-Dokumente) wird aus dem Rezipienten der Produzent seines individuellen Medienangebots. Betrachtet man noch deutlich interaktivere Möglichkeiten wie z.B. Kommentarsysteme, Chats oder Blogs[7] wird die medientheoretische Neuartigkeit der Online-Medien deutlich.
Somit kann zum zweiten Gesichtspunkt konstatiert werden, dass im Gegensatz zu den bisherigen Entwicklungsphasen aufgrund der zunehmenden Diversifizierung eine rein technische Definition nicht gelingen kann.
Während die auf den ersten beiden Aspekten beruhenden Konzepte demnach nicht zu überzeugen vermögen, erscheint der dritte Ansatzpunkt für eine aktuelle Definition der Neuen Medien deutlich hilfreicher. Parallel zu der historischen Einordnung in die Phasen A bis D greift Faulstich mit den Primär-, Sekundär-, Tertiär- und Quartär-Medien auf ein Modell zurück, das – wie die Ansätze von Simanowski und Winko – auf technischen Aspekten basiert. Über diesen objektorientierten Ansatz hinaus integriert es aber bei den Quartär-Medien, die als Synonym für die Neuen Medien angesehen werden können, mit dem Hinweis auf die Sender-Empfänger-Beziehung die entscheidende kommunikationswissenschaftliche Perspektive. So erhält beispielsweise das Abspielen eines Tonbands über digitale Technik in Faulstichs Modell nicht den „Ritterschlag“ zum Neuen Medium, weil auch das Abspielen eines Tonbands über digitale Technik nichts an der klassischen Produzent-Rezipient-Beziehung verändert. Der kombinierte Blick von objekt- und kommunikationsorientierter Betrachtung, der in der Betrachtung von Primär-, Sekundär- und Tertiär-Medien nicht bemüht wird und somit innerhalb des Theoriemodells einen deutlichen Bruch erkennen lässt, deutet schon an, dass diese Definition in den nächsten Jahren noch wachsen wird. Besonders der kommunikationswissenschaftliche Bereich erfordert noch weitere Forschung, um das „Mehr“, was Neue Medien über die digitale Speicherung hinaus ausmacht, qualitativ genauer zu beschreiben. Es reicht sicher nicht, dabei nur auf die Auflösung oder Störung des klassischen Rollenverhältnisses in der Kommunikation als wesentliches Qualitätsmerkmal hinzuweisen. Vielmehr erscheint mir eine Erweiterung um Kategorien wie Vernetzung (Hypertexte) und Mehrwerte (Multimedia, Interaktivität) erforderlich[8]. Hilfreich wird dabei die intensiv geführte Forschung zu den medialen Einzeltheorien[9] sein, die zwar von Faulstich (2000, S. 23 f.) als wissenschaftliche Sackgassen beschrieben werden, für tragfähige theoretische Gesamtmodelle allerdings unabdingbar sind.
2. Neue Medien in der Wissenschaft
Unabhängig von der gerade vorgestellten medientheoretisch komplexen Betrachtung der Neuen Medien ist deren Sprachgebrauch im Zusammenhang mit der wissenschaftlichen Nutzung unproblematisch. Hier steht klar die Funktionalität des digitalen Werkzeugs im Vordergrund, welches die wissenschaftliche Arbeit vereinfacht, verbessert und in vielen Fällen auch erst ermöglicht. Um die Dimension der Veränderungen in den letzten fünfzig Jahren zu verdeutlichen, wird häufig von der „Digitalen Revolution in der Wissenschaft“ gesprochen (Drenth, 2002, S. 155 ff.). Folgend stelle ich diesen „radikalen Umsturz“ anhand der Auswirkung der Neuen Medien auf Forschung und Lehre dar.
2.1. Auswirkungen auf die universitäre Lehre
In der Lehre wird grundsätzlich zwischen der Nutzung der Neuen Medien als Hilfsmittel und der Betrachtung der Neuen Medien als Lehrgegenstand unterschieden (Ministerium für Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, 1998, S. 7 ff.).
Als Hilfsmittel werden sie zur Ergänzung und Substitution traditioneller Lehrmethoden, zur Optimierung der Lehre durch neue Lehrformen sowie zur Vereinfachung der Kommunikation innerhalb der wissenschaftlichen Einrichtungen eingesetzt[10]. Die unterstützende Nutzung des WWW im Lehrbetrieb (z.B. die Bereitstellung von seminarbegleitenden Informationen, Recherche, Nutzung als Kommunikationsmedium), der Einsatz von Autorensystemen zur Präsentation sowie der Einsatz von Spezialsoftware (z.B. rechnergestützte Visualisierung, Simulation in den Naturwissenschaften) gelten als klassische ergänzende Lehrformen.
Die neu entstandenen Methoden basieren meist auf der Nutzung von lokalen Netzwerken bzw. des Internets und finden in den Bereichen Fernlehre (Teleteaching, E-Learning) und „Selbstgesteuertes Lernen“ Anwendung (Humboldt Universität zu Berlin, 2003, S. 7). Als Technologien werden in der Fernlehre hauptsächlich Videokonferenzen zur Realisierung von virtuellen Seminaren und Streaming-Technologie[11] zur dezentralen Verteilung von Vorlesungen genutzt. Im Selbstgesteuerten Lernen dominierten in den letzten Jahren Lernprogramme auf PC-Basis, die aber immer stärker durch webbasierte Lernangebote ergänzt und abgelöst werden.
Der Hinweis auf die neuen Anforderungen der Berufswelt im Informations- und Kommunikationszeitalter ist das wichtigste Argument für die Integration Neuer Medien als Lehrgegenstand, der die Stärkung von Informations- und Rechnerkompetenz der Studierenden zum Ziel hat. Dabei bezeichnet Informationskompetenz die Fähigkeit zu zielgerichteter Recherche, Bewertung und Präsentation, während Rechnerkompetenz sich auf den direkten Umgang mit der Informationstechnik bezieht. Neben diesen für die Praxis entscheidenden Kompetenzen beschäftigt sich die theoretische Lehre mit dem Feld der Medienkompetenz, die sich mit dem aktiven Rezipieren, effektiven Nutzen und kreativen Gestalten von Medien unter pädagogischen Gesichtspunkten befasst[12].
2.2. Einsatz Neuer Medien in der Forschung
Auch in der Forschung spielt die Nutzung der Neuen Medien eine immer größere Rolle. Während der Einsatz von digitalen Medien in Kommunikation und Informationsmanagement eher unterstützenden Werkzeugcharakter hat, gibt es Forschungsbereiche, in denen Computertechnologie integraler Bestandteil ist und die ohne moderne Technologien nicht in der aktuellen Form bestehen würden.
Neben der Nutzung der E-Mail, als Basis für die weltweite Kommunikation innerhalb der Forschergemeinde, werden immer häufiger auch erweiterte Möglichkeiten wie Diskussionsforen und Mailinglisten zum wissenschaftlichen Diskurs eingesetzt. Dies geht bis zur Bereitstellung kompletter Kongresse als webbasierte Live-Videoübertragung inklusive der Teilnahme an der Podiumsdiskussion.
Die Möglichkeiten des Informationsmanagements, die durch die Neuen Medien geboten werden, haben die Forschungstätigkeit in den letzten Jahrzehnten grundlegend verändert. Begonnen hat dies Anfang der siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts mit der Verwaltung bestehender Literaturarchive, die nach und nach für die lokale und später auch dezentrale Recherche geöffnet wurden. Der entscheidende Schritt für die Forschung war dabei die Bereitstellung dieser Dienste über das Internet, wodurch ein weltweiter Zugriff auf die Bestände ermöglicht wurde. Aber nicht nur die neuen Formen der Recherche prägt die aktuelle Arbeit der Forscher. Immer wichtiger wird auch die Bereitstellung und Veröffentlichung wissenschaftlicher Informationen in digitaler Form, das so genannte Elektronische Publizieren. Dies umfasst alle wissenschaftlichen Texte, die in elektronischer Form online (über das Internet zu erreichen) oder offline (z.B. als CD/DVD) veröffentlicht wurden. Auf dieses, für meine Arbeit zentrale Thema, werde ich unter II.4 näher eingehen.
Bei den gerade vorgestellten Berührungspunkten zwischen Neuen Medien und der Wissenschaft handelt es sich zwar schon um eine umfassende Umwälzung bestehender Strukturen und Arbeitsweisen, eine „Digitale Revolution der Wissenschaft“ ist darin aber noch nicht zu erkennen. Dazu gehören neben neuen Formen auch neue – und im Fall einer „Revolution“ signifikant neuartige – Inhalte und Methoden.
Diese finden wir hauptsächlich im Bereich der Naturwissenschaften. Dort ist mit dem Einzug von Computermodellen und Simulationen in einigen Forschungsbereichen ein neues Zeitalter eingetreten. Immer leistungsfähigere Computer ermöglichen über die Modellierung bzw. Simulierung die Abbildung der Natur, indem sie die Auswirkungen der bekannten Naturgesetze auf fast jede beliebige Art und Zahl von Beobachtungsdaten und Parametern anwenden können. Damit ist aus dem seit Hunderten von Jahren bestehenden Zweiklang von Theorie und Experiment mit der Simulation ein Dreiklang geworden.
Simulationen sind ein neuartiger, dritter Fall zwischen Theorie und Experiment. (Schröter, 2004b, S. 146)
Was diese dritte Säule der Wissenschaft vom klassischen Experiment unterscheidet, beschreibt Valentin Braitenberg (1995, S. 7):
Man hatte früher keinerlei Modell oder Gestänge oder mathematisches Gleichungssystem zur Verfügung, wenn es um Situationen ging, die zweierlei in sich vereinten: eine große Zahl von Einzelteilen, also Freiheitsgraden, und eine komplexe Struktur, die ihr Zusammenwirken regelt.
Damit eignet sich die Simulation besonders zur Erforschung vielschichtiger Systeme, was diese Methode für die Nutzung in den Geowissenschaften prädestiniert, die mit der Natur das wohl komplexeste System zum Forschungsgegenstand haben. Besonders verbreitet ist sie in den Disziplinen Meteorologie, Klimatologie und Vulkanologie, in denen Naturphänomene wie z.B. der Klimawandel mit immer leistungsfähigeren „Super-Computern“ erforscht werden.
Aber auch in einer Vielzahl weiterer Fachrichtungen hat nach der „Digitalen Revolution“ die EDV einen entscheidenden Anteil an Forschungsmethode und -inhalt. Beispiele sind die Entschlüsselung des menschlichen Genoms und Erforschung von neuro- und hirnphysiologischen Grundlagen im medizinischen Bereich oder die Simulation von ökonomischen Prozessen auf Makro- und Mikroniveau sowie vergleichende Studien in Sprach- und Literaturwissenschaften in den Geisteswissenschaften.
Zum Abschluss seien noch die Forschungen rund um die Neuen Medien als Gegenstand an sich erwähnt. So entstand 1989 das, was heutzutage unter „Internet“ verstanden wird, nämlich das World Wide Web in dem europäischen Kernforschungslabor in Genf. Zu dem großen Feld der Arbeiten in den Bereichen der Computertechnologie und der Informationswissenschaften gehören die Entwicklungen in Hardware- (Leistungssteigerungen, Mikro- und Nanotechnologie, Netzwerke) und Softwaretechnologie (z.B. semantische Informationssysteme).
Mit einem Großteil der gerade angerissenen Themen beschäftigt sich die „Sportinformatik“, die im folgenden Kapitel vorgestellt wird.
3. Sportinformatik
Die Sportinformatik, als Teildisziplin der Sportwissenschaft, versteht sich nicht nur als Nutzer von Standard-Lösungen der Informatik, sondern ebenso als Modellierer und Entwickler originärer Systeme (Elpel, 2000, S. 17). Der Einsatz von Computern zur reinen Verarbeitung großer Datenmengen (z.B. Archivierung, Dokumentation, statistische Auswertung, Präsentation) erscheint als Basis für eine Teilwissenschaft nicht ausreichend (Lames, 1997, S. 59 ff.), erst die Entwicklung eigener Lösungen sowie die Integration informatorischer Theoriemodelle werden wissenschaftlichen Ansprüchen gerecht.
3.1. Entwicklung
Wie in den meisten geisteswissenschaftlichen Bereichen, war der erste Kontakt zwischen Datenverarbeitung und der Sportwissenschaft eher verhalten. Die ersten Berührungspunkte entstanden parallel zur aufkommenden EDV-Nutzung an den Universitäten Mitte der siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts. Initiiert waren sie zum Großteil durch die bestehenden Probleme im Bereich der empirischen Auswertungen und Literatur-Recherche[13]. Obwohl auch zu dieser Zeit schon der Begriff Sportinformatik geprägt und die ersten wissenschaftlichen Diskurse entstanden[14], beschränkte sich der praktische Einsatz in Forschung und Lehre noch auf die Nutzung des Computers als reines Werkzeug.
Erst nach etwa zehn Jahren nahm, besonders durch das Aufkommen der günstigen Personal Computer (PC), das Interesse an der Nutzung der EDV in der Sportwissenschaft stark zu. Parallel dazu entstanden auch eigenständige sportinformatorische Forschungsarbeiten, welche durch den seit 1989 stattfindenden Workshop „Sport & Informatik“[15] eine erste institutionelle Basis erhielten. Die dort vorgestellten Arbeiten in den Bereichen „Modellbildung“, „Einsatz relationaler Datenbanken“, „Datenerfassung, -verarbeitung und -auswertung", „Spielbeobachtung“, „Multimedia“ und „Leistungsdiagnostik/ Trainingssteuerung“ dokumentieren einen regen Austausch innerhalb der deutschen Forschergemeinde, der 1995 zur Gründung einer eigenen Sektion „Sportinformatik“ in der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft (dvs) führte[16].
In den folgenden Jahren öffnete sich die junge Disziplin dem internationalen Diskurs, der nun seit 1998 im Symposium „Informatik im Sport“ einen eigenen Rahmen erhalten hat. Neben neuen inhaltlichen Themen, unter denen mit dem Aufkommen des Internets besonders vernetzte Anwendungen zu finden sind, gehören auch institutionelle Fragen weiterhin zur aktuellen Diskussion. Vor allem das Berufsbild des Sportinformatikers, dessen Entstehung 1975 auf dem Kongress „Kreative Sportinformatik“ für das Jahr 2000 prognostiziert wurde, ist noch längst nicht gefestigt und die dazugehörige Ausbildung an deutschen Sportinstituten steckt noch in den Kinderschuhen. Aktuell[17] gibt es zwei vollwertige Diplomstudiengänge und einen Magisterstudiengang im Spannungsfeld zwischen Sport und Informatik.
Seit 1993 besteht die integrierte Ausbildung zum „Diplom-Sportwissenschaftler“ bzw. zur „Diplom-Sportwissenschaftlerin mit Schwerpunkt Informatik“ an der Technischen Universität Darmstadt. Seit 1997 gibt es die kooperative Ausbildung zum „Diplom-Sportingenieur (Dipl.-Sporting.)“ im Studiengang „Sport & Technik“ der Universität Magdeburg, in der die Fakultäten bzw. Fachbereiche Sportwissenschaft, Elektrotechnik, Maschinenbau, Informatik und Mathematik kooperieren. Seit 1998 kann an der Technischen Universität in Chemnitz der Magisterstudiengang „Sportwissenschaft und Informatik“ studiert werden, der zum Großteil aus einem parallelen Studium von Sportwissenschaft und Informatik besteht, ohne dass in der Theorie ein spezieller sportinformatorischer Anteil angeboten wird.
Neben diesen Studiengängen gibt es auch an anderen sportwissenschaftlichen Hochschulinstituten vereinzelt Angebote zur Sportinformatik. Oft sind diese Veranstaltungen allerdings rein anwendungsorientiert (so genannte EDV-Kurse) oder werden nur als Sonderveranstaltungen angeboten; kontinuierliche Ansätze sind immer noch selten zu erkennen[18].
Systematische Ansätze der universitären Ausbildung im Bereich Informatik im Sport, die auf die Verbesserung der allgemein-informatorischen Kompetenz abzielen, sind im Bereich der Sportwissenschaft spärlich gesät. (Wiemeyer, 1997, S. 293)
Das einzige Institut, das dieser Ausbildung auch einen formalen Rahmen gegeben hat, ist die Deutsche Sporthochschule Köln. Dort kann seit dem Wintersemester 2000 die 16 Semesterwochenstunden umfassende Zusatzqualifikation „Sportinformatik“ erreicht werden[19].
Es ist zu hoffen, dass dieses Beispiel Schule macht, damit die Sportwissenschaftler die für die Arbeit in Forschung und Lehre immer wichtiger werdenden informatorischen Kompetenzen schon in ihrer universitären Ausbildung erwerben können. Dazu sollten die Angebote allerdings nicht mehr nur auf dem starken individuellen Engagement einzelner Lehrender basieren – der Aufbau von systematischen, integrierten und kontinuierlichen Aus- und Weiterbildungskonzepten ist der notwendige nächste Schritt auf dem Weg zu einer adäquaten Integration der Neuen Medien in das Studium der Sportwissenschaft[20].
3.2. Gegenstands- und Anwendungsbereiche
Martin Lames beschreibt den Gegenstandsbereich der Sportinformatik in seinem Aufsatz zur Gründung der Sektion „Sportinformatik“ der dvs als eine „Kreuztabelle der Anwendungsfelder (Training und Wettkampf, Sportverwaltung, Informationsmanagement, Sportwissenschaft) mal der Bearbeitungsebenen (Werkzeuge, Konzepte, Theorienbildung)“ (Lames, 1997, S. 59). Im Gegensatz dazu trennt Perl zur Eingrenzung die „Einsatzbereiche“ (vergleichbar mit den Anwendungsfeldern von Lames) von den „Gegenstandsbereichen“, die bei Lames das Ergebnis der Matrix bilden (Perl, 1997a, S. 9 f.). Inhaltlich unterscheiden sich die Ansätze nur wenig: Lames bietet mit seinem praxisnäheren Entwurf noch die Ebene der Unterscheidung nach „Werkzeugen“, „Konzepten“ und „Theoriebildung“, während bei Perl die einzelnen Gegenstandsbereiche aufgrund der Trennung von den Anwendungsfeldern theoretisch schärfer gefasst sind. Wenn auch Lames mit der Unterscheidung der einzelnen Bearbeitungsebenen besonders für das Verständnis zu unterscheidbaren wissenschaftlichen Formen von Sportinformatik wichtig erscheint, so orientiere ich mich in dieser Arbeit an dem generischeren Ansatz Perls, da diese Sicht die Integration aktueller Entwicklungen vereinfacht.
In der Folge stelle ich die von Perl definierten Gegenstandsbereiche „Modellbildung“, „Simulation“, „Methoden der Datenanalyse“, „Datenbanken/Expertensysteme“ und „Präsentation“ im Zusammenhang mit ihren Einsatzbereichen vor, wobei die Modellbildung und die Simulation aufgrund ihrer besonderen Bedeutung für eine eigene sportinformatorische Theoriebildung in der Sportwissenschaft vertieft erläutert werden. Die Aspekte der Datenanalyse, Datenbanken, Expertensysteme und Präsentation erscheinen in ihren wesentlichen Grundzügen.
Weiterhin ergänze ich diese von Perl 1997 vorgestellten Bereiche um die Themen „E-Learning“ und „Elektronisches Publizieren“. Dies ist aufgrund der dynamischen Entwicklung in der Informatik und besonders in der noch jungen Disziplin Sportinformatik als rein inhaltliche Erweiterung im bestehenden theoretischen Konzept zu verstehen[21]. Da das „Elektronische Publizieren“ die theoretische Basis für den praktischen Teil meiner Arbeit bildet, wird dieser Aspekt unter II.4 ausführlich behandelt.
Allerdings erscheint es aufgrund der ständig wachsenden Zahl an neuen Feldern[22] angebracht diese abstrakter zu definieren, um den Gegenstandsbereichen ein beständiges theoretisches Gerüst zu geben. Eine solche Struktur ist auch in der 2003 durch Perl aktualisierten Darstellung der Sportinformatik, die nun „Datenbanken/ Datenverwaltung“, „Softwareentwicklung“, „Modellbildung“, „Medien“, „Kommunikationsnetze“, „Informationstechnologie“ als Schwerpunkte nennt (Perl, 2003, 515 ff.), noch nicht abschließend zur erkennen. Einerseits ist hier eine Tendenz zur Abstraktion klar erkennbar: Aus „Expertensysteme“ wird „Softwareentwicklung“, die „Präsentation“ wird unter „Medien“ eingeordnet. Andererseits hat die Liste immer noch eher Aufzählungs- als Strukturcharakter. In ihr werden technisch definierte Teilbereiche wie Informationstechnologie oder Kommunikationsnetze neben einen so komplexen Begriff wie „Medien“ gestellt, der eine Vielzahl an pädagogischen, soziologischen und technischen Facetten vereint. Eine umfassende Theoriebildung ist in der Form eines lexikalischen Beitrags sicher auch nicht zu erwarten; jedoch scheint die Zeit nach fast 20 Jahren intensiver deutschsprachiger Forschung gekommen, der Sportinformatik ein klares Arbeitsfeld zu verleihen. Dass dieser Definitionsprozess zwangsläufig auch eine gewisse Unschärfe mit sich bringen wird, ist unvermeidlich – der Gewinn für die Disziplin wäre allerdings enorm.
3.2.1. Modellbildung
Die Modellbildung ist eine Mitte des letzten Jahrhunderts in Folge des Einsatzes von Computern im Forschungsbetrieb entstandene wissenschaftliche Methode, die in vielen Disziplinen (z.B. Soziologie, Psychologie, Mathematik, Informatik) eingesetzt wird.
Das Modell ist ein abstraktes Abbild eines Systems. Es dient der Diagnose des Systemzustandes und der Prognose des Systemverhaltens. (Perl & Uthmann, 1997, S. 43)
Unter „System“ ist hier ein Ausschnitt der Wirklichkeit zu verstehen. Es steht nicht für sich allein, sondern kann mit einer Vielzahl weiterer Komponenten interagieren. Das Ziel der Modellierung besteht darin, durch methodische Schritte die Beschreibung des Zustands und vor allem Voraussagen für zukünftiges Verhalten zu ermöglichen. Die größte Schwierigkeit und gleichzeitig der elementare Ansatzpunkt bei der Theoriebildung ist die potentiell unendliche Zahl an Einflussfaktoren in den betrachteten Systemen. Durch die iterative Reduktion dieser Komplexität, durch Abstraktion auf die wesentlichen Aspekte, kann aus einem Modell ein Abbild der Realität werden[23].
In der Sportwissenschaft wird seit etwa 1970 mit der Modellierung gearbeitet. Dabei reichen die Arbeiten von einfachen Modellen z.B. für Trainingsreiz- und Reaktionsprognosen über rein naturwissenschaftliche Detailmodellierungen von Einzelbewegungen und verhaltenstheoretische Modelle zur Darstellung von Sportspielen bis hin zu aktuellen, dynamischen Modellen auf Basis von Fuzzy-Logic[24] oder Neuronalen Netzen.
Dabei dominierten im naturwissenschaftlichen Bereich[25] zu Beginn die Versuche, mit biomechanischen Größen Teilfunktionen und Zusammenhänge im Bewegungsapparat formulierbar zu machen. Daraus sind in den letzten Jahrzehnten, ermöglicht durch den Fortschritt in der EDV, immer komplexere Modelle besonders in der Biomechanik und Physiologie entstanden.
Bei der verhaltenstheoretischen Modellierung[26] besteht ein grundlegendes Problem in der überwiegen sehr hohen Komplexität der Systeme. Entgegen den meisten naturwissenschaftlichen Modellen erschweren in der Verhaltenstheorie eine unüberschaubare Menge von interagierenden sozialen und psychologischen Faktoren eine adäquate Abstraktion und Modellierung[27].
Diese Einschränkungen gelten natürlich auch für Beobachtungen des Sports als soziales System (z.B. zur Modellierung und Simulation einer Sitzung im Sportverein). Der Sport bietet aber noch ein weiteres Feld, das aus Sicht der Modellierung per se eine zulässige Einschränkung der Komplexität zulässt: Die Beobachtung des menschlichen Verhaltens bei der Ausübung von Sport. Lames (1994, S. 206 ff.) definiert dabei vier Merkmale von Sportausübung, die den Interaktionsrahmen beschränken und damit die Modellierung erleichtern. Die drei wichtigsten sind folgende:
1. Sport als regelgeleitetes Handeln
Die Vielzahl an normativen Regelungen im Sport beschränkt die Handlungsalternativen.
2. Situationscharakteristika im Sport
Häufig liegen im Sport sehr spezielle Situationscharakteristika mit relativ wenigen situativen Determinanten vor.
3. Erklärungen und Interpretationen sportlichen Verhaltens
Die Sinnbezüge von sportlichem Verhalten sind in den meisten Fällen vergleichbar einfach zu bestimmen (z.B. Erreichen der sportlichen Ziele).
Diese Besonderheiten erleichtern die Nutzung der Modellbildung in den für die Sportwissenschaft relevanten Disziplinen der Bewegungswissenschaft, der Trainingswissenschaft und der Sportpsychologie.
Am Beispiel des komplexen Falls der Sportspiele[28] möchte ich abschließend die unterschiedlichen Ansätze von naturwissenschaftlichen und verhaltenstheoretischen Modellierungen erläutern und einen kurzen Ausblick auf aktuelle, unkonventionelle Methoden geben. Die Sportspiele eignen sich zum Vergleich besonders, da in ihnen von isolierten Bewegungsabläufen (z.B. Schuss oder Aufschlag), über komplexere Spielsituation (z.B. Abwehrverhalten bei definierten Situationscharakteristika) bis zum gesamten Spiel als Summe von Interaktionsprozessen die verschiedenen Systemtypen vereint sind.
Während die naturwissenschaftlichen Modelle über die isolierten Bewegungsabläufe oder auch taktische Einzelentscheidungen relevante Simulationen erzeugen können, fehlen ihnen bei der Untersuchung von Spielsituationen mit interagierenden Partnern die wissenschaftlichen Mittel. Daher werden diese Modelle häufig zur Verbesserung der körperlichen Voraussetzung oder zur Optimierung von speziellen Abläufen (z.B. Freiwurf im Basketball) eingesetzt.
Wenn aber ganze Spielsituationen oder -sequenzen beschrieben werden sollen, bedarf es der verhaltenstheoretischen Modellierung. Diese stellt den Interaktionsprozess in das Zentrum des Modells und versucht darüber Zusammenhänge zwischen einzelnen Spielparametern (z.B. Treffergenauigkeit, aber auch externe Faktoren wie Wetter) und dem Ergebnis im Sinne des Spielziels (z.B. Punktgewinn) darzustellen. Mit Hilfe solcher Untersuchungen kann beispielsweise die Trainingsplanung angepasst werden, um sich auf die nach dem Modell besonders erfolgsversprechenden (geringer Aufwand à große Veränderung der Erfolgsaussicht) Aspekte zu konzentrieren.
Diese beiden Modelle schließen sich nicht gegenseitig aus, sondern werden auch ergänzend eingesetzt. So könnte die verhaltenstheoretische Modellierung im Volleyball ergeben, dass eine 5%-ige Steigerung des Aufschlagtempos zu einer 15%-igen Erhöhung der Punktewahrscheinlichkeit führen soll. Das naturwissenschaftliche Modell zum Volleyballaufschlag würde dann aufzeigen, welche Parameter verändert werden müssten, um die 5% an Geschwindigkeitssteigerung zu erreichen (z.B. Erhöhung der Kraft, Veränderung des Treffpunkts).
Bisher wurden die verhaltenstheoretischen Modelle als geeignetes Mittel zur Untersuchung von begrenzten Spielsituationen und für die Bestimmung von Gesamtspielstärken[29] vorgestellt. Problematisch ist die Nutzung der klassischen Verhaltenstheorie allerdings bei dem Versuch den Ausgang kompletter Spiele zu simulieren, da nach dem vorgestellten Muster immer die Akteure mit der besten Gesamtspielstärke gewinnen würden. Während dies in relativ geschlossenen Spielen (z.B. Tennis) mit wenigen Interaktionskomponenten mit hoher Prozentzahl[30] eintritt, kann das in den großen Sportspielen nicht beobachtet werden. Hier gibt es zu viele unvorhersehbare Komponenten, die den Spielerfolg bestimmen (z.B. Pfosten-/Lattenschüsse oder umstrittene Elfmeterentscheidungen im Fußball) und die nicht durch konventionelle Modellierung erfasst werden können[31].
Neben den beiden vorstehend genannten Modellen wurden für diese Fälle in den letzten Jahren verschiedene, so genannte dynamische Modelltheorien[32] entwickelt. Zu diesen unkonventionellen, sich oft an natürlich-biologischen Problemlösungsansätzen orientierenden, Theorien gehören „Neuronale Netze“, „Fuzzy-Modellierung“[33], „Genetische Algorithmen“ und „Chaos“. Der Ausgang des oben angesprochenen Fußballspiels könnte so z.B. über die Integration einer „Chaos-Komponente“ in ein klassisches verhaltensorientiertes Modell simuliert werden.
3.2.2. Simulation
Wie es sich in den aufgeführten Beispielen zur Modellbildung schon angedeutet hat, sind Simulation und Modellierung eng verzahnte Arbeitsbereiche. Die Simulation[34] wird dabei zur Darstellung des Modellverhaltens genutzt und hat durch die rasche technologische Entwicklung eine bedeutende Rolle unter den wissenschaftlichen Methoden erlangt[35].
Die Simulation dient grundsätzlich der Realisierung von Modellverhalten. Ein wesentliches Ziel der Simulation ist es, das Verhalten des simulierten Modells und des dadurch modellierten Systems zu prognostizieren. Das Motiv für diese Vorgehensweise ist, dass es häufig nicht möglich ist, das Verhalten des Systems selbst ohne Probleme zu beobachten. (Perl et al., 1997, S. 65 )
Ein entscheidendes Merkmal von Simulationen ist somit die Verknüpfung mit einem Modell (Lames, 1994, S. 141). Dies zeigt auch Abbildung 1, in der die enge Einbindung der beiden Instrumente in den Prozess der wissenschaftlichen Methode illustriert wird. Weiterhin wird hier deutlich, dass die Simulation nicht immer nur das Ende eines Prozesses ist, sondern ebenso eine wichtige Rolle bei der iterativen Optimierung des Modells spielt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Zusammenhang zwischen Simulation und Modellbildung (vereinfachte und übersetzte Darstellung nach Spriet & Vansteenkiste, 1982, S. 5)
Die wichtigsten Aufgaben von Simulationen im Kontext der Modellbildung liegen also in der Überprüfung des Modells sowie der Bereitstellung einer Prognose über das Verhalten der durch die Modellierung dargestellten Systeme.
Obwohl die visualisierten, computerbasierten Auswertungen nicht die einzigen Ergebnisarten von Simulationen sind, überwiegen die Computersimulationen in der wissenschaftlichen Arbeit der letzten Jahre[36].
3.2.3. Weitere Gegenstandsbereiche
Wie unter II.3.2 näher dargestellt, unterliegt die Zahl der Bereiche, mit denen sich die Sportinformatik auseinandersetzt, aufgrund des rasanten technischen Fortschritts ständiger Veränderung. Daher erhebt die in der Folge dargestellte Auswahl der Felder Datenanalyse, Datenbanken, Expertensysteme, Präsentation und E-Learning keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern gibt nur einen Überblick über die wichtigsten Forschungs- und Anwendungsfelder der Sportinformatik innerhalb der Sportwissenschaft.
Die Datenanalyse ist ein klassischer Bereich der wissenschaftlichen Forschung. Grundsätzlich kann die Datenanalyse in hermeneutische[37] und statistische Verfahren der Erfassung und Auswertung von Daten unterteilt werden. In der Sportinformatik spielt, bedingt durch die Möglichkeiten der rechnergestützten Analyse, fast ausschließlich der naturwissenschaftlich-empirische Ansatz zur Entwicklung von Berechnungs- und Auswertungsverfahren eine Rolle. Dabei ist die Statistik das in der Forschungspraxis bestimmende Auswertungsinstrument, obwohl auch hier alternative Methoden wie Unschärfe, Fuzzy Logik, Fallbasiertes Schließen, Genetische Algorithmen und Neuronale Netze an Bedeutung gewinnen[38].
Nach Willimczik (1999, S. 9) werden statistische Methoden in allen sportwissenschaftlichen Teildisziplinen genutzt. Dabei führt er folgende Anwendungsgebiete auf:
- Nutzung zur übersichtlichen Darstellung vorliegender Einzeldaten (-ergebnisse) oder zur Charakterisierung von Daten mit Hilfe von Durchschnittswerten und Streuungsmaßen. Z.B. Ergebnislisten, Darstellungen von Entwicklungstrends
- Nutzung zur Bestimmung von Zusammenhängen von Merkmalen oder Unterschieden zwischen Gruppen. Z.B. Untersuchung des Zusammenhangs zwischen motorischen Fähigkeiten und sportmotorischen Fertigkeiten, Vergleich zwischen Trainingsmethoden oder die Frage nach dem Zusammenhang zwischen aggressivem Verhalten und Spielstärke im Mannschaftssport
- Nutzung zur Verallgemeinerung im Sinne des induktiven Schlusses und zur Quantifizierung des Risikos bei Verallgemeinerungen
Datenbanken, bzw. wie Perl (2003, S. 515 f.) richtig ergänzt, Datenbanken und Datenverwaltung sind seit Beginn des EDV-Zeitalters originäre Bestandteile der Informatik und auch in der Forschung von zentraler Bedeutung[39]. Das Einsatzfeld reicht vom Informationsmanagement (z.B. Recherche in Literaturdatenbanken) bis zur Verwaltung großer Datenbestände (wie sie z.B. in der Simulation oder Statistik anfallen). In diesem Zusammenhang rücken in den letzten Jahren aufgrund der immer größer werdenden Datenmengen neben rein technischen Aspekten des Speicherns die semantisch-informatorischen Fragestellungen rund um das Suchen und Finden von Informationen in den Vordergrund[40].
Dabei haben sich die Recherche und Archivierung in Literaturdatenbanken sowie die Unterstützung von Training und Wettkampf zu den beiden wichtigsten Anwendungsgebieten von Datenbanken in der Sportwissenschaft entwickelt.
Die speziellen sportwissenschaftlichen Literaturdatenbanken sind zu einem zentralen Recherchewerkzeug der Forscherinnen und Forscher geworden. Vorreiter im deutschsprachigen Raum war dabei das vom Institut für Angewandte Trainingswissenschaft Leipzig (IAT) entwickelte Angebot SPOWIS sowie die vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft (BISp) betreute SPOLIT. Dabei werden in SPOLIT seit 1970 sportwissenschaftliche Beiträge aus Zeitschriften, Büchern, Dissertationen sowie aus Konferenz- und Symposiumsberichten erschlossen, mit Schlagworten und einem Kurzreferat versehen und informatorisch in der Datenbank erfasst. Während SPOLIT in einem universellen Ansatz alle Disziplinen der Sportwissenschaft bedient, versteht SPOWIS sich als Ergänzung im trainingswissenschaftlichen Bereich. Die Datenbanken wurden in den letzten Jahren vom Medium CD-ROM ins Internet verlagert und durch neue Angebote erweitert. Die wichtigsten sind SPONET (Internet-Suchmaschine des IAT), SPOFOR (Datenbank deutschsprachiger Forschungsprojekte des BISp) und SPOMEDIA (Datenbank deutschsprachiger, audio-visueller Medien im Leistungssport des BISp)[41]. I
m Leistungssport sind Datenbanken zur Dokumentation von Trainings- und Wettkampfleistungen nicht mehr wegzudenken. Sie bieten die Grundlage für die Trainingssteuerung und werden zur Simulation von Trainingsmodellen benötigt[42].
So wird beispielsweise am Olympiastützpunkt in Freiburg seit 1992 in einer interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Informatik, Trainingswissenschaft, Biomechanik und Medizin eine sportwissenschaftliche Trainings- und Leistungsdatenbank aufgebaut. In diesem dezentralen System pflegen die Sportler ihre Daten aus der Leistungsdiagnostik in Training und Wettkampf vor Ort über eine webbasiert e Verwaltung. Das System kann somit neben Standardberichten über die Leistungsfähigkeit und den Trainingsverlauf auch Antworten auf spezielle Fragestellungen geben, die von den Betreuern (Ärzte, Trainer) bei der Suche nach Optimierungspotential gestellt werden[43].
Bei der Beschäftigung mit Expertensystemen trifft man auf ein Forschungsgebiet innerhalb der Künstlichen Intelligenz, das mit „Knowledge Engineering“ umschrieben wird. Dieser Bereich des Wissensmanagements beschäftigt sich mit der regelhaften Abbildung von Welt- und Expertenwissen[44], um dieses in computergestützte Systeme zu integrieren, zu denen auch die Expertensysteme gehören.
Expertensysteme sind wissensbasierte Systeme der verschiedensten Anwendungsbereiche, die geistige Aktivitäten wie Klassifizieren, Diagnostizieren, Konstruieren und Planen in einer Qualitätsstufe durchführen, die der Leistung menschlicher Experten vergleichbar ist. (Puppe, Stoyan & Studer, 2000, S. 631)
Die Hauptmodule dieser Programme sind die durch direkte, indirekte oder automatisierte Datenerhebung entstandene Wissensbasis[45], die durch Formalisierung[46] des Wissens aufgestellten Regeln und die für die Verarbeitung von Wissen und Regeln programmierte Inferenzkomponente (auch Schlussfolgerungskomponente genannt).
Die ersten Expertensysteme entstanden in den siebziger und achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts unter einer, durch die große Technikeuphorie zu erklärenden, hohen Erwartungshaltung. Da die damaligen Projekte den in sie gesetzten Hoffnungen bei weitem nicht gerecht wurden und sich darüber hinaus als sehr entwicklungs- und wartungsintensiv herausstellten, kühlte diese Begeisterung merklich ab. Erst durch neue technische und methodische Entwicklungen sowie dem neuen, kommerziellen Einsatzgebiet als so genannte „Software-Agenten“[47] stieg das Interesse wieder merklich an.
In der Sportwissenschaft werden Expertensysteme hauptsächlich im Bereich der Sportspielbeobachtung eingesetzt. Es existieren unter anderem Systeme für Tennis, Tischtennis und Handball[48].
Die Inhalte der Bereiche Präsentation, Multimedia und E-Learning werden von Perl (2003, S. 516) zu dem Begriff Medien zusammengefasst. Dabei ist E-Learning sicher der Gegenstandsbereich, der die klarsten Konturen hat und am einfachsten in die Kategorie Medien einzuordnen ist. Multimedia und Präsentation sind dagegen als übergeordnete Gattungsbegriffe eher strukturell konkurrierend anzusehen. Daher werde ich auf eine explizite Vorstellung von Multimediainhalten verzichten, zumal diese in den vorgestellten Gegenstandsbereichen integrativ behandelt werden.
Die Präsentation wird in der Informatik als „Vermittler von Informationen“ (Perl, 1997b, S. 125) verstanden. Dabei dient sie in einem prozessualen Ansatz als Schnittstelle zwischen den informatorischen Modellen und Daten sowie dem Benutzer. Dies wird in Abbildung 2 an den Transformationsprozessen innerhalb einer Modellierung dargestellt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Transformation in der Modellierung (nach Perl, 1997b, S. 127)
Hier wird deutlich, dass die Präsentation der Informationen, die durch das Modell erstellt werden, nahezu deckungsgleich mit der Aufgabe der Simulation ist[49]. Dabei liegt das Gewicht bei der Simulation auf der naturwissenschaftlich-theoretischen Ableitung aus dem Modell, während die Präsentation sich eher übergeordnet mit den kommunikationstheoretischen Aspekten auseinandersetzt. Ausprägungen der computergestützten Präsentation sind jegliche Visualisierung von Informationen: Zu nennen wären hier Tabellen, Grafiken, Animationen, Bilder oder Video- und Audiodaten.
Eingesetzt werden diese nahezu in jeder Disziplin der Sportwissenschaften, sei es zur Darstellung von empirischen Reihen in Diagrammform in der Sportpsychologie, die Bildreihe einer Wurfbewegung in der Bewegungswissenschaft oder die 3D- Simulation von Bodenreaktionskräften beim Laufen in der Biomechanik. Für die Sportinformatik besonders herausfordernd erscheinen dabei die Felder der Simulation und Animation sowie der Videoanalyse.
Ebenfalls in dem Themenkreis von Präsentation und Multimedia ist das E-Learning positioniert. Darunter versteht man Lehr- und Lernprozesse, die durch den Einsatz von elektronischen Medien unterstützt werden. Bedingt durch diese unscharfe Definition hat der Bereich E-Learning eine Vielzahl von Ausprägungen. Angefangen bei den web- bzw. computerbasierten Trainingsanwendungen[50], über Autorensysteme und Lernsoftware bis hin zu Videokonferenzsystemen, unterstützender Lehrbetreuungs-Software oder Mischformen von Präsenz- und E-Learning („Blended Learning“) reicht das Feld der Anwendungen, die den Stempel E-Learning tragen. Dabei ist deren kleinster gemeinsamer Nenner die Digitalität. In den Anfangsjahren wurden teilweise Druckerzeugnisse eins-zu-eins digitalisiert, ohne medienadäquate Mehrwerte wie Multi- oder Hypermedialität zu schaffen[51]. Zu diesen beiden Merkmalen (Digitalität und Multi-/Hypermedialität), die die klassische CBT-Anwendung charakterisieren (auch als Lernsoftware oder Autorensysteme bekannt), werden in der modernen E-Learning-Definition noch zwei Anforderungen hinzugefügt: Die Möglichkeit zur Interaktion zwischen Lernenden, System und Lehrenden sowie – als notwendige Voraussetzung – die Nutzbarkeit in Netzwerken wie dem Internet.
Neben diesen eher formalen Eigenschaften sollte keine E-Learning-Anwendung ohne didaktisches Konzept entstehen. Hier werden aktuell drei Modelle mit behavioristischem, kognitivem sowie konstruktivistischem Hintergrund unterschieden:
- Der weit verbreitete behavioristische Ansatz (auch Lernpfad genannt) zeichnet sich durch ein relativ starres Lehr-Lernmuster aus. Der Lernende ist hier eher passiv und erhält auf einem vorbestimmten Lernpfad die durch den Lehrenden vorbestimmten Inhalte in Form von Instruktionen.
- Das Lernarrangement stellt als kognitives Modell die gesamte Lernhandlung als individuellen Prozess in den Vordergrund. Die E-Learning-Anwendung hat hier die Aufgabe, die benötigten Informationen zur Verfügung zu stellen, die Problemstellung zu konstruieren und als „Dramaturg“ im Sinne von handlungs- und problemorientierter Didaktik zu agieren.
- Das konstruktivistische Modell hat das selbstgesteuerte Lernen als Zielsetzung. Dabei kann sich der Lernende in einer autodidaktischen Lernumgebung seine individuellen Lernziele und -wege selbst erarbeiten und wird dabei nicht wie im Modell eins geführt, noch wie im zweiten Modell gelenkt, die lehrende Instanz hat hier nur noch unterstützende Funktion[52].
Siemens (2004) hat dazu folgende Kategorien von E-Learning definiert, die bewusst die technische Ebene (z.B. Auslieferungs- bzw. Präsentationsart) aussparen.
- Courses
Dies ist die klassische Anwendung im Bereich des elektronischen Lernens, deren Ausprägungen aktuell den E-Learning-Markt noch bestimmen. Unter „Kursen“ wird ein meist themenspezifischer Transfer bestehender Lerninhalte und -konzepte verstanden, die – multimedial aufbereitet – in E-Learning-Systeme integriert werden. Diese können vom didaktischen Ansatz behavioristisch, kognitiv oder konstruktivistisch angelegt sein; auch Mischformen sind häufig anzutreffen.
- Informal learning
Dieser Ansatz hat im Gegensatz zum Kurssystem noch keinen konstitutionellen Rahmen. Unter informellem Lernen werden Aspekte des selbst gesteuerten Lernens (Arbeiten mit individuellen Lernquellen, z.B. Internet-Suchmaschinen, Blogs, …) und des persönlichen Informations- und Wissensmanagements subsumiert.
- Blended learning
Unter „Blended learning“ versteht man die Mischform von E-Learning und Präsenzlernen, bei der die Lernphasen durch webbasierte Vorbereitung und Begleitung von klassischen Bildungsangeboten effizienter gestaltet werden sollen. Dieser Aspekt ist besonders im Hinblick auf universitäre Lehr- und Lernformen von hoher Aktualität[53].
- Communities
Das Lernen in „Gemeinschaften“ ist mit dem WWW Wirklichkeit geworden. Durch Kommunikationsmittel wie E-Mail, Mailinglisten, Foren oder Blogs können Lern- und/oder Forschungs-„Communities“ international genutzt werden[54].
- Knowledge management
Hier wird unter „knowledge management“ die Nutzung und Verwaltung des Wissens verstanden, das innerhalb von Organisationen im Alltagsgeschäft entsteht.
- Networked learning
Die „Lern-Netzwerke“ werden als eher lose Verbindung von Communities, Einzelpersonen und Organisationen definiert. Sie nutzen ebenso wie die Communities die aktuellen, vernetzten Kommunikationsmöglichkeiten.
- Work-based learning
Dies ist der Versuch den Vermittlungsprozess in die täglichen Arbeitsprozesse zu integrieren. Dieser Ansatz ist aus vielen Computeranwendungen bekannt, die dem Nutzer jederzeit eine kontextsensitive Hilfe anbieten.
Für die Betrachtung im Rahmen der sportwissenschaftlichen Lehre verdienen aus dieser Liste besonders die Punkte „Courses“ und „Blended learning“ Beachtung. In der Forschung spielen die „Communities“ und „Netzwerke“ eine ebenso wichtige Rolle, wie sie das „knowledge management“ innerhalb der Institutionen innehaben sollte.
[...]
[1] Weitere Informationen zu diesem 1997 begonnenen Projekt sind auf der Internetseite des Fachbereichs Sportwissenschaft der Universität Hamburg zu finden: http://www.rrz.uni-hamburg.de/sport/forschung/projekte/sport_ins_internet/ebene3_sport_ins_internet.html
[2] Vergleiche Theis und Mäncher (2001, S. 11 ff.).
[3] Vergleiche Borkenhagen (2001, S. 30 ff.).
[4] Das Werk „Informatik im Sport – Ein Handbuch“ (Perl, 1997a) wurde schließlich 1997 veröffentlicht. Den Zeitpunkt der Konzeption nannte mir Prof. Dr. Perl in privater Korrespondenz.
[5] Objektorientiertes Ordnungsprinzip zur Unterscheidung von vier Mediengruppen: Primärmedien, die ohne den Einsatz von Technik auskommen (z.B. Theater); Sekundärmedien, die zur Produktion Technik einsetzen (z.B. Zeitung); Tertiärmedien, die bei Produktion und Rezeption Technikeinsatz bedürfen (z.B. Fernsehen); Quartärmedien, die ebenso wie Tertiärmedien bei Produktion und Rezeption Technik nutzen, zusätzlich aber digital verteilt werden und die traditionelle Sender-/Empfänger-Beziehung auflösen. Vergleiche auch Ludes (1998, S. 141 ff.).
[6] Computer rechnen intern mit Bits. Bits sind die kleinsten Informationseinheiten und können die Werte 0 oder 1 annehmen. Jede digitale Information ist auf Nullen und Einsen zurückzuführen, die vereinfacht dargestellt für die Information „Strom an / Strom aus“ stehen.
[7] Ein Blog, abgeleitet von Weblog, ist eine Mischung aus News und Tagebuch. Die Blog-Software erlaubt auch Internet-Laien, eine Website zu betreiben und Artikel einzustellen. Die chronologisch sortierten Einträge sind meist persönlich geprägte Kurzartikel oder auch nur Notizen, die sich um das Geschehen im WWW und Ereignisse im Leben des Verfassers (Blogger) drehen.
[8] Anschauliche Einführung in diese Themen geben für Multimedia Klimsa (2002, S. 5ff.), für Hypertexte Tergan (2002, S. 99 ff.) und für Interaktivität Haack (2002, S. 127 ff.).
[9] Eine Übersicht zur Forschungshistorie sowie der Stand ist bei Schröter und Böhnke (2004, S. 14 f.) zu finden.
[10] Einen umfassenden theoretischen Überblick geben Issing (2002, S. 9 ff.) und Salomon (2002, S. 19 ff.).
[11] Als Streaming bezeichnet man kontinuierliche Übertragung von Video- oder Audiodaten über ein Netzwerk, insbesondere über das Internet. Damit bieten sie das Internetäquivalent zu Fernsehen und Hörfunk. Bekannte Formate sind z.B. Web-Radio und Video on Demand.
[12] Bettina Hurrelmann (2002, S. 301 ff.) gibt einen umfassenden Überblick über den aktuellen Stand der Diskussion.
[13] Einen umfassenden Überblick über die historische Entwicklung der deutschen Sportinformatik bieten Miethling und Perl (1997, S. 17 ff.).
[14] 1975 erschien die erste deutschsprachige Veröffentlichung „Kreative Sportinformatik“ von Recla und Timmer. Sie enthielt die Sammlung der Referate des gleichnamigen Kongresses, der im selben Jahr von der Internationalen Gesellschaft für Sportinformatik in Graz veranstaltet wurde.
[15] Eine Aufstellung zu den einzelnen Veranstaltungen ist auf der Internetseite der dvs-Sektion Sportinformatik zu finden: <http://www.sportinformatik.uni-mainz.de/veranstaltungen/bisher.html>
[16] Den Vortrag zur Gründung der Sektion ist in Lames (1997, S. 59 ff.) zu finden.
[17] Stand Wintersemester 2004/05. Zum Stand innerhalb der sportwissenschaftlichen Ausbildung 1997 ausführlich Elpel (2000, S. 19 ff.).
[18] Zum Wintersemester 2004/05 bieten in Deutschland nur die Hochschulinstitute in Augsburg und Saarbrücken sportinformatorische Veranstaltungen an.
Im deutschsprachigen Raum bietet das Institut für Sportwissenschaften der Universität Wien seit 1989 kontinuierliche Veranstaltungen zu Themen der Sportinformatik an. Baca (1999, 223 ff.) stellt die Veranstaltungen ausführlich vor.
[19] Ergänzend sei noch auf eine für die sportinformatorische Forschung wichtige Institution hingewiesen, die die „Sportinformatik“ als Disziplin der Informatik versteht. Seit 1989 besteht an der Universität Mainz die Arbeitsgruppe „Sportinformatik“ am Institut für Informatik, die seit Jahren entscheidende Impulse besonders in der theoretischen Grundlagenforschung liefert.
[20] Ähnlich schon Wiemeyer und Perl (1997, S. 4 ff.), die diesen Appell mit Grundlinien für ein Ausbildungskonzept verbinden. Bonadt (1997, S. 284 ff.) baut diese zu einem Vorschlag für die Integration informatorischer Inhalte in das sportwissenschaftliche Studium aus. Mester (1999, S. 89 ff.) stellt die hochschulpolitische Situation der Sportinformatik vor.
[21] Die Notwendigkeit der ständigen Aktualisierung der Gegenstandsbereiche aufgrund aktueller Entwicklungen wird von Perl (2003, S. 515) und Lames (1997, S. 61) selbst gefordert.
[22] So könnten an dieser Stelle beispielsweise noch Bereiche wie Multimedia und Virtuelle Realität besprochen werden, die in der aktuellen Forschung durchaus eine Rolle spielen.
[23] Umfassend dazu Perl & Uthmann (1997a, S. 43 ff.).
[24] Vergleiche Anmerkung 33.
[25] Einen umfassenden Überblick zur naturwissenschaftlichen Modellierung im Themenkomplex Sportwissenschaft gibt Glitsch (2002, S. 99 ff.).
[26] Martin Lames (2002, S. 179 ff.) gibt einen umfassenden Überblick zur verhaltenstheoretischen Modellierung von den Grundlagen (S. 179 ff.) bis zur Anwendung in der Sportwissenschaft (S. 205 ff.).
[27] Häufig wird dies in der Literatur mit einem einfachen Beispiel erläutert: Es ist einfacher, den Fall des Apfels vom Baum zu modellieren als den Sturz einer Regierung.
[28] Die Grundlagen zur Modellbildung von Sportspielen stellt Lames (2002, S. 239 ff.) vor. Eine Einführung zur Komplexität von Sportspielen bietet Bay-Yam (2003, S. 8 ff.).
[29] Bolch und Cerny (1990, S. 25 ff.) präsentierten schon 1990 das System „TOTO“ zur Bestimmung der Gesamtspielstärken von Fußballbundesligisten. Ein aktuelles Beispiel für die Simulation von Spielsituationen bietet Erdnüß (2003, S. 239) mit einer Kurzvorstellung einer Simulation des Abwehrverhaltens im Hallenhandball.
[30] Lames (2000, S. 180) nennt für den Tennissport eine 93%-ige Wahrscheinlichkeit, dass der Spieler mit der höheren Spielstärke gewinnt.
[31] Umfassend zu der Betrachtung des Faktors „Chaos“ im Fußballspiel: Lames (1999, S. 141 ff.).
[32] Lames, Perl und Uthmann (1997, S. 91 ff.) bieten eine umfassende Übersicht über den aktuellen Forschungsstand der neuen Modellbildungstheorien.
[33] Ausführlich zur Fuzzy-Logik in der Bewegungsanalyse: Schiebl (2000, S. 85 ff.).
[34] Umfassend zur Simulation in der Sportwissenschaft: Perl und Uthmann (1997b, S. 65 ff.).
[35] Zur Bedeutung der Simulation vergleiche II.2.2 „Einsatz Neuer Medien in der Forschung“.
[36] Ein Beispiel für den aktuellen Einsatz von Computersimulationen stellt Quinn (2004, S. 56 ff.) mit der Beschreibung zu Untersuchungen zum Windwiderstand im 200m-Lauf vor.
[37] Hierzu bietet Haag eine Einführung in die Hermeneutik (Haag, 1999, S. 3 ff.) sowie Thiele und Kolb (Thiele & Kolb, 1999, S. 45 ff.) eine Übersicht über die Forschungspraxis, jeweils mit dem Bezugspunkt der Sportwissenschaft.
[38] Eine ausführliche Darstellung der Datenanalyse in der Sportwissenschaft bieten Lames, Perl und Uthmann (1997, S. 81 ff.).
[39] Eine umfassende Einführung in das Thema geben Schröder & Uthmann (1997, S. 105 ff.).
[40] Dazu weiterführend Perl (2000, S. 184 ff.) mit einem Aufsatz zu der Problematik komplexer Informationsstrukturen in der Sportwissenschaft.
[41] Die Datenbanken des IAT sind im Internet unter <http://www.sponet.de> bzw. <http://www.iat.uni-leipzig.de/iat/ids/SPOWIS/startseite.htm> erreichbar. Das BISp bietet den Zugang über die URL <http://www.bisp-datenbanken.de>. Zum Hintergrund der Datenbankentwicklung von SPOLIT und SPOWIS berichtet Schiffer (1997, S. 202 ff.). International sind noch die Datenbanken HERACLES <http://www.sportdoc.unicaen.fr/heracles/> und die kommerzielle SIRC SportDiscus-Datenbank <http://www.sirc.ca/products/> von Bedeutung.
[42] Zum Einsatz von Datenbanken zur Trainings-Wirkungs-Analyse näher Stork (1997, S. 220 ff.).
[43] Das System wird von Schwirtz, Stockhausen et al. (1997, S. 25 ff.) näher vorgestellt. Die aktuellste Ausprägung dieser Arbeit wird im Radlabor Freiburg <http://www.radlabor.de> z.B. zur Betreuung der deutschen Straßen-Nationalmannschaften der Damen und Herren eingesetzt.
[44] Dabei liegt auch dem Wissensmanagement das englische Verständnis von „Knowledge“ zugrunde. D.h. hier werden unter Wissen auch Fähigkeiten und Fertigkeiten subsumiert.
[45] Die Qualität der Erfassung des dem Expertensystem zugrunde liegenden Wissens (auch Wissensakquisition genannt) ist mit entscheidend für die Ergebnisqualität der Software. Siehe dazu auch (Puppe, Stoyan & Studer, 2000, S. 606).
[46] Unter Formalisierung wird die Übersetzung von natürlich-sprachlichen Beschreibungen in formal-technische verstanden. So würde die sprachlich ausgedrückte Bedingung „Wenn die Geschwindigkeit des ersten Aufschlag eines Sportlers in einem Turnier durchschnittlich unter 150 km/h oder der zweite unter 120 km/h liegt, dann soll der Fokus im Block Aufschlagtraining auf Geschwindigkeitserhöhung gelegt werden“ formalisiert durch die konditionale IF-Then-Struktur „IF V_AUFSCHLAG_1 < 1 50 OR V_AUFSCHLAG_2 < 120 THEN AUFSCHLAGTRAINING = V “ repräsentiert.
[47] Unter Software-Agenten versteht man Programme, die z.B. im Internet oder über Hotlines den Kunden interaktiv und individuell bei Problemen oder Fragen zur Seite stehen.
[48] Lames (1994, S. 76 ff.) berichtet über das TEnnis-Simulations-SYstems TESSY und das Handball-Analyse-System HAnSy. Uthmann (1995, S. 215 ff.) über das Tischtennis-Simulations-System TiSSy.
[49] Vergleiche auch die Ausführungen zu Simulation unter II.3.2.2.
[50] Auch als „web based training“ (WBT) oder „computer based training“ (CBT) bezeichnet.
[51] Zu den Problemen im E-Learning und weiter auch zusammenfassend zum Thema: Rockmann & Butz (1997, S. 141 ff.).
[52] Eine ausführliche theoretische Betrachtung zum mediengestützten Lernen bietet Kerres (2001, S. 55 ff.).
[53] Kritisch zur Effektivität, bzw. überzogener Hoffnung: Schulmeister (2002, 129 ff.).
[54] Zum kooperativen Lernen ausführlich Hesse, Garsoffky und Hron (2002, S. 283 ff.).
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2004
- ISBN (eBook)
- 9783836607896
- DOI
- 10.3239/9783836607896
- Dateigröße
- 2.9 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover – Erziehungswissenschaften, Institut für Sportwissenschaft
- Erscheinungsdatum
- 2008 (Januar)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- sportinformatik elektronisches publizieren graue literatur content management
- Produktsicherheit
- Diplom.de