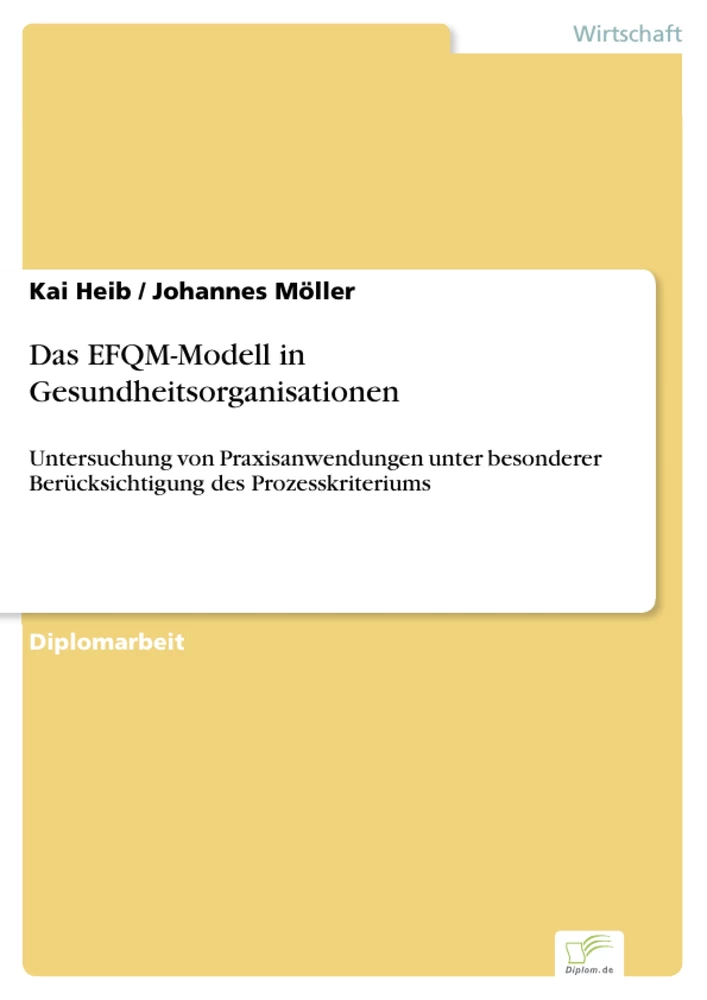Das EFQM-Modell in Gesundheitsorganisationen
Untersuchung von Praxisanwendungen unter besonderer Berücksichtigung des Prozesskriteriums
©2005
Diplomarbeit
99 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Die Umsetzung der Qualitätsprinzipien von TQM-Modellen hat sich als ökonomisch sinnvoll erwiesen. Diese Aussage stützt sich auf die Ergebnisse einer Studie von Hendricks und Singhal, welche den signifikanten Einfluss der langfristigen Umsetzung dieser Qualitätsprinzipien auf die Geschäftsergebnisse von privatwirtschaftlichen Organisationen belegt hat. Dabei nimmt die Prozessqualität eine bedeutsame Rolle ein. Denn die Prozessqualität bildet einen wesentlichen Erfolgsfaktor guter Ergebnisqualität.
Zielsetzung der vorliegenden Diplomarbeit ist es zu untersuchen, inwieweit die Ergebnisse der oben beschriebenen Studie auf EFQM-Anwender in Gesundheitsorganisationen übertragbar sind. Dabei bildet die Prozessqualität aufgrund ihrer erfolgskritischen Eigenschaften den wesentlichen Untersuchungsgegenstand. Ferner sollen dem praxisorientierten Leser Maßnahmenbeispiele vorgestellt werden, welche als Anregung für die praktische Umsetzung des EFQM-Prozesskriteriums dienen können.
Dazu wird im Hauptteil der Arbeit auf Basis von 14 EFQM-Selbstanalysen (Vgl. Anhang I), elf EFQM-Gutachten (Vgl. Anhang II) sowie drei weiteren praxisrelevanten Quellen (Vgl. Anhang III) internationaler EFQM-Anwender untersucht, wie und in welcher Qualität die betrachteten Gesundheitsorganisationen das erfolgskritische EFQM-Prozesskriterium in Bezug zu den Zielsetzungen des EFQM-Modells und der RADAR-Logik umsetzen.
Demgemäß werden zunächst das EFQM-Modell sowie die RADAR-Bewertungssystematik knapp vorgestellt (Kapitel 2). Anschließend werden sowohl das EFQM-Prozesskriterium als auch die Untersuchungsfelder der vorliegenden Arbeit dargestellt (Kapitel 3). Den Schwerpunkt der Diplomarbeit bildet die Anwendung der Untersuchungsfelder auf die einzelnen EFQM-Prozessteilkriterien 5a bis 5e (Kapitel 4). Abschließend werden die gewonnenen Untersuchungsergebnisse kritisch gewürdigt sowie ein Ausblick im Kontext der aktuellen gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen gegeben (Kapitel 5). Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
VORWORTI
ABKÜRZUNGSVERZEICHNISIV
ABBILDUNGSVERZEICHNISV
1.Einleitung1
2.European Foundation for Quality Management3
2.1EFQM-Modell3
2.2RADAR-Bewertungssystematik4
3.Darstellung des EFQM-Prozesskriteriums und weiterer Untersuchungsfelder6
3.1EFQM-Kriterium 5 Prozesse6
3.2Untersuchungsfelder7
4.Anwendung der Untersuchungsfelder auf die EFQM-Prozessteilkriterien8
4.1Untersuchung des EFQM-Teilkriteriums 5a […]
Die Umsetzung der Qualitätsprinzipien von TQM-Modellen hat sich als ökonomisch sinnvoll erwiesen. Diese Aussage stützt sich auf die Ergebnisse einer Studie von Hendricks und Singhal, welche den signifikanten Einfluss der langfristigen Umsetzung dieser Qualitätsprinzipien auf die Geschäftsergebnisse von privatwirtschaftlichen Organisationen belegt hat. Dabei nimmt die Prozessqualität eine bedeutsame Rolle ein. Denn die Prozessqualität bildet einen wesentlichen Erfolgsfaktor guter Ergebnisqualität.
Zielsetzung der vorliegenden Diplomarbeit ist es zu untersuchen, inwieweit die Ergebnisse der oben beschriebenen Studie auf EFQM-Anwender in Gesundheitsorganisationen übertragbar sind. Dabei bildet die Prozessqualität aufgrund ihrer erfolgskritischen Eigenschaften den wesentlichen Untersuchungsgegenstand. Ferner sollen dem praxisorientierten Leser Maßnahmenbeispiele vorgestellt werden, welche als Anregung für die praktische Umsetzung des EFQM-Prozesskriteriums dienen können.
Dazu wird im Hauptteil der Arbeit auf Basis von 14 EFQM-Selbstanalysen (Vgl. Anhang I), elf EFQM-Gutachten (Vgl. Anhang II) sowie drei weiteren praxisrelevanten Quellen (Vgl. Anhang III) internationaler EFQM-Anwender untersucht, wie und in welcher Qualität die betrachteten Gesundheitsorganisationen das erfolgskritische EFQM-Prozesskriterium in Bezug zu den Zielsetzungen des EFQM-Modells und der RADAR-Logik umsetzen.
Demgemäß werden zunächst das EFQM-Modell sowie die RADAR-Bewertungssystematik knapp vorgestellt (Kapitel 2). Anschließend werden sowohl das EFQM-Prozesskriterium als auch die Untersuchungsfelder der vorliegenden Arbeit dargestellt (Kapitel 3). Den Schwerpunkt der Diplomarbeit bildet die Anwendung der Untersuchungsfelder auf die einzelnen EFQM-Prozessteilkriterien 5a bis 5e (Kapitel 4). Abschließend werden die gewonnenen Untersuchungsergebnisse kritisch gewürdigt sowie ein Ausblick im Kontext der aktuellen gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen gegeben (Kapitel 5). Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
VORWORTI
ABKÜRZUNGSVERZEICHNISIV
ABBILDUNGSVERZEICHNISV
1.Einleitung1
2.European Foundation for Quality Management3
2.1EFQM-Modell3
2.2RADAR-Bewertungssystematik4
3.Darstellung des EFQM-Prozesskriteriums und weiterer Untersuchungsfelder6
3.1EFQM-Kriterium 5 Prozesse6
3.2Untersuchungsfelder7
4.Anwendung der Untersuchungsfelder auf die EFQM-Prozessteilkriterien8
4.1Untersuchung des EFQM-Teilkriteriums 5a […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Kai Heib/Johannes Möller
Das EFQM-Modell in Gesundheitsorganisationen
Untersuchung von Praxisanwendungen unter besonderer Berücksichtigung des
Prozesskriteriums
ISBN: 978-3-8366-0588-5
Druck Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2008
Zugl. Fachhochschule Mainz, Mainz, Deutschland, Diplomarbeit, 2005
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplomica.de, Hamburg 2008
Printed in Germany
- II -
VORWORT
Mitte der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts vergab das damalige Bundesministerium für
Gesundheit den Auftrag zur ,,Analyse von Prinzipien der Akkreditierung und
Zertifizierung von Gesundheitseinrichtungen im Ausland". Ergebnisse dieser Studie
wurden von Swertz et al. (1998) veröffentlicht.
Im Rahmen dieser Studie kristallisierten sich mehrere Gesundheitseinrichtungen heraus,
welche bereits seit geraumer Zeit mit Konzepten des Qualitätsmanagements experimen-
tierten darunter das Kantonale Spital in Grabs.
Das Kantonale Spital Grabs, welches der Akutversorgung im schweizerischen Kanton St.
Gallen dient, bot einige Jahre lang ein wichtiges Anwendungs- und Analysefeld für
verschiedene Konzepte des Qualitätsmanagements in Gesundheitsorganisationen. Sie
wurden bereits aus dem Blickwinkel des Anwenders (Möller et al. 2003) und auch im
wissenschaftlichen Kontext (Möller et al. 2005) dargelegt.
Das vorliegende Buch steht in einer Entwicklungslinie mit den o.g. Werken und markiert
den vorerst letzten Beitrag dieser kleinen Schriftenreihe. Darin wurde am Beispiel des
Prozesskriteriums aufgezeigt, welche Erkenntnisse eine systematische Meta-Analyse von
Anwendungen des Qualitätsmanagements in Gesundheitseinrichtungen hervor bringen
kann. Es bleibt dem Leser überlassen, die gewählte Vorgehensweise auf andere Kriterien
des EFQM-Modells oder andere Gesundheitseinrichtungen zu übertragen und daraus
ebenfalls Nutzen für die eigene Organisation zu ziehen.
Dieses Buch ist Herrn Dr. Herwig Heinzl, langjähriger Chefarzt der Klinik für
Anästhesiologie im Kantonalen Spital Grabs in der Schweiz gewidmet. Wichtige
Vorarbeiten zu diesem Buch entstanden unter Leitung von Herrn Dr. Herwig Heinzl am
heutigen Spital Grabs in den Jahren 1997 bis 2007. Diese Widmung ist Ausdruck hohen
Dankes und Anerkennung für das qualitätsbezogene, klinische Lebenswerk von Herrn Dr.
Herwig Heinzl.
Kai Heib, Cham
Johannes Möller, Hamburg
im Januar 2008
- III -
INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT ... I
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS ... IV
ABBILDUNGSVERZEICHNIS ...V
1. Einleitung...1
2. European Foundation for Quality Management...3
2.1 EFQM-Modell...3
2.2 RADAR-Bewertungssystematik ...4
3. Darstellung des EFQM-Prozesskriteriums und weiterer Untersuchungsfelder ...6
3.1
EFQM-Kriterium 5 Prozesse...6
3.2 Untersuchungsfelder ...7
4. Anwendung der Untersuchungsfelder auf die EFQM-Prozessteilkriterien ...8
4.1
Untersuchung des EFQM-Teilkriteriums 5a Prozessmanagement ...8
4.1.1 Zielsetzungen ...8
4.1.2 Auswahlverfahren ...8
4.1.3 Anwendungserfahrungen ...9
4.1.4
RADAR-Konformität der Praxisanwendung ...11
4.1.5
Beurteilung der Untersuchungsergebnisse...11
4.2
Untersuchung des EFQM-Teilkriteriums 5b Prozessverbesserung ...14
4.2.1 Zielsetzungen ...14
4.2.2 Auswahlverfahren ...15
4.2.3 Anwendungserfahrungen ...15
4.2.4
RADAR-Konformität der Praxisanwendung ...19
4.2.5 Beurteilung
der
Untersuchungsergebnisse...19
- IV -
4.3
Untersuchung des EFQM-Teilkriteriums 5c Produktentwicklung ...22
4.3.1 Zielsetzungen ...22
4.3.2 Auswahlverfahren ...23
4.3.3 Anwendungserfahrungen ...23
4.3.4
RADAR-Konformität der Praxisanwendung ...26
4.3.5 Beurteilung
der
Untersuchungsergebnisse...27
4.4
Untersuchung des EFQM-Teilkriteriums 5d Produktbetreuung ...29
4.4.1 Zielsetzungen ...29
4.4.2 Auswahlverfahren ...29
4.4.3 Anwendungserfahrungen ...29
4.4.4
RADAR-Konformität der Praxisanwendung ...31
4.4.5 Beurteilung
der
Untersuchungsergebnisse...32
4.5
Untersuchung des EFQM-Teilkriteriums 5e Kundenbeziehungen...34
4.5.1 Zielsetzungen ...34
4.5.2 Auswahlverfahren ...34
4.5.3
Anwendungserfahrungen ...35
4.5.4
RADAR-Konformität der Praxisanwendung ...36
4.5.5
Beurteilung der Untersuchungsergebnisse...37
5. Kritische Würdigung und Ausblick ...39
LITERATURVERZEICHNIS...43
ANHANGVERZEICHNIS...51
ANHANG ...49
- V -
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
DRK
Deutsches Rotes Kreuz
EFQM
European Foundation for Quality Management
ISO International
Organization for Standardization
K5 EFQM-Kriterium
5
K5i
EFQM-Teilkriterium 5i (i = a, b, c, d, e)
K5ij
EFQM-Ansatzpunkt 5ij (i = a, b, c, d, e und j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
KTQ
Kooperation für Transparenz und Qualität im Krankenhaus
PDCA Plan-Do-Check-Act
RADAR
Results, Approach, Deployment, Assessment and Review
TQM
Total Quality Management
- VI -
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Abbildungen
Seite
Abbildung 1 Ablaufschema der Untersuchung
2
Abbildung 2 Aufbau und Kriteriengewichtung des EFQM-Modells
3
Abbildung
3
RADAR-Regelkreissystematik
5
Abbildung 4 Architektur des EFQM-Prozesskriteriums in drei Ebenen
6
Abbildung 5 Reihenfolge und Gegenstände der Untersuchungsfelder
7
Abbildung 6 RADAR-Konformität des Verbesserungsmanagementsystems
21
Abbildung 7 Aufbau und Inhalt eines
Patientenfragebogens
24
- 1 -
1. Einleitung
Die Umsetzung der Qualitätsprinzipien von TQM-Modellen
1
hat sich als ökonomisch
sinnvoll erwiesen.
2
Diese Aussage stützt sich auf die Ergebnisse einer Studie von
Hendricks und Singhal, welche den signifikanten Einfluss der langfristigen Umsetzung
dieser Qualitätsprinzipien auf die Geschäftsergebnisse von privatwirtschaftlichen
Organisationen belegt hat.
3
Dabei nimmt die Prozessqualität
4
eine bedeutsame Rolle ein.
5
Denn die Prozessqualität bildet einen wesentlichen Erfolgsfaktor guter Ergebnisqualität.
6
Zielsetzung der vorliegenden Untersuchung ist es zu überprüfen, inwieweit die Ergebnisse
der oben beschriebenen Studie auf EFQM-Anwender in Gesundheitsorganisationen
7
übertragbar sind. Dabei bildet die Prozessqualität aufgrund ihrer erfolgskritischen
Eigenschaften den wesentlichen Untersuchungsgegenstand. Ferner sollen dem
praxisorientierten Leser Maßnahmenbeispiele vorgestellt werden, welche als Anregung für
die praktische Umsetzung des EFQM-Prozesskriteriums dienen können. Dazu wird im
Hauptteil der Arbeit auf Basis von 14 EFQM-Selbstanalysen (Vgl. Anhang I), elf EFQM-
Gutachten (Vgl. Anhang II) sowie drei weiteren praxisrelevanten Quellen (Vgl. Anhang
III) internationaler EFQM-Anwender untersucht, wie und in welcher Qualität die
betrachteten Gesundheitsorganisationen das erfolgskritische EFQM-Prozesskriterium in
Bezug zu den Zielsetzungen des EFQM-Modells und der RADAR-Logik umsetzen.
Demgemäß werden zunächst das EFQM-Modell sowie die RADAR-Bewertungssystematik
knapp vorgestellt (Kapitel 2). Anschließend werden sowohl das EFQM-Prozesskriterium
als auch die Untersuchungsfelder der vorliegenden Arbeit dargestellt (Kapitel 3). Den
Schwerpunkt der Untersuchung bildet die Anwendung der Untersuchungsfelder auf die
einzelnen EFQM-Prozessteilkriterien 5a bis 5e (Kapitel 4). Abschließend werden die
1
Total Quality Management bezeichnet eine auf die Mitwirkung aller Mitglieder beruhende Managementmethode einer
Organisation, welche Qualität in den Mittelpunkt stellt und durch Kundenzufriedenheit auf langfristigen Geschäftserfolg
sowie Nutzen für die Mitglieder der Organisation und für die Gesellschaft zielt (Vgl. Kamiske, 1998, S. 13).
2
Vgl. EFQM, 2003, S. 6.
3
Vgl. Hendricks, Singhal, 2000, S. 17.
4
Zur Bewertung von Qualität hat sich die Verknüpfung der Qualitätskategorien: Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität,
mit dem EFQM-Modell bewährt (Vgl. Nabitz, Klazinga, Walburg 2000, S. 192 und Donabedian, 1966, S. 167).
5
Vgl. Greiling, Buddendick, Wolter, 2004, S. 37 und Pira, 2000, S. 31.
6
Vgl. Hildebrand, 2001, S. 26 und von Eiff, 2000, S. 427.
7
Da die Untersuchungsfelder der Untersuchung auf Akutkrankenhäuser, Pflegeheime sowie psychiatrische Einrichtungen
angewandt werden, wird stets der einheitliche Terminus "Gesundheitsorganisationen" verwendet.
- 2 -
gewonnenen Untersuchungsergebnisse kritisch gewürdigt sowie ein Ausblick im Kontext
der aktuellen gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen gegeben (Kapitel 5).
Abbildung 1 stellt das Ablaufschema der vorliegenden Untersuchung grafisch dar:
Abbildung 1: Ablaufschema der Untersuchung
* X = 1, 2, 3, 4 und 5
1. Einleitung
2. European Foundation for Quality Management
3. Darstellung des EFQM-Prozesskriteriums und weiterer Untersuchungsfelder
4. Anwendung der Untersuchungsfelder auf die EFQM-Prozessteilkriterien
5. Kritische Würdigung und Ausblick
2.1 EFQM-Modell
2.2 RADAR-Bewertungssystematik
3.1 EFQM-Kriterium 5 - Prozesse
3.2 Untersuchungsfelder
4.1
Untersuchung
des EFQM-
Teilkriteriums 5a -
Prozess-
management
4.X.3* Anwendungserfahrungen
4.X.2* Auswahlverfahren
4.X.4* RADAR-Konformität der Praxisanwendung
4.X.5* Beurteilung der Untersuchungsergebnisse
4.X.1* Zielsetzungen
4.2
Untersuchung
des EFQM-
Teilkriteriums 5b -
Prozess-
verbesserung
4.3
Untersuchung
des EFQM-
Teilkriteriums 5c -
Produkt-
entwicklung
4.4
Untersuchung
des EFQM-
Teilkriteriums 5d -
Produkt-
betreuung
4.5
Untersuchung
des EFQM-
Teilkriteriums 5e -
Kunden-
beziehungen
- 3 -
2. European
Foundation
for Quality Management
2.1 EFQM-Modell
Das EFQM-Modell
8
, welches auf den Prinzipien des TQM beruht, versteht sich als
Instrument zur Messung und Bewertung der Struktur-, Prozess- sowie Ergebnisqualität
einer Organisation.
9
Es besteht aus zwei Kriterien-Gruppen. Die Kriterien K1 bis K5
werden als "Befähiger-Kriterien" und die Kriterien K6 bis K9 als "Ergebnis-Kriterien"
bezeichnet.
10
Die Befähiger-Kriterien beschäftigen sich mit der Struktur- und
Prozessqualität, d.h. wie eine Organisation bei der Umsetzung der Qualitätsprinzipien
vorgeht. Die Ergebnis-Kriterien hingegen bewerten die Ergebnisqualität, d.h. was eine
Organisation durch ihr Vorgehen erreicht.
11
Beide Kriteriengruppen sind paritätisch
gewichtet und können je 500 Punkte zur Gesamtbewertung beitragen.
12
Abbildung 2 stellt
den Aufbau sowie die Kriteriengewichtung des EFQM-Modells dar:
Abbildung 2: Aufbau und Kriteriengewichtung des EFQM-Modells
Partnerschaften und
Ressourcen
90 Punkte
Politik und Strategie
80 Punkte
Mitarbeiterbezogene
Ergebnisse
90 Punkte
Gesellschaftsbez.
Ergebnisse
60 Punkte
Kundenbezogene
Ergebnisse
200 Punkte
Führung
100 Punkte
Schlüssel-
ergebnisse
150 Punkte
Prozesse
140 Punkte
Mitarbeiter
90 Punkte
Befähiger-Kriterien 500 Punkte
Ergebnis-Kriterien 500 Punkte
Innovation und Lernen
Vgl. EFQM, 2003, S. 12 und EFQM, 1998, S. 13.
8
Die EFQM wurde 1988 von 14 europäischen Unternehmen als gemeinnützige Organisation auf Mitgliederbasis
gegründet und versteht sich als treibende Kraft Europas hinsichtlich der Verbreitung des Exzellenz-Gedankens. (Vgl.
EFQM, 2003, S. 2 und EFQM, 1999, S. 15).
9
Vgl. EFQM, 2003, S. 12; Hildebrand, 2002, S. 6 und Möller, 2002, S. 101.
10
Vgl. EFQM, 1996, S. 13.
11
Anforderungen der Ergebnisqualität in Gesundheitsorganisationen können die Wiederherstellung des Zustandes vor der
Krankheit, die Herstellung eines stabilen und Wohlbefinden verursachenden Zustandes oder die Entlastung des
Organismus von Krankheitsfolgen sein (Vgl. Schreiner, Fahrni, 2001, S. 5).
- 4 -
Das EFQM-Modell beruht auf folgender Prämisse: Exzellente Ergebnisse im Hinblick auf
Leistung (K9), Kunden (K6), Mitarbeiter (K7) und Gesellschaft (K8) werden durch eine
Führung (K1) erzielt, welche die Politik und Strategie (K2) mit Hilfe der Mitarbeiter (K3),
Partnerschaften und Ressourcen (K4) sowie der Prozesse (K5) umsetzt.
13
Der von rechts
nach links verlaufende Pfeil in Abbildung 2 steht sinnbildlich für den dynamischen
Charakter des EFQM-Modells. Diese Dynamik ist darin begründet, dass Innovation und
Lernen als Grundlage für die Verbesserung der Struktur- und Prozessqualität angesehen
werden, was wiederum zu einer Erhöhung der Ergebnisqualität führen kann.
14
Zur besseren Handhabung des EFQM-Modells wurden zusätzlich zu den neun EFQM-
Kriterien zwei weitere Hierarchiestufen eingeführt. Die so genannten "EFQM-
Teilkriterien" bezeichnen die zweite Hierarchieebene und umfassen insgesamt 32
Zielsetzungen, welche den neun EFQM-Kriterien in unterschiedlicher Anzahl zugeordnet
wurden. Diese EFQM-Teilkriterien bezeichnen Merkmale, auf welche im Rahmen einer
Organisationsbewertung nach dem EFQM-Modell eingegangen werden muss. Weiterhin
sind in einer dritten Hierarchieebene 33 "EFQM-Ansatzpunkte" hinterlegt, welche eine
praxisrelevante Orientierung darstellen sollen und organisationsspezifisch erweitert werden
können.
15
Diese mehrstufige Architektur des EFQM-Modells wird in den Kapiteln 3.1
sowie 4.X.1
16
erneut aufgegriffen und detaillierter beschrieben.
2.2 RADAR-Bewertungssystematik
Den Kern des EFQM-Modells bildet die so genannte RADAR-Logik.
17
Das Akronym
RADAR setzt sich zusammen aus "Results" (Ergebnisse), "Approach" (Vorgehen),
"Deployment" (Umsetzung) sowie "Assessment and Review" (Bewertung und
Überprüfung).
18
Unter Anwendung dieser RADAR-Elemente bestimmt eine Organisation
die Ergebnisse, welche sie mit ihrer Politik und Strategie
19
erreichen möchte, führt
fundierte Vorgehensweisen ein, bewertet und überprüft die eingeführten Vorgehensweisen
12
Vgl. EFQM, 2003, S. 12.
13
Vgl. EFQM, 2003, S. 12 und Möller, Heib, Heinzl, 2003, S. 32.
14
Vgl. Lipp, 2000, S. 1219.
15
Vgl. EFQM, 2003, S. 12 und Brandt, 2001, S. 25.
16
X = 1, 2, 3, 4 und 5.
17
Vgl. EFQM, 2003, S. 27.
18
Vgl. Weibler, Zieres, 2003, S. 85.
- 5 -
und identifiziert daraus Verbesserungsmaßnahmen, welche wieder in einer
Ergebnisbestimmung zusammengefasst werden.
20
Abbildung 3 stellt die einzelnen
Teilschritte der beschriebenen RADAR-Regelkreissystematik dar:
Abbildung 3: RADAR-Regelkreissystematik
1. Schritt:
Festlegung gewünschter Ergebnisse
(Results - R ADAR)
3. Schritt:
Umsetzung der Vorgehensweise
(Deployment - RA D AR)
2. Schritt:
Planung und Entwicklung
einer Vorgehensweise
(Approach - R A DAR)
4. Schritt:
Bewertung und Überprüfung der
Vorgehensweise der Umsetzung
(Assessment and Review - RAD AR )
Zielsetzung
Einführung
Messung
Verbesserung
Vgl. Brandt, 2001, S. 27.
Neben der Anwendung der RADAR-Logik zur systematischen Strukturierung operativer
Veränderungs- bzw. Verbesserungsmaßnahmen wird sie vorwiegend zur Bewertung von
Organisationen nach dem EFQM-Modell eingesetzt. Zur Bewertung der RADAR-
Konformität des Vorgehens einer Organisation empfiehlt die EFQM die Anwendung der
so genannten "RADAR-Bewertungsmatrix". Diese RADAR-Bewertungsmatrix beurteilt
die EFQM-Befähiger-Kriterien hinsichtlich der Elemente "Vorgehen", "Umsetzung" sowie
"Bewertung und Überprüfung" (Vgl. Anhang IV) und die EFQM-Ergebnis-Kriterien
bezüglich der erreichten "Ergebnisse" (Vgl. Anhang V). Die Anwendung der RADAR-
Bewertungsmatrix ermöglicht eine Quantifizierung der Bewertungsresultate in Form eines
EFQM-Punktwertes zwischen 0 und 1.000 Punkten.
21
19
Als Politik und Strategie bezeichnet die EFQM die Art und Weise, wie eine Organisation ihre Mission und Vision auf
Basis der Bedürfnisse der wichtigsten Interessengruppen umsetzt (Vgl. EFQM, 2003, S. 33).
20
Vgl. Brandt, 2001, S. 27.
21
Vgl. EFQM, 2003, S. 28 und Brandt, 2001, S. 28.
- 6 -
3. Darstellung
des
EFQM-Prozesskriteriums und
weiterer Untersuchungsfelder
3.1 EFQM-Kriterium 5 Prozesse
Gegenstand des EFQM-Prozesskriteriums ist die Gestaltung, das Management und die
Verbesserung von Prozessen. Diese Maßnahmen haben die Zielsetzungen die Kunden voll
zufrieden zu stellen und deren Wertschöpfung zu erhöhen.
22
Wie in Kapitel 2.1
beschrieben wird das EFQM-Prozesskriterium in mehrere EFQM-Prozessteilkriterien
sowie EFQM-Prozessansatzpunkte unterteilt. Die EFQM-Prozessteilkriterien beinhalten
Aspekte des Prozessmanagements (K5a), der Prozessverbesserung (K5b), der
Produktentwicklung (K5c), der Produktbetreuung (K5d) sowie des Managements von
Kundenbeziehungen (K5e).
23
Im Rahmen der Kapitel 4.X.1
24
werden diese fünf EFQM-
Prozessteilkriterien in Form der Darstellung aller EFQM-Prozessansatzpunkte detailliert
vorgestellt. Abbildung 4 stellt die Architektur des EFQM-Prozesskriteriums grafisch dar:
Abbildung 4: Architektur des EFQM-Prozesskriteriums in drei Ebenen
K3
K4
K2
K7
K8
K6
K1
K9
K5
K5c
K5d
K5b
K5e
K5a
K5c3
K5c4
K5c2
K5c1
K5c6
K5c5
Vgl. Möller, Heib, Heinzl, 2003, S. 33.
22
Vgl. EFQM, 2003, S. 19.
23
Vgl. EFQM, 2003, S. 19 f..
Ebene 1:
EFQM-
Kriterien
Ebene 2:
EFQM-
Teilkriterien
Ebene 3:
EFQM-
Ansatzpunkte
- 7 -
3.2 Untersuchungsfelder
Die Untersuchungsfelder, auf welchen die vorliegende Untersuchung im Wesentlichen
aufgebaut ist, weisen eine fünfstufige Gliederung auf. In den Kapiteln 4.X.1
25
werden die
Zielsetzungen der einzelnen EFQM-Prozessteilkriterien durch Darstellung der jeweiligen
EFQM-Prozessansatzpunkte dargestellt (1. Schritt). Im Anschluss wird in den Kapiteln
4.X.2
26
das in Anhang VI beschriebene Auswahlverfahren angewandt, damit aus den
vorliegenden Selbstanalysen (Vgl. Anhang I) eine Praxismaßnahme begründet ausgewählt
werden und als Gegenstand der Untersuchung verwendet werden kann (2. Schritt). Die
Kapitel 4.X.3
27
fassen die aus den Selbstanalysen gewonnenen Anwendererfahrungen bei
der Umsetzung der untersuchten Praxismaßnahme zusammen (3. Schritt). Diese
Umsetzung wird anschließend in den Kapiteln 4.X.4
28
auf Konformität zu der in Kapitel
2.2 beschriebenen RADAR-Logik
29
überprüft (4. Schritt). Das Vorgehen dieses vierten
Schrittes ist in Anhang VII beschrieben. Abschließend werden in den Kapiteln 4.X.5
30
die
wesentlichen Ergebnisse der Untersuchungen zusammengefasst und soweit möglich
kritisch beurteilt (5. Schritt). Abbildung 5 fasst die Reihenfolge sowie Gegenstände der
Untersuchungsfelder zusammen:
Abbildung 5: Reihenfolge und Gegenstände der Untersuchungsfelder
1. Schritt:
Darstellung der Zielsetzungen
der EFQM-Prozessteilkriterien
2. Schritt:
Auswahl der zu untersuchenden
Praxismaßnahmen
3. Schritt:
Zusammenfassung der Anwender-
erfahrungen bei der Umsetzung der
untersuchten Praxismaßnahmen
4. Schritt:
Überprüfung der RADAR-
Konformität bei der Umsetzung der
untersuchten Praxismaßnahmen
5. Schritt:
Zusammenfassung und Beurteilung
der Untersuchungsergebnisse
24
X = 1, 2, 3, 4 und 5.
25
X = 1, 2, 3, 4 und 5.
26
X = 1, 2, 3, 4 und 5.
27
X = 1, 2, 3, 4 und 5.
28
X = 1, 2, 3, 4 und 5.
29
Die Bezeichnung "Konformität zur RADAR-Logik" ist in diesem Kontext nicht eindeutig, da die EFQM-
Befähiger-Kriterien nach den Elementen "ADAR" bewertet werden (Vgl. Anhang IV). Aufgrund des besseren
Verständnisses wird in der gesamten Untersuchung auf eine Abänderung verzichtet.
- 8 -
4.
Anwendung der Untersuchungsfelder auf die
EFQM-Prozessteilkriterien
4.1 Untersuchung des EFQM-Teilkriteriums 5a Prozessmanagement
4.1.1 Zielsetzungen
EFQM-Teilkriterium 5a beschäftigt sich mit der systematischen Gestaltung und dem
Management von Prozessen und teilt sich in sechs EFQM-Ansatzpunkte auf. EFQM-
Ansatzpunkt 5a1 beinhaltet die Gestaltung der (Schlüssel-)Prozesse einer Organisation,
welche zur Realisierung ihrer Politik und Strategie erforderlich sind. Die Zielsetzung des
EFQM-Ansatzpunktes 5a2 bezieht sich auf die Identifikation interner sowie externer
Anspruchsgruppen sowie Schnittstellenbelange, um ein effektives Management der
interdisziplinären Prozesse gewährleisten zu können. EFQM-Ansatzpunkt 5a3 empfiehlt
die Festlegung eines Prozessmanagementsystems, welches strukturiert angewandt wird.
Der sich anschließende EFQM-Ansatzpunkt 5a4 befürwortet die Anwendung von
Systemnormen
31
im Rahmen des Prozessmanagementsystems. Die Einführung von
Prozesskennzahlen
32
und Leistungszielen ist Gegenstand des EFQM-Ansatzpunktes 5a5.
Abgeschlossen werden die Empfehlungen der EFQM mit EFQM-Ansatzpunkt 5a6,
welcher eine Effektivitätsanalyse der Prozessarchitektur in Bezug zur Umsetzung der
Strategie und Politik anregt.
33
4.1.2 Auswahlverfahren
Nach Anwendung des Auswahlverfahrens stellt sich heraus, dass die Praxismaßnahme
"Anwendung von Prozessnormen" das höchste Bewertungsergebnis erreicht hat. Somit
stellt diese Maßnahme die Grundlage für die sich anschließenden Untersuchungen des
30
X = 1, 2, 3, 4 und 5.
31
Systemnormen beziehen sich auf bestimmte Bereiche einer Organisation, wie z.B. das Umweltmanagement oder den
Arbeitsschutz (Vgl. EFQM, 2003, S. 19). In diesem konkreten Bezug zu einem ausgewählten Bereich liegt der
Unterschied zur Prozessnorm, welche sich unabhängig von den beteiligten Bereichen auf einen Prozess, wie z.B. den
Behandlungsprozess eines Patienten in einer Gesundheitsorganisation, beziehen.
32
Als Prozesskennzahlen bezeichnet die EFQM Frühindikatoren, welche die Leistung spezifischer Prozesse beschreiben
und messen (Vgl. EFQM, 2003, S. 33).
33
Vgl. EFQM, 2003, S. 19 und Brandt, 2001, S. 206.
- 9 -
EFQM-Teilkriteriums 5a dar. Das gesamte Auswahlverfahren ist in den Anhängen VIII
und IX dargelegt und begründet.
4.1.3 Anwendungserfahrungen
In Gesundheitsorganisationen wird davon ausgegangen, dass die Qualität der
Behandlungsergebnisse maßgeblich von der systematischen Anwendung eindeutiger und
überprüfbarer Prozessnormen beeinflusst werden kann.
34
Dabei hat es sich bewährt diese
Prozessnormen entsprechend individueller fach-, klinik- und stationsbezogener
Eigenschaften zu definieren.
35
Eine solche Definition bzw. Einführung von Prozessnormen
kann durch eine Vielzahl von Instrumenten unterstützt werden. So. z.B. durch den Einsatz
von Checklisten
36
, Flussdiagrammen
37
, Leitlinien
38
, Merkblättern
39
und Richtlinien
40
.
Eine systematische Dokumentation von Prozessnormen erweist sich in der Praxis häufig
als besonders hilfreich bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiter sowie der Lösung
alltäglicher prozessbezogener Probleme.
41
In diesem Kontext hat sich seit Mitte der 90er
Jahre in Anlehnung an die Prozessdokumentationen bei der Anwendung von ISO-Normen,
die Erstellung von Prozesshandbüchern durchgesetzt.
42
In der Praxis dokumentieren diese
Handbücher alle eingeführten Prozessabläufe sowie normen und beziehen sich inhaltlich
auf unterschiedliche Tätigkeitsbereiche. So gibt es Handbücher, welche sich ausschließlich
mit ärztlichen und pflegerischen Behandlungsprozessen beschäftigen.
43
Darüber hinaus
können sich prozessbezogene Handbücher auch auf Supportbereiche, wie z.B. den
Technischen Dienst, beziehen.
44
Um eine möglichst hohe Anzahl von Mitarbeitern zu
erreichen, hat sich eine Hinterlegung der Prozessabläufe im hauseigenen Intranet
bewährt.
45
In kritischen Bereichen, wie z.B. der Arbeitssicherheit in
34
Vgl. Selbstanalyse H, 2003, S. 19.
35
Vgl. Selbstanalyse D, 2004, S. 27 und Selbstanalyse J, 2002, S. 30.
36
Selbstanalyse F, 2003, S. 45.
37
Selbstanalyse K, 2000, S. 30.
38
Selbstanalyse E, 2003, S. 31.
39
Selbstanalyse D, 2004, S. 27.
40
Selbstanalyse C, 2004, S. 40.
41
Vgl. Selbstanalyse A, 2004, S. 40; Selbstanalyse D, 2004, S. 27; Selbstanalyse F, 2003, S. 45 und
Selbstanalyse G, 2003, S. 45.
42
Vgl. Selbstanalyse A, 2004, S. 40 und Selbstanalyse M, 1998, S. 28.
43
Vgl. Selbstanalyse G, 2003, S. 37 und Selbstanalyse J, 2002, S. 30.
44
Vgl. Selbstanalyse D, 2004, S. 29.
45
Vgl. Selbstanalyse E, 2003, S. 31 und Selbstanalyse G, 2003, S. 37.
- 10 -
Gesundheitsorganisationen, weist die Dokumentation der angewandten Prozessnormen in
Form von Prozesshandbüchern zusätzliche Vorteile der juristischen Absicherung auf.
46
Aufgrund der Tatsache, dass die Definition, Aktualisierung sowie Anpassung von
Prozessnormen ein hohes Maß an fachlicher Kompetenz sowie Ressourceneinsatz bedarf,
ist es sinnvoll die unmittelbar Prozessbeteiligten strukturiert einzubeziehen.
47
In der Praxis
erfolgt dieser Einbezug vielfach in Form einer im Verhältnis zur Fachkompetenz und
zeitlichen Verfügbarkeit stehenden Übertragung von Prozessverantwortlichkeiten sowie
der Bildung interdisziplinärer Projektgruppen.
48
Trotz dieser Maßnahmen bestehen bei der Praxisanwendung Verbesserungspotentiale in
Bezug zur Konzeption der Prozessnormen.
49
Daher haben einzelne Organisationen
grundlegende Merkmale für Prozessnormen definiert. Demnach ist es notwendig neben
einer eindeutigen Bestimmung eines Prozessablaufes dessen einzelne Schritte mit
Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten auszustatten. Dabei sollten die am Prozess
beteiligten Mitarbeiter, Dienste sowie sonstige Interessengruppen
50
dokumentiert und bei
Verbesserungen einbezogen werden. Auch das Vorgehen zur Prozessoptimierung sollte
parallel zur Prozessnorm dokumentiert werden und messbar ausgestaltet sein.
51
Besonders der Messbarkeit von Prozessabläufen wird eine erfolgskritische Bedeutung
beigemessen, da diese eine fundierte Grundlage zur Identifikation von
Verbesserungsbereichen darstellen kann. Aber dem Anspruch der kontinuierlichen
Messung von Ergebnissen im Anschluss an die Einführung neuer Prozessnormen wird
jedoch in der Praxis nur selten entsprochen.
52
Daher erscheint es sinnvoll, bereits bei der
Definition einzelner Prozessnormen ein Kontrollsystem zu integrieren. Instrumente zur
Kontrolle können beispielsweise die Auswertung prozessbezogener Kennzahlen
53
,
kritischer Behandlungsvorfälle
54
oder Behandlungsprotokolle
55
sein. Mit Hilfe solcher
46
Vgl. Selbstanalyse F, 2003, S. 47.
47
Vgl. Selbstanalyse A, 2004, S. 40 und Selbstanalyse M, 1998, S. 28.
48
Vgl. Selbstanalyse A, 2004, S. 40; Selbstanalyse C, 2004, S. 40; Selbstanalyse E, 2003, S. 31; Selbstanalyse J, 2002,
S. 30 und Selbstanalyse M, 1998, S. 28.
49
Vgl. Gutachten G, 2002, S. 10.
50
Als Interessengruppen bezeichnet die EFQM diejenigen Personen, welche ein direktes Interesse an einer Organisation,
ihren Aktivitäten und Ergebnissen haben, so z.B. Kunden, Partner, Aktionäre oder Behörden (Vgl. EFQM, 2003, S. 32).
51
Vgl. Selbstanalyse A, 2004, S. 40.
52
Vgl. Gutachten A, 2004, S. 19; Gutachten B, 2004, S. 17 und Gutachten G, 2002, S. 10.
53
Selbstanalyse A, 2004, S. 41.
54
Selbstanalyse D, 2004, S. 33.
- 11 -
Instrumente können Unregelmäßigkeiten frühzeitig erkannt und die Entwicklung hin zu
einer "Lernenden Organisation"
56
unterstützt werden.
57
Bei Abweichungen komplexer und
erfolgskritischer Prozessnormen empfiehlt sich eine umfassende Analyse der Ist-Situation,
welche über die Auswertung einzelner Indikatoren hinausgeht.
58
Hinsichtlich der
Umsetzung von identifizierten Verbesserungspotentialen einzelner Prozessnormen hat sich
ein unter Einbezug der Prozessbeteiligten, in Teilschritten durchgeführtes und in
vorbildlich organisierten Bereichen beginnendes Optimierungsverfahren bewährt.
59
4.1.4 RADAR-Konformität der Praxisanwendung
Zwölf der 14 untersuchten Organisationen geben an, dass sie Prozessnormen eingeführt
haben. Die Untersuchung
60
der einzelnen RADAR-Attribute bei der Praxisanwendung
dieser Prozessnormen zeigt jedoch erhebliches Verbesserungspotential auf. Denn nur zwei
der 14 betrachteten Organisationen weisen bei der Anwendung von Prozessnormen ein
durchgängig RADAR-konformes Vorgehen auf. Bei detaillierter Betrachtung wird
deutlich, dass weniger als die Hälfte der untersuchten Organisationen ein fundiertes und
integriertes Vorgehen, eine systematische Umsetzung sowie eine Bewertung durch
Messung der eingeführten Maßnahmen aufweisen. Zusätzlich weisen die Bereiche des
Lernens sowie der Verbesserung mangelhafte Ergebnisse auf, da weniger als ein Drittel der
Anwenderorganisationen diese nachweisen kann.
4.1.5 Beurteilung der Untersuchungsergebnisse
In Bezug zu den Zieldefinitionen des EFQM-Teilkriteriums 5a (Vgl. Kapitel 4.1.1)
generiert die Untersuchung der meistgenannten Maßnahmenbeispiele unerwartete
Ergebnisse. Die Tatsache, dass die Maßnahme der Definition von Prozesshierarchien
61
mit
zehn Nennungen die zweithäufigste Praxismaßnahme der untersuchten Organisationen
55
Selbstanalyse M, 1998, S. 28.
56
Organisationales Lernen bezeichnet die Weiterentwicklung eines von den Organisationsmitgliedern geteilten
Wissensbestandes (Vgl. Pira, 2000, S. 122).
57
Vgl. Selbstanalyse K, 2000, S. 34.
58
Vgl. Selbstanalyse F, 2003, S. 45.
59
Vgl. Selbstanalyse A, 2004, S. 40 und Möller, 2001, S. 48.
60
Die Ergebnisse der Untersuchung der RADAR-Konformität sind in Anhang X zusammengefasst.
61
Prozesshierarchien teilen die einzelnen Prozessabläufe übergeordneten Kategorien zu, wie z.B. Führungsprozessen,
klinischen Prozessen und unterstützenden Prozessen (Vgl. Pohlmann, Döhr, 2003, S. 32).
- 12 -
darstellt, ist aufgrund des mangelnden Bezugs zu den Zielen der EFQM-Ansatzpunkte
(Vgl. Anhang IX) negativ zu bewerten. Unterstützt wird diese These durch die Tatsache,
dass relativ zielkonformere und praxisrelevantere Maßnahmen, wie z.B. das Management
von Schnittstellenproblemen, welche ca. 80 Prozent der Organisationsprobleme
ausmachen, deutlich seltener beschrieben werden (Vgl. Anhang VIII).
62
Hinsichtlich des Entwicklungs- bzw. Verbesserungspotentials einer Organisation weist
einzig die Maßnahme der Anwendung von Prozessnormen einen ausgeprägten Bezug auf.
Sowohl die Definition von Prozesshierarchien, als auch die isolierte Darstellung von
Prozessabläufen stellen zwar Möglichkeiten zur Identifikation von prozessbezogenen
Verbesserungsbereichen dar, besitzen jedoch keinerlei dynamischen Charakter, wie es bei
der systematischen Anwendung von Prozessnormen der Fall ist.
Weiterhin gestaltet sich die Qualität der Anwendung von Prozessnormen in der
Praxisumsetzung heterogen. In der Regel werden Prozesshandbücher zur Dokumentation
und Verwaltung einzelner Prozessnormen verwendet.
63
Elementar für die Wirksamkeit
dieser Art der Prozessdokumentation ist eine systematisch und kontinuierlich
durchgeführte Bewertung und Aktualisierung aller Prozessabläufe.
64
Diese Bewertungs-
und Aktualisierungsmaßnahmen werden in der Praxis aber nur selten durchgeführt.
65
Eine
wesentliche Begründung dafür ist der hohe Arbeitsaufwand dieser Maßnamen.
66
Aufgrund
der Tatsache, dass diese Handbücher die formale Grundlage der Verhaltensweisen der
Mitarbeiter darstellen, ist es fraglich, ob die häufig hinsichtlich der Verbesserung und
Aktualisierung vernachlässigten Handbücher ihren eigentlichen Zweck, die Optimierung
der vorherrschenden Prozessqualität, erfüllen. Besonders die darauf aufbauende
Einarbeitung neuer Mitarbeiter (Vgl. Kapitel 4.1.3) birgt die Gefahr einer Verschleppung
suboptimaler Prozessqualität.
Hinzu kommt, dass sich die Art der Darstellung der Praxismaßnahmen in den
Selbstanalysen häufig mangelhaft gestaltet. Ein wesentlicher Grund liegt darin, dass die
62
Vgl. Ament-Rambow, 2001, S. 31.
63
Vgl. Selbstanalyse A, 2004, S. 40; Selbstanalyse G, 2003, S. 37; Selbstanalyse J, 2002, S. 30 und Selbstanalyse M,
1998, S. 28.
64
Vgl. Gutachten F, 2002, S. 13.
65
Vgl. Gutachten A, 2004, S. 18; Gutachten B, 2004, S. 17; Gutachten F, 2002, S. 13 und Gutachten H, 2000, S. 22.
- 13 -
Anwender ihren Fokus weniger auf eine strukturierte Vorgehensweise, als auf die
Prozessnormen an sich legen. Eine präzise Beschreibung dessen wie etwas gemacht wird
ist im Sinne der EFQM zielführender als eine ausgedehnte Beschreibung dessen was
gemacht wird.
67
Hinsichtlich der systematischen Gestaltung und Standardisierung des interdisziplinären
Prozessmanagements kann die Anwendung entsprechender Systemnormen, wie z.B. eines
Zertifizierungsverfahrens nach ISO 9000 ff. oder KTQ
68
, zur Strukturierung des Vorgehens
beitragen.
69
Bei den untersuchten Organisationen kommen solche Systemnormen zur
Unterstützung der Implementierung von Prozessmanagementsystemen aber nur selten zum
Einsatz.
70
Einen weiteren Kritikpunkt bei der Praxisanwendung von Prozessnormen bildet die
Tatsache, dass sich diese nicht auf den Patienten alleine konzentrieren sollte.
71
Hinsichtlich
des Ziels einer Erhöhung der Kundenbindung hat sich ein nach Kundensegmenten (z.B.
Patienten, Einweiser, Kostenträger) gegliedertes Vorgehen bewährt.
72
Bei der Umsetzung von Prozessnormen im ärztlichen Bereich ist die Anwendung von
Leitlinien zweckmäßig, welche z.B. auf Basis von Evidence Based Medicine
73
Handlungsalternativen aufzeigen.
74
Lediglich eine der untersuchten Organisationen
beschreibt die Berücksichtigung dieser wissenschaftlichen Komponente.
75
In der
Integration empirisch belegter best-practice-Maßnahmen
76
liegt daher ein wesentliches
Verbesserungspotential im Umgang mit Prozessnormen in Gesundheitsorganisationen.
66
Vgl. Selbstanalyse A, 2004, S. 40.
67
Vgl. Gutachten A, 2004, S. 18.
68
KTQ steht für "Kooperation für Transparenz und Qualität im Krankenhaus" und bezeichnet ein
krankenhausspezifisches Zertifizierungsverfahren (Vgl. KTQ, 2002, S. 5).
69
Vgl. Brandt, 2001, S. 217.
70
Vgl. Gutachten A, 2004, S. 19 und Gutachten G, 2000, S. 21.
71
Vgl. Gutachten G, 2002, S. 13.
72
Vgl. Gutachten A, 2004, S. 18.
73
Evidence Based Medicine bezeichnet die effiziente Nutzung wissenschaftlicher Erkenntnisse bei der
Patientenversorgung (Vgl. Hildebrand, 2001, S. 479).
74
Vgl. Hansen, 2004, S. 9 und Trill, Teichmann, 2001, 7.7, S. 24.
75
Vgl. Selbstanalyse C, 2004, S. 1.
76
Als best-practice-Maßnahmen bezeichnet die EFQM fehlerfreie, bewährte und dokumentierte Arbeitsweisen, welche
die Standards der bekannten, gegenwärtigen operativen Leistungen in einem bestimmten Geschäftsbereich übertreffen
(Vgl. EFQM, 2003, S. 32).
- 14 -
Die RADAR-Konformität der Praxisanwendungen im EFQM-Teilkriterium K5a ist
mangelhaft (Vgl. Kapitel 4.1.4). Dies ist insofern bedenklich, da eine fundierte und
integrierte Umsetzung sowie regelmäßige Überprüfung, Bewertung und Anpassung von
Prozessnormen die Marktposition von Gesundheitsorganisationen in Zeiten zunehmenden
Wettbewerbs, abnehmender Bestandsgarantie und pauschal vergüteter Behandlungsfälle
positiv beeinflussen kann.
77
Hinsichtlich der Tatsache, dass die RADAR-Logik den Kern
der EFQM-Anwendung bildet (Vgl. Kapitel 2.2) sowie einem Umsetzungsleitfaden ähnelt
(Vgl. Abbildung 3), weist dieses Ergebnis auf erhebliche Verbesserungsbereiche bei der
Praxisanwendung in Gesundheitsorganisationen hin.
Fazit:
In Bezug zu den Zieldefinitionen des EFQM-Teilkriteriums 5a wurde im Rahmen der
Untersuchung deutlich, dass die Praxisumsetzung der beschriebenen Maßnahmen
erhebliche Verbesserungspotentiale aufweist. Jene Maßnahmen, welche in den
untersuchten Selbstanalysen am zahlreichsten beschrieben werden, stehen teilweise im
Widerspruch zu den vorgegebenen Zielen des EFQM-Teilkriteriums und erweisen sich
zusätzlich als nicht erfolgskritisch. Die Praxisanwendung und -umsetzung der
beschriebenen Maßnahmen erfolgt in unbeständiger Qualität, ohne vergleichenden
Einbezug von best-practice-Maßnahmen und ist zu sehr auf das Kundensegment
"Patienten" fokussiert. Die mangelhafte RADAR-Konformität der Praxisanwendungen ist
insofern bedenklich, da eine regelmäßige Überprüfung, Bewertung und Anpassung von
Prozessnormen die Grundlage für eine positive Beeinflussung der Marktposition von
Gesundheitsorganisationen in Zeiten abnehmender Bestandsgarantie bilden kann.
4.2 Untersuchung des EFQM-Teilkriteriums 5b Prozessverbesserung
4.2.1 Zielsetzungen
Das EFQM-Teilkriterium 5b gliedert sich in neun EFQM-Ansatzpunkte und zielt auf die
Zufriedenstellung und Erhöhung der Wertschöpfung aller Interessengruppen. Diese Ziele
sollen bei identifiziertem Bedarf unter Nutzung von Innovationen erreicht werden. EFQM-
Ansatzpunkt 5b1 bezieht sich auf die Ermittlung und Priorisierung von vorherrschenden
77
Vgl. Klauber, Robra, Schellschmidt, 2004, S. 44; Sommer, Esswein, 2004, S. 38 und Vera, 2004, S. 31.
- 15 -
Verbesserungsbereichen. Weiterhin empfiehlt EFQM-Ansatzpunkt 5b2 die Anwendung
von Leistungs- und Wahrnehmungsergebnissen als Grundlage für die Definition
vorrangiger Ziele für Verbesserungsmaßnahmen. Mit der Zielsetzung qualitativ
hochwertiger Ergebnisse befürwortet EFQM-Ansatzpunkt 5b3 die Förderung sowie den
Einbezug der kreativen und innovativen Talente aller beteiligten Interessengruppen.
EFQM-Ansatzpunkt 5b4 weist darauf hin, dass eine Entdeckung und der Einsatz
revolutionärer Prozessgestaltungen, Geschäftsphilosophien sowie weiterführender
Technologien unerlässlich sind. Durch Umsetzung des EFQM-Ansatzpunktes 5b5 wird
sichergestellt, dass zweckmäßige Methoden ausgewählt werden, um den Wandel zu
vollziehen. Ebenso ist es nach EFQM-Ansatzpunkt 5b6 sinnvoll, die Einführung neuer
Prozessabläufe in Pilotversuchen zu erproben sowie zu überprüfen. EFQM-Ansatzpunkt
5b7 empfiehlt eine umfassende Bekanntmachung der Prozessänderungen, welche alle von
ihr betroffenen Mitarbeiter erreicht. Zwischen einer solchen Information und der
Prozesseinführung sollten jene Mitarbeiter hinsichtlich der Prozessneuerungen geschult
werden, welche unmittelbar von diesen betroffen sind. Solche Schulungen sind Gegenstand
des EFQM-Ansatzpunktes 5b8. Abschließend befasst sich EFQM-Ansatzpunkt 5b9 mit der
Sicherstellung, dass die Prozessänderungen die gewünschten Resultate erzielen.
78
4.2.2 Auswahlverfahren
Nach Anwendung des Auswahlverfahrens stellt sich heraus, dass die Praxismaßnahme
"Anwendung eines systematischen Verbesserungsmanagements" das höchste
Bewertungsergebnis erreicht hat. Somit stellt diese Maßnahme die Grundlage für die sich
anschließenden Untersuchungen des EFQM-Teilkriteriums 5b dar. Das gesamte
Auswahlverfahren ist in den Anhängen XI und XII dargelegt und begründet.
4.2.3 Anwendungserfahrungen
Verbesserungsbezogene Aktivitäten in Gesundheitsorganisationen gestalten sich häufig
unsystematisch und erhalten selten die zur Einleitung einer wirklichen
Prozessumgestaltung nötige Unterstützung der Geschäftsführung.
79
Zudem erfolgen
78
Vgl. EFQM, 2003, S. 19 und Brandt, 2001, S. 229.
79
Vgl. Brandt, 2001, S. 235 und Hildebrand, 2001, S. 289.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2005
- ISBN (eBook)
- 9783836605885
- DOI
- 10.3239/9783836605885
- Dateigröße
- 466 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Hochschule Mainz – Wirtschaftswissenschaften, Studiengang Gesundheitsökonomie / Krankenhausmanagement
- Erscheinungsdatum
- 2007 (Oktober)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- efqm-modell qualitätsmanagement prozessmanagement total quality management krankenhausmanagement
- Produktsicherheit
- Diplom.de