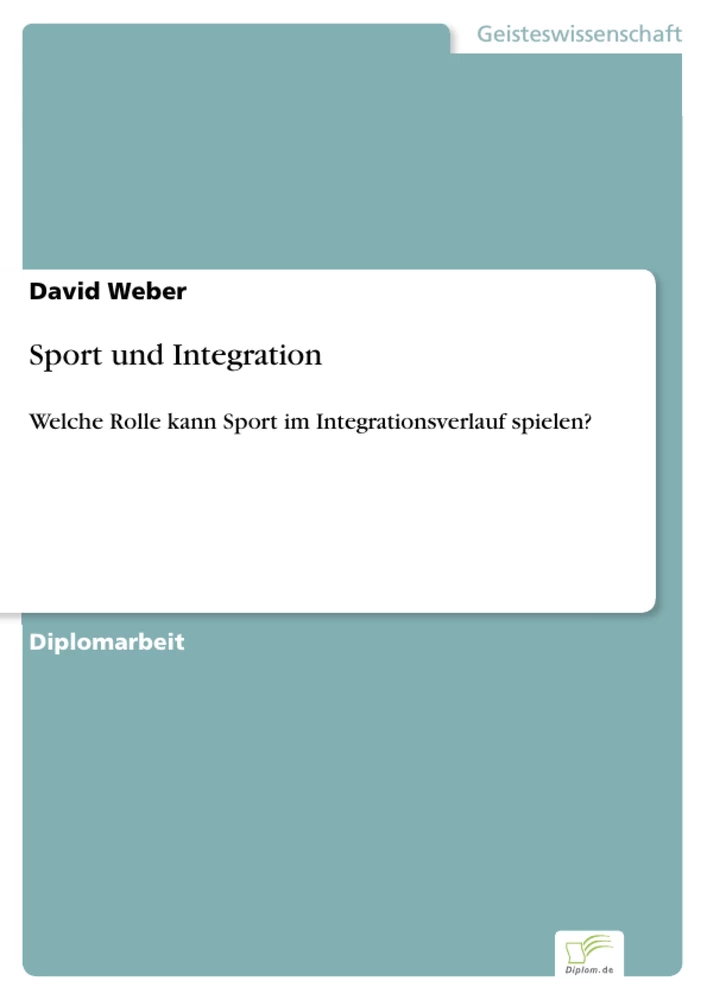Sport und Integration
Welche Rolle kann Sport im Integrationsverlauf spielen?
Zusammenfassung
Auch 30 Jahre nach dem Anwerbestopp ist es für die klassischen Arbeitsmigranten und ihre Familien noch immer sehr schwierig an den zentralen gesellschaftlichen Gütern und Positionen teilzuhaben. Sicherlich haben sich die Abstände gerade in der Generationenfolge deutlich verringert, dennoch besteht nach wie vor eine Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit.
Eine große Ausnahme scheint hierbei der Sport zu sein: Fußballer, Boxer, Handballer und viele andere Sportler in den unterschiedlichsten Sportarten ernten als Arbeitsmigranten hohen gesellschaftlichen Respekt und Sympathie. Zumindest im Falle von Profisportlern spielen die klassischen Integrationshürden: Sprache, kulturelle Kompetenzen und Kenntnisse oder auch gesellschaftliche Diskriminierung, scheinbar keine Rolle. Anerkennung und Positionierung erfolgen alleine durch sportliche Leistung.
Ähnliches gilt möglicherweise auch auf Amateur- und Freizeitsportebene. Deshalb wird in dieser Arbeit untersucht welche Rolle Sport im Integrationsverlauf von Migranten spielen kann.
Gang der Untersuchung:
Dazu werde ich zunächst einen kurzen Blick auf die Lebenslagen von Migranten zu werfen, um zu verdeutlichen wie die Situation von Migranten in Deutschland insgesamt einzuschätzen ist.
Darauf aufbauend erfolgt dann eine Darstellung des Integrationsverlaufs, wie er in der Theorie Hartmut Essers beschrieben wird. Dabei wird, ohne zu viel vorweg zu nehmen, deutlich, dass der Erwerb relevanter Kapitalien (Sprache, Bildung, etc.) von zentraler Bedeutung ist.
Dies wird in der Praxis aber oft durch gesellschaftliche Integrationsbarrieren erschwert.
Danach wird der Sport mit allen seinen Facetten im Fokus stehen.
Zunächst wird die Besonderheit des Funktionssystems Sport und die mögliche Bedeutung von Sport für die Integration von Migranten erläutert.
Dann stelle ich die Bedeutung von Sport für Gesellschaft und Individuum auf Basis des aktuellen soziologischen Forschungsstandes dar.
Es folgt eine Untersuchung, welchen Einfluss Sport auf die Sozialisation von Menschen hat und welche Chancen auf gesellschaftliche Integration der (Wettkampf-)Sport eröffnen kann.
Dieser findet in Deutschland, entgegen allen Trends zum Individualsport im Fitnessstudio, vor allem in Sportvereinen statt, weshalb deren Bedeutung für die Gesellschaft und die Vereins-Mitglieder selbst, ebenfalls in Augenschein genommen wird.
An Praxisbeispielen werden die gewonnenen Erkenntnisse nochmals reflektiert […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhalt
1. Einführung
2. Lebenslagen von Migranten
3. Integrationstheorie Hartmut Essers
3.1 Sozialintegration
3.2 „Investition“ & “Kapitalerwerb“
3.3 Assimilation
4. Gesellschaftliche Integrationsbarrieren
5. Sport
5.1 Bedeutung des Funktionssystems Sport für die Integration von Migranten
5.2 Bedeutung von Sport für die Gesellschaft
5.3 Bedeutung von Sport für das Individuum
6. Sportvereine als Integrationsplattformen ?
6.1 Forschungsergebnisse
6.2 Sportvereine im Wandel
6.3 Bewertung
7. Praxisbeispiel
7.1 Migranten im deutschen Ligenfußball
7.2 Zugangsbarrieren im Sport
7.3 Ethnisch geschlossene Ausländerclubs
8. Praxisbeispiel
8.1 Schwarze im US-Sport
8.2 Diskriminierung im Sport
9. Fazit
10. Literaturverzeichnis
1.Einleitung
Auch 30 Jahre nach dem Anwerbestopp ist es für die „klassischen Arbeitsmigranten“ und ihre Familien noch immer sehr schwierig an den zentralen gesellschaftlichen Gütern und Positionen teilzuhaben. Sicherlich haben sich die Abstände gerade in der Generationenfolge deutlich verringert, dennoch besteht nach wie vor eine Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit.
Eine große Ausnahme scheint hierbei der Sport zu sein: Fußballer, Boxer, Handballer und viele andere Sportler in den unterschiedlichsten Sportarten ernten als „Arbeitsmigranten“ hohen gesellschaftlichen Respekt und Sympathie. Zumindest im Falle von Profisportlern spielen die klassischen Integrationshürden: Sprache, kulturelle Kompetenzen und Kenntnisse oder auch gesellschaftliche Diskriminierung, scheinbar keine Rolle. Anerkennung und Positionierung erfolgen alleine durch sportliche Leistung.
Ähnliches gilt möglicherweise auch auf Amateur- und Freizeitsportebene. Deshalb wird in dieser Arbeit untersucht welche Rolle Sport im Integrationsverlauf von Migranten spielen kann.
Dazu werde ich zunächst einen kurzen Blick auf die Lebenslagen von Migranten zu werfen, um zu verdeutlichen wie die Situation von Migranten in Deutschland insgesamt einzuschätzen ist.
Darauf aufbauend erfolgt dann eine Darstellung des Integrationsverlaufs, wie er in der Theorie Hartmut Essers beschrieben wird. Dabei wird, ohne zu viel vorweg zu nehmen, deutlich, dass der Erwerb relevanter „Kapitalien“ (Sprache, Bildung, etc.) von zentraler Bedeutung ist.
Dies wird in der Praxis aber oft durch gesellschaftliche Integrationsbarrieren erschwert.
Danach wird der Sport mit allen seinen Facetten im Fokus stehen.
Zunächst wird die Besonderheit des Funktionssystems Sport und die mögliche Bedeutung von Sport für die Integration von Migranten erläutert.
Dann stelle ich die Bedeutung von Sport für Gesellschaft und Individuum auf Basis des aktuellen soziologischen Forschungsstandes dar.
Es folgt eine Untersuchung, welchen Einfluss Sport auf die Sozialisation von Menschen hat und welche Chancen auf gesellschaftliche Integration der (Wettkampf-) Sport eröffnen kann.
Dieser findet in Deutschland, entgegen allen Trends zum
Individualsport im Fitnessstudio, vor allem in Sportvereinen statt, weshalb deren Bedeutung für die Gesellschaft und die Vereins-Mitglieder selbst, ebenfalls in Augenschein genommen wird.
An Praxisbeispielen werden die gewonnenen Erkenntnisse nochmals reflektiert und überprüft.
Zum einen möchte ich Migranten im System des Deutschen Ligenfußballs, zum anderen die Situation der Schwarzen im US-Sport betrachten.
In einem abschließenden Kapitel werden dann die Ergebnisse aufgearbeitet und die Frage beantwortet, welche Rolle Sport im Integrationsverlauf letztlich spielen kann.
2. Lebenslagen von Migranten
Im nachfolgenden Kapitel soll die Situation von Migranten in der Praxis anhand verschiedener Lebenslagen dargestellt werden, um einen Eindruck davon zu bekommen wie die Lebenssituation vieler Migranten in Deutschland ist.
Nach Zahlen des statistischen Bundesamtes (vgl. bamf, 2007, Kap. 2 - 3) leben in Deutschland ca. 6,75 Mio. Menschen ausländischer Herkunft. Das bedeutet einen Ausländeranteil von 8,2%.
In dieser Statistik sind jedoch keine Menschen mit Migrationshintergrund wie bsp. Spätaussiedler oder „Gastarbeiterkinder“ der 2. oder 3. Generation erfasst.
2005 waren in Deutschland ca. 26 Mio. Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Der Anteil ausländischer Beschäftigter lag jedoch nur bei 6,7%.
Im selben Jahr lag die Arbeitslosigkeit gesamtdeutsch im Durchschnitt bei 13%. Bei Ausländern lag die Arbeitslosenquote im Schnitt jedoch bei ca. 25%, im Osten Deutschlands sogar bei bis zu 50%.
Die Situation von Migranten auf dem Arbeitsmarkt ist also außerordentlich prekär. Gemäß ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung sind sie bei der Zahl der Beschäftigungsverhältnisse unterrepräsentiert.
Ebenfalls sehr bedenklich die Tatsache, dass die Arbeitslosigkeit etwa doppelt so hoch ist wie bei Deutschen.
Zu den Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund sind folgende Erkenntnisse aufallend :
Kinder mit Migrationshintergrund besuchen Kitas seltener und weniger lange. Sie versäumen somit einen wesentlichen Teil frühkindlicher Förderung und Bildung.
Gerade die möglichen Defizite im sprachlichen Bereich werden deshalb nicht bereits im Vorschulalter minimiert, sondern mit in die Grundschule genommen.
Sehr häufig kumulieren diese sprachlichen Mängel und stehen einer erfolgreichen Bewältigung der schulischen Anforderungen dauerhaft im Wege.
Auch wenn Migrantenkinder sicherlich ähnlich hohe Ambitionen haben wie die Einheimischen, bleiben ihnen Bildungschancen mehr oder weniger verwehrt. Nur 16% machen das Abitur und fast 20% brechen die Schule ohne jeden Abschluss ab.
Nicht anders die Situation auf dem Ausbildungsmarkt. 40% bleiben ohne einen Ausbildungsplatz, 32% ohne Berufsabschluss. Im Jahre 2002 lag der Migrantenanteil unter den Azubis sogar bei nur 5%.
Jugendliche mit Migrationshintergrund werden von Schule, Betrieben und in der Jugendhilfe häufig als besonders defizitär und problembelastet angesehen. Diese Voreingenommenheit mindert die Chancen solcher Jugendlichen auf Zugang zum Ausbildungssystem sehr.
Junge Migranten reagieren auf erfahrene Ablehnung oftmals mit ethnischer Abschottung. Es entsteht ein Teufelkreis, der oft genug im Bezug sozialstaatlicher Leistungen endet, ohne jede Chance auf berufliche Perspektive (vgl. Juventa, 2005, S. 165 - 171).
In Bezug auf die Arbeitsmarktsituation und die Armutsentwicklung ist folgendes zu betonen:
Der industrielle Sektor, in dem viele Migranten beschäftigt waren und sind, hat zugunsten des Dienstleistungssektors an Bedeutung eingebüßt und viele Arbeitsplätze verloren.
Von solchen wirtschaftlichen Umwälzungen und Konjunkturkrisen sind Migranten besonders betroffen, da ihre ökonomische Situation sehr stark auf solche Schwankungen reagiert. Die meisten arbeiten immer noch als gering qualifizierte Arbeiter in Industrie und Fertigung.
Gutes Sprachvermögen und Bildung sind dafür nicht notwendig und können in solchen Berufen auch kaum erworben oder verbessert werden.
Dementsprechend hoch ist das Armutsrisiko. Viele Migrantenhaushalte sind von Arbeitslosigkeit und prekären Einkommensverhältnissen gekennzeichnet.
2003 lag die Armutsquote von Migranten bei 23%. Bei den Deutschen waren es 14% (vgl. Juventa, 2005, S.174 - 193).
Hinzu kommt, dass in keinem Land die Bildungszielerreichung so sehr von der sozialen Herkunft abhängt wie in Deutschland.
Somit sind vor allem Kinder und Jugendliche aus Migrationshaushalten besonders benachteiligt, da viele in sozial schwachen Familienverhältnissen aufwachsen.
Fast ein Drittel der Kinder mit Migrationshintergrund in der Altersgruppe <10 Jahren lebt unter der Armutsgrenze.
Gleiches gilt für die Altersgruppen der 21-30jährigen und der über 60jährigen.
Kein Beispiel für ökonomischen Erfolg sind die stark gestiegenen Unternehmensgründungszahlen bei Migranten, wie eine auf türkische Unternehmensgründungen ausgerichtete Studie aus Berlin belegt (vgl. Juventa, 2005, S. 202 - 210). Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die marginalisierte Arbeitsmarktsituation mit der ebenfalls marginalisierten Situation als Unternehmer getauscht wurde; oftmals mit einem viel zu niedrigen, die Existenz bedrohenden, Einkommen.
Gerade in den Bereichen Gastronomie und Handel blühen die Unternehmensgründungen geradezu auf, da hier nur ein geringer Kapitalbedarf und kaum schulisch-fachliche Vorqualifikation notwendig ist.
Es handelt sich nicht selten um 1-Mann- oder Familienbetriebe, von denen 30% unter dem Existenzminimum rangieren und 50% „gerade so auskommen.“ Vieles deutet darauf hin, dass die Devise „selbständig statt arbeitslos“ verfolgt wird.
Ebenfalls auffällig die Zusammenhänge zwischen sozialer Schicht und Gesundheit. Untere soziale Schichten haben deutlich erhöhte Morbidität und Mortalität.
Gründe dafür sind ungünstige, belastende Lebensbedingungen, mangelnde Kenntnisse bezüglich des Gesundheitssystems oder soziokulturell begründete Hemmschwellen (vgl. Juventa, 2005, S. 211 - 307).
In einer sehr interessanten Studie wurden Türken nach ihren persönlichen Befindlichkeiten befragt (vgl. Assion, 2005, S.69 - 80).
So fühlt sich nur etwa die Hälfte der Befragten in Deutschland wirklich zu Hause. Gleichzeitig geben fast genauso viele an hin und her gerissen zu sein. Über 40% bezeichnen sich als heimatlos und mehr als 50% halten die deutsche und türkische Lebensweise für unvereinbar.
70% sehen keine Nähe zu ihren deutschen Mitbürgern und die Hälfte der Befragten hält es für angebracht aufzupassen nicht „zu deutsch“ zu werden.
Befragt nach ihrem sozialen Umfeld und den Wohnverhältnissen sind 70 - 80% mit diesen zufrieden.
Nur 40% können sich mit dem Aus- und Weiterbildungssystem anfreunden, die Mehrheit lehnt dieses ab oder hat keinerlei Kenntnisse davon.
Zwei Drittel beurteilen die eigenen Berufschancen als gut, jedoch hätten 60-70% gerne einen höheren Abschluss bzw. eine höhere berufliche Stellung.
40% beklagen sich über ein zu niedriges Einkommen und monieren die fehlenden Möglichkeiten an der Konsumwelt teilhaben zu können.
Diese kurze Zusammenstellung verschiedener Forschungs- und Umfrageergebnisse verdeutlicht die Situation von Migranten in Deutschland und gibt Hinweise auf die im nachfolgenden Kapitel noch näher zu beschreibenden Eigenarten und Schwierigkeiten des Integrationsprozesses:
Migranten sind in fast allen Bereichen der Gesellschaft benachteiligt und unterrepräsentiert.
Zwar ist es im Generationenverlauf gelungen viele Defizite und Rückstände aufzuholen, bzw. abzubauen, doch sind sie in der Besetzung gesellschaftlicher Positionen nach wie vor wenig erfolgreich.
An den Indikatoren, die benutzt werden, um die gesellschaftliche Situation von Migranten zu beschreiben, wird deutlich, dass gelungene und gelingende Integration vor allem im Zusammenhang mit der Positionierung von Migranten im Bildungssystem und Arbeitsmarkt festgemacht wird.
Voraussetzung für eine solche Positionierung ist der Erwerb spezieller Fähigkeiten und Kenntnisse, so genanntes „Humankapital“ wie Sprache oder Bildung.
Die Gesellschaft gibt also den Rahmen vor, indem sich die Individuen beweisen müssen.
Für Migranten sind diese zum Teil sehr komplexen Herausforderungen kaum zu verstehen und nur schwer zu bewältigen.
Im nachfolgenden Kapitel werden nun der Begriff der Integration und die Rahmenbedingungen gelingender Integration aus theoretischer Sicht betrachtet.
3. Integrationstheorie Hartmut Essers
3.1 Sozialintegration
Die Definition des Begriffs Integration soll an dieser Stelle in Ahnlehnung an Hartmut Esser erfolgen. Hier wird die Komplexität des Integrationsprozesses und die Bedeutung des „Humankapitals“ für den Integrationsverlauf besonders deutlich.
Esser versteht unter Integration ganz allgemein den Zusammenhalt von Teilen in einem systemischen Ganzen, unabhängig davon worauf dieser Zusammenhalt beruht.
Dabei müssen die Teile ein nicht wegzudenkender „integraler“ Bestandteil des Ganzen sein (vgl. Esser, 2001, S.3 - 29).
Mit dem Begriff der Integration werden stets 2 Einheiten angesprochen: das System als Ganzheit und die „Teile“, die es bilden. Dementsprechend unterscheidet Esser zwischen Systemintegration und Sozialintegration.
Für diese Arbeit relevant sind seine Überlegungen zur Sozialintegration.
Wird in dieser Arbeit also der Begriff Integration benutzt, ist Sozialintegration gemeint, also die Inklusion der Akteure (Migranten) in das System als Ganzes (Aufnahmegesellschaft) und die jeweiligen Sub-Systeme (Schule, Arbeitsmarkt, etc.).
Soziale Integration beschreibt Unterschiede zwischen den Individuen in Bezug auf das Ausmaß der von ihnen unterhaltenen Beziehungen und der dadurch erreichten sozialen Positionierung.
Esser unterscheidet 4 verschiedene Varianten (Ebenen) der Sozialintegration: Kulturation, Platzierung, Interaktion und Identifikation.
- Mit Kulturation meint Esser die Übernahme von Wissen, Fertigkeiten und kulturellen Vorstellungen.
Wissen und Kompetenzen beziehen sich auf die Kenntnis der wichtigsten Regeln für bestimmte Situationen und die Beherrschung der dafür nötigen kulturellen Fertigkeiten. Damit ist insbesondere die Sprache gemeint.
- Platzierung bezeichnet die Besetzung bestimmter gesellschaftlicher Positionen durch einen Akteur. Das Individuum wird über den Vorgang der Platzierung in ein bereits bestehendes System integriert und besetzt dann eine bestimmte Position.
Damit einher geht die Verleihung bestimmter Rechte wie bsp. Staatsbürgerschafts- und Wahlrecht sowie die Übernahme beruflicher und anderer Positionen.
Dies wiederum macht das Durchlaufen einer gewissen Bildungskarriere notwendig.
Platzierung auf möglichst zentralen Positionen der Gesellschaft ist von entscheidender Bedeutung für nachhaltige Sozialintegration.
- Interaktion, als dritte Dimension der Sozialintegration, meint die Aufnahme von sozialen Beziehungen und die Eingliederung in familiäre Zusammenhänge und Freundschaftsnetzwerke.
- Vierte Ebene der Sozialintegration ist die Identifikation.
Hier geht es um die emotionale und kognitive Beziehung
zwischen dem einzelnen Akteur und dem sozialen System als Ganzem.
Die vier genannten Dimensionen der Sozialintegration stehen in direktem Zusammenhang zueinander und sind voneinander abhängig.
Eine Identifikation mit der Aufnahmegesellschaft ist nur dann zu erwarten, wenn die Zugehörigkeit zur selben auch als positiv und gewinnbringend empfunden wird.
Voraussetzung dafür ist die Einbettung in anregende soziale Bezüge.
Dies wiederum ist nur möglich, wenn die notwendigen kulturellen Fähigkeiten, vor allem die sprachlichen, vorhanden sind.
Beides setzt die Platzierung auf bestimmten Positionen voraus, wobei die Platzierung selbst auch nur durch ein Minimum an Kulturation möglich wird.
Gelungene, nachhaltige Sozialintegration ist also ein Prozess, der auf mehreren Ebenen gleichzeitig stattfindet.
Die Akteure müssen dabei relevante Kapitalien erwerben, um sich auf möglichst zentralen Positionen zu platzieren und die damit verbundene Kulturation zu erreichen zu können.
In der Praxis wird der Integrationsverlauf jedoch von vielen Variablen beeinflusst.
So spielt die jeweilige Familien- und Migrationsbiographie der Individuen und damit verbunden die Bleibeabsicht, Bildung und Einreisealter eine große Rolle für die Integrationsbereitschaft und -fähigkeit.
Das gleiche gilt für die Bedingungen im Herkunfts- und Aufnahmeland.
Die demographische, ökonomische und politische Situation dort beeinflusst die Integrationschancen ebenso, wie hier die Situation auf dem Arbeitsmarkt, die soziale und kulturelle Distanz oder die Ausländerpolitik.
3.2 „Investition“ & “Kapitalerwerb“
Wichtig ist immer auch das Engagement des Einzelnen und der Mechanismus der Investition (vgl. Esser, 2006, S. 39 - 52).
Man kann davon ausgehen, dass im Prinzip alle Menschen ihr psychisches Wohlbefinden erhalten und soziale Wertschätzung erlangen wollen.
Dies ist jedoch nur möglich, wenn von der Gesellschaft vorgegebene Ziele verfolgt werden.
Nur so ist es möglich genau die Ressourcen zu erlangen, die in dieser Gesellschaft mit Wohlbefinden und Wertschätzung verbunden sind.
Jedoch haben nicht alle Individuen die Mittel zur Verfügung, die zur Umsetzung der Ziele in die Praxis notwendig sind.
Es entsteht also eine Situation, in der die Akteure nun resignieren und einen Status Quo hinnehmen oder den Versuch unternehmen an neue, zusätzliche Mittel heranzukommen, um früher oder später doch noch an vorher nicht erreichbaren Ressourcen partizipieren zu können.
Gerade Migranten sind sehr häufig mit dem Problem konfrontiert, dass aus dem Herkunftsland mitgebrachte Mittel und Fähigkeiten für das Aufnahmeland nur von geringer oder gar keiner Bedeutung sind.
Sie müssen also besonders große Investitionsbereitschaft und Motivation mitbringen, um den gewünschten Status zu erreichen.
Dies gelingt, wie der Blick auf die Lebenslagen in Kapitel 2 zeigte, aber nur schwer.
Von zentraler Bedeutung für einen erfolgreichen Integrationsverlauf ist die Sprache.
Esser schreibt ihr 3 Funktionen zu (vgl. Esser, 2006, S.52 - 59):
- Zum einen ist sie eine Ressource in die man investieren kann und über die andere Ressourcen erschlossen werden können.
- Zudem ist sie ein Symbol, dass Gefühle ausdrückt, Aufforderungen transportiert und Situationen definiert.
- Schließlich ist sie Medium der Kommunikation und stellt Verständigung sicher.
Der Erwerb der Sprache des Aufnahmelandes ist Grundvoraussetzung für jede weitere Sozialintegration von Migranten in die Aufnahmegesellschaft.
Sprache ist Voraussetzung für Bildungserfolg, berufliche Positionierung, Aufnahme von Kontakten und Beziehungen, also für alle Bereiche der sozialen Integration.
3.3 Assimilation
Neben dem Begriff der (Sozial-)Integration taucht in der Diskussion interethnischer Beziehungen auch der Begriff der Assimilation auf (Esser, 2001).
Dieser beschreibt die Vorstellung einer Angleichung der ethnischen Gruppen im Verlaufe mehrerer Generationen.
Das Assimilationskonzept geht von einer ethnisch homogenen Gesellschaft als Ziel aus, in der es zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppen keine Unterschiede in der Verteilung gewisser Merkmale gibt.
Assimilation ist ein spezieller Fall der Sozialintegration (vgl. Esser, 2001,
S.17 - 26) .
Sozialintegration lässt sich also nicht nur nach den 4 Dimensionen der Kulturation, Platzierung, Interaktion und Identifikation gliedern, sondern kann auch auf unterschiedliche gesellschaftliche Systeme bezogen werden.
Bei Migranten kann sie zusätzlich noch auf das Herkunftsland, das Aufnahmeland und die ethnische Gemeinde im Aufnahmeland bezogen werden.
Untersucht man die soziale (Des-)Integration von Migranten in ihre Herkunftsgesellschaft/ethnische Gemeinde einerseits und die Aufnahmegesellschaft andererseits, lassen sich 4 verschiedene Typen der Sozialintegration von Migranten unterscheiden:
- Mehrfachintegration als Sozialintegration in beide Gesellschaftstypen.
- Segmentation als Sozialintegration in ethnische Gemeinde und Exklusion aus der Aufnahmegesellschaft.
- Marginalität als Ausschluss aus allen Bereichen.
- Assimilation als Sozialintegration in Aufnahmegesellschaft unter gleichzeitiger Aufgabe der ethnischen Bezüge/Herkunft.
Gelungene und vollwertige Sozialintegration in die Aufnahmegesellschaft ist eigentlich nur in Form der Assimilation möglich.
Analog zu den 4 Dimensionen der Sozialintegration erfolgt Assimilation als:
- kulturelle Assimilation = die Angleichung im
Wissen und den Fähigkeiten.
- strukturelle Assimilation = Besetzung von Positionen in den verschiedenen Funktionssystemen wie bsp. Bildungssystem, Arbeitsmarkt oder die Wahrnehmung bestimmter Rechte.
- soziale Assimilation = Aufnahme von interethnischen Kontakten und Beziehungen mit Einheimischen.
- identifikative Assimilation = gefühlsmäßige Identifikation mit der Aufnahmegesellschaft.
Diese Dimensionen hängen ebenfalls kausal miteinander zusammen und bedingen sich gegenseitig.
Assimilation meint immer die Angleichung von Gruppen in Bezug auf bestimmte Eigenschaften, jedoch nicht die komplette Gleichheit aller Individuen.
Es geht vor allem darum, dass es keine systematischen Unterschiede in der Verteilung von Ressourcen in einer Gesellschaft gibt.
Zusammenfassend beschreibt die Theorie Essers Integration als einen Prozess, der auf verschiedenen Ebenen mehr oder weniger zeitgleich abläuft.
Migranten müssen sich in den verschiedenen Dimensionen der Sozialintegration initiativ engagieren und einbringen, um gesellschaftlich relevantes Kapital (Sprache, Bildung, informelle Kontakte, etc.) zu erwerben und somit ihren Status in der neuen Heimat zu verbessern.
Wichtig für gelingende Integration ist die Bereitschaft der Migranten in ihr neues Leben zu investieren. Das Hauptaugenmerk liegt dabei unter anderem auf der Sprache.
Es liegt jedoch, wie nachfolgendes Kapitel zeigt, nicht alleine bei den Migranten, ob Integration in die Aufnahmegsellschaft gelingt.
4. Gesellschaftliche Integrationsbarrieren
Von nicht minder großer Bedeutung für den Integrationsprozess ist die Frage, wie die Aufnahmegesellschaft auf die neuen Mitbürger reagiert.
Migranten werden von den Einheimischen zunächst als Ausländer wahrgenommen (vgl. SPI, 2002, S.11 -27).
Sie werden als Konkurrenz (Wohnungs- und Arbeitsmarkt), eventuell sogar als Gefährdung für den eigenen Status betrachtet.
Die Distanz wird zusätzlich noch dadurch verstärkt, dass Ausländern/Migranten nicht dieselben Rechte und Solidarität zukommen wie Einheimischen.
Aufgrund der Heterogenität der Migrantengruppen, sowie der Unterschiedlichkeit der Migrationsursachen und -folgen ist eigentlich eine fachlich gesteuerte Migrationspolitik notwendig, die zwischen den politischen Interessen (bsp. Arbeitsmarkt), Menschen- und Grundrechten, sowie gesellschaftlichen Prozessen vermitteln sollte.
Tatsächlich aber wird das Thema Migration immer wieder ideologisch aufgeladen.
Migranten werden zu Sündenböcken gemacht und für politische Ziele missbraucht. Statt der beschriebenen Migrationspolitik wird in Deutschland vornehmlich Ausländerpolitik betrieben.
Dies jedoch nicht für die Zugewanderten, sondern vor allem für die Einheimischen (= Wähler).
Denen kann man entweder seine Liberalität gegenüber zugewanderten Mitbürgern demonstrieren (Minderheitsposition), indem man sich zum Verfechter einer „Multi- Kulti- Gesellschaft“ macht oder sich ihre Loyalität sichert (Mehrheitsposition) durch Ungleichbehandlung und Forderungen nach Verschärfungen des Ausländer- und Zuwanderungsrechts.
Migranten sind also nicht nur „ökonomisches Gut“, sondern vor allem auch „politisches Gut“.
Gerade in Zeiten in denen nationalstaatliche Kräfte schwinden und ökonomische Politik an Bedeutung verliert, werden Politikfelder interessant, in denen man sich durch symbolische Handlungen Loyalitätszuwächse sichern kann.
Die Forderung nach Pflichtsprachkursen ist Ergebnis einer solchen Politik, welche die Schuld an Integrationsproblemen alleine den Migranten zuschreibt und die deutsche Bevölkerung von jeder Integrationsleistung ausnimmt.
Ganz egal, ob man den Sachverhalt der Einwanderungs- und Multikulturellen Gesellschaft akzeptiert oder nicht, Fakt ist die andauernde und dauerhafte Anwesenheit einer zugewanderten Bevölkerungsgruppe, die etwa 8% der Gesamtbevölkerung ausmacht (vgl. bamf, 2007, Kap. 2 und 3).
Der Integrationsprozess ist ein sehr ungleichmäßiger Vorgang.
Oftmals ist die kulturelle und strukturelle Integration/Assimilation deutlich weiter fortgeschritten als die sozialen und identifikativen Eingliederungsprozesse.
Dies lässt sich am Beispiel der Gastarbeiter gut verdeutlichen:
Solange man davon ausgehen konnte, dass diese bald wieder in die Heimat zurückkehren würden, waren sie zwar fremd, hatten aber einen eher zu vernachlässigenden Status als vorübergehende Gäste.
Als sich der Status vom Gast zum dauerhaft Anwesenden änderte, wird plötzlich die im Alltagsleben kaum noch wahrnehmbare Verschiedenheit als Fremdheit thematisiert.
Gerade die Angehörigen der zweiten und dritten Generation haben damit große Probleme.
Zwar sind sie sozialisiert wie ihre deutschen Altersgenossen, doch werden sie durch diskriminierende Praktiken des Alltags wie Fremde behandelt und zu Fremden gemacht.
[...]
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2007
- ISBN (eBook)
- 9783836610551
- DOI
- 10.3239/9783836610551
- Dateigröße
- 441 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Hochschule Ludwigshafen am Rhein – Soziale Arbeit, Migration
- Erscheinungsdatum
- 2008 (März)
- Note
- 2,0
- Schlagworte
- migranten integration sozialpädagogik sportverein sozialarbeit
- Produktsicherheit
- Diplom.de