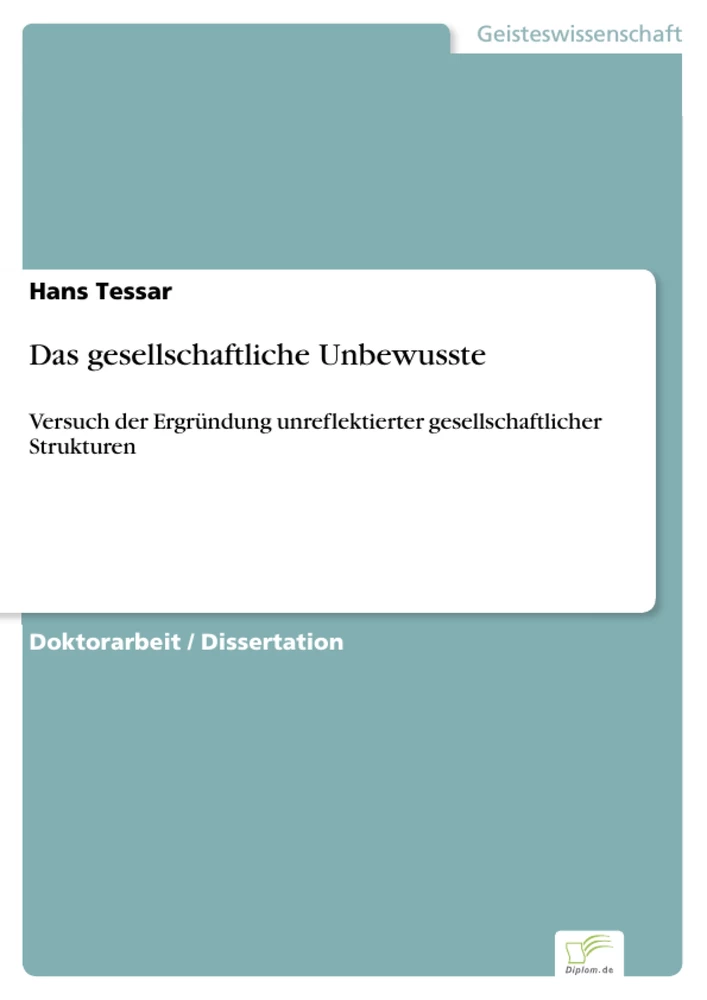Das gesellschaftliche Unbewusste
Versuch der Ergründung unreflektierter gesellschaftlicher Strukturen
Zusammenfassung
Strenggenommen kann so etwas wie ein gesellschaftliches Unbewußtes nicht empirisch wahrgenommen werden. Vom empirischen Standpunkt aus gesehen gibt es so etwas wie ein gesellschaftliches Unbewußtes daher nicht, und dem ist wohl strenggenommen auch beizupflichten. Dies ändert aber nichts daran, daß das menschliche Zusammenleben (unter anderem) durch Sitte und Gesetz geordnet ist. Die meisten der gesellschaftlichen Regeln waren jedenfalls in früheren Zeiten nicht schriftlich fixiert, sodaß zumindest zu dieser Zeit das zwischenmenschliche Zusammenleben in erster Linie durch die Sitte geregelt war, wobei diese grundsätzlich nicht sprachlich-kognitiv tradiert worden war.
Ausgehend von dieser Beobachtung kann somit behauptet werden, daß jedenfalls dieser gewohnheitsrechtliche Verhaltenskodex (=Sitte) sich dadurch auszeichnete, das menschliche Zusammenleben zu strukturieren, obwohl sein Inhalt nur sehr rudimentär bekannt war. Meines Erachtens ist diese unbestreitbare Tatsache die Einfallspforte für die Ergründung des Phänomens des gesellschaftlichen Unbewußten. Wenn man nämlich, ausgehend von dieser Feststellung, die Sitte näher betrachtet, gelangt man notgedrungen zur Erkenntnis, daß die Sitte nicht das einzige Phänomen ist, das unabhängig vom individuellen menschlichen Willen die menschliche Verfaßtheit beeinflußt und bestimmt.
So kann z.B. die Sitte immer erst aus ihrer Einbettung in die gesellschaftlichen Strukturen, Institutionen und Wechselprozesse her verstanden bzw. ergründet werden. Die Sitte erhellt sich sohin erst dann, wenn man ihre Funktion und Bedeutung innerhalb der konkreten gesellschaftlichen Wirklichkeit erfaßt hat. Wenn man sohin versucht, die Sitten in einer Gesellschaft zu analysieren, stößt man unweigerlich auf weitere Phänomene, welche einen maßgebenden Einfluß auf die Willensentscheidungen und Handlungen des Einzelnen haben, wenngleich sie vom jeweiligen Individuum grundsätzlich weder reflektiert noch hinsichtlich ihres Einflusses auf die subjektive Lebenssituation wahrgenommen werden.
All diese Mechanismen der Gestaltung der menschlichen Wirklichkeit haben ein Merkmal jedenfalls gemeinsam, nämlich daß sie nur postuliert, nie aber sinnlich wahrgenommen werden können, sodaß wieder der Schluß recht nahe liegt, daß sie möglicherweise gar nicht wirklich existieren, sondern nur rein willkürliche Theorien eines Beobachters sind, mit denen dieser bei mehreren Personen bzw. Kulturen beobachtbare […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
VORBEMERKUNGEN:
Strenggenommen kann so etwas wie ein "gesellschaftliches Unbewußtes" nicht empirisch wahrgenommen werden. Vom empirischen Standpunkt aus gesehen gibt es so etwas wie ein "gesellschaftliches Unbewußtes" daher nicht, und dem ist wohl strenggenommen auch beizupflichten. Dies ändert aber nichts daran, daß das menschliche Zusammenleben (unter anderem) durch Sitte und Gesetz geordnet ist. Die meisten der gesellschaftlichen Regeln waren jedenfalls in früheren Zeiten nicht schriftlich fixiert, sodaß zumindest zu dieser Zeit das zwischenmenschliche Zusammenleben in erster Linie durch die Sitte geregelt war, wobei diese grundsätzlich nicht sprachlich-kognitiv tradiert worden war.
Ausgehend von dieser Beobachtung kann somit behauptet werden, daß jedenfalls dieser "gewohnheitsrechtliche" Verhaltenskodex (=Sitte) sich dadurch auszeichnete, das menschliche Zusammenleben zu strukturieren, obwohl sein Inhalt nur sehr rudimentär bekannt war. Meines Erachtens ist diese unbestreitbare Tatsache die Einfallspforte für die Ergründung des Phänomens des gesellschaftlichen Unbewußten. Wenn man nämlich, ausgehend von dieser Feststellung, die Sitte näher betrachtet, gelangt man notgedrungen zur Erkenntnis, daß die Sitte nicht das einzige Phänomen ist, das unabhängig vom individuellen menschlichen Willen die menschliche Verfaßtheit beeinflußt und bestimmt. So kann z.B. die Sitte immer erst aus ihrer Einbettung in die gesellschaftlichen Strukturen, Institutionen und Wechselprozesse her verstanden bzw. ergründet werden. Die Sitte erhellt sich sohin erst dann, wenn man ihre Funktion und Bedeutung innerhalb der konkreten gesellschaftlichen Wirklichkeit erfaßt hat. Wenn man sohin versucht, die Sitten in einer Gesellschaft zu analysieren, stößt man unweigerlich auf weitere Phänomene, welche einen maßgebenden Einfluß auf die "Willensentscheidungen" und Handlungen des Einzelnen haben, wenngleich sie vom jeweiligen Individuum grundsätzlich weder reflektiert noch hinsichtlich ihres Einflusses auf die subjektive Lebenssituation wahrgenommen werden.
All diese "Mechanismen" der Gestaltung der menschlichen Wirklichkeit haben ein Merkmal jedenfalls gemeinsam, nämlich daß sie nur postuliert, nie aber sinnlich wahrgenommen werden können, sodaß wieder der Schluß recht nahe liegt, daß sie möglicherweise gar nicht wirklich existieren, sondern nur rein willkürliche Theorien eines Beobachters sind, mit denen dieser bei mehreren Personen bzw. Kulturen beobachtbare menschliche Verhaltensmuster in ein System zwängt bzw. zu zwängen versucht.
Abweichend vom "gewöhnlichen" Zugang zum Unbewußten erscheinen mir daher die Phänomene, die auf eine unbewußte Gesetzmäßigkeit hinzuweisen scheinen, viel interessanter als die Gesetze, die postuliert werden, um diese Phänomene zu erklären. Als logische Konsequenz dieses Ausgangspunktes scheint es sodann aber auch müßig zu sein, die richtige Theorie zu finden; denn letztlich ist jede Theorie nur ein "Hirngespinst", welche solange nicht als solches erkannt wird, solange sie noch irgendeine sinnvolle Funktion erfüllt. Folglich will ich auch versuchen, einerseits alle von mir gefundenen auf unbewußte gesellschaftliche Strukturen verweisende Phänomene aufzuzeigen und andererseits möglichst viele Theorien, die derartige Phänomene erklären wollen, darzulegen, im Bewußtsein, daß jede Theorie für sich gesehen eine wahre Aussage hat, auch wenn einander die Theorien mitunter widersprechen.
Da leider die meisten Autoren der westlichen Wissenschaftstradition entsprechen, veröffentlichen sie in ihren Publikationen zumeist - entsprechend dieser Tradition - bloß Antworten (bzw. Theorien) bzw. beschäftigen sich fast ausschließlich mit solchen. Die diesen Antworten (bzw. Theorien) zugrundeliegenden, der Hinterfragung würdigen, sinnlichen Wahrnehmungen werden höchstens gestreift und oft erst gar nicht bedacht. (Spätestens dann hebt sich übrigens eine Theorie von der Realität endgültig ab.) Folglich bleibt mir nichts anderes übrig, als mit den tradierten Ergebnissen (=Theorien) zu beginnen, um mich dann langsam zu den (auch von mir letzlich bloß postulierbaren) "Anfängen" vorarbeiten zu können. Ich lege also zuallererst die mir für diese Themenstellung dienlichen Theorien dar, und werde dann versuchen, die diesen Theorien zugrundeliegenden sinnlichen Wahrnehmungen zu ergründen, die vermittels der dargelegten Theorien (meines Erachtens) einer Hinterfragung für würdig gefunden wurden. Abschließend will auch ich eine Theorie (bzw. ein Hirngespinst) postulieren, wohl wissend, daß auch meine Theorie nur den Anspruch erheben kann, den Blick für bestimmte gesellschaftliche Vorgänge zu schärfen.
Wie jede Theorie (bzw. jedes Hirngespinst) soll auch die vorliegende Arbeit nur einen Beitrag leisten, um Menschen aufzumuntern bzw. eventuell sogar anzuleiten, Zusammenhänge zwischen sinnlich wahrnehmbaren Phänomenen herstellen, welche sie sonst nicht hergestellt hätten. Falls nun aber jemand sogar soweit geht, meine Sichtweise der Zusammenhänge zwischen den Phänomenen zu seiner eigenen zu machen, so hoffe ich, daß dann auch seitens dieser Person diese Gedankengänge auch mit ihrer je konkreten Lebenssituation und Gesellschaftsverfaßtheit in Verbindung gebracht werden und dieser "Philosoph" einen Beitrag zur Bekämpfung der infolge dieser Analyse bewußt gewordenen Mißstände leistet.
Da es, meines Erachtens, nur solange eine Theorie gibt, als der sie begründende Mißstand besteht bzw. als diese zum Machterhalt der gesellschaftlich Mächtigen dienlich ist, hoffe ich naheliegenderweise, daß auch die in dieser Arbeit dargelegten Theorien samt den diesen zugrundeliegenden Problemstellungen einmal überflüssig werden; also als das bezeichnet werden, was sie im Grunde ja immer schon sind bzw. waren, nämlich als Hirngespinste.
Erster Abschnitt: Der Begriff des "Unbewussten":
A. Der Begriff des "Unbewussten" in der Philosophie:
1. Spinoza:
Baruch Spinoza postuliert eine vom Bewußtsein unabhängige eigenständige Instanz der unbewußten Natur. Da das Bewußtsein in einem Gegensatz zur Natur zu stehen vermag, treten die Bedürfnisse und Begehren zumeist verschleiert ins Bewußtsein. Das menschliche Denken neigt nach Spinoza zur Verkennung seiner selbst, sodaß das Ziel allen Strebens die Erkenntnis der wahren Natur sein sollte. Ähnlich wie Freud meint daher schon Spinoza, daß die unklaren, Leiden verursachenden Affekte bzw. Begierden dann kein Leid mehr schaffen, wenn man eine klare Idee von ihnen hat.[1]
Da aber Spinoza den menschlichen Willen und Geist in die den Naturgesetzen unterworfene Natur einbindet, unterliegt auch der menschliche Wille den keinen Zufall zulassenden Naturgesetzen. Dies hat zur logischen Konsequenz, daß die menschliche Willensfreiheit negiert wird.
2. Leibniz:
Die erste bedeutsame Darlegung einer Theorie des Unbewußten, die sich auch für die später auftauchenden Versuche der Klärung dieses umstrittenen Begriffes als wegbereitend erweist, stammt von Gottfried Wilhelm Leibniz. Leibniz unterscheidet im Gebiet der psychischen Zustände die Bereiche der Perzeptionen und der Aperzeptionen. Das sich auf den inneren Zustand richtende apperzeptiv-rationale Wachbewußtsein verdeckt nach Leibniz das perzeptiv-emotionale Bewußtsein. Bewußt ist lediglich das apperzeptiv Unterscheidbare. Die "kleinen Perzeptionen", die nicht stark genug sind, um unsere Aufmerksamkeit zu erregen, bestimmen ein "perzeptiv Unbewußtes". So schreibt Leibniz, "daß es in jedem Augenblicke in unserem Inneren eine unendliche Menge von Perceptionen gibt, die aber nicht von Aperception und Reflexion begleitet sind, sondern lediglich Veränderungen in der Seele selbst darstellen, deren wir uns nicht bewußt werden, weil diese Eindrücke entweder zu schwach und zu zahlreich oder zu gleichförmig sind, so daß sie im einzelnen keine hinreichenden Unterscheidungsmerkmale aufweisen. Nichtsdestoweniger können sie im Verein mit anderen ihre Wirkung tun und sich in der Gesamtheit des Eindrucks wenigstens in verworrener Weise geltend machen."[2]
Leibniz zufolge entstehen merkliche Perzeptionen nach einer Stufenleiter von Klarheits- bzw. Dunkelheitsgraden aus solchen "petit perceptions", die zu schwach sind, um bemerkt zu werden. Die Summe der unendlichen Anzahl dieser "kleinen Wahrnehmungen" und der Gesamteindruck der sich aus Reizen der Sinnesorgane und infolge den körperlichen Triebe, Strebungen und Neigungen zusammensetzt, stellen die menschliche Identität her. Identität ergibt sich also aus einer Vielzahl zusammengesetzter Eindrücke. "So gibt es unmerkliche Neigungen, deren man nicht gewahr wird; es gibt merkliche, deren Dasein und deren Gegenstand man kennt, deren Bildung uns aber nicht zu Bewußtsein kommt, und dies sind die verworrenen Neigungen, die wir dem Körper zuschreiben, obgleich ihnen stets etwas Geistiges entspricht; endlich gibt es deutliche Neigungen, die aus der Vernunft stammen und deren Stärke und Bildung uns zum Bewußtsein kommt..."[3]
Leibniz bestimmt also den Körper als eine Art Bild der Seele, sodaß letztlich Körper und Seele eine Einheit bilden. Der Körper ist sohin gleichsam die Schrift der Seele, die von den feinen und subtilen Einflüssen der Seele bestimmt wird.
3. Carus:
Der vitale Grund und die irrationalen Bewegungen der selbstbewußten Seele bleiben nach Carus das ganze Leben hindurch größtenteils unbewußt. Er schreibt daher, daß "der Schlüssel der Erkenntnis vom Wesen des bewußten Seelenlebens in der Region des Unbewußten (liegt)."[4]
4. Schopenhauer:
Arthur Schopenhauer trennt den empirisch individuellen Willen vom Bewußtsein. Dieser Wille ist nun eine unbewußt wirkende Kraft, der die Vorstellungen erst ermöglicht und der sich vermittels dieser Vorstellungen mit der Welt identifiziert. Der Wille steht folglich in einem Gegensatz zur erkennenden Vorstellung und ist ursprünglicher als das Bewußtsein.
Der Wille selbst wird wieder nur bedingt individuell gedacht; wird doch der einzelne Wille in einen untrennbaren Konnex zu den übrigen Willen gebracht.[5]
5. Nietsche:
Friedrich Nietzsche spricht vom Einfluß unbewußter Motive und unsichtbarer Qualitäten auf das menschliche Handeln und Denken. Dabei unterscheidet er die wirklichen Motive, die den Handlungen zugrunde liegen, von den bloß geglaubten oder eingebildeten. Die wirklichen Motive sind die unbewußten, die auch den größten Teil unseres geistigen Wirkens bestimmen.[6]
6. Reininger:
Für Robert Reininger gibt es kein Sein, das nicht zugleich bewußtes Sein wäre. Insofern ist ein "Unbewußtes" nicht möglich. Das Vergessene ist daher nicht unbewußt, sondern vielmehr unbestimmt bewußt.[7]
7. Sartre:
Jean Paul Sartre verwirft Freud's Postulat des Unbewußten.[8] Seines Erachtens ist es durch einen Dritten nicht möglich, den Menschen in seinen inneren Zusammenhängen zu erklären.
Vielmehr gilt es, vermittels der von Sartre entworfenen existentiellen Psychoanalyse, die Wahl, daher eigentlich den je konkreten Lebensentwurf des Menschen (Patienten) zu erfassen.[9] "Und eben weil es das Ziel der Untersuchung sein muß, eine Wahl und nicht einen Zustand zu entdecken, muß diese Untersuchung bei jeder Gelegenheit daran denken, daß ihr Gegenstand nicht eine in der Dunkelheit des Unbewußten verborgene Gegebenheit ist, sondern eine freie und bewußte Bestimmung - die nicht einmal im Bewußtsein wohnt, sondern mit diesem Bewußtsein selbst eins ist."[10]
B. Darlegung der Verwendung des Begriffes des "Unbewussten" in den wichtigsten Psycho-therapeutischen Schulen:
I. Psychoanalyse:
1. Freud:
Freud behandelt das Phänomen des "Unbewußten" in zwei voneinander abzugrenzenden Kontexten. Ersterer ist gleichsam ein erkenntnistheoretischer bzw. phänomenologischer, während letzterer eher einen metaphysischen Blickwinkel beleuchtet.
Ablehnend zum Freudschen Zugang zum Unbewußten steht Hubert Rohracher, der meint, daß alle (bewußten wie unbewußten) Bewußtseinsinhalte sich auf nervöse Erregungsprozesse im Gehirn zurückführen lassen. "Man müßte dann sagen: unangenehme Erlebnisse erzeugen in bestimmten Ganglienzellen molekulare Strukturänderungen, die sich in Platzangst oder Ansteckungsfurcht auswirken können. Man könnte also eine sachliche und begriffliche Verbesserung erreichen, wenn man das Unbewußte nicht etwas Psychisches, sondern etwas Körperliches sein läßt."[11]
a. der deskriptive Begriff des Unbewussten:
Wenn Freud das Adjektiv "unbewußt" gebraucht, umschreibt er "die Gesamtheit der im aktuellen Bewußtseinsfeld nicht gegenwärtigen Inhalte"[12]. In diesen Begriff "unbewußt" fallen alle Inhalte, die in die, in der ersten Topik dargelegten, Bereiche des Vorbewußten und Unbewußten fallen. Deskriptiv ist dieser Begriff des Unbewußten deshalb, da in diesem nicht zwischen den Inhalten der Systeme "Vorbewußt" und "Unbewußt" unterschieden wird.[13]
b. der systematische Begriff des Unbewussten in der ersten und zweiten Topik:
I. Grundlegendes:
"Im weitesten Sinne kann man das Unbewußte als einen besonderen "seelischen Ort" annehmen, den man sich nicht wie ein zweites Bewußtsein, sondern als ein System von Inhalten, Mechanismen und vielleicht mit einer spezifischen "Energie" vorstellen muß."[14] Gemäß dieser systematischen Konzeption des Unbewußten weist das Unbewußte eigene Regeln, wie z.B. die Verdichtung oder die Verschiebung, und eigene Prinzipien, wie z.B. den Primärvorgang, auf.[15]
Das Unbewußte zeichnet sich auch durch eine bemerkenswerte Ungeschichtlichkeit aus, was dazu führt, daß es nicht an den eigenen Tod glaubt. Außerdem ist es betont solipsistisch, sodaß es gegenüber Mitmenschen ambivalent ist.[16]
Der Auslöser für die Schaffung der systematischen bzw. topischen Konzeption war die Wahrnehmung Freuds, daß "vergessene" Bewußtseinsinhalte weiterhin in der Psyche wirksam bleiben. Demnach beinhaltet das Unbewußte Vorstellungen, die aus irgendwelchen Gründen einmal verdrängt, daher aus dem Bewußtsein entfernt worden sind. Eine derartige Verdrängung aus dem Bewußtsein erfolgt vor allem dann, wenn die Bewußthaltung bzw. solange die Bewußtwerdung Gefahren für das Ich auslöst bzw. auslösen würde.[17]
Eine Verdrängung eines Bewußtseinsinhaltes geschieht demnach dann, wenn ein Mensch durch eine Triebregung in einen Konflikt geraten ist bzw. geraten würde: Zwar verspricht die Befriedigung des Triebes einerseits Lust, aber andererseits könnte sie Unlust nach sich ziehen, nämlich dann, wenn sie zu moralischen oder ethischen Forderungen im Widerspruch steht.
Um diesen Konflikt abzuwehren, kann der Mensch die verbotene Triebregung (bzw. die den Trieb repräsentierenden Bilder, Gedanken und Vorstellungen) aus dem bewußten Gedächtnis auslöschen, oder eben: verdrängen. Das Verdrängte ist jedoch nur aus dem dem Bewußtsein zugänglichen Teil des Gedächtnisses ausgelöscht; wirklich beseitigt ist es keineswegs, sondern es führt ein Eigenleben an einem dem Bewußtsein unzugänglichen Ort: Dieser imaginäre Ort ist das Unbewußte.
Diese verdrängten Inhalte wirken nun aber weiterhin, nur eben verdeckt. Sie sind die Ursachen psychischer Störungen, wie z.B. der Neurosen. Diese verdrängten Bewußtseinsinhalte müssen aber nicht immer unbewußt bleiben, sondern können unter bestimmten Bedingungen wieder ins Bewußtsein treten. Freud geht sogar davon aus, daß diese mit Triebenergie besetzten verdrängten Inhalte von sich aus versuchen ins Bewußtsein zu gelangen, jedoch durch den Zensor des Vorbewußten zurückgehalten bzw. verzerrt werden. Ziel der Therapie muß es darum sein, unbewußte Vorgänge in bewußte zu übersetzen. Durch diese Bewußtmachung "(verliert) die unbewußte Vorstellung die dem alten System angehörenden und eigentümlichen Merkmale und nimmt durch diese funktionale Umwandlung die Eigenschaften des neuen Systems an."[18] Durch die Bewußtmachung werden folglich die Erregungen der Triebe gebändigt und gebunden. Was liegt sohin näher, als zu versuchen, unbewußte Inhalte ins Bewußtsein zu heben. Dieser Aufgabe dient die Freud'sche Psychoanalyse.
Charakteristisch für die beiden Freud'schen Topiken ist, daß das Unbewußte dadurch charakterisiert werden kann, daß es nicht unmittelbar zugänglich ist. Es ist darum "vergeblich, das Unbewußte von der Ebene des Bewußtseins direkt erreichen zu wollen."[19]
Das Unbewußte ist nur über einige "Ausfallspforten" erreichbar. Freud zählt darunter den Traum, das Symptom, den Witz und die Fehlleistung.[20] Über diese Phänomene kann das Verdrängte erschlossen werden. Diese Sichtweise des Zuganges zum Verdrängten wird in der Literatur als die dynamische Auffassung des Unbewußten umschrieben.
Für Freud liegt nun die Aufgabe der Psychotherapie darin, möglichst viel Unbewußtes durch die Analyse bewußt und damit unschädlich zu machen. Den therapeutischen Erfolg erklärt Freud damit, daß die leib-seelische Gesundheit des Menschen nur dann möglich ist, wenn das Bewußtsein sich nicht in trügerischer Autonomie abkapselt, sondern sich immer wieder auf seinen Ursprung, auf das Unbewußte, zurückbezieht. Wenn dies aber nicht gelingt, entwickelt das Unbewußte eine vom Ich-Bewußtsein nicht bemerkte, schädliche Eigendynamik, welcher wieder nur durch Bewußtmachung Einhalt geboten werden kann.
Die Bewußtmachung des Unbewußten erfolgt im Rahmen der Bearbeitung der Widerstände des Patienten. Widerstand wieder kann als heftiges Opponieren gegen vom Therapeuten dem Patienten gegenüber geäußerten Charakterzuschreibungen verstanden werden. Die in der Therapie dem Patienten zugeschriebenen Charaktereigenschaften werden vom Therapeuten aus den seitens des Patienten frei geäußerten Assoziationen im Rahmen der Therapie abgeleitet. Eine besondere Bedeutung kommt diesbezüglich den Assoziationen zu, die der Patient anläßlich der Reflexion eines Traumes äußert; dies deshalb, da im Rahmen des Traumes in einem hohen Maße verdrängte Bewußtseinsinhalte ins Bewußtsein gelangen.[21]
II. Darlegung:
(1) der systematische Begriff des Unbewußten in der ersten Topik:
In der ersten Topik unterscheidet Freud drei Instanzen, nämlich des Bewußtsein, das System Vorbewußt und das System Unbewußt.[22]
Das Bewußtsein beinhaltet das gesamte jeweils präsente Wissen. Zwischen ihm und dem Unbewußten liegt das Vorbewußte, das im wesentlichen die Aufgabe hat, das aktive Gedächtnis zu beherbergen und das Bewußtsein vor den aufgrund ihrer Gefährlichkeit für das Bewußtsein verdrängten Triebregungen des Unbewußten zu schützen. Dieser Schutz wird durch den Zensor, der an der Grenze zwischen Vorbewußtem und Unbewußtem anzusiedeln ist, gewährleistet.
Das System Unbewußt besteht "aus den Triebrepräsentanzen und dem Verdrängten"[23] und wird vom Lustprinzip dominiert.[24] Es unterscheidet sich vom Bewußtsein und Vorbewußten durch besondere Eigenschaften und spezielle Merkmale. "Es gibt in diesem System keine Negation, keine Zweifel, keine Grade von Sicherheit."[25] Das System Unbewußt hat "keinen Zugang zum Bewußtsein, außer durch das Vorbewußte."[26] Dieser Zugang ist aber durch den Zensor, der nur bestimmte Bewußtseinsinhalte ins Vorbewußte passieren läßt, versperrt. "Die Tätigkeit der Zensur wird Verdrängung genannt (...)."[27] Weitere Merkmale des Systems Unbewußt sind, daß dessen Inhalte nicht bewußtseinsfähig sind und daß die Erinnerungsspuren nicht an Wortvorstellungen gebunden sind.[28]
Interessent ist weiters, daß Freud das System Unbewußt vom System Vorbewußt sogar nach einem sprachtheoretischen Gesichtspunkt differenziert. Freud postuliert nämlich, "daß unsere Fähigkeit der Bildung von Vorstellungen über ein Objekt zwei verschiedene Komponenten aufweist, die Sachvorstellungen, welche als Erinnerungsspuren der Sache aufgebaut sind, und die Wortvorstellungen, die sich aus Erinnerungsspuren des Sehens und des Hörens von Worten aufbauen. Freud nimmt weiters an, daß die Sachvorstellungen, die zu den unbewußten Vorstellungen gehören, erst dann bewußt werden können, wenn sie mit Resten der Wortwahrnehmung verknüpft werden, und daß diese Wortvorstellungen zum System Vorbewußt gehören und nicht zum System Unbewußt."[29] Bewußt wird also ein Bewußtseinsinhalt, indem an eine Sachvorstellung eine Wortvorstellung geknüpft wird. Erst die Sprachsymbolik ermöglicht also erst das bewußte und realitätsbezogene Denken und Handeln.
(2) der systematische Begriff des Unbewußten in der zweiten Topik:
In der zweiten Topik differenziert Freud den psychischen Apparat wieder in drei Bereiche, dieses Mal aber in das Über-Ich, das Ich und das Es; wobei das Ich und das Es im wesentlichen den Bereich decken, den in der ersten Topik das Bewußtsein, das System Vorbewußt und das System Unbewußt charakterisierten:
"Wir sondern jetzt in unserem Seelenleben, das wir als einen aus mehreren Instanzen (...) zusammengesetzten Apparat auffassen, eine Region, die wir das eigentliche Ich heißen, von einer anderen, die wir das Es nennen. Das Es ist das ältere, das Ich hat sich aus ihm entwickelt. Im Es greifen unsere ursprünglichen Triebe an, alle Vorgänge im Es verlaufen unbewußt. Das Ich deckt sich, wie wir bereits erwähnt haben, mit dem Vorbewußten, es enthält Anteile, die normalerweise unbewußt bleiben. Für die psychischen Vorgänge im Es gelten ganz andere Gesetze des Ablaufs und der gegenseitigen Beeinflussung, als die im Ich herrschen."[30]
Die in der ersten Topik dargelegten Merkmale des Systems Unbewußt schreibt Freud also nun dem Es zu. Gleichzeitig ordnet er aber auch dem Ich und dem Über-Ich unbewußte und vorbewußte Anteile zu.[31]
Wolfgang Schmidbauer analysiert dies folgendermaßen: "Denn tatsächlich hat ja das Verdrängte eine starke Tendenz, zum Bewußtsein durchzudringen und sich auf diesem Weg ins Verhalten hinein zu entladen. Der Widerstand muß eine Äußerung des Ich sein, beziehungsweise des Über-Ich (...). Das heißt, daß sehr wichtige Teile des Ich bzw. des Über-Ich unbewußt sind. (...) Das Unbewußte der ersten Theorie war mit dem Verdrängten weitgehend identisch. Im Gegensatz dazu wird in "Das Ich und das Es" ein Bild der Abwehroperationen entworfen, wonach weite Teile der Ich-Funktionen ebenfalls unbewußt sein müssen. Das Es in dieser Theorie ist nun -topisch gesehen - kleiner als das unbewußt Psychische bzw. das frühere System Unbewußt. Es enthält nicht die sehr bedeutsamen, unbewußten Anteile von Ich und Über-Ich. Auf der anderen Seite ist das Es, dynamisch gesehen, "größer" als das frühere Unbewußte, weil es die Gesamtheit der Triebe verkörpert und nicht, wie das System Unbewußt in der ersten Theorie nur die Sexual- im Gegensatz zu den Ichtrieben."[32] Weiters wandelt sich auch die Bedeutung des Vorbewußten. "Es umfaßt ebenfalls nicht mehr, wie in der ersten topischen Theorie, eine eigene seelische Provinz ..., sondern wird zu einer adjektivischen Beschreibung, die auf beide psychischen Systeme angewendet werden kann, die Zugang zum Bewußtsein haben: Ich und Über-Ich sind zum Teil unbewußt, zum Teil vorbewußt."[33]
Zusätzlich hebt nun Freud auch einen kollektiven Aspekt des Unbewußten hervor, wenn er annimmt, daß das Es auch durch phylogenetische Erwerbungen geprägt ist.[34] Das Es setzt sich also aus einem im Laufe der Ich-Entwicklung durch Verdrängungen erworbenen Teil und einem ursprünglich mitgebrachten Anteil zusammen. Während dieser erworbene Anteil das in der ersten Topik bezeichnete System Unbewußt umfaßt, stellt der ursprünglich mitgebrachte Anteil ein phylogenetisches Erbe dar. "Was unbewußt ist, war einmal zu irgend einer Zeit im Bewußtsein; das Unbewußte hat die Existenz des Gehirns zur Voraussetzung. Das Es ist aber schon vor dem Aufbau des Gehirns da, das Gehirn ist das Werkzeug des Es (...), das Unbewußte ist ein Teil der Psyche, die Psyche ein Teil des Es."[35]
2. Fromm:
Erich Fromm lehnt die Annahme einer dunklen Macht "hinter" dem Ich ab. Er versucht das Unbewußte als den Bereich des menschlichen Lebens zu deuten, zu dem man bislang keinen kognitiven Zugang gefunden hat. "Etwas wie das Unbewußte gibt es nicht, es gibt nur Erfahrungen, deren wir uns bewußt sind, und andere, deren wir uns nicht bewußt sind, das heißt, die uns unbewußt sind."[36]
Auch gibt es keinen Ort bzw. ein Ding, der bzw. das als das "Unbewußte" angesehen werden könnte. "Unbewußtheit ist kein Ort, sondern eine Funktion. Ich kann mir bestimmter Erfahrungen (Ideen, Impulse) nicht gewahr sein, weil eine strenge Abwehr ihnen den Zugang zum Bewußtsein versperrt. In einem solchen Fall kann man sagen, daß diese Erfahrungen unbewußt sind; sind sie nicht blockiert, dann sind sie bewußt. (...) Freilich gibt es bestimmte Inhalte, die die Neigung haben, häufiger unbewußt zu sein als andere; doch auch diese Eigentümlichkeit rechtfertigt eine topographische Redeweise vom Unbewußten als Ort nicht."[37]
Das Unbewußte ist eigentlich ein dem Bewußtsein gleichwertiger Aspekt des menschlichen Daseinsvollzuges. "Was wir gewöhnlich Bewußtsein nennen, ist ein Zustand des Geistes, der durch unser Bedürfnis bestimmt ist, die Natur zu beherrschen, um zu überleben, und - im engeren Sinne - um materielle Dinge zu produzieren, mit denen wir jene Bedürfnisse befriedigen, die sich im Laufe des historischen Prozesses entwickelt haben. Doch wir leben nicht nur, um für unsere biologischen Bedürfnisse zu sorgen und uns gegen Gefahren zu schützen. Im Schlaf, und seltener auch in anderen Zuständen wie etwa bei der Meditation, in der Ekstase oder in durch Drogen herbeigeführten Zuständen, sind wir von der Last, für unser Überleben sorgen zu müssen, befreit. Unter diesen Umständen kann ein anderes System des Gewahrwerdens zum Zuge kommen, bei dem wir uns selbst und die Welt in einer völlig subjektiven und persönlichen Weise wahrnehmen, ohne daß wir unsere Wahrnehmungen durch die Interessen einer Überlebensstrategie zensieren müssen. Diese Art der Wahrnehmung ist zum Beispiel in unseren Träumen bewußt und das "objektive" Erleben unbewußt; wenn wir im Wachzustand sind, ist es umgekehrt. Weil das Leben des Menschen hauptsächlich dem Kampf um sein Dasein gewidmet war, erachtete man das Bewußtsein, bezogen auf diesen zweckorientierten Zustand des Seins, als das "eigentliche" Bewußtsein und sah im anderen Bewußtsein, jenem, das von äußeren Verbindlichkeiten völlig frei war, das Unbewußte. In Wirklichkeit sind beide völlig verschiedene Formen der Logik und der Erfahrung, die von den beiden Formen des Seins und des Handelns abhängen."[38]
Andererseits stimmt Fromm mit Freud hinsichtlich der Gründe, warum ein Bewußtseinsinhalt unbewußt und nicht bewußt ist, im wesentlichen überein. Auch er meint, daß die Gedankeninhalte nicht ins Bewußtsein gelangen, die aufgrund ihrer Unvereinbarkeit mit den eigenen Werten verdrängt werden.[39]
3. LORENZER:
Lorenzer führt die psychischen Leiden auf eine sprachliche Verwirrung des Patienten zurück, sodaß das Ziel der Psychoanalyse in der Veränderung der Sprachspiele liegen muß.[40] Das Unbewußte wird nun als das gefaßt, das außerhalb der für den einzelnen begreifbaren symbolischen Kommunikation liegt, und folglich von diesem verdrängt ist. Mangels dieses Verständnishorizontes entwickelt der Patient daher eine Privatsprache, was eine Interaktionsstörung zur Konsequenz hat. Das Unbewußte ist also das, was aus dem individuellen Sprachhorzizont des Einzelnen herausfällt.[41] Die therapeutischen Anstrengungen der Psychoanalyse bewegen sich daher in einer symbolischen Vermittlungssphäre, in der Schicht der Symbole. Diese Anstrengungen zielen darauf ab, die privatistischen Sprachfiguren in die Kommunikation zurückzuholen.[42] Dem Symbol kommt dabei eine entscheidende Bedeutung zu, da sich im Symbol die Bereiche des Unbewußten und des Bewußten schneiden.[43]
II. Individualpsychologie:
Ein Ziel der Individualpsychologie ist es, den unbewußten Lebensplan aufzudecken, denn dann erst kann dieser einer kritischen Revision unterzogen werden.[44]
1. Adler:
Für Alfred Adler "steht der einheitliche Zusammenhang der Gesamtpersönlichkeit immer im Mittelpunkt der Betrachtung. Für ihn sind Bewußtes und Unbewußtes nicht gänzlich wesensverschiedene psychische Gebilde, sondern für ihn kommt im Unbewußten nur das klar und eindeutig zum Ausdruck, was sich auch im Bewußtsein, wenngleich versteckt, verzerrt und verfälscht, nachweisen läßt. Daher ist ihm auch die Neurose nicht ein plötzlicher Einbruch dunkler Gewalten in die Persönlichkeit, sondern sie wächst aus dem Boden einer ganz spezifisch geformten Persönlichkeit hervor. Daher ist für Adler die neurotische Disposition wichtiger als die Neurose. Sie ist die bleibende Grundlage, die Krankheit hingegen unter Umständen etwas Vorübergehendes. Das Zurückgehen der Krankheitssymptome an sich stellt daher auch keine eigentliche Heilung dar, weil der Patient dann noch immer die große Wahrscheinlichkeit einer neuen Erkrankung in sich trägt. Wirkliche Heilung liegt nur in der Behebung oder bedeutenden Herabsetzung der Persönlichkeit, in einer Wandlung ihrer Zielsetzung und ihres Charakters. (...) Das worauf es Adler ankommt ist gewissermaßen den Kristalisationspunkt zu entdecken, um den herum das verschiedenartige Material sich gesetzmäßig anordnet, eine beherrschende Tendenz aufzuzeigen, in deren Dienst der psychische Rohstoff verarbeitet wird. Diesen Angelpunkt findet Adler im Gefühl der Minderwertigkeit (...)."[45]
Alfred Adler lehnt es ab, "das Unbewußte" also als eine abgegrenzte, besondere Funktionsgruppe dem Bewußtsein gegenüberzustellen. Vielmehr kann jede einzelne psychische Funktion bald bewußt, bald unbewußt sein.[46]
Die unbewußte und die bewußte Sphäre der menschlichen Existenz stellen für Adler eine untrennbare Einheit dar. "Und diese Einheit ist derart geschlossen, daß sie sich in jeder Einzelerscheinung widerspiegelt."[47] Nichts liegt daher näher, als den unbewußten Teil der Persönlichkeit durch Analyse der Handlungen, Intentionen und Bewußtseinsinhalte der jeweiligen Person zu erschließen.
Im Rahmen dieser Eruierung des Unbewußten legt nun Alfred Adler besonders viel Wert darauf, den unbewußten Lebensplan des Patienten ausfindig zu machen. Von diesem Lebensplan her, welcher sich gleichnishaft in jeder Ausdrucksbewegung unserer Handlungen durchscheint, sind alle menschlichen Handlungen, Intentionen und Bewußtseinsinhalte zu deuten. "Ausdrucksbewegung, Handlung, Affekt, Physiognomie und alle anderen seelischen Phänomene, die krankhaften miteinbegriffen, sind ein Gleichnis des unbewußt gesetzten und wirkenden Lebensplanes."[48]
Beim nervösen Charakter ist dieser Lebensplan dadurch gekennzeichnet, daß er vom Überlegenheits- und Machtstreben durchdrungen ist. Da diese Intentionen gegen die Gemeinschaft und den Mitmenschen gerichtet sind, widersprechen sie dem im Menschen angelegten Gemeinschaftsgefühl, was letztlich zu den mit der Neurose verbundenen seelischen Problemen des Patienten führt.[49]
Eine Verselbständigung des Unbewußten versucht Adler aber auch deshalb zu vermeiden, da dies immer in sich die Gefahr birgt, daß im Individuum Subjekt und Objekt voneinander unterschieden werden, was wieder den Anschein erwecken würde, als ob ein wesensfremder Akteur im Subjekt wirksam sei. Eine derartige Begriffsmythologie ist aber für Adler nur "der gedankliche Ausdruck dafür, daß eine Grundtatsache unerfaßt geblieben ist. Die Unfähigkeit, den zentralen Punkt des Problems zu erfassen, wird gedanklich dann in sich verselbständigenden Wesenheiten ausgedrückt."[50]
Konform mit der Psychoanalyse geht Adler insofern, als auch er bestrebt ist, durch die Psychotherapie den Kreis des Bewußtseins zu erweitern. Das Ziel dieser Öffnung liegt für Adler darin, das Bewußtsein so auszudehnen, daß es für einen größeren Kreis des Lebens aufgeschlossener wird, wodurch der Patient die starre Ichhaftigkeit des nervösen Charakters abbaut und in seinem Realitätsbezug gestärkt wird. Dieser Effekt ist unter anderem dadurch erklärbar, daß die nervösen Symptome nicht mehr ohne weiteres reproduzierbar sind, wenn ein Bewußtsein vom eigentlichen Sinn der Charakterhaltung und der nervösen Symptome gebildet worden ist.[51]
Zentrales Ziel jeder Psychotherapie ist die Aufdeckung des individuellen, bislang unbewußt wirkenden Lebensplanes und die Bewußtmachung des im Lebensplan liegenden destruktiven und pathogenen Interesses, welches sich grundsätzlich dadurch auszeichnet, daß es nach Überlegenheit strebt. Da ein derartiges Ziel vom Kranken vor Therapiebeginn nicht eingestanden werden konnte, wurde es vom Bewußtsein ausgeschlossen. Durch die Bewußtmachung wird nun der Sinn des eigenen Tuns verständlich und ein Sich-Selbst-Verstehen erreicht. Ein weiterer Effekt dieser Horizonterweiterung ist, daß dadurch die Unsicherheit des Patienten abgebaut wird und sein Selbstwertgefühl gehoben wird.[52]
Für Alfred Adler hat das Bewußtsein mehrere Funktionen:
Erstens speichert es Wahrnehmungen, Gedanken etc.
Zweitens stellt es auch einen Filter dar, denn es werden alle Wahrnehmungen nach den Kriterien der Förderlichkeit bzw. Hinderlichkeit geordnet. Dabei kann festgestellt werden, daß der Mensch die Tendenz hat, Unangenehmes entweder unbeachtet zu lassen oder aber im Sinne eines individuellen Zieles umzuwerten bzw. umzufunktionieren. Zum Schutz vor der Wahrnehmung unangenehmer Sachverhalte hat sohin jeder eine private Logik entwickelt, die die Wirklichkeit ordnet und möglichst nur die angenehmen Wahrnehmungen ins Bewußtsein vorläßt.[53]
Drittens ist es eine Art Wache, die nur dann tätig wird, wenn es eine Schwierigkeit gibt. "Man kann also sagen: Unbewußt bleibt uns all das, dessen Bewußtwerdung durch eine reale Schwierigkeit nicht erfordert wird."[54] Wenn nun aber Unbewußtes bewußt wird, so deshalb, weil es der Einzelne braucht. Unbewußt bleibt folglich all das, was nicht durch eine Lebensproblematik ins Bewußtsein gelangt. Bewußtwerdung dient daher dem Zwecke der Erreichung eines Ziels.
Meines Erachtens ist dieser Gedankengang deshalb revolutionär, da damit die vorherrschende Einschätzung unserer Kultur, daß das wesentliche der menschlichen Existenz das Bewußtsein ist, auf den Kopf gestellt wird. Vielmehr hat das Bewußtsein nun gleichsam nur mehr die Funktion, als ordnende Kraft zur Lösung von konkreten, subjektiv erlebten Problemen beizutragen.
[...]
[1] - vgl. Chatelet F.; 1974; S. 150ff
[2] - Leibniz G.W.; 1971; S. 10
[3] - Leibniz G.W.; 1971; S. 195
[4] - Carus C. G.; 1946; S. 1
- vgl. auch: Ellenberger H.F.; 1985; S. 283-295
[5] - vgl. Schopenhauer A.; 1962; S. 60ff
- vgl. auch Wucherer-Huldenfeld A.K.; 1968; S. 181ff
- vgl. auch Wucherer-Huldenfeld A.K.; 1969; S. 21f
- vgl. auch Wucherer-Huldenfeld A.K.; 1956; S. 246f
- vgl. auch Wucherer-Huldenfeld A.K.; 1975; S. 126
[6] - vgl. auch Wucherer-Huldenfeld A.K.; 1968; S. 185f
- vgl. auch Wucherer-Huldenfeld A.K.; 1956; S. 244.248
[7] - vgl. Reininger R.; 1970; S. 24f
[8] - vgl. Sartre J.P.; 1991; S. 983f:
"Wenn der Komplex wirklich unbewußt ist, das heißt, wenn das Zeichen durch eine Schranke vom Bezeichneten getrennt ist, wie könnte das Subjekt ihn erkennen? Ist es der unbewußte Komplex, der sich erkennt? Aber ist ihm nicht das Verstehen versagt? Und wenn man ihm die Fähigkeit, die Zeichen zu verstehen, zugestehen müßte, müßte man dann nicht gleichzeitig aus ihm ein bewußtes Unbewußtes machen? Was ist denn Verstehen, wenn nicht Bewußtsein davon haben, daß man verstanden hat? Können wir dagegen sagen, daß das Subjekt als bewußtes das gezeigte Bild erkennt? Aber wie vergliche es dieses mit seiner wirklichen Affektion, wo sie doch unereichbar ist und es nie von ihr Kenntnis gehabt hat?"
[9] - vgl. Sartre J.P.; 1991; S. 975-986, insbesonders S. 984f:
"Dieser Vergleich ermöglicht uns, besser zu verstehen, was eine existentielle Psychoanalyse sein muß, wenn es sie geben können soll. Sie ist eine Methode, in streng objektiver Form die subjektive Wahl ans Licht zu bringen, durch die jede Person sich zur Person macht, das heißt sich selbst anzeigen läßt, was sie ist."
[10] - Sartre J.P.; 1991; S. 983
[11] - Rohracher H.; Wien 1971; S. 472
[12] - Laplanche J, Pontalis J.-B.; 1973, S. 562
- vgl. auch: Freud S.; Einige Bemerkungen über den Begriff des Unbewußten in der Psychoanalyse; Studienausgabe Bd. 3; Frankfurt/M 1975; S. 29ff
[13] - vgl. Huber G.; 1979; S. 67f
- vgl. auch: Wucherer-Huldenfeld A. K.; 1979; S. 339
[14] - Laplanche J., Pontalis J.-B.; 1973b, S. 563
[15] - vgl. Huber G.; 1979; S. 66f
[16] - vgl. Freud S.; Zeitgemäßes über Krieg und Tod; Gesammelte Werke Bd. 10; Frankfurt/M4 1967; S. 354
[17] - vgl. Freud S.; Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse; Studienausgabe. Bd. 1; Frankfurt/M 1969-1975; S. 451-471,
- vgl. auch: Barz H.; 1979; S. 61ff
[18] - Huber G.; 1979; S. 78
[19] - Huber G.; 1979; S. 66
[20] - vgl. Schuster P., Springer-Kremser M.; Wien 1991; S. 30ff
[21] - vgl. Freud S.; Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse; Studienausgabe. Bd. 1; Frankfurt/M 1969-1975; S. 292-295. 335f. 389f. 396-398
- vgl. Freud S.; Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse; Studienausgabe. Bd. 1; Frankfurt/M 1969-1975; S. 527-531
- vgl. Freud S.; Erinnern, Wiederholen und Durcharbeiten; Gesammelte Werke Bd. 10; Frankfurt/M4 1967; S. 129f. 135f
- vgl. auch Barz H.; 1979; S. 61-64
[22] - vgl. Leupold-Löwenthal H.; 1986; S. 249
- vgl. Freud S.; Metapsychologische Ergänzung zur Traumlehre; Studienausgabe Bd. 3; Frankfurt/M 1975; S. 177
[23] - Schuster P., Springer-Kremser M.; Wien 1991; S. 29
- vgl. auch: Wucherer-Huldenfeld A. K.; 1979; S. 339
[24] - vgl. Schuster P., Springer-Kremser M.; Wien 1991; S. 32f
- vgl. Wucherer- Huldenfeld A. K.; 1974; S. 144f
[25] - Freud S.; Das Unbewußte; Studienausgabe Bd. 3; Frankfurt/M 1975; S. 131
[26] - Huber G.; 1979; S. 71
[27] - Schuster P., Springer-Kremser M.; Wien 1991; S. 30
[28] - vgl. Schuster P., Springer-Kremser M.; Wien 1991; S. 29
[29] - Huber G.; 1979; S. 79f
- vgl auch: Freud S.; Das Ich und das Es; Studienausgabe Bd. 3; Frankfurt/M 1975; S. 289f
- vgl. auch: Freud S.; Das Unbewußte. Studienausgabe Bd. 3; Frankfurt/M 1975; S. 160
[30] - Freud S.; Das Ich und das Es; Studienausgabe Bd. 3; Frankfurt/M 1975; S. 292
- vgl. Wucherer-Huldenfeld A.K.; 1978; S. 119ff
[31] - vgl. Laplanche J, Pontalis J.-B.; 1973b, S. 562
- vgl. Freud S.; Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse; Studienausgabe. Bd. 1; Frankfurt/M 1969-1975; S. 496-516
[32] - Schmidbauer W.; 1975, S. 41
- vgl. auch: Wucher-Huldenfeld; 1968; S. 178-187
- vgl. auch: Wucher-Huldenfeld; 1956; S. 244-248
- vgl. auch: Wucher-Huldenfeld; 1978; S. 119-121
- vgl. auch: Wucher-Huldenfeld; 1974; S. 14f
- vgl. auch: Wucher-Huldenfeld; 1974a; S. 144f
- vgl. auch: Wucher-Huldenfeld; 1975; S. 126f
- vgl. auch: Wucher-Huldenfeld; 1969; S. 21f
[33] - Schmidbauer W.; 1975, S. 48
[34] - Freud S.; Das Ich und das Es; Studienausgabe Bd. 3; Frankfurt/M 1975; S. 315f
- anderer Ansicht: Schmidbauer W.; 1975; S. 10ff. 34ff. 41f. 49
[35] - Groddeck G.; 1974; S. 67
[36] - Fromm E.; 1981b; S. 91
[37] - Fromm E.; 1990; S. 80
- vgl. auch Fromm E.; 1981c; S. 231
[38] - Fromm E.; 1990; S. 82f
- vgl. auch Fromm E.; 1980; 130f
[39] - vgl. Fromm E.; 1981b; S. 231
- vgl. auch Fromm E.; 1990; S. 30f
[40] - vgl. Lorenzer A.; 1970; S. 55
[41] - vgl. Lorenzer A.; 1970; S. 36
- vgl. Lorenzer A.; 1975; S. 100
[42] - vgl. Lorenzer A.; 1975; S. 96ff
[43] - vgl. Lorenzer A.; 1971; S. 38f
- vgl. Lorenzer A.; 1970; S. 77ff
[44] - vgl. Strotzka H.; 1982; S. 64f
-vgl. Jacoby H.; 1983; S. 59ff. 87ff
[45] - Furtmüller C.; Wexberg E.; 1973; S. 33
-vgl. auch: Adler A.; 1973; S. 42-66. 94-113
-vgl. auch: Lazersfeld S.; 1931; S. 69-71. 76-79. 83-85
-vgl. auch: Ellenberger H.F.; S. 812-815
[46] - vgl. Jacoby H.; 1983; S. 87ff
[47] - Adler A.; 1973; S. 125
- vgl. auch Adler A.; 1973; S. 114-122
- vgl. auch Adler A.; 1977; S. 37
[48] - Adler A.; 1973; S. 122
- vgl. auch Adler A.; 1973; S. 123-133
- vgl. auch Adler A.; 1977; S. 37
- vgl. Strotzka H.; 1982; S. 64. 222
[49] - vgl. Adler A.; 1973; S. 42-62
- vgl. Adler A.; 1977; S. 37. 151. 173-175
[50] - Jacoby H.; 1983; S. 87
[51] - vgl. Jacoby H.; 1983; S. 88ff
[52] - vgl. Jacoby H.; 1983; S. 88ff
[53] - vgl. Sperber M.; 1970, S. 99
[54] - Sperber M.; 1926, S. 29
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 1996
- ISBN (eBook)
- 9783836607179
- Dateigröße
- 966 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Wien – Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft, Studiengang Philosophie
- Erscheinungsdatum
- 2014 (April)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- philosophie erkenntnisphilosophie sprachphilosophie paradigma psychoanalyse
- Produktsicherheit
- Diplom.de