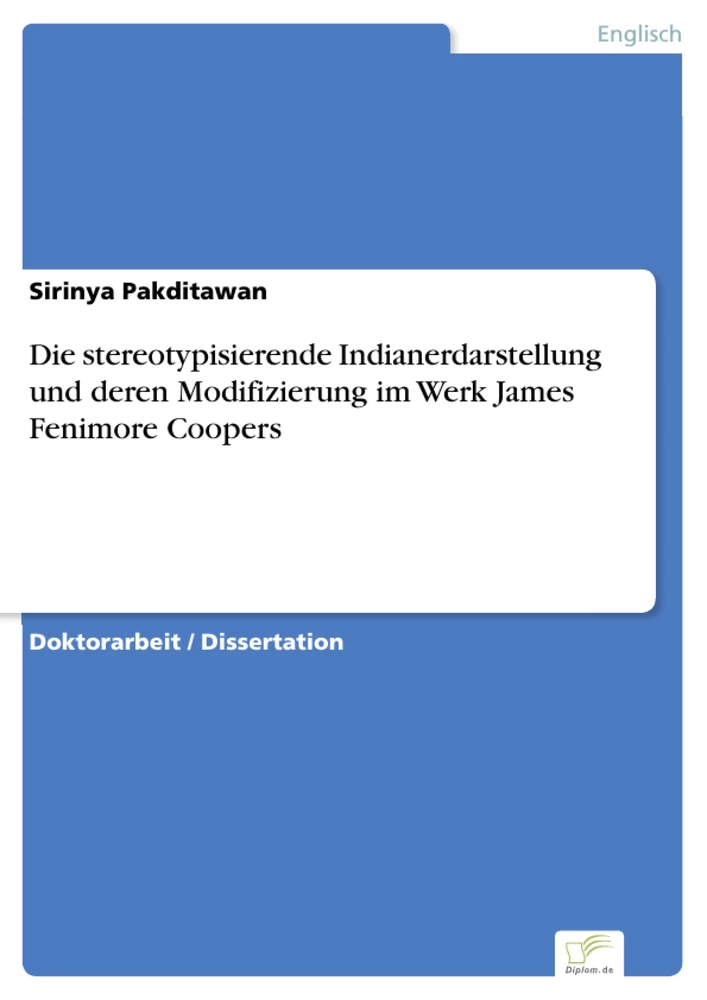Die stereotypisierende Indianerdarstellung und deren Modifizierung im Werk James Fenimore Coopers
Zusammenfassung
James Fenimore Coopers Werk markiert den Beginn der Indianerliteratur des 19. Jahrhunderts. In seinen Indianerromanen stellt Cooper die Beziehung der Angloamerikaner zu den Indianern dar und entwirft darüber hinaus ein Bild des Indianers, das am Nachhaltigsten die Vorstellung vom typischen Indianer in der Literatur geprägt hat.
Hierbei ist Cooper einerseits der europäischen Aufklärung verpflichtet, die den noble savage erfand. Andererseits greift Cooper auch das puritanische Feindbild des Indianers, den satanic savage, auf. Darüber hinaus orientiert sich Cooper aber auch an zeitgenössischen spezifisch amerikanischen Vorstellungen von Indianern, wie dem vanishing American. Im Ganzen präsentiert Cooper ein stereotypisiertes Bild des Indianers, indem er ihn unter die simple Dichotomie des guten und des bösen Indianers subsumiert. Dennoch problematisiert Cooper bestimmte Klischees des Fremden, indem er einzelne Indianer individualisiert.
James Fenimore Cooper gilt als Amerikas erster Mythopoet, herausragender Vertreter der amerikanischen Romantik, Vater der amerikanischen Nationalliteratur und als amerikanischer Scott, weil er Themen aus der amerikanischen Geschichte verarbeitete. Dabei fiktionalisierte er historische Ereignisse, indem er sie in die tradierten Formen einer Romanhandlung umgoss und von der Ebene des individuellen Erlebens her beleuchtete. Hierbei bekannte sich Cooper nicht nur zu einem genuin amerikanischen Schauplatz (setting), sondern erstritt mit seinen indianischen Protagonisten die Literaturwürdigkeit der nordamerikanischen Ureinwohner.
Im Rahmen seines umfangreichen Werkes stellen vor allem die Leatherstocking Tales den amerikanischen Mythos schlechthin dar und bilden darüber hinaus den Beginn der Indianerliteratur des 19. Jahrhunderts. Coopers Indianerfiguren wurden infolge der breiten Rezeption sowohl in Amerika als auch in Europa zum Inbegriff des Roten Mannes. So schrieb beispielsweise der Kritiker Paul Wallace im Jahr 1954: For a hundred years The Leatherstocking Tales cast a spell over the reading public of America and Europe and determined how the world was to regard the American Indian.
Coopers Indianerdarstellung hat also wesentlich dazu beigetragen, dass sich das gegensätzliche Indianerbild vom guten und bösen Indianer zu dem Mythos vereinigen konnte, der sich bis in die heutige Zeit hinein durchsetzen konnte.
Die Lederstrumpf-Romane, aber auch andere Indianerromane Coopers, […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhalt
Abbildungsverzeichnis
0. Einleitung
1. Stereotypisierende Indianerbilder in der nordamerikanischen Literatur
1.1 Das Indianerbild der Puritaner
1.1.1 Der „teuflische Wilde“ der Captivity narrative
Exkurs: Der Begriff des Stereotyps und die religiöse Typologie der Puritaner
1.1.2 Revision der Erfahrung mit den Indianern und erste ethnologische Ansätze
1.2 Der „edle Wilde“ in der europäischen Tradition des Fremden
1.3 Der „edle Wilde“ der Amerikaner und andere amerikanisch-indianische Stereotypen
1.3.1 The vanishing American
1.3.2 Der „gute“ Indianer
1.3.3 Der blutrünstige und der degenerierte Indianer
2. Coopers problembewusste Indianer-Bearbeitung
2.1 Coopers Informationsquellen
2.2 Festschreibung und Verarbeitung der Quellen
2.2.1 Captivity narratives und melodramatische Erlebnismuster
2.2.2 Die Herrnhuter Indianermission
2.2.3 Der Missionar Heckewelder
3. Indianer-Typen in The Last of the Mohicans
3.1 Stereotype Charakterisierung des indianischen Wesens
3.1.1 „Typische“ Indianer und die „guten“ Delawaren
3.1.2 Die „bösen“ Huronen
3.2 Naturgebundenheit und Statik als Merkmale der indianischen Zivilisation
4. Magua: Der „teuflische Wilde“ mit komplexem Charakter
4.1 Äußere Erscheinung und Verhalten
4.2 Negative Charakterentwicklung und Widerspruch zur angloamerikanischen Zivilisation
5. Uncas: Der zivilisationswillige „edle Wilde“
5.1 Äußere Erscheinung und Verhalten
5.2 Positiver Entwicklungsprozess und Affiliation mit der angloamerikanischen Zivilisation
5.3 Uncas – Magua: Ein Antagonistenpaar mit Analogien
6. Chingachgook: Der unzivilisierbare „edle Wilde“
6.1 Ambivalentes Wesen des nicht zivilisierbaren „guten“ Indianers
6.2 Vom „guten“ zum degenerierten Indianer
7. Scalping Peter: Vom gefährlichen zum degenerierten Indianer
7.1 Ursprüngliche Gefährlichkeit und mangelnde Einsicht
7.2 Von der plötzlichen Konversion zum Relikt der Vergangenheit
8. Conanchet: Der akkulturierte „gute“ Indianer
8.1 Von der Gefangenschaft zur ansatzweisen Assimilation
8.2 Der Tod als endgültige Rückkehr zur indianischen Zivilisation
9. Resümee
10. Literaturverzeichnis
10.1 Primärliteratur
10.2 Sekundärliteratur
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1 Thomas Cole „Landscape from the Last of the Mohicans” (1827), New York State Historical Association Cooperstown, NY
Abb. 2 Indianische Kriegsführung und das Skalpieren: Zwei Indianer aus dem Südosten zeigen ihre Trophäen; Kupferstiche: Library of Congress
Abb. 3 Roger Williams und die Narragansett-Indianer. Kupferstich: Library of Congress
Abb. 4 Ein Abschnitt aus Benjamin Wests The Death of General Wolfe, 1770: National Gallery of Canada, Ottawa. Wests Darstellung dieses Native Americans stellt eine Idealisierung des Indianers als noble savage dar
Abb. 5 Native Americans lauschen den Predigten der Herrnhuter Missionare: Kupferstich nach einem Gemälde von Christian Schussele: Library of Congress
Abb. 6 Johann Valentin Haidt. Das „Erstlingsbild“ (1748)
Abb. 7 Magua als lüsternder, bedrohlicher Indianer: Zeichnung und Kupferstich von Tony Johannot..
Abb. 8 Uncas als beschützende, engelsgleiche Gestalt im Hintergrund: Zeichnung und Kupferstich von Tony Johannot
Abb. 9 Chingachgook als würdige Gestalt: Illustration von Gerhard Goßmann
Abb. 10 Blanketed Indian: Tasunka Ota (Plenty Horses) ist in eine Decke gehüllt, um seinen Widerstand gegen die Assimilation auszudrücken. Fotografie von J.C.H. Grabill
Abb. 11 Der degenerierte Chingachgook: Illustration von Gerhard Goßmann aus: Die Ansiedler, Frontispiz
Abb. 12 Thomas Cole „Scene from the Last of the Mohicans“ (1826), Terra Museum of American Art, Chicago, IL, USA
0. Einleitung
The Leather-Stocking stories illustrate (…) the Indian’s shifting role on the American frontier.[2]
James Fenimore Cooper gilt als Amerikas erster Mythopoet, herausragender Vertreter der amerikanischen Romantik, Vater der amerikanischen Nationalliteratur und als „amerikanischer Scott“,[3] weil er Themen aus der amerikanischen Geschichte verarbeitete. Dabei „fiktionalisierte“ er historische Ereignisse, indem er sie in die tradierten Formen einer Romanhandlung umgoss und von der Ebene des individuellen Erlebens her beleuchtete. Hierbei bekannte sich Cooper nicht nur zu einem genuin amerikanischen Schauplatz (setting), sondern erstritt mit seinen indianischen Protagonisten die Literaturwürdigkeit der nordamerikanischen Ureinwohner. Im Rahmen seines umfangreichen Werkes stellen vor allem die Leatherstocking Tales den amerikanischen Mythos schlechthin dar und bilden darüber hinaus den Beginn der Indianerliteratur des 19. Jahrhunderts.[4] Coopers Indianerfiguren wurden infolge der breiten Rezeption sowohl in Amerika als auch in Europa zum Inbegriff des „Roten Mannes“.[5] So schrieb beispielsweise der Kritiker Paul Wallace im Jahr 1954: „For a hundred years ’The Leatherstocking Tales’ cast a spell over the reading public of America and Europe and determined how the world was to regard the American Indian“.[6] Coopers Indianerdarstellung hat also wesentlich dazu beigetragen, dass sich das gegensätzliche Indianerbild vom „guten“ und „bösen“ Indianer zu dem Mythos vereinigen konnte, der sich bis in die heutige Zeit hinein durchsetzen konnte: „by developing powerful images to symbolize both extremes of feeling about the red man (…) [Cooper] created one of the major nineteenth-century myths about America“.[7]
Die Lederstrumpf -Romane, aber auch andere Indianerromane Coopers, verarbeiten also Grunderfahrungen und –probleme der jungen amerikanischen Nation und rufen somit auf der Ebene der literarischen Realität vor allem die Indianerfrage als ein amerikanisches Grundsatzproblem ins öffentliche Bewusstsein. Auf diese Weise sind einerseits narzisstische Selbstspiegelung, ob des unaufhaltsamen Wachsens der jungen amerikanischen Nation, sowie andererseits bußfertige Selbstanklage, ob der rücksichtslosen Vertreibung der Ureinwohner und der damit verbundenen Trauer über den Untergang der indianischen Welt, in ihrer unaufhebbaren Ambivalenz literarisch in Coopers Indianerromanen greifbar. Cooper thematisiert hierbei in durchaus realistischen Schilderungen den Untergang nordamerikanischer Indianerstämme durch die vorrückenden europäischen Siedler.
The Pioneers (1823) und The Last of the Mohicans (1826) sind dabei diejenigen Werke aus dem Lederstrumpf -Zyklus, die den historischen Prozess, d.h. die Wildniskämpfe und die Ansiedlung der Weißen, thematisieren und am deutlichsten geschichtlich konzipiert sind.[8] Entsprechend befasst sich Cooper in diesen Werken mit Indianern und den Vorgängen bei der Inbesitznahme des nordamerikanischen Kontinents durch die angloamerikanische Zivilisation. Hierbei stellt Cooper in The Last of the Mohicans, aber auch in dem zeitlich später angesiedelten The Pioneers, die Beziehung der weißen Amerikaner zu den Indianern dar und entwirft darüber hinaus ein Bild des Indianers,[9] das am nachhaltigsten die Vorstellung vom typischen Indianer in der Literatur geprägt hat.[10] In diesem Zusammenhang ist jedoch zu bemerken, dass The Pioneers zwar intensiv die Siedlungsproblematik behandelt, aber The Last of the Mohicans der indianischen Tragödie sehr viel mehr Raum widmet, die in der unseligen Verknüpfung zwischen der Eroberung des Kontinents durch die weißen Einwanderer und der damit ausgelösten Vernichtung der Indianer besteht. In beiden Romanen präsentiert Cooper jedoch im Ganzen ein stereotypisierendes Bild des Indianers, indem er dessen Eigenschaften auf wenige Merkmale reduziert und ihn somit generell unter die simple Dichotomie des „guten“ und des „bösen“ Indianers subsumiert. Gleichwohl greift Cooper bestimmte Klischees des Fremden auf, um sie dadurch zu problematisieren, dass er einzelne Indianer individualisiert. Auf diese Weise lässt sich aufzeigen, dass Cooper eine Differenz zwischen den Stereotypen[11] seiner Zeit und konkreten indianischen Protagonisten darstellt. Somit lässt sich die These aufstellen, dass sich in Coopers Indianerdarstellung insofern ein neuer Zug findet, als über die bekannte Typisierung in „gute“ und „böse“ Indianer hinaus, Widersprüche, Divergenzen und eine Zerrissenheit zur Geltung kommen.
Dennoch verdanken Coopers „primitive Wilde“ ihre Existenz grundsätzlich weniger seinen ethnologisch präzisen Kenntnissen als einer langen und komplizierten europäischen Tradition, die sich seit dem Zeitalter der Entdeckungen in Auseinandersetzung mit den Ureinwohnern der amerikanischen Kontinente entwickelt hatte. Der nordamerikanische Indianer war also mythisch als barbarische, wilde Kreatur und als unverdorbenes, glückseliges Naturgeschöpf existent, lange bevor Cooper ihn episch stilisierte.[12] Im ersten Kapitel soll deshalb die historische Entwicklung des stereotypisierenden Indianerbildes skizziert werden, um zunächst klären zu können, welcher Tradition Cooper generell verpflichtet ist. Hierbei wird es auch um eine historische Einbettung der Romane gehen. Dabei ist zu klären, wie in der literarischen Tradition mit dem Fremden, Wilden und Neuen umgegangen wurde. Cooper ist hierbei einerseits der europäischen Aufklärung verpflichtet, die den noble savage „kreierte“. In diesem Kontext wird zudem zu zeigen sein, dass sich vor allem die kulturkritische Philosophie Rousseaus in The Pioneers und The Last of the Mohicans spiegelt. Denn Cooper verdeutlicht, dass erst die Viren der weißen Zivilisation das „Schlechte“ in die indianische Lebensweise eingeführt und das Edle und Tugendhafte im Charakter der Indianer zunehmend zersetzt haben.[13] Andererseits greift Cooper aber auch auf das puritanische Feindbild des Indianers, den satanic savage, zurück. Hierbei muss jedoch beachtet werden, dass das Indianerbild der Puritaner keineswegs auf das der evil savages begrenzt war. Das Indianerbild der Puritaner ist deshalb zu differenzieren und erste anthropologische Ansätze sind zu erwähnen. Darüber hinaus orientiert sich Cooper auch an zeitgenössischen spezifisch amerikanischen Vorstellungen von Indianern, wie dem vanishing American und dem degenerate Indian.
Die Gestaltung des Indianers als literarische Figur erweiterte Cooper aber auch durch umfangreiche Quellenstudien, deren Ursprünge seine eigene inventio sowohl antezedieren als auch überschreiten. Im zweiten Kapitel werden die historisch relevanten Quellen (vor allem John Heckewelder, Jonathan Carver, Mary Kinnan), die Cooper zum Teil mit Sicherheit, zum Teil wohl nur möglicherweise gekannt und für seine Romane benutzt hat, untersucht. Zu bemerken ist, dass sich gerade im 18. Jahrhundert Reisebeschreibungen, Expeditions- und Missionarsberichte über die nordamerikanischen Indianer häufen, die sich im Unterschied zu den eher pauschalen Abhandlungen früherer Jahrhunderte mit einzelnen Stämmen und ihren Traditionen befassen. Es wird deshalb zu klären sein, wie Cooper die Klischees, die in frühen, aber auch noch in zeitgenössischen Schriften kursierten, unterläuft, hinterfragt oder gar aufhebt. In diesem Zusammenhang wird zudem analysiert werden, wie Indianer in Coopers Hauptquellen dargestellt werden, und auf welche Weise er diese kritisch und problembewusst bearbeitet. Hierbei ist auch der Wahrheitsgehalt der historischen Quellen an sich zu prüfen sowie zu klären, ob diese Texte lediglich den Klischees verhaftet bleiben, oder ob auch sie schon individualisierte Indianerfiguren präsentieren. Die Quellentexte werden vor dem Hintergrund der erzähltheoretischen Ansätze Wolfgang Isers und Siegfried J. Schmidts betrachtet.
Jedoch ist Coopers Indianerdarstellung bereits von Zeitgenossen kritisiert worden, mit dem Vorwurf, seinen Indianern fehle es an Lebensechtheit.[14] Entscheidend ist hierbei, dass Cooper seine Indianer stets als Figuren seiner dichterischen Freiheit verstanden hat, also gar nicht für sich in Anspruch nahm, nordamerikanische Ureinwohner tatsächlich realistisch gezeichnet zu haben.[15] Coopers antithetisches Bild des Indianers scheint somit in der Tat idealisiert und eine grobe Vereinfachung zu sein, wobei die Stereotypen grundsätzlich rassistisch erscheinen. Dennoch kann generell gesagt werden, dass kein weißer amerikanischer Schriftsteller des frühen und mittleren 19. Jahrhunderts vollkommen vorurteilsfrei gegenüber Indianern war.[16] Das gilt auch für Cooper. Insofern kann auch seine Präsentation des Indianers zu den rassischen Stereotypen gezählt werden, die das amerikanische Denken im 19. Jahrhundert geprägt haben. Aus diesem Grund erscheint Coopers polares Indianerbild als Spiegel seines kulturellen Hintergrunds. Darum auch wurde oft betont, dass Cooper die Indianer so hinnahm, wie sie ihm durch seine Kultur präsentiert wurden.[17] Verdeutlicht soll aber auch werden, dass Cooper nach einem Kompromiss zwischen seinen eigenen, vorurteilsbeladenen Vorstellungen vom Typ Indianer und seinen epischen und politischen Intentionen suchte. Denn auch er teilte prinzipiell die Überzeugung seiner Zeitgenossen von der historischen Notwendigkeit des weißen Siegs. Auf diese Weise wird die Stereotypisierung seiner indianischen Protagonisten auch als Beweis für seine ethno-chauvinistische Vorurteilsbeladenheit zitiert. Nicht ohne Grund gilt Coopers Interesse primär dem Wilden, den man durch die Vorstellungen und Erfordernisse des zivilisierten Lebens definiert.[18] Die Tatsache aber, dass die Entstehung von The Pioneers und The Last of the Mohicans generell in eine Periode relativer Indianerfreundlichkeit in Politik und Literatur fallen,[19] legt nahe, dass Cooper bei der Darstellung von Indianern in der Tat nicht bloß den Konventionen folgt, sondern zentrale Indianergestalten mehrschichtig anlegt und sie dementsprechend komplexer gestaltet.
Auf diese Weise stellt Elisabeth Hermann bereits in ihrer 1986 veröffentlichten Dissertation über die Darstellung der nordamerikanischen Indianer im Werk James Fenimore Coopers und seiner Zeitgenossen[20] fest, dass Cooper mit der Möglichkeit experimentiert, das scheinbar Unvereinbare, nämlich die dynamische angloamerikanische und die statische indianische Zivilisation, zusammenzubringen und die Indianer in den Ablauf der Geschichte des nordamerikanischen Kontinents einzubeziehen. Diese einschlägige Studie über die Gestaltung und Funktionalisierung indianischer Charaktere in Coopers Romanen gelangt zu dem Ergebnis, dass Cooper bei der Präsentation seiner Indianer zwar auf einer Darstellungsebene die Konventionen seiner Zeit aufgreift, wenn es darum geht, den „typischen“ Indianer zu präsentieren. Alte Leservorurteile und damit zusammenhängende grundlegende Urteilssicherheit des Lesers über indianische Eigenheiten werden damit bestätigt. Jedoch betont Hermann auch, dass es darüber hinaus noch eine zweite Ebene gibt, auf der Cooper in der Gestaltung des kollektiven Schicksals der Zivilisation hinausgeht, und mithilfe von „Akkulturationsexperimenten“ Möglichkeiten ausleuchtet, durch die eine Einbeziehung der indianischen Zivilisation in den Ablauf amerikanischer Geschichte ermöglicht werden könnte. Hermann gelangt zu dem Schluss, dass die Indianer die Lösung aus der Gebundenheit an ihre wenig entwickelte Zivilisationsstufe,[21] den Schock des Herausgerissenwerdens aus einem Jahrhunderte währenden Zustand, nicht überstehen und folglich auch nicht als aktive Teilnehmer in den Verlauf von Geschichte integriert werden können. Aufgezeigt an dominanten Indianerfiguren, führt der plötzliche, erzwungene Übergang nach Hermann eher zu einem Prozess der Desintegration, in dessen Verlauf die Indianer entweder ihr Leben verlieren oder als passive Mündel der weißen Zivilisation enden, ohne an deren Zukunft teilhaben zu können.
Es lässt sich Hermann darin zustimmen, dass Cooper bei der Darstellung des „typischen“ Indianers, d.h. des Indianers als Angehörigen eines Volkes, im Ganzen den Konventionen seiner Zeit folgt und diesen Indianer stereotypisiert darstellt. Im dritten Kapitel wird entsprechend analysiert werden, welche Funktion die Übernahme von Klischees für die Darstellung des „typischen“ Indianers einnimmt. In diesem Zusammenhang wird auch darauf einzugehen sein, dass das Fremde vorwiegend aus der sentimentalisierenden Perspektive der Weißen geschildert wird. Darum ist auch zu beachten, ob ein kritisches Verhältnis Coopers gegenüber der Sicht der Angloamerikaner deutlich wird. Zu bemerken ist nämlich, dass Cooper durchaus den Versuch unternimmt, aus der ethnozentrischen Sichtweise der europäischen Literatur auszubrechen und sich ansatzweise auch in die Angehörigen der Nationen hineinzuversetzen, die diese Literatur zu Objekten der Betrachtung reduziert. Aus diesem Grund kann man die These aufstellen, dass Cooper speziell in The Last of the Mohicans nicht mehr die Konfrontation von Zivilisation und Barbarei, sondern vielmehr das Nebeneinander mehrerer Kulturen gestaltet.[22]
Obwohl Cooper schon in The Last of the Mohicans die Möglichkeit einer angloindianischen Mischkultur andeutet, wird die Möglichkeit kultureller Assimilation[23] erst in dem Roman The Wept of Wish-Ton-Wish von 1829 explizit durchgespielt. Die Annäherung eines Indianers an die angloamerikanische Zivilisation wird hier in besonders deutlicher Weise aufgegriffen. Denn der Protagonist Conanchet geht durch die eheliche Verbindung mit der Weißen Ruth Heathcote eine tiefe emotionale Beziehung mit den Angloamerikanern ein. The Wept of Wish-Ton-Wish ist auch insofern literarhistorisch interessant, als sich dort eine ganz andere Verarbeitung der captivity narrative zeigt, als in The Last of the Mohicans. Denn indem der Roman nicht nur das Schicksal einer puritanischen (weiblichen) Gefangenen, sondern auch das eines gefangenen (männlichen) Indianers behandelt, wird zudem eine Transformation der Gattung der captivity tales als solcher vorbereitet.[24] Deshalb kann man sagen, dass Cooper nicht nur captivity tales verarbeitet hat, sondern auch zu deren Transformation beigetragen hat. Darüber hinaus markiert die Verbindung von Conanchet und Ruth Heathcote einen Moment in der Kolonialgeschichte Neuenglands, der ihrem weiteren Verlauf nachhaltig beeinflussen und eine andere Richtung hätte geben können.
Bleibt Conanchet trotz seiner engen Bindung an die angloamerikanische Kultur seiner ursprünglichen Identität verhaftet, so scheint an Scalping Peter aus The Oak Openings (1848), dem schaffenschronologisch letzten von Coopers Indianerromanen, eine Aufgabe seiner indianischen Identität, bedingt durch ein plötzliches Konversionserlebnis, am vollständigsten demonstriert. Als „traurigste Indianerfigur“[25] geht Scalping Peter aber der eigenen Sprache verlustig und scheint deshalb dem Typus des „roten Trottels“ zu entsprechen. Da in diesem Roman indianisches traditionelles Wissen zudem komisiert wird, stellt sich die Frage, ob Cooper den Indianer in diesem späten Werk degradiert. Damit würde er sich in die Tradition der späteren Autoren des 19. Jahrhunderts, Mark Twain und Edgar Allan Poe, stellen, die die Figur des Indianers benutzt haben, um lächerliche Momente der menschlichen Existenz hervorzuheben. Hierbei ist jedoch zu bedenken, dass Komik an sich stets die Implikation der Negation in sich trägt, weshalb eine scheinbare Abwertung des Indianers durchaus eine Kritik an der weißen Zivilisation beinhalten kann.
Es ist deutlich geworden, dass Coopers Indianerdarstellung nicht nur eine bedeutende Rolle hinsichtlich der Präsentation des Indianers in der Literatur zukommt, sondern dass seinem Indianerbild auch das Potential zugestanden werden muss, den kulturellen Hintergrund des 19. Jahrhunderts näher beleuchten und die Einstellung der Angloamerikaner zu den Native Americans verdeutlichen zu können. Aus diesem Grund erscheint eine eingehende Betrachtung der Bedeutung der stereotypisierenden Indianerdarstellung und deren Modifizierung anhand individualisierter Indianergestalten ein angemessener und geeigneter Aspekt für eine Interpretation von Coopers Romanen The Pioneers und The Last of the Mohicans, aber auch für The Wept of Wish-Ton-Wish und The Oak Openings.
Festzustellen ist hierbei, dass den fünf individualisierten indianischen Hauptfiguren aus diesen Romanen – Magua, Uncas, Chingachgook, Conanchet und Scalping Peter – durch ihre Rollen als „gute“ beziehungsweise „böse“ Indianer eine symbolische Funktion zukommt, so dass sie zu Repräsentanten der verschiedenen Stadien der Extermination der Indianer werden und dabei auch die sich verändernde Rolle des Indianers an der American frontier widerspiegeln. Auf diese Weise lässt sich an ihnen aufzeigen, inwiefern Cooper die Stereotypen problematisiert und verkompliziert. Die Bedeutung der Abweichungen werden an diesen Beispielen in den folgenden fünf Kapiteln gedeutet werden. Der Protagonist Uncas und der Antagonist Magua aus The Last of the Mohicans sollen dabei vornehmlich als Prototypen des „guten“ beziehungsweise des „bösen“ Indianers betrachtet werden. Hierbei ist festzuhalten, dass der „böse“ Magua als Gegenwartsindianer konzipiert ist, während der „gute“ Uncas von vornherein als Vergangenheitsindianer erscheint, der bereits bei Entstehung des Romans The Last of the Mohicans der Vergangenheit angehörte und damit zur Glorifizierung freigegeben war. Somit repräsentieren Uncas und Magua beide eine jeweils andere Phase in der Ausrottung der Indianer durch den unaufhaltsamen Fortschritt der weißen Zivilisation. Interessant ist hierbei insbesondere, inwiefern Magua vom Prototyp des „schlechten“ Indianers abweicht. Bei Chingachgook scheint Cooper zwei typische Entwicklungsstadien indianischer Existenz vor Augen gehabt zu haben, denn Chingachgook erscheint in The Pioneers als degenerierter Gegenwartsindianer, während er in The Last of the Mohicans und vor allem im chronologisch ersten Roman der Leatherstocking Tales, The Deerslayer (1841), eher dem „edlen Wilden“ gleicht.[26] An Conanchet wird die Integration des Indianers in die angloamerikanische Zivilisation am weitesten geführt und der Entwicklungsprozess des Indianers auf realistische Art und Weise geschildert. Dahingegen wird aus dem anfänglich „gefährlichen“ Indianer Scalping Peter unvermittelt ein bekehrter Indianer, der somit zum typischen vanishing American wird. Die Verteilung bewegt sich also entlang einer Grenze, die von Vergangenheit (d.i. gut, edel) und Gegenwart (d.i. schlecht, degeneriert) gebildet wird. Hierbei wird generell eine bedauernde Haltung Coopers hinsichtlich des Absterbens der reinrassigen, edlen Wilden deutlich.[27] Zudem wird letztlich auch sichtbar werden, dass der Unterschied zwischen dem „guten“ und dem „bösen“ Indianer in der Tat nicht sehr groß ist, sondern dass der „edle Wilde“ nur die Kehrseite des „teuflischen Wilden“ bedeutet.
1. Stereotypisierende Indianerbilder in der nordamerikanischen Literatur
1.1 Das Indianerbild der Puritaner
1.1.1 Der „teuflische Wilde“ der Captivity narrative
For them [the Puritans], Indians were direct instruments of Satan’s bidding, if not actual devils themselves.[28]
Wenn sich Menschen verschiedener Kulturen begegnen, treffen sich damit vor allem zunächst ihre unterschiedlichen Bedürfnisstrukturen. Auf diese Weise richten sich ihre Hoffnungen, Wünsche und Erwartungen auf das jeweilige Gegenüber. Es ist hierbei der gesamte kulturelle Hintergrund, d.h. das, was in der lebenslangen Sozialisation erworben wird, das den hermeneutischen Prozess der Wahrnehmung und Einschätzung des anderen Menschen und der Verständigung mit ihm regelt. Stehen Menschen verschiedener kultureller Herkunft einander das erste Mal gegenüber, so wird aus dem Anderen der Fremde und Fehlinterpretationen der fremden Kultur können die Folge sein.[29] Denn festzuhalten ist, dass bei der Kulturbegegnung eine gemeinsame, historisch entwickelte semantische Basis zur Verständigung fehlt.
Die historische Bestimmtheit der menschlichen Wahrnehmung wirkt dabei zweischneidig. Denn indem der individuellen wie der kollektiven Reaktion auf das Fremde allein frühere Erfahrungen als Orientierung zur Verfügung stehen, besteht unmittelbar die Gefahr, dass die Gegenwart durch die Sicht der Vergangenheit verzerrt und verstellt wird. In den fremden Menschen werden dann nur Teile des ohnehin schon Bekannten gesehen und infolgedessen werden die fremden Menschen mit Zuschreibungen belegt.[30] Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Kulturbegegnung unter dem Angstdruck eines ökonomischen Neuanfangs steht. Dann liegt es nahe, die fremden Menschen zu Projektionsträgern der eigenen Wünsche, Erfahrungen und Ängste zu machen. Dies hat zur Folge, dass das ihnen Eigene durch das auf sie Projizierte verstellt wird.[31] Auf diese Weise ist auch das Bild der edlen Wilden beziehungsweise der teuflischen Wilden zustande gekommen.
Vor allem auf dem nordamerikanischen Kontinent kam es nach der Gründung der Kolonien zu massiven Konflikten zwischen den Zugewanderten und den Ureinwohnern. Die Europäer, die den nordamerikanischen Kontinent erreichten, fanden nämlich kein „kulturelles Niemandsland“[32] vor. Die „City upon a hill“ der Puritaner musste aus diesem Grund in strikter Abgrenzung zu der Kultur der bereits ansässigen Menschen errichtet werden. Somit lässt sich erklären, weshalb die Puritaner den Indianern im Allgemeinen äußerst feindselig gegenüberstanden und ihre Kultur gar nicht anerkennen konnten.
Bis zum Ausgang des 19. Jahrhunderts spielte das Verhältnis der Angloamerikaner zu den Indianern somit eine zentrale Rolle für die Entwicklung der vom Pioniergeist geprägten Siedlerkultur zur hochzivilisierten Nation. Es lässt sich vom ersten Kontakt bis zur eskalierenden Konfrontation aufzeigen, wie sich die amerikanische Kultur verstanden hat. Literarische Schriften erscheinen hierbei prinzipiell als Mittel zur Verarbeitung von Geschichte sowie als Ausdruck von Ideenprozessen. Denn sie erlauben es, Rückschlüsse auf die Einstellung der weißen Amerikaner zum Anderen, d.h. zum Fremden, zu ziehen. Diese Literatur spiegelt dabei einen Prozess der Entstehung von Stereotypen wider, wobei festzuhalten ist, dass diese in erster Linie Konstruktionen von Nicht-Indianern darstellen und somit grundsätzlich wenig mit der Realität des indianischen Lebens gemein haben.
Auf diese Weise war das dichotome Bild von den amerikanischen Ureinwohnern, der Widerspruch zwischen Verteufelung und Verherrlichung, bereits bei Kolumbus und anderen Entdeckungsreisenden der Renaissance angelegt und kennzeichnet alle folgenden Indianerdarstellungen der Kolonialzeit. Die Auffassungen vom edlen und unedlen Wilden formten also schon relativ früh feste Bestände westlicher Kultur und ermöglichten den Repräsentanten der abendländischen Kultur, sich selbst zu bestätigen, abzugrenzen, eigenes unrechtmäßiges Verhalten vor sich selbst zu rechtfertigen, aber auch sich selbst zu kritisieren.[33] Die intellektuelle und moralische Qualifizierung des Indianers erscheint somit auch als ein Mittel zur Bestimmung des kulturellen Selbstwertes. Denn die Berührung mit den Eingeborenen führte den Weißen das vor Augen, was sie nach ihren Wertmaßstäben nicht sein sollten und forderte von ihnen somit eine Definition ihrer eigenen Kultur.
Das Bild des Indianers als „roter Teufel“ ist im Wesentlichen als Resultante einer biblisch fundierten Weltbetrachtung der puritanischen Siedler zu verstehen. Diese Vorstellung vom Indianer geht hauptsächlich auf die eurozentrische, christlich-theologische Voreingenommenheit der Puritaner zurück, die den Indianern notwendig als dämonisch, da ungläubig, sehen und ihm mit unverhohlenem Misstrauen und unerschütterlichem Glauben an die eigene Überlegenheit sowie die Gottgewolltheit ihrer Anwesenheit in der Neuen Welt begegnen mussten. Die puritanische Sicht der Indianer als „teuflische Wilde“ basiert auf ihrem religiösen Geschichts- und Realitätsverständnis, welches wiederum auf einer stark typologisch orientierten Theologie beruht. So werden die Puritaner zum heiligen Volk, Amerika zum New Canaan, die Wildnis zur Wüste des alten Testaments und die Indianer zu Ausgeburten des Teufels.[34]
Somit erkannte der puritanische Geist in den Indianern von Anfang an die teuflische Opposition gegen die göttliche Ordnung.[35] Darüber hinaus trug die mangelnde Bereitschaft der Indianer, sich bekehren zu lassen, zu der Überzeugung der Puritaner bei, dass diese der höheren Zivilisation zu weichen hatten. Auf diese Weise konnten die Puritaner die Eliminierung der Ureinwohner sowie die Urbarmachung des Landes als göttlichen Willen deklarieren. Dabei betrachten sie ihre Beziehung zu den Indianern einseitig als eine Gefährdung ihrer selbst, aus der allein Gott sie erretten konnte. Um die Aneignung von Land rechtfertigen zu können, haben die Puritaner den Indianern das Menschsein und somit auch das Recht auf ihr Land abgesprochen.[36] Den Puritanern konnten die Indianer somit nur fremd und unmenschlich bleiben, da sie sie nie als gleichberechtigte Wesen betrachtet haben. So schreibt die auf Neuengland bezogene Literatur des 17. Jahrhunderts entscheidende Komponenten der rhetorischen Appropriation der Indianer im 16. Jahrhundert fort.[37] Dies trifft insbesondere auf Reiseberichte und offizielle Verlautbarungen englischer Bischöfe (z.B. Jewell und Abbott) zu, die das Bild vom Indianer als „cruel, degenerate Devil worshippers“ verbreiteten.[38] So überwiegen in diesen Predigten und Anlässen plurale Abgrenzungen von „Indians“, „Savages“, „Heathens“ und „Barbarians“ im Vergleich zur Verwendung von Stammesbezeichnungen wie beispielsweise Wampanoag, Pequot, Mohegan und Narragansett.[39]
Da die Puritaner allein in Gottes Wort eine Richtlinie für die innere wie äußere Ordnung des Gemeinwesens erblickten, die somit auch eine Folie zur Interpretation der fremden Kultur lieferte, passten die Indianer lediglich als Teil des bereits Gewussten in einer abstrakten Menschlichkeit in dieses Gefüge. Diese Haltung impliziert generell, dass die Puritaner die Indianer gar nicht als ein Anderes erkennen konnten, das zur kritischen Reflexion der eigenen Kultur aufforderte.[40] Dementsprechend ist in den historischen Dokumenten der Puritaner selten Verständnis für die indianische Kultur als solche vorhanden. Vor diesem Hintergrund erscheint der Hass der Puritaner auf die ihnen fremden Indianer primär als Ausdruck eines institutionalisierten, strukturellen Ethnozentrismus, der die Aufrechterhaltung der puritanischen Herrschaft mit theologischen Argumenten legitimierte.[41]
So bezeichnete der führende Puritaner Cotton Mather die Eliminierung der Indianer als das höchste Ziel der Kolonisten, da dies der offensichtliche Wille Gottes sei. Deshalb sprach er den Indianern alle menschlichen Wesenszüge ab und betrachtete sie einseitig als „rapacious wolves“ und „serpents“.[42] Auch in dem aus demselben Jahr stammenden Rückblick „ The Troubles, which the Churches of NEW-ENGLAND have undergone in the WARS, which the People of that Country have had with the Indian Salvages” [43] betrachtet Mather die Indianer als „Instrumente des Teufels” (Kap.7, S. 41) und „Devils in Flesh” (Kap. 7, S. 49). Er deutet den Pequot-Krieg (1637) deshalb auch als Konflikt zwischen „the Infant Colonies of New-England” und „satanischen Wilden“ (Kap. 7, S. 42).[44] So betrachtet er auch den King Philip’s War (1675-78) als „the War […] begun by a Fierce Nation of Indians, upon an Honest, Harmless, Christian Generation of English “ (Kap. 7, S. 46). Er stellt dabei stets „[t]he Blasphemy, and Insolence, and prodigious Barbarity of the Salvages“ (Kap. 7, S. 52) der Sorge der Neuengländer bezüglich der Bewahrung ihrer kirchlichen und zivilisatorischen Errungenschaften gegenüber.[45]
Aber auch schon in Increase Mathers Brief History of the Warr With the Indians in New-England [46] von 1676 wird diese Abgrenzung von den Indianern in besonders eindringlicher Weise deutlich. Denn auch Increase Mather entfaltet dort das Repertoire der negativen Repräsentation der Indianer in seiner gesamten Bandbreite.[47] So bestimmen in seinen Augen „[M]ischief“ (S. 87), „inhumanity“ (S. 90), „treachery“ (S. 93, 107) und „insolency“ (S. 88) das Handeln und Denken der Indianer. Ihr Verhalten beschreibt er deshalb auch als „barbarous“ (S. 87, 90, 100) und „malicious“ (S. 87). So stigmatisiert er die nordamerikanischen Ureinwohner kollektiv auch als „wicked Men whose tender Mercies are cruelties“ (S. 92). Zudem betrachtet er sie als „ Barbarous Heathen “ (S. 103), „wild Beasts“ (S. 104), „perfideous and bloody Heathen“ (S. 107) und schließlich auch als „perfect Children of the Devill“ (S. 116).[48]
Die Indian-devil -Stereotypie findet sich jedoch nicht nur in den historischen Dokumenten der Puritaner, sondern auch in den Erfahrungsberichten (factual prose) und in den Berichten über Gefangenschaften bei den Indianern (captivity tales/narratives) der puritanischen Kolonisatoren des 17. Jahrhunderts. Diese Berichte über Gefangenschaften bei den Indianern stellen das erste originär amerikanische Genre[49] dar und wurden zunächst nur im religiösen Eifer geschrieben, um nach der Befreiung aus indianischen Händen die Gnade und die Allmacht Gottes zu preisen und die Schrecken der heidnischen Wildnis darzustellen.[50] Vor allem die captivity tales dienten zu jener Zeit als einzige Informationsquelle über das Leben der Indianer und beeinflussten somit sehr stark das Bild vom „Wilden“ in den Augen derer, die fern von der Erfahrung der Wildnis lebten. In diesen Erzählungen werden indianische Ureinwohner im Allgemeinen nicht als erkennbare Individuen oder als Menschen anderer Kultur dargestellt, sondern vielmehr als stereotype Handlanger von teuflischen Mächten, die zu bekämpfen die Puritaner sich an Gottes Seite berufen fühlten.[51] Zwar treten in Gefangenschaftsberichten auch hin und wieder „gute“ Indianer auf, die den Verzweifelten Nahrung und Trost spenden, manchmal sogar deren Leben retten, doch werden ihre Handlungen nicht als Ausdruck ihrer Menschlichkeit gesehen, sondern als Manifestationen göttlicher Gnade. Die wohl bekannteste Erzählung dieser Art ist Mary Rowlandsons A Narrative of the Captivity and Restoration of Mrs. Mary Rowlandson von 1682.[52]
Die Handlung der captivities folgt meist nur einem einzigen Plotschema. So wird zumeist ein/e Neuengländer/in[53] während der Grenzkriege von französisch-freundlichen Indianern gefangen genommen und erlebt auf dem Marsch ins indianische Hinterland Entbehrungen und entsetzliche Grausamkeiten. Schließlich wird er/sie durch eine wunderbare, gottgewollte Fügung gerettet und kehrt in die neuenglische Zivilisation zurück. Die captivity folgt somit nach Van der Beets auch dem archetypischen Muster von Tod und Wiedergeburt,[54] denn die Gefangenschaft setzt stets mit der Trennung von der eigenen Kultur, und deshalb mit einem symbolischen Tod, ein. Daraufhin folgt die Transformation, ein innerer Entwicklungsprozess durch schwierige, zu bestehende Situationen, die mit der Rückkehr in die ursprüngliche Kultur endet. Diese ist als eine symbolische Wiedergeburt durch eine neue Erkenntnis zu verstehen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2 Indianische Kriegsführung und die Praktik des Skalpierens: Zwei Indianer aus dem Südosten zeigen ihre Trophäen; Kupferstiche: Library of Congress[55]
Zu den wiederkehrenden Gräueltaten der Indianer in diesen Berichten gehören neben Skalpieren auch Kannibalismus und Vampirismus.[56] Diese Handlungen werden gewöhnlich ausgeschmückt und detailliert wiedergegeben. Da vor allem die Erfahrung der Angst das konstitutive Element der Gefangenschaftsberichte darstellt und die menschlichen Qualitäten lediglich an den moralischen und kulturellen Maßstäben der Zivilisation gemessen wurden, konnten die captivity narratives weder ein objektives noch ein realistisches Bild des Indianers und seiner Kultur liefern.[57] Dennoch bildete dieses Genre einen konstitutiven Bestandteil der Literatur nach 1680 und übte einen entsprechend großen Einfluss auf die anti-indianische Haltung der Kolonialliteratur aus. Da die captivity tales als wesentlicher Bestandteil der frontier romances dann vor allem im 19. Jahrhundert sehr populär wurden, haben diese auch sehr zur Vorstellung des Indianers als „roter Teufel“ in der Literatur dieser Zeit beigetragen: „Bis zu den Groschenromanen des ausgehenden 19. Jahrhunderts bleiben die Gefangenschaftsberichte mit ihrem geschlossen negativen Indianerbild (…) eines der stabilsten Genres der amerikanischen Literatur“.[58]
Exkurs: Der Begriff des Stereotyps und die religiöse Typologie der Puritaner
Der ursprünglich aus der Druckertechnik stammende Begriff „Stereotyp“ wird heutzutage in unterschiedlichen Kontexten verwendet, in denen er verschiedene Bedeutungen haben kann.[59] Der „Stereotyp“ bezeichnet jedoch stets ein bestimmtes gleich bleibendes Schema. Ein Stereotyp kann deshalb als eine Zusammenfassung von Eigenschaften oder Verhaltensweisen angesehen werden. Diese hat meistens einen hohen Wiedererkennungswert und vereinfacht den gemeinten Sachverhalt sehr stark. Deshalb steht der Stereotyp generell in einem engen Bedeutungszusammenhang zum Klischee oder Vorurteil.[60]
Der Begriff „Stereotyp“ findet vor allem in der Sozialpsychologie, der Soziologie, aber auch in der Literaturwissenschaft Anwendung. Am geläufigsten ist die Verwendung jedoch in einem sozialwissenschaftlichen Kontext. In diesem Zusammenhang bezeichnen Stereotype Komplexe von Eigenschaften oder Verhaltensweisen, die bestimmten Personengruppen zugeschrieben werden und die über eine gewisse sozialpsychologische und gesellschaftliche Dynamik verfügen.[61] Somit grenzen sie sich sichtbar von den so genannten Schemata ab, die keine primären sozialen Informationen beinhalten (z.B. Prototypen). Stereotype kennzeichnen sich vor allem dadurch, dass sie besonders distinkte Eigenschaften karikierend hervorheben und teilweise falsch verallgemeinern.
Der Begriff „Stereotyp“ wurde im Jahre 1922 von Walter Lippmann in die Diskussion der Vorurteilsforschung eingeführt. Sein Werk Public Opinion (Die öffentliche Meinung)[62] war somit bahnbrechend für die Stereotypenforschung im literaturwissenschaftlichen Kontext. Denn Lippmann argumentiert hier als politischer Journalist und nicht als Soziologe, „wenn er das Stereotyp als eine Projektion des Wertbewusstseins, der eigenen Stellung und Rechte (…)“[63] versteht. Dennoch ist man sich in der Literatur immer noch nicht darüber einig, wie man Stereotypen charakterisieren soll. Man stellt sich deshalb die Frage, ob es bestimmte Haltungen, Überzeugungen oder verbale Ausdrücke von Überzeugungen sind, die Stereotypen kennzeichnen. Einigkeit herrscht jedoch darüber, was die Merkmale von Stereotypen betrifft: ihr Gegenstand ist immer eine bestimmte Gruppen von Menschen, wobei das Individuum Stereotype als Ausdruck der öffentlichen Meinung durch die Erziehung der Familie oder des Milieus kennen lernt. Hierbei wird „[d]ie Wahrnehmung und Perzeption sozialer Hinweisreize und deren Transformation in individuelle Eindrücke (…) durch kulturelle Rahmenbedingungen beeinflusst“.[64] Dies geschieht unabhängig von der persönlichen Erfahrung des Menschen. So heißt es auch bei Schütz und Luckmann: „Alle meine Erfahrungen in der Lebenswelt sind auf dieses Schema bezogen, so daß mir die Gegenstände und Ereignisse in der Lebenswelt von vornherein in ihrer Typenhaftigkeit entgegentreten (…)“.[65] In Bezug auf die wertende Funktion des Stereotyps ist es stets emotional geladen, sowohl positiv als auch negativ.
Zudem ist ein Stereotyp entweder völlig tatsachenwidrig oder es enthält nur partiell Tatsachen. Es erweckt aber den Anschein, völlig wahr zu sein. Darüber hinaus sind Stereotype dauerhaft und resistent gegen Veränderungen, da sie unabhängig von der Erfahrung entstehen und eine emotionale Aufladung besitzen. Sie haben hierbei geradezu eine „„Selbst-erfüllende Prophezeiung[en]“ (…), die nach Robert Merton „ein Reich des Irrtums“ erschaff[t] und verewig[t].“[66] Die soziale Funktion von Stereotypen besteht vor allem darin, die von einer Gruppe oder Gesellschaft akzeptierten Werte und Urteile zu verteidigen. In psychologischer Sicht dient die Stereotypisierung deshalb als Orientierungssystem und vereinfacht die Entscheidung für eine kognitive Ökonomie. Denn „Stereotype dienen den Akteuren einer Gesellschaft, bestimmte Personen und Personengruppen in diese Strukturen sozial zu „verorten“, wodurch sich eine hierarchische Gesellschaftsordnung herausbilden kann“.[67] Darüber hinaus dient die Stereotypisierung auch als Anpassungssystem, so dass in einer Gruppe Konflikte verringert werden. Außerdem haben Stereotypisierungen auch die Funktion, als Systeme zur Aufrechterhaltung des Selbst zu dienen. Denn „Stereotype (…) [tragen] fundamental mit dazu bei, eine Gesellschaftsordnung der sozialen Interaktion zu schaffen und aufrecht zu erhalten“.[68] In diesem Sinne unterstützt und fördert die Stereotypisierung die Selbstdefinition und Selbstverankerung.
Wendet man sich jedoch der puritanischen Vorstellung des Indianers als „roter Teufel“ zu, so ist zu beachten, dass der Begriff „Typ“ in der Theologie eine ganz andere Bedeutung hat, als das spätere moderne Verständnis dieses Begriffs. Aber was bedeutet nun ein „Typ“ in diesem spezifischen Sinne? Schaut man in die Klassiker der nordamerikanischen Literatur, so findet sich beispielsweise in Herman Melville Israel Potter, einem Werk aus der Zeit der amerikanischen Romantik,[69] ein Hinweis. So beschreibt Melville die Seeschlacht des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges als „something singularly indictory in this engagement: it may involve at once a type, a parallel, and a prophecy “.[70] Der Begriff „Typ“ wird hier als Vorbild, Parallele und Prophetie verstanden.
In der lateinischen Übersetzung von figura, bedeutet „Typ“ in dem spezifischen von Melville verwendeten Sinne „Parallele“ sowie „Prophetie“. So ist im theologischen, biblischen Verständnis ein Typus eine Person, Sache, Handlung oder Einrichtung, die durch positive Bestimmung des die Geschichte vorausordnenden Gottes neben ihrer durchaus selbständigen Bedeutung als Tatsache ihrer Zeit noch eine zukünftige Person, Sache, Handlung oder Einrichtung vorherbildet.[71] Nach Brumm handelt es sich hierbei um eine Konzeption, „die jahrhundertelang die abendländischen Vorstellungen vom menschlichen Schicksal und vom Weltablauf bestimmte und die damit auch auf die Dichtung und Geschichtsschreibung ausstrahlte“.[72]
Somit haben die amerikanischen Puritaner das alte Testament als konkret-dramatische Weltgeschichte typologisch auf ihr eigenes Schicksal bezogen. So klingt mit ihrer Auswanderung in die amerikanische Wildnis ein typologisches Motiv an, nämlich das des Auszugs der Kinder Israels in ein „Zweites Jerusalem“.[73] Dieser Zug der Kinder Israel aus Ägypten in die Wüste (Wildnis) und schließlich in das gelobte Land, ist der alles beherrschende Typ der Puritaner. Diese Konzeption gab den Puritanern Kraft, um die Gefahren und Unwirtlichkeiten Neuenglands zu bewältigen: „(…) sie [die Typologie] war ein Mittel, das Einsamkeitsgefühl in der „howling wilderness“ zu überwinden und sich trotz Entferntheit und Trennung durch einen Ozean als Teilhaber der großen christlich-abendländischen Tradition zu fühlen“.[74]
Ein sehr bekanntes Beispiel, dass das puritanische Geschichtsverständnis sowie ihre Einstellung gegenüber der Neuen Welt offenbart, findet sich in William Bradfords Chronik Of Plymouth Plantation[75] (1630-50). Denn dort schildert Bradford die Ankunft der Puritaner in der Neuen Welt, die sie als Wüstenei erfahren, in der sie nichts Vertrautes willkommen heißt. Der Chronist setzt den Kampf der ersten Siedler in Beziehung zum Zug des Volkes Israel und gebraucht dabei die Wüstenmetapher als Typologie. Diese steht im Gegensatz zur Paradiesmythe. Er verleiht der Verlorenheit der Neuankömmlinge Ausdruck, indem er an die Stelle einer Beschreibung dessen, was sie sehen, eine Auflistung der Dinge stellt, die sie an diesem Ort vermissen: „Being thus passed ye vast ocean…they had now no friends to wellcome them, nor inns to entertaine or refresh their weatherbeaten bodys, no houses or much less townes to repaire too, to seeke for succoure.“[76] Die Neuankömmlinge sind offenbar mit einem geschichtslosen Ort konfrontiert, der im Namen Gottes erst seinem Reich einverleibt und urbar gemacht werden muss. Denn die Puritaner erblicken in ihrer neuen Umgebung lediglich „a hidious & desolate wilderness, full of wild beasts & wild men“.[77]
Die Typologie dient den Puritanern somit nicht nur zur Deutung der Welt, sondern auch zur Interpretation von Geschichte. Aus diesem Grund fehlt in der puritanischen Vorstellung von Geschichte der Begriff der Entwicklung als etwas in der Zeit zu einem unbekannten Ziel kausal Fortschreitendes völlig. Aus der typologischen Sicht der Puritaner ist Geschichte vielmehr nach den drei Stufen „prophetische Präfiguration“, „Erfüllung“ und „endzeitliche letzte Erfüllung“[78] konzipiert.
[...]
[1] Aus http://www.swarthmore.edu/.../kjohnso1/sublime04.html. 20.12.2006.
[2] Warren S. Walker, James Fenimore Cooper: An Introduction and Interpretation (New York, 1962), S. 33.
[3] Beatrix Dudensing betont, dass sich mit Coopers Bezeichnung als „The American Scott“ zweierlei verbinden lässt. Erstens die Tatsache, dass Sir Walter Scott (1771-1832) sowie Cooper als Begründer einer Nationalliteratur und als Verfasser historischer Romane mit bestimmten Figurenkonstellationen angesehen werden können. Zweitens die Tatsache, dass sich neben strukturellen Ähnlichkeiten der Romane eine gemeinsame Verwurzelung im Primitivismus und im kulturellen Relativismus nachweisen lässt (vgl. Beatrix Dudensing, Die Symbolik von Mündlichkeit und Schriftlichkeit in James Fenimore Coopers „Leatherstocking Tales“ (Frankfurt am Main, 1993), S. 7f.). Auch John Lye bezeichnet Cooper als den „American Scott“. Vgl. John Lye, Romance as a Genre: Some Notes. http://www.brocku.ca/english/courses/2F55/romance.html. 14.12.2006 (Eine Veröffentlichung der Brock University, Ontario, Kanada). Zur Bedeutung Coopers als Begründer der amerikanischen Nationalliteratur siehe auch Barbara Buchenau, Der frühe amerikanische historische Roman im transatlantischen Vergleich (Frankfurt am Main, 2002), S. 345. Cooper wurde primär durch seine Indianerromane, aber auch durch Abenteuerromane im Pionier- und Seefahrermilieu bekannt.
[4] Zur Bedeutung Coopers als erstem amerikanischen Schriftsteller äußern sich auch Ursula Brumm, “Motive für historisches Sein: Eine Untersuchung an frühen historischen Romanen von Scott und Cooper.“ In: Theodor Wolpers, Hrsg. Gattungsinnovation und Motivstruktur. Bericht über Kolloquien der Kommission für literaturwissenschaftliche Motiv und Themenforschung 1986-1989. Teil I (Göttingen, 1989), S. 134, Klaus P. Hansen, “James Fenimore Cooper: Die entschärfte Progressivität des retrospektiven Liberalismus.“ In: Die retrospektive Mentalität. Europäische Kulturkritik und amerikanische Kultur (Cooper, Melville, Twain) (Tübingen, 1984), S. 123 u. 130 und Hartmut Heuermann, “Von diabolischen Wilden und dichotomen Werten: James Fenimore Coopers Leatherstocking Tales (1823ff.).“ In: Mythos, Literatur, Gesellschaft. Mythokritische Analysen zur Geschichte des amerikanischen Romans (München, 1988), S. 240. Leslie A. Fiedler betont darüber hinaus, dass Cooper als erster Jugendschriftsteller Amerikas auch als erster wahrer amerikanischer Autor gelten kann. Nach Fiedler stellen die Lederstrumpf-Romane nämlich den Amerikaner so dar, wie er sich im Grunde seines Wesens selbst betrachtet (vgl. Leslie A. Fiedler, “James Fenimore Cooper und der historische Roman.“ In: Liebe, Sexualität und Tod. Amerika und die Frau, aus dem Amerikanischen übers. von Michael Stone & Walter Schürenberg (Berlin, 1964), S. 154). Zur Bedeutung Coopers als Jugendschriftsteller siehe insbesondere Anneliese Bodensohn, Im Zeichen des Manitu. Coopers „Lederstrumpf“ als Dichtung und Jugendlektüre (Frankfurt am Main, 1963).
[5] Dies wird beispielsweise dadurch veranschaulicht, dass in Deutschland, wo Coopers zweiter Roman Der letzte Mohikaner schon im 19. Jahrhundert populär war, die Alltagsformulierung „der letzte Mohikaner“ für viele letztüberlebende Zeitzeugen oder Anhänger einer Idee oder Überzeugung sprichwörtlich wurde. Vgl. Lutz Röhrich, Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. Bd. 3. 5. Aufl. (Freiburg/Basel/Wien, 1991), S. 1040. Krüger-Lorenzen bemerkt auch, dass die deutschen Redensarten „den Kriegspfad beschreiten”, „das Kriegsbeil begraben” und „die Friedenspfeife rauchen” von Cooper stammen. Vgl. Kurt Krüger-Lorenzen, Der lachende Dritte. Deutsche Redensarten und was dahinter steckt III. Mit Zeichnungen von Franziska Bilek (Düsseldorf/Wien, 1973), S. 186.
[6] Heuermann, S. 243, zitiert Paul Wallace aus: “Cooper’s Indians“, New York History, 35 (1954), S. 417.
[7] Walker, S. 46.
[8] Ursula Brumm hebt hervor, dass die beiden Romane insofern sichtbar historisch platziert sind, als The Pioneers die Siedlungsproblematik, die bei Cooper das letzte Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts und das erste des 19. Jahrhunderts umspannt, und The Last of the Mohicans die Verwicklungen der Kolonialkriege, in denen England und Frankreich vom späten 17. bis über die Mitte des 18. Jahrhunderts hinaus den Kampf um den Besitz Nordamerikas austragen, behandeln. Hierbei erscheint insbesondere The Last of the Mohicans geschichtlich konzipiert, weil dort das historisch belegte Massaker von Fort William Henry am Lake George (1757) mit dem triadischen Konflikt zwischen Engländern, Franzosen und Indianern, wenn auch in eindeutig fiktionalisierter Form, im Zentrum der Handlung steht (vgl. Brumm, Motive für historisches Sein, S. 134 und Ursula Brumm, “Geschichte und Wildnis in James Fenimore Coopers The Last of the Mohicans.“ In: Geschichte und Wildnis in der amerikanischen Literatur (Berlin, 1980), S. 80).
[9] Zu beachten ist, dass der Begriff „Indianer“ eine grobe Verallgemeinerung darstellt, die die kulturellen Unterschiede zwischen den verschiedenen Stämmen gänzlich unberücksichtigt lässt und somit wesentlich dazu beigetragen hat, das Schicksal der Stämme zu besiegeln und ihr Bild in der Literatur zu bestimmen.
Die Bezeichnung „Indianer“ (ursprünglich spanisch: indios) geht auf das Missverständnis des Seefahrers und Entdeckers Christoph Kolumbus zurück, der glaubte, in Indien angekommen zu sein, als er Amerika im Jahre 1492 für die Europäer (Spanier) (wieder-)entdeckte. Mit „Indien“ bezeichneten die europäischen Seefahrer zu jener Zeit allgemein den gesamten ostasiatischen Raum, den sie über den westlichen Seeweg zu erreichen suchten. Selbst nachdem sie ihren Irrtum erkannt hatten, hielten sie an dieser Bezeichnung fest. Der Ausdruck „Indianer“ stellt somit die deutsche Version des englischen „ Indians “ dar. Es handelt sich hierbei also um einen Begriff, mit dem die europäischen Kolonialmächte die nordamerikanischen Ureinwohner bezeichneten. Dieser Sammelbegriff steht somit für eine Vielzahl verschiedener amerikanischer Ethnien, die sich kulturell teilweise sehr stark voneinander unterscheiden. Damit vereinheitlichten die Kolonialherren die Bewohner der eroberten Gebiete.
Die Völker Amerikas kannten selbst vor der Zeit Kolumbus’ keine entsprechende Gesamtbezeichnung. Vielmehr definierten sie sich ausschließlich über ihre jeweilige Volksgruppe. Vgl. Alvin M. Josephy, Hrsg., Amerika 1492. Die Indianervölker vor der Entdeckung. Idee von Frederick E. Hoxie. Aus dem Amerikanischen übers. von Brigitte Walitzek (Frankfurt am Main, 1992). Siehe insbesondere Teil I Wir, die Menschen, 1492, S. 21-307. Im Zuge der weißen Vorherrschaft, Verfolgung und Genozide gewannen insbesondere die Völker Nordamerikas jedoch zunehmend ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Heutzutage gebrauchen sie in den USA für sich die englischen Begriffe American Indian (Indianer) oder Native American (amerikanischer Ureinwohner). Hierbei wird erstere Bezeichnung besonders von politisch aktiven Menschenrechtskämpfern gebraucht.
Mit der Bezeichnung der Indianer wird im Folgenden der Symbolkomplex, das Bild dieser Menschen als ideologisches Substrat euroamerikanischen Bewusstseins beziehungsweise sein internalisiertes Bild im Individuum, gemeint. Die Verwendung singulärer Formen wie zum Beispiel „(der) Wilde“, „(der) Indianer“ und „(der) Barbar“ unterstützt die Privilegierung kultureller Schemata und Kategorisierungen auf Kosten individueller und individualisierender Perzeptionen und Repräsentationen. Aus diesem Grund sind Indianerbilder immer zugleich auch als projizierte Übertragungen des Eigenen zu interpretieren. D.h. als Vorstellungs- und Symbolkomplexe verraten gerade die künstlerischen Produkte mehr über soziale, politische und kulturelle Probleme ihrer euroamerikanischen Produzenten als über die reale Existenz der in diesen Komplexen symbolisierten indianischen Kulturen.
[10] Zur Bedeutung von Coopers Indianerbild für die Literatur siehe insbesondere Hartmut Lutz, “Indianer“ und “Native Americans“: Zur sozial- und literarhistorischen Vermittlung eines Stereotyps (Hildesheim/Zürich/New York, 1985), S. 151 u. 266ff.
[11] Die Bedeutung des Begriffs „Stereotyp“ wird im Exkurs zu Kapitel 1.1 Das Indianerbild der Puritaner ausführlich behandelt werden.
[12] Vgl. Robert F. Berkhofer, Jr., The White Man’s Indian. Images of the American Indian from Columbus to the Present (New York, 1978); Urs Bitterli, Die „Wilden“ und die „Zivilisierten“. Grundzüge einer Geistes- und Kulturgeschichte der europäisch-überseeischen Begegnung (München, 1976); Stephen Greenblatt, Wunderbare Besitztümer. Die Erfindung des Fremden: Reisende und Entdecker, aus dem Englischen übers. von Robin Cockett (Darmstadt, 1994); Roy Harvey Pearce, Rot und Weiß: Die Erfindung des Indianers durch die Zivilisation, aus dem Amerikanischen übers. von Wolfgang Bick (Stuttgart, 1991).
[13] Fiedler macht Cooper generell verantwortlich für die amerikanische Einbürgerung des Rousseauschen Mythos (vgl. Fiedler, S. 160f.).
[14] Beispielsweise wurde 1852 von dem Historiker Francis Parkman der Vorwurf erhoben, dass Coopers Indianer sehr oberflächlich dargestellt sind: „We do not allude to his [Cooper’s] Indian characters, which it must be granted, are for the most part either superficially or falsely drawn.“ Barrie Hayne, “Ossian, Scott and Cooper’s Indians”, Journal of American Studies, 3 (1969), S. 73, zitiert Francis Parkman aus: The North American Review, 74, No. 154 (Januar 1852), S. 150. Auf weitere Kritik an Coopers Indianerdarstellung verweisen Fiedler, S. 159 und Gaile Mc Gregor, “Cooper and the New Noble Savage.” In: The Noble Savage in the New World Garden: Notes Toward a Syntactics of Place (Bowling Green, Ohio, 1988), S. 135.
[15] Auf diese Weise verwies Cooper auf Homer und das „Recht“ des Dichters, die Realität durch das „ beau idéal “ zu ersetzen und dem Leser die Charaktere als Idealbilder zu präsentieren (vgl. Fiedler, S. 144 u. 159, Mc Gregor, S. 126 und Wolfgang Hochbruck, ’I Have Spoken’. Die Darstellung und ideologische Funktion indianischer Mündlichkeit in der nordamerikanischen Literatur (Tübingen, 1991), S. 143). Zu weiterer Kritik an Coopers Indianerdarstellung siehe auch Pearce, S. 282 sowie H. Daniel Peck, Hrsg., “Introduction.“ In: New Essays on “The Last of the Mohicans“ (Cambridge, 1992), S. 6ff.
[16] Allgemein stellt Hort zur Thematik der Vorurteile fest, „(…) dass es weder ein vorurteilsfreies (Zeit-)Alter noch vorurteilsfreie Klassen oder Schichten gibt“ (Rüdiger Hort, Stereotype und Vorurteile – soziale und dynamische Konstrukte. Eine sozialpsychologische und wissenssoziologische Untersuchung über die Entstehungsursachen, die Bedeutung und die Funktionen von Stereotypen- und Vorurteilsstrukturen. Magisterarbeit (Hamburg, 2002), S. 7.
[17] Vgl. Pearce, S. 270 und Peck, S. 8.
[18] Nach Pearce besteht für Cooper die Funktion des Indianers hauptsächlich darin, zum Verständnis des weißen Mannes vorzudringen (vgl. Pearce, S. 271).
[19] Diese Information stammt aus Hochbruck, S. 140. Das frühe 19. Jahrhundert war in der Tat die Zeit, in der Indianer aus „humanitären“ Gründen umgesiedelt wurden: „on their new land in the West, protected by a paternal and benign federal government, the Indians could gradually be prepared for (…) citizenship. Left on their own to compete with superior whites for territory in the East (…) they were certain to be decimated” (Lucy Maddox, Removals. Nineteenth-Century American Literature and the Politics of Indian Affairs (Oxford, 1991), S. 25). Der Verzicht auf ihre angestammten Territorien und die Neuansiedlung westlich des Mississippi sollte die „Wilden“ vor dem für sie verderblichen Kontakt mit der Zivilisation bewahren und ihnen einen langsamen, geregelten und geplanten Übergang in die Moderne ermöglichen, bis sie sich schließlich der amerikanischen Nation würden anschließen können.
[20] Elisabeth Hermann, Opfer der Geschichte: Die Darstellung der nordamerikanischen Indianer im Werk James Fenimore Coopers und seiner Zeitgenossen (Frankfurt am Main, 1986).
[21] Nach Dudensing sind die Indianer in den Leatherstocking Tales der ersten Gesellschaftsstufe zuzuordnen, denn sie werden nur auf einer Kulturstufe dargestellt, von der aus sie sich nicht weiterentwickeln. Dabei finde weder eine Annäherung an die Angloamerikaner statt, noch lassen sich spezifische Entwicklungsstufen der Stämme erkennen (vgl. Dudensing, S. 167f.).
[22] Auf Coopers Streben nach einer Rassenharmonie verweist allgemein Louise K. Barnett, die den „bösen“ Indianer und den „edlen Wilden“ als Verkörperung des nostalgischen Gefühls der siegreichen weißen Amerikaner gegenüber den aussterbenden Indianern betrachtet. Sie betont, dass in dieser Nostalgie möglicherweise das beinhaltet ist, was D.H. Lawrence „wish fulfillment fantasy“ oder „yearning myth“ nach einer Rassenharmonie bezeichnet (vgl. Louise K. Barnett, The Ignoble Savage. American Literary Racism, 1790-1890 (Westport, Connecticut, 1975), S. 96). Zu Coopers Intention, eine Begegnung von Kulturen darzustellen, siehe auch Maria Diedrich, “Die Wildnis als historischer Ort und Heimat in The Last of the Mohicans “, Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen, 140.225 (1988), S. 66.
[23] Im Kontext der Kulturbegegnungen und -annäherungen muss man zwischen den Begriffen der Akkulturation, der Assimilation und der Transkulturation unterscheiden.
In der Sozialpsychologie sowie in der Migrationsforschung wird Akkulturation generell als das Aufeinandertreffen von Menschen aus unterschiedlichen Kulturen verstanden. Nach John W. Berry lassen sich vier Akkulturationsstrategien unterscheiden. Diese werden über die Fragen definiert, ob die Minderheitengruppe die eigene Kultur beibehalten will beziehungsweise soll oder nicht und ob irgendeine Form des Kontakts zwischen Mehrheit und Minderheit bestehen kann. Werden beide Fragen bejaht, spricht Berry von einer Integration, wird die Kultur verneint aber ein Kontakt bejaht, handelt es sich nach Berry um eine Assimilation. Wird die Kultur angenommen, aber ein Kontakt verneint, so nennt Berry dies eine Segregation oder Separation und bei Verneinung beider Fragen von einer Marginalisierung oder Exklusion. Vgl. John W. Berry, Handbook of cross-cultural psychology (Boston, 1997), passim.
Unter Assimilation versteht man in der Soziologie die einseitige Anpassung einer Minderheit an ihr soziales Umfeld oder das Aufgehen einer Minderheit in der Mehrheit durch biologische Vermischung.
Schließlich bedeutet Transkulturation das allmähliche Durchdringen fremder, meist von Minderheiten besetzter Bereiche durch mächtigere Kulturen, Nationen oder Religionen bis zu deren Assimilation. Der Begriff der Transkulturation (transculturación) wurde vor allem durch die Werke des kubanischen Anthropologen Fernando Ortiz’ (1881-1969) geprägt (vgl. Juan Neidhardt, Transkulturationsforschung. http://www.uni-koeln.de/phil-fak/histsem/ibero/forschung/thema/transkulturation/18.12.2006). Ortiz ersetzt die englische Theorie der Akkulturation durch die der Transkulturation. Unter dem Begriff „Akkulturation“ versteht er die völlige Auslöschung der Kultur, die von der dominierenden Zivilisation überdeckt wird (vgl. Doris Schwarzwald, “Lateinamerikanische Literatur im Lichte der Transkulturation“, TRANS Nr. 14, September 2005 (Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften). http://www.inst.at/trans/14Nr/schwarzwald14.htm. 18.12.2006. Obwohl die Transkulturation Ähnlichkeiten zum Nationalismus und zum Ethnozentrismus aufweist, ist sie nicht mit diesen Begriffen gleichzusetzen. Ein Beispiel für die Transkulturation ist die Christianisierung. Unter Christianisierung versteht man die Hinwendung ganzer Völker oder Kulturkreise zum Christentum oder ihre gewaltsame Unterwerfung unter diesen Glauben.
[24] Die Transformation der captivity narrative kommt mit der Entstehung der slave narrative in der Mitte des 19. Jahrhunderts zum Abschluss (Ulla Haselstein, “Die Gabe des Todes: James Fenimore Coopers Roman The Wept of Wish-Ton-Wish (1829).“ In: Die Gabe der Zivilisation. Kultureller Austausch und literarische Textpraxis in Amerika, 1682-1861 (München, 2000), S. 88).
[25] Hochbruck, S. 141.
[26] Auf Coopers Verarbeitung der indianischen Gegenwart im Verhältnis zu historischen „edlen Wilden“ weisen Hochbruck, S. 129 und Barnett, S. 96 hin. Auch Hansen verweist auf die Bedeutung Uncas’ als Vergangenheitsindianer, wenn er betont, dass der Auftritt dieses vollkommenen Naturmenschen unter dem Vorzeichen des Untergangs steht. Da Cooper ihn als letzten Spross eines ehemals mächtigen Geschlechts vorführt, wirke Uncas inmitten der um sich greifenden Zivilisationsherrschaft bereits unzeitgemäß (vgl. Hansen, S. 137).
[27] Susan Scheckel sieht in der trauernden Haltung der weißen Siedler hinsichtlich des Verschwindens der Indianer primär ein Mittel zur Rechtfertigung der Vertreibung der Native Americans. Sie betont, dass diese Einstellung im frühen 19. Jahrhundert geradezu zu einem „national habit of thought“ wurde (vgl. Susan Scheckel, Race and Nationalism in Nineteenth-Century American Culture (Princeton, New Jersey, 1998), S. 32).
[28] Kathryn Zabelle Derounian-Stodola & James Arthur Levernier, The Indian Captivity Narrative, 1550-1900 (New York, 1993), S. 61.
[29] Julia Kristeva, Fremde sind wir uns selbst, aus dem Französischen übers. von Xenia Rajewsky (Frankfurt am Main, 1990), passim und Hans-Peter Rodenberg, Der imaginierte Indianer. Zur Dynamik von Kulturkonflikt und Vergesellschaftung des Fremden (Frankfurt am Main, 1994), S. 11.
[30] Ibid.
[31] Rodenberg, S. 12f.
[32] Ibid.
[33] Diese Informationen stammen aus Lutz, S. 128ff., Berkhofer, S. 3ff. und Derounian-Stodola & Levernier, S. 52 u. 54. Bitterli weist darauf hin, dass verallgemeinernde pejorative Ausdrücke zur Bezeichnung von Eingeborenen wie „Wilder“ oder „Barbar“ von Kolonisatoren primär dann verwendet wurden, wenn sie die Kulturbegegnung intellektuell nicht bewältigen konnten. Er betont darüber hinaus, dass diese herabwürdigenden Stereotypen vor allem dazu dienten, eigenes Fehlverhalten zu legitimieren (vgl. Bitterli, S. 367).
[34] Siehe hierzu den an dieses Unterkapitel anschließenden Exkurs über den Begriff des Stereotyps und der religiösen Typologie der Puritaner.
[35] Vgl. Rodenberg, S. 22f. Bei der oftmals gewaltsamen Auseinandersetzung der frühen Kolonisten und Siedler mit der Wildnis, vor allem mit den Indianern, als den extremen Antipoden zur christlich-abendländischen Kultur, handelt es sich nach Richard Slotkin darüber hinaus um ein bis in die Gegenwart fortwirkendes spezifisch amerikanisches Phänomen (vgl. Richard Slotkin, Regeneration Through Violence. The Mythology of the American Frontier, 1600-1860 (Middletown, Connecticut, 1973), passim).
[36] Das Massaker von Jamestown im Jahre 1622 gilt als entscheidendes historisches Ereignis, das die Fronten zwischen den Indianern und den weißen Siedlern verschärfte, womit die Epoche der Konfrontation begann. In der Literatur über Virginia trug dies darüber hinaus zur Entstehung des negativen Stereotyps des Indianers bei, denn nach 1622 verkörperten die Native Americans für die Angloamerikaner ein Hindernis, das in diabolischer Unwissenheit den Fortschritt der Zivilisation behinderte (vgl. Derounian-Stodola & Levernier, S. 58 und Brigitte Georgi, Der Indianer in der amerikanischen Literatur. Das weiße Rassenverständnis bis 1900 und die indianische Selbstdarstellung ab 1833. Versuch einer Gegenüberstellung (Köln, 1982), S. 14ff.).
[37] Vgl. Udo J. Hebel, “Those images of jealousie“. Identitäten und Alteritäten im puritanischen Neuengland des 17. Jahrhunderts (Frankfurt am Main, 1997), S. 228f.
[38] Vgl. ibid und Alfred A. Cave, “New England Puritan Misperceptions of Native American Shamanism”, International Social Science Review 67 (1992), S. 15.
[39] Vgl. Hebel, S. 230.
[40] Berkhofer betont, dass die Puritaner die Indianer lediglich als Werkzeuge Gottes angesehen haben, die entweder die zukünftige Errettung der Puritaner verhindern oder fördern konnten (vgl. Berkhofer, S. 80ff.).
[41] Bitterli betont im Zusammenhang kultureller Vorurteile, dass es generell zum Wesen der Ethnozentrik gehört, dass die moralischen Bewertungskriterien für das Fremde fast ausschließlich im Bewusstsein der eigenen Vorzüglichkeit wurzeln. Somit behaftet eine Bezeichnung wie „Wilder“ das Gegenüber der kulturellen Begegnung von vornherein auf seine Andersartigkeit, ohne dass derjenige, der es gebraucht, sich die Mühe einer Begründung machen müsste. Solche prinzipielle Voreingenommenheit kann notwendigerweise nur zu einer fatalen Diskriminierung des Fremden führen (vgl. Bitterli, S. 367). Interessant ist in diesem Kontext auch zu bemerken, dass die Verurteilung des Fremden auch stets einen Abwehrmechanismus des machtlosen Ichs gegen das Unvertraute darstellt. Aus diesem Grund kann das Andere auch als „eigenes“ Unbewusstes beziehungsweise als unbewusstes „Eigenes“ verstanden werden (siehe hierzu Kristeva, S. 199f. u. 208f.). Diese Überlegung wird auch beispielsweise durch die Tatsache nahe gelegt, dass es spätestens seit den Hexenprozessen des Jahres 1692 in Salem in den Kolonien Neuenglands zu einer merkwürdigen Verquickung der Angst vor den immer stärker dämonisierten Wilden mit hysterischen Symptomen unterdrückter und somit ebenfalls verteufelter Sexualität kam (vgl. Slotkin, Regeneration Through Violence, S. 47). Indem die Puritaner ihre unverstandenen Triebbedürfnisse rigoros ins Unbewusste verdrängten beziehungsweise auf die sie bedrohenden unheimlichen, heidnischen Indianer projizierten, konnten sie diesen auch konsequenterweise nur mit Gewalt- und Ausrottungsstrategien begegnen: „The pressure of demographic expansion, coupled with the psychological fear of acculturation, moved the Puritans toward a policy of exterminating the Indians“ (ibid, S. 42). Auf ähnliche Weise bemerkt auch Rodenberg, dass die in den repressiven puritanischen und calvinistischen Gemeinschaften unterdrückte, aber auch geschaffene Aggressivität paranoid auf die Native Americans projiziert wurde. Somit wurden die Indianer, ungeachtet der Motivation ihres wirklichen Verhaltens, als „rote Teufel“ abgestempelt. Auf diese Weise erschien die eigentlich innere Bedrohung als von außen kommend und konnte unter psychischer Entlastung von Gewissensforderungen bekämpft werden (Rodenberg, S. 347).
[42] Vgl. Rodenberg, S. 23, zitiert Cotton Mather aus: Magnalia Christi Americana; Or the Ecclesiastical History of England, 1702. Repr. 2 Bde. (New York, 1967), S. 587 u. 590.
[43] Cotton Mather, Magnalia Christi Americana; Or, The Ecclesiastical History of New-England, from the First Planting in the Year 1620 unto the Year of Our Lord, 1698. London: Parkhurst, 1702, 7: Kap. 4).
[44] Vgl. Hebel, S. 232.
[45] Ibid.
[46] Increase Mather, A Brief History of the Warr With the Indians in New-England, (1676). Slotkin/Folsom, 1978, S. 79-152.
[47] Vgl. Hebel, S. 235.
[48] Ibid.
[49] Jedoch waren sich Kritiker lange darüber uneins, ob es sich bei den captivity tales tatsächlich um eine eigene Gattung handelt. 1947 hatte Roy Harvey Pearce die captivities noch als subliterarisches Genre betrachtet. Van der Beets Untersuchungen gehen aber davon aus, dass es sich um eine eigenständige Gattung mit eigendynamischer Entwicklung handelt, die sich funktionsgeschichtlich in drei Phasen unterteilt. Die frühen captivity narratives des 17. und 18. Jahrhunderts sind demzufolge primär als religiöse Dokumente zu verstehen, die die Existenz von „Divine Providence“ zu belegen hatten. Die Gefangenschaft erhält hier einen symbolischen und typologischen Charakter. Dies wird durch den Gebrauch von Bibelzitaten und Anspielungen auf die Bibel erreicht. Denn die Puritaner haben die Gefangenschaft bei den Indianern in der Regel als Test oder Strafe Gottes verstanden, aus der sie geläutert hervorgehen können. In der Mitte des 18. Jahrhunderts, im Zuge des französisch-indianischen Krieges, wandelte sich ihre Funktion zunehmend dahin gehend, den Hass der Neuengländer auf Franzosen und Indianer zu schüren. Die Propaganda bediente sich deshalb mit Vorliebe der detaillierten Darstellung indianischer Kriegsgreul. Erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts sorgte die Expansion des kommerziellen Buch- und Zeitschriftenmarktes mit wachsenden Leserzahlen dafür, dass zunehmend auch fiktionale captivities mit melodramatisch-sensationalistischen Zügen als unterhaltsame Nationalliteratur abgesetzt wurden. Siehe Richard Van der Beets, The Indian Captivity Narrative. An American Genre (Lanham/New York/London, 1984), passim.
[50] In diesem Zusammenhang ist wichtig zu bemerken, dass die betreffenden Opfer ihre Erfahrungen meist erst niederschrieben, als sie schon längst wieder in die angloamerikanische Zivilisation zurückgekehrt waren. Dieser Aspekt ist bedeutsam, da die Zeitspanne zwischen vergangener Erfahrung und der Erinnerung daran Tatsachen verzerrt. Erfahrene Grausamkeiten konnten nämlich schlimmer erscheinen, als sie wirklich waren.
[51] Vgl. Rodenberg, S. 23. Der elementare Kulturkonflikt zwischen den Angloamerikanern und den Indianern hat in der amerikanischen Literatur prinzipiell tiefe ideologische Spuren hinterlassen. So interpretierten die Puritaner schon bald ihre Auseinandersetzungen mit den Indianern, beispielsweise im King Philip’s War, als einen wesensmäßig religiös-allegorischen Konflikt: „Looking at the culture of the New World (…) the Puritans saw a darkened and inverted mirror image of their own culture, their own mind. For every Puritan institution, moral theory and practice, belief and ritual there existed an antithetical Indian counterpart. Such analogies were never lost on the Puritans, who saw in them metaphors of God’s will” (Slotkin, Regeneration Through Violence, S. 57). Hierbei wurde die physische Wildnis und die von ihr ausgehende Gefahr vor allem auch als moralische Bedrohung von innen verstanden (vgl. ibid, S. 57-94).
[52] Lutz betont jedoch, dass die von Mather nur knapp wiedergegebene captivity tale der Hannah Dustan als Gefangenschaftsbericht einen sehr nachhaltigen Einfluss auf die amerikanische Literatur ausgeübt hat (Lutz, S. 140). So erklärt auch Leslie A. Fiedler Hannah Dustan neben Pocahontas zur zweiten großen „archetypischen“ Frauengestalt der frontier literature (Fiedler, S. 98-108 et passim). Die Geschichte der Hannah Dustan zeigt, dass nach puritanischer Auffassung göttliche Vorsehung und Gnade auch im Spiel sind, wenn die Puritaner Indianer töten. Die captivity narrative der Hannah Dustan verdeutlicht zudem, wie eng puritanisch-religiöse Selbstgerechtigkeit, Erwerbssinn und Skrupellosigkeit miteinander verbunden sein können.
[53] Es sind ungefähr 600 captivity narratives erhalten, davon stammen zwei Drittel von Frauen. Jungfrauen oder junge Mütter erscheinen hierbei als ideale Gefangene, da sie wehrlos und bemitleidenswert sind. Denn auf diese Weise konnte die Landnahme durch pazifistische Darstellung legitimiert werden. Zahlreiche captivities finden sich in Cotton Mathers Magnalia Christi Americana. Jedoch sind captivities auch in fast alle anderen Chroniken, die ab der Zeit des Pequot Krieges (1637) erschienen, zu finden.
[54] Vgl. Van der Beets, The Indian Captivity Narrative, S. 39-50.
[55] Aus Leila Wardwell, Hrsg., American Historical Images On File. The Native American Experience (New York/Oxford, 1991), 1.57.
[56] Siehe hierzu Richard Van der Beets, “The Indian Captivity Narrative as Ritual“, American Literature, 43 (1971/72), S. 550-553; vgl. auch ders. The Indian Captivity Narrative, S. 39-50.
[57] Georgi hebt hervor, dass Gefangenschaftsberichte mit Cotton Mathers Magnalia Christi Americana zunehmend zu einem Instrument des Rassenhasses wurden. Hierbei nahm das Bild des Indianers als barbarische Kreatur ihre extremste Form an, indem mit den Gefühlen der Leser gespielt wurde. Angesichts des dargestellten teuflischen Charakters der Indianer, mit dem die Gefangenen konfrontiert waren, konnte das Stereotyp nur äußerst negativ ausfallen (vgl. Georgi, S. 17f. Siehe hierzu auch Derounian-Stodola & Levernier, S. 85 und Hermann, S. 95f.).
[58] Hochbruck, S. 78.
[59] Der Begriff „Stereotyp” geht auf die Erfindung des französischen Druckers Didot zurück, der im Jahre 1796 einzelne Buchstaben zu einer Druckplatte zusammenfügte und auf diese Weise ganze Zeilen und Seiten aus einem Stück gießen konnte (vgl. Hort, S. 14).
[60] Vgl. ibid, S. 32.
[61] Siehe ibid, S. 9.
[62] Walter Lippmann, Public Opinion, 1922 (New Brunswick, N.J., 1991).
[63] Hort, S. 14.
[64] Ibid, S. 21; Hervorhebung SP.
[65] Alfred Schütz & Thomas Luckmann, Strukturen der Lebenswelt (Neuwied, Darmstadt, 1975), S. 26.
[66] Hort, S. 28 zitiert aus Robert F. Merton, 1968, S. 247-305.
[67] Hort, S. 31.
[68] Ibid, S. 9.
[69] Israel Potter stammt aus dem Jahre 1855. Die Zeit zwischen 1820 und 1860 wird von Literaturhistorikern gewöhnlich als die Zeit der amerikanischen Romantik angesehen. In Nordamerika erhielt die Romantik später Einzug in die Literatur und in die Künste als in Europa. Die Zeit der amerikanischen Romantik wird auch als „American Renaissance“ bezeichnet. Dieser Ausdruck stammt aus F.O. Matthiessens Werk American Renaissance: Art and Expression in the Age of Emerson and Whitman von 1941. Allerdings ist der Ausdruck „American Renaissance“ irreführend, da es sich nicht um eine Wiedergeburt, sondern vielmehr, wie Matthiessen bemerkt, um „the first maturity“ der nordamerikanischen Literatur handelt. Siehe F.O. Matthiessen, American Renaissance: Art and Expression in the Age of Emerson and Whitman (New York, 1941).
[70] Zitiert nach Ursula Brumm, Die religiöse Typologie im amerikanischen Denken, S. 16; Hervorhebung SP.
[71] Michael Buchberger, Hrsg., Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 10 (Freiburg, 1938), S. 345f.
[72] Brumm, Die religiöse Typologie im amerikanischen Denken, S. 19.
[73] Zur Typologie der Puritaner siehe vor allem ibid, passim.
[74] Ibid, S. 42.
[75] William Bradford, Of Plymouth Plantation, 1630-1650 (Boston, 1928).
[76] Ibid, S. 94.
[77] Ibid, S. 95f. Siehe hierzu auch allgemein Sacvan Bercovitch, The Puritan Origins of the American Self (New Haven/London, 1975), passim.
[78] Brumm, Die religiöse Typologie im amerikanischen Denken, S. 46.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2007
- ISBN (Paperback)
- 9783836602273
- ISBN (eBook)
- 9783956362163
- Dateigröße
- 2.7 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Hamburg – Fachbereich Sprach-, Literatur- und Medienwissenschaft, Amerikanistik
- Erscheinungsdatum
- 2007 (März)
- Note
- 3,0
- Schlagworte
- kolonialismus kulturbegegnung indianer-stereotyp lederstrumpf-romane literatur
- Produktsicherheit
- Diplom.de