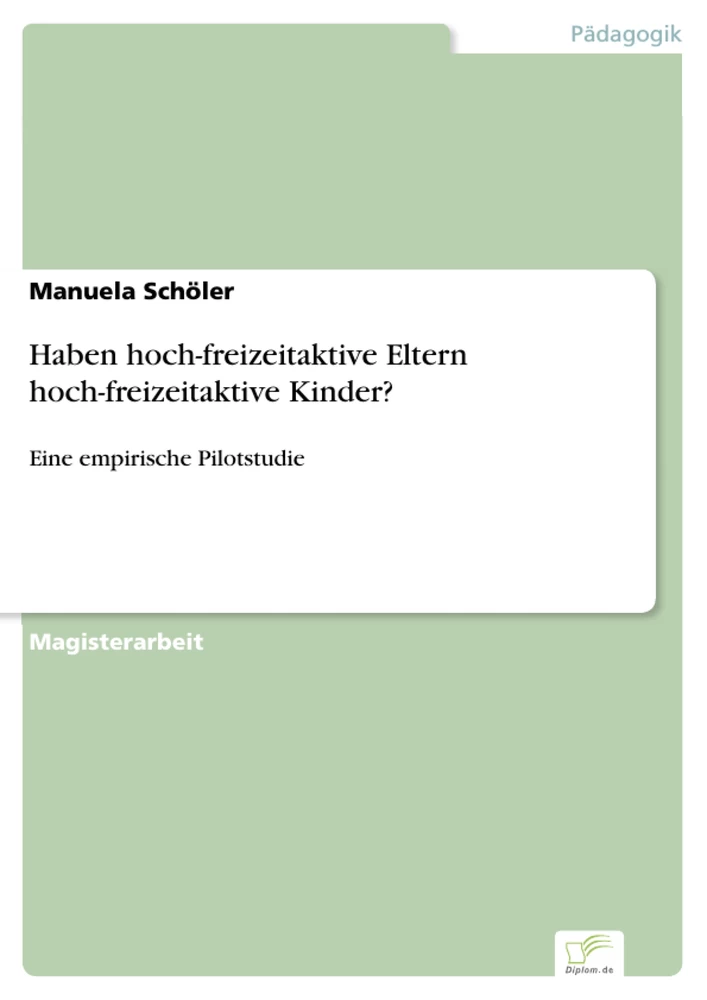Haben hoch-freizeitaktive Eltern hoch-freizeitaktive Kinder?
Eine empirische Pilotstudie
Zusammenfassung
Hauptgegenstand dieser im freizeitpädagogischen Bereich anzusiedelnden Arbeit ist die Frage nach dem elterlichen Einfluss auf die Entwicklung ihrer Kinder bezüglich deren Interesses an Freizeitaktivitäten und ihrer praktischen Ausübung. Die Fragestellung der Arbeit (Haben hoch- freizeitaktive Eltern hoch- freizeitaktive Kinder?), die eigentlich nur mit ja oder nein zu beantworten wäre, wirft die Frage nach den Gründen dafür auf: Spielen die Einstellung und die eigene Freizeitaktivität der Eltern eine Rolle? Welchen Einfluss haben die Umgebung und der Grad der Anregung in Bezug auf Freizeitaktivitäten auf das Freizeitverhalten des Kindes?
Im Blickpunkt von zahlreichen Untersuchungen der traditionellen Familienforschung steht die Frage, warum sich Kinder in bestimmte Richtungen entwickeln und inwieweit die Erziehung und das Verhalten der Eltern diesen Vorgang beeinflussen. Es wird nach Vorhersagemöglichkeiten gesucht, die ein verlässliches Maß an Richtigkeit besitzen, um Aussagen über mögliche kindliche Entwicklungstendenzen basierend auf elterlichen Einflussgrößen machen zu können.
Im Vergleich zu derartigen Untersuchungen erfolgen bei dieser Arbeit zwei wichtige Eingrenzungen: Die thematischen Schwerpunkte liegen im Hinblick auf den Hauptgegenstand zum einen auf der Bedeutung der Eltern und ihrer Aktivität in der Freizeit hinsichtlich ihres Einflusses auf die Freizeitaktivität ihrer Kinder und zum anderen auf der Freizeitaktivität der Kinder selbst.
Trotz dieser Eingrenzungen bedarf es der Berücksichtigung der Familienforschung mit ihren Theorien und Modellen, die die elterlichen Einflussfaktoren auf ihre Kinder in Erziehungs- und Sozialisationsprozessen zu erläutern versuchen. Aus ihnen können die eigenen theoretischen Begründungen von Zielen, Planungsaspekten, Durchführungsmethoden und Ausführungskriterien abgeleitet werden.
Aufgrund der thematischen Eingrenzung auf die Rolle und Funktion der Eltern im Erziehungs- und Sozialisationsprozess auf den Bereich der Freizeit ist eine spezielle Darstellung sowohl der Familiensituation als auch des Freizeitbegriffes, auch in historischer Perspektive, notwendig.
Im ersten Kapitel werden daher die Problemfelder Familie, Freizeit und Sozialisation unter Berücksichtigung verschiedener Sozialisationsmodelle behandelt, auf deren Grundlage ein Modell zur familialen Freizeitaktivität entwickelt wird. Voraussetzung für das Modell ist, dass es für eine empirische […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
INHALTSVERZEICHNIS
1. EINLEITUNG
2. THEORETISCHER RAHMEN
2.1 Einordnung der Fragestellung
2.2 Familie
2.2.1 Definitionen von „Familie“
2.2.2 Entwicklung und Wandel der Familie
2.2.2.1 Von der Haushaltsfamilie in der vorindustriellen Gesellschaft bis zur Familie der Gegenwart
2.2.2.2 Die heutige Entwicklung
2.2.3 Funktionen der Familie
2.2.3.1 Hauptfunktionen der Familie heutzutage
2.2.3.2 Zur These vom Funktionsverlust der Familie
2.3 Freizeit
2.3.1 Entwicklung der Freizeit
2.3.2 Annäherung an den Begriff
2.3.2.1 Die Entwicklung des Freizeitverständnisses
2.3.2.2 Begriffsbestimmung
2.4 Familie und Freizeit
2.4.1 Familiales Freizeitverhalten
2.4.2 Untersuchungen zum Thema „Familiales Freizeitverhalten“
2.5 Sozialisationstheoretischer Hintergrund
2.5.1 Sozialisation- Definitionen und Konzepte
2.5.2 Sozialisationsforschung
2.5.3 Familiale Sozialisation
2.6 Sozialisation im Modell
2.6.1 Modell des produktiv Realität verarbeitenden Subjektes
2.6.2 Theoretisches Rahmenkonzept der Sozialisation
2.6.3 Das Sozialisationsmodell zur Freizeitaktivität
2.7 Herleitung der Hypothesen aus der Theorie
3. METHODE
3.1 Untersuchungsplan
3.2 Versuchspersonen
3.3 Operationalisierung der Modellkomponenten
3.3.1 Familienlage
3.3.2 Familienorientierung
3.3.3 Anregung und Ausnutzung
3.4 Weitere Fragestellungen zum Thema „Freizeit“
3.4.1 Wunsch nach mehr gemeinsam verbrachter Freizeit mit dem/n Kind/ern
3.4.2 Kinder in der Nachbarschaft
3.5 Der Fragebogen
3.6 Gütekriterien
3.6.1 Objektivität
3.6.2 Reliabilität
3.7 Inhaltliche und statistische Hypothesen
4. ERGEBNISSE
4.1 Deskriptive Statistik
4.1.1 Die Untersuchungsgruppe
4.1.2 Die Modellkomponenten im Ergebnis
4.1.2.1 Lage
4.1.2.2 Orientierung
4.1.2.3 Anregung und Ausnutzung
4.1.3 Weitere Fragestellungen zum Thema „Freizeit“
4.1.3.1 Wunsch nach mehr gemeinsam verbrachter Freizeit mit dem/n Kind/ern
4.1.3.2 Kinder in der Nachbarschaft
4.2 Schließende Statistik
4.2.1 Varianzanalysen
4.2.1.1 Orientierung
4.2.1.2 Anregung
4.2.1.3 Ausnutzung
4.3 Modellprüfung
4.3.1 Regressionsanalyse
5. DISKUSSION
5.1 Diskussion der deskriptiven Befunde
5.1.1 Die Fragestellung der Arbeit
5.1.2 Die aus der Theorie abgeleiteten Hypothesen
5.2 Diskussion der Befunde der schließenden Statistik
5.2.1 Diskussion der Ergebnisse der Varianzanalyse
5.2.2 Kritische Betrachtung des Modells
5.2.3 Diskussion des Gesamtmodells
ZUSAMMENFASSUNG
LITERATURVERZEICHNIS
ANHANG A DER FRAGEBOGEN
ANHANG B Sortierte Items zu den Modellkomponenten Anregung und Ausnutzung
ANHANG C Indexbildung zur Modellkomponente Lage
TABELLENVERZEICHNIS
Tabelle 1: Systemebenen nach Witte (1994)
Tabelle 2: Themenblöcke und Komponenten des Sozialisationsmodells im Fragebogen
Tabelle 3: Cronbach- Alpha- Koeffizient zur Bestimmung der internen Konsistenz im Zusammenhang mit den Modellkomponenten
Tabelle 4: Zweifaktoriell rotierte Komponentenmatrix für die Anregungs- und Ausnutzungsitems
Tabelle 5: Mittelwerte (M) und Standardabweichungen (SD) der Indizes der einzelnen Indikatoren und des Gesamtindexes, aufgeteilt nach Gruppen der nicht- freizeitaktiven, mäßig- freizeitaktiven und hoch- freizeitaktiven Elternteile
Tabelle 6: Prozentuale Häufigkeiten, Mittelwerte (M) und Standardabweichungen (SD) in den Einstellungsvariablen zu dem Begriff Freizeit für die Gesamtgruppe
Tabelle 7: Prozentuale Häufigkeiten, Mittelwerte (M) und Standartabweichungen (SD) in den Einstellungsvariablen zur Bedeutung der Freizeit für die Kinder für die Gesamtgruppe
Tabelle 8: Prozentuale Häufigkeiten, Mittelwerte (M) und Standardabweichungen (SD) in den Einstellungsvariablen bezüglich des Gesprächsthemas Freizeitaktivitäten
Tabelle 9: Mittelwerte (M) und Standartabweichungen (SD) der Komponente „Orientierung“ für die drei Gruppen der nicht- freizeitaktiven, mäßig- freizeitaktiven und hoch- freizeitaktiven Elternteile
Tabelle 10: Mittelwerte (M) und Standardabweichungen (SD) der Anregungsvariable aufgeteilt in die drei Gruppen der hoch- freizeitaktiven, mäßig- freizeitaktiven und nicht- freizeitaktiven Elternteile
Tabelle 11: Mittelwerte (M) und Standardabweichungen (SD) der Ausnutzungsvariable aufgeteilt in die drei Gruppen der hoch- freizeitaktiven, mäßig- freizeitaktiven und nicht- freizeitaktiven Elternteile
Tabelle 12: Freizeitaktivitäten in Vereinen und Organisationen des ersten und des zweiten Kindes
Tabelle 13: Mittelwerte (M) und Standardabweichungen (SD) der Aktivitäten außerhalb von Vereinen und Organisationen des ersten und zweiten Kindes
Tabelle 14: Mittelwerte (M) und Standardabweichungen (SD) der Aktivitäten außerhalb von Vereinen und Organisationen des ersten Kindes aufgeteilt nach den drei Gruppen der nicht- freizeitaktiven, mäßig- freizeitaktiven und hoch- freizeitaktiven Kinder
Tabelle 15: Mittelwerte (M) und Standardabweichungen (SD) der Aktivitäten außerhalb von Vereinen und Organisationen des zweiten Kindes aufgeteilt nach den drei Gruppen der nicht- freizeitaktiven, mäßig- freizeitaktiven und hoch- freizeitaktiven Kinder
Tabelle 16: Prozentuale Häufigkeitsverteilungen der Freizeitaktivität in Vereinen und Organisationen aufgeteilt in die drei Gruppen für das erste Kind
Tabelle 17: Prozentuale Häufigkeitsverteilungen der Freizeitaktivität in Vereinen und Organisationen aufgeteilt in die drei Gruppen für das zweite Kind
Tabelle 18: Prozentuale Häufigkeiten der Variable „Wunsch nach mehr gemeinsam verbrachter Freizeit mit den Kindern“ aufgeteilt in die drei Gruppen der nicht- freizeitaktiven, mäßig- freizeitaktiven und hoch- freizeitaktiven Elternteile
Tabelle 19: Häufigkeitsverteilungen für das erste Kind bezüglich der Frage, ob die Kinder Zeit mit den Nachbarskindern verbringen, unterteilt nach den drei Gruppen der nicht- freizeitaktiven, mäßig- freizeitaktiven und hoch- freizeitaktiven Kinder
Tabelle 20: Häufigkeitsverteilungen für das zweite Kind bezüglich der Frage, ob die Kinder Zeit mit den Nachbarskindern verbringen, unterteilt nach den drei Gruppen der nicht- freizeitaktiven, mäßig- freizeitaktiven und hoch- freizeitaktiven Kinder
Tabelle 21: Ergebnisse der Varianzanalyse für die Variable „Orientierung“ mit den dazugehörigen Mittelwerten (M) und Standardabweichungen (SD) der drei Gruppen der nicht- freizeitaktiven, mäßig- freizeitaktiven und hoch- freizeitaktiven Elternteile
Tabelle 22: Ergebnisse der Varianzanalyse für die Variable „Anregung“ mit den dazugehörigen Mittelwerten (M) und Standardabweichungen (SD) der drei Gruppen der nicht- freizeitaktiven, mäßig- freizeitaktiven und hoch- freizeitaktiven Elternteile
Tabelle 23: Ergebnisse der Varianzanalyse für die Variable „Ausnutzung“ mit den dazugehörigen Mittelwerten (M) und Standardabweichungen (SD) der drei Gruppen der nicht- freizeitaktiven, mäßig- freizeitaktiven und hoch- freizeitaktiven Elternteile
Tabelle 24: Standardisierte Regressionskoeffizienten der vier Modellkomponenten für das erste und zweite Kind
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Abbildung 1: Graphische Darstellung des theoretischen Rahmenkonzeptes der Sozialisation von Witte (1994)
Abbildung 2: Modell der familialen Sozialisation zur Freizeitaktivität in Vereinen und Organisationen
1. EINLEITUNG
Hauptgegenstand dieser im freizeitpädagogischen Bereich anzusiedelnden Arbeit ist die Frage nach dem elterlichen Einfluss auf die Entwicklung ihrer Kinder bezüglich deren Interesses an Freizeitaktivitäten und ihrer praktischen Ausübung. Die Fragestellung der Arbeit („Haben hoch- freizeitaktive Eltern hoch- freizeitaktive Kinder?“), die eigentlich nur mit „ja“ oder „nein“ zu beantworten wäre, wirft die Frage nach den Gründen dafür auf: Spielen die Einstellung und die eigene Freizeitaktivität der Eltern eine Rolle? Welchen Einfluss haben die Umgebung und der Grad der Anregung in Bezug auf Freizeitaktivitäten auf das Freizeitverhalten des Kindes?
Im Blickpunkt von zahlreichen Untersuchungen der traditionellen Familienforschung steht die Frage, warum sich Kinder in bestimmte Richtungen entwickeln und inwieweit die Erziehung und das Verhalten der Eltern diesen Vorgang beeinflussen. Es wird nach Vorhersagemöglichkeiten gesucht, die ein verlässliches Maß an Richtigkeit besitzen, um Aussagen über mögliche kindliche Entwicklungstendenzen basierend auf elterlichen Einflussgrößen machen zu können.
Im Vergleich zu derartigen Untersuchungen erfolgen bei dieser Arbeit zwei wichtige Eingrenzungen: Die thematischen Schwerpunkte liegen im Hinblick auf den Hauptgegenstand zum einen auf der Bedeutung der Eltern und ihrer Aktivität in der Freizeit hinsichtlich ihres Einflusses auf die Freizeitaktivität ihrer Kinder und zum anderen auf der Freizeitaktivität der Kinder selbst.
Trotz dieser Eingrenzungen bedarf es der Berücksichtigung der Familienforschung mit ihren Theorien und Modellen, die die elterlichen Einflussfaktoren auf ihre Kinder in Erziehungs- und Sozialisationsprozessen zu erläutern versuchen. Aus ihnen können die eigenen theoretischen Begründungen von Zielen, Planungsaspekten, Durchführungsmethoden und Ausführungskriterien abgeleitet werden.
Aufgrund der thematischen Eingrenzung auf die Rolle und Funktion der Eltern im Erziehungs- und Sozialisationsprozess auf den Bereich der Freizeit ist eine spezielle Darstellung sowohl der Familiensituation als auch des Freizeitbegriffes, auch in historischer Perspektive, notwendig.
Im ersten Kapitel werden daher die Problemfelder „Familie“, „Freizeit“ und „Sozialisation“ unter Berücksichtigung verschiedener Sozialisationsmodelle behandelt, auf deren Grundlage ein Modell zur familialen Freizeitaktivität entwickelt wird. Voraussetzung für das Modell ist, dass es für eine empirische Untersuchung operationalisierbar ist. Es werden daraus Arbeitshypothesen abgeleitet, die eine Zielorientierung für die empirische Untersuchung darstellen.
Im zweiten Kapitel erfolgen die methodischen Vorüberlegungen zur Entwicklung des Fragebogens, durch den die relevanten Daten zum Themenkomplex „Elterliche Einflussfaktoren für die Freizeitaktivität ihrer Kinder“ ermittelt werden können. Es wird daher auf die Versuchspersonen, die Operationalisierung der Modellkomponenten und die Erarbeitung und Gliederung von Fragen zur Datenerhebung eingegangen. Nach Überprüfung des Fragebogens anhand der Gütekriterien endet das Kapitel mit der Formulierung statistischer und inhaltlicher Hypothesen.
Das dritte Kapitel stellt die Ergebnisse der Erhebung unter Berücksichtigung verschiedener Analysemethoden dar.
Abschließend werden im vierten Kapitel die statistischen Ergebnisse im Hinblick auf die Fragestellung der Arbeit diskutiert und bezüglich der Bestätigung oder der Nichtbestätigung der verschiedenen Arbeitshypothesen zusammengefasst, bevor eine kritische Betrachtung des angewandten Modells stattfindet.
Im Anhang befinden sich neben zwei Übersichten zur „Freizeitbezogenen Operationalisierung der Modellkomponenten „Anregung“ und „Ausnutzung““ und zur „Indexbildung zur Modellkomponente Lage“ der für die Datenerhebung entwickelte Fragebogen.
2. THEORETISCHER RAHMEN
2.1 Einordnung der Fragestellung
Die Fragestellung dieser Arbeit lässt sich in den Bereich der Freizeitpädagogik einordnen.
Die Pädagogik oder Erziehungswissenschaft im Allgemeinen umfasst sowohl das erzieherische Handeln mit seinen Wertvorstellungen, Zielen, Techniken, handelnden Personen, geschichtlichen Grundlagen und institutionell- organisatorischen Rahmen als auch die Theorie der Erziehung (vgl. Böhm, 2000, S. 404).
Für die Pädagogik als Wissenschaft der Erziehung ergeben sich nach Schaub & Zenke (2000) vier Aufgabenbereiche:
1. die Beschreibung von Erziehungs-, Unterrichts- und Ausbildungsprozessen in Gegenwart und Vergangenheit
2. die Interpretation der erzieherischen Programme und Theorien im Hinblick auf ihre weltanschaulichen, wissenschaftlichen, politischen und sozialen Bedingungen
3. die Erklärung der organisatorischen und der zwischenmenschlichen Gestaltung von Erziehungsprozessen und der beobachtbaren erzieherischen Wirkung
4. die Klärung der pädagogischen Grundbegriffe und bildungstheoretischen Analyse der Entwicklungen der Gesellschaft
Die Fragestellung ist in den dritten Bereich einzuordnen, da die Wirkung der elterlichen Erziehung auf ihre Kinder untersucht werden soll.
Erziehung lässt sich wie folgt definieren:
„ Ganz allg. wird man E. als jene Maßnahmen und Prozesse bezeichnen können, die den Menschen zu Autonomie und Mündigkeit hinleiten und ihm helfen, alle seine Kräfte und Möglichkeiten zu aktuieren und in seine Menschlichkeit hineinzufinden.“ (Böhm, 2000, S. 157)
Das Wesen des Menschen wird dabei auf der individuellen, sozialen, kulturellen und metaphysischen Ebene angesprochen. Demnach kann Erziehung entweder als Wachstum und Entwicklung, als Eingliederung in die Kultur und Gesellschaft (Sozialisation, Entkulturation), als Einführung in die Gesellschaft oder als personale Erweckung und Begegnung verstanden werden (vgl. Böhm, 2000, S. 157).
Für diese Arbeit ist die gesellschaftlich- kulturelle Eingliederung von Bedeutung. Es steht die Sozialisation, die soziale Prägung des Menschen durch die Umwelt, im Vordergrund.
Mit Umwelt sind in diesem Fall die Eltern gemeint, die ihren Kindern in den verschiedensten Bereichen bestimmte Werte, Normen und Regeln vermitteln und sie somit prägen. Es wird im Speziellen auf den Bereich der Freizeit und Freizeitaktivitäten eingegangen.
Demnach lässt sich die Fragestellung in die Freizeitpädagogik einordnen, da diese als Teilbereich der Pädagogik angesehen wird, „der seinen Aufgabenbereich aus dem Handlungs- und Problemfeld Freizeit ableitet“ (Deutsche Gesellschaft für Freizeit, 1986, S. 111). Die vier erwähnten Aufgabenbereiche der Pädagogik lassen sich dabei auf den Bereich Freizeit übertragen.
Die Freizeitpädagogik muss aufgrund des großen Problemfeldes viele unterschiedliche Wissenschaftsdisziplinen integrieren und sich ihrer Ergebnisse bedienen. Daher werden in dieser Arbeit auch soziologische und psychologische Aspekte zur Sprache kommen.
2.2 Familie
In diesem Teil der Arbeit soll ein Überblick über die verschiedenen Definitionsmöglichkeiten des Begriffes „Familie“ gegeben werden, bevor auf ihre geschichtliche Entwicklung und den damit verbundenen Wandel bis in die heutige Zeit eingegangen wird. Am Ende werden die Funktionen der Familie und die These zum Funktionsverlust der Familie erläutert.
2.2.1 Definitionen von „Familie“
Um sich dem Begriff „Familie“ zu nähern, ist ein Blick in eine Enzyklopädie sinnvoll.
Im Brockhaus (1997) findet man folgende Definition:
„Familie [zu lat. Famulus; urspr. „Dienerschaft“, „Gesinde“, „Hausgenossenschaft“] die, -/-n, (seit dem 16., endgültig seit dem 18. Jh.) die (Lebens-)Gemeinschaft der Eltern und ihrer unselbständigen Kinder, i. w. S. auch einschließlich der Verwandtschaft; vor dem 16. Jh., v. a. in ländl. Bereichen bes. Mitteleuropas, auch die Hausgenossenschaft einschließlich des ledigen Gesindes (aufzählend „[Mann], Weib und Kind“ bzw. „Haus“, lat. „familia“ genannt)…“ (Brockhaus, 1997, S. 95 ff.)
Als Funktionen der Familie werden im Brockhaus die Fortpflanzung und Aufzucht der Nachkommen, die arbeitsteilige Produktion, die Versorgung und Sozialisation ihrer Mitglieder sowie deren Platzierung im sozialen Gefüge genannt.
Aus pädagogischer Sicht definiert Böhm (2000) den Begriff „Familie“ folgendermaßen:
„F. ist die überall verbreitete, staatl. legalisierte und gesellschaftl. geschützte (in Dtl. Gemäß Art. 6 GG) normale Form des geregelten Zusammenlebens der Generationen und Geschlechter.“ (Böhm, 2000, S. 168)
Sie ist durch die Institution der Ehe begründet, die sich durch „große hist. Variabilität, strukturelle Vielfalt und funktionalem Reichtum in Abhängigkeit zu „äußeren“ gesellschaftl. Bedürfnissen, Anforderungen und Wandlungen“ (Böhm, 2000, S. 168) auszeichnet. An der Nahtstelle zwischen Individuum und Gesellschaft kann sie als die lebensgeschichtlich bedeutendste Primärgruppe gesehen werden, die durch starke Emotionalität und Intimität der Beziehungen gekennzeichnet ist. Die Familie begleitet den Heranwachsenden von seiner frühesten Kindheit bis zur Ablösung vom Elternhaus. Er erhält in ihr Pflege, Fürsorge, Betreuung sowie Erziehung und neben materieller Versorgung vor allem Überschaubarkeit, Konstanz und Stabilität des sozialen Lebens. Außerdem bietet die Familie dem Heranwachsenden affektive Zuwendung und sensorische Anregung und macht ihn gesellschaftsfähig (vgl. Böhm, 2000, S. 168).
Bei der Erziehung in der Familie wird nach Böhm (2000) nicht explizit „pädagogisch“ gehandelt. Diese vollzieht sich eher spontan, intuitiv oder willkürlich und wird über den Umgang, die Gewohnheit, die Improvisation und die Atmosphäre vermittelt. Eltern handeln in der Regel nach eigenen Erfahrungen und Informationen. Die Ausprägung eines bestimmten Sozialcharakters, die Lern- und Leistungsmotivation, sowie der spätere Schulerfolg des Kindes werden durch Art, Ausmaß und Anlass der innerfamiliaren Kommunikation und Interaktion bestimmt. Die Berufstätigkeit und Arbeitsplatzerfahrung der Eltern, das Einkommen, die Geschwisterzahl, die Weltanschauung, die Zukunftsperspektiven oder die Konsumgewohnheiten sind weitere Einfluss nehmende und prägende Faktoren.
Für den Familienpsychologen Schneewind (1999) besteht das grundlegende Merkmal einer Familie darin, dass ihre Mitglieder einen großen Teil ihres Lebens gemeinschaftlich verbringen. Durch Art, Dauer und Intensität des gemeinschaftlichen Lebensvollzuges entstehen Bindungen, die die Personen und ihre Beziehungen zueinander beeinflussen. Die im Vordergrund stehende Bedeutung von „Familie“ beeinflusst die Art der Bindungen.
Nach Karpel & Strauss (1983) lassen sich folgende Bedeutungsvarianten von Familie unterscheiden:
Die funktionale Familie zeichnet sich durch die Art und Weise aus, wie sie im täglichen Zusammenleben die praktischen Anforderungen des Lebens meistert, z.B. Haushaltsführung oder Freizeitgestaltung der Kinder. Es kann auch in der funktionalen Familie zu dysfunktionalen, d.h. gestörten, Entwicklungen kommen. Dies ist unter anderem der Fall, wenn Basisbedürfnisse der einzelnen Familienmitglieder wie Nahrung oder Schutz nicht befriedigt werden.
In der rechtlichen Familie werden Bindungen vor allem durch die Normen des Rechtssystems definiert. Bindungen entstehen durch Unterhalts- und Erziehungspflichten, die Adoptiveltern bei der Annahme von nicht- leiblichen Kindern eingehen. Das gleiche gilt für Unterhalts- und Sorgerechtsregelungen bei einer Scheidung. Die Bindungen bleiben in diesem Fall durch Zahlungsverpflichtungen bestehen.
Bei der Familie „wie sie von ihren Mitgliedern gesehen wird“ bezieht sich die Bindung auf die subjektive Wahrnehmung der einzelnen Familienmitglieder. Vom „schwarzen Schaf der Familie“ bis zum „verlorenen Sohn“ werden persönliche Abgrenzungen gemacht, die zwischen den einzelnen Familienmitgliedern variieren können oder geteilt werden.
Kennzeichen der Familie mit langfristigen Verpflichtungen ist das hohe Maß an Erwartungen bezüglich der Dauerhaftigkeit und Stabilität der wechselnden Bindungen, das beispielsweise durch das Eheversprechen „bis dass der Tod Euch scheidet“ ausgedrückt wird. Wirklich langfristige Bindungen beruhen nicht auf Versprechen, sondern darauf, dass gemeinsam erlebte Erfolge und Krisen bewältigt werden.
Die Bindung in der biologischen Familie ist in der Blutsverwandtschaft begründet. Sie stellt die Einflussquelle des individuellen Verhaltens dar und ist ein wichtiger Bestandteil der Identitätsbestimmung des Einzelnen.
Die traditionelle Familie ist legale, biologische und funktionale Familie zugleich. Die Familienmitglieder nehmen sich als zur Familie zugehörig wahr und sind in einen Lebensrahmen mit langfristigem Verpflichtungscharakter eingebunden. Bei alternativen familiären Lebensformen wie nichtehelichen Gemeinschaften oder Ein- Eltern- Haushalte fehlt mindestens eines der Bedeutungs- und Bindungscharakteristika. Diese Tatsache kann aber nicht als Defizit gesehen werden.
Ein wichtiger Aspekt der Familienbedeutungs- und Bindungsformen von Karpel & Strauss (1983) besteht darin, dass es für die Familienmitglieder unterschiedlich schwer ist, ihre Mitgliedschaft zu ändern. Von einer funktionalen Familie wie beispielsweise einer Wohngemeinschaft, bei der es um die Aufteilung der alltäglichen Haushaltsaufgaben geht, kann sich der Einzelne leicht trennen. Für die biologische Familie hingegen gilt, dass man sich ihrer Mitgliedschaft aufgrund der Blutsverwandtschaft nicht entziehen kann.
Bindungen können von außen zugeschrieben werden (legale Familie) oder durch unterschiedlich tief greifende Formen von Gemeinschaftlichkeit (funktionale, wahrgenommene oder mit langfristigem Verpflichtungscharakter gekennzeichnete Familien) von jedem Einzelnen erfahren werden.
In der Soziologie gibt es laut Nave- Herz (2002a) keine allgemein anerkannte Definition des Familienbegriffes. Bei der Umschreibung wird entweder die gesamtgesellschaftliche Bedeutung der Familie oder ihr Gruppencharakter betont.
Aus makrosoziologischer Sicht ist die Familie eine soziale Institution. Sie wird demnach als öffentlich- anerkannte Einrichtung angesehen, die bestimmte gesellschaftliche Leistungen, vor allem die „Reproduktion der menschlichen Charaktere“ (Horkheimer, 1936), zu erbringen hat.
Die mikrosoziologische Perspektive beschreibt die Familie als „eine Gruppe, in der ein Ehepaar mit seinen direkten Nachkommen zusammenlebt“ (Nave- Herz, 2002a, S. 148). Diese Definition verweist verstärkt auf die biologische Dimension von Familie, die bei einer Adoption beispielsweise nicht gegeben ist.
Unter Berücksichtigung der Makro- und Mikroebene unterscheidet sich das System „Familie“ von anderen sozialen Systemen durch ihre „biologisch- soziale Doppelnatur“ (König, 1976). Damit sind sowohl die Übernahme von Reproduktions- und Sozialfunktionen als auch andere gesellschaftliche Funktionen, die kulturell variabel sind, gemeint. Weitere Kriterien sind die Generationsdifferenzierung, die bestimmte Rollenstruktur (Mutter, Vater, Tochter, Sohn, Enkel, Schwester, u.s.w.) und das spezifische Kooperations- und Solidaritätsverhältnis zwischen ihren Mitgliedern.
Man unterscheidet zwischen der Kernfamilie (nuclear family= Zwei- Generationen, Vater- Mutter- Kind) und der Mehr- Generationen- Familie sowie der erweiterten Familie (extended family). Die erweiterte Familie besteht entweder aus mehreren Kernfamilien der gleichen Generation, z.B. zusammenlebende Familien, der Kernfamilie mit einzelnen Seitenverwandten oder der Kernfamilie mit Mehrfach- Besetzung der Ehepartner- Rolle (Polygamie) (vgl. Nave- Herz, 2002a, S. 148 f.).
Die Definitionen aus den verschiedenen Wissenschaftsbereichen zeigen, wie vielfältig die Beschreibungen des Begriffes „Familie“ sein können. Während der Brockhaus (1997) die Herkunft des Begriffes „Familie“ und ihre Funktionen hervorhebt, stehen für Böhm (2000) aus pädagogischer Sicht die erzieherischen Aspekte im Vordergrund. Der Familienpsychologe Schneewindt (1999) hingegen legt bei seinen Erläuterungen den Schwerpunkt auf die Beziehungen und Bindungen, die in einer Familie entstehen. In der Soziologie werden nach Nave- Herz (2002a) die gesamtgesellschaftliche Bedeutung und der Gruppencharakter der Familie hervorgehoben.
In dieser Arbeit soll die Familie als bedeutendste Primärgruppe für den Heranwachsenden gesehen werden, in der er neben Fürsorge und Erziehung durch die innerfamiliale Kommunikation und Interaktion beeinflusst und geprägt wird. Es wird der oben erwähnten pädagogischen Definition gefolgt, die die Familie in diesem Zusammenhang beschreibt.
2.2.2 Entwicklung und Wandel der Familie
2.2.2.1 Von der Haushaltsfamilie in der vorindustriellen Gesellschaft bis zur Familie der Gegenwart
Die vorindustrielle Gesellschaft war ein Wirtschafts- und Sozialsystem, das in den westlichen und mittleren Teilen Europas bis in das 19. Jahrhundert bestand. Für 90% der Bevölkerung stellte sie eine kleine Welt von Dörfern, Marktgenossenschaften und Gutshöfen dar, die durch einfache landwirtschaftliche und handwerkliche Wirtschaftsweise geprägt, politisch und geistig durch relativ autoritäre Herrschaftsformen bestimmt und vom Mangel an räumlicher und gesellschaftlicher Mobilität gekennzeichnet war.
Arbeitsteilung und großflächiger Handel waren schwach entwickelt, so dass die Subsistenzwirtschaft, eine möglichst vollständige Selbstversorgung kleiner Wirtschaftseinheiten (Haus-, Guts-, Dorfwirtschaft), das Bild außerhalb der Städte prägte (vgl. Neidhardt, 1975, S.28).
Charakteristisch für diese kleinen Wirtschaftseinheiten war laut Sieder (1987) die Einheit von Produktion, Konsumtion (Verbrauch von Wirtschaftsgütern) und Familienleben. Mann, Frau, Kinder und Verwandte lebten und arbeiteten auf einem Hof. Jedoch reichte die Arbeitskraft einer Familie meist nicht aus, um diesen zu bewirtschaften. Die anfallenden Arbeiten wurden zusätzlich von „ledigem Gesinde“ erledigt, das in den bäuerlichen Haushalt sozial und hausrechtlich integriert war und somit zur Familie zählte, oder von Tagelöhner, die außerhalb des Bauernhauses lebten.
Die Verantwortung für Hof und Familie oblag dem Hausvater als Familienvorstand. Je nach wirtschaftlicher Lage konnte er Kinder frühzeitig vom Hof verstoßen und auf anderen Höfen unterbringen oder neue Knechte und Mägde, uneheliche Kinder und Verwandte als weitere Mitglieder in den Haushalt eingliedern. Außerdem entschied er über die Ehefähigkeit der Hausgenossen und arrangierte die entsprechend besten „Partien“ (vgl. Hettlage, 2002, S. 25 f.).
Kinder wurden in den Haushaltsfamilien vor allem als Arbeitskräfte und Erben gesehen. Die Eltern hatten wenig Zeit, sich um sie zu kümmern.
„Das Aufziehen der Kinder erfolgte als integraler Bestandteil aller hauswirtschaftlichen Arbeits- und Lebensprozesse. Die Mutter legte den Säugling in der Küche oder am Feldrand ab, wenn sie zu arbeiten hatte. Säuglinge und Kleinkinder wurden häufig ihren älteren Geschwistern zur Beaufsichtigung überlassen.“ (Sieder, 1987, S. 40)
In arbeitsintensiven Phasen erhöhte sich die Säuglingssterblichkeit. Jedoch wurde nicht lange über den Tod eines Kindes getrauert. Zu dieser Zeit hatte man eine fatalistische Einstellung gegenüber Kleinkindern: Entweder es überlebte oder starb. Der Tod eines Kindes wurde durch die Geburt eines weiteren quasi „wettgemacht“. (vgl. Sieder, 1987, S. 40 ff.)
Nach Hettlage (2002) kann man davon ausgehen, dass Liebe und Zuneigung in der Familie dem Wohlergehen und der Absicherung des Haushalts untergeordnet blieben. Gefühle und Liebe waren keine notwendige Bedingung für das eheliche und familiäre Zusammenleben, da dessen eigentlicher Kern die langfristige Versorgung mit dem Lebensnotwendigsten war.
Wuchsen die Kinder heran, begegneten ihnen die Eltern und andere Erwachsene oft mit außerordentlicher Härte. Dies war vor allem der Fall, wenn sie arbeiten sollten. Ab dem vierten Lebensjahr wurden den Kindern Arbeiten zugeteilt, die ihren körperlichen Fähigkeiten angemessen erschienen. Die Eltern schickten ihre Kinder nur zur Schule, wenn es die Arbeit auf dem Hof zuließ (vgl. Sieder, 1987, S. 45 f.).
Die Bewegungs- und Aufstiegschancen des Einzelnen waren zu dieser Zeit von der familialen Herkunft abhängig. Sie bestimmte die Stellung und das Ansehen in der Gesellschaft, die nicht durch eigene Fähigkeiten und Leistungen erworben werden konnten (vgl. Neidhardt, 1975, S. 29).
Hamann (1988) fasst die Merkmale einer vorindustriellen agrarisch- handwerklichen Haushaltsfamilie folgendermaßen zusammen:
Sie war eine traditions- und ortsgebundene Lebens-, Wirtschafts- und Versorgungsgemeinschaft, die vom Familienoberhaupt bis hin zu den Kindern und Dienstboten hierarchisch gegliedert war. Außerdem konnte sie als eine „Erziehungsinstitution eigener Art“ gesehen werden, da sie für viele Kinder lange Zeit der wichtigste Erziehungsträger neben der Schule und Kirche war.
Eine Übergangsform zwischen der Haushaltsfamilie und der bürgerlichen Familie stellte die Familie der Heimarbeiter dar. Viele von ihnen waren Tagelöhner in der Landwirtschaft. Sie wurden meist zu Heimarbeitern, wenn sie die Absicht hatten, eine Familie zu gründen. Aus diesem Grund kauften sie sich in der Regel ein kleines Haus, in dem sie wohnten und zugleich arbeiteten. Eine häufige Arbeit war das Weben. Der Mann webte, während die Frau und die Kinder spulten.
Im Gegensatz zu den Haushaltsfamilien waren Heimarbeiterfamilien nicht darauf bedacht, möglichst viele Kinder zu bekommen, um daraus wirtschaftlichen Nutzen ziehen zu können. Aufgrund der beengten Wohnverhältnisse und der Fürsorge, die ein Kleinkind bedurfte und die die Mutter wiederum von der Arbeit abhielt, waren ein bis zwei Kinder die Regel. Meist mussten sich die älteren Geschwister um die Jüngeren kümmern. Sie wuchsen in einer von der täglichen Routine der Heimarbeit gekennzeichneten Atmosphäre auf. Primäres und lebensnotwendiges Ziel war die „Erziehung zur Arbeit“.
Im Alter von drei Jahren begannen die Kinder bei der Heimarbeit zu helfen. Die monotone Arbeit, das Aufspulen der Webfäden auf hölzerne Spindeln, hatte oft gesundheitliche Schäden und körperliche Missbildungen zur Folge. Außerdem litt die Schulbildung unter der Arbeit. Die Schule war für viele Kinder, die vor und nach dem Unterricht arbeiten mussten, die einzige Ruhepause, die sie zum Schlafen nutzten. Heimarbeiterkinder blieben meist bis zu ihrer Hochzeit im Elternhaus, da sie als Arbeitskräfte zum Einkommen der Familie beitrugen (vgl. Sieder, 1987, S. 82 ff.).
Im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts löste sich die vorindustrielle Gesellschaft durch unterschiedliche Faktoren wie geistige (Aufklärung, Rationalismus, Erfahrungswissenschaften), wirtschaftliche (Kapitalismus, Industrialisierung, Welthandel) und politische (Liberalismus, Demokratisierung, Sozialstaat), langsam auf (vgl. Neidhardt, 1975, S. 30).
Zu Beginn der Industrialisierung wurden erste Maschinen in den Heimarbeiterhäusern aufgestellt wie z.B. Spinn- und Webmaschinen. Im Laufe der Zeit wurden Fabrikgebäude und Werkhallen mit größeren Maschinen errichtet, wodurch sich die gesamte Struktur der Gesellschaft veränderte. Aufgrund der neuen Produktionsweise musste die Arbeit umorganisiert werden. Arbeits- und Wohnbereich wurden voneinander getrennt. Die wirtschaftlichen Entwicklungen erforderten ein Umdenken. Der Mensch wurde nicht mehr entsprechend seines Standes eingestuft, sondern ganz individuell als geschäfts- und vertragsfähige Einzelpersönlichkeit (vgl. Weber- Kellermann, 1981, S. 100 f.).
An die Stelle der Haushalts- und Heimarbeiterfamilie trat die so genannte bürgerliche Kleinfamilie.
„Ihre Kennzeichen sind nun der berufliche aushäusige Familienvorstand, die elterliche Rollenverteilung zwischen männlicher Ernährerfunktion und weiblicher „Hausaufgabe“. Frauen der Bürgerschicht wurden von wirtschaftlichen Tätigkeiten freigesetzt und hatten sich ganz der Haus- Arbeit, also der Kindererziehung und der Ordnung eines „gepflegten Hauses“, zu widmen.“ (Hettlage, 2002, S. 26 ff.)
Für die Rolle der Frau und Mutter ergab sich eine ganz neue Situation. Bisher war sie in den Haushaltsfamilien in deren arbeitsteilige Wirtschaftsordnung integriert gewesen. Durch die Trennung von Arbeits- und Wohnbereich wurde sie zunächst auf das Heim zurückgedrängt. Ihre neue Lebenswelt waren die drei großen „K“s: Kirche, Küche und Kinder (vgl. Weber- Kellermann, 1981, S. 100 ff.).
Bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts waren wirtschaftliche Faktoren und die Standeszugehörigkeit Ausgangspunkte für eine Eheschließung. Durch die zunehmende Emotionalisierung änderten sich die Gründe für eine Hochzeit. Der Anspruch auf geistige Gemeinsamkeiten und beiderseitiges Interesse rückte in den Vordergrund. Liebe wurde zum ersten Mal Vorbedingung für eine Ehe.
Die veränderte Einstellung gegenüber der Ehe und der Familie spiegelte sich auch in der Beziehung zu den Kindern wieder. Bisher war die Haltung gegenüber Kindern distanziert und von körperlichen Bestrafungen geprägt gewesen. Die Eltern bemühten sich nun, ihre Kinder und deren Motive zu verstehen und nicht nur das äußere Verhalten zu bestrafen. In den ersten Lebensjahren übernahmen die Eltern nur zum Teil die Betreuung. Viele Kinder aus bürgerlichen Familien wurden von Hauslehrern unterrichtet. Die Erziehung hatte das Ziel, aus den Heranwachsenden normengeleitete, vernünftige Menschen zu machen. Das Kind galt nun erstmals als „erziehbares“ Wesen. Credo dieser „Bürgererziehung“ war Rousseaus Erziehungsroman „Emile“ (vgl. Sieder, 1985, S.135 ff).
Der Erste Weltkrieg und die Nachkriegsjahre setzten die Familien der lohnabhängigen Bevölkerung enormen Belastungen aus. Familienväter und militärdienstfähige Söhne wurden in die Armee eingezogen. Die Frauen mussten sich allein um Kinder, Haushalt und das „Organisieren“ von Lebensmitteln kümmern. Sie ertrugen ihr Schicksal, da sie mit der Heimkehr ihrer Männer das Ende dieser Überbelastungen herbeisehnten. Jedoch kehrte ein Großteil der Männer physisch und psychisch erkrankt aus dem Krieg zurück. Viele von ihren waren arbeitsunfähig oder sogar pflegebedürftig. Die Familien hatten die Last zu tragen, diese Folgen des Krieges aufzufangen und zu verarbeiten.
Nach dem Ersten Weltkrieg und in den zwanziger und dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts entstanden Spannungen zwischen den Generationen durch „den Gegensatz von autoritären Familienstrukturen und gleichzeitigem Prestigeverlust der Familienväter (durch die Niederlage im Ersten Weltkrieg, ihre wirtschaftliche Depotenzierung durch Arbeitslosigkeit)“ (Sieder, 1987, S. 229).
Die Nationalsozialisten nutzten die Differenzen in den Familien und gründeten Vereine und Organisationen. Viele Kinder und Jugendliche aus gesellschaftlich unterprivilegierten Schichten sahen in der Mitgliedschaft in einer Kinder- und Jugendorganisationen einen Statuszuwachs im Verhältnis zu Erwachsenen bzw. zu ihren Eltern. Die dichten Strukturen der Vereine und der Organisationen boten Aufstiegsmöglichkeiten, die das Selbstbewusstsein der Jugendlichen stärkten und somit vor allem die Spannungen in den sozialistisch und kommunistisch gesinnten Arbeiterfamilien erhöhten.
Den Erwachsenen versprachen die Nationalsozialisten den Abbau von Arbeitslosigkeit, die Verbesserung der Ernährungslage und die Durchsetzung des Familienideals „des gut verdienenden Vaters, der mütterlichen Hausfrau und der wohlgeratenen Kinder“ (Sieder, 1987, S. 232).
Kinderreiche Familien wurden finanziell unterstützt. Die dadurch wachsende soziale Sicherheit, die verbesserten Konsummöglichkeiten und das propagierte Familienbild schienen eine Stabilisierung des Familienlebens zur Folge zu haben. Längerfristige Investitionen in die Ausbildung der Kinder waren möglich.
Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges wurden die Familienväter und ältesten Söhne wieder von ihren Familien getrennt. Viele Frauen wurden einer starken Doppelbelastung ausgesetzt. Neben Kindern und Haushalt mussten sie in Fabriken „kriegswichtiges Material“ herstellen.
Wie bereits nach dem Ersten Weltkrieg kamen viele Männer erkrankt und arbeitsunfähig zurück und mussten zu Hause gepflegt werden. Physische und psychische Erschöpfung der Frauen waren häufig die Folge. Viele Söhne hatten in der Abwesenheit des Vaters die Verantwortung für ihre Geschwister übernommen. Mit der Rückkehr des Vaters kam es zu Konflikten um die Anerkennung und die Beibehaltung dieses Status. Viele Väter konnten dies nicht akzeptieren und kämpften zum Teil auch gewalttätig, um die Vormachtstellung in ihrer Familie. Vermehrt wandten sich die Kinder von ihren Vätern ab und orientierten sich an ihren Müttern oder wichen zu Gleichaltrigen in ihren Wohnvierteln aus.
In den fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts kehrte man langsam zum geordneten Leben in Kleinfamilien zurück. Jedoch wurde die Schwächung der Vormachtstellung des Vaters durch den Einfluss der Kriegs- und Nachkriegsjahre, wie lange Kriegsgefangenschaft oder Invalidität, immer deutlicher. Obwohl in den meisten Familien noch immer der Mann dominierte, kam es immer häufiger vor, dass die Frau gleichgestellt war. Der Wirtschaftsaufschwung in den fünfziger und sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts und die gestiegene Anzahl an erwerbstätigen Frauen begünstigte diese Tendenz (vgl. Sieder, 1987, S. 228 ff.).
2.2.2.2 Die heutige Entwicklung
Nach Hettlage (2002) ging man lange davon aus, dass die Familie von den erheblichen Veränderungen in vielen Teilen des gesellschaftlichen und sozialen Lebens nicht beeinträchtigt wurde. Sie schien als Festung des Privatlebens allen Krisen und Schwankungen standzuhalten.
Im Laufe der Industrialisierung und Säkularisierung fanden umfassende Modernisierungsprozesse in verschiedenen Lebens- und Handlungsbereichen statt. Diese Veränderungen und neuen Strukturen führten dazu, dass dem Menschen immer mehr Möglichkeiten offeriert wurden, sein Leben zu gestalten (vgl. Kaufmann, 1990, S. 400 ff.).
Kaufmann (1990) sieht in der durch die Industrialisierung zunehmenden gesellschaftlichen Arbeitsteilung, der Vervielfältigung erwerbswirtschaftlicher, staatlicher, religiöser, gemeinnütziger und vereinsmäßiger Einrichtungen einen Gewinn an Freiheit, aber auch ein immer unübersehbareres Angebot an Möglichkeiten.
Neben der immer größer werdenden Zahl an neuen Orientierungsmöglichkeiten vollzog sich bis in die heutige Zeit eine „Enttraditionalisierung“ von alten Leitbildern der Lebensgestaltung. Die vielen dargebotenen Möglichkeiten stellten alte Traditionen in Frage. Es konnte aufgrund der erweiterten Handlungsspielräume und Freiheiten in allen Lebensbereichen, die neue Wege und Alternativen aufzeigten, von den alten Leitbildern abgerückt werden (vgl. Schneewind, 1992, S. 22).
Ein Beispiel dafür war die bis in die Gegenwart zunehmende Bildungs- und Erwerbsbeteiligung der Frau, die sie unabhängiger werden lies und somit ihre Lebensperspektive veränderte.
Diese Entwicklungen haben dazu beigetragen, dass familiale Strukturen aufbrachen, da sie als dynamische Form menschlichen Zusammenlebens von kulturellen Vorstellungen, zeitgeschichtlichen Ideen, sozialen und wirtschaftlichen Gegebenheiten der Gesellschaft geprägt sind und somit Veränderungen unterliegen.
Wandlungsprozesse und Strukturveränderungen der Familie, in denen sich gesamtgesellschaftliche Verhältnisse und Umgestaltungen widerspiegeln, lassen sich in Bezug auf generelle Tendenzen der Familienentwicklung nachweisen. Die heute sichtbaren Veränderungen haben sich über einen längeren Zeitraum vollzogen und herausgebildet (vgl. Hamann, 2000, S. 10 ff.).
Beck- Gernsheim (1994) sieht in dem Weg von der vorindustriellen Haushaltsfamilie, einer auf Solidarität beruhenden Arbeits- und Wirtschaftsgemeinschaft, zu den heutigen mannigfaltigen Formen und Beziehungsmustern des familialen und familienähnlichen Lebens einen Trend in Richtung Individualisierung. Dieser kennzeichnet auch zunehmend familiäre Strukturen. Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts erfolgte die Einführung von Sicherheitsleistungen des Staates, z.B. Kindergeld, Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe. Dies hatte eine Lockerung der Bindung an die herkömmliche Familie zur Folge. Der Einzelne war nicht mehr zwingend von der finanziellen Unterstützung der Familie abhängig. Entscheidend war auch die zunehmende Erwerbstätigkeit von Frauen. Sie führte zu einer allmählichen Veränderung des Familienalltages und der Aufgabenverteilung.
Mitterauer (1989) fasst den familialen Wandel unter den Aspekten der Veränderungen der Rollenstruktur, der Gattenbeziehungen und der Eltern- Kind- Beziehungen zusammen. Zu diesen drei Punkten zählen u.a. die zunehmende Scheidungsrate, das neue Rollenverständnis, die Änderungen im Familienzyklus oder die Zunahme der Zwei- und Einpersonenhaushalte.
Laut Nave- Herz (2002b) haben sich in den letzten Jahrzehnten unterschiedliche Familienformen herauskristallisiert, die nicht dem „normalen“ Familienbildungsprozess und der traditionellen Rollenzusammensetzung entsprechen.
Von 1990 bis 2000 hat sich die Zahl der nicht- ehelichen, zumeist kinderlosen Lebensgemeinschaften auf 2,1 Millionen verdoppelt. Sie kann somit als neue Lebensform menschlichen Zusammenseins definiert werden, die dazu geführt hat, dass sich der Ablauf vom Kennenlernen bis zur Eheschließung und die Sinnzuschreibung der Ehe verändert haben. Untersuchungen haben ergeben, dass die Gründe für die Ehe hauptsächlich die Schwangerschaft, der Kinderwunsch oder das Vorhandsein von Kindern sind und nicht mehr die finanzielle Absicherung. Heutzutage hat eine Heirat aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung, beispielsweise die Berufstätigkeit der Frau, als materielle Versorgungsinstitution an Bedeutung verloren (vgl. Nave- Herz, 2002b, S. 18 f.).
„Beide- die Ehe und die Nichteheliche Lebensgemeinschaft- unterscheiden sich (…) durch den Gründungsanlass: Eine partnerbezogene Emotionalität ist immer starker Anlass für die Gründung einer Nichtehelichen Lebensgemeinschaft, die emotionale kinderorientierte Partnerbeziehung zur Eheschließung.“ (Nave- Herz, 2002b, S. 19)
Auch die Zahl der Ein- Eltern- Familien hat in den letzten 30 Jahren stetig zugenommen. Ihr Anteil beträgt in Deutschland 23% aller Familienformen. Insgesamt gesehen bilden sie aber eine Minderheit. Insbesondere ist der Anteil an Vater- Familien sehr gering und lediglich die Anzahl der allein erziehenden Mütter steigt an.
Der Anteil an Adoptions-, Stief- und Pflegefamilien ist in Deutschland im Vergleich zu den USA gering. In Stieffamilien wachsen ca. 6% aller Kinder auf.
Die beschriebenen Familienformen sind keine neuartigen Lebensformen. Es gab schon immer Mutter- und Vater- Familien. Im 19. Jahrhundert waren Adoptions-, Pflege- und Stieffamilien verbreiteter als heute. In der vorindustriellen Zeit stellten Ein- Eltern- Familien aber keine eigenständigen Systeme dar, sondern waren in anderen Lebensformen, z.B. in eine Haushaltsfamilie, eingebettet. Ihre Gründungsanlässe waren Verwitwung oder Nicht- Ehelichkeit und nicht wie heutzutage überwiegend Trennung oder Scheidung. Sie kamen allerdings nur in den Armutsschichten vor. Im 20. Jahrhundert ging ihr Anteil, abgesehen von der Zeit während und nach den beiden Weltkriegen, zurück.
Mit 82% bezogen auf alle Elternformen mit Kindern unter 18 Jahren sind die Eltern- Familien mit formaler Eheschließung weiterhin dominierend. Die große Mehrheit minderjähriger Kinder (ca. 86%) lebt mit ihren leiblichen Eltern zusammen. Diese sind zu 90% miteinander verheiratet, obwohl heute jede dritte Ehe geschieden wird. Das liegt daran, dass die Zahlen der Scheidungen bei kinderlosen Ehen am höchsten und die der kinderreichen am geringsten sind. Relativ viele Ehen werden geschieden, wenn die Kinder bereits volljährig sind (vgl. Nave- Herz, 2002b, S. 22 ff.).
Nach Hamann (2000) lässt sich der familiale Wandel unter verschiedenen Indikatoren zusammenfassen. Die Veränderung der Einstellung gegenüber der Ehe und Familie führte zu einer Pluralisierung der Haushalts- und Familienformen, zu Geburtenrückgang und zu einem veränderten Heiratsverhalten. Wie bereits beschrieben, stieg die Zahl der nichtehelichen Lebensgemeinschaften und kinderlosen Paare an. Ebenso nahmen Ehescheidungen und Ein- Eltern- Familien zu. Die Berufstätigkeit der Frauen führte zu einem Wandel der Geschlechterrollen und einer Veränderung in der häuslichen Arbeitsteilung und der familialen Interaktionsbeziehungen.
Die beiden letzten Abschnitte verdeutlichen, wie stark die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen die Familie im Laufe der Geschichte beeinflusst haben.
Im 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts war das Leben der Haushalts- und Heimarbeiterfamilien mit dem Vater als Familienoberhaupt von der Arbeit bestimmt. Jeder musste mithelfen, um das Lebensnotwendige zu erwirtschaften. Gefühle und eigene Interessen spielten kaum eine Rolle. Es wurde standesgemäß und aus wirtschaftlichen Gründen geheiratet.
Zu Zeiten der Industrialisierung kam es zu Veränderungen. Die Frau blieb zu Hause, um sich um die Kinder und deren Erziehung zu kümmern, während der Mann arbeiten ging. Die Einstellung gegenüber der Ehe wandelte sich. Liebe und gemeinsame Interesse spielten als Beweggründe für eine Heirat eine entscheidende Rolle.
Während des Ersten und Zweiten Weltkrieges versuchten die Familien, ohne die im Krieg dienenden Väter und älteren Söhne zu überleben. Danach lag ihre Aufgabe darin, die psychischen und physischen Folgen so gut wie möglich aufzufangen und zu verarbeiten.
Seit den Fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts verlor der Vater nach und nach seine Vormachtstellung in der Familie. Der Anteil an berufstätigen Frauen nahm zu und damit auch ihre finanzielle Unabhängigkeit. Viele Frauen „nahmen ihr Leben selbst in die Hand“, da sie nicht mehr auf den Mann als Ernährer angewiesen waren.
Diese Entwicklungen spiegeln sich auch in der stetig wachsenden Zahl an alternativen Familienformen wie Ein- Eltern- Familien oder nichteheliche Lebensgemeinschaften wider. Die traditionelle Familie (Vater- Mutter- Kind) bleibt weiterhin die häufigste Familienform. Jedoch ist sie nicht mehr so dominierend wie beispielsweise die Haushaltsfamilien in der vorindustriellen Gesellschaft.
Nach diesem geschichtlichen Abriss der Entwicklung der Familie gilt es nun, ihre Funktionen aufzuzeigen.
2.2.3 Funktionen der Familie
2.2.3.1 Hauptfunktionen der Familie heutzutage
Es lassen sich nach Hamann (1988) sechs Hauptfunktionen der Familie auflisten.
Eine Funktion ist die biologische Reproduktion. Die Zeugung und das Gebären von Kindern sichert die biologische Existenzgrundlage der Gesellschaft. Obwohl nicht unbedingt eine Kernfamilie erforderlich ist, erfolgt die Geburt und das „Aufziehen“ der Kinder meistens in einer vollständigen Familie. Allerdings sind heutzutage die Geburtenzahlen rückläufig.
Eine weitere Funktion ist die soziale Platzierung. Dies ist der Prozess, bei dem die Eltern ihren Kindern eine bestimmte Position des beruflichen, politischen und kulturellen Lebens vermitteln. Eltern prägen durch ihr erzieherisches Handeln bestimmte Interessen, Wertorientierungen, Leistungsmaßstäbe und Intelligenzvoraussetzungen ihrer Kinder. Von der eigenen sozialen Situation bzw. Schichtzugehörigkeit hängt ab, was Eltern ihren Kindern im Leben mitgeben und welche Voraussetzungen sie ihnen schaffen. Aufgrund individuell verschiedener situativer Gegebenheiten sind die Erziehungs- und Sozialisationsfähigkeiten bei jeder Familie unterschiedlich. Die Vermittlung der jeweiligen Normen und Werte kann jedoch nicht als Benachteiligung von Individuen gegenüber anderen gesehen werden. Vielmehr tragen die verschiedenen Einstellungen und Fähigkeiten zur Stabilisierung der in unserer Gesellschaft bestehenden Schichtstrukturen bei (vgl. Neidhardt, 1975, S. 73).
Die dritte Funktion ist die physische Erhaltung von Familienmitgliedern.
„Die Funktion besteht darin, einen Lebensraum zu schaffen, in welchem Ernährung, Pflege und Fürsorge samt den materiellen Aufwendungen, die das Selbstwerden und die Entlastung von Not sicherstellen, gewährleistet sind.“ (Hamann, 1988, S. 31)
Diese Zuwendung vollzieht sich nicht nur unter biologischen, sachlichen oder wirtschaftlichen Aspekten, sondern Emotionen spielen dabei ebenfalls eine entscheidende Rolle.
Der Spannungsausgleich ist eine weitere Funktion. Er bietet die Möglichkeit der Bewältigung von Problemen, die im Zusammenhang mit den von der Öffentlichkeit geforderten Einstellungen und Verhaltensweisen stehen (vgl. Hamann, 1988, S. 31).
Nach Schmucker (1961) übt die heutige hochspezialisierte, -organisierte und bürokratisierte Gesellschaft ständig Zwänge auf den Menschen aus. Jeder muss sich neuen Situationen stellen und dementsprechend anpassen, womit nicht jeder zurechtkommt. Dies kann auf Dauer zu seelischen Verspannungen führen. Das Familienleben schafft dazu einen Ausgleich. Hier kann sich jeder ungezwungen bewegen und seine persönlichen Eigenarten entfalten.
Die Haushalts- und Freizeitfunktion spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Der Haushalt ist der Ort des täglichen Zusammenlebens. Hier trifft sich die Familie, um zu essen, zu schlafen oder miteinander zu reden. Durch die gemeinsame Nutzung von Räumlichkeiten, Gegenständen, Erfahrungen, Können und Wissen tritt ein Solidaritätscharakter hervor. Solange die Haushaltsgemeinschaft aufrechterhalten wird, bleibt dieser trotz Spannungen und Konflikten bestehen (vgl. Hamann, 1988, S. 32).
Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl zeigt sich auch in großem Maße im gemeinsamen Freizeiterleben. Ein großer Teil der freien Zeit, besonders die Wochenenden und der Urlaub, werden mit der Familie verbracht. Selbst wenn die Kinder erwachsen sind, halten sie an der Familie fest und kommen zu Festen und Feiern (vgl. Neidhardt, 1975, S.76).
Von großer Bedeutung ist die Sozialisations- und Erziehungsfunktion. Sie wird immer neu diskutiert und zu bestimmen versucht. Es gibt jedoch unterschiedliche Meinungen hinsichtlich ihrer Aufgaben und Ziele.
Die Sozialisation (vgl. Abschnitt 2.5.1) wird, wie bereits erwähnt, als soziale Prägung des Menschen durch die Umwelt verstanden. Sie umfasst die komplexen und vielfältigen Prozesse der Vergesellschaftung des Menschen, die in verschiedenen Phasen ablaufen (vgl. Böhm, 2000, S. 501).
In der Soziabilisierung, der ersten Hauptphase der Sozialisation, erschließt sich die Möglichkeit zur Entfaltung in der Anlage vorhandener menschlicher Fähigkeiten und Eigenschaften. Die zweite Hauptphase ist die Entkulturation, durch die das Kind kulturelle Überliefungen wie Erfahrungen, Sprache, Normen oder Werte von seiner Gruppe (Familie) erlernt und geprägt wird. Die sekundäre soziale Fixierung (dritte Hauptphase) ist durch die Einführung und Übernahme spezieller und auswechselbarer soziale Rollen der Gesellschaft geprägt.
Die Hauptaufgaben der familiären Erziehung sind vielfältig und unterschiedlicher Art. Zum einen soll die Familie die elementaren Bedürfnisse wie Nahrung, Behausung oder Verlangen nach Angenommen- oder Geliebtsein befriedigen und Schutz und Geborgenheit gewähren. Ein anderer Aufgabenbereich ist die Vermittlung von elementaren Kenntnissen und Fähigkeiten, z.B. Essen, Sitzen, Gehen, und von gesellschaftlichen und kulturellen Normen und Werten. In der Familie wird das Kind auf den „Eintritt“ in das Berufs-, Arbeits- und Wirtschaftsleben vorbereitet. Eine große Rolle spielt auch die sexuelle, moralische und religiöse Erziehung, die das Kind besonders in seinen Ansichten und Verhalten gegenüber Mitmenschen prägt (vgl. Hamann, 1988, S. 32 ff.).
Aufgrund der zahlreichen und vielfältigen Funktionen, die eine Familie bei der Geburt eines Kindes übernimmt, stellt sich die Frage, ob sie es schafft, diese allein zu bewältigen oder Hilfe von außen in Anspruch nimmt. Die These vom Funktionsverlust der Familie stellt einen möglichen Ansatz zur Klärung dar.
2.2.3.2 Zur These vom Funktionsverlust der Familie
Nach Neidhardt (1975) stehen soziale Stellung, Struktur und Funktion eines sozialen Gebildes in einem voneinander abhängigen Verhältnis. Ändert sich im Laufe der Geschichte einer der drei Faktoren, so wandeln sich auch die anderen beiden. Gleiches gilt für die Familie, da sie ebenfalls ein soziales Gebilde darstellt.
Während der Industrialisierung wurde die städtebauliche Erschließung (Urbanisierung) vorangetrieben. Die zunehmenden städtischen Lebensbedingungen hatten eine Verminderung des sozialen Zusammenhalts zwischen den Generationen und den Verwandten zur Folge. Damit gingen die stabilisierenden Effekte der großen Haushaltsfamilien verloren. Diese Tatsache wird im Allgemeinen mit der These vom Funktionsverlust der Familie in Zusammenhang gebracht.
Industrialisierung und Urbanisierung haben laut der These die immer häufigere Neolokalität der Ehegatten bewirkt. Damit ist gemeint, dass das Ehepaar nach der Hochzeit nicht zur Familie der Frau oder des Mannes zieht, sondern sich an einem dritten Wohnort niederlässt. Daraufhin kam es zu einer immer häufigeren Bildung von Kleinfamilien (vgl. Sieder 1987, S. 252).
Nach dieser These haben die Kleinfamilien wesentliche Aufgaben, die früher in den Haushaltsfamilien gelöst wurden, an andere Institutionen abgegeben. Beispiele dafür sind die Erziehung, die heutzutage zum Teil von Schulen und Ausbildungsstätten übernommen wird, oder Freizeitaktivitäten, für die diverse Vereine und Organisationen zuständig sind.
Neidhardt (1975) erscheint die These zu ungenau, da die Familien nicht alle Aufgaben abgegeben haben. Öffentliche Einrichtungen haben Funktionsteile der Erziehung und der Freizeit übernommen. Da es sich dabei aber nur um Bruchstücke handelt, ist die Familie in den betroffenen Funktionsbreichen nicht wirkungslos geworden. Trotz Schule und Ausbildungsstätten erziehen Eltern weiterhin ihre Kinder und vermitteln ihnen Manieren und Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens bei. Die moderne Familie erbringt unter den veränderten gesellschaftlichen Bedingungen Leistungen, die im Zeitalter vor der Industrialisierung noch nicht notwendig waren. Die Kinder müssen heutzutage lernen, autonom und selbstverantwortlich zu handeln. In den Haushaltsfamilien entschied der Vater als Familienoberhaupt über Wohl und Zukunft seiner Kinder.
Neidhardt (1975) stellt außerdem in Frage, ob die Familie vor der Industrialisierung alle Produktions-, Erziehungs- und Versorgungsaufgaben vollständig und allein gelöst haben. In den großen Haushaltsfamilien teilten sich die Eltern die Erziehung der Kinder mit den Tanten, Großeltern oder dem Gutsherrn. Heute übernimmt dies die Schule.
Die Veränderung liegt demnach nicht in der Funktionsabgabe der Familie. Die Neuerung besteht darin, dass an Stelle von Verwandten oder Nachbarn Behörden, Schulen oder Industriebetriebe Teile von familialen Aufgaben übernehmen.
Es zeigt sich, dass die Familie im Laufe der Geschichte keine Funktionen abgegeben und sie dadurch verloren hat. Sie wurden lediglich auf außerfamiliäre Institutionen übertragen.
Die beiden letzten Abschnitte verdeutlichen die Vielfältigkeit der Funktionen und Aufgaben einer Familie. Obwohl ein Teil von außerfamiliären Institutionen übernommen wird, bewältigen die meisten Familien einen großen Teil der Aufgaben selbst.
Für die Fragestellung der Arbeit sind die Freizeit- und die Sozialisationsfunktion der Familie von Bedeutung. Es soll untersucht werden, wie Familien ihre Freizeit verbringen. Hierbei spielt die Sozialisationsfunktion eine bedeutende Rolle, da darauf eingegangen werden soll, welche Normen und Werte im Hinblick auf Freizeit Eltern ihren Kindern vermitteln und inwieweit diese dadurch beeinflusst werden.
Im Folgenden soll daher näher auf die Begriffe „Freizeit“ und „Sozialisation“ eingegangen werden.
2.3 Freizeit
Es erfolgt zunächst ein Überblick über die historische Entwicklung der freien Zeit, bevor auf den Begriff „Freizeit“ in seiner Begrifflichkeit und Bedeutung eingegangen wird.
2.3.1 Entwicklung der Freizeit
Bei den primitiven Agrarvölkern und in der Antike gab es ca. 170 Ruhetage im Jahr. Tabu- und unheilvolle Tage wurden in heilige Tage bzw. Feiertage, Fastentage in Festtage umgewandelt. In der griechischen Aristokratie wurde die (unfreiwillige) Lohnarbeit von Sklaven geleistet, während sich die freien Griechen mit der Politik und den Künsten beschäftigten (vgl. Opaschowski, 1988, S. 27).
Nach Ortega y Gasset (1949) war das damalige Leben in zwei Zonen unterteilt.
Die erste Zone wurde otium (Muße) genannt, womit das Beschäftigen mit dem Menschlichen des Menschen, wie Herrschaft, Organisation, Wissenschaft oder Künste gemeint war.
Die zweite Zone, als negotium bezeichnet, war mit Anstrengungen um die elementaren Bedürfnisse gefüllt, um alles, was otium ermöglicht, zu befriedigen.
Für den freien Griechen war die gesamte Zeit „freie Zeit“ im Sinne des von Ortega y Gasset beschriebenen otium. Jedoch gab es für die Lohnarbeit leistenden Sklaven auch viele Festtage, an denen sie anstatt zu arbeiten an Theateraufführungen und kultischen Festen teilnahmen.
Im 13. Jahrhundert war die Nacht- und Sonntagsarbeit und Tätigkeiten nach den Samstagsvespern (vier bis fünf Uhr nachmittags) für die meisten Berufe verboten. Die Handwerker erhielten neben den 141 Ruhetagen im Jahr noch 30 Tage Ferien. Ab dem 15. Jahrhundert nahm die Anzahl der Ruhetage ab. Um 1700 betrug die tägliche Arbeitszeit zwölf Stunden.
Mit der Industrialisierung nahm die tägliche Arbeitszeit rasch zu. Die einsetzende Urbanisierung bewirkte ein Überangebot am Arbeitsmarkt. Der Lohn lag am Rande des Existenzminimums, so dass auch Frauen und Kinder arbeiten gehen mussten, um die Familie zu ernähren. An sechs bis sieben Tagen in der Woche wurde 16 bis 18 Stunden (Kinder und Frauen: 12 bis 14 Stunden) gearbeitet. Jedoch trat 1893 das „Fabrikregulativ“ in Kraft, das die tägliche Arbeitszeit von Frauen und Jugendlichen auf maximal zehn Stunden am Tag festlegte. Die übrigen Erwerbstätigen mussten bis an ihre physischen Grenzen gehen.
„Die verbleibende Zeit war so gering, dass sie allenfalls noch für lange Heimwege, kärgliche Nahrungsaufnahme, dringendste Hygiene und etwas Schlaf reichte. In elenden Wohnquartieren, ungesunden Lebensverhältnissen und mit den durch Frauen- und Kinderarbeit strapazierten Familienstrukturen lebte die ständig wachsende Zahl der Industriearbeiter des 19. Jahrhundert ohne freie Zeit.“ (Prahl, 2002, S. 98)
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts änderten sich die Verhältnisse wieder. 1918 wurde der 8- Stunden- Arbeitstag eingeführt. Es kam zu einer Umkehrung in der Verteilung von Arbeitszeit und arbeitsfreier Zeit. Während die unteren Sozialschichten an freier Zeit gewannen, verloren die höheren Schichten sie. Diese Tendenz hat sich in den letzten Jahren noch mehr verstärkt. Arbeitsstellen mit einem niedrigen sozialen Status haben die schnellste Freizeitverlängerung erlebt.
Ab 1950 lassen sich nach Opaschowski (1988) vier Zeitzäsuren der Freizeitentwicklung unterscheiden.
Um 1950, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, lebten die Menschen um zu arbeiten und sich eine eigene Existenz aufzubauen. Freizeit war „Zeit zur Erholung von der geleisteten und für die noch zu leistende Arbeit“ (Opaschowski, 1988, S. 32). Es gab die 6- Tage- und 48- Stundenwoche, die den Alltag bestimmte. Einmal im Jahr gab es 15 Tage Erholungsurlaub, der von den meisten entweder zu Hause oder bei Verwandten verbracht wurde. Zu dieser Zeit lebten die Menschen von und mit der Arbeit.
1970 gab es die 5- Tage- Woche, 42- Stunden- Woche, 238 Arbeitstage und 127 Freie Tage (Urlaub, Feiertage, Wochenenden). Es wurden 1900 Stunden im Jahr gearbeitet. Zusätzlich kamen ca. 400 Stunden für die Wege zu und von der Arbeit hinzu, so dass die zur Verfügung stehende freie Zeit deutlich hinter der verwendeten Zeit für Arbeitszwecke lag. Zu diesem Zeitpunkt, auf dem Höhepunkt der wirtschaftlichen Konjunktur und kurz vor Beginn der Massenarbeitslosigkeit, bestimmte die Arbeit mit ihrem Umfang und ihrer Bedeutung die Struktur der Gesellschaft. Dennoch veränderte das lange Wochenende die Alltagsgewohnheiten.
Der Sonntag galt nicht mehr als Ruhe- und Erholungstag. Die zwei freien Tage am Wochenende standen jetzt für Geselligkeit und außerhäusliche Unternehmungen.
Bis 1990 hat sich der Stellenwert der Arbeit deutlich verändert. Freizeit und Freunde wurden genauso wichtig wie Arbeit und Geld verdienen. Neben 200 Arbeitstagen gab es 165 Freie Tage im Jahr. Die Menschen hatten mit durchschnittlich 2000 Stunden Arbeitszeit und 2100 Stunden Freizeit mehr Zeit zur freien Verfügung als sie für den Lebenserwerb benötigten. Arbeit und Freizeit rückten qualitativ und quantitativ immer dichter zusammen. Es zeigten sich erste Konturen einer Freizeit- Arbeitsgesellschaft, da viele Freizeitaktivitäten zunehmend Arbeitscharakter bekamen und viele freizeit- orientierte Ansprüche an die Arbeitswelt herangetragen wurden.
2010 wird nach Opaschowski (1988) der Wandel von der Arbeits- zur Freizeit- Arbeitsgesellschaft vollzogen sein. Die Arbeitswoche wird für viele am Donnerstag enden. Daraus resultieren wird der Arbeitsstress für die immer größer werdende Zahl an Freizeitberufen. Es wird nur noch 165 Tage im Jahr gearbeitet werden, da 200 Tage frei sind. Die Freizeitgesellschaft wird es aber nicht geben, da die Arbeit als Symbol für sinnvolle menschliche Tätigkeit aufgrund ihrer langen Geschichte kaum an Bedeutung verlieren wird.
Es zeigt sich, dass sich im Laufe der Geschichte die Bedeutung und das Ausmaß der freien Zeit oder „Freizeit“ verändert haben. Aufgrund der heutigen gesellschaftlichen Entwicklungen (zunehmende Arbeitslosigkeit, Verringerung der wöchentlichen Arbeitsstunden) gewinnt die Freizeit immer mehr an Bedeutung. Sie dient nicht mehr allein der Erholung von der Arbeit, wie es beispielsweise in den fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts der Fall war. Es bleibt den Menschen genügend Zeit, sich anderen Aktivitäten und Tätigkeiten zu widmen.
Diese Aktivitäten in der Freizeit, im Speziellen die in Vereinen und Organisationen, sind Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit.
Nachdem das Verhältnis von Arbeit und Freizeit von der Vergangenheit bis in die Gegenwart dargestellt und ein Ausblick in die Zukunft gegeben wurde, ist es nun wichtig, die historische Entwicklung des Begriffes „Freizeit“ genauer zu betrachten.
2.3.2 Annäherung an den Begriff
2.3.2.1 Die Entwicklung des Freizeitverständnisses
Der Begriff „Freizeit“ stammt von dem mittelalterlichen Rechtsbegriff „frey zeyt“, der 1350 in seiner Bedeutung als „Marktfriedenszeit“ zum ersten Mal in der deutschen Literatur auftauchte. Sie gewährte den Marktbesuchern vom 7. September (ein Tag vor Maria Geburt) bis 1. Oktober (Remigiusfest) Schutz vor Gewalt und Störungen. In diesem Zeitraum war der Markt eine Art Friedensbezirk. „Frey zeyt“ stellte eine besondere Form bürgerlicher Freiheit dar. Sie war Friedenszeit und somit auch Freiheitszeit. Als damals geltendes Gesetz kann es mit dem Tarifvertrag des modernen Arbeitsrechts verglichen werden, der ebenfalls objektives Recht setzt und eine „Friedenspflicht“ begründet (vgl. Opaschowski, 1976, S.18).
Ab dem 16. Jahrhundert wurde mit Einsetzen des Humanismus die Bedeutung der „frey zeyt“ zur „freyen zeyt“ individualisiert und mit dem antiken „otium“ in Verbindung gebracht. Ein Zeitabschnitt mit gesteigerter Freiheit für den Einzelnen wurde daraufhin als „frey zeyt“ bezeichnet. Diese Bezeichnung drückte erstmalig einen erhöhten Freiheitsanspruch des Individuums aus.
Bisher waren die Wortverbindungen zwischen „frei“ und „Zeit“ getrennt gewesen. Zum Ende des 17. Jahrhunderts kam es zu einer festen Bindung durch den Begriff „Freystunde“ bzw. „Freistunde“. A. H. Francke verstand darin die Zeit der Erholung und Entspannung vom Unterricht, in der die Schüler und Studenten aber trotzdem nützliche Tätigkeiten und Übungen durchführen sollten. Im 18. Jahrhundert waren „Freistunden“ die Zeit, in der man nicht arbeiten musste und freigestellt war. (vgl. Nahrstedt, 1972, S. 32).
Die durch Martin Luther ausgelöste Reformation (1517) veränderte nachhaltig sowohl das geistlich- religiöse als auch das wirtschaftlich- soziale und politische Leben in Deutschland und Westeuropa. Die Kirche und die Religion beherrschten fortan die Gesellschaft. Das Leben wurde methodisch- rational reglementiert und eingeteilt. Für Luther war das Gott Wohlgefällige, die gehorsame Fügung in den Beruf und die Verachtung des Genusses in der berufs- und arbeitsfreien Zeit, erstrebenswert. Die ständische Ordnung sollte aber unverändert bleiben. Den Menschen wurde bewusst, dass es eine Kluft zwischen öffentlich „verpflichtender“ Zeit und übrig bleibender privater „freier“ Zeit gibt.
„ „Arbeiten“ und „Erwerben“ galten plötzlich nicht mehr als Mittel zum Zweck der Befriedigung von Lebensbedürfnissen; sie wurden (Selbst-)Zweck des Lebens. Die Auffassung von Arbeiten und Erwerben als Selbstzweck basierte auf einer religiös begründeten Verpflichtung, die der einzelne gegenüber dem Inhalt seiner „beruflichen“ Tätigkeit empfinden sollte.“ (Opaschowski, 1976, S. 19)
Die „verpflichtende“ Zeit dominierte gegenüber der „freien“ Zeit. Ein Jahrhundert später im Pietismus wurde der in der verbleibenden freien Zeit mögliche Daseinsgenuss sogar als sittlich verwerflich dargestellt. Geselligkeit, Sport, Spiel und der Genuss von Kultur-, Kunst- und Luxusgütern galten als Zeitvergeudung und schwerste aller Sünden.
Zu dieser Zeit erhielt das Wort „frey“ vor allen Dingen eine negative Bedeutung. Während im Mittelalter „frey zeyt“ als Zeit der gesteigerten Freiheit für Handel und Ausübung des Berufes gesehen wurde, waren nach der Reformation ihre Hauptfunktionen die Erholung und Entspannung von der Arbeit, in denen aber religiöse Belehrungen stattfinden sollten (vgl. Nahrstedt, 1972, S. 32 f. und Opaschowski, 1976, S. 18 ff).
Im 18. Jahrhundert erhoben sich mit der Aufklärungsbewegung Proteste gegen die „Entfremdung“ der „freyen zeyt“ im Zuge der Reformation. Das Ziel war die Verwirklichung der „wahren“ Freiheit des Individuums, die sich in der „freyen zeyt“ des Humanismus bereits angedeutet hatte.
1760 forderte Rousseau in seinem Erziehungsroman „Emile“ die Begründung des Lebens auf eine „temps de liberté“ (Zeit der Freiheit). Dieser Gedanke wurde in Deutschland unter anderem von Pestalozzi und Fröbel übernommen. Für Pestalozzi war die Erziehung durch Freiheit geprägt. Die Schüler sollten die Möglichkeit haben, in den unterrichtsfreien Zeiten ihren eigenen Interessen nachzugehen und sich zu erholen. Fröbel, der als Hauslehrer für Pestalozzis Söhne tätig war, übernahm während der gemeinsamen Arbeit die Gedanken einer durch Freiheit gekennzeichneten Erziehung. 1805 errichtete Pestalozzi ein Erziehungsinstitut in Iferten, in dem neben Fröbel auch der Germanist und Sprachforscher Schmeller pädagogisch tätig wurde.
„Im Umgang und Zusammenarbeit haben diese drei Pädagogen möglicherweise eine pädagogische Fachterminologie entwickelt, in der sie die „Zeit zur freien Beschäftigung“, die den Zöglingen „zur Anwendung nach ihren persönlichen und individuellen Bedürfnissen freigegeben“ war, als „ganz freie Erholungszeit“ (Fröbel), als Muße, als freie Zeit, kurz als „Freizeit“ bezeichnet.“ (Opaschowski, 1976, S. 24)
Diese drei Pädagogen können nach Opaschowski (1976) als geistige Urheber für die deutsche Wortprägung „Freizeit“ gesehen werden.
Die Entstehung des Wortgebrauchs „Freizeit“ lässt sich seit seiner Entstehung in verschiedene Richtungen verfolgen.
In der Pädagogik gehörte es seit 1924 zum stehenden Wortschatz und wurde zu einem eigenständigen Bereich mit wachsender Bedeutung. Es tauchte zuerst im schulischen Bereich als Pausen- und Ferienbezeichnung auf, bevor es auch ein Terminus in der Jugendpflege und Volkshochschule wurde. In den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts kehrte es auch in der Schule zur Kennzeichnung neuer freizeitpädagogischer Aufgaben zurück. 1924 bzw. 1927 entwickelten W. Flitner und F. Klatt erste Entwürfe einer Freizeitpädagogik. Nach dem 2. Weltkrieg entstand eine eigene „Freizeit“- Literatur und Fachzeitschriften wurden herausgegeben.
Um 1900 wurde das Wort „Freizeit“ auf die Wirtschaft, die „Sozialfürsorge und Sozialpolitik“ übertragen. Ein Beispiel dafür ist eine „Denkschrift über die Lage der in der Seeschiffahrt Hamburgs beschäftigten Arbeiter“ von 1902, in der „Arbeitszeit“ und „Freizeit“ gegenübergestellt, eine geregelte „Freizeit“ gefordert und eine Arbeit in der „Freizeit“ als eine „Beschneidung der Freiheit“ abgelehnt wurden. Jedoch vollzog sich der Einzug in den wirtschaftlichen Wortschatz langsamer als in den pädagogischen.
Seit 1913 wurden die von der evangelischen Jugend durchgeführten mehrtägigen „Rüstzeiten“ als Freizeit bezeichnet. Der Plural „Freizeiten“ wurde oft in Verbindung mit Bestimmungswörtern wie „Wanderfreizeiten“, „Erholungsfreizeiten“ oder „Skifreizeiten“ verwendet. Seit 1930 findet man den Begriff „Freizeit“ mit dieser Bedeutung in den Wörterbüchern.
Im 20. Jahrhundert nimmt die Verwendung des Wortes „Freizeit“ zu. Die Zahlen der Buchtitel, die das Wort enthalten, steigen. „Meyers Taschenlexikon“ erklärt seit der siebten Auflage (1929) und „Der große Brockhaus“ seit der 15. Auflage (1930) die Bedeutung dieses Wortes. Zugleich steigt auch die Formenzahl auf mindestens 40 an. Beispiele sind Freizeithemd oder Freizeitspaß (vgl. Nahrstedt, 1972, S. 34 ff).
Der Begriff „Freizeit“ wurde im Hinblick auf seine Entwicklung betrachtet. Im Folgenden soll definiert und differenziert werden, was „Freizeit“ ist, welche Formen es gibt und welche Art von „Freizeit“ in dieser Arbeit untersucht werden soll.
2.3.2.2 Begriffsbestimmung
Grundsätzlich lassen sich nach Opaschowski (1977) und Prahl (2002) zwischen einem positiven und einem negativen Freizeitbegriff unterscheiden.
Negativ bezieht sich hierbei nicht auf die Qualität der Freizeit, sondern grenzt ab, was Freizeit nicht ist. Es werden von einem Zeitbudget, z.B. 24 Stunden von einem Tag, alle Tätigkeiten abgezogen, die nicht als Freizeit gelten. Hierzu zählen Arbeit, Schlaf, Hygiene, Nahrungsaufnahme oder Hausarbeit. Es bleibt eine Restzeit über, die als Freizeit bezeichnet werden kann, demnach eine Zeit frei von Arbeit, Schlaf, Hygiene, Nahrungsaufnahme oder Hausarbeit.
Der positive Freizeitbegriff hingegen meint die freie Zeit, „die von Abhängigkeit und Zwang befreite, die für individuelle und gesellschaftliche Emanzipation verfügbare Lebenszeit“ (Opaschowski, 1977, S. 16). Die Zeit wird als „frei zu…“ definiert. Es werden eher positiv besetzte Tätigkeiten als Inhalte der freien Zeit genannt.
Aus soziologischer Sichtweise richtet Prahl (2002) die Freizeit quantitativ an verschiedenen Zeitrahmen aus.
Unter Tagesfreizeit versteht man 24 Stunden minus Zeiten für Schlafen, Ernährung, Hygiene, Ernährung, Einkaufen, familiäre Pflichten, Wohnungspflege u. ä.
Die Wochenfreizeit sind 144 Stunden minus obige Zeiten plus Wochenendfreizeit.
Die Jahresfreizeit beträgt 365 Tage minus obige Zeit plus Jahresurlaub, Festtage, Fehlzeiten. Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit zählen auch dazu, soweit sie als Freizeit empfunden werden.
Unter Lebensfreizeit versteht man die Summe aller Jahresfreizeiten plus Kindheit und Zeiten neben den Ausbildungsprozessen und in der nachberuflichen Phase. Es kommen Zeiten hinzu, die aufgrund von Vermögen, persönlichen oder erzwungenen Entscheidungen nicht im Erwerbsleben verbracht werden.
Neben diesen Formen der Freizeit gibt es auch jene, die nicht alle Menschen nutzen können. Hierunter fällt zum einen die Freizeit in einer bestimmten Lebensphase wie Freisemester oder Erziehungsurlaub, zum anderen die erzwungene Freizeit durch Arbeitslosigkeit, Invalidität, Krankheit oder Kurzarbeit.
Aus freizeitpädagogischer Sicht unterteilt Opaschowski (1976) die gesamte Lebenszeit des Menschen in drei Zeitabschnitte, die sich in ihrem Grad an freier Verfügbarkeit über die Zeit und der entsprechenden Wahl-, Entscheidungs- und Handlungsfreiheit unterscheiden.
Die Dispositionszeit oder „Freie Zeit“ ist frei verfügbar, einteilbar und selbstbestimmbar. Sie stellt eine qualitative Handlungszeit dar. Damit ist gemeint, dass sie einem Minimum an ökonomischen, sozialen und normativen Zwang unterliegt und ein Maximum an individueller Wahl-, Entscheidungs- und Handlungsfreiheit hat.
„Freie Zeit lässt sich nicht daran erkennen, was einer tut, sondern warum und wie er es tut, aus welchen Beweggründen, mit welcher Zielsetzung und inneren Anteilnahme. Freie Zeit ist charakterisiert durch das Freisein von Verpflichtungen und Zwängen.“ (Opaschowski, 1977, S. 17)
Unter der Voraussetzung, dass die Tätigkeiten in der freien Zeit selbst gewählt und aus eigener Motivation durchgeführt werden, lassen sich die freie Zeit in drei Abschnitte gliedern.
Die „Spielerische Arbeit“ sind psycho- physisch anstrengende und geistig anspannende Aktivitäten, die für den Menschen befriedigend sind. Beispiele hierfür sind der Wettkampf im Freizeitsport, Schach spielen oder Denksportaufgaben.
Bei den „Zielgerichteten Beschäftigungen“ unterscheidet man zwischen sachbezogenen Tätigkeiten (Basteln, technisches Werken, Stricken), personenbezogenen Tätigkeiten wie Erholen, Körperpflege oder Weiterbilden und partnerschaftsbezogenen Tätigkeiten. Dazu zählen Kontakte, Gespräche oder gemeinsame Unternehmungen mit dem Ehepartner und den Freunden. Des Weiteren kann man zwischen kleingruppenbezogenen Tätigkeiten, z.B. Teilnahme an Gruppenreisen, Spiele in und mit Gruppen, Gruppenaktivitäten, und großgruppen- und gesellschaftsbezogene Aktivitäten, beispielsweise Teilnahme an großen Veranstaltungen in den Bereichen Sport, Unterhaltung, Kultur, Politik, Elternversammlungen oder Demonstrationen differenzieren.
Als „Zwanglose Muße“ wird die individuell frei verfügbare Zeit für Eigentätigkeiten wie Spazierengehen, Bücher lesen oder Musikhören oder die zweckfreie Zeit für Nichtbeschäftigtsein und Nichtstun bezeichnet. In diesem Zeitabschnitt wird die Aktivität um ihrer selbst Willen ausgeübt.
Die Obligationszeit oder „Gebundene Zeit“ ist verpflichtend, bindend und verbindlich. Hauptkennzeichen ist die Zweckbestimmung. Sie liegt vor, wenn sich das Individuum zu einer bestimmten Tätigkeit verpflichtet fühlt oder aus beruflichen, familiären, sozialen oder gesellschaftlichen Gründen an die Tätigkeit gebunden ist.
Die Determinationszeit oder „Abhängige Zeit“ ist dadurch gekennzeichnet, dass sie festgelegt, fremdbestimmt und abhängig von einer Sache ist. Das Individuum ist hierbei zu einer bestimmten Tätigkeit gezwungen bzw. in der Ausübung der Tätigkeit zeitlich, räumlich und inhaltlich festgelegt.
In dieser Arbeit wird der Begriff „Freizeit“ als die Zeit verstanden, die frei verfügbar, einteilbar und selbstbestimmt ist. Von Opaschowski (1977) wird diese Zeit auch als Dispositionszeit bezeichnet. Im Blickpunkt stehen hierbei die spielerische Arbeit und die zielgerichteten Beschäftigungen, wobei auch der Zeitumfang eine wichtige Rolle spielen soll.
Nachdem die beiden Theorieblöcke „Familie“ und „Freizeit“ erläutert wurden, sollen diese jetzt zusammengeführt werden, da sie die theoretische Grundlage für die Fragestellung der Arbeit bilden. Es folgen einige Ausführungen zu dem Thema Familie und Freizeit.
2.4 Familie und Freizeit
Dieser Abschnitt erläutert das familiale Freizeitverhalten und geht auf Untersuchungen ein, die bereits zu diesem Thema durchgeführt wurden.
2.4.1 Familiales Freizeitverhalten
Nach Nave- Herz (2002b) hat die Familie durch den familialen Strukturwandel eine neue gesellschaftliche Funktion zugewiesen bekommen, die heutzutage zwar als selbstverständlich erscheint, jedoch nicht immer zu den Aufgaben einer Kernfamilie zählte: das gemeinsame Verbringen der Freizeit.
[...]
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2005
- ISBN (Paperback)
- 9783836600255
- ISBN (eBook)
- 9783956360961
- Dateigröße
- 631 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Christian-Albrechts-Universität Kiel – Philosophische Fakultät, Pädagogik
- Erscheinungsdatum
- 2006 (Dezember)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- pädagogik freizeitpädagogik familie freizeitverhalten sozialisation
- Produktsicherheit
- Diplom.de