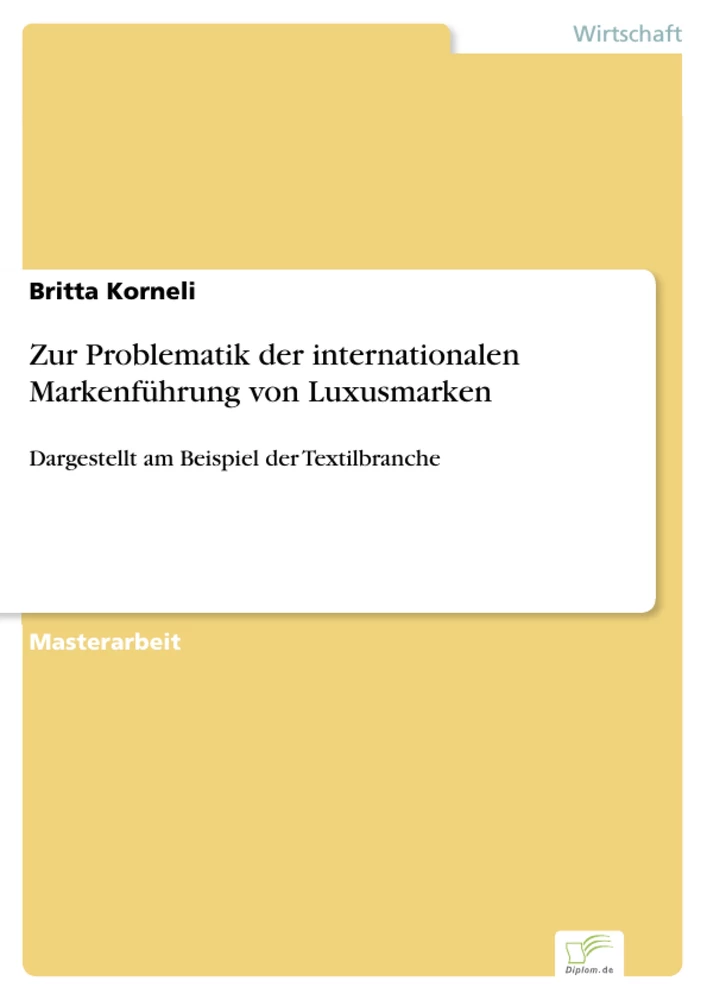Zur Problematik der internationalen Markenführung von Luxusmarken
Dargestellt am Beispiel der Textilbranche
©2006
Masterarbeit
96 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Luxusmarken erfahren große Beachtung von (potentiellen) Konsumenten wie von Marketingverantwortlichen. Verkörperten sie lange Zeit unangefochten höchste Anbieterautorität, steht die Branche in Zeiten wachsenden Wohlstands und weitgehender Befriedigung der Basisbedürfnisse vor neuen Herausforderungen. Dennoch übt der Luxusgütermarkt nach wie vor eine große Faszination aus. Diese Faszination und Begehrlichkeit rührt nicht zuletzt aus dem speziellen Wesen des Luxusprodukts an sich. So konstatierte Bernard Dubois im Journal of Advertising Research, dass Luxusprodukte nie ein Problem lösen, sondern einen Traum konkretisieren.
Dieser Auffassung ist auch Dumas-Hermès: Le luxe, c'est créer un rêve qui perdure. Dieser Traum ist ein multidimensionales Konzept, das auf entsprechendem Management und Marketing basiert. Kapferer spricht gar von dem Traumpotenzial einer Luxusmarke. Diese mythische Aufladung und starke Begehrlichkeit der Luxusmarken unter den besonderen Voraussetzungen der zunehmenden Dynamisierung, Internationalisierung und Innovationsgeschwindigkeit der Textilbranche zu kreieren und zu erhalten, stellt das Markenmanagement von textilen Luxusmarken vor besondere Herausforderungen.
Problemstellung:
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Problematik im Zusammenhang mit der internationalen Führung von textilen Luxusmarken. Erkenntnisobjekt der vorliegenden Arbeit ist das textile Luxusprodukt, das im Kontext des Problemfeldes Markenmanagement betrachtet werden soll. Aufgrund von Schnittstellen zwischen Produkt- und Markenmanagement wird das Produktmanagement in dieser Arbeit Berücksichtigung finden, allerdings erfolgt eine Argumentation aus Sicht des Markenmanagements.
Zielsetzung der Arbeit ist es also, einen Problemkatalog im Zusammenhang mit dem internationalen Markenmanagement von Luxustextilmarken aufzuzeigen. Darüber hinaus werden Hypothesen und Lösungsansätze skizziert. Dazu werden zuerst Luxusmarkenbegriff und Motive für den Luxuskonsum beleuchtet.
Im Weiteren folgt die Betrachtung der Branchenspezifika und der Grundlagen der internationalen Markenführung. Anschließend erfolgt in Kapitel 4 die systematische Betrachtung der resultierenden Problematiken des Markenmanagements textiler Luxusmarken, sowie die Formulierung von Hypothesen und exemplarischer […]
Luxusmarken erfahren große Beachtung von (potentiellen) Konsumenten wie von Marketingverantwortlichen. Verkörperten sie lange Zeit unangefochten höchste Anbieterautorität, steht die Branche in Zeiten wachsenden Wohlstands und weitgehender Befriedigung der Basisbedürfnisse vor neuen Herausforderungen. Dennoch übt der Luxusgütermarkt nach wie vor eine große Faszination aus. Diese Faszination und Begehrlichkeit rührt nicht zuletzt aus dem speziellen Wesen des Luxusprodukts an sich. So konstatierte Bernard Dubois im Journal of Advertising Research, dass Luxusprodukte nie ein Problem lösen, sondern einen Traum konkretisieren.
Dieser Auffassung ist auch Dumas-Hermès: Le luxe, c'est créer un rêve qui perdure. Dieser Traum ist ein multidimensionales Konzept, das auf entsprechendem Management und Marketing basiert. Kapferer spricht gar von dem Traumpotenzial einer Luxusmarke. Diese mythische Aufladung und starke Begehrlichkeit der Luxusmarken unter den besonderen Voraussetzungen der zunehmenden Dynamisierung, Internationalisierung und Innovationsgeschwindigkeit der Textilbranche zu kreieren und zu erhalten, stellt das Markenmanagement von textilen Luxusmarken vor besondere Herausforderungen.
Problemstellung:
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Problematik im Zusammenhang mit der internationalen Führung von textilen Luxusmarken. Erkenntnisobjekt der vorliegenden Arbeit ist das textile Luxusprodukt, das im Kontext des Problemfeldes Markenmanagement betrachtet werden soll. Aufgrund von Schnittstellen zwischen Produkt- und Markenmanagement wird das Produktmanagement in dieser Arbeit Berücksichtigung finden, allerdings erfolgt eine Argumentation aus Sicht des Markenmanagements.
Zielsetzung der Arbeit ist es also, einen Problemkatalog im Zusammenhang mit dem internationalen Markenmanagement von Luxustextilmarken aufzuzeigen. Darüber hinaus werden Hypothesen und Lösungsansätze skizziert. Dazu werden zuerst Luxusmarkenbegriff und Motive für den Luxuskonsum beleuchtet.
Im Weiteren folgt die Betrachtung der Branchenspezifika und der Grundlagen der internationalen Markenführung. Anschließend erfolgt in Kapitel 4 die systematische Betrachtung der resultierenden Problematiken des Markenmanagements textiler Luxusmarken, sowie die Formulierung von Hypothesen und exemplarischer […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Britta Korneli
Zur Problematik der internationalen Markenführung von Luxusmarken
Dargestellt am Beispiel der Textilbranche
ISBN-10: 3-8324-9842-7
ISBN-13: 978-3-8324-9842-9
Druck Diplomica® GmbH, Hamburg, 2006
Zugl. Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Münster, Deutschland, MA-Thesis /
Master, 2006
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2006
Printed in Germany
I
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis I
Abkürzungsverzeichnis III
Abbildungsverzeichnis IV
Tabellenverzeichnis V
1
Internationale Luxusmarken in der Textilbranche- Begehrlichkeit
zwischen Dynamik und Konstanz
1
2
Luxusmarken in der Textilbranche
3
2.1
Definitorische Grundlagen zu Luxusmarken, Merkmale und
Konsummotive 3
2.1.1
Der Begriff der Luxusmarke
3
2.1.2
Motive für den Luxuskonsum
7
2.2
Besonderheiten von Luxusmarken unter besonderer Berücksichtigung
der Textilbranche
13
2.2.1
Abgrenzung der Luxustextilbranche
13
2.2.2
Struktur des Marktes für Luxustextilgüter
14
3
Internationale Markenführung
18
3.1
Definition und Ziele der internationalen Markenführung
18
3.1.1
Definition der internationalen Markenführung
18
3.1.2
Ziele der internationalen Markenführung
20
3.2
Prozess und Strategien der internationalen Markenführung
22
3.2.1
Prozess der internationalen Markenführung
23
3.2.2
Strategien der internationalen Markenführung
24
4
Anforderungen an die Markenführung internationaler Luxusmarken in
der Textilbranche - Problematik, Hypothesen und Lösungsansätze
29
4.1
Systematik der Probleme im Zusammenhang mit der Markenführung
von Luxusmarken in der Textilbranche
29
4.1.1
Problematik im Zusammenhang mit den Besonderheiten der
Internationalität 30
4.1.2
Problematik im Zusammenhang mit den Besonderheiten von
Luxusgütern 39
II
4.1.3
Problematik im Zusammenhang mit den Besonderheiten der
Textilbranche 43
4.2
Hypothesen und exemplarische Lösungsansätze zur Problematik der
internationalen Markenführung von Luxusmarken in der Textilbranche 48
4.2.1
Forschungshypothesen zur internationalen Markenführung von
Luxusmarken in der Textilbranche
49
4.2.2
Exemplarisch skizzierte Lösungsansätze zur Problematik der
internationalen Markenführung von Luxusmarken in der
Textilbranche 50
4.2.2.1
Lösungsansätze zur Problematik im Zusammenhang mit
der Internationalität
50
4.2.2.2
Lösungsansätze zur Problematik im Zusammenhang mit
dem Luxusgut
51
4.2.2.3
Lösungsansätze zur Problematik im Zusammenhang mit
der Textilität
57
5
Zusammenfassung und Ausblick
60
III
Abkürzungsverzeichnis
Abb. Abbildung
Aufl. Auflage
Bsp. Beispiel
Bspw. beispielsweise
CRM Customer
Relationship Management
Etc. et
cetera
f. folgende
ff. fortfolgende
Hrsg. Herausgeber
H&M Hennes
&
Mauritz
i.e.S.
im engeren Sinne
i.w.S.
im weiteren Sinne
Jh. Jahrhundert
LMVH
Louis Vuitton Moet Hennessy Konzern
Mia. Milliarde
o.V. ohne
Verfasserangabe
S. Seite
s. siehe
sog. so
genannte/r
Tab. Tabelle
vgl. vergleiche
z.B. zum
Beispiel
IV
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Luxusmarkeneinteilung nach Kapferer
S. 81
Abbildung 2: Motive der Luxusmarkenwahl
S. 81
Abbildung 3: Der Weltmarkt für Luxusgüter
S. 82
Abbildung 4: Ziele der Markenführung
S. 82
Abbildung 5: Markenmanagementprozess
S. 83
Abbildung 6: Luxusmarkenstrategien
S. 83
Abbildung 7: Exportanteil der textilen Luxushersteller
S. 84
Abbildung 8: Rahmenbedingungen des internationalen
Bekleidungsmarketings
S. 84
Abbildung 9: Eigen-Retail-Anteil bei Luxusgüter-
unternehmen
S. 85
V
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Problematik im Zusammenhang mit den
Besonderheiten der Internationalität S.
86
Tabelle 2: Problematik im Zusammenhang mit den
Besonderheiten von Luxusgütern
S. 87
Tabelle 3: Problematik im Zusammenhang mit den
Besonderheiten der Textilität
S. 88
1
1 Internationale Luxusmarken in der
Textilbranche- Begehrlichkeit zwischen
Dynamik und Konstanz
Luxusmarken erfahren große Beachtung von (potentiellen) Kon-
sumenten wie von Marketingverantwortlichen. Verkörperten sie
lange Zeit unangefochten höchste Anbieterautorität, steht die
Branche in Zeiten wachsenden Wohlstands und weitgehender Be-
friedigung der Basisbedürfnisse vor neuen Herausforderungen.
1
Dennoch übt der Luxusgütermarkt nach wie vor eine große Faszi-
nation aus. Diese Faszination und Begehrlichkeit rührt nicht zuletzt
aus dem speziellen Wesen des Luxusprodukts an sich. So konsta-
tierte Bernard Dubois im Journal of Advertising Reasearch, dass
Luxusprodukte nie ein Problem lösen, sondern einen Traum kon-
kretisieren.
2
Dieser Auffassung ist auch Dumas-Hermès
3
: ,,Le luxe,
c'est créer un rêve qui perdure."
4
Dieser Traum ist ein multidimen-
sionales Konzept, das auf entsprechendem Management und
Marketing basiert.
5
Kapferer spricht gar von dem ,,Traumpotenzial"
einer Luxusmarke.
6
Diese mythische Aufladung und starke Be-
gehrlichkeit der Luxusmarken unter den besonderen Vorausset-
zungen der zunehmenden Dynamisierung, Internationalisierung
und Innovationsgeschwindigkeit der Textilbranche zu kreieren und
zu erhalten, stellt das Markenmanagement von textilen Luxusmar-
ken vor besondere Herausforderungen.
1
Vgl. Belz, O. (1994), S. 646
2
Vgl. Dubois, B.; Paternault, C. (1995), S. 69-76
3
Jean-Louis Dumas-Hermès ist Chairman und CEO des Luxuskonzerns
Hermès
4
Vgl. Dumas-Hermès, J.-L. (2006)
5
Vgl. Catry, B. (2003), S. 17
6
Vgl. Kapferer, J.-N. (2001), S. 330
2
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Problematik im Zusammen-
hang mit der internationalen Führung von textilen Luxusmarken.
Erkenntnisobjekt der vorliegenden Arbeit ist das textile Luxuspro-
dukt, das im Kontext des Problemfeldes Markenmanagement
7
be-
trachtet werden soll. Aufgrund von Schnittstellen zwischen Pro-
dukt- und Markenmanagement wird das Produktmanagement
8
in
dieser Arbeit Berücksichtigung finden, allerdings erfolgt eine Ar-
gumentation aus Sicht des Markenmanagements. Zielsetzung der
Arbeit ist es also, einen Problemkatalog im Zusammenhang mit
dem internationalen Markenmanagement von Luxustextilmarken
aufzuzeigen. Darüber hinaus werden Hypothesen und Lösungs-
ansätze skizziert. Dazu werden zuerst Luxusmarkenbegriff und
Motive für den Luxuskonsum beleuchtet. Im Weiteren folgt die Be-
trachtung der Branchenspezifika und der Grundlagen der interna-
tionalen Markenführung. Anschließend erfolgt in Kapitel 4 die sys-
tematische Betrachtung der resultierenden Problematiken des
Markenmanagements textiler Luxusmarken, sowie die Formulie-
rung von Hypothesen und exemplarischer Lösungsansätze.
7
Vgl. Meffert, H.; Burmann, C. (2005), S. 32
8
Vgl. Koppelmann, U. (1997) S. 2 f
3
2 Luxusmarken in der Textilbranche
2.1 Definitorische Grundlagen zu Luxusmarken,
Merkmale und Konsummotive
Im folgenden Kapitel wird ausgehend von einer Betrachtung des
Markenbegriffs und des Luxusbegriffs eine Definition der ,,Luxus-
marke" festgelegt, sowie Luxuskonsummotive beleuchtet.
2.1.1 Der Begriff der Luxusmarke
Bislang existiert in der Literatur keine einheitliche Definition des
Begriffs ,,Luxusmarke". Daher soll über die Einzelbetrachtung der
Begriffe Marke und Luxus eine Arbeitsdefinition festgelegt werden.
In der Literatur gibt es zahlreiche Definitionen des Begriffs Marke,
die häufig unterschiedliche Schwerpunkte setzen.
9
Die aktuellen
Definitionen von Marken werden im Rahmen dieser Arbeit auf den
Markendefinitionsansatz der identitätsorientierten Markenführung
beschränkt. Dieser geht über die einseitige Ausrichtung auf die
Wahrnehmung der Marke beim Nachfrager weit hinaus, in dem er
die outside-in Perspektive um das Selbstbild der Marke aus Sicht
der internen Zielgruppen innerhalb der Institution, die die Marke
trägt, ergänzt. Diesem Selbstbild der Marke, ihrer Markenidentität,
als diejenigen raum-zeitlich gleichartigen Merkmale der Marke, die
aus Sicht der internen Zielgruppen in nachhaltiger Weise den Cha-
9
Als Grund hierfür gibt Bruhn an, dass die Autoren aus der Wissenschaft aus
verschiedenen Forschungseinrichtungen kommen und die Vertreter aus der
Praxis ihre eigenen Interessen verfolgen. Vgl. Bruhn, M. (2001), S. 14
4
rakter der Marke prägen
10
, kommt im Rahmen der identitätsorien-
tierten Markenführung besondere Bedeutung zu. Das identitätsori-
entierte Markenmanagement definiert Marke in Anlehnung an Kel-
ler wie folgt: ,,ein Nutzenbündel mit spezifischen Merkmalen, die
dafür sorgen, dass sich dieses Nutzenbündel gegenüber anderen
Nutzenbündeln, welche dieselben Basisbedürfnisse erfüllen, aus
Sicht relevanter Zielgruppen nachhaltig differenziert".
11
Zum Begriff Luxus existieren ebenfalls eine Vielzahl unterschiedli-
cher Definitionsansätze aus verschiedenen Perspektiven, die teil-
weise bis in die Antike zurückreichen.
12
Vielfach sind sie sehr sub-
jektiv geprägt, und daher nicht frei von Wertungen.
13
Bislang exis-
tiert keine einheitliche übergreifende Begriffsdefinition. Zwei ge-
gensätzliche Werthaltungen finden sich in den verschiedenen Lu-
xusdefinitionen und Interpretationen der Ursprünge des Wortes
Luxus: Begehrlichkeit und Bewunderung auf der einen Seite und
Übermäßigkeit und Verschwendung auf der anderen Seite.
14
Mühlmann beschrieb Luxus als einen hohen Aufwand, der über
das Lebensnotwendige hinausgeht.
15
Dies verdeutlicht, dass der
Luxusbegriff erst konkretisiert werden kann, wenn der gesell-
schaftliche Kontext und das subjektive Empfinden im Bezug auf
10
Vgl. Die Markenidentität ist die in sich widerspruchsfreie, geschlossene
Ganzheit von Merkmalen einer Marke, die diese dauerhaft von anderen
Marken unterscheidet. Sie entsteht aus der wechselseitigen Beziehung zwi-
schen internem Selbstbild und externen Fremdbild Vgl. 2.1.1; Vgl. Bur-
mann, C.; Meffert, H.(2005a), S. 46, 49
11
Vgl. Burmann, C.; Meffert, H.; Koers, M. (2005), S. 7
12
Vgl. Belz, O. (1994), S. 646
13
Vgl. Kapferer, J.-N. (2001), S. 347
14
Vgl. Valtin, A. (2005), S. 19
15
Mühlmann untersuchte den Luxusbegriff etymologisch. Vgl. Mühlmann, H.
(1975), S. 69 ff
5
das ,,Notwendige" bekannt ist.
16
Zahlreiche Kategorisierungen un-
terteilen Luxusgüter in Abhängigkeit von der Produktkategorie.
17
Im Folgenden soll eine wirkungsorientierte Luxusmarkendefinition
zu Grunde liegen, d.h. unabhängig von der Produktkategorie.
Intrakategorial bezeichnet ein Luxusgut eine herausragende Stel-
lung innerhalb der Produktkategorie. Kapferer unterteilt die Pro-
duktangebote der Luxusmarke Dior in Luxusunikat, als ein einma-
liges, handgefertigtes Objekt, Luxusmarke, welche in kleinen Se-
rien ebenfalls überwiegend handgefertigt hergestellt wird und
Premiummarke (s. Abb. 1).
18
Die Premiummarke ist enger mit dem
funktionalen Nutzen verbunden als die Luxusmarke, die stärker
einen symbolischen Nutzen repräsentiert und ist im Vergleich zu
ihr breiter distribuiert. In der Gegenüberstellung mit Basismarken
ihrer Kategorie ist die Premiummarke teurer und qualitativ hoch-
wertiger. Eine Unterscheidung zwischen Luxus- und Premiummar-
ke ist vor allem vor der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklung
und vielfach zitierten Konsumwandel hin zu einem neuen Luxus
von großer Bedeutung. Zahlreiche aktuelle Publikationen betonen
eine allgemeine Zuwendung der Verbraucher zu Luxus und Lu-
xusprodukten und sprechen dabei streng genommen meist von
Premiumprodukten bzw. trennen nicht exakt zwischen Premium
und Luxus.
19
Im Gegensatz zu klassischen Luxusprodukten wie
bspw. einem Chanel-Kostüm versteht man unter ,,neuem Luxus"
Produkte und Dienstleistungen, die auch für die Mittelschicht ver-
16
Vgl. Vickers, J.; Renand, F. (2003), S. 460
17
Vgl. Kapferer, J-N. (2001), S. 324
18
Vgl. Ebenda, S. 324
19
Vgl. Mazzalovo, G. (2003), 1 ff; Silverstein, M.; Fiske, N. (2003): 2 ff; Danet,
J.-B. (2005), S. 1 ff; Kaminsky, P. (2001), S. 1 ff; Ahrens, K.; Pittner, H.
(2005), S. 242 ff; Gillies, J.-M. (2003), S. 1 ff; Mei-Pochtler, A. (2003a), S.
92 ff
6
fügbar sind, die mit einem höheren funktionalen oder symbolisch-
emotionalen Nutzen verbunden sind, die teuerer sind als ver-
gleichbare Produkte innerhalb ihrer Kategorie, aber dennoch er-
schwinglich.
Meffert/Burmann grenzen den Begriff Luxusmarke mit Hilfe den
Dimensionen Preis und dominantem Markennutzen von alternati-
ven Optionen im vertikalen Markenwettbewerb ab. Zusammenfas-
send definieren sie den Begriff Luxusmarke als ,,..ein Nutzenbün-
del mit spezifischen Merkmalen, die zu einem weit überdurch-
schnittlich differenzierten Vorstellungsbild im Kopf des Konsumen-
ten, einer Dominanz der ideellen Markenfunktion und in Konse-
quenz zu einem weit überdurchschnittlich hohen wahrgenomme-
nen Gesamtnutzen, einer weit überdurchschnittlichen Begehrlich-
keit sowie einer weit überdurchschnittlichen Preisbereitschaft füh-
ren."
20
Diese Definition einer Luxusmarke soll den folgenden Aus-
führungen dieser Arbeit zu Grunde liegen. Der von den Verbrau-
chern wahrgenommene Kern
21
einer Luxusmarke zeigt sich nach
einer empirischen Untersuchung von Dubois/Paternault/Czellar in
sechs Faktoren, die als Merkmale von Luxusmarken bezeichnet
werden können:
·
Hoher
Preis, sowohl interkategorial, d.h. absolut, als auch
relativ/intrakategorial zu anderen Marken der gleichen Pro-
duktkategorie
20
Lasslop, I. (2005), S. 475
21
Der Begriff des Markenkerns bezeichnet die essentiellen Merkmale der Mar-
kenidentiät, die von der Markenführung nicht oder zumindest nur geringfü-
gig verändert werden sollten. Vgl. Meffert, H.; Burmann, C.(2005a) S. 56 -
57
7
·
Hohe
Qualität, sowohl im Bezug auf die verwendeten Ma-
terialien als auch hinsichtlich deren Verarbeitung
·
Einzigartigkeit, die sich in einer schweren Erhältlichkeit
bzw. in Knappheit widerspiegelt
·
Ästhetik, im Sinne eines Produkterlebnisses aufgrund des
Zusammenwirkens von Farbe, Formgebung etc.
·
Historie durch Kontinuität in Markenauftritt, Design etc.
·
Nicht-Notwendigkeit, ausgedrückt in einer dominierenden
Wahrnehmung symbolischer gegenüber funktionalen Ei-
genschaften.
22
Diese Wahrnehmungsformen schaffen einen ideellen Nutzen, der
im folgenden Kapitel im Zusammenhang mit den Motiven des Lu-
xuskonsums erläutert wird.
2.1.2 Motive für den Luxuskonsum
Die in Kapitel 2.1.1 genannten emotional-symbolischen Produktei-
genschaften sind im Bezug auf ihre Kaufverhaltensbeeinflussung
von größerer Bedeutung als funktionale Nutzenvorstellungen.
23
Als Basis einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit den
Motiven
24
des Luxuskonsums muss die Betriebswirtschaft auf an-
dere Wissenschaftsbereiche zurückgreifen. Es existieren in die-
sem Zusammenhang eine Vielzahl von verhaltenswissenschaftli-
22
Vgl. Lasslop, I. (2005), S. 473 - 474
23
Vgl. Grubb, E.; Grathwohl, H, (1967), S. 22 ff
24
Unter einem Motiv versteht man einen isolierten Beweggrund menschlichen
Verhaltens; das Zusammenspiel verschiedener aktivierender Motive in ei-
ner konkreten Situation bezeichnet man in der Psychologie als Motivation;
Nerdinger, F. W.; v. Rosenstiel (1991), S. 71
8
chen und ökonomischen Studien, die die Motive im Sinne von
psychologisch aktivierenden Prozessen mit kognitiver Zielorientie-
rung
25
untersuchen. Sie beleuchten vier unterschiedliche Effekte,
die zur Herleitung der zentralen Motive des Luxuskonsums heran-
gezogen werden können
26
der Veblen Effekt
27
, der Snob Effekt
28
,
der Bandwagon-Effekt sowie das Streben nach Hedonismus.
29
Der Preis ist wie bereits erwähnt ein determinierendes Kriterium
für ein Luxusgut. Die Untersuchungen von Veblen
30
prägten den
Begriff des ,,conspicious consumption", des demonstrativen Kon-
sums, als Motiv des Luxuskonsums um dadurch die Sicherung
oder Verbesserung des sozialen Status zu erreichen.
31
Demnach
erfüllen Luxusprodukte primär die Funktion der Abgrenzung nach
unten sowie des Ausdrucks der Zugehörigkeit zu höheren Klassen
durch die erstrebte Demonstration von Status und Prestige.
32
Als Snob-Effekt bezeichnet man das Phänomen der nachlassen-
den Nachfrage aufgrund der Ablehnung einer Marke bzw. eines
Produkts durch Konsumenten wegen zunehmender Verbreitung.
Ursache ist der Verlust des Distinktionswerts und somit der Exklu-
sivität des Produkts mit zunehmender Verbreitung und die daraus
25
Vgl. Kisabaka, L.(2001), S. 17
26
Vgl. Reich, C. (2005), S. 38
27
Vgl. Veblen, T. (1981), S. 80 ff
28
Vgl. Ebenda, S. 83 ff
29
Vgl. Vigneron, F.; Johnson, L. (1999), S. 2ff
30
Der Veblen-Effekt unterstellt eine atypische positive Korrelation zwischen der
Nachfrage und dem Preis eines Gutes aufgrund der Bereitschaft, einen
höheren Preis für ein Gut zu zahlen als für ein funktionales gleichwertiges
Produkt, wenn damit das Motiv des demonstrativen Konsums befiedigt
wird. Vgl. Belz, O. (1994), S. 647
31
Vgl. Mason, R. (1981), S. 130
32
Vgl. Ebenda, S. 647; Vickers, J.; Renand, F. (2003), S. 461; Silverstein, M.
(2004) S. 4;
9
resultierende Nicht-Eignung zur Differenzierung und zum Aus-
druck der eigenen Persönlichkeit.
33
Konträr dazu verhält sich die Nachfrage beim Bandwagon-Effekt
34
,
der auch Mitläufer-Effekt genannt wird. Zentrales Konsummotiv
von Luxusgütern ist demnach der Wunsch/das Bestreben einer
bestimmten Referenzgruppe bzw. Schicht durch den Konsum zu-
gehörig zu erscheinen oder ähnlich zu sein.
35
Das intrinsisch motivierte Streben nach Selbstbelohung und
-verwirklichung findet neuerdings innerhalb des neuen Luxusver-
ständnisses große Beachtung. Ausgehend von einer hedonisti-
schen Orientierung der Verbraucher dient der Luxuskonsum bspw.
zum Ausgleich für Stress und Zeitmangel.
36
Die Luxusgüter müs-
sen nicht zwingend sozial wahrnehmbar sein, die Befriedigung
emotionaler selbst-gerichteter Motive wie Verwöhnung, Genuss
und Ästhetik dominieren. Die verwendeten Marken verkörpern ei-
gene Wertvorstellungen und Lebensgefühle des Individuums
37
und können darüber hinaus ein Mittel sein, die eigene Persönlich-
keit auszudrücken. In diesem Zusammenhang spricht man von der
Identifikationsfunktion von Luxusmarken.
Vor dem Hintergrund des den Ausführungen dieser Arbeit zu
Grunde liegenden identitätsorientierten Markenverständnisses
erscheint eine Auseinandersetzung mit dem Identitätssystem von
33
Vgl. Leibenstein, H. zitiert nach Kisabaka, L. (2001), S. 21
34
Vgl. Demnach wird die Nachfrage eines Gutes durch die Tatsache gesteigert,
dass andere Individuen das Gut konsumieren und führt zu einer positiven
Korrelation zwischen dem eigenen Verbrauch und dem Verbrauch der Re-
ferenzgruppe. Vgl. Leibenstein, H., zitiert nach Valtin, A. (2005), S. 38
35
Vgl. Dubois, B.; Duquesne, P., zitiert nach Reich, C. (2005), S. 41
36
Vgl. Silverstein, M.; Fiske, N. (2005); S. 35 ff
37
Vgl. Ebenda, S. 50; Belz, O. (1994), S. 647
10
Luxusmarken notwendig. Das bereits in Kapitel 2.1.1 definierte
Konzept der Identität, findet sich im Rahmen der Identitätsbetrach-
tungen des Selbstkonzepts, des symbolischen Konsums und des
Konsumverhaltens wieder.
38
Grubb/Grathwohl untersuchten den
Zusammenhang zwischen ,,Consumer Self-Concept, Symbolism
and Marketing Behaviour."
39
Das Selbstkonzept eines Menschen
beinhaltet ein System aus Werten, Zielen und Regeln, durch wel-
ches es dem Individuum möglich ist, seine Wahrnehmung und
Handlungen im Kontext der Umwelt zu organisieren und dadurch
seine eigene Wirklichkeit zu konstruieren.
40
Durch die Interaktion
des Individuums mit seiner sozialen Umwelt konstituiert sich im
Wechselspiel das Selbstkonzept. Marken können als Symbole
dienen, die als Instrumente der indirekten Kommunikation zwi-
schen Individuen und deren sozialer Umwelt interpretiert werden
können.
41
Grubb/Grathwohl geben ein Bsp. aus dem Bereich
Mode: Individuen kaufen das Modeobjekt aufgrund ihrer Gefühle,
was es für sie tun kann. Es erlaubt dem Konsumenten, sich direkt
mit ihm zu verbinden, d.h. die Markeneigenschaften auf die eigene
Persönlichkeit zu übertragen und somit sein eigenes Selbstkon-
zept zu festigen und zu erhöhen.
42
Die Marke wird somit ein sym-
bolisches Kommunikationsmittel, welche durch den Klassifikati-
onsprozess in Beziehung zu anderen Objekten gesetzt wird: ,,If a
product is to serve as a symbolic communication device it must
achieve social recognition, and the meaning associated with the
product must be clearly established and understood by related
38
Vgl. Dolrich, I. (1969), S. 80 ff; Grubb, E. L.; Hupp, G. (1968), S. 58 ff;
Aaker, J. L. (1999), S. 45 -57; Hogg, M.; Michell, P. C.N. (1996), S. 629 - 644
39
Vgl. Grubb, E. L.; Grathwohl, H. L. (1967), S. 22ff
40
Vgl. Rosenberg, M.; zitiert nach Lasslop, I. (2005); S.477
41
Vgl. Grubb, E. L.; Grathwohl, H. L. (1967), S. 24
42
Vgl. Ebenda (1967), S. 25
11
segments of society."
43
Damit nennen Grubb/Grathwohl zwei wich-
tige Kriterien für ein symbolisches Kommunikationsobjekt: Dem
Objekt muss eine hohe soziale Aufmerksamkeit zu Teil werden
und die assoziierte Bedeutung muss für das Selbstkonzept der
Nachfrager Relevanz besitzen. Darüber hinaus gelten ein hohes
Maß an Spezifität der Marke sowie die Existenz einer starken
Markenpersönlichkeit als weitere Voraussetzung für ein symboli-
sches Kommunikationsobjekt.
44
Durch die Betrachtung der Motivkategorien im Zusammenhang mit
der Luxustextilbranche wird deutlich, dass Kleidung als heraldi-
sches Objekt
45
als ein wichtiges Indiz zur Eindrucksbildung fun-
giert, als Indikator für sozialen Status und Persönlichkeit benutzt
wird
46
und auf unser erlebtes Selbst rückwirkt. Eine Vielzahl von
Untersuchungen hat diesen Zusammenhang zwischen dem sym-
bolischen Bild der Kleidung und dem Selbstkonzept thematisiert
47
und die identitätsstiftende Funktion der Mode
48
belegt. Demnach
wählen Menschen Kleidung nach ihrem Bedeutungswert
49
aus,
von der sie glauben, sie repräsentiere ihr Selbstkonzept, wobei
Untersuchungen zeigen, dass die Wahl der Kleidung mehr vom
Ideal-Selbst als vom realen Selbstbild geleitet wird.
50
Die Erweite-
rung dieses Modells des Zusammenhangs von Selbstkonzept,
Markenidentiät und symbolischem Konsum von Grubb/Grathwohl
43
Vgl. Ebenda (1967), S. 24
44
Vgl. Lasslop, I. (2005), S. 478
45
Vgl. Karmasin, H. (1995), S. 70;
46
Vgl. Conner, Peters, Nagasawa, zitiert nach Nerdinger, F. W.; v. Rosenstiel,
L. (1991), S. 73
47
Vgl. Davis, Lennon, zitiert nach Nerdinger, F. W.; v. Rosenstiel, L. (1991), S.
74
48
Vgl. Wiswede, G. (1991), S. 101
49
Vgl. Karmasin, H. (1995), S. 65
50
Vgl. Dollase, zitiert nach Nerdinger, F. W.; v. Rosenstiel, L. (1991), S. 75
12
durch Hogg/Cox/Keeling ermöglicht es, die Wahl von Luxusmar-
ken auf drei zentrale Motive zurückzuführen: Das private, distinkti-
ve oder öffentliche Selbstkonzept (s. Abb. 2).
51
Nach dem Prozess
des privaten Selbstkonzepts versucht der Konsument durch Besitz
und Verwendung von Luxusmarken die eigenen Wertestandards
zu erreichen, das Image dieser Marken auf sein eigenes Selbst zu
transferieren und sich selbst etwas Gutes zu tun. Voraussetzung
für diese Wirkung ist die konkrete Vorstellung des Konsumenten
über sein tatsächliches und ideales Selbst. Die zu Grunde liegen-
den Motive der Selbstverwirklichung und -belohung können als
Erklärung für die Nachfrage nach hochwertigen, aber weniger auf-
fälligen Luxusmarken herangezogen werden.
52
Die Verfolgung des
distinktiven Selbstkonzepts hingegen zielt auf die Erreichung ex-
terner Standards und hat als Konsummotiv die horizontale als
auch vertikale Abgrenzung bzw. Zugehörigkeit zu bestimmten
Gruppen. Das öffentliche Selbstkonzept ist auf die soziale Aner-
kennung eigener Wertvorstellungen durch die relevante soziale
Umwelt gerichtet; Konsummotiv ist demnach die Eigenschaft der
Luxusmarke, als Beweismittel für eigene Persönlichkeitsmerkmale
wie guten Geschmack und Stil zu fungieren.
53
Für ein nachhaltig erfolgreiches Management einer Luxusmarke
ist es unerlässlich, das Konsumentenverhalten im Bezug auf Lu-
xusmarkenkonsum zu erforschen, um ein detailliertes Verständnis
darüber zu erlangen, wie bei Konsumenten Begehrlichkeiten und
Kaufabsichten geweckt werden können.
51
Vgl. Hogg, M.; Michell, P. C. N. (1996), S. 629 ff; Hogg, M. K.; Cox, A. J:;
Keeling, K. zitiert nach Valtin, A. (2005); S. 50-51, Lasslop, I. (2005), S.
480-481
52
Vgl. Diez, W., zitiert nach Lasslop, I. (2005), S. 481
53
Vgl. Ebenda, S. 481; Valtin, A. (2005), S. 51
13
2.2 Besonderheiten von Luxusmarken unter
besonderer Berücksichtigung der Textilbranche
Im folgenden Kapitel erfährt der Marktes für Luxustextilien ein-
schließlich aktueller Rahmenbedingungen eine nähere Betrach-
tung. Zunächst erfolgt eine Abgrenzung des Untersuchungsbe-
reichs.
2.2.1 Abgrenzung der Luxustextilbranche
Die Textilindustrie ist eine Branche des produzierenden Gewer-
bes, die textile Rohstoffe
54
zu textilen Produkten verarbeitet und
letztere zu textilen Gebrauchsgegenständen z.B.
Kleidungsstücken veredelt.
55
Der Begriff Textilien geht stärker von
der bei Kleidung vorherrschenden aber nicht notwendigen Mate-
rialität aus; definitorisch sind daher nicht alle Textilien Kleidungs-
stücke.
56
Diese Arbeit betrachtet allerdings nur ,,fertige" Beklei-
dung. Aufgrund der Nähe von Bekleidung zu sonstigen am Körper
getragenen Produkten und deren Bedeutung im Zusammenhang
mit dem sog. ,,Einstiegsluxus"
57
und der Markenexpansionspolitik
der Luxusmarkenhersteller werden Accessoires im weiteren Ver-
lauf nicht ausgeklammert und dienen zur lllustration der Thematik.
Aufgrund der vorgenommenen Eingrenzung erscheint eine Defini-
tion des Begriffs Mode für sinnvoll, da dieser in besonderer Weise
mit der Textilbranche verbunden ist. Es existieren zahlreiche Defi-
nitionsversuche des Begriffs Mode aus unterschiedlichen Perspek-
tiven verschiedener Wissenschaften. Hermanns definiert Mode als
54
Man unterscheidet zwischen pflanzlichen textilen Rohstoffen wie bspw.
Leinen, Jute, Sisal und Baumwolle und tierischen textilen Rohstoffen wie
bspw. Schafwolle und Seide. Vgl. o.V.1 (2006)
55
Vgl. Ebenda
56
Vgl. o.V.2 (2006)
57
Vgl. Ahrens, K.; Pittner, H. (2005), S. 242
14
,,eine durch das menschliche Streben nach Abhebung und Anpas-
sung bewirkte Änderung der Lebens- und Konsumgewohnheiten
breiter Bevölkerungsschichten.., die nach einer gewissen Zeit
durch eine erneute Veränderung aufgehoben wird.
58
Das Phäno-
men der Zukunftgerichtetheit innerhalb der Mode formulieren
bspw. Armani ,,Mode ist immer eine Mischung aus dem, was gera-
de kommt, und dem, was gerade geht."
59
und Lagerfeld: ,,Der
Mode entkommt man nicht. Denn auch wenn Mode aus der Mode
kommt, ist das schon wieder Mode."
60
Der Begriff der Mode richtet
sich jedoch nicht ausschließlich auf den Bereich Bekleidung, er
soll allerdings für diese Arbeit auf den Bekleidungsbereich be-
grenzt werden. Betrachtungsperspektive der Arbeit ist die der tex-
tilen Luxusmarkenhersteller, ohne Fokussierung auf einen be-
stimmten geographischen Markt aufgrund der globalen Branchen-
struktur. Die Handelsperspektive wird nicht untersucht. Als Luxus-
textilmarken werden die ,,klassischen" textilen Luxusmarken wie
bspw. Chanel, Dior, etc, betrachtet.
2.2.2 Struktur des Marktes für Luxustextilgüter
Reitzle
61
bezeichnet Luxusprodukte als ,,Schrittmacher der Volks-
wirtschaft"
62
und betont die Bedeutung der vom Luxus ausgehen-
den Impulse für die Wirtschaft. Die wirtschaftliche Bedeutung des
Luxusgütermarktes ist in den vergangenen Jahren beträchtlich
gestiegen.
63
Trotz einiger Umsatzeinbrüche
64
in den letzten Jah-
58
Vgl. Hermanns, A. (1991), S. 16
59
Armani, G. (2006)
60
Lagerfeld, K. (2006)
61
Ehemals verantwortlich für die Luxusmarken des Ford-Konzerns
62
Vgl. Reitzle, W. (2001), S. 88
63
Vgl. Cagnoli, G., Gutkowski, K.; Ruess, A., zitiert nach Reich, C. (2005),. S. 1
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2006
- ISBN (eBook)
- 9783832498429
- ISBN (Paperback)
- 9783838698427
- DOI
- 10.3239/9783832498429
- Dateigröße
- 881 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Münster – Wirtschaftswissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2006 (September)
- Note
- 2,0
- Schlagworte
- marketing public relations corporate identity bekleidungsindustrie markenführung
- Produktsicherheit
- Diplom.de