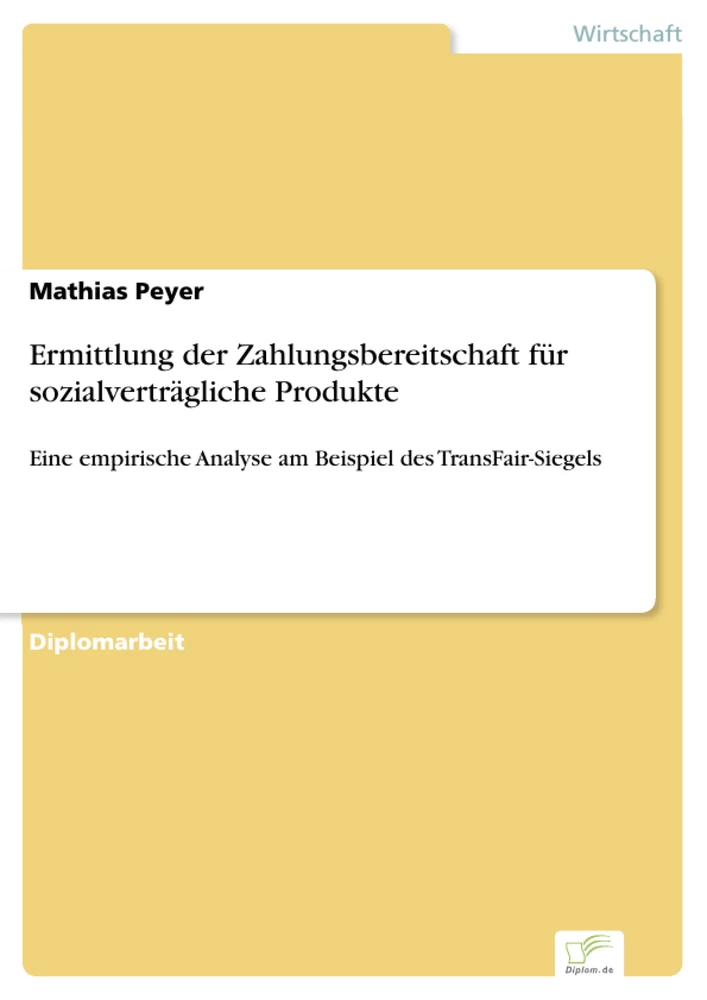Ermittlung der Zahlungsbereitschaft für sozialverträgliche Produkte
Eine empirische Analyse am Beispiel des TransFair-Siegels
©2005
Diplomarbeit
101 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Mit Aufkommen der Kapitalismusdebatte im Frühjahr 2005 wurde insbesondere die soziale Verantwortung der Unternehmen und damit implizit das sozialverträgliche Handeln durch Politiker und Medien hinterfragt. Auf diese Weise geriet die soziale Verantwortung deutscher Unternehmen im eigenen Land in die öffentliche Diskussion und gewann neuerliche Aktualität. Jedoch ist dieses Thema längst nicht neu und wird im Rahmen der Globalisierung schon lange diskutiert. Schon vor über 30 Jahren wurde die Stichting SOS-Wereldhandel-Gesellschaft in den Niederlanden für den Import von fair gehandelten Waren gegründet und damit der Start für den weltweit fairen Handel gegeben.
Auch in Deutschland gründeten sich in kurzer Folge viele Aktionsgruppen und Initiativen, die den alternativen Handel förderten. Dennoch gibt es nur sehr vereinzelt Untersuchungen zu dieser Thematik. Gerade wenn es explizit um die Messung der Preisbereitschaft der Konsumenten für den Absatz fair gehandelter und damit sozialverträglicher Produkte geht, sind nur wenig aussagekräftige Studien zu finden. Diese Arbeit soll daher einen Beitrag leisten, die Forschungslücke zu schließen. Zusätzlich werden weiterführenden Fragestellungen zu sozialverträglichen Produkten beantwortet.
Da der Vertrieb sozialverträglicher Produkte eng mit dem fairen Handel verzahnt ist, müssen einige Besonderheiten beachtet werden. Wie sich im Laufe der Arbeit zeigen wird, bemüht sich der faire Handel um den Spagat zwischen dem Vertrieb im kommerziellen Handel und auf der alternativen Ebene. Diese Studie wird, auch in Erwartung sehr geringer Zahlungsbereitschaften, die Erhebung unabhängig davon durchführen, wo und ob der Konsument alternative Produkte kauft. In einer möglichst realistischen Kaufsituation sollen sozialverträgliche Produkte in direkter Konkurrenz zu anderen Produkten stehen. Auf diese Weise lassen sich einerseits wirkliche Kaufwahrscheinlichkeiten und Marktanteile schätzen.
Jedoch ist zu beachten, dass in Deutschland diese Angebotssituation (noch) nicht überall in dieser Form zu finden ist. Dass diese Angebotssituation aber keine Zukunftsmusik sein muss, zeigen Entwicklungen in der Schweiz und eine stetige Zunahme sozialverträglicher Produkte auch im kommerziellen Handel in Deutschland. Daher können die ermittelten Ergebnisse als Prognose für künftige Angebotssituationen verstanden werden.
Gang der Untersuchung:
Im Kapitel 2 wird zunächst eine Einführung in das Thema der […]
Mit Aufkommen der Kapitalismusdebatte im Frühjahr 2005 wurde insbesondere die soziale Verantwortung der Unternehmen und damit implizit das sozialverträgliche Handeln durch Politiker und Medien hinterfragt. Auf diese Weise geriet die soziale Verantwortung deutscher Unternehmen im eigenen Land in die öffentliche Diskussion und gewann neuerliche Aktualität. Jedoch ist dieses Thema längst nicht neu und wird im Rahmen der Globalisierung schon lange diskutiert. Schon vor über 30 Jahren wurde die Stichting SOS-Wereldhandel-Gesellschaft in den Niederlanden für den Import von fair gehandelten Waren gegründet und damit der Start für den weltweit fairen Handel gegeben.
Auch in Deutschland gründeten sich in kurzer Folge viele Aktionsgruppen und Initiativen, die den alternativen Handel förderten. Dennoch gibt es nur sehr vereinzelt Untersuchungen zu dieser Thematik. Gerade wenn es explizit um die Messung der Preisbereitschaft der Konsumenten für den Absatz fair gehandelter und damit sozialverträglicher Produkte geht, sind nur wenig aussagekräftige Studien zu finden. Diese Arbeit soll daher einen Beitrag leisten, die Forschungslücke zu schließen. Zusätzlich werden weiterführenden Fragestellungen zu sozialverträglichen Produkten beantwortet.
Da der Vertrieb sozialverträglicher Produkte eng mit dem fairen Handel verzahnt ist, müssen einige Besonderheiten beachtet werden. Wie sich im Laufe der Arbeit zeigen wird, bemüht sich der faire Handel um den Spagat zwischen dem Vertrieb im kommerziellen Handel und auf der alternativen Ebene. Diese Studie wird, auch in Erwartung sehr geringer Zahlungsbereitschaften, die Erhebung unabhängig davon durchführen, wo und ob der Konsument alternative Produkte kauft. In einer möglichst realistischen Kaufsituation sollen sozialverträgliche Produkte in direkter Konkurrenz zu anderen Produkten stehen. Auf diese Weise lassen sich einerseits wirkliche Kaufwahrscheinlichkeiten und Marktanteile schätzen.
Jedoch ist zu beachten, dass in Deutschland diese Angebotssituation (noch) nicht überall in dieser Form zu finden ist. Dass diese Angebotssituation aber keine Zukunftsmusik sein muss, zeigen Entwicklungen in der Schweiz und eine stetige Zunahme sozialverträglicher Produkte auch im kommerziellen Handel in Deutschland. Daher können die ermittelten Ergebnisse als Prognose für künftige Angebotssituationen verstanden werden.
Gang der Untersuchung:
Im Kapitel 2 wird zunächst eine Einführung in das Thema der […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Mathias Peyer
Ermittlung der Zahlungsbereitschaft für sozialverträgliche Produkte
Eine empirische Analyse am Beispiel des TransFair-Siegels
ISBN-10: 3-8324-9735-8
ISBN-13: 978-3-8324-9735-4
Druck Diplomica® GmbH, Hamburg, 2006
Zugl. Universität Potsdam, Potsdam, Deutschland, Diplomarbeit, 2005
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2006
Printed in Germany
Inhaltsverzeichnis
I
Inhaltsverzeichnis
ABBILDUNGSVERZEICHNIS...III
TABELLENVERZEICHNIS ... IV
ABKÜRZUNGS- UND SYMBOLVERZEICHNIS...V
1
EINLEITUNG... 1
1.1
R
ELEVANZ DES
T
HEMAS UND
Z
IELSETZUNG DER
A
RBEIT
... 1
1.2
G
ANG DER
U
NTERSUCHUNG
... 2
2
DAS PRINZIP SOZIALVERTRÄGLICHKEIT ... 4
2.1
S
OZIALE
V
ERANTWORTUNG UMSETZEN
... 4
2.1.1
CSR im Zuge der Nachhaltigkeitsdebatte... 4
2.1.2
Sozialstandards als Voraussetzung ... 6
2.1.3
Sozialverträgliche Produkte ... 7
2.2
E
THISCHE
W
ARENZEICHEN
... 9
2.2.1
Der Begriff ,,ethisches Warenzeichen" ... 9
2.2.2
Vergabe von ethischen Warenzeichen ... 11
2.2.3
Wirkungen und Probleme ethischer Warenzeichen... 13
2.3
M
ARKTCHANCEN DER
S
OZIALVERTRÄGLICHKEIT
... 15
2.3.1
Preisbereitschaft für fair gehandelte Produkte ... 15
2.3.2
Nische vs. Gesamtmarktabdeckung ... 18
2.3.3
Sozialverträglichkeit als Marketinginstrument ... 20
3
METHODEN ZUR ERMITTLUNG DER ZAHLUNGSBEREITSCHAFT .. 22
3.1
B
ESTIMMUNG INDIVIDUELLER
Z
AHLUNGSBEREITSCHAFTEN
... 22
3.1.1
Direkte Preis- und Präferenzbefragung von Konsumenten... 22
3.1.2
Präferenzbefragung mittels Conjoint-Analyse ... 23
3.1.3
Vorlage ,,echter" Kaufangebote ... 26
3.2
B
ESTIMMUNG AGGREGIERTER
Z
AHLUNGSBEREITSCHAFTEN
... 27
3.2.1
Marktdatenanalyse und Preisexperimente ... 28
3.2.2
Wahlurteile mittels Discrete-Choice-Analyse ... 29
Inhaltsverzeichnis
II
4
EMPIRISCHE ERHEBUNG DER ZAHLUNGSBEREITSCHAFT ... 38
4.1
U
NTERSUCHUNGSDESIGN
... 38
4.1.1
Aufgaben und Modellvorstellung... 38
4.1.2
Produktauswahl und Fragebogenkonstruktion ... 40
4.1.3
Erhebung der Daten ... 44
4.2
D
ATENANALYSE
... 46
4.2.1
Deskriptive Analyse ... 46
4.2.2
Modellprüfungen im Rahmen der DCA ... 52
4.2.3
Parameterinterpretation... 60
4.2.4
Marktanteile und Zahlungsbereitschaften ... 65
4.3
E
RGEBNISSE
... 72
5
FAZIT ... 75
5.1
K
RITISCHE
W
ÜRDIGUNG
... 75
5.2
M
ARKETINGIMPLIKATIONEN UND
A
USBLICK
... 77
LITERATURVERZEICHNIS ... 80
Abbildungsverzeichnis
III
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1:
Auswahl ethischer Warenzeichen... 11
Abbildung 2:
Verlauf der logistischen Funktion ... 34
Abbildung 3:
Grundmodell der Saftauswahl ... 40
Abbildung 4:
Den Probanden präsentiertes Alternativenset... 42
Abbildung 5:
Geschlechteraufteilung und Saftauswahl... 47
Abbildung 6:
Deskriptive Statistiken zum Saftkauf ... 47
Abbildung 7:
Geschlechtsspezifische Saftauswahl... 48
Abbildung 8:
Siegelerkennung und bedeutung... 48
Abbildung 9:
Aussagen zum T
RANS
F
AIR
-Siegel... 50
Abbildung 10: Sozialsiegel und Siegelvertrauen... 51
Abbildung 11: Siegelvertrauen und Vertrauenserhöhung ... 51
Abbildung 12: Marktanteilsveränderungen durch das T
RANS
F
AIR
-Siegel... 67
Abbildung 13: Preis-Nutzenwirkung ... 67
Abbildung 14: Zahlungsbereitschaft für Pfanner und Albi ... 69
Abbildung 15: Zahlungsbereitschaft für Amecke und Drink ... 69
Abbildung 16: Marktanteile der T
RANS
F
AIR
-Kenner ... 71
Abbildung 17: Marktanteile der T
RANS
F
AIR
-Käufer... 72
Tabellenverzeichnis
IV
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1:
Preisvektoren ... 43
Tabelle 2:
Zweiter Fragebogenteil... 44
Tabelle 3:
Modell 1... 54
Tabelle 4:
Modell 2... 57
Tabelle 5:
Modell 3a... 58
Tabelle 6:
Klassifikationsmatrix... 60
Tabelle 7:
Modell 3b... 62
Tabelle 8:
Marktanteile und Marktanteilsveränderungen... 66
Abkürzungs- und Symbolverzeichnis
V
Abkürzungs- und Symbolverzeichnis
A
k
Alternativenset für Konsument k
ACA
Adaptive Conjoint Analyse
AEDT European Association of National Organizations of Textile Retailers
B
Logit-Koeffizient
b
j
Koeffizient der Variable j
BMU
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
CBC
Choice-based-Conjoint
CCC
Clean Clothes Campaign
CSR
Corporate Social Responsibility
DCA
Discrete-Choice-Analyse
e
Eulersche Zahl
e
B
Effektkoeffizient
EFTA European Fair Trade Association
ETI
Ethical Trading Initiative
EU
European Union
gepa
Gesellschaft zur Förderung der Partnerschaft mit der Dritten Welt
GRI
Global Reporting Initiative
GTZ
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH
ICC
International Chamber of Commerce
ILO
International Labour Organization
imug
Institut für Markt Umwelt Gesellschaft
i
Produktindex
IIA
Independence of Irrelevant Alternatives
IÖW
Institut für ökologische Wirtschaftsforschung
ISO
International Organization for Standardization
k
Konsumentenindex
LL
v
maximierter Log-Likelihood-Wert des vollständigen Modells
LL
0
maximierter Log-Likelihood-Wert des Nullmodells
LR
Likelihood-Ratio
N
Stichprobenumfang
NRO
Nichtregierungsorganisation
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development
Abkürzungs- und Symbolverzeichnis
VI
P
ik
Wahrscheinlichkeit, dass Konsument k Produkt i auswählt
R
2
Pseudo-R
2
; Anteil der erklärten Variation des logistischen Regressionsmodells
s
bj
Standardfehler von b
j
S
k
Vektor für persönliche Merkmale von k
S
k
*
Vektor für unbeobachtete persönliche Merkmale von k
SA
Social Accountability
SE
Standard Error
U
ik
Nutzen von k für i
UN
United Nations
USP
Unique Selling Proposition
v
deterministische Nutzenkomponente
Z
ik
Vektor für subjektiv wahrgenommene Eigenschaften von k und i
Z
ik
*
Vektor für unbeobachtete und subjektiv wahrgenommene Eigenschaften von k
und i
Vektor für die Gewichtung der Produktattribute
0
alternativenspezifischer Parameter für Design/Marke
p
Parameter für den Nutzen der generischen Preisgröße
t
Parameter für den Nutzen des T
RANS
F
AIR
-Siegels
Vektor, der die Nutzenbewertung der Produktattribute in Abhängigkeit der
persönlichen Merkmale angibt
s
Parameter, der den Einfluss des Geschlechts angibt
ik
stochastische Nutzenkomponente
ik
Spezifikations- und Messfehler
Element aus...
1 Einleitung
1
1 Einleitung
1.1 Relevanz des Themas und Zielsetzung der Arbeit
Mit Aufkommen der Kapitalismusdebatte im Frühjahr 2005 wurde insbesondere die
soziale Verantwortung der Unternehmen und damit implizit das sozialverträgliche Han-
deln durch Politiker und Medien hinterfragt. Auf diese Weise geriet die soziale Verant-
wortung deutscher Unternehmen im eigenen Land in die öffentliche Diskussion und
gewann neuerliche Aktualität. Jedoch ist dieses Thema längst nicht neu und wird im
Rahmen der Globalisierung schon lange diskutiert. Schon vor über 30 Jahren wurde die
,,Stichting SOS-Wereldhandel"-Gesellschaft in den Niederlanden für den Import von
fair gehandelten Waren gegründet und damit der Start für den weltweit fairen Handel
gegeben (vgl. Misereor et al. 2000, S. 7). Auch in Deutschland gründeten sich in kurzer
Folge viele Aktionsgruppen und Initiativen, die den alternativen Handel förderten.
1
Dennoch gibt es nur sehr vereinzelt Untersuchungen zu dieser Thematik (vgl. ebd. S. 8).
Gerade wenn es explizit um die Messung der Preisbereitschaft der Konsumenten für den
Absatz fair gehandelter und damit sozialverträglicher Produkte geht, sind nur wenig
aussagekräftige Studien zu finden. Diese Arbeit soll daher einen Beitrag leisten, die
Forschungslücke zu schließen. Zusätzlich werden weiterführenden Fragestellungen zu
sozialverträglichen Produkten beantwortet.
Da der Vertrieb sozialverträglicher Produkte eng mit dem fairen Handel verzahnt ist,
müssen einige Besonderheiten beachtet werden. Wie sich im Laufe der Arbeit zeigen
wird, bemüht sich der faire Handel um den Spagat zwischen dem Vertrieb im kommer-
ziellen Handel und auf der alternativen Ebene. Diese Studie wird, auch in Erwartung
sehr geringer Zahlungsbereitschaften, die Erhebung unabhängig davon durchführen, wo
und ob der Konsument alternative Produkte kauft. In einer möglichst realistischen
Kaufsituation sollen sozialverträgliche Produkte in direkter Konkurrenz zu anderen
Produkten stehen. Auf diese Weise lassen sich einerseits ,,wirkliche" Kaufwahrschein-
lichkeiten und Marktanteile schätzen. Jedoch ist zu beachten, dass in Deutschland diese
Angebotssituation (noch) nicht überall in dieser Form zu finden ist. Dass diese Ange-
botssituation aber keine Zukunftsmusik sein muss, zeigen Entwicklungen in der
1
Auf eine Unterscheidung von alternativem und fairem Handel soll hier verzichtet werden. Für den
interessierten Leser sei auf die ausführliche Darstellung in Valio-Ottowitz (1997, S. 4ff.) hingewiesen.
1 Einleitung
2
Schweiz und eine stetige Zunahme sozialverträglicher Produkte auch im kommerziellen
Handel in Deutschland. Daher können die ermittelten Ergebnisse als Prognose für künf-
tige Angebotssituationen verstanden werden.
1.2 Gang der Untersuchung
Im Kapitel 2 wird zunächst eine Einführung in das Thema der Sozialverträglichkeit ge-
geben. Dabei wird die Umsetzung der Sozialverträglichkeit in der betrieblichen Praxis
erläutert (Kap. 2.1), wobei insbesondere auf die aktuelle CSR-Diskussion eingegangen
wird (Kap. 2.1.1), Sozialstandards erläutert werden (Kap. 2.1.2) und nach einer Be-
griffsdefinition für Sozialverträglichkeit gesucht wird (Kap. 2.1.3). Im nachfolgenden
Kapitel 2.2 soll dem Leser nahegebracht werden, was unter ethischen Warenzeichen zu
verstehen ist und wie deren Anwendung in der Praxis erfolgt. Da in dieser Arbeit die
Zahlungsbereitschaft für sozialverträgliche Produkte im Fokus steht, werden in Kapitel
2.3.1 vorhandene Studien zu diesem Thema beleuchtet. Darauf aufbauend schließt sich
eine Diskussion über die Marktpräsenz dieser Produkte im Kapitel 2.3.2 an, bevor mit
den Möglichkeiten zur Anwendung als Marketinginstrument (Kap. 2.3.3) die Ausfüh-
rungen zur Sozialverträglichkeit abgeschlossen werden.
Aufgabe des dritten Kapitel ist es, einen Überblick über gängige Methoden zur Ermitt-
lung von Zahlungsbereitschaften zu geben. Dabei werden unter Kapitel 3.1 Verfahren
veranschaulicht, die Zahlungsbereitschaften auf individueller Ebene ermitteln. Neben
den klassischen Methoden wie direkter Preisbefragung (Kap. 3.1.1) und der Conjoint-
Analyse (Kap. 3.1.2), wird auch die Vorgehensweise bei Auktionen (Kap. 3.1.2) erklärt.
Anschließend werden Methoden beleuchtet, die auf aggregiertem Niveau die Zahlungs-
bereitschaft messen (Kap. 3.2). Nach Vorstellung der Marktdatenanalyse (Kap. 3.2.1)
wird das Hauptaugenmerk auf Kapitel 3.2.2 liegen. Da im anschließenden empirischen
Kapitel die Discrete-Choice-Analyse (DCA) zur Anwendung kommt, soll sie auch et-
was ausführlicher behandelt werden.
Im Kapitel 4 werden die Erkenntnisse aus den beiden vorangegangenen Kapiteln ge-
nutzt, um die Zahlungsbereitschaft für sozialverträgliche Produkte auf empirischem
Wege mittels diskreter Entscheidungsanalyse am Beispiel von Orangensaft zu ermitteln.
Nach Festlegung der Untersuchungsaufgaben (Kap. 4.1.1) und der Fragebogenkonstruk-
tion (Kap. 4.1.2) wird die Art der Datenerhebung erläutert (Kap. 4.1.3). Die eigentliche
1 Einleitung
3
Datenanalyse beginnt mit der deskriptiven Auswertung (Kap. 4.2.1), um einen Einblick
in die erhobenen Daten zu bekommen. Unter Berücksichtigung dieser Ergebnisse wird
anschließend mittels diskreter Entscheidungsanalyse nach einem Modell gesucht, wel-
ches die Kaufentscheidungen möglichst optimal erklärt (Kap. 4.2.2). Für das beste Mo-
dell werden dann in Kapitel 4.2.3 die Parameter interpretiert und schließlich Marktantei-
le und Zahlungsbereitschaften berechnet.
Abschließend erfolgt in Kapitel 5 eine kritische Würdigung der Ergebnisse (Kap. 5.1).
Dabei sollen Fehlerquellen in der Analyse herausgestellt und Verbesserungsmöglichkei-
ten für zukünftige Untersuchungen angeführt werden. Wie die gewonnenen Resultate
im Marketing Anwendung finden können, wird im letzten Kapitel 5.2 dargelegt.
2 Das Prinzip Sozialverträglichkeit
4
2 Das Prinzip Sozialverträglichkeit
In diesem Kapitel soll eine erster Einblick in das Thema der Sozialverträglichkeit gege-
ben werden. Zuerst erfolgt die Einordnung in die Metaebene der Nachhaltigkeit inklusi-
ve einer Begriffsbestimmung für sozialverträgliche Produkte. Um das Konzept der sozi-
alen Verantwortung auf die eigenen Produkte zu übertragen, ist eine entsprechende
Kennzeichnung nötig. Das Kapitel 2.2 setzt sich daher mit den ethischen Warenzeichen
auseinander. Im dritten Unterkapitel wird der Frage nach dem Nutzen eines solchen
Konzeptes aus Unternehmens- und Verbrauchersicht nachgegangen.
2.1 Soziale Verantwortung umsetzen
Die Rolle der sozialen Verantwortung soll nun in den Kontext der nachhaltigen Ent-
wicklung eingeordnet und unter dem Begriff der ,,Corporate Social Responsibility"
(CSR) weiter erläutert werden. Im Kapitel 2.1.2 schließt sich eine Einführung in die
Sozialstandards an. Dabei wird auf verschiedene existierende Standards und deren prak-
tische Anwendung hingewiesen. Im letzten Teil dieses Abschnittes wird nach einer Ar-
beitsdefinition für sozialverträgliche Produkte gesucht, die als Grundlage für den empi-
rischen Teil dient.
2.1.1 CSR im Zuge der Nachhaltigkeitsdebatte
Das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung wurde erstmalig von der Brundtland-
Kommission 1987 veröffentlicht und auf der Konferenz von Rio im Jahre 1992 weiter-
entwickelt.
2
Seither wird das Thema umfangreich diskutiert (vgl. Deutscher Bundestag
1998, S. 27; Joos et al. 1999, S. 2).
Das vom englischen Begriff Sustainable Development übersetzte Leitbild beinhaltet
eine ökonomische, ökologische und soziale Perspektive (vgl. Balderjahn 2004, S. 3) und
wird auch als Drei-Säulenmodell bezeichnet. Mit dem ökonomischen Aspekt werden
vor allem Umsatz-, Marktanteils-, und Gewinnziele des Unternehmens impliziert (vgl.
Deutscher Bundestag 1998, S. 32), aber auch der Beitrag von Unternehmen Arbeitsplät-
ze und Wohlstand zu schaffen. Alle Maßnahmen zum Umweltschutz können unter der
ökologischen Dimension subsumiert werden. Die soziale Dimension definiert Balder-
2
Der Ursprung der Nachhaltigkeit findet sich in der Forstwirtschaft des 17. Jahrhunderts. Danach durf-
te nur soviel Holz gefällt werden, wie auch tatsächlich nachwächst (vgl. Nutzinger 1995, S. 207ff.).
2 Das Prinzip Sozialverträglichkeit
5
jahn als: ,,...ein Maß für die Sozialverträglichkeit unternehmerischen Handelns, und
erfasst die Gestaltung der Beziehungen zu Anspruchsgruppen." (Balderjahn 2004, S.
13). Obwohl in der Vergangenheit in Deutschland der Umweltaspekt in der Nachhaltig-
keitsproblematik im Vordergrund stand (vgl. Deutscher Bundestag 1998, S. 27; Empa-
cher/Wehling 2002, S. 7), wird darauf hingewiesen, dass die drei Dimensionen nicht
unabhängig voneinander betrachtet werden dürfen und vielfach Verknüpfungen beste-
hen (vgl. Umweltbundesamt 1997, S. 8). Wenn in dieser Arbeit die soziale Dimension
im Vordergrund steht, wird somit stets eine Verknüpfung mit der ökonomischen und
ökologischen Perspektive impliziert.
Eine nachhaltige bzw. verantwortungsvolle Unternehmensführung wird oft mit dem
Terminus Corporate Social Responsibility (CSR) gleichgesetzt. In der Literatur wird
dieser Begriff sehr vielfältig und teilweise wenig trennscharf verwendet.
3
Das unter-
schiedliche Verständnis von CSR resultiert aus den verschiedenen Standpunkten und
Anspruchsgruppen die davon Gebrauch machen (vgl. OECD 2001, S. 13). Jedoch soll
hier auf eine tiefergehende Diskussion verzichtet werden und die Begriffsauslegung der
Europäischen Kommission (2001, S. 4f.) als Grundlage dienen. Danach wird unter CSR
die Verpflichtung von Unternehmen verstanden, sich auf freiwilliger Basis für soziale
Belange und Umweltangelegenheiten gleichermaßen einzusetzen und diese in die
Wechselbeziehungen mit den Stakeholdern zu integrieren. CSR ist damit als Leitprinzip
einer nachhaltigen Unternehmensführung zu interpretieren. Die freiwillige Übernahme
von sozialer Verantwortung, also über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus, ist dabei
Kernpunkt. Sobald dem Unternehmen zusätzlich ökonomische Anreize geboten werden
und sich mit dem CSR-Konzept die Wettbewerbsfähigkeit steigern lässt, wird es zur
Adoption aus eigenem Antrieb heraus kommen, wie in Kapitel 2.3.3 gezeigt wird.
Die soziale Verantwortung kann hinsichtlich einer internen und einer externen Dimen-
sion wahrgenommen werden. Intern sind hauptsächlich Arbeitnehmerfragen wie Ar-
beitsschutz oder Human Ressource Management und umweltverträgliche Produktion
betroffen. Hingegen wird unter der externen Dimension die Berücksichtigung der vielen
Stakeholder wie Aktionäre, Händler, Lieferanten oder Behörden und deren Interessen
3
Zu einer umfassenden Differenzierung vgl. Schoenheit, Hansen (2004, S. 236ff.) aber auch Gray
(1999, S. 12); ISO (2004, S. 28f.) und Siemens AG (2002, S. 2ff.).
2 Das Prinzip Sozialverträglichkeit
6
verstanden. Bei den momentan am Markt beziehbaren sozialverträglichen Produkten
spielt insbesondere die externe Dimension eine bedeutende Rolle. Die Einhaltung der
Menschenrechte, globaler Umweltschutz und langfristige Beziehungen zu den Lieferan-
ten werden oft als Kriterien angelegt. Bevor nun der Terminus sozialverträglicher Pro-
dukte genauer veranschaulicht wird, soll die freiwillige Umsetzung von sozialer Ver-
antwortung und damit der Weg zur Sozialverträglichkeit von Unternehmen über Sozial-
standards aufgezeigt werden.
2.1.2 Sozialstandards als Voraussetzung
Soziales Engagement von Unternehmen ist kein neues Thema. Schon vor über 100 Jah-
ren profilierten sich moderne Unternehmen mit der Einführung von Mindestlöhnen oder
der Sozialversicherung. Zum Ende der 60er Jahre setzte eine verstärkte Diskussion um
Sozialbilanzen in den USA ein, die ihren Schwerpunkt in den 70er Jahren in Deutsch-
land fand (vgl. Clausen/Fischer 1996, S. 38). Dabei wurde die freiwillige Rechen-
schaftslegung über alle sozialen Auswirkungen der unternehmerischen Aktivitäten the-
matisiert. Jedoch wurden diese nicht rechtskräftig und durch fehlende Standards und
Kontrollinstanzen häufig zu Schönfärberei missbraucht. Immer weniger Unternehmen
stellten Sozialbilanzen auf und so schlief das Konzept ein (vgl. ebd., S.42f.). Mit
Aufkommen der Nachhaltigkeitsdebatte arbeitet die Global Reporting Initiative (GRI)
seit 1997 wieder am Aufbau von verbindlichen Richtlinien (vgl. Latzel 2003).
Viele Unternehmen legen sich heute Verhaltenskodizes auf, also Regeln die sie sich
selbst geben, und verpflichten sich zu deren Einhaltung bzw. Veröffentlichung. Nach
der Definition der EU sollte ein Kodex Mindeststandards enthalten, die auch für Liefe-
ranten und Nachunternehmen gelten (vgl. Europäische Kommission 2001, S. 28). Somit
sind Verhaltenskodizes auf internationaler Ebene ein Instrument, mit dem die Anwen-
dung sozialer Mindeststandards im gesamten Einflussbereich sichergestellt werden kann
(vgl. GTZ 2004, S. 3). Das Problem dabei ist die fehlende gesetzliche Regelung gerade
im globalen Kontext und die Einheitlichkeit solcher Standards. Unternehmen können
sich ihre Standards selbst definieren und es sind kaum Kontrollmöglichkeiten vorhan-
den. Daher werden in den letzten Jahren neben rechtlich bindenden politischen Vorga-
ben viele internationale freiwillige und allgemeingültige Vereinbarungen, sogenannte
"Codes of Conduct" von unabhängigen Institutionen entwickelt (vgl. Balderjahn 2004,
S. 23).
2 Das Prinzip Sozialverträglichkeit
7
Im Feld der sozialen Mindeststandards haben sich insbesondere die Kernarbeitsnormen
der International Labour Organization (ILO) durchgesetzt. Sie sind Grundlage fast aller
Verhaltenskodizes. Zu den auf den UN-Menschenrechtskonventionen basierenden ILO-
Kernarbeitsnormen gehören unter anderem die Abschaffung von Kinder- und Zwangs-
arbeit, Existenz sichernde Löhne, Vereinigungsfreiheit und ein Verbot von Diskriminie-
rung (vgl. GTZ 2004, S. 4). Diese Kernarbeitsnormen der ILO werden auch als Min-
destsozialstandards bzw. Schutzstandards bezeichnet.
Auf Grundlage dieser Standards entstand die Zertifizierungsinitiative Social Accounta-
bility (SA 8000), die 1998 von der Nichtregierungsorganisation Council for Economic
Priorities in Zusammenarbeit mit Wirtschaft und Wissenschaft entwickelt wurde. SA
8000 wird danach als weltweit konsensfähiger Nachhaltigkeitsstandard ständig weiter-
entwickelt und durch unabhängige Gutachter in den Unternehmen zertifiziert (vgl. Bal-
derjahn 2004, S. 32). Mit der Einführung eines Sozialmanagementsystems, Dokumenta-
tionspflichten und Überwachung der gesamten Wertschöpfungskette werden Grundla-
gen gelegt, um mit diesem Standard den Unterschied zwischen umweltschonend und
sozial fair hergestellten Produkten und Produkten, welche die Umwelt ausbeuten und
Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen ignorieren, zu machen (vgl. Gebhardt
2003).
Im Zuge der Standards der nachhaltigen Entwicklung gibt es noch weitere Initiativen
und Vereinbarungen, wie beispielsweise das Global Compact, die OECD-Richtlinien,
die schon erwähnten GRI und CSR-Europe oder die ICC-Charta (vgl. Balderjahn 2004,
S. 24ff.). Ebenso die Clean Clothes Campaign (CCC) oder der ETI Base Code von der
britischen Ethical Trading Initiative können dazu gezählt werden. Es soll jedoch bei der
Erläuterung des SA 8000 bleiben, da es von den offiziellen internationalen Standards
einerseits sehr weit verbreitet ist und andererseits stark auf die soziale Komponente und
damit, wie oben angeführt, auch auf sozialverträglich hergestellte Produkte bezogen ist.
Zur weiteren Ausführung über sozialverträgliche Produkte dient das nun folgende Kapi-
tel.
2.1.3 Sozialverträgliche Produkte
Der Ausdruck Sozialverträglichkeit wurde von Mayer-Abich eingeführt. Dabei versteht
er unter dem Begriff die ,,...Verträglichkeit mit der gesellschaftlichen Ordnung und
2 Das Prinzip Sozialverträglichkeit
8
Entwicklung..." (Mayer-Abich/Schefold 1981, S. 98). Da sich Gesellschaftsordnungen
aber unterscheiden und verändern, wird man nie eindeutig feststellen, ob etwas wirklich
sozialverträglich ist. Es werden immer fallweise Entscheidungen sein, die von vorgege-
ben Standards abhängig sind. Auch van den Daele (1993, S. 219ff.) geht von unklaren
Konturen des Konzepts Sozialverträglichkeit aus und kann sich Sozialverträglichkeits-
kriterien nicht unabhängig von politischen Zielvorgaben vorstellen. Ebenso fehlten für
Importprodukte jegliche produktbezogenen Sozialnormen (vgl. Wiemann 1996, S. 137).
Da solche Zielvorgaben, wie im vorangegangen Kapitel angeführt, in den letzten Jahren
aber verstärkt in den Vordergrund gerückt sind und diese einen fast weltweiten Konsens
über viele Gesellschaftsordnungen hinweg finden konnten, kann man solche Standards
inzwischen als Grundlage nutzen. Es ist jedoch zu beachten, dass diese einer ständigen
Anpassung unterliegen und lediglich einen Grundkonsens darstellen.
Eine andere Definition von Sozialverträglichkeit lässt sich bei Hinterberger/Welfens
(1994, S. 404) finden, wonach das Streben nach ,,...gerechter Verteilung von Lebens-
chancen..." als sozialverträglich bezeichnet wird. Laut dieser Definition wäre beispiels-
weise die Förderung einer gemeinschaftlichen Alters- und Krankenversicherung in ar-
men Länder sozialverträglich. Im Gegensatz dazu liefert Scherhorn (1994, S. 201) eine
Definition, die Sozialverträglichkeit über die Einstellung der Menschen definiert. Dabei
geht es um das Streben nach sozialer Gerechtigkeit und den Einsatz zum Schutz der
Schwächeren. Es lassen sich noch weitere Begriffsbestimmungen in der Literatur fin-
den
4
, die sich nach wert-konservativ bzw. wert-progressiv unterteilen lassen. Jedoch soll
auf weitere Definitionen an dieser Stelle verzichtet werden und stattdessen, aufbauend
auf der Definition von Mayer-Abich, mit Hilfe der oben erläuterten Sozialstandards das
sozialverträgliche Produkt genauer spezifiziert werden.
Ausgehend von den Sozialstandards können sozialverträgliche Produkte über den fairen
bzw. ethischen Handel definiert werden. Dabei haben sich mit der Zeit einige grundle-
gende Kriterien wie existenzsichernde Einkommen für die Produzenten, langfristige
Verträge, Vorfinanzierung und wenig Zwischenhandel herauskristallisiert (vgl. Valio-
Ottowitz 1997, S. 19). Insbesondere die Anforderungen an die internationalen Konven-
tionen zum Arbeits-, Sozial- und Umweltrecht sollten von allen am Produktionsprozess
4
Vgl. dazu u.a. Lübke (1986), Müller-Reißmann et al. (1989) oder auch Zelewski (1987).
2 Das Prinzip Sozialverträglichkeit
9
Beteiligten eingehalten werden. Danach können Produkte also dann als sozialverträglich
bezeichnet werden, wenn sie die Kriterien des fairen Handels erfüllen (vgl. Kretsch-
mer/von Koerber 1999). Je nach Produkt können sich diese Kriterien vereinzelt unter-
scheiden, wie beispielsweise die Höhe der garantierten Preise oder eine direkte Bezah-
lung an den Erzeuger, wodurch die Begriffsbestimmung nicht eindeutig ist.
Definitionen in wissenschaftlichen Veröffentlichungen sind zumeist breiter angelegt
und erfassen die gesamte Klasse der nachhaltigen Produkte. Explizite Klärungen was
sozialverträgliche Produkte sind, finden sich bisher kaum. Ausgehend von einer marke-
tingtheoretischen Sicht müssen solche Produkte jedoch wettbewerbsfähig sein und
zumindest einen Nutzen für den Kunden stiften, der mit anderen Produkten vergleichbar
ist. Unter dieser Bedingung spricht man von einem sozialverträglichen Produkt, wenn es
im gesamten Prozess von Herstellung bis Entsorgung Menschen und ihre sozialen Ge-
meinschaften weder persönlichen noch sozialen Gefahren aussetzt (vgl. Balderjahn
2004, S. 174).
2.2 Ethische Warenzeichen
Die Kennzeichnung sozialverträglicher Produkte für den Konsumenten kann auf ver-
schiedenen Wegen erfolgen. So können beispielsweise vergleichende Warentests, Pro-
duktlinienanalysen, Sozialgütesiegel oder Unternehmenstests zur Verbraucherinforma-
tion herangezogen werden (vgl. imug 2002, S. 29). In dieser Arbeit sind insbesondere
die Sozialgütesiegel, auch ethische Warenzeichen oder Sozialzeichen genannt, von ho-
her Relevanz. Sie sind einerseits für den Verbraucher im Moment der Kaufentscheidung
sichtbar und damit die unmittelbarsten und effektivsten Informationsmittel (vgl. AEDT
2002, S. 8). Andererseits brechen sie die vorab erläuterten, prozessbezogenen Sozial-
standards auf die Produktebene herunter und sind daher notwendige Vorraussetzung für
den empirischen Teil. Nach der Begriffsfindung geht es in Kapitel 2.2.2 um die Verga-
bepraxis der ethischen Warenzeichen, bevor im dritten Unterkapitel Probleme und Wir-
kungen dieser erläutert werden.
2.2.1 Der Begriff ,,ethisches Warenzeichen"
Um Produkteigenschaften für Verbraucherinnen und Verbraucher auf einen Blick er-
kennbar zu machen und somit Kaufentscheidungen zu erleichtern, wird das Instrument
der Warenzeichen benutzt. Ein Warenzeichen kann synonym auch als Symbol, Emblem,
2 Das Prinzip Sozialverträglichkeit
10
Logo oder Label bezeichnet werden, welches auf Produkten bzw. auf deren Verpackung
aufgebracht ist. Diese Zeichen können dabei auf eine besondere Qualität von Produkten
wie gesundheitliche, soziale oder ökologische Eigenschaften hinweisen. Damit dienen
sie der Abgrenzung gegenüber anderen Produkten mit gleichem Gebrauchszweck, die
diese Eigenschaften nicht aufweisen (vgl. Landmann 1999, S. 29). Ferner sind Labels
freiwillige Bezeichnungen für Produktmerkmale oder die Produktionsmethode und
können den Unternehmen nicht verbindlich vorgeschrieben werden.
Um den Begriff ethisches Warenzeichen detailliert zu erfassen, muss auch das Ver-
ständnis von Ethik in diesem Zusammenhang geklärt werden. Ethik fragt nach Verant-
wortlichkeit des menschlichen Handelns. Bei ethischen Warenzeichen spricht man dem-
zufolge von einem Symbol, das für ein verantwortlich hergestelltes Produkt steht. Je-
doch gibt es keine allgemein anerkannte und verbindliche Ethik, wodurch der Begriff an
Unschärfe gewinnt und einer Spezifizierung bedarf. Laut Landmann geht es vielmehr
um gebündelte Informationen, die von der Entstehung bis zum Verkauf des Produktes
spezielle soziale Forderungen beachten. Ethische Warenzeichen geben also eine zu-
sammengefasste Bewertung über die bessere Sozialverträglichkeit eines Produktes ab
(vgl. ebd. S. 29f.). Damit wird die Funktion des Sozialzeichens als Bindeglied zwischen
dem Verbraucher und den vom Unternehmen anerkannten Verhaltenskodizes deutlich
(vgl. AEDT 2002, S. 8). Der Konsument kann beim Vorfinden eines solchen Warenzei-
chens davon ausgehen, dass bestimmte Sozialstandards vom Unternehmen eingehalten
werden. Hier stellt sich wieder das Problem der verschiedensten existierenden Standards
was zur Folge hat, dass der Begriff Sozialgütesiegel unterschiedlich ausgelegt wird. In
dieser Arbeit wird die Definition aus dem Grünbuch der EU als Grundlage genommen.
Danach sind Sozialgütesiegel ,,Textangaben und bildliche Angaben auf Produkten, die
die Kaufentscheidungen der Verbraucher beeinflussen wollen durch Zusicherungen in
Bezug auf die sozialen und ethischen Auswirkungen einer Geschäftstätigkeit auf andere
Stakeholder" (vgl. Europäische Kommission 2001, S. 29).
Das erste Sozialgütesiegel wurde 1988 in den Niederlanden als ,,Max-Havelaar-Siegel"
für Kaffee aus fairem Handel eingeführt. Fünf Jahre später kam mit dem T
RANS
F
AIR
-
Siegel auch in Deutschland ein solches Zeichen auf den Markt, das neben fair gehandel-
ten Kaffee eine sich ständig erweiterndes Angebot im Nahrungsmittelbereich bietet
(vgl. Piepel 2000, S. 13). Weitere Siegel wie das ,,Rugmark"-Zeichen für Teppiche oder
2 Das Prinzip Sozialverträglichkeit
11
das ,,Flower-Label" sind entstanden und bieten dem Konsumenten in Europa auch im
Non-Food-Sektor die Möglichkeit zum Kauf sozialverträglicher Produkte (siehe Abbil-
dung 1). Inzwischen sind auch über die Grenzen Europas hinaus Gütesiegelinitiativen
gegründet worden, wie Beispiele aus Nordamerika und Asien zeigen (vgl. Valio-
Ottowitz 1997, S. 52f.). Im Jahre 2003 wurde das alte, deutsche T
RANS
F
AIR
-Siegel er-
setzt und international mit dem ,,Max Havelaar-Siegel" normiert. Somit tritt es nun
weltweit mit gleichem Gesicht auf (siehe Abbildung 1).
Abbildung 1: Auswahl ethischer Warenzeichen (Quelle: Eigene Darstellung)
Um diese Siegel an den Markt, also zum Konsumenten zu bringen, haben sich in Euro-
pa verschiedene Importorganisationen unter dem Dach der European Fair Trade Associ-
ation (EFTA) zusammengeschlossen. Diese hat sich zur Aufgabe gemacht, den Handel
mit diesen Produkten zu fördern und die Vermarktung der nationalen Organisationen zu
koordinieren (vgl. ebd. S. 51). Die Gesellschaft zur Förderung der Partnerschaft mit der
Dritten Welt (gepa) ist dabei die deutsche Handelsorganisation, die mit einer breiten
Palette sozialverträglicher Produkte ihre Projektpartner in aller Welt unterstützt. Ver-
marktungswege sind dabei hauptsächlich die Weltläden, jedoch nehmen auch Einzel-
handel, Katalogversand und Großverbraucher eine zunehmend wichtigere Stellung ein
(vgl. ebd. S. 35f.).
2.2.2 Vergabe von ethischen Warenzeichen
Wie bereits erwähnt sind Sozialstandards Grundlage für die Vergabe von ethischen Wa-
renzeichen. Damit solche Siegel auf dem Produkt erscheinen, muss ein Produzent den
Nachweis erbringen, dass er diese Sozialstandards einhält (vgl. Landmann 1999, S. 30).
Abhängig von Label und Vergabeinstitution gibt es aber auch weitere Vergabekriterien
wie den Bau sozialer Einrichtungen oder das Einzahlen von Geldern in Sozialfonds
Blumen:
,,Flower-Label"
Teppiche:
,,Rugmark-Zeichen"
Lebensmittel/ Textilien:
,,T
RANS
F
AIR
"
(alt)
(neu)
2 Das Prinzip Sozialverträglichkeit
12
(vgl. ebd., S. 32). Für die endliche Vergabe des Siegels kann dann entweder eine ganz-
heitliche Betrachtung des Produktes in Frage kommen oder lediglich ein Kriterium ge-
wählt werden, wie es bei dem Rugmark-Zeichen oder Kaleen-Siegel für Teppiche ohne
Kinderarbeit der Fall ist (vgl. AEDT 2002, S. 19f.).
Nun stellt sich die Frage, wer diese Gütesiegel vergeben darf. Dabei ist zwischen
selbstverliehenen oder staatlichen Labeln sowie denen von Nichtregierungsorganisatio-
nen (NRO's) zu unterscheiden (vgl. Europäische Kommission 2001, S. 22). Viele Her-
steller kreieren sich ihre eigenen Siegel, um auf die Sozialverträglichkeit ihrer Produkte
aufmerksam zu machen. Ein Beispiel dafür ist das PureWear-Zeichen, das von der Fir-
ma Otto in Zusammenarbeit mit gemeinnützigen Institutionen erarbeitet wurde. Das
Problem dabei ist die fehlende Vergleichbarkeit und Kontrolle, denn die Unternehmen
hegen in erster Linie Absatzinteressen. Die tatsächliche soziale Wirksamkeit oder die
Unzulänglichkeit solcher Siegel können nur von Fall zu Fall geprüft werden. Das glei-
che Dilemma ergibt sich bei der Vergabe und Kontrolle von Siegeln von privaten Fir-
men. So vergibt beispielsweise die Firma AMANA für eine Schutzgebühr das LINK-
Label an Unternehmen die den SA8000 Standard einhalten (vgl. AEDT 2002, S. 8).
Eine Antwort darauf sind staatliche Labels, wie sie sich für Umweltsiegel bereits be-
währt haben. Dabei ist die Regierung für die Vergabe und Kontrolle verantwortlich. Die
Erarbeitung der Kriterien wird in Zusammenarbeit mit interessierten Kreisen, also bei-
spielsweise Unternehmen und Verbraucherschützern, vom Staat koordiniert (vgl. ebd.).
Jedoch stehen solche Initiativen der öffentlichen Hand im Bereich der Soziallabels erst
am Anfang. Das einzige nationale Label, was per Gesetz verankert wurde, ist momentan
in Belgien zu finden (vgl. EurActiv 2003). Durch die staatliche Institution FOD Eco-
nomie werden dort Produkte mit dem Soziallabel ausgezeichnet, die den oben angeführ-
ten Kernarbeitsnormen der ILO entsprechen. Weitere nationale Sozialgütezeichen wer-
den in anderen europäischen Ländern in den nächsten Jahren folgen (vgl. FOD Econo-
mie 2003). Das Fernziel muss ein europa- bzw. weltweit anerkanntes Zeichen analog
zur europäischen Umweltblume sein.
Weiter fortgeschritten sind demgegenüber schon die unabhängigen Gütesiegel von
NRO's. Sie übernehmen die Rolle des unabhängigen Prüfers und vergeben gegen Ge-
bühr die Lizenz zur Nutzung des Siegels, welches auf Verhaltenskodizes beruht (vgl.
2 Das Prinzip Sozialverträglichkeit
13
AEDT 2002, S. 8). Da NRO's im Vergleich zu privaten Zertifizierungsfirmen unabhän-
giger sind, kann diesen Labels ein größeres Vertrauen entgegengebracht werden. Das
T
RANS
F
AIR
-Siegel und ,,Max Havelaar", die von der EFTA schon europaweit über-
wacht werden, oder ,,Rugmark" sind in Deutschland verbreitete Beispiele. Dennoch
bleibt die finanzielle Abhängigkeit der Siegelinitiativen ein Problem, da Lizenzgebüh-
ren noch nicht die Betriebskosten decken (vgl. Piepel 2000, S. 15).
Nach den bisherigen Ausführungen wird deutlich, dass an die Institutionen, welche So-
zialgütesiegel vergeben, und an die Siegel selbst bestimmte Bedingungen geknüpft wer-
den müssen, um den Verbraucher wahrheitsgemäß zu informieren. An erster Stelle muss
die Unabhängigkeit des Zeichengebers garantiert sein, was insbesondere bei den Priva-
ten fraglich ist. Weiterhin sollte der gesamte Prozess der Zeichenvergabe überprüfbar,
transparent und nachvollziehbar sein. Insbesondere schriftlich festgehaltene Regelungen
und eine umfangreiche Informationspolitik der beteiligten Institutionen sind dabei hilf-
reich. Auch die verbreitete und praktische Anwendung des Labels ist ein weiterer ent-
scheidender Punkt für die Akzeptanz beim Verbraucher (vgl. Valio-Ottowitz 1997, S.
29). Bezüglich des Erscheinungsbildes sollte ein Gütesiegel verständlich, klar und
sichtbar am Produkt angebracht sein. Zusätzlich muss die Operationalisierung der sozia-
len Dimension im Vordergrund stehen, da es sich um ein soziales Siegel handelt (vgl.
imug 2002; S. 30).
2.2.3 Wirkungen und Probleme ethischer Warenzeichen
Informations- und Bewertungsinstrumente haben das Ziel, zur Informationsentlastung
des Konsumenten beizutragen und komplexe Sachverhalte einfach und glaubwürdig in
Form einer Schlüsselinformation darzustellen (vgl. Hansen/Kull 1995, S. 406). Da es
sich bei sozialverträglichen Produkteigenschaften vermehrt um Vertrauenseigenschaften
handelt, die vom Verbraucher nur schwer nachprüfbar sind, nimmt daher die Glaubwür-
digkeit von ethischen Warenzeichen eine zentrale Stellung ein (vgl. Neuner 2001, S.
359). Nachfolgend sollen daher die generellen Probleme und Ziele in der noch jungen
Diskussion um die ethischen Warenzeichen (vgl. Piepel 2000, S. 21) erläutert werden.
Informationsentlastung für den Konsumenten kann es nur geben, wenn klar ist was mit
dem Sozialzeichen tatsächlich gemeint ist. Da es noch an einem harmonisierten System
für die ethischen Warenzeichen fehlt, sind die Bedeutungen verschiedener Zeichen im
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2005
- ISBN (eBook)
- 9783832497354
- ISBN (Paperback)
- 9783838697352
- DOI
- 10.3239/9783832497354
- Dateigröße
- 1.3 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Potsdam – Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, Betriebswirtschaft
- Erscheinungsdatum
- 2006 (August)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- gütesiegel marke discrete choice based conjoint
- Produktsicherheit
- Diplom.de